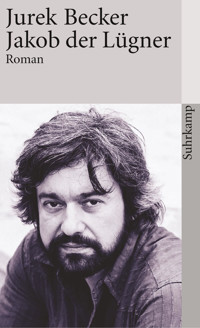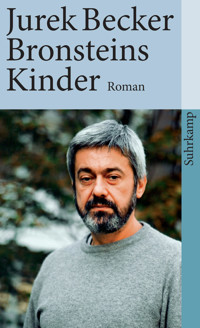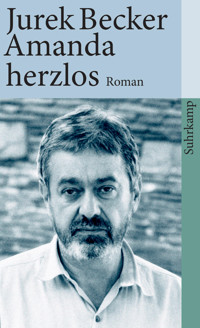
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
›Amanda herzlos‹ ist Liebesgeschichte, Zeitbild, Entwicklungsroman und Literatursatire, in dem der Niedergang eines vielgeschmähten Staates am Schicksal einer Frau mit der professionell geführten Feder ihrer Liebhaber geschildert wird. Michael Bauer, Süddeutsche Zeitung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 508
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Amanda: schlank, groß, mit graugrünen Augen. Ein schöner Name, er duftet wie Ambra und schmeckt nach Mandeln. Und alles, was in diesem Erfolgsbuch geschieht, geschieht in Ost-Berlin, der inzwischen historisch überholten Stadt. Drei Männer, eine Frau: Jeder der Männer erzählt aus seiner Sicht sein Leben mit Amanda im letzten Jahrzehnt der DDR: der biedere Sport-Journalist, der dissidentische Schriftsteller, der westdeutsche Hörfunk-Korrespondent. Die Beschreibung des Alltags, die Lebendigkeit der Figuren (»in meinen Büchern wimmelt es von Leuten, die ich nicht leiden kann«, sagt der Autor) bestechen durch ernste Leichtigkeit und Genauigkeit. Eigenschaften, die aus Jurek Beckers Erzählen nicht wegzudenken sind.
Der beliebte Schriftsteller hat, so scheint es, das letzte Buch vom Alltag der DDR vor dem Zusammenbruch geschrieben: eine Art Schlußpunkt, denn nun wird schließlich alles anders sein.
»Jurek Becker ist ein großes Buch über das gewöhnliche Leben in einem kleinen, gewöhnlichen und deshalb so furchtbaren Land gelungen.« Martin Lüdke, Frankfurter Rundschau
Jurek Becker wurde 1937 in Lodz (Polen) geboren und starb 1997 in Sieseby (Schleswig-Holstein). Er schrieb Romane, darunter Jakob der Lügner und Der Boxer, Erzählungen und Filmdrehbücher. Sein Werk wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet.
Jurek Becker
Amanda herzlos
Roman
Suhrkamp
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2016
Der vorliegende Text folgt der 11. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuchs 2295.
© Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 1992
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Umschlagfoto: Peter Peitsch / www.peitschphoto.com
Umschlaggestaltung: Göllner, Michels, Zegarzewski
eISBN 978-3-518-75055-1
www.suhrkamp.de
Inhalt
Die Scheidung(Ludwig)
Die verlorene Geschichte(Fritz)
Der Antrag(Stanislaus)
Die Scheidung
LUDWIG
Ich glaube, ich verlange nichts Unmögliches. Scheidungen sind nun mal ihrem Wesen nach unangenehm, das darf auch jemand sagen, der noch nie geschieden wurde. Jedenfalls habe ich nicht die Absicht, eine möglichst harmonische Sache daraus zu machen. Ich will nicht verschweigen, daß Amandas Entschluß, sich von mir zu trennen, mich hart getroffen hat, hart und vollkommen unvorbereitet. Ich werde Ihnen später von meinen Versuchen erzählen, sie umzustimmen, es waren nicht sehr viele. Ich habe schnell gespürt, wie sinnlos solche Bemühungen gewesen wären. Natürlich möchte ich die Geschichte ohne großes Blutvergießen hinter mich bringen, verstehen Sie das aber nicht als Bereitschaft, in allen Streitfragen nachzugeben. Eigentlich möchte ich von keiner einzigen meiner Forderungen abrücken, sie sind ohne Ausnahme gerechtfertigt. Ich weiß, was Sie sagen wollen: daß es ein Unterschied ist, ob man sich im Recht fühlt oder ob man recht hat. Ich habe recht. Sie werden sehen, daß wir die besseren Karten in der Hand halten.
Also: Den Wagen möchte ich behalten. Wir haben ihn mit Hilfe der Redaktion bekommen, mit Hilfe meiner Redaktion, und es wäre merkwürdig, wenn ich schon wieder hingehen und sagen müßte, ich brauche einen neuen. In meinem Beruf ist man ohne Wagen halbtot, Amanda dagegen braucht keinen. Außerdem fährt sie so, daß es einem den Magen umdreht. Wenn ich ihr Feind wäre, würde ich sagen: Nimm das Auto und fahr los.
Auf unser Wochenendgrundstück würde ich im Gegenzug verzichten. Es hat beinah auf den Pfennig so viel gekostet wie der Fiat, man könnte beides miteinander verrechnen. Auch an dem Grundstück hänge ich, nur ist mir, im Unterschied zu Amanda, bewußt, daß man nicht alles haben kann. Für mein Leben gern wäre ich in der Lage zu sagen, daß sie alles behalten und damit glücklich werden soll. Ich gönne ihr das sorgenfreiste Leben, aber doch nicht um den Preis, daß ich dafür zum Bettler werde!
Wenn ich behauptet habe, daß ich deshalb auf meinen Forderungen bestehe, weil ich sie für gerechtfertigt halte, dann ist das so nicht richtig. Ich verlange nichts, was ich nicht brauche. Zum Beispiel existiert eine Brillantbrosche von meiner Großmutter, das einzige Wertobjekt, das ich je geerbt habe. Es ist doch wohl keine Frage, daß die mir zustehen würde, aber ich käme nie auf die Idee, sie von Amanda zurückzuverlangen.
Die Wohnung will ich auf keinen Fall hergeben. Ich bin der Verlassene, ich bin der Leidtragende. Ich denke nicht daran, mich auch noch davonzuschleichen. Möglicherweise wird Amanda behaupten, wir hätten die Wohnung nur den Beziehungen ihrer Mutter zu verdanken, einer großartigen Frau übrigens, und das könnte ich nicht einmal abstreiten. Aber hat es nicht Sinn zu fordern, daß der Verlassene bleibt und der Verlassende geht? Wenn man Ehen aufkündigen und zugleich durchsetzen könnte, daß der andere verschwindet, was meinen Sie, was auf der Welt dann los wäre.
Ein heikler Punkt ist das Kind. Ich will offen zu Ihnen sein: Ich will den Jungen nicht haben. Ich kann ihn nicht nehmen. Wie sollte ein alleinstehender Mann, dazu in meinem Beruf, mit einem Kind leben? Daß ich bereit bin, meinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen, versteht sich von selbst. Ich will alles tun, um aus der Distanz ein ordentlicher Vater zu sein, aus einer Distanz, die ich nicht zu verantworten habe – diesen Umstand kann man nicht oft genug erwähnen. Das Peinliche besteht nun darin, daß ich zu Amanda gesagt habe, ich würde Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um den Jungen zu behalten. Was heißt gesagt, ich habe es ihr ins Gesicht geschrien, mehr als nur einmal. Unser Gesprächston war zuletzt laut und provozierend. Es sollte eine Drohung sein, ich wollte ihr Angst einjagen vor den Folgen, die sie tragen muß, wenn sie mich wirklich verläßt. Und nun verläßt sie mich, und ich will nicht klein beigeben. Mein Bedarf an Demütigungen ist gedeckt. Mit einem Wort – ich möchte vor Gericht so tun, als wollte ich Sebastian um alles in der Welt behalten, gleichzeitig müßte aber gewährleistet sein, daß wir uns damit nicht durchsetzen. Das wäre dann Ihre Aufgabe. Wenn Sie als Fachmann mir sagen, hör auf mit dem Unsinn, das Risiko ist zu groß, würde ich auf das Spiel verzichten. Aber schade wäre es. Ich bin sicher, daß Amanda ihr Kind nie hergeben würde, auch wenn sie manchmal unberechenbar ist.
Es wäre am zweckmäßigsten, wenn ich Ihnen alles der Reihe nach erzählen würde, doch das ist leichter gesagt als getan. Seit ich Amanda kenne, ist etwas so Chaotisches in mein Leben getreten, daß ich nie zur Ruhe komme. Ich meine damit in erster Linie, daß wir keine Gewohnheiten hatten. Das sagt Ihnen jemand, der sich nach nichts so sehnt wie nach Gewohnheiten. Wir haben nie diese zuverlässige Wiederholung kleiner Vorgänge gekannt, die nur nach außen hin ermüdend wirkt, die es einem in Wirklichkeit aber erlaubt, sich zurückzulehnen und Atem zu schöpfen. Gewohnheiten sind wie ein Geländer, an dem man sich in Notlagen festhalten kann, das hat mir immer gefehlt. Es stand nie fest, um wieviel Uhr Frühstück gegessen wird. Jedesmal mußte neu ausgehandelt werden, wer ein warmes Abendessen macht. Es gab keine Zuständigkeiten, außer der einen, daß ich morgens in die Redaktion mußte und am Nachmittag abgekämpft nach Hause kam. Manchmal haben wir uns Abend für Abend mit Bekannten getroffen, dann wieder monatelang nicht. Manchmal haben wir Abend für Abend miteinander geschlafen, dann wieder wochenlang nicht. Wenn Sebastian krank war, war sie die fürsorglichste Mutter, dann plötzlich hat sie von mir verlangt, daß ich Urlaub nehmen und mich an sein Bett setzen soll. Ich hätte mich nie darüber beklagt, aber jetzt, da sie mich als einen hinstellt, mit dem das Leben unerträglich ist, muß ich all das ja nicht auch noch verschweigen.
Vor drei Jahren haben wir uns zum erstenmal getroffen, in der Kantine der Zeitung, bei der ich noch heute beschäftigt bin. Man hatte ihr eine Reportage über irgendwelche polnischen Denkmalspfleger in Aussicht gestellt. Seit sie ihr Studium hingeworfen hatte, jagte sie kleinen Aufträgen nach, ohne feste Anstellung. Ich weiß nicht, ob Ihnen bekannt ist, welches Ansehen die Freiberufler in den Redaktionen genießen: das niedrigste. Obwohl Amanda einen Termin hatte, war sie von einer Sekretärin abgewimmelt worden, dementsprechend war ihre Laune. In die Kantine war sie nur gegangen, weil dort das Essen billiger ist. Sie wäre mir wahrscheinlich nicht aufgefallen, hätte sich nicht der größte Weiberheld der Redaktion an ihren Tisch gesetzt. Ich setzte mich dazu, weil ich ihn ärgern wollte, oder weil ihre Bluse so grün war, oder weil wirklich kein anderer Platz frei war, ich weiß es nicht mehr.
Sie verhielt sich abweisend gegenüber Pückler, so hieß der Schönling, das gefiel mir, noch unfreundlicher aber war sie zu mir. Die wenigen Blicke, die ich ergattern konnte, hießen nichts anderes als: Versuch es gar nicht erst. Jedesmal wenn ich daran denke, geht mir die Frage durch den Sinn, ob sie nicht einen Mann geheiratet hat, den sie von Anfang an nicht ausstehen konnte. Damals hat mich ihre Schroffheit eher angespornt, ich war wie der Esel, der nur deshalb vorwärtsgeht, weil man ihn am Schwanz zieht. Der Verdacht, daß ich ihr unsympathisch, bestenfalls gleichgültig sein könnte, hat mich schon früh beschäftigt. Natürlich muß sie Gründe gehabt haben, mich zu heiraten, Liebe jedenfalls war es nicht. Vielleicht haben ihr die hundertfünfzig Liegestütze imponiert, die ich ihr vorführen konnte, vielleicht gefiel es ihr, daß ein paar hübsche Frauen hinter mir her waren. Vielleicht hatte sie es auch satt, von Redaktion zu Redaktion zu hasten und überall als Bittstellerin behandelt zu werden. Sie müssen wissen, daß mein Gehalt das erste regelmäßige Einkommen ihres Lebens war.
Vor ein paar Wochen habe ich sie gefragt, warum sie mich bloß geheiratet hat, kurz nachdem sie zum Anwalt gegangen war. Sie hat geantwortet, daß sie sich kaum mehr erinnert, wahrscheinlich weil sie sich einen Zustand versprochen habe, der nie eingetreten sei. Das einzige, was sie mit Gewißheit sagen könne, sei, daß ich auf dem steinigen Weg zum Märchenprinzen schon auf den ersten Metern steckengeblieben bin. Manchmal drückt sie sich etwas blumig aus. Ich habe den Hohn weggesteckt und mich nach ihrer Vorstellung von Märchenprinzen erkundigt. Ein anderer hätte seine Witze gemacht, ich nicht, ich war auf Verständigung aus. Wollen Sie wissen, mit welchem Ergebnis? Sie hat aufgelacht wie über eine Obszönität und dann gesagt, sie werde sofort nach unserer Trennung eine Liste mit den Haupteigenschaften der Märchenprinzen für mich ausarbeiten, davon könnte dann meine nächste Frau profitieren. Ich sollte aber vorab wissen, daß nicht jede hirnlose, empfindungsschwache Jammergestalt sich zum Märchenprinzen qualifizieren könne. Wie gesagt, manchmal war ihre Sprache reichlich blumig.
Ein halbes Jahr nach jenem Kantinentreffen haben wir geheiratet. Ich hatte mir die erste und, wie ich damals dachte, einzige Hochzeit meines Lebens als rauschenden Tag zwischen Blumenbergen und Glückwunschtelegrammen vorgestellt, inmitten feiernder Gäste, die Ansprachen halten, uns hochleben lassen und sich um den Verstand trinken. Und wie sah es wirklich aus? Auf dem Standesamt unterschrieben wir ein Formular, dann wollten wir im Hotel Unter den Linden Mittag essen, fanden aber keinen Platz, also gingen wir zu mir nach Hause und aßen, was zufällig im Kühlschrank lag. Damit war die Sache erledigt. Amanda duldete kein Fest. Sie sagte, sie kenne niemanden, mit dem sie feiern möchte, bis auf eine Freundin, eine gewisse Lucie, von der noch zu sprechen sein wird; und meine Kollegen und Freunde einzuladen hieße für sie nichts anderes, als den Hochzeitstag mit wildfremden und ausgesucht langweiligen Leuten zu verbringen.
Ich glaube, sie war zu geizig. Später habe ich mich oft über ihre seltsame Beziehung zu Geld gewundert, die, kurz gesagt, darin bestand, es nur im Notfall auszugeben. Können Sie sich vorstellen, mit einer Frau zusammenzuleben, die jede Anschaffung, die jeden Einkauf für Verschwendung hält? Es liegt nahe, diesen Defekt mit ihrer lausigen Einkommenslage zu erklären, aber ihre Mutter hat mir erzählt, daß sie immer schon so war, schon als Achtjährige. Ihre Freundinnen schlagen sich die Bäuche voll mit Schokolade, Amanda steckt ihr Taschengeld in den Sparstrumpf. Weil sie aber selbst nach Süßigkeiten lechzt, kommt sie auf eine glorreiche Idee: Sie fängt an, den anderen Kindern Geld zu borgen, und zwar gegen Zinsen, die in Form von Schokolade zu entrichten sind.
Eine Folge ihrer Knauserei war zum Beispiel, daß es bei uns zu essen gab wie im Gefängnis: billig, wenig und schlecht. Solange noch ein Stück Brot in der Speisekammer lag, und wenn es hart war wie Beton, wurde kein neues gekauft. Wenn ich einen guten Apfel essen wollte, hatte ich zuerst zu prüfen, ob nicht ein schlechter da war, der zuerst gegessen werden mußte. Was unsere Ernährung betraf, hatten wir regelrecht einen unterschiedlichen Lebensstandard, denn ich aß mich in der Redaktion satt, an Imbißbuden oder heimlich in Restaurants. Das tat mir leid, ich hatte nie die Absicht, ihr etwas vorzuenthalten, aber ich war dazu gezwungen, wenn ich nicht abmagern wollte. Merkwürdigerweise schöpfte sie keinen Verdacht, ich könnte mir woanders holen, was mir zu Hause vorenthalten wurde. Nie wunderte sie sich, daß ich viel dicker war, als ich es nach ihren Hungerrationen hätte sein dürfen. Es kann aber auch sein, daß es sie nicht interessierte.
Ich weiß nicht, ob es uns nützt, Amandas Eltern ins Spiel zu bringen, das müssen Sie entscheiden. Von ihrem Vater hätten wir wenig zu erwarten, der zählt zur Gegenpartei. Er hat nichts gegen mich persönlich, da bin ich sicher, er würde keinen Mann mögen, der ihm die Tochter weggeheiratet hat. Er hängt an ihr wie ein Toter am Strick, es macht ihn krank, daß sie nicht mehr das Mädchen ist, das ihn für den Meister aller Dinge hält. Dabei hätten wir beide gute Voraussetzungen, uns zu mögen: Er war Wasserballer – ich verstehe etwas von Wasserball, er ist Zahnarzt – ich habe das perfekteste Gebiß, das er je gesehen hat. Er liebt Amanda – ich habe sie die längste Zeit auch geliebt. Einmal hat er mich gebeten, zu ihm in die Poliklinik zu kommen, er wollte einen Gipsabdruck von meinen Zähnen machen, aus schlichter Freude an etwas Gesundem. Er heißt Thilo Zobel. Ich glaube, daß er froh sein wird, wenn Amanda von mir getrennt ist, sie rückt dann wieder in seine Reichweite. Es kommt ihm einfach nicht der Gedanke, daß sein Besitzanspruch übertrieben sein könnte.
Anders verhält es sich mit ihrer Mutter, die ist mir wohlgesonnen. Ich will nicht behaupten, sie wäre gegen Amanda eingestellt, aber sie findet, daß ihre Tochter in mir einen guten Mann hat, mit dem sie lieber auskommen sollte, anstatt ihm das Leben schwerzumachen. Ich habe es nicht schriftlich, doch nur so kann ich mir viele ihrer Blicke und Seufzer erklären. Sie ist eine unvoreingenommene, liebenswürdige Person, das sage ich nicht nur, weil sie mich mag. Und nicht zuletzt ist sie auch eine Frau, die sich sehen lassen kann, ich möchte das nicht näher ausführen. Es gab Augenblicke, da habe ich regelrecht gelitten, weil ich nicht darauf reagieren durfte. Und ich vermute, es tat nicht nur mir leid. Bevor ich sie kannte, hätte ich mir nicht vorstellen können, daß eine Frau von immerhin Ende vierzig einen auf ihre Weise ansehen und eines jungen Mannes Phantasie so beschäftigen kann. Anfang der fünfziger Jahre war sie eine bekannte Schwimmerin, unter ihrem Mädchennamen, Freistil und Rücken. Als ich sie zum erstenmal traf, steckte ich schon in der Sportredaktion. Ich sah vor meinem Besuch im Archiv nach und entzückte sie damit, daß ich ihre Bestzeiten auswendig wußte. Am Beckenrand hat sie auch den Wasserballer kennengelernt. Ihre Stellung in der Familie ist alles andere als beneidenswert: Wann immer es zu Meinungsverschiedenheiten kommt, steht sie allein gegen die beiden anderen. Thilo Zobel ist ihrer schlicht und einfach überdrüssig geworden. Sie kann sagen, was sie will, er zieht die Augenbrauen hoch oder murmelt etwas Abfälliges. Und auf Amanda wirkt sie wie ein rotes Tuch. Ich habe noch nie solche Aggressionen einer Tochter gegen ihre Mutter erlebt. Ich kann nicht sagen, was sich vor meiner Zeit zwischen beiden abgespielt hat, Amanda ist eine zurückhaltende Erzählerin. Doch wenn ich es recht verstehe, wirft sie ihrer Mutter zweierlei vor: Erstens, daß sie eine gefühlskalte Person ist – mein Eindruck ist ein völlig anderer; und zweitens nennt sie die politische Haltung ihrer Mutter unterwürfig.
Ich sage das folgende nicht gern und bin mir der Tragweite bewußt: Amanda hat eine verhängnisvolle Neigung zur Staatsfeindlichkeit. Alle Zirkel, in denen auf die Regierung eingedroschen wird, ziehen sie an, alle Personen, deren Ansichten sich mit denen der Regierung decken, findet sie unerträglich. Es ist um so schwerer, sich mit einer so infantilen und vorausberechenbaren Haltung abzufinden, als Amanda nicht müde wird, ihre Umgebung zu provozieren. Wie Sie aus Ihrer Praxis sicher wissen, bleibt einem oft keine andere Wahl, als politisch anzügliche Reden zurückzuweisen. Und eine Frau wie Amandas Mutter, von Beruf Parteisekretärin, ist geradezu verpflichtet, all den Ausfällen entgegenzutreten. Während ihres Studiums hat sich Amanda mit Existentialphilosophie beschäftigt, daher kommt wohl das ganze Elend. Ich selbst verstehe kaum etwas davon, so viel ist aber klar, daß Amanda seither ein verzerrtes Bild von ihrer Umgebung hat. Überzeugungen sind für sie Privatsache. Einsicht in Notwendigkeiten nennt sie Kriecherei, und wenn man sie fragt, woher ihre Maßstäbe kommen, antwortet sie, ohne zu erröten: Das Maß bin ich.
Aber zurück zur Hauptsache: Sobald ich versuche, mit ihr über die Modalitäten unserer Scheidung zu sprechen, verläßt sie das Zimmer. Es ist seltsam, wie aufgeregt und verkrampft sie dann ist, so als würde die Ehe von mir aufgekündigt, nicht von ihr. Schließlich ist es mir einmal gelungen, ihr meine Forderungen hinterherzurufen, meine wenigen, und ich habe sie gebeten, doch auch die ihren zu nennen. Die ganze Antwort bestand aus dem dunklen Satz: Du wirst dich noch wundern. Ich habe keine Ahnung, was sie damit meint, ich weiß nur, daß es nicht Amandas Art ist, leere Drohungen auszustoßen.
Obwohl ich mir keiner Schuld bewußt bin, fühle ich mich seitdem beunruhigt. Andauernd beschäftigt mich die Frage, was sie gegen mich in der Hand hat. Vermutlich ist es im Laufe unserer Ehe nicht ausgeblieben, daß ich unbedachte politische Äußerungen getan habe, bestimmt nicht allzuoft. Es ist unmöglich, sich vier Jahre lang unter Kontrolle zu halten, meint sie das? Will sie mich vor Gericht anschwärzen? Ich kann es mir, ehrlich gesagt, nicht vorstellen, verschiedene Gründe sprechen dagegen. Erstens ist Amanda keine Denunziantin. Zweitens wären wir uns in den Augenblicken, da ich solche Bemerkungen gemacht haben könnte, besonders einig gewesen, sie würde sich also selbst denunzieren. Drittens sitzt Amanda gerade in dieser Beziehung im Glashaus, dafür gibt es Heerscharen von Zeugen.
Ein Thema, mit dem sie mich in Schwierigkeiten bringen könnte, sind Frauen. Es ist wahr, daß ich von Zeit zu Zeit sogenannte Ehebrüche begangen habe, ich sage das nicht mit Stolz, aber auch nicht zerknirscht. Ich bin von Versuchungen umzingelt, in der Redaktion, auf Reisen, in Lokalen, ich brauche meine Kraft für etwas anderes, als mich immerzu gegen das Lächeln hübscher Frauen zur Wehr zu setzen. Ich will aber auch nicht den Eindruck erwecken, als hätte ich all diese kleinen und mitunter größeren Geschichten widerwillig durchzustehen, wie Schicksalsschläge. Nein, sie machen mir viel Freude, und wenn es sie nicht gäbe, würde ich sie vermissen und am Ende gar suchen, es ist nun mal, wie es ist. Jede Frau ist für mich wie ein kleiner Kontinent, voller zu erforschender Gegenden und phantastischer Landschaften, mit Vulkanen, die erloschen daliegen, um dann auszubrechen. Abenteuer, die es sonst in meinem Leben nicht gibt.
Wenn ich sagte, Amanda könnte mich damit in die Enge treiben, so ist das theoretisch zwar richtig, praktisch aber ausgeschlossen. Sie hat von alldem keine Ahnung. Vom ersten Tag unserer Ehe an habe ich streng darauf geachtet, daß sie nichts erfährt. Und das nicht nur aus Furcht, wie Sie vielleicht denken, sondern auch aus Rücksichtnahme. Wenn ihr je ein Verdacht gekommen sein sollte, hat sie sich nichts anmerken lassen; und da ich nicht glauben kann, daß eine Frau über Jahre hinweg die Betrügereien ihres Mannes ignoriert, halte ich es für unwahrscheinlich, daß sie davon weiß. Meine Seitensprünge sind es nach menschlichem Ermessen also auch nicht, was hinter ihrer Drohung steckt, etwas anderes fällt mir aber nicht ein, ich bin ratlos.
Einmal war Amanda wegen einer Reportage verreist, was selten vorkam, denn sie bemühte sich kaum mehr um Aufträge. Lieber saß sie in ihrem Zimmer und beschäftigte sich mit höheren Dingen, sie schrieb Erzählungen, wie sich später herausstellte, oder sie schrieb ein Hörspiel, wovon ich erst erfuhr, als ich versehentlich den Antwortbrief von Stimme der DDR öffnete, der eine Ablehnung enthielt. Kurz und gut, Amanda war unterwegs, und ich hatte das Gefühl, es wäre Verschwendung, eine solche Gelegenheit ungenutzt verstreichen zu lassen. In jener Zeit war eine fröhliche Geschichte im Entstehen, mit einer Kollegin von der Berliner Zeitung. Während meiner ganzen Ehe war mir kein Verhältnis verlockender vorgekommen als dieses, vielleicht weil es so große Hindernisse gab. Ich lud die Frau in unsere Wohnung ein, sie war verheiratet wie ich, und in ein Hotel zu gehen, lehnte sie ab.
Sie dürfen nicht glauben, ich sei von allen guten Geistern verlassen gewesen, ich war im Gegenteil sehr vorsichtig: Weil Elisa gewöhnlich ein markantes Parfum trug, und weil Amanda eine feine Nase hat, bat ich Elisa, diesmal auf den Duft zu verzichten. Sie sah das ein und kam ohne Parfum; schon bei der Begrüßung fand ich, daß sie besser roch als je zuvor. Ich werde Sie nicht mit Einzelheiten dieses Abends belästigen, nur eine muß ich erwähnen, allerdings eine sehr gravierende: Wir waren im Wohnzimmer und vertrieben uns die Zeit, als ich hörte, wie die Eingangstür geöffnet und wieder geschlossen wurde. Amanda, zwei Tage zu früh! Glücklicherweise ging sie zuerst in die Küche. Ich stürzte zu ihr hin, um sie abzulenken und für Elisa einen Fluchtweg zu öffnen, wir hatten keine fünf Sekunden Zeit, uns zu besprechen. Unsere Küche hat keine Tür, nur einen Perlenvorhang, so daß es kaum möglich ist, unbemerkt vorbeizukommen. Das konnte Elisa natürlich nicht wissen. Ich stand mit Amanda in der Küche, spielte den freudig Überraschten, dem es die Sprache verschlagen hat, hielt sie umarmt wie ein Schraubstock und zitterte vor dem Unglück, das gleich geschehen mußte. Aber es rührte sich nichts. Später erzählte mir Elisa, daß sie unters Sofa gekrochen und entschlossen war, dort so lange zu bleiben, bis ich ihr ein Zeichen gab. Um die Sache abzukürzen – dieses Zeichen gab ich ihr nie. Ich wagte nicht, Amanda aus den Augen zu lassen. Ich blieb bei ihr in der Küche, ich ging mit ihr ins Bad, ich legte mich mit ihr ins Bett. Ich ließ sie nicht aus den Augen, bis sie schlief. Erst tief in der Nacht, als sie im Traum zu reden anfing, schlich ich in unser Wohnzimmer. Elisa war gegangen, ich hatte es nicht bemerkt, obwohl ich auf jedes Geräusch geachtet hatte wie ein Jäger. Ich räumte auf, was aufzuräumen war, Weinflasche, Gläser, Aschenbecher, ein Feuerzeug, das Elisa liegengelassen hatte, vielleicht mit Absicht. Es mag seltsam klingen, aber ich fühlte mich Amanda nach dieser Tortur näher als je zuvor. Ich war dankbar für ihre Arglosigkeit. Elisa sprach tagelang kein Wort mit mir, so als wäre ich für Amandas vorzeitige Rückkehr verantwortlich gewesen. So als hätte ich ein Versprechen nicht eingehalten, doch schließlich kam sie wieder zur Vernunft.
Wenig später habe ich etwas getan, das nach meinen eigenen Maßstäben fragwürdig war. Amanda hatte Geburtstag, und ich kam auf die durchtriebene Idee, ihr das gleiche Parfum zu schenken, das Elisa nahm. Es gefiel ihr sehr gut, und ich brauchte Elisa nicht mehr zu bitten, ihr Parfum wegzulassen. Was aber zuerst wie eine pfiffige Vereinfachung meiner Situation aussah, stellte sich bald als Nachteil heraus. Sie können es glauben oder nicht, mir schlug das Gewissen. Jedesmal, wenn Amanda ihr neues Parfum auftrug, mußte ich denken: Du Hund! Habe ich schon erwähnt, daß mir selbst der Duft nicht besonders gefiel? Die Geschichte mit Elisa war wenig später zu Ende, Amanda aber wollte auf das Parfum nicht mehr verzichten. Sie benutzt es heute noch.
Bestimmt brauchen Sie auch diese Information: Amanda hat keine Männergeschichten. Ich meine damit nicht, daß ich nichts von Männergeschichten weiß, die sie eventuell haben könnte, ich meine: Sie hat keine. Wenn Sie ihr begegnen, werden Sie erstaunt sein, denn sie sieht sehr gut aus. Sie sieht aus, als müßten ihr die Männer nachlaufen. Manche tun das auch, aber es kümmert Amanda nicht, es langweilt sie. Am Anfang war ich stolz, weil ich mir einbildete, der Grund dafür sei ich. Weil ich ihr in jeder Beziehung genügte, dachte ich, sei ihre Distanz zu den anderen nur natürlich. Bis ich merkte, daß dieselbe Interesselosigkeit auch mir galt.
Auch wenn Sie einen anderen Eindruck haben sollten – ich bin nicht übertrieben selbstbewußt. Oft frage ich mich, ob es richtig ist, was ich tue, ob es erlaubt ist, was ich tue, ob ich die Folgen bedacht habe, ob ich meine Kräfte nicht überschätze und meine Zeit nicht vergeude. Bevor ich Amanda kannte, war das anders. Auf geheimnisvolle Weise hat sie es fertiggebracht, einen Zweifler aus mir zu machen, einen Zweifler an mir selbst. Ich gebe mir Mühe, genauso arglos wie früher zu leben, aber das gelingt nur scheinbar. Auch wenn es aussieht, als sei alles mit mir beim alten geblieben, ist mein Kopf plötzlich voll von Skrupeln; es ist plötzlich ein schlechtes Gewissen da, das mich in meinen eigenen Feind verwandelt. Alle Genüsse werden auf diese Weise halbiert. Ich habe Angst, daß die Trennung von Amanda mich davon nicht erlösen wird; daß sie geht, daß aber meine Fähigkeit, sorglos draufloszuleben, nicht wiederkehrt. Amanda dagegen verläßt unsere Ehe als dieselbe Person, als die sie eingetreten ist. Es mag wie ein Armutszeugnis klingen: Ich habe nicht den kleinsten Einfluß auf sie ausgeübt. Was sie wollte, hat sie getan, was ihr nicht paßte, hat sie gelassen, unabhängig von meinen Wünschen. Vielleicht war es der wundeste Punkt unserer Beziehung, daß ich keinen Einfluß auf sie hatte. Zuerst habe ich mich um Einfluß bemüht, aber nichts als Unfrieden war die Folge.
Für eine kleine Zeitschrift fuhr sie einmal in eine Textilfabrik, um den Direktor zu interviewen. Sie stellte ihm so provozierende Fragen, daß er nicht nur das Gespräch abbrach, sondern die Redaktion anrief und sich über Amanda beschwerte. Danach bekam sie von dort keine Aufträge mehr, und weil sich solch ein Verhalten schnell herumspricht, wurde es generell dünner mit Aufträgen. Als ich von Amanda wissen wollte, womit sie den Mann so aus der Fassung gebracht hatte, zeigte sie mir einen Zettel mit ihren Fragen: Was er, der Direktor, für wichtiger halte – die Wünsche der Bevölkerung oder den Plan. Ob er glaube, daß es dem Sozialismus schaden würde, wenn die Leute gutsitzende Hosen trügen. Sie schien noch nie davon gehört zu haben, daß uns Journalisten gewisse Grenzen gesetzt sind. Als ich sie fragte, ob sie erwartet hätte, der Betriebsleiter würde derartige Angriffe widerstandslos hinnehmen, nannte sie mich seinen Handlanger. Und von dieser Sekunde an weigerte sie sich, über die Möglichkeiten der Presse auch nur ein Wort mit mir zu reden, obwohl ich es immer wieder versuchte. Sie sagte, von einem Analphabeten lasse sie sich keine Vorträge über Rechtschreibung halten, das war ihre Vorstellung von Humor.
Ich stelle mir vor, daß Streit in einer guten Ehe wie ein Spiel sein kann und nicht unbedingt das Ende von Einigkeit bedeuten muß. Man sagt sich nicht nur die Meinung, man reibt sich auch aneinander, Reibungswärme ist auch Wärme und hat auch einen Wert, da bin ich sicher. Ein Wasserspringer klettert nicht auf den Turm, weil es ihm oben so gut gefällt, sondern um Höhe für seinen Sprung zu gewinnen. Und Streit in einer Ehe, wie ich sie mir wünschte, hätte vor allem den Zweck, Möglichkeiten der Versöhnung zu schaffen. Aber so war es in meiner Ehe nie, Streitigkeiten waren immer Schwerarbeit. Erstens ist Amanda eine kämpferische Person, die keinen Unterschied zwischen nachgeben und verlieren kennt. Zweitens hatten wir bald nach unserer Heirat einen unerschöpflichen Vorrat an Meinungsverschiedenheiten. Sie wuchsen aus dem Nichts, sie blühten plötzlich an Stellen, an denen man sie nie vermutet hätte. Drittens ist Amanda ungewöhnlich intelligent. Das machte mir immer zu schaffen. Ihre Intelligenz ist wie ein bissiger Hund, mit dem man in einem Zimmer eingesperrt ist. Nie konnte ich die Augen schließen und mich zurücklehnen. Ständig belauerte einen die Bestie ihres Verstandes, keine Verfehlung ließ sie ungeahndet. Wo aber sonst, frage ich Sie, ist der Ort, an dem es einem möglich sein sollte, sich gehenzulassen, wenn nicht in einer Ehe? Amanda hat es mir unmöglich gemacht, ohne Blessuren aus einer Meinungsverschiedenheit herauszukommen, etwa mit Redensarten. Sie schnitt einem alle Fluchtwege ab, gnadenlos deckte sie das Dürftige auf, das in den meisten menschlichen Bemerkungen nun mal enthalten ist. Entweder man hatte ein Argument, das sie plattwalzte, oder man war verloren. Oft blieb mir gar nichts anderes übrig, als mich in Grobheiten zu flüchten.
Als junger Mann habe ich immer geglaubt, die Frau, die ich einmal heiraten würde, hätte zwei Bedingungen zu erfüllen: Sie müßte gut aussehen, und sie müßte intelligent sein. Was für eine Illusion, denke ich heute, was für ein Kinderglaube! Inzwischen weiß ich, daß Intelligenz mehr Probleme schafft, als sie zu lösen imstande ist. Zumindest für die Ehe gilt das, wahrscheinlich aber auch für manches andere. Vielleicht fehlte es Amanda an einer gewissen Lebensklugheit, vielleicht wäre alles halb so schlimm gewesen, wenn sie die Fähigkeit besäße, ihren Verstand nur dort einzusetzen, wo Verstand von Nutzen ist. Beim Beseitigen von Schwierigkeiten nämlich, bei der Suche nach Auswegen, Amandas Intelligenz aber hat nur immer neue Schwierigkeiten geschaffen.
Wenn ich Ihnen all die Vorwürfe aufzählen wollte, die sie mir je gemacht hat, würde ich Tage brauchen. Ich behaupte nicht, daß jeder einzelne unberechtigt gewesen ist, aber Amanda war eine leidenschaftliche Vorwerferin. Bald nach unserer Eheschließung muß sie die Überzeugung gewonnen haben, daß es keine interessantere Form der Kommunikation gibt, als sich Vorwürfe zu machen. Oft habe ich mit kleinen Geschenken versucht, sie günstig zu stimmen, weil ich ihr nicht gewachsen war, oder einfach weil ich Frieden wollte. Sie aber hielt das sofort für ein Zeichen von schlechtem Gewissen. Eines Tages wirft sie mir an den Kopf, daß ich nur denke, wenn es unbedingt sein muß. Daß mein Normalzustand ein Dahindämmern ist. Ich muß mir anhören, daß meine Art zu denken dem Grasen von Kühen gleicht: Hin und wieder wächst irgendwo in der Umgebung ein Gedanke, ohne mein Zutun, und wenn er mir hübsch vorkommt, und wenn er nicht allzuweit neben meinem Weg steht, dann rupfe ich ihn eben. Ich glaube, es gibt keinen Menschen, der gelassen darauf reagieren könnte.
Eine Beschuldigung, die sie in langweiliger Regelmäßigkeit wiederholte, lautete, ich sei ein Anpasser. Das eine Mal war ich ein feiger Anpasser, dann ein würdeloser Anpasser, ein typisch deutscher, ein unterwürfiger. Ich biete Ihnen nur eine Auswahl. Als ich sie fragte, was sie früher an einem solchen Dreckskerl bloß habe finden können, sagte sie, darauf gäbe es zwei Antworten: Zum einen sei meine Anpassungsbereitschaft mit der Zeit gewachsen, zum anderen sei ich natürlich nicht nur ein Anpasser gewesen. Das lasse sich selbst heute noch sagen.
Für unsere Beziehung zur Umwelt war es eine dauernde Belastung, daß sie bei ihren Vorwürfen keine Rücksicht nahm, ob uns jemand zuhörte. Manchmal hatte ich sogar den Eindruck, daß die Anwesenheit von Bekannten sie animierte. Nicht weil sie Zeugen suchte, sondern weil ihre Kritik mir peinlich war. Ich bin fest davon überzeugt, daß sie kühl vorging, daß sie zwar oft so tat, als sei sie vor Zorn außer sich, in Wirklichkeit aber über der Situation stand. Es machte ihr Vergnügen, meinen roten Kopf zu sehen und meine Bettelblicke und die betretenen Gesichter ihres Publikums. Irgendwann fiel mir auf, daß sie mich vor Fremden am liebsten wegen meines Opportunismus heruntermachte, wie um zu demonstrieren, daß eine solche Sache an die Öffentlichkeit gehört. Wenn sie mir aber Lieblosigkeit vorhielt oder Gefühlsarmut oder mangelnde Neugier auf unser Kind, vergleichsweise intime Beschuldigungen also, waren wir immer unter vier Augen. Das kann kein Zufall gewesen sein.
Ich erinnere mich an einen Abend, der für den Scheidungsrichter wohl nichts hergibt, Ihnen aber deutlich machen wird, in was für einer Anspannung ich lebte. Heinrich Koslowski, der stellvertretende Chefredakteur meiner Zeitung, feierte seinen sechzigsten Geburtstag und hatte die halbe Redaktion eingeladen, darunter uns. Ich wußte, daß Amanda ihn für einen Kriecher hielt, obwohl sie ihn nur aus gelegentlichen Erzählungen von mir kannte. Ich hatte nichts dergleichen erwähnt, Amanda aber meinte, sie könne das auch so beurteilen; man brauche nur die Zeitung aufzuschlagen und schon erkenne man die wesentlichen Charakterzüge ihrer Mitarbeiter. Was sollte ich tun? Zu der Feier zu gehen hieß nichts anderes, als Amanda ein Forum für einen Auftritt zu verschaffen, andererseits wollte ich Koslowski nicht vor den Kopf stoßen. Ich sagte mir auch: So weit wird es noch kommen, daß ich aus Furcht vor Amanda meine wenigen Beziehungen zerstöre!
Ich ermahnte sie, das heißt, ich bat sie, den Abend einfach zu genießen und ihre kritischen Ansichten auf dem Fest nicht auszubreiten wie Warenmuster, dort wolle sie ohnehin keiner hören. Niemand hätte einen Nutzen davon, wenn sie mich oder Koslowski oder alle zusammen beschimpfte – ich nicht, der ich mit diesen Menschen auszukommen habe, und sie nicht, die doch von Zeit zu Zeit veröffentlichen wolle. All das sagte ich so unaggressiv wie möglich, mehr konnte ich nicht tun.
Um es kurz zu machen, sie verhielt sich an jenem Abend mustergültig. Sie scherzte viel, trank Sekt, plauderte mit allen und tanzte sogar. Ein Kollege flüsterte mir zu, es kursiere in der Redaktion das Gerücht, Amanda habe Haare auf den Zähnen, das sei ungefähr das Lächerlichste, was er je gehört habe. Alle waren entzückt von ihr. Nur ich nicht, Sie ahnen warum: Ich hielt ihre Freundlichkeit für ein Vorspiel zu dem Krach, den sie jeden Moment anzetteln konnte. Ich ließ sie nicht aus den Augen, ich zitterte bei jedem Glas, das sie trank. Bei jedem Gespräch, das sie anfing, war ich sicher: Jetzt passiert es! Für Augenblicke wünschte ich sogar den Eklat herbei, nur um die Ungewißheit zu beenden. Ich will ihr nicht auch noch zur Last legen, daß sie kein Unheil anrichtete, aber einige ihrer Blicke machten mir klar, daß meine Qualen sie vergnügten. Als wir aufbrachen, hatten sich alle Gäste amüsiert, nur ich nicht. Im Taxi fragte Amanda, ob ich zufrieden mit ihr sei, und ich mußte wohl oder übel antworten: So hätte ich es mir schon lange gewünscht. Sie hatte es fertiggebracht, daß mir selbst ihr Wohlverhalten vergällt war.
Sie dürfen aus meiner Erzählung nicht schließen, Amanda sei im Grunde ein mißmutiger Mensch, das würde ich nie behaupten. Sie lacht viel, sie hat die heitersten Augen, und wer nicht mit ihr leben muß, könnte sie für eine Quelle dauernden Frohsinns halten. Eine Zeitlang habe ich das ja selbst geglaubt. Sie nimmt die meisten Probleme auf die leichte Schulter, das ist die liebenswerteste Eigenschaft, die man sich vorstellen kann. Solange ich die Folgen nicht auszubaden hatte, war ich entzückt davon. Am Anfang unserer Bekanntschaft kam es mir vor, als blieben ihr viele Sorgen allein deshalb erspart, weil sie sie ignorierte. Sie lebte in einer Wolke von Leichtgläubigkeit, unwillkürlich hatte man das Bedürfnis, ihr den Kinderblick zu bewahren und sie zu beschützen. Inzwischen geht mir diese Weltfremdheit gewaltig auf die Nerven. Amanda tut so, als könnten die Notwendigkeiten des Lebens sie nicht erreichen. In ihrem Hirnlaboratorium produziert sie haufenweise Prinzipien, die sich zum wirklichen Leben verhalten wie Hunde zu Katzen, und ich werde beschimpft, weil ich mich nicht danach richte.
Ich frage Sie: Wenn der Preis für eine gute und ruhige Existenz darin besteht, daß man gewisse Gedanken für sich behält und gewisse Handlungen unterläßt, und wenn man diesen Preis zahlt – das soll unterwürfig sein? Amanda ist eindeutig dieser Ansicht, ich dagegen finde, daß meistens Geltungsbedürfnis oder Streitsucht dahinterstecken, wenn einer sich weigert zu zahlen. Ganz abgesehen davon, daß mir persönlich dieser Preis nie besonders hoch zu sein schien. Wer ist man denn, daß man seine privaten, oft störrischen Bedenken für die Hürde hält, über die alle anderen zu springen haben?
Ich habe Amanda nie vorgeworfen, daß sie so gut wie nichts verdiente, natürlich war ich nicht glücklich darüber. Ich brauche Ihnen nicht zu erklären, wieviel die geringe Zahl der Artikel, die sie bei Zeitschriften unterbrachte, und die große Zahl ihrer Einwände gegen unseren Staat miteinander zu tun hatten. Es machte mich neidisch, wenn ich sah, wie ringsum die Frauen arbeiten gehen und fast so viel Geld nach Hause bringen wie ihre Männer. Bestimmt wäre es kein Unglück gewesen, wenn wir uns mehr hätten leisten können, trotzdem habe ich Amandas Zurückhaltung in bezug auf Arbeit ohne Klagen hingenommen. Wahrscheinlich wurden ihre wenigen Artikel zu Recht abgelehnt. Das gibt es, dachte ich damals, daß jemand noch so intelligent sein mag, für die Sachen aber, die er erledigen müßte, nicht taugt.
Erst nach langem Warten kam mir die Galle hoch. Sie versuchte kaum mehr, Aufträge zu ergattern, sie strich sogar die Nummern der Redaktionen in ihrem privaten Telefonbuch aus, dabei bin ich alles andere als reich. Allem Anschein nach hatte sie sich aus dem Erwerbsleben zurückgezogen, mit sechsundzwanzig Jahren. Statt zu arbeiten, vergrub sie sich in ihrem Zimmer und schrieb Texte, über die sie schwieg. Als ich mich einmal erkundigte, ob ich es von nun an mit einer Schriftstellerin zu tun hätte, sagte sie, das stehe noch nicht fest, aber es sei auch nicht ausgeschlossen.
Erkennen Sie die Arroganz, die hinter solchen Worten steckt? Sie wollte mir das Gefühl geben, daß sie sich in einer Sphäre aufhielt, aus der mir keine Nachricht zustand, weil ich sowieso nichts verstehen würde. Sooft ich die Rede darauf brachte, wich sie aus. Natürlich sagte sie nie – das geht dich nichts an. Das eine Mal war sie noch nicht so weit, um darüber zu sprechen, dann wieder behauptete sie, der Gegenstand ihrer Arbeit sei so zerbrechlich, daß sie fürchte, ihn kaputtzuerzählen. Ein andermal trat sie die Flucht nach vorn an: Ihre Reportagen und Artikel hätten mich ja auch nie gekümmert, woher plötzlich das Interesse? Ihre Dünkelhaftigkeit forderte mich zur einzigen Bemerkung übers Geldverdienen heraus, die sie je zu hören bekam. Ich sagte, es imponiere mir, daß sie sich abmühe, ihre künstlerischen Grenzen kennenzulernen, aber ich wäre noch mehr beeindruckt, wenn sie etwas zu unserem Lebensunterhalt beitragen würde, meinetwegen weit entfernt von diesen Grenzen. Alles war sie von mir gewohnt, nur Spott nicht.
Ihr Hochmut hatte etwas Peinigendes, nicht allein weil es für niemanden angenehm ist, hochmütig behandelt zu werden; irgendwann fing ich an, ihr Alltagsverhalten, das ja nicht immer hochmütig war, für gekünstelt zu halten. Ich witterte Herablassung auch dort, wo sie freundlich war, ich dachte, Freundlichkeit dient ihr nur als Tarnung. Es ist möglich, daß ich Gespenster sah, aber auch das wäre Amandas Schuld gewesen. Ich habe mich nie für etwas Besonderes gehalten, ich habe es nie bedauert, ein sogenannter Dutzendmensch zu sein, bis Amanda mich in die Zange nahm. Bis sie mir einzutrichtern begann, daß es keinen schrecklicheren Makel gebe, als so zu sein wie die anderen, also normal. Das tat sie allerdings nie mit Worten, die man auf Tonband hätte aufnehmen oder die man hätte mitschreiben können, ihre Methode bestand aus Gesten und Blicken und Launen und Küssen und der Verweigerung von Küssen und dergleichen mehr. Wenn ich sie gefragt hätte, warum sie solche Abscheu vor dem Normalen hat, hätte sie bestimmt verwundert gesagt: Ludwig, ich ahne nicht einmal, wovon du sprichst.
Wissen Sie, was ich glaube? Daß sie an mir genau die Eigenschaften mißachtet hat, die ich brauchte, um sie und das Kind zu ernähren: Fleiß, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit. Auch eine bestimmte Art von Anpassung, da gibt es nichts herumzureden. Wenn ich der Anarchist wäre, mit dem sie offenbar verheiratet sein wollte, dann möchte ich wissen, wovon wir hätten leben sollen. Ganz abgesehen davon, daß ich keine Ahnung habe, wie ich mich als Rebell hätte verhalten sollen. Ich kann doch nicht wegen eines Prinzips, das mir wesensfremd ist, gegen Autoritäten anrennen, die ich für respektabel halte!
Und ich will Ihnen noch etwas sagen: Der größte Druck, unter dem ich je gestanden habe, war der, den Amanda auf mich ausgeübt hat. Mehr als drei Jahre lang. Die Tatsache, daß ich ihm widerstanden habe, beweist wohl, daß ich nicht der sklavische Anpasser bin, als den sie mich immer bezeichnet hat. Wenn ich mich hätte breitschlagen lassen, dann wären die Schwierigkeiten, die ich durch die Partei, durch meine Redaktion oder durch wen auch immer bekommen hätte, nicht schwerer zu ertragen gewesen als der Druck, unter dem ich jetzt stehe.
Sie schrieb an einem Roman, wie sich schließlich herausstellte, sie sitzt noch heute daran. Vielleicht wird sie eines Tages eine Berühmtheit, allerdings würde mich das wundern. Für viel wahrscheinlicher halte ich, daß die Sache im Sande verläuft. Ich habe Ihnen darzulegen versucht, warum Amanda immer seltener für Zeitungen und Journale schrieb: weil ihre Ansichten den Verantwortlichen immer unakzeptabler vorkamen. Aber es gibt noch einen Gesichtspunkt, der nicht unter den Tisch fallen sollte, und das ist Amandas Faulheit. Bevor wir uns kannten, war sie auf den Verkauf von Artikeln angewiesen, da klangen ihre Ansichten viel sanfter. Nun, da sie es sich finanziell leisten kann – zumindest glaubt sie das –, wird ihr Ton so radikal, daß keine Redaktion ihr mehr eine Zeile abnimmt. Nach meiner Überzeugung handelt es sich um kaltblütig herbeigeführte Arbeitslosigkeit; nicht allein das Beharren auf Prinzipien steckt dahinter, sondern auch Faulheit. Ich habe gelesen, daß sich manche Männer im Krieg eigenhändig verstümmelten, um nicht eingezogen zu werden – etwa so sollte man sich Amandas Radikalisierung erklären. Falls sie Unterhaltsforderungen zu stellen versucht, kann es, Ihr Einverständnis vorausgesetzt, nicht schaden, die Rede auf dieses Thema zu bringen.
Dieselbe Faulheit war schuld daran, daß sie unregelmäßig kochte, viel zu selten saubermachte, zu selten einkaufte, zu selten Wäsche wusch. Wenn sie sich in ihr Zimmer zurückzog, um, wie sie sagte, zu arbeiten, dann hatte man entweder Verständnis dafür zu haben, oder man war ein Unmensch. Ich gebe zu, es war eine perfekte Konstruktion, man kam nicht an sie heran. Jedenfalls wird ihr gebrochenes Verhältnis zur Arbeit sie daran hindern, einen ganzen Roman zu schreiben. Ich verstehe nicht viel von Literatur, doch so viel steht wohl fest, daß ein Buch, bevor es fertig ist, Seite für Seite geschrieben werden muß. Daran wird sie sich die Zähne ausbeißen. Meine Redaktion ist voll von Leuten, die Romane angefangen haben; das Romananfangen scheint eine Art Krankheit zu sein, von der viele in jungen Jahren befallen werden wie von Mumps. Wollen Sie hören, wie viele davon ihren Roman beendet haben? Nicht einer. Dabei handelt es sich um zielstrebige, fleißige Menschen, die es krankmachen würde, untätig herumzusitzen.
Ein zweiter Grund, der mich an Amandas Erfolg zweifeln läßt, ist ihre Unerfahrenheit. Sie hat es nicht gern, aus der Wohnung zu gehen, sie mag keine Bekanntschaften, sie reduziert ihre Beziehungen auf das Unvermeidliche, worüber will sie schreiben? Meist, wenn ich einen Kollegen oder einen Freund nach Hause mitbringe, entschuldigt sie sich, bevor drei Sätze gewechselt sind, verschwindet in ihrem Zimmer und taucht erst wieder auf, wenn die Wohnungstür hinter dem Gast ins Schloß gefallen ist. Meint sie, die ideale Vorbereitung der Schriftsteller auf ihre Bücher bestehe darin, die eigene Umgebung zu ignorieren? Sie hat nichts erlebt, sie kennt keinen, sie sieht und hört nichts. Schön, sie liest viel, aber das soll genügen?
Amandas wichtigste und zugleich einzige Freundin ist Lucie Capurso, eine hübsche, total verschlampte junge Frau, die am selben Tag wie Amanda geboren ist. Die beiden kennen sich seit dem Kindergarten, sie hängen aneinander wie Kletten; es vergeht kaum ein Tag, an dem sie sich nicht treffen müssen und tausend Angelegenheiten zu besprechen haben. Ihren Familiennamen verdankt diese Lucie einem italienischen Regieassistenten, den sie mit neunzehn Jahren geheiratet hat. Mit Zwanzig fand sie heraus, daß die Ehe ihr nicht zum erhofften Reisepaß verhalf, also ließ sie sich wieder scheiden. Sie hat eine Tochter, fragen Sie nicht von wem, es kommen nach meiner Schätzung zwanzig Männer in Frage. Wenn sie uns besucht, im Durchschnitt also dreimal die Woche, bringt sie gewöhnlich das Mädchen mit, eine perfekte Terroristin im Alter von fünf Jahren. Angeblich spielen die Kinder dann miteinander, in Wirklichkeit sitzt Sebastian eingeschüchtert in der Ecke, während Soja, so heißt Lucies Tochter, sein Spielzeug zertrümmert.
Noch nie ist es mir gelungen, länger als drei Minuten mit Lucie zu reden: Sobald sie auftaucht, gehört sie Amanda. Wenn die beiden in einem Zimmer sind, kann man getrost die Wohnung verlassen, man wird nicht mehr beachtet. Zudem ist man unerwünscht. Normalerweise handeln ihre Gespräche von irgendwelchen Schwierigkeiten, von denen Lucie umzingelt ist, von Geldaffären, Liebesaffären, Kindergartenaffären. Lucie ist die Hilfsbedürftige, Amanda die Ratgeberin. Doch ich habe den Eindruck, als handelte es sich um ein merkwürdiges Spiel, bei dem die Rollen verkehrt besetzt sind: als tue Lucie mit ihrer Hilfsbedürftigkeit Amanda einen Gefallen. Als sei das Ratgeben für Amanda wichtiger, als das Beratenwerden für Lucie. Dennoch ist Lucies Situation wenig beneidenswert: Nicht nur, daß sie in einem hoffnungslosen Durcheinander lebt, allein mit dem unzähmbaren Kind, in einer feuchten, chaotischen, kaum beheizbaren Wohnung – zu allem Überfluß zahlt ihr der Kindsvater keinen Pfennig Unterhalt. Und Lucie lehnt es ab zu klagen, Amanda sagt, darüber könne man mit ihr nicht sprechen.
Auf den ersten Blick scheint mich das nichts anzugehen, nur leider borgt sich Lucie regelmäßig Geld von Amanda. Da ihre Geldnot ein Dauerzustand ist, verwandelt sich alles Verliehene nach einiger Zeit in eine Schenkung. Beim ersten Mal hat Amanda mich noch um Zustimmung gebeten, ich war einverstanden; beim zweiten Mal war ich wieder einverstanden, nun aber widerwillig. Beim dritten Mal habe ich nein gesagt, da beschimpfte sie mich als Geizhals, sie mich, und gab Lucie von nun an hinter meinem Rücken Geld. Sie dachte, ich merke es nicht, sie dachte, ich kann Kontoauszüge nicht lesen. Wenn Lucie dem Vater ihres Kindes die Unabhängige vorspielen will, ist das ihre Sache. Wenn Amanda ihre Freundin unterstützen möchte, ist das ihre Sache. Wenn aber offenbar alle sich vorgenommen haben, auf meine Kosten großzügig zu sein, sollte ich schon ein Wort mitreden dürfen.
Ich habe Amanda gesagt, daß ich, wenn diese Rentenzahlungen nicht aufhören, unser Konto auflösen und mir ein eigenes einrichten werde, zu dem sie keinen Zugang hat. Da bin ich vom Geizhals zum Erpresser aufgestiegen, aber sie gab sich geschlagen. So dachte ich zumindest. In Wirklichkeit wurde nur der Zahlungsmodus verändert: Während eines Streits hat sie es indirekt gestanden, indem sie sagte, sie kümmere sich ja auch nicht darum, was ich mit meinem Geld mache. Woher sie das Geld nahm? Vielleicht hatte sie einen kleinen Vorrat angelegt, denn als sie noch Artikel verkaufte, konnte sie mit den Honoraren machen, was sie wollte. Wahrscheinlicher aber ist, daß sie das Geld vom Wirtschaftsgeld abzweigte, ich hatte nicht Mut genug, es nachzurechnen.
Vor einem Jahr im Winter kam ich eines Abends abgekämpft aus der Redaktion nach Hause, da saßen Amanda und Lucie auf dem Sofa, tranken Wein und sahen fern. Sie luden mich ein, ein Glas mitzutrinken, das war sensationell, sie ignorierten mich nicht und waren freundlich. Ich spürte, daß etwas nicht in Ordnung war. Auf einem Stuhl lag der Mantel von Lucies Tochter, sie war also da, dennoch hörte man kein Geschrei in der Wohnung, auch das ungewöhnlich. Ich fand sie schlafend in unserem Ehebett, umgeben von Sebastians schönsten Spielsachen, sie sah hinreißend friedlich aus. Amanda, die mir gefolgt war, nahm mich bei der Hand und sagte, sie hätten Soja nur zum Einschlafen hierhergelegt, später werde sie in ihr, in Amandas Zimmer gebracht. Bei dem Wort später sträubten sich mir die Haare. Amanda sagte, sie hätte Bedenken gehabt, die beiden Kinder allein im Kinderzimmer schlafen zu lassen, so sei es sicherer. Ich rief: Was heißt Bedenken, sie hätte ihn umgebracht! Zu jener Zeit war Sebastian gerade ein Jahr alt.
Kurz und gut: unter dem Deckmantel der Freundlichkeit wurde mir mitgeteilt, daß Lucie und ihre Tochter für einige Zeit bei uns wohnten, es handle sich um einen Notfall. Ich rief, das komme überhaupt nicht in Frage, aber Sie können sich denken, wieviel es genützt hat. Als wären meine Worte unhörbar gewesen, sagte Amanda, daß in Lucies Wohnungswänden Risse seien, durch die der Wind Schnee hereinblase, daß die Temperatur im Schlafzimmer unter zehn Grad liege und daß es eine Art von Solidarität gebe, die man sogar mir abverlangen könne.
Lucie und Soja blieben sechs Wochen. Es war eine harte Zeit, nicht nur der Enge und der Unruhe wegen, sondern vor allem wegen meines Ausgeschlossenseins. Bald hatte ich das Gefühl, daß Lucie Amanda näherstand, als es mir je vergönnt war. Oft verließ ich die Wohnung, weil ich nicht mitansehen konnte, wie gut sie sich verstanden. Ich halte es für möglich, daß in jener Zeit unsere Ehe unheilbar verletzt wurde, nicht durch Lucie, sondern durch die Situation. Als ich einmal die Bemerkung wagte, ich hätte auf dem Rasen vor dem Verlagsgebäude die ersten Krokusse gesehen, sagte Amanda aufgebracht, ich könne ja zur Probe ein paar Tage in Lucies Wohnung wohnen; wenn ich den Test eine Woche lang ohne Grippe überstehen würde, könnten Soja und Lucie nachkommen. Wenn ich das aber ablehnte, wofür sie Verständnis hätte, sollte ich mich mit so unhöflichen Anspielungen zurückhalten. Und das alles in Lucies Gegenwart.
Was habe ich also getan? Ich habe meine wärmsten Sachen zusammengesucht und bin in Lucies Wohnung gezogen. Die zwei Frauen standen daneben, während ich den Koffer packte. Lucie war der Auftritt peinlich, zumindest tat sie so. Sie sagte, das sei eine Überreaktion von uns beiden, sie werde auf der Stelle ausziehen; sie finde selbst, daß ihr Aufenthalt schon länger dauere, als es gut sei; und daß man Soja ausgesprochen gern haben müsse, um sie länger als eine Viertelstunde zu ertragen, auch das sei ihr bekannt. Aber Amanda ließ nicht zu, daß so vernünftige Einsichten sich durchsetzten. Sie machte sich nicht einmal die Mühe des Argumentierens, sie sagte nur – so weit wird es noch kommen, dann half sie mir demonstrativ beim Packen.
Amanda hatte nicht übertrieben, Lucies Wohnung war eine Katastrophe. Es sah aus wie nach einem Raubüberfall, die Temperatur war für einen Menschen aus Fleisch und Blut nicht zumutbar. In der ersten Nacht verheizte ich alles Holz und alle Kohlen, die auffindbar waren, vermutlich eine Wochenration, ich schlief in langen Unterhosen und in zwei Pullovern und war am Morgen doch blaugefroren. Ein immer wiederkehrendes Geräusch, das ich zuerst für Mäusegetöse hielt, stellte sich als Rascheln von Papier heraus, das vom pausenlos durchs Zimmer wehenden Wind verursacht wurde. Lucies Weigerung, hier zu wohnen, war vollkommen verständlich, nur: Was hatte ich damit zu tun?
Ich rächte mich an Amanda, indem ich die nächsten drei Nächte bei Corinna Halske zubrachte. Sie war Sekretärin in unserem Verlag, eine unhübsche Frau, die gerade ihre dritte Scheidung hinter sich hatte und nicht so sehr an mir wie an Männern interessiert war. Es war eine Sache ohne Vergnügen, es war ein Notfall. Sie umsorgte mich, daß mir Hören und Sehen verging, ich hatte kaum Zeit, ihre herrlich geheizte Wohnung zu genießen. Aber ich will mich nicht beklagen, was ich machte, machte ich freiwillig, und es gab auch angenehme Augenblicke. Corinna ist das Gegenteil einer abwartenden Person, sie mag weder Pausen noch Geheimnisse. Im Schnellverfahren berichtete sie, wie es zu den drei Scheidungen gekommen war: wegen einer gewissen Müdigkeit ihrer Männer. Es war sonnenklar, daß sie mich warnen wollte, denselben Fehler zu begehen. Ich war auch bereit, das Unmögliche zu versuchen, ich dachte: immer noch besser als Lucies Iglu. Ich wäre die volle Woche ihr Untermieter geblieben, wenn sie nicht angefangen hätte, mir in der Verlagskantine zuzublinkern und mir Zeichen zu geben, die einem Blinden auffallen mußten. Einmal setzte sie sich mir gegenüber, wir aßen scheinbar aneinander vorbei, doch als ich aufstehen wollte, sah die halbe Redaktion, wie sie ihren Fuß nicht aus meinem Hosenbein herausbekam. Nein, das war nicht komisch.
Als ich in die Eisbude zurückkam, war das Bett frisch bezogen, die Wohnung notdürftig aufgeräumt. Meine lange Unterhose, die mich in der ersten Nacht gerettet hatte, lag zusammengefaltet über einer Stuhllehne, und der Kohlenkasten war bis zum Rand aufgefüllt. Auf dem Kopfkissen lag ein Zettel: Seien Sie nicht so eigensinnig und kommen Sie zurück, bitte, Lucie.
Sie rief am Abend an, nicht Amanda rief an, sondern Lucie, und kündigte für den nächsten Tag ihre Rückkehr an. Das lehnte ich ab, ich muß verrückt geworden sein. Ich sagte, die Woche sei noch nicht vorbei, ich bestand auf vollen sieben Tagen. Wahrscheinlich hatten sie jeden Abend angerufen und wußten genau, daß ich woanders geschlafen hatte – es hätte mir nichts ausgemacht. Im Hintergrund hörte ich Amanda sagen, ich könnte auch länger bleiben, die Folgen meiner Abwesenheit seien nicht so verheerend, wie ich es mir vorstellte. Lucie richtete es nicht aus, statt dessen sagte sie, ich sollte, wenn ich schon so störrisch sei, wenigstens Abendbrot mit ihnen essen. Auch das kam natürlich nicht in Frage.
Der nächste Abend brachte eine peinliche Geschichte, vor der mich Lucie unbedingt hätte warnen müssen, es klingelte an der Tür. Bevor ich öffnete, zog ich meinen Mantel aus, ich rechnete mit Lucie oder mit Amanda, doch es war ein Mann. Er sah mich vernichtend an und fragte, was ich hier zu suchen hätte. Ich sagte, das sei eine so traurige Geschichte, daß ich ihm damit die Laune nur noch mehr verderben würde. Er ging an mir vorbei in die Wohnung, als sei jedes Wort für mich zu schade. Er öffnete alle Türen und kontrollierte alle Räume. Angst vor Tätlichkeiten brauchte ich nicht zu haben, er war einen Kopf kleiner als ich und bestimmt fünfzehn Kilo leichter, auch wenn er sich benahm wie ein Schwergewichtler. Weil es kein Badezimmer in der Wohnung gab, stand mein Rasierzeug in der Küche; er nahm es in die Hand, starrte es an wie ein sensationelles Beweisstück und warf am Ende Messer und Pinsel in den Ausguß. So drohend ich konnte, sagte ich, er sollte das nicht noch einmal tun, aber eigentlich hatte ich Mitleid. Den Mann möchte ich sehen, der an seiner Stelle vergnügt gewesen wäre. Ich versuchte, ihm das Nötigste zu erklären, bevor er noch den Verstand verlor und sich auf mich stürzte. Meine Informationen beruhigten ihn oder auch nicht, jedenfalls öffnete er eine Schublade, holte eine Schachtel heraus, aus der nahm er Geld, ein kleines Bündel, und steckte es ein. Es waren ein paar hundert Mark, ich erinnere mich, daß ich dachte: Da nimmt er mein Geld. Plötzlich ging mir aber auch durch den Kopf, der Mann könnte ein Einbrecher sein, oder nein, kein Einbrecher, sondern ein Bekannter von Lucie, der zufällig wußte, wo sie ihr Geld versteckt hielt und geistesgegenwärtig ihre Abwesenheit nutzte. Ich rief sofort zu Hause an, Lucie sollte mir sagen, was ich zu tun hatte. Sie war nicht da, nur Amanda war da, und bevor ich ihr erklären konnte, was vor sich ging, hörte ich die Wohnungstür ins Schloß fallen. Später erfuhr ich, daß der Mann Ferdinand hieß und zu Lucie so stand, daß er jederzeit an ihr Geld durfte. Wie Amanda an meines.
Die Tage nach der Rückkehr in die eigene Wohnung waren hoffnungsvoll, Amanda behandelte mich ungewöhnlich zuvorkommend. Offenbar ahnte sie, daß sie mit Lucies Einquartierung zu weit gegangen war. Und was mir noch wichtiger zu sein schien: Offenbar wollte sie nicht zu weit gehen. Sie küßte mich wieder, sie erkundigte sich, was ich gern essen wollte, sie ließ sich nicht nur widerwillig verführen, sondern unternahm selbst entsprechende Anstrengungen. Wenn das der Lohn ist, dachte ich, dann kann Lucie jedes Jahr für ein paar Tage bei uns wohnen. Sie wusch sogar meine Wäsche, obwohl bis dahin ein ungeschriebenes Gesetz gegolten hatte, wonach jeder für seine eigene Wäsche verantwortlich war. Einen schönen Augenblick lang stellte ich mir vor, Amandas Verhalten wäre nicht Folge eines schlechten Gewissens, es könnte sie wirklich freuen, daß ich wieder zu Hause war.
Dann geschah eine kleine Katastrophe, die alles wieder verdarb. Ich mußte auf das Kind aufpassen, das auf dem Sofa lag und schlief, während Amanda in der Küche beschäftigt war; der Fernseher lief, ich vertiefte mich in eine Sportübertragung, und wie es das Unglück will – Sebastian wacht auf, dreht sich zur falschen Seite und fällt vom Sofa. Natürlich war es meine Schuld, keine Frage. Er schrie wie wahnsinnig, Amanda kam gelaufen und schrie auch wie wahnsinnig, wir hatten Angst, es könnte ein Schädelbruch sein. Wir fuhren ins Krankenhaus, es war nichts, nur eine Beule auf der Stirn. Doch Amandas Entgegenkommen war von diesem Moment an wieder dahin.
Stellen Sie sich vor, ich durfte tagelang meinen Sohn nicht anfassen. Sie tat, als müßte er vor mir geschützt werden. Sie verstieg sich zu der irren Behauptung, es habe sich nicht um einen Unfall gehandelt, sondern um die zwangsläufige Folge meiner Gleichgültigkeit, die wiederum Teil meiner allumfassenden Gleichgültigkeit sei. Mir fehle jede Aufmerksamkeit fürs Kind, ich würde ihm nie zusehen, beim Spielen nicht und beim Essen nicht und beim Schlafen nicht, wahrscheinlich könnte ich nicht einmal seine Augenfarbe nennen. Solche Vorwürfe prägen sich ein. Plötzlich rief sie, los, sag seine Augenfarbe, und ich sagte, ich lasse mich nicht wie ein dummer Junge examinieren, und sie schrie, los, sag sie, und ich ging wieder einmal aus der Wohnung. Als ich zurückkam, folgte die nächste Beschimpfung: Ein Kind großzuziehen bedeute mehr, als es bis zur Volljährigkeit irgendwie am Leben zu erhalten. Nur wisse sie nicht, ob es vernünftig sei zu wünschen, daß ich mich intensiver um Sebastian kümmere; dann wachse schließlich die Gefahr, daß er ein ähnlich gefühlsarmer, seelisch zweitklassiger Mensch wie ich würde, das könne keine Mutter wollen.
Ich gebe Ihnen mein Wort, daß ich mich selten im Leben so auf etwas gefreut habe wie auf die Geburt Sebastians. Wahr ist, daß ich lieber ein Mädchen gehabt hätte, doch hielt sich die Enttäuschung keine zwei Tage. Sie können jeden fragen, ich war verrückt nach dem Baby. Ich habe ihm stundenlang vorgesungen, ich habe es gefüttert und mir alle Hemden mit Spinat vollsabbern lassen, ich habe in seinem ersten Sommer einen Gazerahmen gebaut, damit es bei offenem Fenster schlafen konnte. In der Redaktion stand sein Bild auf meinem Schreibtisch, und manchmal stellte ich mich nach der Arbeit in eine endlose Schlange, um ein Kilo Bananen zu ergattern.
Amanda war das alles zu wenig. Auch wenn sie es nie ausdrücklich verlangte, hätte ich nach ihrer Überzeugung der Hauptverantwortliche sein sollen, und das war ich nicht. Ich finde nichts Mittelalterliches an der Forderung, daß eine Mutter sich mehr um ihr Kind zu kümmern hat als der Vater. Vor allem dann, wenn an ihm die ganze Last des Lebensunterhalts hängt. Und weil das so offenkundig ist, hat Amanda nie direkte Forderungen gestellt, nur verschlüsselte. Zum Beispiel gab es, wenn wir zerstritten waren, keinen geraderen Weg, ihre Geneigtheit zurückzuerobern, als mich mit Sebastian zu beschäftigen. Oft konnte ich das aus Zeitmangel nicht. Aber ich hatte noch mit einer zweiten Schwierigkeit zu kämpfen, über die man leicht die Nase rümpfen kann, so wie Amanda es getan hat: Ich wußte nichts mit Sebastian anzufangen.
Vergessen Sie nicht, daß wir über einen Jungen sprechen, der heute zwei Jahre alt ist. Was sollte ich mit ihm tun, wenn ich mich kümmerte? Ich trug ihn herum, ich warf ihn in die Luft, ich hob auf, was er immer wieder fallen ließ, ich zischte und fauchte, bis er endlich gelangweilt lächelte, ich machte ihm hundertmal etwas vor, das er doch nie lernte. Ich beklage mich nicht darüber, verstehen Sie das nicht falsch, ich will nur andeuten, daß die vielen Stunden, die wir zusammen verbrachten, nicht zu den abwechslungsreichsten zählen. Anders wäre es gewesen, wenn ich die Nerven gehabt hätte, mich sozusagen in abgeschaltetem Zustand zur Verfügung zu stellen, ohne eigene Erwartungen, so wie Amanda es konnte. Ich bin nicht der Mensch dafür. Wenn ich im Zimmer saß und Zeitung las, und Sebastian unzufrieden im Gitter meckerte, kam sie garantiert herein und fragte, warum ich ihn sich selbst überlasse; wenn ich dann sagte, das sehe nur so aus, in Wirklichkeit bringe ich ihm bei, sich selbst zu beschäftigen, hob sie das mißhandelte Kind auf, küßte es zum Trost, und die nächste Verstimmung war da. Ich habe noch nie eine Frau gesehen, die so verächtliche Blicke werfen kann wie Amanda.
Heute schon weiß ich, daß ich den Jungen elend vermissen werde. Wenn es Ihnen scheint, als wäre unser Leben eine einzige Folge von Mißhelligkeiten gewesen, dann liegt das daran, daß ich natürlich eine Auswahl treffe. Wolkenlose Erinnerungen bringen uns nicht