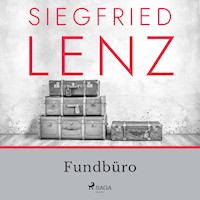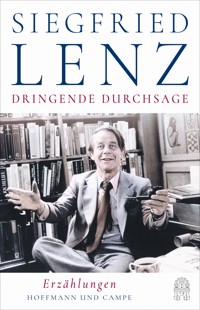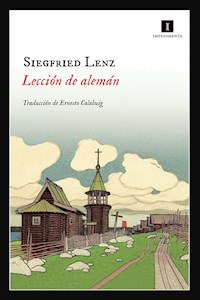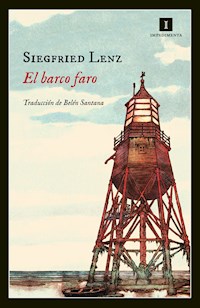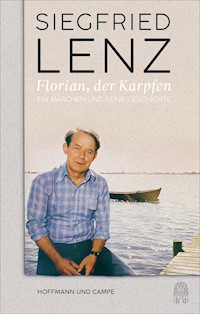10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
"Am 16. Oktober, 9.15 a.m. erstes Appointment mit Mr. Milos O. Ptak im Department of State, Telefonat mit Dr. Schött von der Deutschen Botschaft, der bereits Nachricht hinterlassen hatte." Vierundvierzig Tage reist Siegfried Lenz im Jahre 1962 durch die USA. Er notiert allabendlich das Erlebte in ein Notizbuch. Genau fünfzig Jahre danach erscheint dieses Dokument einer Reise durch Amerika. Zur selben Zeit als Siegfried Lenz am Morgen nach seiner Ankunft in Washington und noch mit Jetlag seinen ersten Verabredungen nachkommt, trifft sich der amerikanische Präsident John F. Kennedy mit seinen Militärberatern und wichtigsten Beamten zur Besprechung der Kubakrise. Amerika steht vor seiner größten Krise seit dem Ende des zweiten Weltkriegs. Diese bedrohliche Atmosphäre empfindet Siegfried Lenz bereits nach wenigen Tagen seiner Amerikareise. Der Ost-West-Konflikt, die Kubakrise, die Diskussion um die Atombombe, das Engagement der Vereinigten Staaten in Vietnam - von diesen Stimmungen ist Siegfried Lenz Reisetagebuch 1962 bestimmt. Dabei war der junge Schriftsteller, der seine ersten Bücher bei Hoffmann und Campe verlegt hatte, doch eingeladen worden, die amerikanische Demokratie kennenzulernen. Der deutsche Seekadett, Journalist und Literat war, wie Martin Walser, Günter Grass, Ingeborg Bachmann oder auch Marcel Reich-Ranicki ein überaus wichtiger Gast aus Deutschland, der dem sich findenden Deutschland Bericht erstatten sollte aus dem Land der Sieger. Siegfried Lenz war von vielem begeistert, von der amerikanischen Literatur wusste er viel, ihr wollte er weiter auf die Spur kommen. Fast hätte er Faulkner noch getroffen. Es war sein Wunsch. Es hat nicht mehr sollen sein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 109
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
1. Auflage 2012 Copyright © 2012 by Hoffmann und Campe Verlag, Hamburgwww.hoca.de Covergestalung: Jan Kermes, Hamburg Foto: gettyimages/Superstock Satz und E-Book-Umsetzung: Dörlemann Satz, Lemförde ISBN 978-3-455-81062-2
50 Jahre später – Ein Vorwort von Siegfried Lenz
Vor fünfzig Jahren erhielt ich eine Einladung, die USA zu besuchen. Diese Einladung war mit keinen besonderen Erwartungen verknüpft. Man bot mir an, auf einer Reise Land und Leute kennenzulernen und mir ein Bild zu machen von den Vereinigten Staaten. Leidlich vertraut mit Geschichte und Literatur überließ man es mir, die Orte zu wählen, die ich sehen, die Menschen zu nennen, denen ich begegnen wollte. Fürsorglicher, großzügiger kann eine Reise nicht geplant werden.
Von Anfang an zeigte sich die Vollkommenheit amerikanischer Gastfreundschaft: Im Osten und im Westen, im Süden und Norden, wohin ich auch kam, überall wurde ich erwartet, fragte man mich nach meinen Wünschen. Überall gab man mir zu verstehen, daß ich mich nicht allein fühlen sollte. Allein zu sein, ratlos und vielleicht sogar hilflos zu sein: Dieses Gefühl wollten mir alle Gastgeber ersparen. Sie fragten mich nicht zuerst: »Wie finden Sie Amerika?«, sondern: »Was können wir für Sie tun auf Ihrer Reise?« Diese Besorgtheit um den Gast ließ wie von selbst die Vermutung entstehen, was das Alleinsein für manche meiner Gastgeber selbst bedeutet haben mag. Schon zu Anfang der Reise hörte ich das Bekenntnis: Man kann leicht verlorengehen in diesem Land, auch im betäubenden Gewimmel des großen Molochs New York.
Dankbar stellte ich fest, daß man mich an die Hand genommen hatte und an der Hand hielt, wohin immer ich kam. Unübersehbar waren die Bemühungen, mir selbst bei zufälligen Begegnungen das Gefühl der Fremdheit zu nehmen. Noch bevor ich eingeladen war, dem offiziellen Besuchsprogramm zu genügen, legte sich mir eine Hand auf die Schulter und ein Kontorist, oder ein Lehrer, oder ein Feuerwehrmann lud mich ein, ihn in seinem Haus zu besuchen, zu einer örtlichen Spezialität.
Verblüfft nahm ich das Anvertrauen der Amerikaner zur Kenntnis: Schon nach dem Abendgespräch wusste ich, wieviel das Haus gekostet hat, ich kannte die Arbeitsbedingungen meines Gastgebers, kannte sein Einkommen und seine politischen Neigungen. Der Vergleich stiftete Nähe. So manches Gespräch machte mir deutlich, daß wir alle ähnlichen Bedingungen unterworfen sind, ähnliche Hoffnungen haben, ein Ende der Fremdheit zeigte sich da wie von selbst. Und auch dies ist ein Grund, Dankbarkeit zu empfinden. Je mehr du mich in dein Leben einweist, desto mehr erfahre ich über mein eigenes Leben. Das Anvertrauen meiner Gesprächspartner bedenkend, wächst auch ein Gefühl der Verbundenheit.
Es gibt mancherlei Gründe zur Dankbarkeit. Unwillkürlich mußte ich bei mancher Begegnung an die Erfahrungen der Nachkriegszeit denken, an die Kälte, den Hunger, an andere mannigfache Not. Sie waren es, die Amerikaner, die Sieger, die bemüht waren, die große Not der Geschlagenen zu lindern, und nicht nur in meinem Land. Amerikanische Hilfeleistungen erreichten etliche europäische Häfen, bewahrten viele Menschen vor der Verzweiflung: Es gibt Erfahrungen, die nicht dem Vergessen anheimfallen sollten; dies wird für immer meine Erfahrung bleiben.
Zum ersten Mal in dem Land, dessen Menschen wir für die Hilfe in extremer Zeit zu danken haben, wollte ich nur dies: ein Tagebuch führen. Ich wollte nicht so sehr herausfinden, ob das, was ich sah und erlebte meinen Vorstellungen entsprach, sondern einfach festhalten, was der Tag brachte, was er mir an Kenntnissen ließ. Damit so wenig wie möglich verlorengehe, entschied ich mich für schlichte abendliche Bilanzen. Und während ich schrieb – erschöpft mitunter, überwältigt vom Augenschein, glücklich über neue Informationen –, erfüllte mich abermals ein Gefühl großer Dankbarkeit. Was ich im Kopf und im Herzen trug, offenbarte sich als ein besonderes, ein unverlierbares Geschenk.
Hamburg, Mai 2012
Amerika-Reise für
Hamburg, 15. Oktober
8:30 Uhr, Abflug von Hamburg; bei guter Sicht über die Zuidersee, der angemessen künstliche Eindruck, über den Kanal nach London. Eine Stunde Aufenthalt, dann, im Jet-Clipper, Start nach New York. Das junge Mädchen mit der Gitarre (»Essen Sie Lakritz?«), das zu einem Esso-Direktor als Haushaltsgehilfin ging; der schwarze Bassist; biedere Männer, die wie Regierungsinspektoren anmuteten; das lächelnde rosige greise Ehepaar vorn, das der Besatzung Geschenke machte. In 13000 Metern über die Irische See, Begegnung mit einer Düsenmaschine, Irlands Felder, der Atlantik. Ich konnte die Schiffe erkennen, die Schaumkronen der Wellen, die seltsamerweise nicht zu wandern schienen, wieder Schiffe und Wolken, die die Sicht nahmen. Ein zeremonielles Mittagsmahl, das zwei Stunden dauerte, viel Alkohol, Gefrorenes (Orangeneiscreme). Danach zog der Steward die Fensterblenden zu, lud zum Kurzschlaf ein. Als ich wieder hinuntersah, lag Labrador unter uns, Seen, Ströme, braune Wälder und graue Berge. Es war sehr klar. Wir flogen an der Küste entlang; Seensysteme, auf denen einzelne Motorboote erkennbar waren, nie ein Haus. Das gepflegte alte Ehepaar machte weitere Geschenke, Stewards und eine Stewardess bedankten sich überschwenglich. Der Pilot sagte: »Wir sind über amerikanischem Land: Maine.« Eine knappe Stunde noch, dann flogen wir von der See New York an, beziehungsweise Idlewild1: Das Sumpfgelände, von Kanälen durchzogen, auf denen unzählbare Motoryachten und -boote schwammen, Trümmergrundstücke, die von herrlichen Wagen eingeschlossen waren, Landebahnen und Abstellplätze für Flugzeuge. Nach siebenstündigem Flug Landung, Besichtigung durch den Gesundheitsinspektor. Als der Immigrationsinspektor Schwierigkeiten machen wollte, meldete sich Mr. Slater (vom State Department) und holte mich ab. Mit mir reiste ein junger norwegischer Politiker (Mathiesen), der von seinem Freund, einem UNO-Beamten, abgeholt wurde. Während Mr. Slater sich um alles kümmerte, ging ich mit den Norwegern in ein modernes Warte-Walhalla, eine riesige Kuppel aus Beton; die beiden Mädchen, die photographiert wurden, mit Lederhosen, Lederstrumpf-Jacken, die Fransen hatten, stramme kleine Hintern, die sie angehalten wurden, herauszustrecken: die Mädchen machten den Eindruck von Wachsblumen.
Weiterflug nach Philadelphia (beim Landen platzte ein Reifen), dann, mit feuerspeienden Auspuffrohren, nach Washington; unterwegs Gespräch mit Mathiesen: ein junger Politiker der norwegischen Arbeiterbewegung, er hat während des Krieges als Widerstandsmann in einem deutschen Lager gesessen. Wir sprachen über den »ostdeutschen« Kommunismus, fanden zu der gleichen Ansicht. Ein sehr freundlicher Beamter empfing uns in Washington, brachte uns während der Rush-hour in unsere Hotels. Ich wohne im Windsor Park, Connecticut Avenue, im siebten Stock. Die erste liebenswürdige Handlung des Beamten bestand darin, mir den Fernseher einzuschalten.
Es ist sehr heiß, über 30°C, die Luftfeuchtigkeit unerträglich. Ich versuchte gleich zu schlafen, lag jedoch zwölf Stunden wach.
1Der New Yorker Idlewild Airport trägt seit Ende 1963 den Namen John F. Kennedy International Airport.
Washington, 16. Oktober
Um 9:15 Uhr erstes appointment mit Mr. Milos O. Ptak im Department of State, Telefonat mit Dr. Schött von der Deutschen Botschaft, der bereits Nachricht hinterlassen hatte. Mr. Ptak schenkte mir Tabak, den seine Tochter beim Pferdewetten gewonnen hatte und fuhr mich zu meinem zuständigen Sponsor vom American Council of Education, Mr. Lewis H. Carnahan, der sich rührend nach all meinen Absichten, Wünschen und Plänen erkundigte und dann einen ganzen Vormittag lang ein Programm für mich entwarf.
Er riet mir, den Süden des Landes zuletzt zu bereisen, wegen der Hitze, und schlug vor, zunächst nach Boston zu reisen und weiter westwärts, was ich gern annahm. (Nach Oxford1 riet er mir einstweilen nicht zu gehen, die Leute stehen dort wegen der Rassenauseinandersetzungen unter Hochspannung, sie könnten vermuten, ich wollte sie als ausländischer Schriftsteller desavouieren.)
Nun, das Programm ist festgelegt, und jetzt kann es losgehen. Das Frühstück ist eine herrliche Mahlzeit hier (im Gegensatz etwa zu Italien): Eiswasser, eisgekühlter Fruchtsaft, Kaffee, gebratene Wurst und Eier: wonderful.
Nachmittags um 14 Uhr, nach schnellem Duschbad, Treffen mit Thilo Koch2 bei der NBC. Thilo Koch fuhr mich raus zu seiner Villa, leicht im Wald gebaut (Laubwald), Air Condition, bemerkenswert schön (40000 Dollar). Thilo ist Rundfunk- und Fernsehkorrespondent, ein enormes Arbeitspensum, dennoch fast ohne Echo. Darin liegt der Grund seiner Resignation; ohne das mindeste Echo zu sein (weder Zustimmung noch Ablehnung). Wir sprachen einen ganzen Nachmittag zusammen, er war sehr resigniert, dazu körperlich angeknackst, da er bei der Rückreise von New York in Philadelphia eine Notlandung hatte. Er sieht keine Möglichkeit, in diesem Land zu bleiben. Gespräche über die Probleme Amerikas: die Überproduktion, der Rassenstreit, Kuba, Berlin (Kuba als außenpolitische Mausefalle). Im Berufsverkehr nach Hause. Der Verkehr, die Fahrweise, keine Fußgänger, herrliche Villen.
Morgens: Schwarze auf dem Schulweg: rauchende Zehnjährige, die Mädchen: scheu, anmutig, mit wassergekämmtem Haar, manchmal geölt, kleine abstehende gezwirbelte Zöpfe, die Jungen sehr selbstbewußt, schlendern, die Bücher unterm Arm, den Autofahrer herablassend musternd, über die Fahrbahnen. Ich machte meine ersten Einkäufe im Drugstore, stand lange vor einem Scherzartikelgeschäft, in dessen Auslagen ein Tod hing, ein harmloser Tod aus Laternenpapier. Neben dem Geschäft wurde Kennedy in Gips verkauft, mit weit offenem Mund und eigensinniger Stirnfalte.
1In Oxford, Mississippi, lebte und arbeitete William Faulkner, den Siegfried Lenz sehr schätzt. Er verstarb am 6. Juli 1962. Siegfried Lenz zog dennoch einen Besuch in Betracht.
2Thilo Koch (1920–2006) begann seine Karriere als Schriftsteller, bevor er journalistisch für das Fernsehen (zunächst für den NWDR/NDR) und die Presse (u.a. für die ZEIT) arbeitete. Als Washingtoner Korrespondet wurde er mit regelmäßigen Beiträgen für die Tagesschau in Deutschland sehr bekannt.
Washington, 17. Oktober
Morgens Spaziergang. Die Art der Begrüßung zwischen amerikanischen Männern. Kurze Besprechung im AmericanCouncil. Dann, mit Familie Koch, Besuch von Mount Vernon am Potomac, George Washingtons Heim und Residenz, heute ein nationaler Schrein, ein Wallfahrtsort, wo die beiläufigs-ten Gegenstände den Rang eines Relikts haben: Rasiermesser, Knöpfe, Ziegelsteine, selbstgenähte Nachthemden von Frau Washington. Eine Nation ohne tiefreichende Geschichte schafft sich so Vergangenheit. Das Gespräch zweier Amerikanerinnen angesichts Washingtons Bett: (»Er muß klein gewesen sein. Früher waren alle kleiner.« »Was meinst du damit?« »Nichts besonderes.« »Aber du mußt doch was gemeint haben.« »Hochgewachsen war er nicht.« etc.) Über dem Potomac gelegen, in der großzügigsten Parklandschaft, die man sich denken kann. Vögel, Pflanzen. Die Andacht der Besucher, Schulklassen, viele Frauen, auch junge Ehepaare. Am Potomac patrouilliert berittene Polizei. (Alle Informationen im Mount Vernon Handbook.)1
Nachmittags in die Stadt. Der singende, vor sich hin singende Filipino. Ich ging zum Post Office, kaufte Marken, die Fahndungsplakate an der Wand, ich beguckte sie (alle gesucht wegen Postraub, auch ein Soldat war darunter, weiches Gesicht), während mich ein Schwarzer am Schalter unentwegt beobachtete. Ich lächelte ihm zu, er lächelte nicht zurück. Im Drugstore, die Wortlosigkeit, die Einsamkeit der amerikanischen Männer. Keine Abschiede. Die Männer scheinen unter einem besonderen Druck zu stehen. Zwei schwarze Frauen, die Brote schmieren, Hamburger braten, alles beklecksen mit Ketchup, wortlos die Teller auf die Theke schieben, ausdruckslos nach weiteren Wünschen fragen, sobald man sie länger als eine Sekunde ansieht. Sie scheinen außerstande, das geringste Gefühl zu zeigen.
Beim Anblick der schweigend, fast reglos dasitzenden Männer erwartet man unwillkürlich eine plötzliche Explosion, wartet auf einen befreienden Amoklauf, auf einen tröstlichen Ausbruch in eine Verzweiflungstat. Ich sah auch Schwarze so dasitzen auf einem Geländer, ein Mädchen ging vorbei, die Männer sahen fast gleichgültig über es hin.
Morgen beginnt mein eigentliches Programm.
1Siegfried Lenz führte dieses Reiesetagebuch auch als Dokumentation für seine in Deutschland gebliebene Ehefrau Liselotte. Die gesammelten Reisedokumente, Prospekte etc. sind nicht erhalten.
Washington, 18. Oktober
Es ist immer noch sehr heiß, die Luftfeuchtigkeit so groß, daß das Hemd nach fünf Minuten am Körper klebt. Mit einigermaßen bangem Gefühl zum Büro des American Council, wo man für mich einige appointments bereithalten wollte; das Gefühl der Abneigung, des Widerstands wurde noch stärker, als mir der Kollege von Mr. Carnahan fünf appointment cards überreichte und sagte: »Das ist heute Ihr Programm.« Beklommen, übellaunig zog ich los, fasziniert von diesem bürokratischen Aufwand (der sich jedoch als sehr praktisch erwies. Sie wollen jeden Zufall bannen, in allem, ein riesiges Netz unter die Existenz ziehen; nun ja).
Um 9:30 Uhr der erste Treffpunkt: Mrs. Marsh, Library of Congress. Ein betagter Bediensteter führte mich durch die größte Bibliothek der Welt, ein Dom, ein St. Peter für Leser. Kein Eisen wurde beim Bau verwendet, nur der beste Marmor der Welt. Viele Lesende, viele Schwarze, gute intelligente gesammelte Gesichter. Die Führung dauerte eine halbe Stunde, die Symbole wurden mir erklärt (auch Heines Name steht in der Galerie der Poeten an der Decke); dann Treffen mit Mr. Louis Untermeyer, Consultant in Poetry to the Library of Congress. Ein älterer, sehr reizender Herr, selber Schriftsteller und Poet, der ein wenig nervös war, da es ihm oblag, in Washington ein Poetry Festival vorzubereiten. Es soll am 22. Oktober beginnen, man erwartet unter anderen den 88jährigen Robert Frost. Wir sprachen eine halbe Stunde, ganz unverbindlich, überhaupt sind die meisten Gespräche ganz unverbindlich, dann lud er mich zum Essen ein, doch vorher sah ich Dr. Arnold Price, German Specialist, bleich, in einer heißen Zelle. Er zeigte mir meine Bücher, ich fand bei ihm fast alle Autoren der Gruppe 47, er selbst hatte einen Essay über das Nibelungenlied geschrieben (Freudsche Interpretation). Leos x-mal Deutschland auf dem Tisch.1 Von Dr. Price zurück zu Dr. Untermeyer, sehr gutes Mittagessen im Department of Justice (Leber mit Schinken, Kuchen, Blumenkohl, Suppe). Die Männer sind ungewöhnlich freundlich, jeder das Abziehbild eines Amerikaners, in seiner Weise. Hilfsbereit, großzügig. Untermeyer teilte meine Ansicht über das prinzipielle Engagement des Autors.
Nach dem Essen um 14 Uhr zu Mrs. Maidel Richman ins Meridian House, Institute of Contemporary Arts