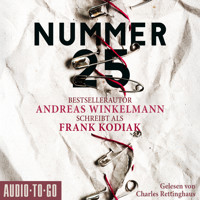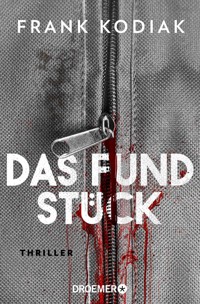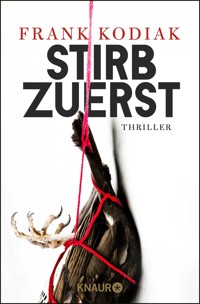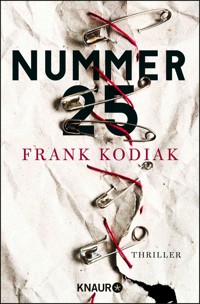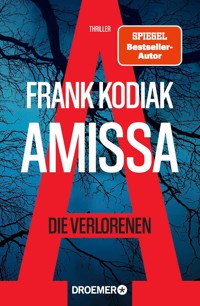
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kantzius
- Sprache: Deutsch
Knallharte Spannung, intelligente Twists: Band 1 der Thriller-Reihe von Frank Kodiak um die Privatdetektive Rica und Jan Kantzius In einer regnerischen Herbstnacht werden die Privatdetektive Rica und Jan Kantzius Zeugen eines grauenhaften Zwischenfalls an einer Autobahn-Raststätte: Ein panisches Mädchen rennt direkt auf die Fahrbahn und wird von einem Auto erfasst, jede Hilfe kommt zu spät. An der Raststätte findet sich die Leiche eines Mannes, der das Mädchen offenbar entführt und sich dann erschossen hat. Die Privatdetektive stellen Nachforschungen an und finden heraus, dass es weitere Teenager gibt, die auf ähnliche Weise kurz nach einem Umzug verschwunden sind. Eine Spur führt zu "Amissa", einer Hilfsorganisation, die weltweit nach vermissten Personen sucht und für die Rica arbeitet. Plötzlich ist nichts mehr wie es war, und Rica und Jan kommen Dingen auf die Spur, von denen sie lieber nie gewusst hätten. »Frank Kodiak« ist das Pseudonym des Bestseller-Autors Andreas Winkelmann, der mit »Amissa. Die Verlorenen« einen knallharten Thriller um vermisste Teenager und die dubiosen Machenschaften einer weltweit tätigen Hilfsorganisation vorlegt. Von »Frank Kodiak« sind außerdem die Thriller »Nummer 25«,"Stirb zuerst" und "Das Fundstück" erschienen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 435
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Frank Kodiak
Amissa. Die Verlorenen
Thriller
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
In einer regnerischen Herbstnacht werden die Privatdetektive Rica und Jan Kantzius Zeugen eines grauenhaften Zwischenfalls an einer Autobahnraststätte: Ein panisches Mädchen rennt direkt auf die Fahrbahn und wird von einem Auto erfasst, jede Hilfe kommt zu spät. An der Raststätte findet sich die Leiche eines Mannes, der das Mädchen offenbar entführt und sich dann erschossen hat.
Die Privatdetektive stellen Nachforschungen an und finden heraus, dass es weitere Teenager gibt, die auf ähnliche Weise kurz nach einem Umzug verschwunden sind. Eine Spur führt zu »Amissa«, einer Hilfsorganisation, die weltweit nach vermissten Personen sucht und für die Rica arbeitet. Plötzlich ist nichts mehr, wie es war, und Rica und Jan kommen Dingen auf die Spur, von denen sie lieber nie gewusst hätten.
Inhaltsübersicht
Kapitel 1
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
Kapitel 2
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
Kapitel 3
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
Kapitel 4
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
Kapitel 5
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
Kapitel 6
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
Kapitel 7
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
Danksagung
Kapitel 1
1.
Das Messer sirrte durch die Luft, doch ihr Verfolger war zu weit entfernt, nur die Spitze der Klinge erreichte sie, durchtrennte den dünnen Stoff der gefütterten blauen Winterjacke und die darunterliegende Haut. Sie spürte den scharfen Schmerz und einen Lidschlag später warmes Blut den Oberarm hinablaufen.
Das Mädchen zuckte zusammen, schrie aber nicht. Sie wusste, wenn sie überleben wollte, musste sie rennen. So schnell wie nie zuvor in ihrem Leben, und das würde ihr nur gelingen, wenn sie Kraft und Atemluft allein dafür verwendete. Weder durfte sie um Hilfe schreien noch sich nach ihrem Verfolger umdrehen und damit wertvolle Sekunden verschenken.
Also rannte sie. Panische Angst und der Schmerz am Oberarm setzten genug Adrenalin frei, um ihre Beine nur so über den Boden fliegen zu lassen.
Instinktiv hielt das Mädchen auf die Lichter zu, die Rettung zu versprechen schienen. Auf diese großen, orange leuchtenden Kugeln, die in einiger Entfernung hoch über dem Boden schwebten. In schrägem Winkel zog der vom Wind gepeitschte Nieselregen durch die Streulichtkegel, ein diesiger Vorhang, der die Sicht auf wenige Meter beschränkte. Feine Tropfen trieben ihr ins Gesicht, und es dauerte nicht lang, bis ihr das lange, dunkle Haar an Kopf und Wangen klebte.
Lauf, lauf, lauf, du schaffst das!
Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Das Atmen fiel ihr schwer, ihre Lunge brannte, und sie hatte das Gefühl, ihr Körper würde jeden Moment kollabieren.
In der tiefen, nassen Dunkelheit konnte sie kaum etwas erkennen, und so übersah sie den tief hängenden Ast einer ausladenden Sandkiefer. Ein spitzer Dorn trockenen Holzes traf sie seitlich am Hals, durchbohrte die Haut und riss sie von vorn bis in den Nacken auf. Der Schmerz übertraf den des Messerstichs, sodass sie jetzt doch laut aufschrie, ins Taumeln geriet und auf die Knie fiel. Das Mädchen presste sich die rechte Hand auf die Wunde, spürte wieder Blut aus dem Körper rinnen, aber nicht mit der Wucht, die zu erwarten gewesen wäre, wenn der Ast ihr die Halsarterie aufgerissen hätte.
Schwer atmend, ein Knie und eine Hand am Boden, warf sie nun doch einen Blick zurück. Dunkelheit. Regen. War da eine schwarze Gestalt dazwischen, die sich zielstrebig auf sie zu bewegte?
Geriete sie ihm erneut in die Finger, würde er sie töten, keine Frage. Das Mädchen wusste selbst nicht, wie sie zu der Chance gekommen war, dem Mann überhaupt zu entkommen, aber sie wusste, eine zweite würde es nicht geben.
Sie stieß sich vom Boden ab und rannte weiter.
Ihr Herz wummerte wie verrückt, und sie spürte, wie der drastisch erhöhte Puls das Blut aus den beiden Wunden an Oberarm und Hals presste. Irgendwann würde der Blutverlust sie schwächer werden lassen, aber noch nicht. Jetzt musste sie um ihr Leben rennen und sich abverlangen, wozu sie nie zuvor in der Lage gewesen wäre.
Der schmale, asphaltierte Weg, der aus dem kleinen Waldstück auf die Lichter zuführte, teilte sich vor ihr. Der rechte Abzweig führte auf die Lichter zu, und wenn sie es richtig interpretierte, gehörten sie zu dem Parkplatz einer Autobahnraststätte – sie konnte das Rauschen von Reifen auf der nassen Straße hören.
Das Mädchen warf einen schnellen Blick in den linken Abzweig und glaubte kaum, was sie dort sah: Nicht einmal fünfzig Meter entfernt befand sich ein flaches Gebäude mit einem Polizeischild daran.
Sie schrie auf vor Erleichterung.
Polizei.
Ihre Rettung!
2.
Du warst zu hart zu ihr!«
Martin Eidinger schüttelte den Kopf und ballte die Hände zu Fäusten, versteckte sie aber unter dem Schreibtisch zwischen den Beinen, damit seine Frau es nicht sah.
Eine Stunde nach dem monströsen Streit war sein Ärger noch immer nicht verraucht, denn die Vorwürfe, die er sich hatte anhören müssen, wanderten wieder und wieder durch seinen Kopf und warfen Fragen auf. Fragen, deren Beantwortung er sich nicht stellen wollte. Es nicht konnte. Sie waren zu existenziell, gingen zu tief und kratzten den glänzenden Lack von seinem Selbstbildnis. Den Rost darunter hatte er lange schon gespürt, ihn zu sehen war zu viel der Realität.
»Sie ist doch unser einziges Kind«, fuhr Lydia fort.
Martin blickte noch immer auf den PC-Bildschirm und hatte ihr den Rücken zugedreht, hörte aber an ihrer Stimme, wie nah sie den Tränen war. Wenn sie weinte, würde er es auch, das war schon immer so gewesen, wie wütend er auch sein mochte.
Seit seine Tochter Leila vor einer Stunde die Haustür mit Wucht hinter sich zugeworfen hatte und in den Abend verschwunden war, hatte er versucht, ein wenig zu arbeiten, doch es war ihm nicht gelungen. Der Artikel über die Inklusion an der Gesamtschule von Taubenheim sollte in drei Tagen fertiggestellt sein, die Daten und Fakten lagen vor, er musste sie nur noch leserfreundlich verpacken – aber wie sollte er, nachdem dieser eine Satz seiner Tochter ihm den Boden unter den Füßen fortgezogen hatte.
»Wenn du deinen Job beherrschen würdest, würde es uns besser gehen, und ich hätte meine Freunde noch.«
Seine kleine Fee, wie Martin seine Tochter seit ihrer Geburt nannte, war in diesem Moment alles andere als eine Fee gewesen, eher eine selbstsüchtige Hexe, und es war einfach nur gemein von ihr, ihn für alles verantwortlich zu machen. Manchmal verlief das Leben anders, als man es sich vorgestellt hatte, und die seit Jahren andauernde Krise der Printmedien war ja nun mal nicht seine Schuld. Immerhin arbeitete er noch als Journalist, wenn auch nicht mehr bei einem der großen Nachrichtenmagazine Deutschlands, sondern stattdessen für eine Provinzzeitung. Mit wesentlich geringerem Gehalt, und den Wohnort hatten sie dafür auch wechseln müssen, was der Hauptgrund für den Streit gewesen war, aber er war nicht arbeitslos wie so viele seiner ehemaligen Kollegen und Freunde.
Martin Eidinger entspannte die Hände, schüttelte den Kopf und drehte sich zu seiner Frau um. »Es tut mir auch leid …«, sagte er. »Aber sie war so unfair. Manchmal erkenne ich sie nicht wieder. Wann ist sie so geworden?«
Lydia stieß sich vom Türrahmen ab, ging vor dem Schreibtischstuhl in die Hocke und nahm seine Hände. »Sie ist siebzehn und hat gerade ihr soziales Umfeld verloren … das kommt einem Weltuntergang gleich.«
Martin nickte. Er wusste das, denn er konnte sich noch gut an die Umzüge seiner Eltern erinnern. Vier während seiner Schulzeit, und die Neuanfänge waren nie einfach gewesen. Wenn man ein wenig nerdig und in sich gekehrt war, geriet man an jeder Schule zuallererst einmal an die coolen Typen, die noch cooler wurden, indem sie den Neuen so richtig aufmischten.
»Ich bin mir sicher, sie hat es nicht so gemeint«, fuhr Lydia fort. »Du bist gut in dem, was du tust, es liegt nicht an dir. Das weißt du, nicht wahr?«
Martin sah seiner Frau in die Augen. Sie waren von hellblauer Farbe mit winzigen silbernen Sprenkeln darin und so offen zugänglich, wie man es nur selten erlebte. Weder Mitleid noch übertriebene Fürsorge begleiteten ihre Worte, was sie sagte, dachte sie auch. Darauf konnte er sich verlassen, und es war von jeher sein Halt gewesen, dass sie nicht an seinem Talent zweifelte. Ein einziger Mensch nur, der immer an ihn geglaubt hatte, ohne daraus ein großes Ding zu machen. Das reichte ihm, um weitermachen zu können, auch in Krisenzeiten wie diesen.
»Ich weiß«, sagte er leise, ohne den Blick zu senken. Er hatte dunkle Augen und hoffte, sie würden die Wahrheit verbergen, die sich hinter dieser Lüge versteckte. Martin war sich seines Talents nicht mehr sicher. Aber für eine Provinzzeitung würde es wohl reichen.
Sie erhoben sich gleichzeitig und umarmten einander, standen minutenlang nur da. Martin zog Kraft und Zuversicht aus ihrer Wärme und ihrer Hand in seinem Nacken, wo ihre Finger sein Haar streichelten. In diesem Moment fühlte er sich behütet und beschützt, und er fragte sich, ob es Lydia ebenso erging. Und wenn nicht? Wurde er seiner Rolle als Mann in ihrer kleinen Familie dann überhaupt gerecht?
Mit harten Worten hatte er seine Tochter aus dem Haus getrieben und ließ sich dafür jetzt auch noch von seiner Frau trösten. Was für ein toller Kerl er doch war!
»Holst du sie zurück? Bitte!«, sagte Lydia an seinem Hals, schob ihn dann ein Stück von sich und sah ihn wieder an. »Ich bin sicher, sie wartet auf dich.«
»Meinst du?«
Lydia nickte und lächelte.
»Wo ist sie hin?«
»Ins Level24.«
»Äh …« Martin kratzte sich hilflos am Kopf. Sie waren vor drei Wochen in diese Stadt gezogen, und er hatte noch keinerlei Überblick.
»Gegenüber der Aral-Tankstelle vorn am Kreisverkehr. Ist der Szenetreff für Jugendliche hier.«
»Sollte ich als Lokaljournalist wissen, oder?«
»Wissen ist eine Ansammlung von Erfahrungen, und das Level24 betreffend wirst du deine heute Abend machen.«
Lydia küsste ihn. Nicht leidenschaftlich oder auch nur liebevoll, sondern aufmunternd, wie man jemanden küsst, der eine schwierige Prüfung vor sich hat. »Geh«, sagte sie flüsternd und fuhr ihm mit der Hand durchs ohnehin schon zerzauste Haar. »Bring unser Kind zurück. Ich bereite derweil ein Abendessen zu, und dann reden wir zu dritt über alles.«
Martin schnappte sich Schlüssel, Geldbörse und Jacke und verließ das kleine Haus aus den Siebzigern mit der hässlich verblichenen Putzfassade, das sie angemietet hatten. Fieser Nieselregen, der vom Wind durch die Lichtkegel der Straßenlaternen getrieben wurde, zwang Martin einen gebückten Gang auf, den Kopf tief zwischen den Schultern, die Hände in den Jackentaschen. Ein Gang, der zu seinem Zustand passte.
Vorn an der Kreuzung lag die blau beleuchtete Tankstelle wie ein fremdartiges Raumschiff im feuchten Dunst. Alles, was nicht beleuchtet war, verschwand.
Martin ging daran vorbei und überquerte die Straße.
Das Level24 hatte nur eine schmale Leuchtreklame über der Eingangstür, dafür waren die beiden großen Fenster, die an einen ehemaligen Supermarkt erinnerten, hell erleuchtet, und er sah schon von Weitem Menschen dahinter. Hinter den Scheiben schlängelten sich an riesigen Yuccapalmen blinkende Weihnachtslichterketten in unterschiedlichsten Farben. Eine Deko von zweifelhaftem Geschmack, aber die Jugendlichen störte es vermutlich nicht.
Kaum hatte er die Eingangstür aufgezogen, drangen die Schallwellen tiefer Bässe an seine Ohren. Da er immer auf dem Laufenden war, was neue Musik anging, erkannte er dahinter den Gangsterrap, der zurzeit angesagt war. Capital Bra und Konsorten. Geiler Sound, abartige Texte, wie Martin fand.
Nach einer weiteren Tür gelangte er in den Hauptraum mit Theke, einigen Tischen und Stühlen, Bänken und Sitzsäcken sowie einem Kicker und Billardtisch. Die große Tanzfläche dazwischen wurde nicht genutzt. Etwa ein Dutzend Teenager standen, saßen oder lagen herum und unterhielten sich.
Seine Tochter sah Martin nicht auf den ersten Blick, deshalb ging er tiefer in den Raum hinein. Der junge Mann hinter der Theke musterte ihn mit finsterem Blick. Er trug einen dunklen Vollbart, sein Scheitel war tief und wie mit dem Lineal gezogen.
Martin durchquerte den Raum und checkte die einzelnen Gruppen ab, konnte seine Tochter aber nirgends entdecken. Leider wusste er nicht, ob sie in der kurzen Zeit hier schon Freunde gefunden oder Bekanntschaften aufgebaut hatte. Eigentlich musste es so sein, warum sonst sollte sie nach ihrem Streit hierher geflüchtet sein.
Martin beobachtete ein paar Minuten die Tür zu den Toilettenräumen. Einige Mädchen kamen von dort zurück in den Clubraum, seine Tochter war nicht dabei.
»Kann ich Ihnen helfen?«
Martin erschrak, als er plötzlich von hinten angesprochen wurde. Es war der bärtige junge Mann mit dem scharfen Scheitel, den er beim Hereinkommen hinter dem Tresen gesehen hatte.
»Ich suche meine Tochter«, sagte Martin, nannte ihren Namen und beschrieb sie.
Der Bärtige ließ ihn nicht ausreden, schüttelte den Kopf und sagte: »Ich weiß schon … Aber sie war heute noch nicht hier.«
3.
Das Mädchen warf sich gegen die Eingangstür des Gebäudes der Autobahnpolizei, hämmerte dagegen und rief um Hilfe.
Doch drinnen blieb es dunkel. Niemand kam.
Es dauerte, bis sie begriff, dass diese Dienststelle wohl nicht besetzt war, und dann bemerkte sie auch den verwahrlosten Zustand, die schmutzigen Scheiben, den vom Wind in den Eingangsbereich getriebenen Müll.
Enttäuschung zerriss ihre Hoffnung in Fetzen.
Panisch blickte sie nach rechts in die Dunkelheit, aus der sie gekommen war, und erstarrte. Dort stand breitbeinig ihr Verfolger. Er hielt eine Waffe in der Hand, hob sie an und zielte auf sie.
Der Überlebensinstinkt in ihr übernahm wieder die Führung. Erneut rannte sie, so schnell sie konnte. Sie geriet in einen dicht bepflanzten Grünstreifen, ein vielleicht fünf Meter breites Dickicht aus Büschen. Dornen stachen ihr durch die dünne Jeans in die Beine, sie streifte die Nässe von den verbliebenen, herbstlich verfärbten Blättern und war klatschnass, als sie sich durch das Dickicht hindurchgekämpft hatte.
Dahinter öffnete sich eine weite asphaltierte Fläche, Dutzende Lkw parkten dort dicht an dicht. Auf dem Lack der Führerhäuser und den Planen der Auflieger brach sich das orange Licht der Peitschenlampen in den unzähligen Wassertropfen und verlieh den Vierzigtonnern eine gespenstische Aura der Auflösung.
Menschen, da sind Menschen drin, dachte das Mädchen. Obwohl ihre Beine zitterten – wahrscheinlich eine Folge des Blutverlusts –, hielt sie geradewegs auf den erstbesten Truck zu.
Mit ihrer blutigen Hand schlug sie gegen das Blech der Beifahrertür und rief laut um Hilfe. Dann packte sie den Griff, zog sich daran die beiden Stufen hinauf und hämmerte gegen die Glasscheibe. Doch in dem dunklen Führerhaus tat sich nichts. Sie konnte auch niemanden darin sehen. Aus ihrer erhöhten Position blickte sie sich um und entdeckte ihren Verfolger sofort. Er war links um den dicht bewachsenen Grünstreifen herumgegangen und hielt auf sie zu, ging zügig, rannte aber nicht. Seine ostentative Gelassenheit jagte ihr noch mehr Angst ein als die Waffe in der rechten Hand.
Sie konnte sich täuschen in diesem Dreckslicht, aber das Mädchen meinte zu sehen, dass er sie langsam anhob, während er auf sie zukam.
Mit einem Satz sprang sie vom Führerhaus weg und rannte weiter. Am scheinbar endlos langen Auflieger eines weiteren Gespanns entlang, das nach Gummi und Öl roch. Dann bog sie nach links ab, schob sich durch den Spalt zwischen Führerhaus und Heck zweier Lastkraftwagen hindurch, schlich in den engen Gang weiterer Auflieger bis nach vorn, wo sie erneut in die Richtung abbog, in der sie die Tankstelle der Raststätte vermutete. Dort müsste man ihr doch helfen können!
Das Mädchen schlug einen Haken nach links – und stieß gegen eine Gestalt.
Sie spürte etwas heiß von ihrem Hals abwärts zwischen den Brüsten hinabfließen und wusste, es war ihr Blut.
Ihr Verfolger hatte sie ausgetrickst und mit einer schnellen Bewegung den Hals aufgeschnitten.
Doch warum konnte sie noch atmen?
Und schreien!
Sie nahm den Geruch von Kaffee wahr, und erst jetzt registrierte sie, dass der Mann vor ihr kein Messer in der Hand hielt, sondern einen Pappbecher. Erschrocken starrte er sie an, wich sogar vor ihr zurück.
»Helfen Sie mir, bitte, er bringt mich um!«, flehte sie den Mann an, den sie für einen Fernfahrer hielt.
Er trug eine helle Jogginghose, auf der sich ebenfalls Kaffeeflecken abzeichneten, dazu Gesundheitslatschen und ein weites Shirt, das sich über den mächtigen Bauch spannte. Der Becher entglitt seiner Hand, ebenso die Papiertüte mit dem Aufdruck von McDonald’s. Beides fiel in eine Pfütze. Der Mann hob wie zum Schutz die Hände und wich noch weiter von ihr zurück.
»Helfen Sie mir doch!«, rief sie verzweifelt.
Doch der Mann dachte gar nicht daran. Er nahm seine kurzen Beine in die Hand, lief, so schnell er konnte, drehte sich noch einmal um und verschwand zwischen den geparkten Lastkraftwagen.
Das Mädchen war fassungslos, wollte ihm hinterherschreien, kam aber nicht dazu.
Links von sich sah sie einen hellen Blitz und hörte ein metallisches »Klonk«, mit dem sich wie aus dem Nichts ein Loch ins Blech des Lkw stanzte.
Er hatte wirklich auf sie geschossen!
Panisch flüchtete das Mädchen Richtung Autobahn.
4.
Der Regen hatte zugenommen, das Wasser lief ihm in Strömen übers Gesicht.
Martin Eidinger stand auf dem Bürgersteig vor dem Jugendtreff und drehte sich im Kreis, suchte nach seiner Tochter. Sie war nicht einmal dort gewesen, hatte der Bärtige gesagt und verlangt, er solle abhauen, wenn er nichts trinken wolle.
Martin nahm die Brille ab, durch die er wegen des Regens ohnehin nichts mehr sehen konnte, und steckte sie in die Jackentasche.
Musste er sich Sorgen machen?
Aber was sollte Leila passiert sein in dieser kleinen Provinzstadt Taubenheim, in der um zwanzig Uhr die Bürgersteige hochgeklappt wurden und die Menschen einander so gut kannten, dass es schon an Spionage grenzte, was manche hier betrieben. Hatte er nicht in den Wochen vor dem Umzug genau diesen Umstand immer wieder dazu genutzt, seiner Tochter den neuen Wohnort schmackhaft zu machen?
Dort ist es viel sicherer als in Frankfurt, es gibt kaum Kriminalität, man kann nachts rausgehen, ohne sich Sorgen machen zu müssen.
Leila hatte seine Argumente mit Langeweile assoziiert.
Wohin konnte sie gegangen sein?
Vielleicht zu einer Schulfreundin? Dass sie erst seit drei Wochen in der Stadt waren, musste ja nicht bedeuten, dass seine Tochter noch niemanden gefunden hatte, dem sie sich anvertrauen konnte. Möglicherweise einen Jungen, ganz egal, alles wäre Martin recht, wenn seine Tochter nur wohlbehalten nach Hause zurückkehren würde.
Martin war klatschnass, als er ihr kleines Mietshaus erreichte. Durch das Küchenfenster, das nach vorn zur Straße ging, konnte er seine Frau in der hell erleuchteten Küche das Versöhnungsessen zubereiten sehen.
Lydia hatte ihn losgeschickt, ihre Tochter heimzuholen.
Jetzt kehrte er ohne sie zurück.
Trotz des Regens und der Kälte, die ihm tief in den Körper kroch, blieb Martin vor dem Haus stehen, starrte durchs Fenster und fragte sich, wie er seiner Frau erklären sollte, dass Leila nicht im Level24 gewesen war.
Er schüttelte den Regen ab, schloss die Haustür auf und trat ein. Sofort kam Lydia aus der Küche, und das Lächeln gefror in ihrem Gesicht, als sie ihren durchnässten und ratlos wirkenden Mann im Hausflur stehen sah.
»Wo ist …?«, begann sie, doch Martin unterbrach sie.
»Mach dir keine Sorgen. Sie war nicht im Level24, aber ich bin mir sicher, es ist alles in Ordnung.«
Lydia schlang sich die Arme um den Oberkörper und kam zwei Schritte auf ihn zu. »Sie war nicht da? Was heißt, sie war nicht da? Überhaupt nicht oder nur kurz, oder was?«
»Niemand hat sie dort gesehen.«
»Aber sie hat mir versprochen, nur dorthin zu gehen. Sonst wäre ich ihr doch sofort hinterher!«
»Vielleicht hat sie ja vor dem Level24 eine Freundin getroffen, und die beiden sind zu ihr nach Hause gegangen. Lass uns dort anrufen. Dir hat sie doch bestimmt von ihren neuen Freundinnen erzählt.«
Ganz langsam, so als bestünde ihr Nacken aus Beton, schüttelte Lydia den Kopf. »Martin … darum geht es doch … wir sind vor drei Wochen hergezogen. Sie hat hier noch keine Freundin gefunden. Sie kann zu niemandem gegangen sein. Sie hat mir versprochen, nur ins Level24 zu gehen.«
Martin legte seiner Frau die kalten Hände an die Oberarme. »Mach dir keine Sorgen, es geht ihr sicher gut.«
»Ich mache mir aber Sorgen! Wo ist unsere Tochter?«
Ihre Stimme drohte zu kippen, und Martin war klar, er konnte sich nicht wieder ins Büro setzen und hoffen, dass Leila schon auftauchen würde, wenn sie sich beruhigt hatte.
Er zog sein Handy hervor und rief seine Tochter an. Während es klingelte, versuchte er sich mit einem Blick auf seine Frau an einem aufmunternden Lächeln.
Leila ging nicht ran. Die Mailbox meldete sich.
»Leila … ich bin’s, Papa … Es tut mir leid, lass uns reden, ja? Komm bitte nach Hause!«
Er legte auf und steckte das Handy ein. Lydia musste nichts sagen, ihr Blick war Aufforderung genug.
»Okay … okay, ich geh wieder raus und suche nach ihr. Frage vorn an der Tankstelle, vielleicht hat sie dort jemand gesehen.«
Martin flüchtete geradezu aus dem Haus, es war ihm gleichgültig, dass es mittlerweile noch stärker regnete und er sich wahrscheinlich eine Erkältung holen würde, so nass, wie er mittlerweile war. Denn in Lydias Blick, in ihren Gesten und Worten, hatte er ihn gesehen, den Vorwurf.
Deine Schuld, deine Schuld, deine Schuld …
5.
Vergiftete Luft strömte aus dem Kofferraum nach vorn in den Wagen und entfaltete augenblicklich ihre verheerende Wirkung.
Rica Kantzius, die sich gerade in den neuen Fall hatte einlesen wollen, presste sich eine Hand vor Mund und Nase, doch das nützte nichts, denn längst hatte sie die unsichtbar kleinen, aber dennoch hocheffizienten Partikel eingeatmet. Niemand konnte sich gegen einen solchen Angriff zur Wehr setzen.
»Ragna!«, schrie Jan Kantzius und schlug mit der Hand aufs Lenkrad des Defender. »Nicht schon wieder … das darf doch nicht wahr sein!«
Ragna, ihr Wolfshund hinten im Kofferraum, hob den Kopf und warf ihnen einen Blick zu, der zu verstehen gab, dass er rein gar nichts mit diesem Gestank zu tun hatte, dann widmete er sich wieder seinen Träumen und seiner Flatulenz.
»Du bist schuld, nicht Ragna«, sagte Rica hinter vorgehaltener Hand und kurbelte mit der anderen das Fenster der Beifahrertür hinunter. »Ich hab’s dir doch gesagt: Hunde vertragen keine Spaghetti aglio e olio.«
»Das bisschen«, verteidigte sich Jan. »Ich glaube, er ist krank. Magen-Darm-Infekt wahrscheinlich.«
Rica konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. Ihr Mann Jan war wie ein kleiner Junge, wenn es um den Hund ging, den er aus tiefstem Herzen liebte. Vielleicht nicht ganz so, wie er sie liebte, aber viel fehlte nicht – zumindest hoffte Rica, dass es so war. Wenn Ragna Jan beim Essen nur lange genug anstarrte, bekam er irgendwann seine Portion, ganz gleich, was Jan gerade zu sich nahm. Er argumentierte immer, Hunde seien Allesfresser, ließ dabei aber gern außer Acht, dass das nur für natürlich vorkommende Nahrung galt, nicht für Pommes, Ravioli oder Spaghetti mit Knoblauchdressing.
Sie kamen gerade aus Erfurt, von einer Veranstaltung bei Amissa, der Hilfsorganisation, für die Rica weltweit nach vermissten Menschen suchte. Seit zwei Stunden waren sie auf der Autobahn unterwegs, und alle dreißig Minuten furzte der Hund hinten im Kofferraum, was das Zeug hielt. Die Ausdünstungen waren so aromatisch, dass Rica schon einen Belag auf der Zunge spürte, der sie an ihre letzte Mahlzeit beim Italiener erinnerte. Jan behauptete hingegen, so schlimm sei es doch gar nicht.
Lange konnte sie das Fenster nicht geöffnet lassen, da es regnete und der Fahrtwind die Tropfen ins Wageninnere drückte. Also kurbelte Rica es wieder hoch, bis nur noch ein schmaler Spalt blieb, durch den mehr Geräusche als frische Luft hereindrangen – immer noch besser, als zu ersticken.
»Vielleicht verträgt er das Autofahren einfach nicht«, sagte Rica, um Jan zu veralbern, doch der blieb ernst.
»Glaub ich nicht. Und selbst wenn, er kann ja schlecht dauernd allein zu Hause bleiben.«
Jedes seiner Worte machte deutlich, wie undenkbar es für ihn war, Ragna länger als einen Tag und eine Nacht allein auf dem Hof zu lassen.
»Wie auch immer, für die nächste Fahrt besorge ich Atemschutzmasken.« Rica stellte sich vor, wie sie beide mit diesen Masken vor dem Gesicht im Wagen saßen, während hinten der Hund sich flatulierend wohlfühlte, und brach in Lachen aus. Jan fiel mit ein. Zusammen lachten sie, bis Rica Tränen aus den Augenwinkeln rannen.
Jäh und sehr nachdrücklich wurde ihr wieder einmal bewusst, wie sehr sie diesen Mann neben sich liebte und dass es kein für sie vorstellbares Szenario ohne ihn gab.
Sie wischte sich die Tränen aus den Augen, beugte sich hinüber und küsste ihn.
»Was hast du da?«, fragte Jan schließlich und deutete auf ihr Handy, in dem sie kurz vor dem Giftgasalarm gelesen hatte.
»Ein neuer Fall.«
»Echt? Schon wieder? Willst du nicht mal eine Pause einlegen?«
»Es sind zu viele für eine Pause.«
»Ja, aber die haben dich ohnehin schon angestarrt auf dem Empfang.«
»Ach, ich werde doch immer angestarrt, das merke ich schon gar nicht mehr.«
Was nicht stimmte. Rica verfügte über sehr feine Antennen, sie musste es nicht sehen, ob jemand sie anstarrte, sie spürte es. Wenn man in einem Land lebte, in dem neunundneunzig Prozent der Menschen so vollkommen anders aussahen als sie, war ein Übermaß an Aufmerksamkeit Alltag. Ablehnung ebenfalls. Und in letzter Zeit war auch offen zur Schau getragener Rassismus nicht mehr ungewöhnlich. Rica stammte aus der Karibik. Ihre Haut war dunkel, ihr Haar und ihre Augen ebenfalls, sie war exotisch, wie Jan gern sagte, und er meinte damit, dass sie einen gewissen Zauber ausstrahlte, zumindest auf ihn. Für viele andere galt das nicht. Sie sahen das Fremde, das ihnen Angst machte, weil sie es nicht in Schubladen ablegen konnten.
»Das meine ich nicht«, sagte Jan. »Sie waren neidisch auf deinen Erfolg. Du hattest in diesem Jahr die beste Quote. Sieben! Sagst du dir das eigentlich oft genug? Du hast sieben seit Langem vermisste Menschen gefunden. Und das auch deshalb, weil du ohne Pause arbeitest.«
»Drei aber nur tot«, konkretisierte Rica. Sie wusste, sie sollte sich über ihren Erfolg freuen, aber wenn sie nicht schlafen konnte und darüber nachdachte, fielen ihr nur die Toten ein. Tote konnte man nicht in die Arme schließen. Eine Leiche war für die Angehörigen kein wirklicher Trost.
Immer wieder war es die Zeit, die alles durchkreuzte.
Die Zeit heilte nicht, sie verwundete, sie beschleunigte und erstarrte zugleich, und viel zu oft reichte sie nicht aus. Viel zu oft kamen sie zu spät.
Jan legte ihr eine Hand auf den Oberschenkel. »Ob tot oder lebendig, am Ende schaffst du Gewissheit.«
Ricas Lächeln fiel gequält aus, das spürte sie selbst. Sie arbeitete gern für Amissa, und dank Jan hatte sie eine höhere Erfolgsquote als alle anderen. Sie waren das beste Team. Aber gestern, als Ansprachen, Ehrungen und Beifall ihrer Arbeit Respekt zollen sollten, war Rica wieder einmal bewusst geworden, dass es nie enden würde. Niemals.
Solange es mächtige, alte weiße Männer gab, würden machtlose junge Frauen verschwinden.
»Ich bin stolz auf dich«, sagte Jan. »Phönix aus der Asche ist lächerlich im Vergleich zu dir.« Diesmal wollte er sich zu ihr herüberbeugen, um sie zu küssen, doch dazu kam es nicht.
Jan stieß einen gepressten Laut aus, der sich wie »Shit« anhörte, und stieg hart auf die Bremse.
Rica wurde in den Gurt gepresst, Ragna gegen die Rückenlehne der hinteren Sitzbank. Natürlich war auch der Hund angeschnallt, sodass er nicht durch den Wagen fliegen konnte.
Vor ihnen auf der Autobahn leuchteten die Bremsleuchten aller Fahrzeuge auf, ein kreischendes Rot, in dem die Regentropfen wie Blut erschienen. Autos schlingerten auf der nassen Fahrbahn, eines touchierte die Mittelleitplanke und wurde zurückgeschleudert. Damit war das Chaos perfekt. Wagen krachten ineinander, stellten sich quer zur Fahrbahn, eines holperte rechts die Böschung hinunter und überschlug sich.
Rica schrie auf und stemmte die Hände gegen das Armaturenbrett.
Jan kurbelte am Lenkrad, spielte mit Bremse und Kupplung und versuchte, sie unbeschadet durch das wie aus dem Nichts entstandene Chaos zu lavieren. Rica spürte, wie das Heck des massiven Defender einen anderen Wagen touchierte, und fürchtete, Jan könnte die Kontrolle verlieren. Instinktiv wollte sie die Augen schließen, kämpfte jedoch dagegen an. Es hatte eine Zeit in ihrem Leben gegeben, da hatte sie die Augen zuerst vor der Gefahr und später aus Scham geschlossen, und sie hatte sich geschworen, das niemals wieder zu tun.
Es bestand ein Zusammenhang zwischen Wegschauen und der ungehemmten Entfaltung des Bösen auf der Welt.
Und weil sie hinsah, bemerkte Rica den Körper, der vielleicht zwanzig Meter vor ihnen durch die von rotem Licht und Wasser gesättigte Luft flog, auf der Motorhaube eines Fahrzeugs aufprallte, seitlich fortgeschleudert und von einem weiteren Wagen überrollt wurde.
Wieder schlug sie sich eine Hand vor den Mund, aber diesmal war blankes Entsetzen der Grund, und sie konnte das halb erstickte Geräusch nicht zurückhalten.
Jan brachte den schweren Wagen zum Stehen.
»Bleib sitzen!«, warnte er und behielt den Rückspiegel im Auge. Von hinten näherten sich immer noch Fahrzeuge in hoher Geschwindigkeit, und es bestand die Gefahr, dass sie in die Unfallstelle hineinrasten.
Ragna winselte und reckte die Schnauze über die Sitzbank.
»Alles gut, ist gleich vorbei«, beruhigte Jan ihn.
Rica spürte, wie sie am ganzen Körper zu zittern begann.
Jan ergriff ihre Hand. »Alles in Ordnung bei dir?«
Sie nickte und schluckte einen Kloß im Hals hinunter. »Hast du … den Körper …?«
Jan drückte ihre Hand fester. »Ja, ich hab’s gesehen. Bleib hier bei Ragna, ja? Ich schaue, was ich tun kann.«
Rica nickte, und nach einem erneuten Blick in den Rückspiegel stieg Jan aus. Er ließ die Tür geöffnet, sah sich um und ging zu der Stelle hinüber, an der der Körper liegen musste.
Jan spürte seine Schritte langsamer werden. Jeder einzelne fiel ihm umso schwerer, je näher er dem Körper kam, der dort auf der Fahrbahn lag.
Um ihn herum herrschte Chaos. Es roch nach verbranntem Gummi, heißer Kühlflüssigkeit und Motoröl. Jens sah demolierte Autos, er schritt über Glassplitter von zerstörten Scheinwerfern und Windschutzscheiben. Inzwischen waren etliche Menschen ausgestiegen, die meisten standen herum, wirkten orientierungslos und verstört, andere halfen denen, die in ihren Autos eingeklemmt oder zu schwer verletzt waren, um aussteigen zu können – nur um diesen Körper wollte sich niemand kümmern.
Es war klar, dass die Person einen solchen Aufprall nicht überlebt haben konnte.
Wahrscheinlich ein Selbstmord, dachte Jan. Warum sonst sollte jemand auf eine stark befahrene Autobahn laufen?
Der Regen durchnässte Haar und Kleidung, und Jan begann zu frieren. Die Kälte hatte ihren Ursprung jedoch in seinem Inneren. Wieder einmal war er mit dem Tod konfrontiert, auch wenn diesmal ein Unfall dafür verantwortlich war und nicht er selbst – oder eines dieser Monster, die die Welt bevölkerten.
Auf der rechten Seite der Autobahn befand sich eine Raststätte. Jens sah die hell erleuchtete Tankstelle, das Restaurant und den Parkplatz, der mit Vierzigtonnern zugestellt war. Einige Leute kamen trotz des miesen Wetters aus dem Restaurant herübergelaufen. Handys blitzten auf.
Gaffer. Wie Jan die hasste! Sollte es einer von denen wagen, hierherzukommen, um ein Foto von der Leiche zu seinen Füßen zu machen, würde er sein blaues Wunder erleben.
Jan senkte den Blick.
Der Leichnam sah unsäglich klein, verloren und abstrus verbogen aus. Ein junges Mädchen, sicher noch keine zwanzig Jahre alt, in engen Bluejeans und einer blauen Steppjacke, die überall aufgerissen war und aus der weißes Füllmaterial quoll, hier und dort mit Blut getränkt. Sie trug keine Schuhe und am rechten Fuß auch keine Socke mehr. Da sie auf dem Rücken lag, konnte Jan sehen, was von ihrem Gesicht übrig geblieben war. Die komplette rechte Seite des Schädels lag frei. Blanker, hell schimmernder Knochen, von dem der Regen die letzten roten Schlieren wusch.
Hoffnung, ihr helfen zu können, hatte Jan nicht, dennoch ging er auf die Knie und legte zwei Finger an die Halsschlagader des Mädchens.
Kein Puls, natürlich nicht, was hatte er …
Plötzlich ging ein heftiges Zucken durch den zerstörten Körper, eine Spastik, unter der sich die Hüfte emporbog, und obwohl Jan erschrak und zurückwich, sah er, wie sich die Lippen der Totgeglaubten bewegten.
Sie sprach zu ihm.
Jan beugte sich vor und ergriff ihre Hand, die sie nach ihm ausstreckte.
»Die Grube …«
Mit diesen Worten auf den Lippen starb sie wirklich.
Dann öffnete sich ihre Hand und offenbarte ein Stück zusammengeknülltes weißes Papier.
6.
Martin Eidinger rannte die dreihundert Meter bis zur Kreuzung, an der die Tankstelle lag. In alle Richtungen sah er sich nach seinem Kind um, doch die Straßen waren verwaist, niemand mehr unterwegs bei diesem Dreckswetter.
Wenn Lydia nicht so nachdrücklich gewesen wäre, wenn sie nicht diese Schuldgefühle in ihm ausgelöst hätte, hätte er zu Hause auf seine Tochter gewartet. Sicher hockte sie in diesem Moment in einem warmen Zimmer auf dem Bett einer Freundin, wenn es sein musste, auch in den Armen eines Jungen, und klagte ihr oder ihm ihr Leid, schimpfte über ihren Vater. Lydia wollte das nicht glauben, aber welche Eltern wussten schon alles von ihren pubertierenden Kindern? Vielleicht täuschte Lydia sich, und ihre Tochter hatte in der Kürze der Zeit doch schon Freundschaften geschlossen.
Allerdings wusste Martin als Journalist, wie es in der Welt zuging. Er hatte Artikel über verschwundene Menschen geschrieben. Über die Strukturen, in denen Leben Ware bedeutete, die zu Geld gemacht werden konnte. Über Menschenfänger, die Ausschau hielten und zugriffen, wenn sich eine Gelegenheit bot.
Außer Atem erreichte Martin die Tankstelle.
Sie war verwaist, kein einziges Auto stand an den Tanksäulen. Unter dem Vordach schüttelte er den Regen ab, betrat den Verkaufsraum und entdeckte hinter der Kasse einen älteren Herrn im Rentenalter. Zwar hatte Martin hier schon einige Male getankt, diesen Mann aber nicht in Erinnerung. Vielleicht arbeitete er nur nachts.
Neugierige Blicke empfingen ihn.
»Mein Name ist Martin Eidinger …«, begann er.
Der alte, weißhaarige Mann mit dem kugelrunden Bauch nickte. »Ich weiß. Der neue Redakteur. Aus Frankfurt, nicht wahr.«
Da klang ein wenig Misstrauen mit, so als sei man per se verdächtig, wenn man aus einer größeren Stadt hierherzog. Vielleicht lag es aber auch an Martins Aussehen. Nass, gehetzt und verängstigt. Nicht unbedingt wie jemand, der die Kasse ausrauben wollte, aber sicher auch nicht vertrauenswürdig.
»Ich suche meine Tochter.«
»Hier? In der Tankstelle?« Der alte Mann zog eine Augenbraue hoch.
»Nein, nicht hier … sie wollte ins Level24, aber da ist sie nicht, und da habe ich gedacht, dass Sie sie vielleicht gesehen haben. Sie muss hier entlanggekommen sein.«
»Wann?«
»So vor einer Stunde. Vielleicht anderthalb.«
»Hm. Da war ich schon hier. Wie alt ist denn Ihre Tochter?«
»Siebzehn.«
»Ach, diese Teenager«, sagte der Mann und machte eine abwertende Handbewegung. »Kommen hier rein, bevor sie rüber ins Level24 gehen, wo es keinen Alkohol gibt. Nehmen einen Volljährigen mit und lassen ihn den Wodka bezahlen, den sie sich drüben in die Cola mischen. Waren bestimmt zehn von denen in den letzten zwei Stunden hier. Wie sieht sie denn aus, Ihre Tochter?«
Martin hatte ein Bild in seinem Portemonnaie, eine Porträtaufnahme von vor zwei Jahren. Da hatte sie noch ihr naturblondes Haar und sah wunderschön aus.
»Jetzt ist ihr Haar dunkel«, sagte er und zeigte das Foto.
Der Rentner betrachtete es eingehend. »Hm … ich kann mich täuschen, aber …«
»Haben Sie meine Tochter gesehen?«
Er schüttelte den Kopf. »Nicht hier drinnen. Aber da ist ein Mädchen die Straße entlanggerannt, ziemlich schnell, so als habe sie es eilig. Ich hab mich noch gewundert, bei dem Wetter und ohne Schirm. Aber die Kids sind heutzutage ja so leichtsinnig.«
»In welche Richtung ist sie gerannt?«, fragte Martin mit vor Aufregung zitternder Stimme.
Der alte Mann zeigte zur Kreuzung. »In die Innenstadt, würde ich sagen … Und mir ist noch etwas aufgefallen.«
»Was?«
»Dieses Wohnmobil.«
»Was für ein Wohnmobil?«
»So ein altes Ding. Das kam aus Richtung Autobahn und ist neben dem Mädchen hergefahren, vielleicht zehn, zwanzig Meter, dann hielt es.«
»Und?« Martins Herz zerriss beinahe. »Sie ist doch nicht eingestiegen, oder?«
Der Mann hinter der Kasse zuckte mit den Schultern. »Ich weiß nicht. Ich musste die Sechs abkassieren und einen Coffee to go rausgeben, und als ich wieder hinsah, war das Wohnmobil fort … und das Mädchen auch.«
7.
Die Grube …«
Noch über dem toten Mädchen hockend, fragte sich Jan Kantzius, was sie damit gemeint hatte. Da war keine Angst in ihrem letzten Blick gewesen, eher Erleichterung, aber die beiden Worte hatte sie mit zitternder Stimme ausgesprochen. Für einen kleinen Moment hatte es nur sie und ihn gegeben, ein intimer Augenblick in einer abgeschotteten Welt, in dem er der Sterbenden ein letztes Geleit gewährt hatte.
Die Grube …
Bevor Jan Privatermittler geworden war, war er Polizist gewesen, und schon immer hatte er über einen ausgeprägten Jagdinstinkt verfügt. Der war nun geweckt.
Jan nahm das zusammengeknüllte Papier aus der Hand des toten Mädchens.
Es war warm und feucht, so als habe sie es länger in der Hand gehalten und ihre kleine Faust ganz fest geschlossen, damit sie es auf keinen Fall verlor. Selbst der heftige Aufprall, der Schock und die Schmerzen hatten die Hand nicht öffnen können.
Ihm jedoch hatte sie ihr Geheimnis offenbart.
Jan faltete die Papierkugel auseinander. Es befanden sich Blutflecken darauf. Das Stück Papier hatte die Größe einer DIN-A5-Seite und war wohl von einem Block abgerissen worden. Auf der Innenseite befand sich eine Bleistiftzeichnung mit einigen eilig hingekritzelten Worten.
Es war zu dunkel, um sie zu entziffern, außerdem wollte Jan den Zettel nicht dem Regen aussetzen, also faltete er ihn und steckte ihn ein. Als ehemaliger Polizist wusste er natürlich, dass er eigentlich nichts vom Unfallort mitnehmen dürfte, aber wenn er den Zettel daließe, würde der Regen die Zeichnungen und Worte unleserlich machen. Er nahm sich vor, ihn später der Polizei zu übergeben.
Er schloss dem toten Mädchen die Augen, und der intime Moment, der sie für immer miteinander verband, war vorbei. Der schützende Kokon löste sich auf, und das Chaos der Welt drang wieder zu ihm durch.
Jan richtete sich auf und sah sich um.
In einem weißen Kleinwagen ein Stück voraus rief eine Frau um Hilfe und winkte aus dem offenen Fenster der Fahrertür. Jan eilte zu ihr. Was auch immer hinter dem Tod des Mädchens steckte, die Aufklärung musste warten. Hier gab es Menschen, die jetzt Hilfe brauchten.
Die Frau war vielleicht vierzig Jahre alt, blutete aus einer Wunde an der Stirn, und ihr Wagen sah nicht so aus, als würde er je wieder irgendwohin fahren.
Jan fragte sie nach ihrem Namen. Sie hieß Anna. Die Frage nach weiteren Verletzungen oder Schmerzen verneinte sie.
»Bitte, holen Sie mich hier raus, ich will nicht verbrennen.«
»Keine Angst, Anna, es gibt hier kein Feuer.«
Jan probierte die Fahrertür, doch der Wagen war verzogen, die Tür klemmte, ebenso auf der Beifahrerseite. Da Anna immer panischer wurde und in Tränen ausbrach, stemmte Jan einen Fuß gegen die B-Säule des Wagens und riss mit aller Kraft an der Fahrertür. Nach dem dritten Versuch löste sie sich aus der Sperre, sprang auf, und Jan landete hart auf dem Hintern.
Anna löste den Sicherheitsgurt und krabbelte aus ihrem zerstörten Wagen.
Jan erhob sich und half ihr auf die Beine.
Kaum standen sie, sich gegenseitig festhaltend, erhellte Feuerschein den Himmel hinter der Autobahnraststätte, gefolgt von einer heftigen Druckwelle.
Anna zuckte zusammen, klammerte sich an ihn und begann zu wimmern.
»Feuer, ich hab es doch gewusst … es brennt.«
Die Menschen am Unfallort wandten ihre Blicke dorthin, Jan sah zwischen den Bäumen Flammen aufsteigen, hoch und wild flackernd, bevor sie wieder kleiner wurden. Zudem entdeckte er Einsatzlichter von Polizeifahrzeugen, die sich aber nicht näherten, sondern an Ort und Stelle blieben.
Was war hier los?
Ein terroristischer Anschlag?
Drohte etwa immer noch Gefahr?
»Anna, kann ich Sie allein lassen?«, fragte er. »Ich muss zu meiner Frau.«
»Nein, bitte nicht!«
Jan spürte, wie sich ihre Finger in seinen Oberarm krallten.
Eine Frau um die sechzig, die die Szene beobachtet hatte, kam auf sie zu. »Ich kümmere mich, gehen Sie nur«, bot sie an.
Jan überließ ihr dankbar die Frau und rannte zwischen den kreuz und quer stehenden Wagen zurück. Auf halber Strecke kam ihm Rica entgegen, Ragna an der kurzen Leine. Trotz des Stresses, den der Wolfshund sicher verspürte, ging er ruhig neben ihr her.
»Alles in Ordnung?«, fragte Jan.
»Ragna wollte nicht mehr im Wagen bleiben. Er hat gebellt wie verrückt, und dann explodierte dort hinten plötzlich dieser Feuerball. Was ist denn hier los?«
Jan zuckte mit den Schultern. »Ich weiß es nicht, aber es sieht so aus, als ob ein Vorfall auf der Raststätte etwas mit der Person zu tun hat, die auf die Fahrbahn gelaufen ist.«
»Ist sie tot?«
Jan nickte. Er zog Rica zu sich heran und erzählte ihr flüsternd von der jungen Frau, die vor seinen Augen verstorben war, von ihren letzten Worten und dem Zettel in ihrer Hand.
»Die Grube?«, wiederholte Rica und wurde im nächsten Moment von Sirenengeheul unterbrochen.
Rettungsfahrzeuge näherten sich der Unfallstelle von der Raststätte her, die wohl eine Verbindung zu einer Land- oder Bundesstraße hatte. In wenigen Minuten würden genug Notfallsanitäter und Rettungsärzte vor Ort sein, und wahrscheinlich würde es noch Stunden dauern, bevor sie weiterfahren konnten.
»Lass uns zur Raststätte gehen und nachschauen, was los ist«, schlug Jan vor.
Sie schoben sich zwischen den Autos hindurch, überwanden eine Leitplanke und erreichten das Gelände der Raststätte. Zahlreiche Menschen kamen ihnen mit gezückten Handys entgegen, einige drehten sich in die andere Richtung, weil sie sich für das Feuer interessierten.
Jan spürte nach wie vor Verachtung für diese Gaffer, fragte sich im nächsten Moment aber, ob er sich nicht genauso verhielt. Immerhin verließ er zusammen mit Rica gerade den Unfallort, weil er wissen wollte, was hier passiert war. Andererseits ließen ihn die letzten Worte des Mädchens nicht los.
War sie auf die Autobahn getrieben worden?
Hatte sie jemand verfolgt?
Rettungswagen fuhren mit Blaulicht und eingeschaltetem Signalhorn in verkehrter Richtung auf der Abfahrt an ihnen vorbei zur Unfallstelle. Feuerwehr, Ambulanz, Polizei.
Zwei Fahrzeuge fuhren jedoch zu dem Feuer hinüber.
Ihnen folgten Jan und Rica. Ragna wurde wegen der Geräusche zunehmend nervöser, hielt sich aber gut.
Zwischen den geparkten Lkw fiel Jan eine Gruppe Männer auf. Trucker wahrscheinlich. Sie trugen gemütliche Kleidung, so als seien sie gerade eben aus den Kojen gekrochen, hatten aber reflektierende Regenjacken übergeworfen. Sie unterhielten sich lautstark gestikulierend, Wortfetzen wehten zu Jan und Rica herüber.
»... auf mich geschossen …«, hörte Jan heraus und sah, wie einer der Männer, ein gedrungener, beleibter Typ, auf eine Stelle am Führerhaus eines Lkw zeigte.
Jan hielt auf die Gruppe zu. Rica blieb mit Ragna hinter ihm.
»… die wurde verfolgt …. ich wollte dem Mädchen helfen, aber die war total in Panik und ist in Richtung Autobahn abgehauen … ich konnte echt nichts machen.«
Das Einschussloch am Lkw bewies, dass der Mann wohl die Wahrheit sagte.
Aus einem weißen Handwerkerwagen, auf dessen Flanke »Haus und Hof, Dienstleistungen« stand, stieg ein Mann in Handwerkerkleidung und kam auf die Gruppe zu. Er fuchtelte aufgeregt mit den Händen und sagte, er habe den Mann genau gesehen, der geschossen hatte. Das Mädchen sei in Richtung Autobahn geflohen und der Mann dorthin gelaufen, wo es jetzt brenne.
Jan sprach den Handwerker an. »Wie sah der Schütze aus?«
»Weiß nicht, keine Ahnung, es ist ja dunkel, dazu dieser Scheißregen … das ging alles so schnell … Scheiße, mir klopft immer noch das Herz …«
»Sie haben ihn aber doch gesehen!«
»Ja … sicher … ich glaube … groß war er, auf jeden Fall groß, so wie Sie, und er hatte einen Vollbart und dunkle Haare …«
»Die Kleidung?«
»Kleidung … Scheiße, ich weiß nicht … ’ne Winterjacke halt … Aber ich hab genau gesehen, wie er dahin gelaufen ist, wo es jetzt brennt …«
»Bleiben Sie hier«, sagte Jan. »Ihre Aussage ist wichtig, die Polizei wird mit Ihnen reden wollen.«
Die aufgeregte Unterhaltung der Kraftfahrer würde noch eine ganze Weile nicht verstummen, und so, wie es immer lief, würde die Wahrheit Krebsgeschwüre bekommen und zu einer Geschichte heranwachsen, die nicht mehr viel zu tun hatte mit dem, was hier passiert war. Deshalb waren Zeugenaussagen stets mit Vorsicht zu genießen.
Jan ging zurück zu Rica und zog sie und den Hund zwischen die geparkten Lkw.
»Was geht hier vor? Hat das etwas mit dem Unfall zu tun?«, fragte Rica.
»Angeblich wurde auf das Mädchen geschossen«, sagte Jan und starrte Richtung Wäldchen, wo das Feuer langsam kleiner wurde. »Der Schütze soll dorthin gelaufen sein, ehe es zur Explosion kam. Eigentlich geht es uns ja nichts an …«
»Nein. Aber du willst nachschauen gehen, oder?«
Jan konnte seiner Frau nichts vormachen. Das lag nicht etwa daran, dass sie schon so lange verheiratet gewesen wären, denn das waren sie nicht, sondern an ihrer Fähigkeit, in ihm zu lesen wie in einem offenen Buch. Oft wusste sie, was er dachte und wie er sich entschied, bevor es ihm selbst klar war.
Weitere Worte waren nicht nötig.
Rica folgte ihm mit Ragna an der Seite.
Sie näherten sich einer Dienststelle der Autobahnpolizei, kamen jedoch nicht weit, da der Bereich großräumig abgesperrt war. Ein paar wenige Beamte sicherten die Absperrung.
Im Hintergrund, durch Bäume verdeckt, loderte noch immer das Feuer, war aber schon deutlich schwächer geworden. Es roch stark nach verbranntem Gummi.
Bei dem Fahrzeug, so viel konnten sie erkennen, handelte es sich um ein Wohnmobil.
8.
Martin Eidinger rannte die Straße Richtung Innenstadt hinunter. Dorthin war seine Tochter laut den Worten des Tankstellenmitarbeiters gegangen – und dorthin war ihr angeblich dieses schäbige alte Wohnmobil gefolgt, das schließlich neben ihr gehalten hatte.
An der Stelle, die der Mann ihm gezeigt hatte, blieb Martin stehen.
Er hatte immer Romanautor werden wollen, und auch wenn es letztlich nur für einen Job bei einer Provinzzeitung gereicht hatte, bei der er in den nächsten Jahren über Schützenfeste, Fußballturniere und Vorstandssitzungen des örtlichen Taubenzüchtervereins berichten würde, so hatte er doch genug Fantasie, sich die Szene vorzustellen, die der Mann an der Tankstelle beobachtet hatte.
Dunkelheit, Regen, ein wütendes siebzehnjähriges Mädchen rennt die Straße hinunter, verfolgt von einem schäbigen Wohnmobil, die Bremslichter leuchten rot auf, das große Gefährt verdeckt das Mädchen … und dann?
Und dann?
Hatte der Fahrer nur nach dem Weg gefragt? War seine Tochter eingestiegen? Aber warum sollte sie das tun? Martin und Lydia hatten sie immer wieder auf die Gefahren hingewiesen, die einem jungen Mädchen drohten.
Sein Handy brummte in der hinteren Hosentasche, und Martin zog es hervor. Lydia.
»Ich kann Leila einfach nicht erreichen, sie geht nicht an ihr Handy. Ich habe so große Angst! Martin, wo bist du?«
»Ich suche nach ihr.«
»Geh zur Polizei, sofort! Da ist etwas passiert, ich spüre das.«
Martin wagte es nicht, ihr von den Beobachtungen des Kassierers zu erzählen. Lydia war aufgewühlt und allein und würde vielleicht eine Panikattacke bekommen.
»Okay, schon gut, ich bin sowieso Richtung Innenstadt unterwegs und gehe sofort zur Polizei. Aber beruhig dich, bitte, ich glaube nicht, dass etwas passiert ist. Es wird eine ganz harmlose Erklärung für all das geben.«
Martin legte auf und steckte das Handy ein.
Da er vor wenigen Tagen bereits einmal einen Polizisten wegen eines Verkehrsunfalls befragt hatte, wusste er, wo sich die Polizeidienststelle befand. Sollte er wirklich alle Pferde scheu machen auf die Gefahr hin, dass er sich blamierte, weil seine Tochter ihm wegen des Streits einfach nur einen Denkzettel verpassen wollte? Die Polizisten würden ihn wahrscheinlich nicht ernst nehmen, wenn er von dem Streit berichtete.
Unschlüssig drehte Martin sich im Kreis, und sein Blick fiel auf den Grünstreifen am Fahrbahnrand. Dort lag etwas, das er zu kennen glaubte.
Martin bückte sich und hob es auf.
Er hatte sich nicht getäuscht. Es war der Schal, den seine Mutter für ihr Enkelkind gestrickt hatte.
9.
Jan und Rica drangen bis zu der Dienststelle der Autobahnpolizei vor. Ein heruntergekommenes Flachdachgebäude ohne Beleuchtung, das wohl nicht mehr in Benutzung war. Sie gaben sich einem der uniformierten Polizisten als Zeugen zu erkennen. Er bat sie, zu warten. Also standen sie eine halbe Stunde in dem kalten Nieselregen, bis ein Beamter in Zivil auf sie zukam. Er trug einen knielangen schwarzen Mantel aus Schurwolle, an dem die Regentropfen einfach so abperlten. Sein grau meliertes Haar war an den Seiten kurz und oben füllig, hinter den Brillengläsern, die in einem feinen, silbernen Rahmen steckten, erkannte Jan die hellwachen, intelligenten Augen von Arthur König.
»King Arthur!«, stieß Jan aus. Er war nicht erfreut, ausgerechnet diesen Beamten hier zu treffen.
Ragna auch nicht. Ohne ersichtlichen Grund bellte er den Mann an, und als Rica ihn zur Ordnung rief, behielt der Hund ein leises Knurren bei, das tief in seiner Kehle entstand.
Mit den Händen in den Taschen blieb der Hauptkommissar hinter der Absperrung stehen. Sein Blick wechselte von Jan zu Rica und zurück.
»Jan Kantzius, ich bin überrascht – und das an einem Abend voller Überraschungen.«
Jan stellte ihm Rica vor, denn die beiden waren einander noch nicht persönlich begegnet. Jan hatte seiner Frau aber von seinem ehemaligen Kollegen erzählt, der wegen seines Namens oft als King Arthur angesprochen oder wahlweise verspottet wurde, je nachdem, wer das Wort führte. Arthur König hatte einen messerscharfen Verstand und wusste ihn einzusetzen, darüber hinaus war er belesen, rhetorisch geschickt und immer gut gekleidet. Manch einer warf ihm deshalb Arroganz vor.
Zu Recht, wie Jan fand, allerdings nicht aus diesen Gründen. König hielt sich für unfehlbar und glaubte darüber hinaus, dass seine Position es ihm gestattete, auf andere hinabzuschauen.
»Was macht ihr hier?«, fragte König.
»Wir sind auf der Autobahn in den Unfall geraten.«
»Und warum seid ihr dann nicht bei eurem Wagen geblieben?«
Jan erzählte ihm, was sie vor wenigen Minuten auf der nahe gelegenen Autobahn erlebt hatten.
»Es waren noch keine Polizisten da, deshalb sind wir hierhergekommen«, umschiffte Jan den wahren Grund: Neugier.
»Ein junges Mädchen?«, fasste König nach. »Und sie ist tot?«
Jan nickte. »Sie ist ganz sicher tot. Ich war nah an ihr dran, so nah, dass ich ihre letzten Worte hören konnte.«
»Was hat sie gesagt?«
»Die Grube …«
»Die Grube?«, wiederholte Arthur König, zog die Augenbrauen hoch und nahm seine Brille ab, auf der sich die Regentropfen gesammelt hatten. Er ließ sich Zeit damit, sie abzuwischen und in ein Lederetui zu stecken.
»Wir haben da vorn auf dem Parkplatz die Unterhaltung einiger Trucker mit angehört. Es klingt, als sei das Mädchen verfolgt worden. Jemand hat wohl auf sie geschossen«, sagte Jan und zeigte in die Richtung, in der immer noch die Männergruppe beisammenstand. »Da ist ein Handwerker dabei, der behauptet, den Schützen gesehen zu haben. Den solltet ihr auf jeden Fall vernehmen. Er hat den Mann dorthin laufen sehen, wo es brennt. Weißt du schon, was hier passiert ist?«
Sein ehemaliger Kollege, der einiges von dem wusste, was vor drei Jahren dazu geführt hatte, dass Jan aus dem Polizeidienst ausgeschieden war, sah ihn nachdenklich an, als müsse er sich entscheiden, wie viel er Jan mitteilen durfte. Hätte King Arthur alles von damals gewusst, hätte er nicht nachdenken müssen, dann hätte er Jan sofort abgewiesen.
»Also schön … kommt mit«, sagte König. »Aber behaltet die Dreckstöle unter Kontrolle … ich hasse Hunde!«
Er drehte sich um und ging auf die Dienststelle der Autobahnpolizei zu. Auf halber Strecke wies er einen uniformierten Beamten an, mit den Fernfahrern zu sprechen und sich für eine Vernehmung die Personendaten geben zu lassen. Dann führte er Jan und Rica zu einem Seiteneingang.
»Die Dienstelle ist nicht mehr in Betrieb«, sagte er. »An der nächsten Abfahrt haben sie ein neues, modernes Gebäude errichtet.«
Arthur König führte sie in einen kleinen Raum, in dem es lediglich einen Tisch und vier Stühle gab. Überall lag Staub, es roch muffig.
»Da vorn brennt ein Fahrzeug, ein Wohnmobil, wahrscheinlich mit einer Person darin. Näheres erfahren wir erst, wenn das Feuer gelöscht und die Karosserie ausgekühlt ist. Ich brauche unbedingt deine Aussage – und die deiner Frau natürlich.«
»Sicher, kein Problem. Um wen handelt es sich bei der Person im Fahrzeug?«