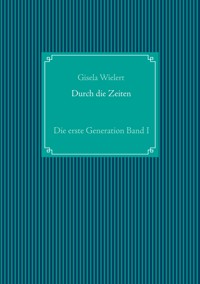Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Amygdala ist eine Sammlung unterschiedlicher Genres wie Kurzkrimis, Märchen für Erwachsene, Fantasy, Liebesgeschichten, Gedichte und ihre Hintergrundgeschichten, Tagebuchaufzeichnungen und reale Geschichten zum Schmunzeln, zum Gruseln, zum Wundern und Staunen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 259
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vollkommene Aufrichtigkeit ist der Weg zur Originalität
(Charles Baudelaire)
Gisela Wielert lernte noch vor Antritt eines geplanten Studiums Fachrichtung Physik mit dem Ziel Gesundheits-Ingenieur ihren Mann kennen und heiratete 1971. Das Paar hat einen Sohn und lebt auf dem Lande in der Nähe Lübecks.
Beruflich war sie als Arztsekretärin, zwischenzeitlich Chefarztsekretärin an der Uni Lübeck tätig. Nebenberuflich arbeitete sie 10 Jahre als Buchhalterin für bis zu 4 Restaurants gleichzeitig. Von 1998 bis 2016 war sie Managerin einer Klinik für Ästhetisch-Plastische-Chirurgie.
Ihre Schreibbegeisterung begann früh. Seit ihrem 17. Lebensjahr sind circa 100 Gedichte entstanden, viele Kurzgeschichten, Tagebuchaufzeichnungen mit Schreibmaschine ohne Seitenzahl, 2,3 kg und Essays. Ein Kinderbuch für ihr Enkelkind.
Bisher erschienen im Buchhandel:
Durch die Zeiten (Band I Die erste Generation) 2017 im Februar
Samba für Charles B. Lyrik im August 2017
Durch die Zeiten (Band II Die Junge Generation) 2018 im Mai
Kontakt. [email protected]
Facebook, Instagram, Twitter
Inhaltsverzeichnis
Magdas Hahn
Die beinahe biographiefreie Elfriede Maruschke
Damals (Gedicht)
Die Geschichte zum Gedicht „Damals“
Frau Lindners Erwachen
Unbehagen
Sollte ich mit 35 meinen ersten Roman aufgeben
Nachtwache
Aus dem Tagebusch, 18. Juli 1985, 21.30 Uhr
Hilla und die Erinnerung an die Kuba Krise
Schachbrettspiele
Ein vorstellbares Leben danach
Traumfach
Irgendwann war da dieser Traum (Gedicht)
Die Geschichte zu dem Gedicht: Irgendwann war da dieser Traum
Verwandlungen
Falldreher
Aufgesessen
Hexe Malu
Verbindungen
Winter trifft Sommer
Der schwarze Wagen
Grauen
Annerose
Die Mitternachtsfrau
Des Wichtes Liebesträume
Die monströse Modeschöpfung
ICE Mainz-Hamburg
Über die Aufhebung des Schwimmverbotes
Schreibwerkstattgeplauder über den Roman: Durch die Zeiten
Magdas Hahn
Jeder der sie kannte, sagte ihr nach, sie sei ein wenig dumm. Und vielleicht stimmte das sogar. Mit achtzehn Jahren bekam sie die erste Tochter und mit neunundzwanzig die fünfte und blieb danach kugelrund. Kugelrund waren auch ihre ständig roten Wangen und ihre strahlend blauen Augen. Dabei gab es nicht viel, worüber sie sich hätte freuen können; es schien vielmehr so, als sei sie die Freude selbst.
Jeden Sonntag, und nicht nur am Sonntag, betrank sich ihr Mann in der Gastwirtschaft. Kam er nach Hause, begann er zu stänkern und zu schimpfen und wenn er sich ausgepöbelt hatte, schlief er seinen Rausch aus. Dann weinte Magda und betete zu Gott: „Lass ihn sich tot saufen, lieber Gott, damit mir auch noch ein wenig Zeit zum Leben bleibt.“ Aber Gott hörte sie nicht und es gab überhaupt niemanden, der sie wahrnehmen wollte. Die Jahre vergingen und sie tat still und fügsam, was getan werden musste: im Haus, im Stall, im Hühnerhof und im Garten. Die Töchter wuchsen heran, heirateten, zogen aus und bekamen selber Kinder. Und schließlich, als Magda einundfünfzig Jahre alt war, verliebte sie sich in einen Hahn. Er war jung, stark, sehr schön und aggressiv. Einzig Magda zähmte ihn. Wenn sie ihn rief, gehorchte er ihrer Stimme, kam zu ihr, pickte ihr artig Körner aus der Hand. Ging sie im Hühnerhof auf und ab um Futter auszustreuen, folgte er ihr wie ein manierliches Hündchen. Und immer häufiger nahm sie ihn mit ins Haus. Dann saß er in ihrer Küche und sah ihr bei der Arbeit zu. Das fand sie schön. Ihr Mann duldete ihn, weil nicht selten ein Tier vorübergehend in der warmen Küche untergebracht werden musste. Mal war es ein Ferkel, frisch und rosig von der Muttersau verstoßen, mal waren es Küken, in zu wetterrauen Tagen geschlüpft.
Magdas Küche war Lebenszentrum. Auf ihrem riesigen Herd, unter dem das Feuer nie ganz ausging, kochte in einem Topf der Kohl und in einem anderen weiße Wäsche. Über ihrem Arbeitstisch hing ein gusseisernes Gestell, auf dem ein Radioapparat stand. Eines Tages nahm sie das Gerät herunter und setzte den Hahn an seiner statt. So hoch über ihrem Kopf entfaltete sich seine Schönheit zu ganzer Vollendung. Sein prächtiges blütenweißes Gefieder, sein leuchtend brandroter Kamm und sein Blick, stolz und gepaart mit herablassender Würde, ähnelte dem eines Adlers. Dort nun, in der Höhe, verbrachte er viele Tagesstunden. Kam Magdas Mann zum Essen in die Küche mit Beschimpfungen und Flüchen, gebärdete sich der Hahn wie toll, krähte und blähte sich auf.
„Das Tier steht mir bei“, sagte Magda dann, holte ihn vom Gestell, setzte ihn auf einen freien Stuhl und fütterte ihn mit Essensresten. Das war eine schöne Zeit für Magda, weil ihr Mann sich allmählich dreinschickte, bei Tisch leise zu sein. Kam er abends in die Stube, schlief er vor lauter Trunkenheit fast schon im Stehen. Und war er erst einmal so betrunken, gab es auch keine bösen Worte mehr und keine hässlichen Vorwürfe wegen ihres armen kugelrunden Bauches, der es nicht geschafft hatte, daraus einen Hoferben zu entlassen.
Es sollte Ostern werden und regelmäßig zu Ostern kam Ida angereist, eine entferntere Verwandte, die weit im Osten lebte. War sie da, ging sie, einer eigen aufgestellten Tradition gehorchend, erst einmal in den Stall um zu staunen, in die Hände zu klatschen und mit durchdringend heller Stimme ihrer Begeisterung Ausdruck zu verleihen: „Allmächtiger Vater, mein Josefchen, was hast für feine fette Schweinchen und so ganz sinnlos stahn hier rum, was bleedsinnig, kennt man die scheen essen.“ „Ne, ne, Ida, missen noch wachsen, aus dem Kopp schlach se dich, nich een davon geht über die Bank.“ Sagte darauf Magdas Mann und ließ nicht mit sich verhandeln. Dann inspizierte Ida die Küche, sah den Hahn und fiel in Ekstase. Den wollte sie haben, wenn der Josef schon zu geizig war ein Ferkelchen für sie, die Ida zu opfern, dann sollte es wenigstens ein Brathähnchen geben „und recht scheen gefillt mit Äpfeln und Rosinen, dass man meinen kennt, es wäre eine Gans.“ Und Rotkohl sollte es dazu geben, Rotkohl sei wichtig für die Illusion, darauf müsse sie bestehen. Und sie redete und redete. Und dann packte Josef den Hahn und schlug ihm draußen auf dem Holzbock den Kopf ab. „Hier Ida, den schenk ich dich, war nur ein ganz mistiges Viech“, sagte er und schmiss ihn blutend und zappelnd auf den Küchentisch.
Magda war immer eine stille bescheidene Frau gewesen, hatte getan, was es Notwendiges zu tun gab. Nun schickte sie Ida und Josef aus der Küche. Sie würde schon eine gute Mahlzeit richten, versprach sie, Ida und Josef würden schon zufrieden sein. Dann war sie allein.
Beim Mittagessen sprach Magda wie gewöhnlich nicht viel und legte sich nur 2 Kartoffeln auf den Teller, ganz satt sei sie vom vielen Abschmecken, sagte sie und Ida und Josef war es nur recht. Sie teilten sich den Hahn und aßen Unmengen Füllung und Rotkohl dazu. Sie aßen so viel, dass sie sich hinterher kaum rühren konnten. „Die Magda“, lobte Ida, „is ne feine Kechin, schad nur, dad se keenen Jungen hat kriegen kennen.“ Und dann wurde ihr schrecklich schlecht. Josef ging hinaus, einen Schnaps zu holen, er schenkte ein, sie tranken und dann wurde ihm auch sehr übel. Magda schenkte die Gläser noch einmal voll. „Trinkt“, sagte sie „ihr habt euch überfressen.“ Ida und Josef tranken und rutschten von den Stühlen, sagen konnten sie nichts mehr, nur stöhnen und sie rissen weit ihre Münder auf. Magda stellte das Radio an. Sie wartete noch ein bisschen, dann holte sie die gewaschenen und über dem Herd getrockneten Hahnenfedern herbei um Ida und Josef damit zu schmücken. „Jetzt sehen sie viel netter aus“, sagte sie.
Magda sah auf die Uhr. Jetzt wollte sie sich aber sputen. Das Geschirr musste abgewaschen und der Tisch frisch zum Nachmittagskaffee eingedeckt werden. Schließlich wollten die Kinder kommen. „Die werden staunen, wenn sie Vater und Ida so schön still und friedlich antreffen“, sagte Magda und war zufrieden, wie lange nicht mehr.
Die beinahe biographiefreie Elfriede Maruschke
Elfriede Maruschke verstarb eher fraktioniert. Nicht im Sinne des sich über eine quälende Wegstrecke vollziehenden Krankenlagers. Nein, sie hätte rein theoretisch vor Jahren schon einem Herzinfarkt erlegen sein können, später einer heftigen Virusinfektion und dann gab es noch diesen unvermittelten Schlaganfall. Jene drei an sich bösartigen Lebensirritationen schadeten ihr nicht in der Intensität, indem sie ihrem Dasein ein Ende bereitet hätten. Trotz der bedrohlichen Phasen erholte sie sich vollständig und feierte Jahr für Jahr ihren Geburtstag. Der 84. war dann doch der letzte und sie starb völlig unspektakulär. Sie legte sich abends in ihr Bett und stand am Folgetag nicht wieder auf. Damit hatte niemand zu diesem Zeitpunkt gerechnet, weswegen die Bestürzung über ihr Ableben eher sehr hoch ausfiel.
Zehn ihrer letzten Lebensjahre hatte Elfriede in einem Pflegeheim zugebracht. Nicht etwa, weil sie Hilfe beim An- und Auskleiden brauchte oder schlecht zu Fuß war, nein, es war ihr Kopf, der einerseits eigenwillige Lebensvorstellungen entwickelte, ihren Schlaf-Wach-Rhythmus beeinflusste und andererseits sie vergessen ließ, wie Nachbarn und Enkelkinder hießen. Elfriede wurde zu einer begeisterten Heimbewohnerin, weil sie hier Unterhaltungsmöglichkeiten entdeckte, die sie trotz vieler Besucher zu Hause nicht hatte. Gleichzeitig war sie dort unter eine unauffällige, aber Gefahren abwendende Kuratel gestellt, die ihr eine laienhaft familiäre Pflegschaft nicht hätte bieten können.
Ohne je eine eifrige Vertreterin ihres evangelischen Glaubens gewesen zu sein, gehörte sie der Kirchengemeinde an und der Pastor ihres Heimatortes stattete der Familie einen Trauerbesuch ab, der letztlich auch dazu dienen sollte, die Biographie der Verstorbenen zu verinnerlichen.
Der Geistliche unterscheidet sich dabei in seiner Vorgehensweise nicht wesentlich von einem Medienvertreter, dessen vornehmstes Ziel darin besteht, die Persönlichkeit eines Menschen durch eindrucksvolle Wortwahl wirkungsvoll zu unterstreichen.
Er wurde traurig und zugewandt von Elfriedes Sohn und Schwiegertochter empfangen, mit Kaffee und Gebäck bewirtet und die Rede zwischen ihnen floss hin und her. Der behagliche Platz in dem Wintergarten des Paares ließ den geistlichen Herrn beinahe seine Jugendgruppe vergessen, die er flugs zu betreuen hatte.
Am späteren Abend saß er fassungslos sinnend über seinen Aufzeichnungen, die aus Elfriedes Geburts- und Sterbedatum bestanden, eine Schneiderlehre aufwiesen, frühen Eheschluss ohne Berufstätigkeit, Erziehung eines Sohnes. Hobbys gab es keine, vielleicht ein gewisses Interesse für klassische Musik, das eher dem bereits früher verstorbenen Gatten zugewiesen werden musste. Die Enkelkinder waren in einer anderen Stadt großgeworden. Himmel und lieber Herrgott, was sollte er eine gefühlte halbe Stunde über diese Frau erzählen, deren Biographie so leer war, wie sein Punktestand in Flensburg? Er hatte Fotos von ihr gesehen. Elfriede mit dem Kinderwagen als junge Frau, Elfriede auf einer Geburtstagsfeier, Elfriede mit dreißig Jahren vom Fotografen abgelichtet. Sie war eine bildhübsche Frau. Und auch das Foto am letzten Weihnachten aufgenommen wies sie augenscheinlich als eine in Würde gealterte, aber durchweg schöne alte Dame aus.
Sie liebte das Pflegeheim, weil sie dort gute Unterhaltung gefunden hatte. Worüber mochte sie gesprochen haben? Was bevorzugte sie von ihren Mitbewohnern gehört zu haben? Der jetzt angesichts des großen Nichts verzweifelte Herr Pastor rekapitulierte im Geiste noch einmal das Gespräch mit Sohn und Schwiegertochter der Verstorbenen. Gab es eine nette Anekdote? War sie eine besonders gute Köchin? Hatte sie die eigenen Eltern oder Schwiegereltern in deren Alter versorgt? Nein, nein, nein. Halt! Der Sohn sagte über sie, dass sie immer eine gute Stimmung verbreitete, heiter, nicht lustig wohlgemerkt, heiter war. Besucher und Enkelkinder hätten sich bis zuletzt in ihrer Gesellschaft wohlgefühlt. Ließe sich daraus eine Predigt formulieren?
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen.
Liebe Familie Maruschke, liebe Trauergemeinde, wir sind heute hier zusammengekommen um Abschied von Elfriede Maruschke, geborene Müller zu nehmen. So, jetzt kommen die paar Fakten und Daten die ich habe und dann Elfriede Maruschke verbrachte die letzten zehn Jahre ihres Lebens in einem Pflegeheim. Hier schloss sie Freundschaften und fühlte sich aufgehoben. In diesem Zeitraum überstand sie Krankheiten, die ihr einen sehr viel früheren Tod hätten bescheren können. Nun verstarb sie im Alter von 84 Jahren und niemand hatte damit gerechnet. Sie ging abends ins Bett und wachte am Morgen nicht auf. Einen schöneren Tod können wir uns nicht vorstellen, als im Schlaf überzugehen in das Reich Gottes.
Elfriede Maruschke war eine heitere Frau, die Wohlgefühl auslöste
. Sie, Herr Maruschke sagten mir, jeder wäre gern mit ihr zusammen gewesen. Diese Worte haben mich nachdenklich gemacht. Ich habe mich gefragt, ob man überhaupt etwas Angenehmeres über einen Menschen sagen kann, als, man habe sich in seiner Gesellschaft wohlgefühlt? Was bedeutet das? Für den Besucher das Gefühl der Freude ihm zu begegnen. Dann die köstlichen Momente seiner Gegenwart zu spüren und beim Verlassen das eigene Lächeln im Gesicht auszukosten, weil es ein guter, ein angenehmer Besuch war.
Es gibt diese unglaublichen Menschen, die allein durch ihre Gegenwart in uns das Gefühl von Behagen auslösen.
Was nützt eine Biographie, angefüllt mit Lebensereignissen, die aufgezählt werden? Sie werden ausgebreitet wie Waren aus einem Präsentkorb: Schaut her, das alles hat X gemacht, dafür hat Y ein Bundesverdienstkreuz bekommen. Das sind in Wahrheit Vergänglichkeiten, die in Vergessenheit geraten werden. Aber einen Satz wie: Jeder hat sich in ihrer Gegenwart wohlgefühlt, den wird niemand vergessen, weil er eine schöne Empfindung in uns auslöst. Nicht sein ständiges etwas tun ist das Wesentliche, das einen Menschen ausmacht, sondern seine bloße Existenz. Der Mensch reduziert auf sich selbst, ohne Orden, Auszeichnungen, ohne Lack und Schnörkel kann Glück bedeuten, Freude bringen und letztendlich Frieden schenken. Ein solcher Mensch ist Elfriede Maruschke gewesen.
Gut, dann kommt: Lasst uns beten und dann der Rest. Der geistliche Herr atmete tief ein und dann aus.
Damals
Damals
als der Nachtwind sich sträubte
meine rechte Wange zu küssen
lebte ich zwischen Fis-Dur und H-Moll das ist lange her und
meine Tongabel liegt auf einer Schutthalde begraben oder
sonst irgendwo
jedenfalls ist sie weg und mit ihr das A unzählige Male
brauchte ich es
meine Gitarre auf die Lieder von Joan Baez und Leonhard Cohen einzustimmen
Heute
als der Nachtwind auch vor meiner linken Wange zurückschreckte
besah ich mir gerade den Weltatlas der aus jenen Tagen
stammt
von spitzen Mäusezähnen sind die Ecken weggefressen ein
Stück Nordpol fehlt es
waren 7 Mäuse
und Fallen reizen
hätten sie sich mit meinen Pralinen und eben diesem
Weltatlas zufriedengegeben wäre es ihnen gut ergangen so
fanden sie ihren Tod
nachts hörte ich wie die Fallen ihnen das Genick brachen
schnapp machte es schnapp und das sieben Mal
Und dann hörte der Nachtwind auf meine rechte Wange zu
küssen meine Pralinen blieben ganz Sibirien blieb auch ganz
bis dahin sind sie nicht mehr gekommen ich habe die Fallen
nicht aufgestellt nein
aber ich glaube ich war die einzige die sich etwas dabei dachte
Die Geschichte zum Gedicht „Damals“
Das Zusammenleben mit Mäusen ist prinzipiell problemlos. Es bedarf einer gewissen gegenseitigen Ignoranz und gleichzeitig der bewussten Duldung. Rein praktisch stellt eine solche Wohngemeinschaft den Wirt vor gewisse Schwierigkeiten. Warum? Weil die Hausgemeinschaft Mensch und Maus aus verschiedenen Gründen, zuvorderst hygienischen, von der überwältigenden Mehrheit der Gesellschaft für unvereinbar erklärt worden ist. Aber mir waren im Alter von fünfzehn Jahren keine ernsthaften Bedenken bekannt. Ekel und Abneigung, gar Angst vor Mäusen, die kannte ich selbstverständlich von den einschlägigen Reaktionen der Erwachsenen. Ich selbst dagegen hatte Mäusen gegenüber eher zärtlich beschützenden Gefühlen, die soweit gingen, dass ich einmal eine bereits leicht benommene Maus aus den Fängen einer Katze rettete und sie zu ihrem eigenen Schutz in den Keller meiner Großmutter setzte. Kurz um, ich lebte mit einer unbekannten Anzahl von Mäusen konfliktfrei und in Harmonie. Wie das möglich war?
Mein Elternhaus, ein großer Geschäftsbetrieb, war weitläufig. Zu meinen Zimmern, die aus Wohn- und Schlafraum bestanden, gelangten Besucher über eine Treppe. Wer kam zu mir? Morgens unser Schäferhund mit dem Auftrag mich zu wecken, später die Haushälterin, Frau Altmann, um das Bett zu machen und zu putzen, später am Nachmittag eine meiner Freundinnen, wenn nicht ich zu ihnen ging. Meine Eltern kamen freiwillig nie, außer ich war krank oder hatte mein kleines Wohn-Arbeitszimmer umgeräumt und sie gebeten, das Ergebnis für gefällig zu erklären. Sonst wurde ich nicht besonders beaufsichtigt, da meine soziale Eingliederung im zarten Alter von fünf Jahren nahezu abgeschlossen war. Meine Eltern aßen gerne außer Haus, und ich durfte sie begleiten, weil ich Messer und Gabel zu diesem Zeitpunkt bereits beinahe geräuschfrei auf dem Teller bewegen konnte. Den sekundären Knigge-Unterricht besorgte dann eine Großtante, die es für wesentlich hielt, mir den Umgang mit unserem Personal anzutrainieren. Im Übrigen lebte ich in großer Freizügigkeit und ging ungestört meinen vielschichtigen außerschulischen Vorlieben nach, wozu auch Besuche in der damals noch geschlossenen Zentrale der kommunistischen Partei gehörten, die ich gerne der Ballettstunde oder dem Gitarrenunterricht anschloss.
Die Mäuse wohnten hauptsächlich in meinem Sofa. Deshalb war auch ihrerseits ein hohes Maß von Toleranz gefragt, wenn ich mich mit Schwung dort niederließ. Saß oder lag ich längere Zeit ruhig, benahmen sie sich recht ungeniert, piepsten, tobten, kopulierten gar, was wusste ich? Da Putzen keineswegs zu meinen Aufgaben zählte, war es für mich eine respektable Aufgabe, jeden Morgen ihre Köttl aufzufinden und einzusammeln, sonst wäre unsere Wohngemeinschaft zu Ende gewesen. Es waren auch nicht die Köttl, die für ein Ende des friedlichen Zusammenlebens sorgten. Es war eine Schachtel Pralinen und mein Schulatlas. Beide Gegenstände lagen unter dem Tisch auf einem Metallrost, das nicht so oft gereinigt werden musste. Irgendwann fiel es Frau Altmann auf, dass die Pralinenschachtel angeknabbert aussah und ebenso der Atlas.
Mein Vater: „Gisela, hast du Mäuse im Zimmer?“ „Wieso?“ „Frau Altmann sagt, es liegen angenagte Sachen unter dem Tisch.“ „Ist mir nicht aufgefallen.“ „Na gut, Herr Wenz besorgt Fallen und stellt sie auf.“ Herr Wenz, ein Verkaufsfahrer, tat es.
Es wurden 7 Fallen aufgestellt und ich hörte, wie sie nachts zuschnappten. Alle Mäuse starben.
Ich vermisste sie. Einmal, als ich an einem Wochenendtag noch im Bett lag, habe ich eine Maus gesehen. Sie huschte an meine Schlafzimmertür, verharrte, schaute mich dabei unverwandt an und schließlich begann sie sich ausgiebig zu putzen. Das hatte etwas Vertrauensvolles an sich. Ein:
Ich weiß, Du tust mir nichts.
Ich musste zulassen, dass sie getötet wurden, wie hätte ich es verhindern können? Zurück blieb die Gewissheit, einen Teil meiner Unversehrtheit unwiederbringlich verloren zu haben.
Frau Lindners Erwachen
Novelle
Das Ehepaar Ott einen Tag vor seiner Weltreise
„Vertrau mir, Henriette!“ Sagte Herr Ott und war ganz ernst. „Buchhaltung und Geschäftsführung sind zweierlei. Buchhaltung und Procura gehören zusammen. Geschäftsführung und Procura beißen sich. Frau Lindner versteht nichts von Buchhaltung und Herr Albrecht nichts von Personalführung und Organisation. Das wird sich parallel gut vertragen.“ Seine Worte blieben ohne Überzeugungskraft auf die Gattin. „Herr Albrecht hat etwas Verschleiertes an sich.“ „Henriette, du spinnst. Herr Albrecht ist zuverlässig, peinlichst genau, korrekt bis in die Haarspitzen. Er wird das Geschäft wie sein eigenes führen.“ „Du sagst es, genau das sind meine Bedenken.“
Herr Ott beschloss seine Frau zu ignorieren und stopfte Socken in alle Ecken seines Koffers. Henriette, des Insistierens müde, schwieg ebenfalls.
Zum Zeitpunkt des Gespräches waren Herr und Frau Ott noch in ihrer Wohnung über der Buchhandlung, die der Vater von Herrn Ott gegründet hatte, als der kleine Anton gerade auf die Welt kam. Stolz nannte er daher sein Geschäft Ott & Sohn. Nun war der Gründervater schon ein paar Jahre tot und der nicht mehr kleine Anton wollte Silberhochzeit mit seiner Gattin Henriette im Mai auf Hawaii feiern.
Drei Wochen zuvor hatte er zusammen mit seinem Buchhalter, Herrn Albrecht, einen Notar aufgesucht, der Vollmachten besiegelte. Buchhalter Albrecht war jetzt Prokurist für die Laufzeit eines Jahres. Frau Ott hätte Frau Lindner, die Geschäftsführerin, für diese Aktion. bevorzugt. Da sie jedoch nichts Sachdienliches gegen Herrn Albrecht vorzubringen hatte, setzte sich der eloquente Gatte bei seiner Ehefrau durch, jedenfalls prinzipiell. Henriette konnte es nicht lassen, einmal pro Tag ihr Misstrauen auszusprechen. Mit anderen Worten, sie quengelte konsequent noch einen Tag vor der Abreise.
Dann kam der Abschiedstag. Von nun an verlieren wir das Ehepaar aus den Augen.
Frau Lindner dachte
sich was dabei, als der Chef ihr eröffnete, dass die Vollmacht für alle rechnerischen Belange bei Herrn Albrecht liegen sollten. Das konnte in etwa so geklungen haben: ‚Eine Chefpersönlichkeit ist der Albrecht nicht. Diese Herausforderung wird über seinen Horizont gehen. Wahrscheinlich hängt er ständig an meinem Rockzipfel und fordert mir Entscheidungen ab, die er allein nicht treffen will. Ich sehe mich schon allabendlich nach Geschäftsschluss in seinem Büro sitzen und mit ihm Endlosdiskussionen über Einkäufe und Rechnungen führen. Dann ist seine Hilfskraft, Frau Schröder, schon im Feierabend. Frau Schröder, die viele Jahre an der Kasse saß, bis sie vor zwei Jahren mitten im besten Weihnachtsgeschäft einen Nervenzusammenbruch erlitt. Nach ihrer Genesung wurde sie ins Büro versetzt, Herr Ott ist ein sozialer Arbeitgeber. Dort sortiert sie Tag für Tag Belege, füllt Überweisungsträger aus und die Formulare für die Sammelscheckaufstellungen. Mit der Buchführung hat sie nichts zu tun, davon versteht sie nichts. Schade, sonst könnte sie Herrn Albrecht über die Schultern gucken. Ach egal, die Monate werden wir überstehen. ’
Lullte sich Frau Lindner in Optimismus ein.
Sechs Wochen später
Der Himmel über Lübeck war uni grau, wie meistens Mitte März. In der Buchhandlung Ott & Sohn brannte die volle Beleuchtung. Frau Berg, die Putzfrau, bewegte den Staubsauger im rhythmischen Tempo über den Teppichboden und weinte. Nein, sie schluchzte nicht, vielmehr liefen ihr stetig dicke Tränen über die Wangen. Sie war nicht wirklich traurig, sondern auf eine ihr eigene zurückhaltende Art sehr wütend. Ihre Kollegin, mit der sie sich seit vielen Jahren die Arbeit in der Buchhandlung geteilt hatte, war wegen einer Krankheit ausgefallen.
Von der Geschäftsführerin wurde ihr sofort Ersatz zugesagt. Daraus war nichts geworden. Der Herr Prokurist hatte es abgelehnt. Eine Mehrstunde pro Tag durfte sie sich aufschreiben. Das war sein letztes Wort. Frau Lindner konnte ihr sein Urteil nicht begründen, oder wollte es nicht, darüber war sie sich unsicher. Am liebsten hätte Frau Berg auf der Stelle gekündigt, wenn ihr das möglich gewesen wäre.
Das ging jedoch wegen ihrer schlechten Arbeitsmarktperspektive nicht. Sie war 55 Jahre alt und konnte nicht wagen, bei einer der großen Reinemachbetriebe um Arbeit anzufragen. Entweder wäre sie wegen ihres Alters gar nicht erst genommen worden oder sie hätte eine zwanzig Jahre jüngere Vorarbeiterin bekommen, die ihr jeden Tag sagen würde, wie was zu machen wäre. Hier wusste sie zumindest, was sie erwartete und sie hatte gute Augen. Eine wirklich gute Putzfrau, hatte ihr vor Jahren eine erfahrene Kollegin verraten, putzt mit dem Kopf und nicht hirnlos jeden Tag alles. Erst wird genau hingesehen, dann ausgeführt. Nur der Teppichboden brauchte täglich Pflege. Der kam immer ganz am Schluss dran, wenn Frau Lindner bereits die Buchhandlung betrat. Punkt 8 Uhr 20 stellte Frau Berg jeden Tag die Kaffeemaschine an, damit die Geschäftsführerin gleich zu Dienstbeginn eine kräftige Stärkung genießen konnte. Nie trank Frau Lindner ihren Kaffee allein, sie wurde mit herzlicher Selbstverständlichkeit dazu geladen. Ihre kleinen Gespräche, die sie dabei führten, drehten sich um das Wetter, das in aller Regel zu nass und zu kalt war, oder um Lebensmittelpreise. Oft erzählte ihr Frau Lindner auch von einem neuen Buch und wenn sie es ausgelesen hatte, gab sie es an Frau Berg weiter, die sich im Laufe der vielen Jahre zu einer geübten Leserin und Kritikerin entwickelt hatte. Kurz und bündig bescheinigte sie Roman X einen großen Erfolg oder sagte zu Roman Y „Dat wart nix, to dörchenanner.“ Frau Berg hatte häufig völlig recht.
Um kurz nach halb neun war Feierabend für Frau Berg und Frau Lindner startete ihren morgendlichen Rundgang durch die Abteilungen der Buchhandlung. Die ersten Angestellten trafen ein, bekamen kurze oder längere Anweisungen und Punkt halb zehn wurde die Ladentür für Kunden geöffnet.
Zehn Monate später
Frau Lindner kleidete, frisierte und schminkte sich sehr sorgfältig an diesem Morgen, an dem sie mit Herrn Albrecht eine Aussprache herbeiführen wollte. Unter keinen Umständen durfte sie ihm die Möglichkeit geben, ihr mangelnde Kompetenz vorzuwerfen und sich mit unklaren Ausreden über Kostenanstieg und Rentabilitätseinbuße aus der Unterhaltung winden. Abrechnungen wollte sie sehen, Zahlen, Daten und den Kontostand. Das war ihr gutes Recht als Geschäftsführerin der Buchhandlung Ott & Sohn.
Sie machte sich früh auf den Weg. Im Geschäft hatte sie Frau Berg erwartet. Sie war nicht da. Stattdessen fand sie auf ihrem Schreibtisch einen Zettel: Mir ist schlecht geworden, Frau Lindner, ich musste gehen, das Herz. Morgen kommt meine Schwiegertochter zur Aushilfe. Auch das noch. Frau Lindner machte sich an die Arbeit. Wenigstens der Teppichboden sollte gesaugt werden. Das war ungewohnte Arbeit für sie und schnell begann die Geschäftsführerin zu schwitzen.
Sie hörte ihn nicht kommen. Plötzlich stand er vor ihr und ihre schlechten Nerven ließen sie kurz erschrocken aufschreien. Dann schaltete sie den Staubsauger ab. „Frau Lindner, sie sehen aus wie eine Furie, so wollen sie doch nicht unsere Kunden empfangen?“
Sie sah ihn für Sekundenbruchteile fassungslos an und spürte trotz ihres Schwitzens durch die ungewohnte körperliche Anstrengung, wie ihr jeder Tropfen Blut aus dem Kopf wich. Eine solche Unverschämtheit musste sie sich nicht gefallen lassen.
„Sie“, sagte Frau Lindner, „ich bin für ihren unhöflichen Gesprächseinstieg überhaupt nicht undankbar, weil ich mich dadurch ebenfalls von überflüssigen Freundlichkeiten entbunden sehe, die zwischen Ihnen und mir kaum angebracht sind. Ich kam so früh um vorzuarbeiten, weil ich dann, sobald Sie hier sein würden, mit Ihnen sprechen wollte. Frau Berg konnte heute wegen einer Herzsache nicht arbeiten, so dass ich diese Tätigkeit übernahm, weswegen Sie froh sein sollten, dass ich davor keine Scheu hatte.“
Während dieses langen Satzes hatte er sie kalt und mit wachsendem Erstaunen angesehen. Dann schüttelte er den Kopf und entgegnete:
„Aber Frau Lindner, Sie sind doch hier die Geschäftsführerin, damit hätten Sie nachher einen Lehrling beauftragen können. Bis zur Geschäftseröffnung wäre dies noch angemessen zeitig gewesen.“
‚Ich dummes Huhn’, dachte sie ‚weswegen kann ich ihm nicht sachlich die Funktionen und wichtigen Morgenaufgaben der Auszubildenden aufzählen, ohne deren Erledigung das Tagesgeschäft im Chaos versinken würde? ’ Er jedenfalls hatte keine Ahnung und sie ließ sich verwirren. „Die haben keine Zeit dafür“, sagte Frau Lindner, „dann geht nachher alles drunter und drüber.“
„Oh“, bemerkte er daraufhin, „ich wusste nicht, dass unsere Geschäftsfähigkeit von Lehrlingen abhängt.“ Sie kochte vor Wut. Ihr war klar, dass er überhaupt keinen Durchblick hatte. Die Kassiererin fiel bereits die 3. Woche wegen Krankheit aus. Diese Aufgabe musste eine Verkäuferin aus der „Unterhaltungs-Literaturabteilung“ übernehmen und an ihre Stelle hatte sie eine tüchtige Auszubildende des dritten Lehrjahres gesetzt. Der andere AZUBI kam den ganzen Tag nicht aus der Telefonzentrale heraus und ein weiterer Verkäufer sitzt den gesamten Tag in der Sachbuchabteilung fest. Und sie selbst, nun, sie war in der „Kunst- und Antiquariatsabteilung“ und hatte darüber hinaus das Zentralregister zu bedienen. Aber das sagte Frau Lindner ihm nicht. Mittlerweile wieder zu Atem gekommen, sah sie ihm fest in die Augen: „Herr Albrecht, es wäre gut, wenn wir hochdeutsch miteinander redeten“, hob sie ihren einstudierten Text an. Sinnlos, er unterbrach sofort:
„Frau Lindner, wir wollen hier gemeinsam gut arbeiten. Bitte keine Diskussionen wegen personeller Engpässe, etcetera. Dieses Thema denke ich, haben wir ausgiebig besprochen. Die Firma kann sich zurzeit keine unnötigen Ausgaben leisten. Bedenken Sie, dass ich mit meinem Namen für die rechnerischen Belange des Hauses einstehe. Ich alleine trage die volle Verantwortung. Sie, als Geschäftsführerin, haben lediglich die Aufgabe das Personal vernünftig und dem Bedarf entsprechend einzusetzen. Sie bekommen ein sehr gutes Gehalt. Beweisen Sie, dass Sie es verdienen.“
Seit Monaten zerriss sie sich, opferte ihre Freizeit für die Firma, organisierte und stopfte Löcher, wo sie nur konnte und musste sich so etwas von ihm nicht sagen lassen. In ihr wurde es ganz kalt. Und kalten Blickes musterte sie ihn. Ja, sie traute ihm zu, dass er nach der Rückkehr des Chefs, kein gutes Haar an ihr lassen würde. Er würde vielmehr sagen:
„Frau Lindner ist ja schrecklich lieb und bemüht sich nach Kräften. Nur, ihr Denken ist unrationell und sie ist auf Gemütlichkeit und Gewohnheit bedacht – eben keine Flexibilität, nicht einmal im Ansatz. Stellen Sie sich vor, Herr Ott, einmal war die Putzfrau ausgefallen und anstatt eine Reinigungsfirma zu beauftragen oder die Lehrlinge dafür einzusetzen, hat sie selber die Räume gereinigt. Sie war völlig fertig, verschwitzt und total überspannt. Ich musste sie motivieren, nach Hause zu gehen und sich frisch zu machen. In diesem Zustand konnte sie unmöglich Kunden empfangen.“
Es ging ganz schnell: Sie hob den Staubsauger an, als wollte sie ihn forttragen und warf ihn mit aller Kraft zu der sie fähig war gegen seinen Kopf. Er stolperte nach rückwärts und schlug mit dem hinteren Schädel gegen die Holzkante eines Bücherschrankes, fiel und blieb liegen.
In der Psychiatrie
Diktat: Frau Lindner, Aktenvermerke zum Gutachten XXI aus 1985
Zur Sozialanamnese: Kindheit und Jugend o. B. Mit 24 erste Heirat. Die kinderlose Ehe wurde nach 3 Jahren geschieden. Die zweite Eheschließung erfolgte im 29. Lebensjahr, blieb kinderlos und wurde nach 5 Jahren geschieden. Eine dritte Ehe ging Frau L. mit 41 Jahren ein, die wiederum kinderlos geschieden wurde. Die heute 45jährige lebt allein. Bemerkenswert ist, dass die Ehescheidungen zu ihrer Schuldlast ausgesprochen wurden. Die Begründungen der Urteile lauteten insbesondere auf Verletzung der ehelichen Pflichten und kompromisslose Haltung in der Haushalts- und Lebensführung. Zwischenbemerkung: Frau L. war 14 Tagen nach Einlieferung gut erholt, hatte zugenommen und war in den Explorationen zugewandt und deutlich interessiert. Wir stellten gemeinsame Lesevergnügen fest und ich erzählte ihr, dass ich, wie unser Favorit Marcel Proust, ebenfalls Asthmatiker sei. Ich berichtete ihr von einem sehr bedrückenden nächtlichen Anfall, den sie mit: ‚Leiden sind etwas, an denen die Persönlichkeit eines Menschen entweder versagt oder wächst’ kommentierte.
Diese Formulierung ist sachlich richtig und gibt noch keine Hinweise auf eine reduzierte Empathie. Was sagt es über ihr Persönlichkeitsbild aus? An dieser Stelle des Gutachtens zitiere ich aus meinem Lehrbuch Seite 234 mit Beginn hier: Eine Persönlichkeitsstruktur mit deutlich masochistischer Tendenz und so weiter.
Als Frau Lindner den Staubsauger hob und damit auf den Kopf des Prokuristen zielte, war sie zweifelsfrei in einer menschlichen Ausnahmesituation, aber weder paranoid noch zwangsorientiert aufgrund eines Prodroms oder einer etablierten Schizophrenie. Ich werde ihr volle Zurechnungsfähigkeit attestieren müssen.
Als Frau L. an jenem Tag die Räume der Buchhandlung betrat, hatte sie keinen Mord geplant. Auf Vorsätzlichkeit wird nicht plädiert werden können. Totschlag trifft zu. Ich möchte nicht darüber urteilen, ob sich Frau L. eines schweren oder minder schweren Totschlags strafbar gemacht hat. Sie hasste den Mann und während des Gesprächs mit ihm hat sie sich in eine Hypothese bezüglich seiner künftigen Aussagen gegenüber dem Chef hineingesteigert, die dazu führte, einen Staubsauger gegen seinen Kopf zu schleudern. Daran ist er nicht verstorben. Das hatte aber den Aufprall seines Hinterkopfes auf den hölzernen Buchregal ausgelöst. Konnte sie damit rechnen, dass das passieren könnte? Nicht unbedingt. Er hätte den Gegenstand abwehren oder beiseite springen können.
Das Diktat des Gutachtens wird morgen erfolgen.
Danke, Ende.
Frau Lindner denkt in einem anderen Raum derselben Einrichtung nach