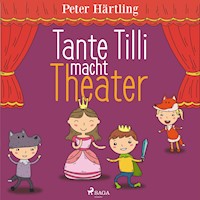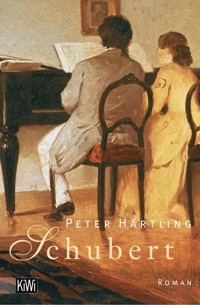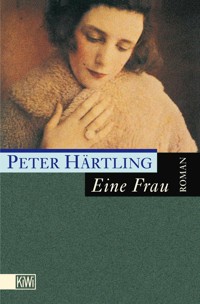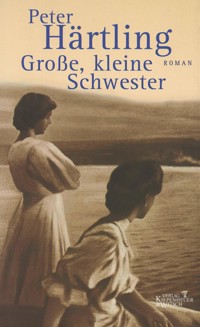24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Peter Härtling war Kinderbuchautor, Romancier, Essayist und Dramatiker. Und in allen Phasen seines Schriftstellerlebens aber schrieb er großartige Gedichte. Mit ihnen begann er sein literarisches Werk, und mit ihnen fand es seinen Abschluss. »An den Ufern meiner Stadt« versammelt erstmals die späten lyrischen Arbeiten Härtlings. Mit siebzehn Jahren veröffentlichte er seinen ersten Gedichtband – darin auch die später oft zitierte Zeile »ein narr wie ich« (gefolgt von den schönen Versen: »narren sind immer gleich / und wunderlich / und immer reich«). Der Narr begegnet uns auch in seinen späten, in seinen Altersgedichten. Hier hat er einen »Totenkopf« – »und einen Zauberspiegel / und einen Bleisoldatenknopf«. Bekannte Motive, Bilder und Stimmungen aus dem überaus reichen und vielgestaltigen Werk ziehen noch einmal auf in diesen späten Texten: mal düster, mal warm und hell, immer aber von beeindruckender sprachlicher Präzision und Schärfe. Seine Gedichte formten für Härtling ein literarisches Tagebuch, das er ohne Unterbrechung sein ganzes Leben über führte. Dieser Band versammelt in sorgsamer Edition sämtliche Gedichte, die von der Jahrtausendwende bis zu seinem Tod im Juli 2017, geschrieben wurden – darunter zahlreiche unveröffentlichte Texte, die erst posthum aufgefunden wurden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 207
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Peter Härtling
An den Ufern meiner Stadt
Späte Gedichte
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Peter Härtling
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Peter Härtling
Peter Härtling, geboren 1933 in Chemnitz, gestorben 2017 in Rüsselsheim, arbeitete zunächst als Redakteur bei Zeitungen und Zeitschriften. 1967 wurde er Cheflektor des S. Fischer Verlages in Frankfurt am Main und war dort von 1968 bis 1973 Sprecher der Geschäftsführung. Ab 1974 arbeitete er als freier Schriftsteller. Peter Härtling wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, zuletzt mit dem Hessischen Kulturpreis 2014 und dem Elisabeth-Langgässer-Preis 2015. Das gesamte literarische Werk des Autors ist lieferbar im Verlag Kiepenheuer & Witsch, zuletzt erschien sein Roman »Gedankenspieler« (2018).
Klaus Siblewski, geboren 1950 in Frankfurt am Main, lebt in Holzkirchen bei München. Er ist Verlagslektor, lehrt als Professor am Institut für Literarisches Schreiben und Literaturwissenschaft an der Universität Hildesheim und veranstaltet seit Jahren die »Deutsche Lektorenkonferenz«. Er hat u.a. die Werke von Ernst Jandl, Peter Härtling und Peter Turrini herausgegeben.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Peter Härtling war Kinderbuchautor, Romancier, Essayist und Dramatiker. Und in allen Phasen seines Schriftstellerlebens aber schrieb er großartige Gedichte. Mit ihnen begann er sein literarisches Werk, und mit ihnen fand es seinen Abschluss. »An den Ufern meiner Stadt« versammelt erstmals die späten lyrischen Arbeiten Härtlings.
Mit siebzehn Jahren veröffentlichte er seinen ersten Gedichtband – darin auch die später oft zitierte Zeile »ein narr wie ich« (gefolgt von den schönen Versen: »narren sind immer gleich / und wunderlich / und immer reich«). Der Narr begegnet uns auch in seinen späten, in seinen Altersgedichten. Hier hat er einen »Totenkopf« – »und einen Zauberspiegel / und einen Bleisoldatenknopf«.
Bekannte Motive, Bilder und Stimmungen aus dem überaus reichen und vielgestaltigen Werk ziehen noch einmal auf in diesen späten Texten: mal düster, mal warm und hell, immer aber von beeindruckender sprachlicher Präzision und Schärfe. Seine Gedichte formten für Härtling ein literarisches Tagebuch, das er ohne Unterbrechung sein ganzes Leben über führte.
Dieser Band versammelt in sorgsamer Edition sämtliche Gedichte, die von der Jahrtausendwende bis zu seinem Tod im Juli 2017, geschrieben wurden – darunter zahlreiche unveröffentlichte Texte, die erst posthum aufgefunden wurden.
Inhaltsverzeichnis
I. Gedichtbände
Ein Balkon aus Papier
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
Nachträge für den Maler Axel Arndt
kommen – gehen – bleiben
I. Kapitel
II. Kapitel
III. Kapitel
IV. Kapitel
V. Kapitel
Schattenwürfe
Schattenwürfe, Erinnerung an altes ...
Abends den Atem wiegen,
Wovon ich leichter werde: ...
Es ist Zeit, den ...
Mit trägen Blicken den ...
Träume befreien und Bilder ...
Wer Wolkenreitern nachruft,
Die Dame sang und ...
Morgens, wenn die Gedanken ...
Mein Stelzenläufer tritt aus ...
Sterne und Erde berühren ...
Den Sommervokal aussenden, das ...
Mit meinem Garten will ...
Schlaf, mächtiger Tagteiler, wie
Dein Traum hat mich ...
Konfettischauer über der lackierten ...
Nirgendwo ankommen. Ein Ort, ...
Die Kinder spielen. Sie ...
Einen Tag, einen endlosen ...
Ich erzähl dir ein ...
Welches Reiseziel habe ich, ...
Im Sommerfrost den Raupen ...
Die Veränderungen nehmen zu: ...
Ich habe Herr und ...
Die Gespräche von einst, ...
Zwischen den Fingern Luftlippen ...
Wenn der Wind das ...
Sobald die Seelenverkäufer ihre ...
Für dieses Fest treibt ...
Der Schatten, der mich ...
Das Holz unter meiner ...
Auf dem Sand geritten, ...
Ich fange an, Sonnenuntergänge ...
Ankommen und wiederfinden: den ...
Das Binsenboot von ehedem, ...
In diesem Sommer übernehmen ...
Querschläger teilen den Schlaf, ...
Dort, wo die Windsbraut ...
Der Engel mit dem ...
Von einem Garten zum ...
In den Beinhäusern warten ...
Spurlos verschwand der alte ...
So tief die Jahre ...
Komm, ruft die Schwermut ...
Schlafmohn. Mohnschlaf. Das könnte ...
Die Abstände zu den ...
Meine alte Liebe bettet ...
»Sonnenflecken«, schrieb er und ...
Der Strand, ein Streifen ...
An diesem Nachmittag singt ...
Sie legte eine Lunte ...
Der kleine Mann verabschiedete ...
Die alten Briefe, im ...
Deinen Schatten hast du ...
Der Sommerfrost greift die ...
Ich sehne mich nach ...
Hoch überm See liefen ...
Mit einem Brief von ...
Wieder steigt das schwarze ...
Für Samuel: Du kamst ...
Verwirrt schichten die Jahreszeiten ...
Von wo ich komme: ...
Auf Reisen lasse ich ...
Variationen zu Brahms
Fenstergedichte
Fenstergedichte – so bezeichnet sie ...
Von einem Kind geschrieben ...
Nacht, ausgegossen und fest ...
Ich und ich, getrennt ...
Weit draußen die Linien, ...
Jetzt drückt es heftig ...
Der auf dem einen ...
Dem raschen Wechsel der ...
Die Stimme wird es ...
Manchmal hält vor dem ...
Der Schnee schließt mir ...
Wann wird der aus ...
Es sind die Kraniche ...
Köchelverzeichnis 545, zweiter Satz, ...
Ungerufen geraten sie in ...
Der Sturm brach die ...
Der Tag zieht allmählich ...
Ein letztes Mal der ...
Draußen, jahrweit draußen, haben ...
Noch immer wandern, draußen, ...
Der Ahornherbst verspätet sich ...
Die Scheiben laufen an, ...
Draußen kannst du zum ...
Ich denke mir das ...
Ich kann dem Wolkenverteiler ...
Aus dem Abgrund steigt ...
Fotos aufgespannt, draußen vorm ...
Schläfer treiben vorüber, leicht ...
Das Kind, auf das ...
Manchmal habe ich sie ...
Ich bin tot, ruft ...
Der alte Mann, den ...
Ich kann die Stadt ...
Zieh dir die Haut ...
Das Blau wird fest, ...
Feierlich erklimmt der Wacholder ...
Schon im März kannst ...
In die Stille, das ...
Die Amseln legen auf ...
Ich habe mir für ...
Halbherzig – ein Wort für ...
Der Märchenmann im Fensterkreuz ...
Die mährischen Szenen, draußen, ...
Er sah, als er ...
Einer, der schon länger ...
Masken gleiten vorüber. Sie ...
Komm zu mir nach ...
Die neuesten Botschaften krümmen ...
Nur nachts erwacht das ...
Jetzt ist Sommer. Die ...
Die ehedem Vertrauten gehen ...
Der Sichelmond wird leicht, ...
Draußen wechseln die Städte. ...
Mit verstellter Stimme rufe ...
Der alte Garten in ...
Die alte Stadt steigt ...
Ich kann ihn nicht ...
Kehren sie zurück? Brechen ...
Das Mädchen aus dem ...
Der Sand steigt vorm ...
Von mir
Von mir
Im Schnee
Ich brech den Apfel,
Algarve I
Algarve II
Nachruf
Diese Liebe
Der Weise Mann im Wald
Für Herburger
In den Fluten
Damals in Lichterfelde-Ost
Versuchte Ewigkeit
Jahreszeiten
Ich und ich
Widmungen
II. Aus Büchern
Sternenbilder. Zwölf Gedichte
Der Wanderer
Der kleine Engel
Orpheus
Ikarus
Melancholia
Engelsflügel
Penelope
Die Augen der kleinen Königin
Der Berauschte
Der sieche Mann
Der geduldige Greis
Das Tödlein
Zehn neue Gedichte
Brünn
Reisefieber
Die kleinen Plätze
Der andere Tag
Die räudige Schrift
Liebe, immer wieder
Reiselied für Fanny
Greisenmorgen
Die schönen Trompeten
Wüstenmärchen, Märchenwüste
Postscripta
Selbstporträt
Strassenmädchen, in einer Pfütze tanzend
Könnte
Wiederkehr
Vier Gedichte
Selbstporträt mit 76
Abendlied
DER TISCH,
Der greise Kopf
Gedichte aus Winkelspiel
Kann sein
Träume sind es, die ...
Als ich mir, es ...
Allein sein
Damals in Lichterfelde-Ost
Sommerlich
Häuser wie Schiffe
Übergang
Der Hunger von früher
Balance
Ein Rest von Glück
Ängste wie Flechten
Den Abschieden nachlaufen, sie
Nachsommer
Abschließend
III. Verstreut veröffentlichte Gedichte
Zum Mitzählen
Trag deine Furcht
Bruchstücke
Friedfertig:
Schadensspruch
An einen befreundeten Maler
An meine Söhne
Mein Garten
D.H. und die Schmetterlinge
Der Unterschied
Windgedicht
Weißt du,
Der Schmerz nimmt zu
Don Ottavio
Jetzt, mit einem Mal ...
Spuren des Ikarus.
Kann man im Wasser
Wenige sind in Anfängen ...
Die Gaukler werden
Unlängst hörte ich ein ...
Wie angenehm
Elegie auf das Kommende Aus den Verzweiflungen der Gegenwart
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
Das Haus
Dies Gedicht, lieber Hans ...
Wulf Segebrecht zum Fünfzigsten
Wer wälzt sich denn ...
Der Wald ist weg.
Erstrittenes Freundescarmen
Der Trost,
Ich habe den Frieden ...
Absage
Ein Narr spielt
Kleiner Flötenliebessong
Verwandlung
Von Gensfleisch nicht leben,
Jubiläums-Carmen
Wenn Bücher
Fußnote
Nachtigallen
Ein Gaukler
Kiesel für Wiesel
Kater, fleht die Katze,
Hier hast du einen ...
Der Elefant, den lieb ...
Ein dicker, schwarzer Bär
Vorausgedacht
Vor der Abreise
Hochzeit im Park des Museums für Kunsthandwerk am Schaumainkai
Beckmanns Fluß
Sprecht,
Wärme
Musik
Neuerdings, ich weiß es,
Theologie
Was weiß der Baum ...
Für Bächler
Für Georg Katzer zum Siebzigsten
Zuhören
Quer unterm Vergessen –
Mein Schatz
Glück fürs Kind
Heim oder weg
Wie viele Nähen.
Was wird sein,
Satz für Satz
Frühlingsgedicht mit Hölderlin
Durch Bücher wandern
Wann erwarte ich von ...
Kann sein
Glückgedicht
Wenn der Kuli spricht
Distanzen 1–14
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
Trauer und Wut
Der Garten von damals
Schritte in den Sommer
IV. Unveröffentlichte Gedichte
Für Konstantin
Vor Eurer Zeit –
Die Nacht wächst dir
Die Wetterfront, heißt es,
Unter Arkaden der leichtere ...
Ich gehe den Wörtern ...
Es könnte sein, die ...
Die Hügel und die Stadt
Ach, Zbigniew, sprechende Seele,
Den Tagstern mitgeschleift
Der alte Fluss überschwemmt ...
Die Tischplatte unter meiner ...
Frühe Gegend
Träume sind es, die ...
Mehr weiß ich von ...
Vielleicht leiser und sprachloser
Den Abend mit einer ...
Sonnenflecken einsammeln wie alte ...
An die Enkel
Das Geweb zwischen den ...
Morgenatem
15.1.2014
Nach allem Schwindel
Was, wenn einer den ...
Winterwünsche
Mit Kinderohren
Fest-Gedicht
An einem Wintermorgen
Manchmal müd,
Auf ein Bild Jacopo Pondormos
Zur Zeit
Am Rand
Alte Geschichten mit Rändern ...
Ins neue Jahr
Mit dem Schatten der ...
Depression
Immer wieder hat mich ...
Wörter tauschen wie Ringe,
Anhang
Mitschriften Die »Späten Gedichte« von Peter Härtling
I. Kapitel
II. Kapitel
III. Kapitel
IV. Kapitel
V. Kapitel
VI. Kapitel
VII. Kapitel
VIII. Kapitel
IX. Kapitel
Editorische Notiz
Editorische Hinweise
Quellen und Anmerkungen
Alpabetisches Verzeichnis der Gedichte
I. Gedichtbände
Ein Balkon aus Papier
1.
Die Fische im Augenwasser,
meistens schwimmen sie
einzeln.
Neuerdings füllen sie
in Schwärmen
den Blick,
nehmen Städte ein
und Landschaften –
eine vinetische Verwandlung:
Ich habe
ein zweites Leben
begonnen.
2.
In den Träumen,
den Morgenträumen,
lösen die Blätter
sich auf
oder
ich höre sie:
Meine Stimme erzählt sie,
und schon
sind sie vergangen
im Bodensatz von allem,
was ich erinnere.
3.
Allmählich entfallen mir
die Gegenden.
Nur noch die eine,
der Hügel,
auf dem mein Engel
seine Flügel
abstreift,
dort, wo Wege sich gabeln,
Koffer offen liegen,
gefüllt mit Schnee,
bereit
für meine Reise.
4.
Dieser junge Mann,
der hinter mir
her
läuft,
vergeudet seine Zukunft,
die ich
nicht mehr habe,
und versucht
ausdauernd
mich loszuwerden.
Oder ich ihn?
5.
Komm! singt mein Kindermund.
Komm! Komm!
Und ich weiß nicht,
ob ich König sein will
oder Knecht.
Wasser oder Stein.
Ich falle in den Brunnen,
ich falle in den Mund
und höre sie singen,
die ich suchte,
den König,
den Knecht,
ein Leben lang.
6.
Nachts
türmen sich Hügel auf
und verschwinden wieder.
Sterne wandern.
ordnen sich zu neuen Bildern:
der Kleine Wolf und
der Alte Bär.
Mühelos gelingt es mir,
mein Kinderdorf aus dem Schlaf
zu rufen.
Die Schwester,
die ich vergaß,
halte ich plötzlich
an der Hand:
Sie kommt,
wenn es tagt.
7.
Mein Schlaf
dehnt sich aus
bis zu dem Rand,
über den alle,
die sich in meinen Traum
drängen,
stürzen werden,
fort von mir,
zurück in ihr Leben.
8.
Wörter
fressen sich mir
unter die Haut.
Die Schattenredner
sagen mir nach,
was ich nicht sagte.
Ihre Rede setzte sich
fest,
Knorpel und Geschwüre.
Ich habe es
ausgehalten:
Meine Schmerzen sind
nicht
ihre.
9.
Mit Greisenschritten
gehe ich
in mir herum.
Meine Ungeduld wächst.
Manchmal aber
finde ich den alten
Schritt,
ausholend, für den Morgen
gespannt,
und wandere
den geliebten Hügel
hinauf:
dort, wo die Windräder sausen
und Kinder spielen,
was ich ihnen
aufsagte.
10.
Mich friert das junge Jahr.
Ich nehme mir vor,
die Vögel zu empfangen,
die in den Garten
einfallen werden,
bald –
den Dompfaff vor allem,
der den Elstern
widerstand.
Ungeduldig halte ich
nach ihm
Ausschau.
11.
Längst zum Wegelagerer geworden,
der aufhält und beraubt,
was nachkommt.
Nichts wird mir entgehen,
nicht
die aufgebrauchte Liebe,
nicht
der hoffnungsvolle Leichnam
namens Zukunft,
nicht
der ausgebleichte Schatten,
der mich zu früh
verloren
gab.
Ich behalte sie
bei mir
und lasse sie
zurück.
12.
Die Briefe,
die ich ausschickte,
kommen zurück,
einer nach dem andern.
So lerne ich
schweigen
und streiche,
einverstanden,
die Sätze
von den Seiten.
13.
Dieser eine Tag auf der Terrasse,
die
der späte Sommer
für mich erfand.
Die ich erwarte,
haben sich versäumt.
Zögernd lese ich
den Schatten
eines Baumes.
Ab und zu pochen
Kastanien
auf den Stein.
Ich atme ohne Regel,
so,
wie sie fallen.
14.
Keine Träume mehr,
wuchernd,
nur noch Bruch,
Geröll,
Abdrücke von Schreien
im Mulm.
Das Gesicht halbiert
und den Mund
ohne Zunge.
Sobald ich erwache,
fürchte ich mich
vorm Schlaf.
15.
Komm, Kind,
hol den Alten aus der Wand,
ruf ihn,
kleine Königin,
er hat dich
erwartet.
Setz ihn aus
und sprich ihn frei,
pflanz ihm den
Stern in die Hand
für eine Runde:
Bis zum ersten Wort.
Bis zum ersten Schritt.
Dann kann er
gehn.
16.
Ein Mal,
ein einziges Mal,
werden alle Bilder
meinen Schlaf verlassen,
er wird mich aufnehmen,
ein Kanal,
nicht schwarz,
nicht weiß,
und ich werde
nicht gefasst sein
auf das,
was nicht mehr ist.
17.
Manchmal
wiederhole ich
vergangene Gespräche,
die Sätze eingeebnet,
die Wörter ohne Münder,
und rufe mir,
bodenlos heiter,
die Freunde
an den Saum des Abends,
bis das Kind
in den Kreis tritt,
mir den kommenden Tag
verspricht.
(für Hildegard)
18.
Nein,
kein Land mehr,
das im Schauen
weit wird.
Die Gegend
nimmt ab
und genügt mir.
Ab und zu
die Steig hinauf,
zur Schwelle vor
der Ebene oben:
ein Herzsprung.
Um den Berg wandernd,
hole ich,
Szene für Szene,
mich ein:
Bis der Greis
hinunter
stolpert.
Ihm genügen
ein paar Schritte
hier
zu sein.
19.
Am Hals
ist mir seine Ader
gesprungen.
Er hat immer besser
singen können als ich.
Als Kind hätte ich
seine Wörter
in einem Baukasten
sammeln wollen.
In Bahnhofslokalen
warte ich auf ihn.
Für ein Glas Wein
nimmt er mich
auf seine Reise mit,
vergisst mich gleich,
damit ich wieder
auf ihn warte.
(für Peter Bichsel)
20.
Fang die Stimme ein
und nicht den Vogel.
Schließ die Augen
und geh ins Bild.
Ich könnte mit Macke
nach Tunis reisen,
mit Klee nach Kairuan.
Kannst du Farbe
falten,
Noten springen lassen?
Nur eine Reise noch –
nicht nach Tunis,
nicht nach Kairuan.
Fang die Stimme ein.
Und geh ins Bild.
21.
Ein Balkon aus Papier,
handtellergroß,
für jeden Morgen.
Das ist kein Kinderspiel.
Diese ein wenig
fahrige Mühe,
den Tag zu gewinnen,
dem ersten Satz zu trauen,
ohne ihn auszusprechen,
Sonnenflecken zu zählen,
den Atem zu hören
und den Rauch der Zigarette
gegen die offene Hand
zu blasen.
Jeder Morgen
könnte mir fehlen.
22.
Vorboten kommen:
Totems und Krüge,
Wolken, die ihre Schatten
zurücklassen
auf der Terrasse
und Vogelschwärme,
die sich am Horizont
stauen.
Der Abdruck von Händen
auf dem Tisch,
noch warm in der Form.
Und Stimmen, die an
den Gegenständen haften,
hier, jetzt.
Nicht ein Satz reicht
über diesen Winter
hinaus.
23.
Ein letztes Mal
in Golems steinernen Büchern
blättern.
Nichts wird mehr erzählt.
Ich verwechsle Schatten
und wage es nicht,
sie anzureden.
Vielleicht mein Vater –
er verliert sich
in der Schrift.
Er plante sein Glück.
Er lernte das Recht.
Dem Kind stellte er
die Heiligen
auf der Brücke vor.
Und Wörter warf er
in den Fluss:
dreiunddreißig Tauben.
Ich wiederhole Gänge,
seine, meine.
(Prag)
24.
An den Ufern meiner Stadt
treffen sich
die Abgelebten,
dünnhäutig und schweigsam.
Manchmal tanzen sie
nach einer Musik,
die nur laut wird,
wenn die Leiber
sich vermengen –
ein kostbares, sehr altes
Geräusch.
Dann brandet an,
was sie mitnimmt.
25.
Die Koffer sind leer.
Aber mein Schubert trägt
schwer an ihnen.
Die Adressen habe ich
nicht für ihn ausgesucht:
Himmelspforte und Himmelsberg.
Auch nicht, dass Komtesse Karolin
im Fuße eines Windrads
verschwindet.
Es ist ein Einfall
der Gegend.
Hier nämlich ist er
seit zwei Wintern
unterwegs.
(Melchinger Winterreise)
26.
Eingewachsen
in meine Armbeuge.
Ich kann dich wiegen,
Kind,
in den Tag,
in den Abend.
Bewahrt bist du
in allen Fluchten,
vor den regnenden Steinen,
vor den steigenden Wassern.
Am Ende wird
das geteilte Leben
dir gehören, Kind,
entwachsen meiner Armbeuge.
(für Hannah)
27.
Mein Haus wird mit mir alt.
Es senkt seine Schwellen,
um meinen Schritten
wohlzutun.
Es legt den Garten um sich,
einen immerfort
sich wandelnden Schal.
Es schickt,
mich zu locken,
Kinderstimmen über die Flure
und schichtet
die einst gelesenen Bücher
um
für Anfänge.
Nur wartet es nicht mehr auf mich.
Ich könnte gehn.
Längst ist es unterwegs
mit mir.
28.
Am Kinderhaar
aus der Fluchtspur gezerrt.
Was heißt schon:
gerettet.
Da kreuzen sich wieder
Lichtfinger am Himmel, der
seinen Horizont verbrennt.
Keinen wirst du
dort mehr erkennen.
Vergiss, sagt Mutter,
den Koffer nicht
mit den Papieren.
Der ging mir immer
verloren.
Nun hört das Kind,
ohne mich,
auf zu reden
im neuen Krieg.
29.
Kommt über die Rampe
und wirft mit Noten,
streut Wörter aus,
kehrt um und
sieht sich zu.
Wenn er nur wüsste,
wer er ist, sein soll,
jetzt oder dann,
ihm sagt es keiner.
Doch ist er, was er war,
nichts als ein Gedanke,
eine Laune mit Namen und Leib:
Komm über die Rampe,
komm wieder!
(für Ursula Bothe)
30.
Ich erzähl dir einen Garten,
unsern letzten, ich erzähl
dir zuerst die Hecke, damit
der Himmel seine Grenze hat,
ich erzähl dir Blumen,
die ihre Farben tauschen,
ich erfinde dir einen Teich,
in dem die Schatten Körper werden,
Nixen und Nöcks, und Bäume setze ich,
die von einem Tag in den andern
ihre Äste verschränken – ein Schirm
aus Laub und Vogelstimmen,
ich spanne dir den Rasen aus,
das alte Tuch mit Kindertritten,
und alle Jahreszeiten schick ich
in einem Atem drüber weg –
einen Garten erzähl ich dir,
unsern.
(für M.)
31.
Plötzlich die Hand
voller Vogelherzen:
ein Instrument für meine
mährische Musik.
Hier
wird sie nicht gehört.
Janáček hat
für sie Linien gezogen.
Wie könnte ich,
mich gegen mein Spiegelbild lehnend
im Fluss,
in der grünen Kindermarch,
wie könnte ich
meine Hand ballen zur Faust:
ach, dieses spürbare,
pochende Lied.
32.
Sätze –
schon unter der Zunge,
schon im Papier,
gespreizt haben sie sich,
sich aufgeführt,
gelogen, geliebt,
haben Feuer gefangen
zwischen Atemzügen,
sind Haut geworden
und Haar.
Nun, nach ihrer Zeit,
nach unserer,
wissen sie nichts mehr
von sich,
von uns.
33.
Meine Toten wachsen
in mich hinein,
stumme, sich ausbreitende
Geschwüre.
Maserungen in meinem
Fleisch.
Mit der Zeit
werden sie mehr sein
als ich.
Wucherungen,
die meiner Seele
den Raum rauben.
Nur mein Gedächtnis
sparen sie
aus.
34.
Das Kind
liegt auf dem Rücken
und bespricht Wolken.
Ich ruf es
unter den Holunder,
dort,
wo der tote Soldat,
von schwarzen Fliegen besetzt,
in die Erde sinkt,
am Ende
eine Spur von Teer
fürs Gedächtnis.
35.
Über die Schwelle
und nicht vor die Tür.
Längst ist der Morgen vermint.
Die Fische schwimmen auf dem Rücken.
Die Gräser bleichen zurück
in die Wurzeln.
Die Sterne ziehen Fäden.
Das Meer springt aufs Land.
Am Ende des Korridors,
sehr fern,
reißt sich der Terror
die Maske
vom Gesicht.
36.
Reif, sagst du.
Wenn du reif sagst,
jetzt, und über den harten
Schatten des Sommers
springst,
mich hinüber
rufst,
lehnen wir uns
gegen die Mauer,
danken dem Stein die Wärme
im Voraus.
Die Liebe,
dieser Sud der Jahre,
wird sämig,
wird fest.
(zum 24.6.99)
37.
Immer wieder den Wörtern
auf den Leim gegangen –
nun endlich,
satt und krank zugleich,
untergetaucht,
um sie von unten zu sehen,
ein Himmel
von faulenden Bäuchen:
Nahrung für
mein wachsendes Schweigen.
38.
Die verbrauchten Häuser
kommen geschwommen
auf meinen Flüssen.
Aufgelöst die Fenster,
die Türen im Schlick,
und vor den Mündungen angelangt
nur noch Umrisse, brüchig,
Sätzen ähnlich, die ein Kind
plappert, den Flüssen
nachredend: Neckarrheinhavelmain
39.
Du, rede ich mich an,
du flüchtig Verdoppelter,
und doch nicht gut
für den Spiegel.
Mein Du für die Dauer
dieses Gedichts:
Du, den ich hier lasse,
eingefasst in Wörter,
Du, mit dem Gedächtnis
einiger Zeilen,
Du, ein knapper Atemzug,
Du, mein wankelmütiges Herz,
mein Jetzt.
40.
Auf einer Reise
allein in einem Abteil
überraschen mich
übrig gebliebene Gespräche.
Ich kann euch nicht sehen,
klage ich.
Wie leicht verlieren Wörter
ihren Körper.
Ich rufe in die Gegenwart,
was nur
auf die Vergangenheit hört.
Wer endet hier?
Wer kommt hier an?
41.
Einer Blume die Blätter
zählen,
bis sie’s endlich weiß.
Einem Stein die Haut
abziehen,
bis er’s endlich spürt
oder
bevor dir die Lider
über die Augen wachsen,
den Tag auswendig lernen,
um ihn zu haben
für den Fall.
42.
Vorm Herbst
der mürben Gartenbank
eine Schleife an die Lehne
binden:
Leicht wird vergessen,
was die Dauer erdachte.
Aus dem Tisch wachsen,
ein Rätsel für ungefragte Gäste,
Blumen anderer Kontinente.
Ich rufe niemanden mehr,
gehe ins Haus,
und das Gras
schwärzt mir die Füße.
43.
Ich habe mir versprochen,
die Sonne in einem Kahn verreisen zu sehen
noch in jener Jahreszeit,
aus der ich,
ich weiß es,
nicht mehr finden werde.
Es könnte die Julisprache sein.
Denn ich habe aufgehört,
in Gesichtern zu lesen,
und Sandkörner bleiben
auf meiner Haut.
Die Bäume schreiben ihre
Namen gegen den Horizont.
Noch vor Nacht lerne
ich sie auswendig.
44.
Komm, fremder, mir noch fremder Schlaf,
komm, Schlaf der Alten,
träg und sprunghaft,
leere meine Träume
und leg dich am Tag zu mir,
füll mich aus,
zieh deine Teerspur
durch mein Gemüt,
schwärze meine restliche Zeit,
bis ich mich deinen Launen füge,
bis ich bereit bin,
dir nachzugeben, dir zu gehören,
mein Schlaf.
45.
Ein Nachmittag wie dieser,
aus dem Kalender verloren,
die Stühle und der Tisch
werfen Schatten, die Sonne
steht hoch, die Bäume
beugen sich im Wind.
Meine Gäste sind gegangen.
Ich rede ihnen nach
und höre mir zu.
Leicht wäre es, den Atem
anzuhalten und
der Schatten zu sein,
der noch fehlt.