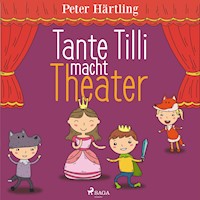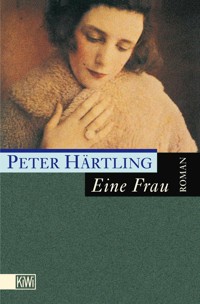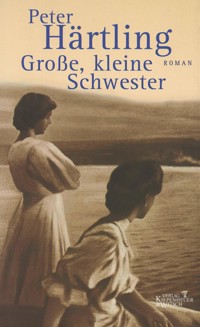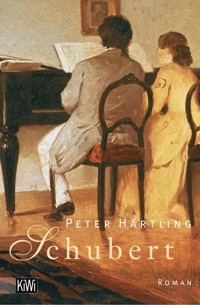
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Sprache wie Musik – Peter Härtlings sinnlicher und faszinierender Roman über den Komponisten Franz Schubert Franz Schubert, der nur 31 Jahre alt wurde, ist neben Mozart der tragischste Genius der abendländischen Musikgeschichte. In seinem Roman "Schubert" entwirft Peter Härtling, der sich von Anfang an mit dem Leben, der Musik und der Wirkung des großen romantischen Komponisten beschäftigt hat, als erster ein modernes literarisches, sehr bewegendes Bild vom Leben und Werk des begnadeten Musikers. Franz Schubert: das Genie, der leise Rebell, der unglücklich Liebende, der erste bürgerliche Komponist. Er kann von einer Gesellschaft leben, zu der er in seiner Musik auf größte Distanz geht. Auch dies gehört zum Modernen seines Lebens. Mit sicherem Blick für das Wesentliche zeichnet Peter Härtling die Lebensstationen Schuberts nach, vom Sängerknaben der k.k. Hofkapelle bis zum gefeierten Mittelpunkt in den Salons der vergnügungssüchtigen Wiener Gesellschaft. Mit großer Intensität und in einer zu Musik gewordenen Sprache beschreibt Härtling das Leben und die Werke Schuberts, ein Leben, das nur in der Kunst Glück erlangt hat, weshalb diese Kunst soviel Glück vermittelt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 317
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
» Buch lesen
» Literatur die mich anregte
» Ich Danke
» Das Buch
» Der Autor
» Impressum
Je mehr ich es jetzt einsehe, was er war, je mehr sehe ich ein, was er gelitten hat.
Moritz von Schwind
Inhalt
1 Moment musical I (Nicht zu langsam)
2 Schulgeburten
3 Stimmen
4 Der Umzug
5 Moment musical II (Ziemlich geschwind)
6 Der musizierende Gefangene
7 Für Klavier zu vier Händen
8 Die Stimme
9 Moment musical III (Schnell)
10 Salieris Schüler
11 Frau Anna
12 Moment musical IV (Ziemlich schnell)
13 Der Absprung
14 Bildnis einer möglichen Geliebten
15 Der Wanderer
16 Doppelwerbung
17 Moment musical V (Nicht zu geschwind)
18 Aufs Schloß
19 Moment musical VI (Etwas geschwind)
20 Mayrhofer
21 Moment musical VII (Etwas langsam)
22 Wiener Leben
23 Ein Traum
24 Das Fensterbild
25 Moment musical VIII (Geschwind)
26 Die schöne Müllerin
27 Moment musical IX (Nicht zu langsam)
28 Sommerfrische
29 Moment musical X (Ziemlich geschwind, doch kräftig)
30 Winterreise
31 Moment musical XI (Etwas langsam)
32 Moment musical XII (Sehr langsam)
Literatur
Ich danke
1.Moment musical I(Nicht zu langsam)
Die Szene ist ein Bild, eine Zeichnung gewesen. Nun nicht mehr. Es brauchte lang, bis sich die mit feinem Stift gezogenen Figuren zu bewegen begannen.
Die kleine Gestalt erscheint. Das gezeichnete Licht verhilft ihr zu einem unverzerrten Schatten.
Er sagt: Nehmen Sie doch dort unter der Linde Platz und warten Sie, bis die Herrschaften ihre Unterhaltung unterbrechen, seien Sie, ich bitte Sie, so höflich, niemandem ins Wort zu fallen.
Er spielt, jetzt sehr entfernt.
Ich wünsche mir, daß wunderlich singt oder Patzak:
»Die Lerche wirbelt in der Luft;
Und aus dem tiefen Herzen ruft
Die Liebe, Leid und Sorgen.«
Beunruhigt und verwirrt wende ich mich an Herrn von Spaun, der den Spazierstock vor sich quer über den Gartentisch gelegt hat als eine deutliche Abgrenzung: Verzeihen Sie, fällt es Ihnen auch so schwer wie mir zu entscheiden, ob wir uns im Freien oder in einem Salon befinden?
Wieso? Herr von Spaun mustert mich verdutzt, schaut dann ins Bild hinein und hört Schubert zu, den ich nun wieder nicht höre.
Ich blicke zu ihm hin. Er greift sich ans Herz.
Um endlich ungestört zu sein, setze ich mich weiter zurück. Ich kann niemanden mehr erkennen, nicht Schober oder Vogl oder Mayrhofer. Die Zimmerdecke hat sich, was zu erwarten war, in Licht aufgelöst, weht wie ein durchscheinendes Segel.
Und ich sehe, wie Schubert mit seinem Klavier hinaus auf eine Wiese fährt, die einer riesigen grünen Schüssel gleicht, und mich überkommt Angst, er könnte über den Rand stürzen, aber eine junge Dame, möglicherweise Katharina Fröhlich, beruhigt mich beiläufig: Einen Rand gibt es nicht. Schauen Sie nur lieber auf die anderen Herren, auf deren Geschichte.
Ich kann die Scharade nicht erraten.
Können Sie mir helfen? bitte ich meine zufällige Nachbarin. Sie lacht auf, legt die Hand auf die Lippen: Es ist möglich, daß Sie hören, was Sie sehen, sagt sie.
Hören, was ich sehe?
Sie nickt und schaut durch mich hindurch. Ja. Oder daß Sie sehen, was Sie hören.
Ehe ich ihr erwidern kann, ereignet sich, wovon sie spricht – oder bilde ich es mir nur ein?
Obwohl Schubert sich vom Klavier entfernt hat, sich zum Horizont hin verbeugt, spielt das Klavier weiter, einen seiner Walzer wie aus der Erinnerung, und Vogl singt den Harfner, und Therese Grob, die eine Figur aus der Scharade gestoßen hat und nun auf einem Luftstreif schwebt, nimmt seinen Gesang auf:
»Heiß mich nicht reden,
Heiß mich schweigen.
Denn mein Geheimnis ist mir Pflicht.«
Schober – ich nehme wenigstens an, daß er es ist – wirft einen Brief in die Luft, gegen das schwingende Zeltdach, das Papier entfaltet sich, und es ist eine Schrift darauf zu lesen, die, wie das Blatt sich auch wendet, gespiegelt bleibt.
Vom Schnürboden wird ein Offizier heruntergelassen. Er müsse die Aufführung im Auftrag seiner Exzellenz, des Fürsten Metternich, bis auf weiteres untersagen.
Er verbeugt sich: Gestatten, mein Name ist Schodl, ich bin der Zensor.
Von Schubert ist nichts mehr zu sehen.
Spaun reißt ein Streichholz an und entzündet die schöne Gegend mit einer Stichflamme. Befinden wir uns nun im Freien oder in einem Salon?
Bevor ich mich abkehre, erkenne ich erschrocken, wie eine haushohe Eisscholle sich über den grünen Rand schiebt. Sie nimmt das verlassene Klavier in einer Nische auf.
2.Schulgeburten
Franz Schubert kam in einem Schulhaus zur Welt. Nicht in einem, wie wir es kennen, einem öffentlichen Gebäude, das allein der Lehre und dem Lernen dient, sondern in einem Haus, in dem gelebt, geliebt, geboren, gestorben und eben auch unterrichtet wurde. In dem es einen täglichen und einen nächtlichen Lärm gab, Geräusche nach einem festen Muster, einem Stundenrhythmus.
Das Haus im Neunten Bezirk gibt es noch; es gleicht nicht mehr ganz dem am einstigen Himmelpfortgrund.
Was sich heute in der Undurchschaubarkeit der großen Stadt museal hervortut, gehörte damals, Ende des achtzehnten Jahrhunderts, zu einem vorstädtischen Bereich, in dem sich dreitausend Menschen in engen, kargen Wohnungen drängten, Handwerker in den Höfen ihre Werkstätten hatten, Taglöhner neben Beamten lebten, Lehrer neben Dienstboten. Die Enge drückte sie alle auf die Straße, wo von ihnen nicht nur viele Handel trieben und arbeiteten, sondern ebenso entspannten, spielten, flanierten, dem Treiben der Nachbarn nachspionierten.
Die Straßen stanken. Bei Nacht gab es so gut wie kein Licht.
Die Lebensunruh wärmte die einen, machte die andern frösteln.
Wer träumte, wurde rasch durch das Geschrei des Tags und die Seufzer der Nacht aufgeschreckt.
Die Sommersonne trocknete die Gassen und Höfe so aus, daß der Unrat gar nicht dazu kam zu faulen. Der Regen häufelte den Dreck auf, und im Winter fror rasch, was faulen und stinken konnte.
Noch ist Franz nicht geboren, noch haben seine Eltern keine Ahnung, wo sie einander treffen, wo sie ihr gemeinsames Leben beginnen werden.
Die Gegend, aus der Franz Theodor Schubert, der Vater, stammt, kenne ich. Neudorf liegt nahe bei Mährisch-Schönberg; in einer hügeligen Landschaft, die sich in der Kindererinnerung schroff auftürmt. Das Altvatergebirge grenzt nach Osten hin den Horizont ab. Es hat, wenn mein Gedächtnis sich nicht schwärmerisch irrt, Bachtäler gegeben, die sich mit grünen Rainen durch die Wälder schnitten, wie in einem Bilderbuch oder einem Lied:
»Hinunter und immer weiterUnd immer dem Bache nachUnd immer frischer rauschteUnd immer heller der Bach.«
Vielleicht hat Vater Schubert manchmal seinen Kindern von dieser Gegend erzählt. Es kann genausogut sein, daß er sie verschwieg, vergessen wollte. Es hat ihn ja fortgedrängt, Karl nach, dem älteren Bruder, der schon in Wien als Lehrer tätig war.
Im Winter 1783 kam Franz Theodor in Wien an. Er hatte sich in Brünn und anderswo bereits an Schulen geübt und darum keine Schwierigkeiten, sich bei seinem Bruder an der Karmeliterschule zu verdingen. Sicher brauchte er einige Zeit, mit der großen Stadt zurechtzukommen, die damals schon mehr als zweihundertfünfzigtausend Einwohner hatte. Er war ehrgeizig, wollte es zu etwas bringen. Zwei Semester lang hörte er an der Wiener Universität Philosophie.
Von Franz Theodor ist ein Porträt erhalten, ein Gemälde, das ihn als gestandenen Schulmeister zeigt und, nach längerem Hinschauen, als unheimliche Person. Das Gesicht zerfließt und wirkt dennoch in seiner Mimik angestrengt. Eine sonderbar fleischige Nasenwurzel drückt die Augen unverhältnismäßig weit auseinander. Auch die Stirn über den kaum vorhandenen Augenbrauen geht in die Breite, findet keine Form. Die Backen hängen müde und schlaff. Das seine Lüsternheit verbeißende Mündchen sitzt über einem ganz und gar kindlichen, durch ein Grübchen geteilten Kinn.
Da will einer sich um nichts in der Welt verraten, spielt den unauffälligen Bürger und gibt unfreiwillig dennoch vieles von dem preis, was ihn quält und worunter seine Nächsten leiden: Daß er fromm zu sein vorgibt, obwohl Zweifel und Verzweiflung ständig an ihm reißen; daß er auf seinen Stand pocht; daß er bis zur Rücksichtslosigkeit auf seiner Autorität besteht und sein sich immer wieder krümmendes Selbstbewußtsein verflucht; daß er den ehrbaren Ehemann, den christlichen Lehrer mit Genugtuung hervorkehrt und seiner gedachten Ausschweifungen und Begierden oft kaum Herr wird; daß er, der zeit seines Lebens von Kindern umgeben ist, ihnen nichts anderes beibringen möchte, als so zu werden wie er und seinesgleichen.
Die Musik, das ist wahr, kann ihm ans Herz greifen, besonders die einfache böhmische, diese aushausigen Melodien, die sich abgelöst haben von der wirklichen Idylle und von ihm bloß noch als sentimentale Signale gehört werden.
Womit ich Franz Theodor Schubert nicht als engstirnigen Spießer, selbstgerechten Bösewicht charakterisiert haben möchte, sondern als einen Mann, der nur einen Zipfel seines Traums erwischte, den er aber, um halbwegs bequem zu überleben, als den ganzen Traum deklarierte. Genau genommen sorgte er sich mehr um sich, um seine Reputation, sein Fortkommen als um das seelische Wohl seiner Frau, seiner Kinder. Da er mit seiner Liebe sparte, bekam er auch wenig.
Von seiner ersten Frau, Elisabeth Vietz, gibt es kein Bild. Dennoch glaube ich von ihr mehr zu wissen als von ihrem Mann. Das allein durch die Musik ihres Sohnes. Er hat vor allem erinnernd auf sie reagiert, hat sie vielleicht sogar verklärt.
Franz Theodor hat sich kaum eingerichtet, falls diese Bezeichnung überhaupt zutrifft für ein Provisorium, einen Wartestand, als sie sich über den Weg laufen, Elisabeth und er. Wie, hat sich in keiner Erinnerung niedergeschlagen, ist auch von den Kindern nicht mitgeteilt worden.
Für den Anfang hätten sie sich ein Märchen ausdenken können, das immer neu und anders erzählt wird. Aber die Wirklichkeit hat das nicht zugelassen. Und deswegen verschwiegen sie die Heftigkeit und Atemlosigkeit, mit der sie aufeinander zustürzten. Er, der Gehilfe von der Karmeliterschule, einundzwanzig Jahre alt geworden, und sie, die Magd aus der Vorstadt Lichtental, die, um drei Jahre älter als er, sich in den Einsamkeiten der Stadt auskannte, wie in den vielfältigen, nicht immer freundlichen Möglichkeiten, ihnen zu entfliehen: diesen Aufschwüngen am Wochenende.
Sie halten sich nicht an die Regeln.
Ist er es, der drängt, oder fürchtet sie, daß ihr die Zeit wegläuft?
Sie erzählt viel von sich.
Er nicht. Das kann er nicht. Er kann sich nicht preisgeben, auch nicht für einen, sie einenden Moment. Er hat sie schon in Besitz genommen, da glaubt sie noch, sich entscheiden zu können.
Sie erzählt, wie ihr Vater, der ein angesehener Büchsenmacher gewesen sei, vor zwölf Jahren mit ihnen aus Zuckmantel in Schlesien aufgebrochen sei. Von Wien hat er sich viel versprochen, sagt sie, alles. Daheim ist es uns nicht gut gegangen.
Hört er zu?
Unterwegs sei die Mutter gestorben, sie wisse nicht, woran. Jetzt waren der Vater und wir drei Kinder ohne sie. Es hätte noch gut werden können, sagt sie. Sie neigt dazu, Schlußstriche zu ziehen und immer wieder Anfänge zu suchen. Mit der Zeit wird sie es bleiben lassen.
Kaum haben wir im »Goldenen Lamm« Quartier genommen, ist der Vater auch verschieden, erzählt sie weiter. Felix, mein Bruder, hat sich als Weber verdingt in Lichtental, Maria Magdalena und ich sind als Hausmädchen untergekommen. Immer hier in unserer Vorstadt, betont sie und meint ein größeres Zuhause, Menschen, die sie kennt, vor denen sie kuscht, die sie mag, respektiert; Wohnungen, in denen sie ein- und ausgeht, von denen sie arbeitend Besitz ergreift, von den Bälgern, den Kindern auch, die sie zu versorgen hat, und wenn sie die Augen schließt, kann es sein, daß einer der jungen Herren an ihrer Hüfte entlangstreicht wie ein Kater und sie es sich gefallen läßt, nicht kratzt wie sonst.
Ich könnte mir ein anderes Leben vorstellen, sagt sie. Er auch. Eine Schule, sagt er, das könnte ein Königreich sein. Warum er sie, schon nach dem ersten oder zweiten Abend, nachdem sie übereinander hergefallen waren und miteinander so schwer wurden wie ein Klumpen Blei, mitnahm in seine Stube im Haus Nr. 152, konnte er sich auch später nicht erklären. Im Schwung des gemeinsamen Aufbruchs erwies er sich als kühn, kümmerte sich nicht um den Tratsch der Nachbarn, des Bruders. Wenn schon, müßtet ihr beide heiraten.
Er wiegelt ab, er will sich umschauen, ob sich nicht doch eine Schule findet, ein ordentliches Zuhause.
Das dauert noch zwei Jahre.
Längst vorher muß er Elisabeth heiraten. Sie erwartet ein Kind. Will sie ihn binden, zwingen? Vielleicht. Aber – und dieser Gedanke verwandelt Elisabeth, münzt ihr Wesen um, erzählt die Geschichte einer Magd um eine Nuance verändert und tückischer –, aber könnte es nicht auch sein, daß sie bereits schwanger war, als sie Franz Theodor kennenlernte? Sie heiraten am 17. Januar 1785 in der Lichtentaler Kirche.
Im Trauungsbuch der Pfarre »Zu den Vierzehn Nothelfern« wird der Beruf des Bräutigams »Franz Schuberth« als »Instruktor« angegeben, worin sich seine »bessere Bildung« ausdrückt: die sechs Gymnasialklassen in Brünn und vermutlich auch sein derzeitiges Philosophiestudium. Auf alle Fälle kann er Latein unterrichten.
Die Braut hingegen, Elisabeth Vietz, hat für das Kirchenbuch keinen Beruf, nicht einmal den einer Magd, sie ist eines »Schlossermeisters Tochter«, und der ist seit Jahren tot.
Die beiden ersten Kinder kommen noch in der Kammer im Lichtentaler Haus 152 zur Welt, Ignaz und Elisabeth.
Franz Theodor gibt nicht nach, er will seine Schule. Elisabeth lernt, im rechten Augenblick zu schweigen, im günstigen zu reden. Von seiner knirschenden Strenge hat sie nichts geahnt, wie nachdrücklich er auf sein Ansehen Wert legt.
Ja, Franz. Nein, Franz.
Sie reagiert schnell. Das mag er. So schnell und geschäftsmäßig, wie er sie in mancher Nacht liebt und danach sofort einschläft, um Kraft zu sammeln für den Unterricht und die Suche nach der Schule.
Ich schreibe: Franz Theodor Schubert sucht eine Schule. So als suche heute jemand eine Wohnung. Unter ähnlich miserablen Bedingungen. Und genau das trifft zu: Er suchte mit der Schule zugleich ein Zuhause – für sich, seine Familie und nicht zuletzt seine Schüler, deren Zahl, hoffte er, bald für den Lebensunterhalt ausreichen würde.
Seine Schule gab es schon. Sie verlangte nur nach einem neuen Lehrer. Die kleine Familie blieb in ihrem Bezirk, dem heutigen Neunten, wechselte nur aus Lichtental auf den benachbarten Himmelpfortgrund, ins Haus »Zum roten Krebsen«, das an der »Oberen Hauptstraße zur Nußdorfer Linie« lag, und jetzt die Nußdorfer Straße 54 ist.
Da nimmt er seine Schule in Augenschein. Genauer: Er mustert die Kammern und Zimmer, in denen er wohnen und lehren wird. Möglicherweise begleitet ihn sein Vorgänger, Anton Osselini, rühmt die Schule, die Gegend, die Kinder, drückt sich gestikulierend vor Wasserflecken an der Wand oder öffnet mit Schwung ein gesprungenes Fenster so weit, daß der Schaden dem prüfenden Blick des Nachfolgers entgeht.
Für die Schulmöbel müsse Schubert selber sorgen. Er, Osselini, habe die seinen anderweitig verkauft.
Jaja, damit habe er gerechnet.
Wie er überhaupt nur noch rechnet.
In dem Haus gibt es sechzehn Wohnungen. Manche Mietpartei lebt schon eine Ewigkeit an der Himmelpforte.
An der Himmelpforte, sagt Franz Theodor, als er Elisabeth die gute Nachricht überbringt. Seit langem lächelt er endlich einmal.
Das könnte was werden, sagt sie leise.
Franz Theodor mietet bei seinem Hausherrn, dem Maurermeister Schmidtgruber, zwei Wohnungen. Die eine, im Parterre, wird die Schule bleiben, ein wenig verändert. In die andere, im Obergeschoß, wird die Familie ziehen, was Elisabeth planend in Angriff nimmt.
In der Kuchel hat es auch genug Raum für die Schlafplätze der Kinder.
Sie mißt ab, richtet in Gedanken ein.
Er tut in den beiden Räumen unten am Hof das gleiche.
Am Heiligen Abend 1787 stirbt in Neudorf der Vater. Die kleine Erbschaft – sechsundneunzig Gulden – hilft Franz Theodor, Schulbänke zu kaufen, eine Tafel.
Schon am 13. Juni 1786 war er von der Landesregierung zum Schullehrer auf dem Himmelpfortgrund ernannt worden.
Zu seinem Verdruß fanden sich anfangs vor allem arme Schüler ein, deren Eltern nicht in der Lage waren, das Schulgeld zu zahlen. Mit der Zeit aber meldeten sich auch Kinder aus solventen Familien.
Beim Schubert wird mehr gesungen als bei seinen Vorgängern. Schon dadurch ändert sich das Tagesgeräusch. Dieses Geräusch, in dem alles eingewoben ist, was die Banalität des Menschentags ausmacht: Türen schlagen, Herr Pospischil, der Nachtwächter, kommt pfeifend heim, die Kinder drücken sich kreischend ins Zimmer, ein Säugling weint, steckt einen zweiten, einen dritten an, ein Hund bellt, im Hof schreit der Schmidtgruber, der Hauswirt, seinen Lehrling an, und rechts nebenan entschließt sich Wandel, der Nichtsnutz, es am hellichten Nachmittag mit seinem Weib zu treiben, sie hören ihn ächzen und ihr Gestöhn, da schlägt schon wieder eines der Kinder unten die Tür zu, daß die Wände wackeln, und auf dem Umgang kreischt ein altes Weib, wenn ihr nicht bald stad seid, kreischt sie, mindestens zum zehnten Mal, und es ist ihrem Gezeter anzumerken, wie gut es ihr tut, und manchmal laufen Ausrufer vorm Haus vorbei, und auf der Gasse wird disputiert und gestritten oder einfach nur getratscht, denen fällt nichts besseres ein, als dem Herrgott die Zeit zu stehlen, dem Teufel ein Ohr abzuschwätzen.
Elisabeth sitzt auf dem Schemel am Fenster und gibt dem Mädchen, das nach ihr getauft wurde, Elisabeth, die Brust. Es wird bald sterben.
Sie lauscht, ist auf dem Sprung. Immer, wenn der Mann die Stiege heraufkommt, will sie seine möglichen Wünsche und Befehle im Kopf ordnen und gerät erst recht durcheinander.
Sie lauscht, ob sich in den Geräuschen aus der Schule, unten im Hof, etwas ändert, Franz Theodor unvermittelt laut wird, eins der Kinder mit dem Stock Schläge bekommt, heult, ob er die Schüler mehr als üblich singen läßt. So kann sie sich auf seine Stimmungen vorbereiten. Sie kommt kaum dazu, an sich zu denken. Entweder ist sie schwanger oder sie hat gerade ein Kind zur Welt gebracht.
Bis Franz geboren wird, der Franz, hat es noch viele Schwangerschaften Zeit.
Schrei nur, Weib, schrei, pflegt Franz Theodor sie zu trösten, wenn die Wehen ihr zusetzen. Das hat er schon beim ersten getan, beim Ignaz. Ignaz Franz, geboren am 8. März 1784, noch in Lichtental, wie auch Elisabeth, geboren am 1. März 1786; sie stirbt im Haus am Himmelpfortgrund, am 13. August 1788 am Fleckenausschlag;
da ist inzwischen Karl geboren, am 23. April 1787, und er geht vor der schwachen und kränklichen Elisabeth am 6. Februar 1788 zugrunde;
schrei nur, Weib, schrei;
Franziska Magdalena wird geboren, am 6. Juli 1788 und stirbt am 14. August 1788 am Gedärmreißen, und während Elisabeth noch den beiden Gischperln nachweint, Elisabeth und Franziska Magdalena, muß sie gewärtig sein, wieder schwanger zu werden, und sie bringt am 5.Juli 1789 ein Mädchen zur Welt, das sie und Franz Theodor aus Trotz und Hoffnung wieder Franziska Magdalena nennen, aber es hält auch nicht lange aus, stirbt am 1.Januar 1792 am Schleimfieber;
schrei nur, Weib, schrei;
Franz Karl bringt sie am 10. August 1790 zur Welt, doch er verläßt diese schon einen Monat später, am 10. September, und nicht einmal ein Jahr darauf wird Anna Karolina geboren, am 11. Juli 1791, die achtzehn Tage danach, am 29. Juli ins Totenregister eingetragen wird, sie sei an Fraisen, an Krämpfen, gestorben;
schrei nur, Weib, schrei;
Petrus kommt am 29. Juli 1792 zur Welt, genau ein Jahr nach dem Tod Anna Karolinas, und er stirbt nicht einmal ein Jahr darauf, am 14. Januar 1793, an den Folgen eines Zahnkatarrhs;
ihm folgt Josef, der am 16. September 1793 geboren wird und mit fünf Jahren, am 18. Oktober 1798, von den Blattern dahingerafft wird;
schrei nur, Weib, schrei;
von nun an jedoch scheint sie für die Zukunft alle Überlebenskräfte zu sammeln und zu horten, denn die drei, die jetzt eingetragen werden in das Verzeichnis der »Geburts- und Sterbefälle in der Familie des Schullehrers Franz Schubert« kommen davon, wachsen auf, ungleiche Brüder, und am Ende, als die Erschöpfung Elisabeth aushöhlte, gibt es noch ein Mädchen, aber ehe Maria Theresia, die Vierzehnte und Letzte in der Kinderreihe am 17.September 1801 geboren wird, bringt Elisabeth noch Ferdinand Lukas am 18. Oktober 1794, Franz Karl am 5. November 1795 und Franz Peter, der hier noch nicht aus der Reihe fällt, am 31. Januar 1797 zur Welt.
Den Tag darauf wird dieser Franz getauft, weil Elisabeth, wie bei den andern Kindern fürchten muß, daß er sich gleich wieder verabschiedet. Er ist besonders klein. Nach Franz wird am 17. Dezember, als Dreizehnte, Aloisia Magdalena geboren. Sie lebt nur einen Tag.
Schrei nur, Weib, schrei!
Währenddessen bewirbt sich Franz Theodor um bessere Stellen, bessere Schulen. Um die in der großen Pfarrgasse in der Leopoldstadt. Um die von St. Augustin. Um die bei den Karmelitern in der Leopoldstadt, wo er bei seinem Bruder Karl die Arbeit begonnen hatte. Nach dessen Tod im Dezember 1804 glaubte er, die Nachfolge antreten zu können. Die Behörde überging ihn, wählte einen andern.
Seid still, herrscht er die Kinder an, gebts um Himmels willen Ruh.
3.Stimmen
Er ist fast drei. Das Haus hat sich um ihn aufgebaut; er kennt sich in ihm aus. Er weiß, wer ins Haus gehört, wer aus welcher Tür kommen könnte, er läßt sich begrüßen oder weicht aus. Alle Leute kennt er an ihren Stimmen. Es sind dunkle und helle Stimmen, weiche und harte, Stimmen, die singen, Stimmen, die nur schimpfen können. Er kennt auch Stimmen, die überhaupt nicht klingen, die stumm scheinen, Stimmen, die sich immer aufgeregt anhören. Manchmal sitzt er in dem schmalen Korridor im ersten Stock, der an den Wohnungstüren entlangführt, und horcht.
Mutters Stimme kennt er aus allen anderen heraus. Sie faßt ihn an, holt ihn zu sich, ohne daß sie unbedingt nach ihm ruft. Hört er sie, läuft er ihr nach, läuft er zu ihr hin.
Mama! Sie zieht ihn einen Augenblick lang an sich, er drückt sein Gesicht in den Rock und hat Lust, sich in den weichen Stoff einzurollen.
Geh, Franzl, sagt sie, und ihre Hände wachsen wie eine Mütze um seinen Kopf.
Unten, in Vaters Schule, singen die Kinder.
Bald wird Vater die Stiege heraufkommen, und er weiß, ob er schimpfen wird oder schweigen, sich mit der Mutter unterhalten oder sogar lachen. Das sagen ihm die Schritte auf der Stiege. Er lauscht nach ihnen. Wenn sie ungut stampfen, verzieht er sich.
Die Stimmen der Brüder hält er ohne Mühe auseinander. Ignaz spricht ein wenig wie der Vater. Er stößt die Wörter aus dem Hals, so daß sie springen und kugeln. Ferdinand, den er mag, weil er ihm oft Geschichten erzählt und ihn tröstet, wenn er sich wehgetan hat, Ferdinand kann seine Stimme zwitschern lassen. Karl, der nur ein Jahr älter ist als er, aber nichts von ihm wissen will, schiebt schnaubend den Atem zwischen die Wörter. Darum ist er kaum zu verstehen.
In einer der Wohnungen singt ein Fräulein so traurig, daß Franz sich, nachdem er zugehört hat, die Daumen in die Ohren stopft.
Was ist? fragt Vater. Er muß wieder hinunter in die Schule; auch Ignaz, der ihm auf Schritt und Tritt folgt. Was ist?
Nichts, Herr Vater.
Er läuft hinunter in den Hof, hockt sich gegen die Hauswand. Sie ist warm. Hat er den Kopf lang genug gegen sie gepreßt, gibt sie Töne von sich, dunkle, warme Steintöne.
Jetzt, im Sommer, stellt er sich in das Tor zum Hof und beobachtet das Treiben auf der Gasse. Mutter sieht das nicht gern. Er dürfe auf keinen Fall vom Haus fort. Ich bitte dich, Franzl. Der Herr Vater schätzt das nicht.
Die meisten Leute, die vorbeigehen, kennt er nicht. Einige wenige grüßen ihn. Servus, Franzl, rufen sie. Er antwortet ihnen und wundert sich, wie groß seine Stimme klingt. Vor manchen Passanten weicht er in den Schatten des Tors zurück. Aber sobald sie vorüber sind, tritt er nach vorn und schaut ihnen nach. Er möchte allzu gern wissen, wohin die fremden Männer gehen. Sie beschäftigen ihn so stark, daß er es wagt, Mutter nach ihnen zu fragen.
Sie wehrt ärgerlich ab. Die sind schlecht, sagt sie, furchtbar schlecht, abgerissene Wandersleute.
Er fragt nicht weiter, legt die Hände fest an die Ohren, so daß es nur in seinem Kopf spricht und singt. Die »schlimmen, schlimmen Wandersleut« singt er. Singt es in seinem Kopf. Niemand kann es hören außer ihm.
Es ist Winter. Im Haus riecht es nach Feuer, Holz und brennendem Dung. Er darf nicht vor die Tür.
Sing, bittet ihn die Mutter, die kaum mehr herumgeht und die Hände vor den Bauch hält.
Kommt ein Vogerl geflogen, singt er.
Wie ein Vogerl, sagt Mutter.
Vater sagt: Ich nehm den Franz bald mit in die Schule. Er soll Geige lernen.
Mutter erwartet ein Geschwister. Du bekommst einen Bruder oder eine Schwester, sagt sie.
Ihr ist übel, sie beugt sich aus dem Fenster und erbricht sich auf die Gasse. Gehts aus dem Weg, schreit sie.
Ignaz, der neben dem Ofen sitzt und Pause hat, ruft, als wäre er der Vater: Das Fenster zu! Mich friert!
Ihn friert es auch. Aber anders. Die Stimmen, die ihm sonst gehorchen, die er nach Belieben bündeln kann, daß mehrere auf einmal zu schwingen beginnen oder auf wunderbare Weise gegeneinander stehen, die Stimmen krümmen sich und werden klein. Ist dir nicht gut? Ferdinand paßt auf ihn auf. Er setzt sich neben ihn auf die Ofenbank, legt den Arm um seine Schultern und flüstert ihm ins Ohr: Der Vater bringt dir das Violinspielen bei. Ihm gefällt das Wort. Es klingt. Es hat eine Stimme. Violine.
Mir ist nicht gut, seufzt die Mutter.
Sie schlafen zu viert neben dem Herd. Er darf der Wärme am nächsten liegen. Ignaz, der älteste, muß am weitesten entfernt schlafen. Karl und Ferdinand zwischen ihnen.
Heute schließt Vater die Tür zur Stube nicht.
Es könnte sein, daß das Kind geboren wird.
Das verschläft er.
Er wacht auf, als der Vater sich mit einer fremden Frau darüber unterhält, daß das Kind gottlob noch die Taufe erhalten habe und mit allen Segnungen verschieden sei.
Mutters Stimme springt. Sie bricht die Wörter auseinander wie hartes Brot.
Warum hat das wieder sein müssen.
Sie muß sich schonen, fordert der Vater.
Tante Maria kommt, um zu helfen, scheucht die beiden großen Brüder herum, doch ihn muß sie herzen: Was weiß ich, wer mir in den Sinn kommt, wenn ich dich anschau, Franzl.
Die tote Schwester heißt Aloisia. Sie ist zweieinhalb Stunden alt geworden.
Franz behauptet, er habe zugeschaut, wie sie die Schwester auf einem Brett hinausgetragen haben.
Das bildest du dir ein, schimpft Ferdinand. Ich werd’s dem Herrn Vater sagen.
Nein, bitte nicht.
Am Sonntag wird für Aloisia in der Kirche gesungen. Vater hat den Priester und alle Sängerinnen und Sänger zusammengerufen, die Musiker dazu.
Schau Franz, die haben eine Violine wie ich, zeigt der Vater.
Ein Mann schlägt mit den Armen, einem großen Vogel gleich, und weckt die Stimmen. Nun dürfen sie so klingen, wie Franz sie immer heimlich hört: alle Stimmen auf einmal.
Nach der Musik führt Vater ihn zu dem Herrn, den er einen Chorregenten nennt. Er muß eine Verbeugung machen, wie sie ihm Ignaz beigebracht hat, und Vater sagt: Verehrter Herr Holzer, ich möcht Ihnen den Franz vorstellen. Ich glaub, er hat ein gutes Gehör und eine schöne Stimme.
Wir werden sehen, sagt Herr Holzer und klöppelt ihm mit einem harten Finger auf den Kopf.
Requiem heißt die Musik für Aloisia.
Sie füllt seinen Kopf aus und verdrängt die andern Lieder. Es ist gar nicht seine Stimme, die er auf der Stiege hört, hell und himmlisch: Diesiraediesillasolvetsaeculuminfavilla.
4.Der Umzug
Am 27. Mai 1801 kauft Franz Theodor ein Haus. Er muß eine Hypothek aufnehmen, doch da das Geld in den folgenden Jahren ständig an Wert verliert, drückt ihn die Verschuldung nicht allzu lang. Das Haus eignet sich mit seinen Räumen im Parterre vorzüglich zur Schule; im ersten Stock hat es genügend Platz für die weiter wachsende Familie. Um Schüler muß Franz Theodor nicht besorgt sein. Die meisten werden mit ihm ziehen, da das neue Schulhaus nur einen Steinwurf vom alten am Himmelpfortgrund entfernt liegt: in der Säulengasse »auf dem Freigrund Sporkenbüchl sub No. 14«. Es trägt den Namen »Zum schwarzen Rössl«. Bald kommen morgens und nachmittags mehr als dreihundert Kinder ins Schulhaus, sogar aus entfernten Stadtteilen. Der Lehrer Schubert hat einen guten Ruf und darum auch keine Mühe, ordentlich ausgebildete Gehilfen zu finden.
Das Haus hat keinen Garten, sondern nur einen drei Stuben großen Hof. Der ist bei weitem enger als der am Himmelpfortgrund. Es könnte sein, daß er Franz dennoch auf den ersten Blick gefällt.
Stimmt das? Ich erzähle von einem Vierjährigen, von dem ich mir ein Bild mache, indem ich die Bilder des Älteren anschaue und dessen Geschichte zurückerzähle. Nicht nur deshalb rede ich mir ein, in den Zügen des Zwanzigjährigen die des Kindes wiederzufinden, das jetzt von Ignaz, dem ältesten Bruder, zum ersten Mal mit zum neuen Haus genommen wird, in das man bald umziehen wird, und ich denke mir einen kleinen stämmigen Buben mit einem etwas zu groß geratenen runden Kopf aus, der, das allerdings bin ich sicher, lieber zuhört als redet, lieber für sich spielt und doch nicht ohne Gesellschaft sein mag.
Auf fast allen Bildern, die von ihm überliefert sind, wirklichkeitsgetreuen oder nachempfundenen, trägt Franz eine Brille. Wann wurde sie ihm angepaßt und aufgesetzt? Wann merkte er, daß er schlecht sieht? Wahrscheinlich gleich nachdem der Vater ihn in die Schule aufgenommen hat. Da er, worauf Franz Theodor bestimmt Wert legte, nicht in der ersten Bank saß, konnte er die Schrift an der Tafel nur undeutlich erkennen. Das fiel dem Vater auf, und sie beschlossen, daß ihm eine Brille angefertigt werde. Die Kinderbrille. Vielleicht glich sie, kaum kleiner, schon der, die er später trug: Die ovalen, dicken Gläser, gerade so groß wie die Augenhöhlen, werden von einer schmalen Metallfassung gehalten und von einem Steg, der sich fest an die Nasenwurzel schmiegt, eng vor die Augen gedrückt. Weshalb es auf manchen Bildern so scheint, als steckten die Augen gleich Murmeln in den Gläsern.
Noch trägt er keine Brille. Noch muß er nicht in die Schule. Obwohl er inzwischen weiß, wie es in der Schule zugeht. Viele Male hat er den Stimmen im Wechsel gelauscht, denen der Kinder und denen des Vaters oder der Gehilfen.
Aber vielleicht hat er das neue Haus auch gemieden, sich verschanzt im alten, wenn die Brüder nach ihm suchten. Endlich hatte er, ohne daß er sich anstrengen mußte, die ungeteilte Aufmerksamkeit der Mutter. Sie erzählte ihm vom Großvater, den Herrschaften, bei denen sie gedient hatte, von großen Küchen und weiten Sälen, von marmornen Treppenhäusern, und sie sang ihm Lieder vor, die ihr die Arbeit erleichterten.
Er ist nun vier. Er sieht sie weinen. Nicht zum ersten Mal. Aber zum ersten Mal ist er allein mit ihr. Er drängt sich an sie, streichelt ihr nasses Gesicht, merkt, wie Weinen ansteckt. Nun muß sie ihn trösten, was sie von neuem weinen macht, worauf er sie trösten kann. Am Ende, wenn sie beide ermattet sind oder sie jemanden kommen hören, bittet sie ihn zu singen: Kommt ein Vogerl geflogen.
Das kann er nicht auf ihrem Schoß oder in ihren Armen. Dazu muß er sich in Positur stellen. Er tritt neben den Stuhl, hält sich an der Lehne fest und singt. Er vergnügt sich an seiner Stimme, die sich schöner anhört, als wenn er spricht.
Wenn ich immer singen könnte, sagt er, und der Herr Vater und du und die anderen Leut auch, das wäre schön.
Sie lacht, nimmt ihn in die Arme: Bei dir würde es mir gefallen, Franzl, doch bei allen – es wäre schrecklich.
Am liebsten möchte er Mutter für sich haben, mit niemandem teilen. Ganz sicher nicht mit dem Vater, der, seit er die neue Schule hat, abends noch ungehaltener und strenger ist, bei der geringsten Störung schreit und um sich schlägt. Vor allem Mutter macht er Vorwürfe. Sie trage an all dieser Unordnung schuld, helfe nicht und verstünde auch nicht, sich darzustellen wie eine Lehrersfrau.
Im September, kurz bevor sie dem Vater in die Säulengasse nachziehen, wird Maria geboren.
Franz hat seine Mutter immer nur schwer atmend erlebt, daß sie ein Kind erwartete, den Bauch vor sich hertrug – ein mächtiger warmer Körper, mit dem er vorsichtig sein mußte, wenn er sich an ihn schmiegte. Maria ist das letzte Kind, das Elisabeth Schubert zur Welt bringt. Sie ist zweiundvierzig Jahre alt.
Es ist anzunehmen, daß Franz Theodor, etwas jünger als seine Frau, ungehalten war über ihre wachsende Müdigkeit und Erschöpfung. Es kann sein, daß er, um sich abzulenken, das kleine Haus in der Säulengasse mit Menschen füllte: Nachdem sein Bruder Karl gestorben war, nahm er Maria Magdalena, dessen Witwe, zu sich. Von ihren beiden Töchtern starb die eine bald nach ihrem Einzug. Wieder lebten sie in großer Enge, beobachteten sich und konnten sich nur das antun, was die anderen duldeten.
Franz freundete sich mit der kleinen Magdalena an. Für eine Zeit zog auch noch der Bruder von Elisabeth, Felix, mit seiner Familie ein, so daß sich über den Schulräumen im Parterre, im ersten Stockwerk des Häuschens, ein Dutzend Menschen drängten, Kinder und Erwachsene, laute und leise, kranke und gesunde. Wenn sie schliefen, vereinte sich ihr Atem und rauschte wie ein Wind durch die Kammern.
Er braucht ein paar Tage, bis er sich Magdalena nähert.
Erst weicht er ihr aus.
Kommst? fragt sie.
Nein.
Komm! sagt sie.
Nein.
Schon sind Fragen und Antworten Muster eines Spiels. Er hat es gern, eingeladen zu werden.
Unten im Hof richten sie sich nicht an einem festen Ort ein, sondern wandern mit der Sonne. Als säßen sie miteinander auf dem Zeiger einer Uhr.
Magdalena bringt ihm bei, Grashalme zu flechten. So mußt du es machen.
Nein.
Doch, schau her!
Viel Zeit für diese Spiele hat er nicht. Der Vater will ihn bald zu sich in die Schule nehmen. Du wirst ein guter Schüler sein, Franzl, verspricht er ihm. Auch Mutter ist davon überzeugt.
Abends, nach der Schule empört sich Vater über einen Mann, der Krieg führt gegen Österreich. Napoleon nennt er ihn, manchmal Buonaparte. Neuerdings heißt er Konsul.
Konsul, sagt Franz vor sich hin.
Was ist das? fragt Magdalena.
Er fängt an, das Wort Konsul zu singen, mal das O betonend, mal das U.
Das gefällt Magdalena. Ihre Spiele enden, bevor er sechs wird.
Sie gehen alle miteinander erst in die Kirche, dann bleibt er unten beim Vater in der Schule.
Er lernt buchstabieren, schreiben. Er lernt rasch, wie es der Vater voraussagte.
Seit er Schüler ist, muß er Vater und Ignaz zuhören, wenn sie musizieren. Außerdem begleitet er die älteren Brüder in die Lichtentaler Kirche zu den Chorproben.
Du hast einen sauberen Sopran, Franzl, stellt Herr Holzer, der Chorregent, fest.
Mit den Buchstaben bringt ihm der Vater Noten bei. Sie sind Franz von Anfang an wichtiger als die Buchstaben.
Er ist sieben.
Zum ersten Mal klemmt er sich eine Violine unters Kinn. Sie ist kleiner als die Ferdinands. Auch der Bogen ist nicht so lang und schwer.
Dazu übt er Klavier, doch nicht so viel, wie es Ignaz verlangt. Das hat er gar nicht nötig. Wenn er still in der Ecke im Hof sitzt, stellt er sich vor, wie die Finger auf die Saiten drücken oder über die Tasten laufen. Er kann sich hören, wenn die andern meinen, er tue nichts. Manchmal setzt sich in seinem Kopf die Musik fort, nicht die auf dem Notenblatt, sondern eine, die nur er kennt. Gibt er während des Übens dieser Musik nach, schimpft ihn der Vater. Er solle aufs Blatt schauen, sich nicht gehen lassen.
Ihn ärgert es, daß der Vater nicht begreift, wie die Lieder, die Stücke ganz von selber weitersingen, sich wiederholen, auf wunderbare Weise verändern.
Oft bittet ihn die Mutter, ihr vorzuspielen. Erst singt er, dann wiederholt die Geige: Kommt ein Vogerl geflogen.
Als er zum ersten Mal in der Messe vor Publikum die Sopransoli singen darf, hat er zuvor mit Herrn Holzer, der betrunken war und ihm Prügel androhte, so wüst geprobt, daß er fürchtete, die Stimme werde ihm wegbleiben.
Er sang das Kyrie und das Agnus Dei. In der Kirche saßen die Eltern, die Geschwister und alle Verwandten aus dem Haus in der Säulengasse. Sie herzten ihn danach wie nie mehr später, auch nicht, wenn es ihm gelang, im Quartett mit Vater, Ferdinand und Ignaz auf der Bratsche so gut zurechtzukommen, daß der Vater nicht umhin konnte, ihn zu loben: Das hast gut gemacht, Franzl.
Sonst springt er anders mit ihm um. Er zwingt ihn, ordentlich zu schreiben, schön zu lesen und vorzutragen, schnell im Kopf zu rechnen, und wenn ihm das nicht gelingt, watscht er ihn.
Mich kannst du nicht täuschen, Franzl!
Was er gar nicht vorhat.
Zwischen Nachtmahl und Bettruh schafft er es mitunter, sich mit Magdalena in dem Verschlag im Hof zu verstekken, sich fest an sie zu drücken, ihr flüsternd zu erzählen, wie er schon bald, aber auf alle Fälle wenn er groß ist, für sie ein Stückerl komponieren wird, ganz allein für sie.
Das tust du ja doch nicht, Franzl, sagt sie.
Er ist zehn.
Herr Holzer hat Vater geraten, ihn zur Prüfung als Sängerknabe der Hofkapelle anzumelden. Beide bereiten ihn vor.
Magdalena trifft er nur noch bei den gemeinsamen Mahlzeiten. Er hat den Eindruck, das Haus fülle sich ständig mit Menschen, und er werde hinausgedrängt.
Vater begleitet ihn zur Prüfung.
Er wird geputzt, neu gekleidet. Mutter hat ihm einen hellgrauen, fast weißen Anzug genäht. Er fällt auf. Die Leute nehmen an, er sei der Sohn eines reichen Müllers.
Es ist der 30. September 1808. Seit Mai befindet er sich nun in der Mangel von Vater und Michael Holzer. Damals hat in der »Wiener Zeitung« eine Aufforderung gestanden, die der Vater ihm so vorlas, als gelte sie ihm allein. Nur ihm:
»Da in der k.k. Hofkapelle zwei Sängerknabenstellen neu zu besetzen sind, so haben diejenigen, welche eine dieser Stellen zu erlangen wünschen, den 30. September Nachmittag um drei Uhr im k.k. Konvikte am Universitätsplatz Nr. 796 zu erscheinen, und sich der mit ihnen sowohl in Ansehung ihrer Studien bisher gemachten Fortschritte, als auch ihrer in der Musik etwa schon erworbenen Kenntnisse vorzunehmenden Prüfung zu unterziehen, und ihre Schulzeugnisse mitzubringen. Die Konkurrenten müssen das zehnte Jahr vollendet haben, und fähig sein, in die erste Klasse einzutreten. Wenn die aufgenommenen Knaben sich in Sitten und Studien auszeichnen, so haben sie nach der allerhöchsten Anordnung auch nach der Mutierung der Stimme im Konvikte zu verbleiben, widrigenfalls sie nach Mutierung der Stimme aus demselben auszutreten haben.«
Er war nicht allein. Vor dem Musiksaal wartete ein ganzer Pulk von Prüflingen. Auf einmal war es ihm gleich, ob er die Prüfung bestehen würde, und es ging ihn nichts an, daß Vater ihm ins Ohr sagte, er zweifle nicht an seinem Können. Ich glaub an dich, Franzl.