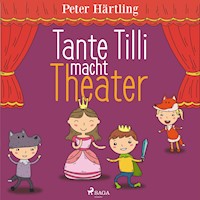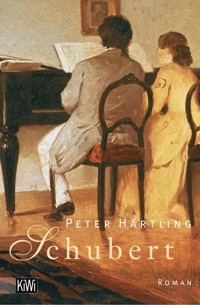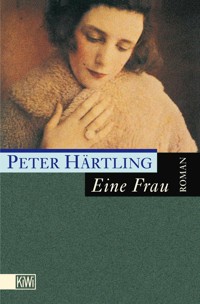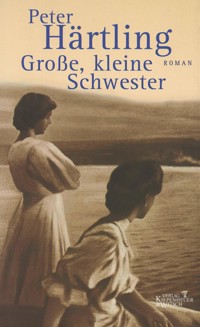10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der vor zwanzig Jahren zum ersten Mal erschienene Roman "Hölderlin" von Peter Härtling markiert einen Wendepunkt im Werk des Autors. Der Roman wurde zu einem Vorbild für die literarisch-biographische Erforschung eines Künstlerlebens, das in seinen menschlichen und geschichtlichen Spannungen von ungeahnter Aktualität geblieben ist. Mit Sachkenntnis und Sensibilität, literaischer Phantasie und Einfühlungsvermögen gelingt es Härtling, Friedrich Hölderlin als Mensch und Poet zu beschreiben, sein Leben und seine Zeit so zu entwerfen, daß sie für uns lebendig werden. Dabei vermag es Härtling, den politisch bewegten Hölderlin, aber auch den liebenden neu und differenziert zu beschreiben. Der Roman ist jedoch nicht nur eine inzwischen berühmt gewordene Version von Hölderlins Leben, so wie es gewesen sein könnte, er ist auch ein Novum in der Art, wie Härtling seinen eigenen Arbeitsprozeß und seine Beziehung zu Hölderlin, seinem Werk und der Landschaft, aus der er schöpft, in den Roman integriert hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 748
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
» Buch lesen
» Über das Buch
» Informationen zum Autor (Klappentext)
» Lieferbare Titel / Lesetipps
» Impressum
Inhalt
Erster Teil: Kindheit und Jugend
Lauffen, Nürtingen, Denkendorf, Maulbronn (1770–1788)
Die beiden Väter
Die erste Geschichte
Denkendorf
Die zweite Geschichte
Maulbronn
Die dritte Geschichte
Zweiter Teil: Studium
Tübingen (1788–1793)
Freundschaften
Die vierte Geschichte
Neue Freunde
Die Reise in die Schweiz
Die Revolution
Die fünfte Geschichte
Privates norm Aufbruch
Die sechste Geschichte
Dritter Teil: Hofmeister und Philosoph
Waltershausen und Jena (1794–1795)
Die siebte Geschichte
Ein Anfang
Die achte Geschichte
Der Zögling
Die Großen von Weimar und Jena
Vierter Teil: Ein Zwischenstück
Nürtingen (1795)
Fünfter Teil: Diotima
Frankfurt (1796-1798)
Die Stadt
Die neunte Geschichte
Hyperion
Die zehnte Geschichte
Die Krise
Die elfte Geschichte
Vorahnungen
Die zwölfte Geschichte
Sechster Teil: Unter Freunden
Homburg, Stuttgart, Hauptwil, Nürtingen (1798–1801)
Einwurf
Die Prinzessin
Der kleine Kongreß
Böhlendorff
Die dreizehnte Geschichte
Der Friedensbote
Die vierzehnte Geschichte
Stimmen von gestern
Siebter Teil: Die letzte Geschichte
Bordeaux, Nürtingen, Homburg (1802–1806)
I
Die erste Widmung (Sinclair)
Achter Teil: Im Turm
Tübingen (1807–1843)
[Menü]
Erster TeilKindheit und Jugend
Lauffen, Nürtingen, Denkendorf, Maulbronn (1770–1780)
[Menü]
I
Die beiden Väter
Am 20. März 1770 wurde Johann Christian Friedrich Hölderlin in Lauffen am Neckar geboren –
– ich schreibe keine Biographie. Ich schreibe vielleicht eine Annäherung. Ich schreibe von jemandem, den ich nur aus seinen Gedichten, Briefen, aus seiner Prosa, aus vielen anderen Zeugnissen kenne. Und von Bildnissen, die ich mit Sätzen zu beleben versuche. Er ist in meiner Schilderung sicher ein anderer. Denn ich kann seine Gedanken nicht nachdenken. Ich kann sie allenfalls ablesen. Ich weiß nicht genau, was ein Mann, der 1770 geboren wurde, empfand. Seine Empfindungen sind für mich Literatur. Ich kenne seine Zeit nur aus Dokumenten. Wenn ich »seine Zeit« sage, dann muß ich entweder Geschichte abschreiben oder versuchen, eine Geschichte zu schreiben: Was hat er erfahren? Wie hat er reagiert? Worüber haben er, seine Mutter, seine Geschwister, seine Freunde sich unterhalten? Wie sah der Tag mit Diotima hinter der geschriebenen Emphase aus? Ich bemühe mich, auf Wirklichkeiten zu stoßen. Ich weiß, es sind eher meine als seine. Ich kann ihn nur finden, erfinden, indem ich mein Gedächtnis mit den überlieferten Erinnerungen verbünde. Ich übertrage vielfach Mitgeteiltes in einen Zusammenhang, den allein ich schaffe. Sein Leben hat sich niedergeschlagen in Poesie und in Daten. Wie er geatmet hat, weiß ich nicht. Ich muß es mir vorstellen –
– das Geburtshaus war der ehemalige Klosterhof. Einen Tag später schon wurde das Kind getauft. Die eilige Taufe war üblich, denn man fürchtete um das Leben eines jeden Säuglings, auch der Mutter, und war darauf bedacht, die Neugeborenen in die Gemeinschaft der Kirche aufgenommen zu wissen. Es war das erste Kind der Hölderlins. Seine Mutter war im Jahre seiner Geburt zweiundzwanzig Jahre alt, sein Vater vierunddreißig.
Die Familie genoß Ansehen, sie hatte Geschichte und Vermögen. Das schwäbische Bürgertum war damals, mehr noch als heute, verbunden durch Verwandtschaft und Beziehung, durch gemeinsame Erinnerungen an Lateinschulen, Seminare, Gymnasien, die Universität. Man half sich, schätzte sich, haßte sich häufig insgeheim. Der Pietismus nötigte zu Demut und Bescheidenheit. Die Pfründen blieben unter Vettern und Basen, wofür sich der zärtlich-hämische Begriff von der »Vetterleswirtschaft« bildete.
Hölderlins Vater, Heinrich Friedrich, kam aus Lauffen, war auf eben demselben Klosterhof aufgewachsen, als dessen »Meister und geistlicher Verwalter« er nun wirkte. Er hatte die Lateinschule in Lauffen besucht, das Gymnasium, in Tübingen die Rechte studiert und 1762, nach dem Tod seines Vaters, den Klosterhof übernommen, wobei von einem Kloster nicht mehr die Rede sein konnte, denn das zu Beginn des 11. Jahrhunderts und zum Andenken an ein im Neckar ertränktes Grafenkind (weshalb ertränkt?) namens Regiswindis gegründete Kloster war in der Reformation säkularisiert und später abgebrochen worden, der Wirtschaftshof hingegen, stattlich und weitläufig, blieb erhalten.
Der Hofmeister Hölderlin muß ein wenig großspurig gewesen sein. Er kleidete sich aufwendig, lebte seinem Stand angemessen oder sogar darüber hinaus, schätzte feine Gesellschaft um sich und war ein beliebter Gastgeber. Vier Jahre stand er dem Haus als Junggeselle vor, wahrscheinlich gehütet und gehätschelt von Haushälterinnen. 1766 heiratete er die Tochter des Pfarrers Heyn aus Cleebronn, Johanna Christiana, ein frommes, wohl auch scheues Mädchen, das auf dem Bild, das der Mann sogleich von ihr malen ließ, eingeschüchtert und ahnungslos erscheint. Nur die großen Augen sehen unbefangen auf den Betrachter. Sie ist achtzehn, wird einbezogen in ein an Abwechslungen, Festen reiches Leben, das sie im väterlichen Haus nicht gekannt haben wird. Ihr Mann, sich und seinen Ruf bestätigend, beschenkt sie mit Schmuck, mit Kleidern.
Vier Jahre lang müssen sie auf das erste Kind warten. Die wachsende Ungeduld der Familie läßt sich ausmalen. Im Schwäbischen nimmt die Verwandtschaft Anteil; Johanna wird von ihrer Mutter befragt und beraten worden sein; die Eltern Heinrichs waren nicht mehr am Leben, doch wird es genügend ältere Onkel und Tanten, auch Vettern gegeben haben, die ihn, die Scherze lassen sich denken, derb auf die Vernachlässigung seiner ehelichen Pflichten hinwiesen.
Der Vater Johannas war kein Schwabe. Er kam von einem thüringischen Bauernhof, studierte jedoch Theologie in Tübingen, amtierte als Pfarrer erst in Frauenzimmern, dann in Cleebronn. Aus einer der ehrwürdigsten schwäbischen Familien dagegen stammte Johannas Mutter, Johanna Rosina Sutor. Zu ihren Vorfahren zählte Regina Bardili, der nachgesagt wird, die »schwäbische Geistesmutter« zu sein, Ahnin von Hegel und Schelling, von Schiller, Mörike und Hölderlin.
Nach vier Jahren kommt Friedrich zur Welt. Der Fritz. Der Holder. Der Hölderle. Die Taufe muß, selbst wenn nicht alle Paten anwesend waren, ein gewaltiges Fest gewesen sein. Einer der wichtigsten Gäste, eine leitmotivische Figur, der Freund beider Väter, Oberamtmann Bilfinger, tat seinen Dienst damals noch in Lauffen, erst später in Nürtingen und Kirchheim.
Lang dauerte das Glück nicht. So hochgemut der Vater lebte, so gefährdet war er. Die Geburt einer Tochter freute ihn noch, doch am 5. Juli 1772 starb er an einem Schlaganfall, wie manch anderer aus seiner Familie, »schlagflüßige Leute«. Er war sechsunddreißig Jahre alt geworden. Gut einen Monat später brachte Johanna das dritte Kind zur Welt, Maria Eleonora Heinrike, »die Rike«, die Schwester. Die Ratlosigkeit der jungen Witwe wird übermächtig gewesen sein, die Tränen, der Trost der Verwandten, die Lektüre von ihr unverständlichen Papieren, wobei wahrscheinlich Bilfinger und ihre ebenfalls verwitwete Schwägerin, Frau v. Lohenschiold, zu der sie mit den Kindern gezogen war, geholfen haben. Der Dreijährige ist unruhig. Man hält ihn an mitzubeten, die Hilfe des Herrn zu erflehen, denn der Glaube half Johanna Hölderlin, die pietistische Selbstbescheidung. Sie ließ davon nicht ab, bis zu ihrem Ende. Der Fritz, noch weniger Worte mächtig, still und wohlerzogen, ist vom allgemeinen Leid eingeschüchtert. Er hört sie reden, klagen und dies, was von den Interpreten meist vergessen wird, nicht auf Hochdeutsch, sondern im Dialekt, der seine Verse später oft merkwürdig einfärben wird.
Vielleicht hat sich Johanna Hölderlin noch als alte Frau die Verluste, Namen für Namen, Datum für Datum aufgezählt. Sie hätte an ihrem Gott zweifeln können, doch nach allem, was man von ihr weiß, hat sie sich ihm gebeugt. Was sind das für jähe Abbrüche: eben noch die Herrin eines großen Hausstandes, dann ein unvermuteter Tod, der Abschied von diesem Anwesen, das sie für ein Leben hätte aufnehmen sollen; mit vierundzwanzig Jahren Witwe, Mutter dreier Kinder, Erbin eines nicht unbeträchtlichen Vermögens. Sie durfte an nichts anderes denken als an eine neue Häuslichkeit, einen neuen Gefährten, denn mehr wußte sie nicht, hatte sie nicht gelernt. Ihr Vater, der Pfarrer Heyn, starb zwei Monate nach dem Mann.
Ihre Erscheinung war gewiß von Reiz, jugendlich, »voller Anmut« und dem unbeholfen gemalten Porträt aus dem Jahre 1767 ist abzulesen, wie in sich gekehrt sie war, einem dauernden Schmerz zugewandt, nicht ohne Lust an einer wortarmen Melancholie. »Geistig« sei sie nie gewesen, heißt es, doch überaus gütig. Es fragt sich, was mit geistig gemeint sei. Zwar war sie den Ausbrüchen des Sohnes nicht gewachsen, aber sie hat alle seine Gedichte gelesen, und diese Stimme war ihr vertraut; hochfliegenden Unterhaltungen wird sie schweigend zugehört haben. Sie dachte nicht in Metaphern. Sie dachte in engen Wirklichkeiten, wünschte, daß er Pfarrer werde. Sie war zum Dienen erzogen worden. Für eine Frau gehörte es sich so, und Gottes Wille war ihr ohnehin Gesetz.
Jetzt sitzt sie aber noch da, bei der Schwägerin Lohenschiold, und lebt ihren Jammer aus. Das kann sie. Der Sohn hatte sie später manchmal gemahnt, sie solle sich nicht derart in ihren Schmerz verbeißen. Sie wartet. Sie hat das Warten noch nicht gelernt. Die Kinder lenken sie ab: die Töchter müssen versorgt werden, und Fritz ist, wie alle Dreijährigen, ständig auf Erkundung, reißt Schubladen auf, zieht an Tischdecken, gefährdet das Geschirr.
In diesem Jahr, oder im kommenden, ist sie zum erstenmal von Johann Christoph Gok besucht worden. (Von ihm kenne ich kein Bild. Nirgendwo ist eines reproduziert in den Erinnerungsgalerien.) Nach Schilderungen muß ich ihn mir ausdenken, nach dem Schatten, der von den Sätzen anderer geworfen wird, und auch diese Sätze sind karg, als hätte es ihn nur als unaufhörlich Tätigen gegeben, den Weinhändler, Bauern und Bürgermeister von Nürtingen, den Eigner des zweiten Vaterhauses, nicht auch als Gefährten, Erzieher, als den geliebten »zweiten Vater«. Er hatte den Grasgarten am Neckar gekauft, von dem aus der Junge zum erstenmal auf seine Landschaft schaut. Vier Jahre war Hölderlin alt, als seine Mutter von neuem heiratete; zehn, als der zweite Vater starb. Das schreibt sich so hin.
Ängste konnte der Junge vor dem Neuen nicht empfinden: Gok war ja als Onkel dagewesen, in Lauffen, und unversehens war er Vater, ersetzte einen anderen, den Hölderlin nicht erinnern konnte, ein Bild, das er sich später einreden würde, zwei Vaterbilder gegen das übermächtige Mutterbild setzend.
Johanna hatte Gok als Freund ihres Mannes kennengelernt. Auch mit Bilfinger war er befreundet, mit ihm gemeinsam betrieb er eine Zeitlang in Nürtingen eine Weinhandlung. Sie kannte ihn. Kannte sie ihn gut? Vielleicht hatte er ihr schon zu Lebzeiten ihres ersten Mannes gefallen. Vielleicht hatte er weniger zum Großspurigen geneigt, war bescheidener aufgetreten. Und sie hatte insgeheim verglichen. Gok wird an der Beerdigung Hölderlins teilgenommen haben. Hat er sie gleich danach besucht, hat er sie getröstet, sie beraten? Oder hat er sich zurückgehalten und diese Hilfen Bilfinger überlassen?
Dann werden sich, im Rahmen des Schicklichen, Besuche gehäuft haben.
Er hat sich mit den beiden Frauen unterhalten. Grüß Gott, Frau v. Lohenschiold. Grüß Gott, Frau Hölderlin.
Er hat kleine Geschenke mitgebracht.
Er hat mit dem Fritz gespielt. Er hat die Rike in ihrer Wiege betrachtet und sich immer wieder darüber erstaunt gezeigt, wie gut sie gedeihe.
Er hat sich gewiß nicht eingeschlichen.
Irgendwann, im Laufe des Jahres 1773, wird er sie gefragt haben, ob sie seine Frau werden wolle.
Sie werden über eine Frist nachgedacht haben. So rasch trennt sich niemand von Erinnerungen.
Wahrscheinlich wird Bilfinger vermittelt haben.
Ja, sagt sie, gut, s’ isch recht, ’s wird’s beschte sei.
In solchen Gesprächen versichert man sich nicht seiner Liebe.
Gok, aus der Heilbronner Gegend stammend, ist so alt wie Johanna Hölderlin. Sie sind, nach heutigem Verständnis, bei ihrer Heirat beide jung: sechsundzwanzig; sie freilich schon Mutter von drei Kindern, verstört und mißtrauisch: daher legt sie auch Wert auf eine Feststellung der Vermögen, daß eine Gütertrennung vorgenommen werde – die Familie braucht sich fürs nächste keine Sorgen zu machen; überdies ist der listigen Tatkraft Goks zu trauen.
Ich erzähle von einem Leben, das vielfach erzählt wurde, das sich selbst erzählt, aber auch verschwiegen hat. Die Daten sind zusammengetragen worden. Ich schlage nach, bekomme Auskunft, aber wenn es dann heißt, Gok kauft am 30. Juni 1774 den Schweizer Hof an der Neckarsteige in Nürtingen, tritt meine Erinnerung hinzu, denn in Nürtingen habe ich dreizehn Jahre lang gelebt, länger als Hölderlin, und ich kenne den Schweizer Hof als eine Schule, die seinen Namen trägt, die nicht mehr dem gleicht, was so beschrieben wird: »Ein sehr stattliches Anwesen, mit landwirtschaftlichen Gebäuden und Kellern« – da bin ich Tag für Tag vorbeigegangen, es ist ein mächtiges Haus, auf Felsen gebaut wie die Stadtkirche, die in den Granit geschlagenen Keller wird es noch geben, und die Terrasse wird früher der Garten gewesen sein oder der Hof. Gok hat dafür 4.500 Gulden zahlen müssen (rechnete man es um, käme man auf etwa 70.000 Mark).
Das kenne ich also. Aber er kannte es anders.
Eigentümlich, daß das Kind kaum sichtbar wird. Die frühen Träume hat Hölderlin später nicht nachgeredet, er hat sie allenfalls überhöht, in Visionen hineingetrieben, in denen diese einfache Umgebung verblaßt. Er wird von niemandem verschwiegen, er ist eben dabei. Eines von drei Kindern. Keine Last, doch eine dauernde Sorge. Auch das, was rundum im Land geschieht, bleibt gleichgültig, wird nur manchmal in den Kommentaren des Vaters angedeutet, der sich mit den Finanzen der Gemeinde plagen muß, der auf die Beamten des Hofes flucht, sich in seine eigenen Geschäfte rettet.
Die Kinder hatten sich an Gok gewöhnt, manchmal fuhr die Mutter mit ihnen nach Nürtingen, und sie mußten bei der Tante Lohenschiold bleiben. Johanna hat ihnen gewiß erst kurz vor dem Umzug nach Nürtingen gesagt: Der Onkel Gok wird euer Vater.
»Der zweite Vater.« Diese Mitteilung verändert den Mann. Der Bub hat mit ihm gespielt, sich über Geschenke gefreut, doch wie hätte er über den aufmerksamen Besucher nachdenken sollen – es war eben der Onkel Gok. Nun ersetzt er den anderen, den Schatten, den »wirklichen Vater«, der immer wieder aus der Erinnerung der Mutter trat, bis auch sie sich der Gegenwart zuwandte, und die Erzählungen »von früher« spärlicher wurden. Eigensinnig hielt er an »seinem Vater« fest.
Es ist Herbst. Es kann sein, daß Johanna mit den Kindern noch einmal über den Klosterhof gegangen ist. Die Leute grüßen respektvoll.
Er reist zum erstenmal und gleich für immer von einem Ort weg. Er wird sich an die Abschiede gewöhnen, an die Furcht vor stets neuer Fremde. Der Wagen fährt vor, es ist früh, man wird den ganzen Tag unterwegs sein. Ein anderer Wagen hat schon den Hausrat nach Nürtingen gebracht. Es ist kalt. In ein paar Tagen, am 10. Oktober, wird Johanna heiraten. Dann soll alles schon im neuen Haus geordnet sein. Vielleicht hat Bilfinger, der Freund, sie abgeholt.
Bekannte kommen und bringen Abschiedsgaben. Sie laufen winkend neben der Kutsche her. Hier hat sie zu leben begonnen, mit welchem Schwung. Sie ist erleichtert, kann wieder leben.
Es ist eine andere Kindheit als die meine, alles ist anders. Wenn er Entfernung denkt, denkt er sie anders als ich; er denkt sie als Wanderer, als Reiter oder als Passagier einer Pferdekutsche. Wenn er seine Kleider fühlt, fühlt er sie anders als ich. Sie sind enger, grober. Er weiß es nicht. Wenn er warm meint, sieht er andere Wärmespender als ich, auch das Licht ist anders für ihn. Wenn er Straße sagt, sieht er andere Straßen als ich, anders bevölkert, anders befahren.
Ich muß mich in das Kind hineinfinden; ich muß es erfinden. Wenn einer 1777 sagt, er gehe jetzt über den Neckar in den Grasgarten, dann kenne ich den Weg, die Neckarsteige hinunter, doch schon das Tor ist nicht mehr da, und auch die Brücke hat anders ausgesehen. An der Neckarsteige standen kaum Häuser und nicht die, die ich erinnere, zum Beispiel aus den fünfziger Jahren die Bücherstube Hauber oder das alte Fachwerkhaus, in dem eine Elektrohandlung untergebracht ist; den Weg am Neckar kann ich mir noch vorstellen, aber das Wehr und das Elektrizitätswerk gab es nicht.
Dort, wo sich der große Garten befand, am Neckarufer gegenüber der Stadt, stehen heute Häuser, und die Asphaltstraße nach Neckarhausen hat den Bereich geteilt. Dennoch gelingt es mir, den Garten wiederherzustellen, aus eigener, nicht mehr genauer Erinnerung: Kurz nach dem Krieg spielten wir dort öfter auf einem großen verwilderten Grundstück, das Gras reichte uns übers Knie, wir fanden an Sträuchern Stachelbeeren, Johannisbeeren.
Im Nürtinger Haus wird er schwer heimisch. An die neuen Leute gewöhnt er sich allmählich, Bilfinger ist ihm vertraut, mit ihm und dem zweiten Vater sitzt er bisweilen im Weinkeller, atmet den Dunst von feuchtem Stein, Holz, Schwefel und Weinsäure. Er hört den Männern gern zu. Sie planen unentwegt. Außerdem ist er stolz auf den Vater, der beim Schultheiß auf dem Rathaus aus- und eingeht. Manchmal läuft er an der Hand des Vaters über den Marktplatz. Da ist der Brunnen. Nein, da ist der Brunnen nicht. Schon wieder trennt uns eine Erinnerung. Dieses Mal aber nur für eine Spanne von Jahren. Dann sehen wir beide den Brunnen. Denn der Zwanzigjährige, der Tübinger Stiftler, der an seine Mutter eben geschrieben hatte, er wolle bei der geistlichen Laufbahn bleiben, und dies wider Willen, nur um sie nicht durcheinanderzubringen, er hat den Brunnen gekannt, hat gehört, unter welchen Umständen er gesetzt worden ist, daß er in Königsbronn gegossen wurde, und daß Schlosser Eiselen das Schmiedeeisen angebracht hat. Das gehört zum täglichen Gerede: Kennst du den Koch von Oberboihingen, weißt du, den Orgelbauer, der hat den Brunnen vergoldet.
Jetzt erinnern wir uns beide an den Brunnen.
Es gibt kein Bild des Siebenjährigen. Erst mit sechzehn wurde er gezeichnet. Heute hätten wir ein Bündel von Fotografien. Die Hölderlins, die Goks hätten wie andere Familien ihre Chronik fotografiert. Der Kleine, der Allerkleinste, da in der Ecke, der warst du. Und der Mann lacht und wundert sich der alten Mutter zuliebe.
Oft geht er hinunter zum Garten, dort ist er für sich. Zwar heißt es, er habe durchaus rauh spielen können, doch oft zieht er sich zurück, und der Garten macht dem Kind die Flucht leicht. Nimm die Rike mit, ruft die Mutter. Manchmal gelingt es ihm, ohne die Schwester fortzukommen. Muß er Rike mitnehmen, zieht er sie in einem Wägelchen hinter sich her. Er spielt Pferd oder Reiter oder Postmeister. Er redet auf Rike ein, ohne eine Antwort zu erwarten. Irgend jemand wird damals schon festgestellt haben, daß er mundfertig sei. Einmal galoppiert er, dann wieder schleicht er, als sei er ein alter Mann. Die Leute kennen ihn alle, den Buben vom Gok, vom Bürgermeister.
Er ist zierlich, fast schmächtig. Später wird man ihm breite Schultern attestieren.
Er hat braune Augen, braunes Haar.
Seine Stirn ist hoch und gerade.
Die Unterlippe aufgeworfen.
Und die Kerbe im kräftigen Kinn malt jeder.
Ich denke mir, daß er blaß war, eine feine wächserne Haut hatte, im Gegensatz zu den anderen Buben.
Aber ich will ihn nicht verzärteln.
Paß auf deinen Anzug auf! hat ihm die Großmutter Heyn nachgerufen.
Er ist sehr säuberlich, doch er vergißt sich im Spiel, rasch sind Grasflecke an Weste und Kniehose. Die Schnallenschuhe und die wollenen Strümpfe zieht er aus. Er schlägt mit einem Stecken die hohen Halme, verbirgt sich hinter einer Uferweide, ruft wie ein Totenvogel, was die Rike ängstlich macht. Sei schtill, bleib hocke, i ben ja do.
Er ist da, erzählt Geschichten, legt sich auf den Rücken, phantasiert Wolkenfiguren, mitunter ist es so spannend, daß die kleine Schwester eine Weile zuhört. So liegt er oft. Erst sieht er nur den Himmel, dann »das Gebirg«, den Albtrauf, den Jusi, den Neuffen und die Teck, dann die Stadt, die Kirche auf dem Fels, darunter die verrutschte Zeile der Häuser, das Neckartor, die Brücke: von dort ist er gekommen.
An diese Tage wird er sich erinnern, vor allem, wenn er heimkommt, ratlos, »ohne Geschäft«, und es wird nicht die Heldenerinnerung sein, »da ich ein Knabe war«, sondern der Drang »heimzugehn, wo bekannt blühende Wege mir sind, / Dort zu besuchen das Land und die schönen Tale des Neckars –.« »Törig red ich. Es ist die Freude.«
Die Freude? Etwas wiederzufinden, das sich erholt hat, eine Umgebung und Menschen, die sein Gedächtnis fassen kann, auch wenn es das Kind anders erlebte. Jedesmal kehrt er wirklich heim, wird aufgefangen, gepflegt und von niemandem gedrängt, ein anderer, größerer zu sein.
Die Mutter sitzt an einem der Fenster zur Neckarsteige, es ist fast ein Hochsitz, und schaut hinunter auf die Häuser an der Stadtmauer, aufs Neckartor. Es gefällt ihr, wie die Ochsenfuhrwerke sich den Buckel hinaufmühen müssen. Sie kann die Rufe der Bauern hören, das Knattern der Räder auf den Steinen. Oft sitzt ihre Mutter, die Großmutter Heyn, bei ihr. Eine Magd stößt den Fritz in die Stube, er ist erhitzt und betreten, doch seine Augen triumphieren. Er habe Maikäfer gesammelt und sie im Zimmer der Mägde losgelassen. Die seien vor Angst außer sich gewesen, und der Lausbub habe noch gejubelt. Die Großmutter will für einen Augenblick lachen, sie verbietet es sich, denn ihre Tochter bleibt ernst und tadelt den Buben: Du hast den merkwürdigsten Unfug im Kopf, kannst du es nicht bleiben lassen? Muß ich dich immer wieder schimpfen? Soll ich es dem Vater sagen? Er schüttelt den Kopf, erwidert: Sie dürfen mir nichts tun, es ist die Freude, ganz einfach die Freude.
Er freut sich auf den Maientag, den der Dekan Klemm zu einem Fest der Menschenfreundschaft und der Gottesliebe erklärt hat. Es wird Wecken, Most und süßen Apfelsaft geben, die Mädchen werden Reigen tanzen, der Dekan wird über die Nächstenliebe und die Gottesliebe reden, über die täglichen guten Werke, sie werden miteinander singen, sich an den Händen fassen, die größeren Buben auf den Maienbaum klettern und Gewinne aus dem Kranz reißen, sie werden auf den Neckarwiesen spielen, der Vater wird fortwährend Leute begrüßen, die Familie ihren »eigenen Tisch« haben und dort empfangen – bis in den Abend hinein, »noch ein halbes Stündchen, bitte«, und in der einbrechenden lauen Dunkelheit wird ihn die Magd oder die Großmutter nach Hause bringen.
Von seinem sechsten Jahr an besucht er die Lateinschule. Diesen Weg kann ich nachgehen, bin ich viele Male gegangen, so, wenn ich von der Marktstraße zur Neckarsteige wollte und durchs »Höfle« abkürzte. Viele Häuser von damals stehen nicht mehr, sogar der Verlauf der Gassen hat sich ein wenig verändert. Aber selbst auf einem Stadtplan von 1830 finde ich mich leicht zurecht.
Es ist früh, wenn er zur Schule muß. Die ersten Male haben ihn die Mutter oder eine Magd hingebracht, obwohl er sich zurechtgefunden hätte: I kann des alloi. Er muß nicht zur Neckarsteige hinunter, sondern er verläßt das Haus durch den Garten, durchs Hintertor. Ein Gäßchen führt zur Kirchstraße. Es ist verwinkelt, eng. Die Mauern geben, wenn es Nacht und still ist, die Schritte auf dem Pflaster als Echo wider. In meiner Kindheit befand sich hier das Stadtgefängnis, das es zu seiner Zeit dort nicht gab. Es wird, nehme ich an, ein Bauernhaus gewesen sein. Schon von hier aus kann er die Stadtkirche sehen, Sankt Laurentius. Man wird ihm erzählt haben, daß noch vor dreißig, vierzig Jahren unmittelbar neben der Kirche das Schloß gestanden habe, ein riesiger Bau mit vier Erkertürmen an der Neckarsteige und einem schönen Innenhof. Es ist abgerissen worden. Über den freigewordenen Platz geht er. Man hat Kastanien und Linden gepflanzt. Die kenne ich auch. Für ihn sind es junge Bäume, die noch von Pfosten abgestützt werden. Die Schule steht in geringem Abstand längs zur Kirche, schon wieder am Rand des Felsens, so daß zur Marktstraße durch die Schule hindurch ein Treppenhaus geführt werden mußte. Die Schule ist neu. Sie ist erst vor neun Jahren gebaut worden. Neben ihr, in einer Flucht, die Vogtei und Kellerei (für mich ist es das Landratsamt) und die Stadtschreiberei (dort, im Amtsgericht, habe ich als junger Journalist Tage verbracht, um über Prozesse gegen kleine Diebe, Hehler, Landstreicher zu schreiben). Der Bezirk zwischen Schule und Kirche gefällt ihm. Hier ist es im Sommer kühl, hier kann man gut spielen.
Er ist ein braver Schüler. Er muß anderes lernen als ich. Schon mit sechs Jahren repetiert er griechische, lateinische, hebräische Vokabeln, und der Magister versucht, ihm Philosophie und Theologie beizubringen. Es ist ein unvorstellbares Pensum. Der Magister Kraz ist zufrieden mit ihm. Man weiß, er wird auf das Seminar gehen, danach aufs Stift. Er soll, so wünschen es seine Eltern, Pfarrer werden.
An den Nachmittagen bringt ihm der Diakon Nathanael Köstlin, der zweite Stadtpfarrer nach dem Dekan Klemm, weiteres bei, folgen die Privatstunden; Köstlin soll ihn aufs Landexamen vorbereiten. Erst hatte er sich vor dem Diakon gefürchtet. Er war vom Vater in die gute Stube gerufen worden, die Eltern saßen mit einem dicken Mann am runden Tisch, tranken Wein, der Vater winkte ihn heran. Er zögerte. Es schien ein feierlicher Augenblick zu sein. Du mußt keine Angst haben, es passiert dir nichts, sagt Köstlin. Die Mutter sagt, während der Junge langsam zum Tisch geht: Er ist eben ein bißchen scheu. Er setzt sich. Wartet. Gok nippt am Glas, sieht seinen Stiefsohn an. So kann der Junge ihn leiden. Hör her, sagt Gok. Viele seiner Sätze beginnen so. Er ist es gewöhnt, daß man auf ihn hört. Hör her, du gehst zwar auf die Lateinschule, und der Magister Kraz ist dir ein guter Lehrer, doch dafür, daß du auf das Tübinger Stift sollst, genügt es nicht. Verstehst du? Das Kind nickt. Es versteht nichts. Doch es ist besser, es versteht.
Zweimal in der Woche, am Dienstag und am Donnerstag, wird der Diakon zum Unterricht kommen. Damit sie ungestört arbeiten können, hat man ihnen eine Stube unterm Dach eingerichtet. Unser Olymp, sagt Köstlin. Betritt er das Haus, pflegt er erst Johanna seine Aufwartung zu machen, sie unterhalten sich über die Talente des Buben, über dessen Fortschritte, ihm wird ein Glas Rotwein eingeschenkt, das er in drei Zügen leert, dann wird der Junge gerufen, der bereits im Nebenzimmer wartet. Wir wollen nichts versäumen, sagt Köstlin, verbeugt sich vor Johanna und schiebt das Kind vor sich her.
Wenn es warm ist, steht das Fenster offen. Der Diakon spricht, liest vor, fragt ab. Stimmen aus dem Hof sind zu hören, sie lenken ihn nicht ab. Köstlin legt Worte Christi aus, er ist ein Bewunderer Bengels, mitunter wird er ekstatisch, dann reißt er seinen Schüler an sich, und Tränen stehen in seinen Augen.
Wer verbürgt uns die Gegenwart Gottes?
Jesus Christus.
Weshalb?
Er ist Gottes Unterpfand für die Menschen.
Er sagt: Gottes Unterpfand, und es fragt sich, ob er weiß, was er sagt, ob es nicht Wörter sind, die er auswendig gelernt hat, die Köstlin ihm abverlangt – oder er denkt darüber nach, was »Unterpfand« bedeutet, fragt womöglich den Diakon, als er dieses Wort zum erstenmal hört:
Was heißt des?
Köstlin, versessen auf Wörter, sie abschmeckend, mit ihnen allein glücklich, mogelt sich nicht hinaus, sondern antwortet: Ein Unterpfand ist einem Pfand gleich, nein, doch nicht, weißt du, sage ich Pfand, meine ich wirklich das Pfand, etwas, eine Sache, die für einen anderen Wert steht, doch das Wort Unterpfand geht darüber hinaus, das braucht man als Gleichnis. Verstehsch, Büble, verstehsch, als Gleichnis, da ist gemeint ein »sichtbares Zeichen«, ein »greifbarer Beweis«, und an diese zweite Bedeutung sollten wir uns halten. Das ist es, nur dies. Daß Jesus eben ein greifbarer Beweis für die Gegenwart Gottes ist.
Ja, sagt er, ja. Das Bild geht ihm ein, seine Faßbarkeit, und manchmal erregt es ihn, so den Wörtern auf die Spur zu kommen, ihre Seele zu erfahren und ihren Leib zu fassen.
Wenn Köstlin seine Phantasien nur nicht immer unterbräche und ihn dann das Schulpensum repetieren ließe. Ille, illa, illud.
Er gewinnt den schweren Mann lieb. Insgeheim vergleicht er ihn mit Gok, auch mit dem phantasierten Inbild des ersten Vaters, und die Vorstellungen mischen sich, die Väter werden übermächtig, schon wieder »Unterpfänder«, unwirklich in ihrer Größe und Güte, »Ihre immerwährende große Gewogenheit und Liebe gegen mich«, wird der Fünfzehnjährige aus Denkendorf an Köstlin schreiben, »und noch etwas, das auch nicht wenig dazu beigetragen haben mag, Ihr weiser Christen-Wandel, erweckten in mir eine solche Ehrfurcht und Liebe zu Ihnen, daß ich, es aufrichtig zu sagen, Sie nicht anders als wie meinen Vater betrachten kann.« Als wie welchen Vater? Den »Führer«, den »Helfer«, den »Freund«?
Er schreibt diese Zeilen fünf Jahre nach dem Tod des zweiten Vaters.
Er macht sich Vorwürfe, um seinem Helfer zu gefallen.
»Immer wankte ich hin und her.«
Wenn er klug sein wollte, sei sein Herz tückisch geworden.
Niemanden um sich habe er leiden können.
Habe er sich seiner Menschenfeindlichkeit widersetzt, so sei er nur darauf aus gewesen, den Menschen zu gefallen, nicht aber Gott.
Er ist neun. Ganz unvermutet kann ihn Wut überkommen, aus geringstem Anlaß: er bebt, ballt die Fäuste, alles spannt sich in ihm, in sein Gesicht schießt Blut – jetzt hat er sein Wütle, sagt die Großmutter Heyn, die ihn am ehesten in einem solchen Zustand noch erreichen kann. Ein Gehilfe in der Weinhandlung hatte ihn gehänselt, als er zwischen den Fässern spielte. So dünn wie er sei, ein solch feines Herrchen, werde er sein Lebtag kein Fäßchen wie dieses stemmen können. Und er habe dazu noch herausfordernd gelacht. Das Kind sei derart in Zorn geraten, daß es, ohne zu zaudern, auf den Mann losgegangen sei, ihn mit Fäusten traktiert und am Ende in die Hand gebissen habe. Der herbeigerufene Vater habe ihn verprügelt, was freilich zur Folge hatte, daß der Bub sich als verstockt erwies und trotz dringender Mahnung nicht zum Mittagstisch erschien.
Du bist anmaßend, sagt Köstlin.
Des stimmt net.
Du kannst dich nicht beherrschen und tust darum anderen unrecht.
Die tun mir unrecht, und dann kommt’s über mich.
Du mußt dich beherrschen lernen, Friedrich.
Er redete ihn als einziger mit Friedrich an.
I kann’s net.
Doch, das mußt du als rechter Christenmensch lernen.
I ben doch a Chrischt, aber des kann i net.
Weil du immer besser sein willst als die andern.
Noi, net besser, bloß anders.
Das könnte er Köstlin erwidert haben, schon wieder ohne Trotz, aus einer kindlichen Selbstsicherheit. Er weiß, daß er bei Köstlin so weit gehen kann. Er war ja nicht nur der »Helfer«, sondern auch ein Verschworener. Er vermittelte ihm ein Wissen, das ihn von allen anderen abhob, auch von dem zweiten Vater, und nur Köstlin empfand wie er. Ich denke mir, daß er, als er seine erste Hauslehrerstelle bei den Kalbs antrat, sich an Köstlin erinnerte, an seine »Weisungen«, seine freundschaftliche Strenge, und daß er ihn zu kopieren versuchte; daß vielleicht die kindliche Erfahrung mit diesem klugen Mann ihn zu diesem Beruf disponierte: Er wollte dem dritten allwissenden Vater gleichen.
Manchmal hatte ihn die Schule schon so ermüdet, daß er den Belehrungen Köstlins nicht mehr folgen konnte. Der quälte ihn nicht, sagte: Laß uns miteinander singen. Sie sangen eins der Streitlieder Zinzendorfs.
Das macht wach und frisch, sagte Köstlin.
Als er zehn Jahre alt geworden war, ließen die Eltern ihm Klavierunterricht geben. Sie bewunderten seine Musikalität. Die Flöte lernte er nebenher. Später, ebenso leicht, die Geige.
Du kannst mir auch auf der Flöte vorspielen, sagte Köstlin, Musik erfrischt den Geist.
Die Mutter sagte, wenn sie Lehrer und Schüler gemeinsam singen hörte: Nun sind sie wieder fröhlich. Nun ist es dem Fritz wieder wohl. Im August 1775 hatte sie zum erstenmal in ihrer zweiten Ehe ein Kind bekommen: Dorothea (die wenige Monate später starb). Die Großmutter hatte den Fünfjährigen aus dem elterlichen Bereich gedrängt, da könne er jetzt nicht sein, hatte ihn in die Obhut einer Magd gegeben, die eigentümliche Sätze murmelte, jetzt müsse die arme Frau leiden, hoffentlich habe die Hebamme einen guten Griff, der Junge hörte aus dem Haus einige Schreie, fürchtete, der Mutter könne etwas zustoßen, versuchte aus dem Zimmer zu schlüpfen, doch die Magd erwischte ihn am Kittel, er blieb, bis die Großmutter wiederkam und sagte, er habe ein Schwesterle bekommen, bald dürfe er es ansehen.
Ein Jahr darauf kommt Karl zur Welt.
In seinem Kopf festigt sich das nicht zu Bildern. Die Sprache Köstlins löst solche nahen Wirklichkeiten in Formeln auf. Sie reinigt, wünscht die Gedanken gottgefällig. So lernt er es. Diese wenigen Jahre, ausgeglichen und voller »Knabenfreude«, werden sich ihm einprägen; sie scheinen ihm im nachhinein ohne Schatten, und die Melancholien der Mutter sind kaum spürbar. Sie enden mit einer Katastrophe.
1778 war der Winter früh und hart hereingebrochen. Eine feste Eisdecke lag über dem Neckar; oft spielte er mit Freunden, sie erkundeten eine völlig veränderte, neue Landschaft, zogen auf dem Eis hinauf bis zur Steinach-Mündung, rutschten, schlitterten, stießen sich gegenseitig um, manchmal gab es Geheul, legten sich aufs Eis und lauschten, wie es arbeitete, horchten auf dieses unheimliche Knirschen und Dröhnen.
Ende November begann es zu tauen. Sie hörten es prasseln und krachen, das Eis wurde von der schwellenden Wassermenge geschoben und getürmt. Er wachte auf, als sie den Vater in der Nacht holten. Der Neckar sei über die Ufer getreten, die Unterstadt überschwemmt. Die Mauer des Grasgartens sei teilweise vom Strom eingerissen worden.
Bleib da, sagte die Mutter, du kannsch doch nix tun. Du holsch dir den Tod.
Sie solle nicht so unbesonnen daherreden, sagte Gok. Er müsse an die Stadt denken. Dies allein sei seine Aufgabe.
Im Hof hatten sich die Männer versammelt. Sie sprachen aufgeregt, riefen sich die neuesten Nachrichten zu:
Jetzt kommt das Wasser schon in die Hundsgasse.
Dem Gonser hat es die Pferde weggeschwemmt.
Er geht zum Fenster, versucht, leise die Läden zu öffnen. Sie quietschen in den Scharnieren, so läßt er es bleiben. Er lugt durch die Schlitze im Holz, muß sich auf einen Schemel stellen. Die Luft ist laut, als rieben sich unsichtbare Wellen aneinander. Die Männer versammeln sich, schleppen lange Leitern, Seile, einer der Knechte spannt die Pferde vor den Wagen. Die Großmutter, in Tüchern vermummt, läuft ihnen ein Stück nach, kehrt aber bald zurück, wird zu einem riesenhaften Schatten im Hof: Seit einiger Zeit regnet es nicht mehr, die Wolken reißen auf, ein Gespenstermond gibt ein ungenaues Licht.
Einer der Schulfreunde, Georg Lauterbach, erzählt am anderen Tag, er sei mit seinem Vater auf den Kirchturm gestiegen und habe beobachten können, wie die Brücke über den Neckar geborsten sei.
Er hat es nur gehört. Das Getöse hat ihn aus seinem zweiten Schlaf gerissen. Es war ein einziger Lärm, und er meinte, noch schlaftrunken, die Welt stürze zusammen. Er rief nach der Mutter. Sie kam nicht, er lief zur Tür und rief wieder, da kam die Großmutter Heyn, nahm ihn zu sich aufs Zimmer, wo es immer nach Äpfeln roch.
Das kann nur die Brücke sein. Oh Gott, sagte sie. Es wird dem Gok doch nichts passiert sein.
Es war längst wieder hell, als man ihn heimbrachte; er war derart erschöpft, daß er aus eigener Kraft nicht mehr gehen konnte. Sie schleppten den Mann ins Haus. Seine Kleider waren völlig durchnäßt, seine Stimme hatte er fast verloren, er habe dauernd Befehle schreien müssen, und das Schlimmste hätte man auch verhindern können, Menschenleben seien keine zu beklagen.
Drei Monate lang lag er, heiß und kalt, phantasierte oder redete mit schwacher Stimme. Sie scharten sich immer wieder um ihn. Der Wundarzt besuchte ihn jeden Tag, legte ihm Kompressen auf und ließ ihn zur Ader. Mit einer solchen »hitzigen Brustkrankheit« sei nicht zu spaßen. Auch der Dekan Klemm war fast jeden Abend zu Gast, tröstete die Frauen, sprach einige Worte mit dem Kranken. Er solle sich schonen. Die Rekonvaleszenz sei sichtbar. Bald könne er, wenn auch mit Rücksicht gegen sich, seine Ämter wieder erfüllen.
Man solle ihm lieber aus der Bibel vorlesen.
Bringt den Karl, ich möchte ihn sehen.
Fritz und Rike stehen am Fußende des großen Bettes. Ins Schlafzimmer wagen sie sich sonst nicht.
Johanna verstummte fast, selbst mit ihrer Mutter unterhielt sie sich nicht mehr. Fritz vermied es, mit ihr allein zu sein. Um so länger arbeitete er an den Nachmittagen mit Köstlin und mit Kraz, der ebenfalls ins Haus kam, damit es an der Vorbereitung aufs Landexamen nicht mangele.
Latein.
Griechisch.
Hebräisch.
Religion.
Dialektik.
Rhetorik.
Johanna Gok bereitete sich diese ganzen Wochen auf ihre zweite Witwenschaft vor. Kein Trost erreichte sie. Ich weiß, daß er sterben wird, antwortete sie ihrer Mutter, die ihr Hoffnung einzureden versuchte. Sie gäbe zu schnell, zu leicht auf. Wenn sie schon keine Lebenskraft habe, wie solle der Mann sie haben. Den ältesten Sohn ärgerte ihr Anblick. Er erinnerte sich an die letzten beiden Jahre in Lauffen, wie die Mutter oft tagelang am Tisch in der Stube saß, Tränen in den Augen, Gebete flüsternd, mit einem schlimmen Geschick allzu vertraut. So mochte er sie nicht, so fürchtete er sie: Ihre Weinerlichkeit, mit der sie alles durchsetzte. Rike versuchte, der Mutter zu gleichen, ahmte sie in allem nach, »ans Wasser gebaut« wie sie ist, sie hielt die Hände stets gefaltet, flüsterte selbst mit dem Bruder. Übertreib’s net, Rike, herrschte er sie an. Was er der Mutter gern sagen würde, ließ er die Schwester wissen.
Gok stirbt mühsam und elend, als werde ihm allmählich der Atem entzogen. Die Aderlässe schwächen ihn zudem. Alle seine Seufzer sind in dem still gewordenen Haus zu hören. Es ist schon schlimm, sagt Köstlin, lern weiter, Fritz. Wie lautet der Imperativ von dormire?
Am 13. März 1779 stirbt Gok. Er ist dreißig Jahre alt geworden. Er liegt hoch aufgebettet, steif. Die Kinder werden zu ihm geführt. Nehmt Abschied von eurem Vater. Die Mutter scheint abwesend in ihrer Trauer, und die Hilflosigkeit der Kinder ist ihr gleichgültig. Wieder hilft Bilfinger. Aber auch Köstlin, Dekan Klemm und der Schultheiß. Sie ist umgeben von Gutwilligen, von Freunden.
Der Weg zum Friedhof an der Kreuzkirche ist nicht weit. Am Grab spricht der Dekan. Friedrich hört nicht, was er sagt. Es ist hell, fast schon warm. Viel Verwandtschaft ist gekommen. Sie reißen ihn an sich, legen die Hände auf seinen Kopf. Er wäre gern allein. Er hat den zweiten Vater verehrt, vielleicht hat er ihn geliebt. Aber in ihm hat er den ersten gesucht, den »wirklichen« Vater, und so schreibt er später, die Nacht gegen den Vorfrühlingstag setzend, vom Begräbnis des ersten Vaters: »Der Leichenreihen wandelte still hinan, / Und Fackelschimmer schien auf des Teuren Sarg, … Als ich, ein schwacher, stammelnder Knabe noch, / O Vater! lieber Seliger! dich verlor.« Er war damals zwei Jahre alt, und an der Bestattung hat er bestimmt nicht teilnehmen dürfen, sie hatten ihn ins Bett gelegt, unter der Obhut einer weniger beteiligten Frau, aber danach hatten sie es ihm erzählt, wahrscheinlich die Mutter, versunken in solchen Abschieden, hat es ihm immer wieder berichtet, bis er es sah, als wäre er dabeigewesen.
Er besuchte das Grab Goks oft, ohne dazu angehalten zu werden; es war eine Station auf seinen Gängen durch die Stadt, ins Freie hinaus. Im alten Teil des Friedhofs entdeckte er das Grab vom Schultheiß Johannes Hölderle, der ein Vorfahr des ersten Vaters war.
Er fügt sich der Weiberwirtschaft, dem zurückgezogenen Leben im Mutterhaus. Seine Phantasie bewahrte die Väter, verschwieg oder vergrößerte sie, machte sie zu Helfern, zu Führern, wiederholte sie in bewunderten Freunden oder vergeistigte sie in Sätzen, in Gedichten, diesen zweiten Vaterländern, in denen die Mütter wenig zu suchen haben.
Jetzt sind sie da, sind um ihn. Sie verwalten die Wirklichkeit. Sie planen und bereden die Zukunft. Auf sie ist Verlaß. Ihr zurückgenommener Schmerz überträgt sich auf ihn als eine dauernde Stimmung, als ein »Hang zur Trauer«.
So sehr sie auch sein Leben zu beeinflussen trachten – und jede Heimkehr ist eben auch eine Flucht ins Mutterhaus –, so wenig können sie es prägen. Stärker sind die Schatten der Väter.
Er klammert sich nicht an Weiberschürzen. Im Gegenteil – nach dem Tod des Vaters findet er endlich die »Gespielen« seiner »Einfalt«, und die Großmutter hat es schwer, ihn in der Ordnung zu halten. Wahrscheinlich hat auch Köstlin ihn gewarnt: Du kannst es dir nicht leisten, Fritz, du hast schon deine Pflichten. Er hat sie. Er vergißt sie.
In der Schule hat er sich Achtung verschafft.
Hören Sie zu, sagt er zu Johanna, und sie erinnert sich der Gokschen Eigenheit, die der Junge unwissentlich nachahmt, hören Sie zu, da ist einer frisch auf der Schule, einer namens Schelling, der kommt aus Denkendorf und ist mit dem Diakon Köstlin verwandt, bei dem er auch wohnt, dieser Schelling ist verrückt, überkandidelt, der weiß viel mehr als jeder von uns und bildet sich darauf auch etwas ein, stolziert herum, preist sich selber, also der hat sich mir angeschlossen, und wenn Sie nichts dagegen einzuwenden haben, Mamma, brächte ich ihn manchmal mit nach Haus. Der Herr Präzeptor hat dazu geraten, der Herr Diakon hält ihn schlichtweg für ein Wundertier.
Schelling zog die Wut der Mitschüler geradezu auf sich. Mit Anmaßung schien er sich zu schützen, die Furcht des Neulings verbergen zu wollen. In den Freizeiten hielt er sich abseits, den Philosophen spielend. Hölderlin war er gleich aufgefallen. Er spürte die Angst, die Einsamkeit. Aber keiner wünschte mit Schelling umzugehen, auch wenn die Lehrer dazu aufforderten. Der ist nicht bei Trost. Im Unterricht aber brillierte er. Er war allen Gleichaltrigen überlegen, wurde schon nach kurzer Zeit versetzt, provozierte um so mehr.
Ein Neunmalkluger.
Ein Spinner.
Sie übergingen ihn.
Bis sie das Schweigen nicht mehr ertrugen und es mit einem handfesten Angriff brachen. Sie umringten den Hochmütigen, schlugen ihn. Da griff »der Hölder« ein. Er stellte sich »gegen die andern, den so viel Jüngern zu mißhandeln geneigten Schüler«. Seid ihr toll? Wenn der Präzeptor das merkt. Der ist mit Schellings Vater befreundet.
Des isch uns egal.
Der Altkluge schließt sich ihm an, redet zum erstenmal nicht nur von sich selbst, hört zu, erkundigt sich. Des Gespann, sagt man von ihnen, d’r Kloi ond d’r Lang. Johanna wird sich nie ganz mit Schelling anfreunden können, er komme ihr vor wie ein Greis, nichts Kindliches sei an ihm. Hölderlin merkt den Altersunterschied nicht, wenn sie über die Götter Griechenlands reden, von den Landschaften Homers träumen, durch das Rom Neros spazieren – zwei kundige Fremde.
Weshalb gibst du dich dauernd mit dem Kerl ab?
Weil er Schutz braucht; er ist so allein.
Du muscht di net immer aufpfludern!
Aber wenn di mi auslachet!
Der Umgang mit Hölderlin dämpfte zwar das Kind, sein Wissensdurst blieb dennoch entsetzlich, und nach zwei Jahren erklärte sich Kraz außerstande, ihm Weiteres beizubringen.
Schelling verließ Nürtingen; Hölderlin wird ihm auf dem Stift in Tübingen wiederbegegnen.
Bleib doch, sei nicht so unersättlich.
Anders macht’s mir keinen Spaß.
Der Vater holt den Buben, stolz, machte seine Honneurs bei der Kammerrätin Gok, gemeinsam mit Köstlin, rühmte Wein und Most, und als sie durchs Neckartor fuhren, lief Hölderlin ihnen eine Weile hinterher, dem kleinen Schelling zuwinkend, als wäre er schon ein Freund.
Es dauert nicht mehr lange, und er wird sich von der Mutter, den Geschwistern, dem Haus verabschieden.
Er hatte die dritte Prüfung des Landexamens in Stuttgart bestanden. Eine vierte lag noch vor ihm, beunruhigte ihn freilich nicht. Er war jetzt nicht mehr Petent, er war Exspektant. Köstlin und Kraz erwarteten das Beste, während die Mutter sich und ihn immer wieder fragte, ob’s denn ausreiche, ob er den Forderungen der gelehrten Herren genüge. Kurz vor der Prüfung, dem Tag vor der Abreise nach Stuttgart, konnte er es vor innerer Spannung kaum mehr aushalten, und Köstlin, dem es sonst immer gelang, ihn zu bändigen, überließ ihn nachsichtig der Unruhe.
Ich versteh’s. Das legt sich wieder.
Schon im Reisewagen war er wieder ruhig. In ihm befanden sich einige Prüflinge mit ihren Eltern und Kraz, der sie begleitete, sie ab und zu mahnte, den Ruf der Schule zu bestätigen, nun komme es darauf an, bei der zweiten Prüfung hätten der Faber und der Rau sich nicht sonderlich ausgezeichnet, hätten mittelmäßige Arbeiten in Latein und Griechisch geliefert. Sie hatten ihren Spaß; alle, bis auf Bilfinger, kannten die Reise, die folgende Prozedur, und bevor die Straße nach Wolfschlugen anstieg, sprangen die Jungen schon aus dem Wagen, schoben, halfen den zerrenden Pferden, vergaßen, was sie erwartete. Es war der 8. September 1783. Drei Prüfungstage lagen vor ihnen. Prüfungsängste sind vergleichbar. Ich sage mir, dem einen oder anderen war fast übel, und es gab hysterische Ausbrüche. Er sitzt unter seinen Schulfreunden. Wen hat er neben sich? Vielleicht zur Rechten Kraz, weil er ihn schätzt, ihm als Hauslehrer vertraut ist; oder doch Johanna? Zur Linken der neue Prüfling, Bilfingers Sohn, Carl Christoph, den er beruhigt: ’S isch alles halb so schlimm. Glaub mir’s.
Kraz fragt ab.
Dich muß ich in Griechisch nicht prüfen. Da bist du der Erste.
Bis jetzt, sagt er.
Du bist ein arger Schwarzseher.
Er lehnt sich zurück. Ich lasse ihn sich an seine erste Reise erinnern. Oft wird er reisen. Er genießt die Angst vor dem Unbekannten. Sie waren zur Großmutter und zur Tante nach Löchgau gereist, die Mutter, Heinrike und er. Sie hatten spielen dürfen, was ihnen beliebte, im Garten, es war im April gewesen, erst vor drei Jahren, sie wurden gehätschelt, alles war ihnen gestattet. Man stopfte sie mit Gebäck, eine Zeitlang war ihm übel.
Morgen gehen wir nach Markgröningen hinüber, hatte die Mutter gesagt.
Ist es weit?
Es sei ein angenehmer Fußweg.
Aber dann war es doch weit, er trottete hinter Mutter und Schwester, grollte in sich hinein.
Du solltest dir ein Vorbild an der Rike nehmen, Fritz.
Des will i aber net.
Dann laß es und lauf.
Wieder wurden sie reich bewirtet, spielten mit anderen Kindern im Haus, die Mutter unterhielt sich mit Tante und Onkel Volmar und anderen Erwachsenen, darunter einem ständig schnaufenden Aufschneider, von dem man ihm sagte, es sei der Schreiber Blum.
Der tut sich aber wichtig, flüsterte er der Mutter ins Ohr.
Der braucht’s halt, flüstert sie zurück.
Beim Mittagessen saßen sie mit am großen Tisch, mußten nicht schweigen. Onkel Volmar unterhielt sie mit lustigen Geschichten aus dem Oberamt.
Er hörte, wie sie über ihn sprachen: Das Kind sei viel zu ernst für sein Alter. Schließlich habe der Fritz schon viel Schlimmes erfahren müssen. Er solle Pfarrer werden. Das sagt die Mutter. Wie ist er denn auf der Schule? Er kommt gut voran; sein Griechisch rühmt man sogar. Ja, wenn der Diakon Köstlin ihm beisteht, dann! Ich will, daß es ihm an nichts fehle. Im Grunde ist er doch noch ein rechtes Kind. Kränkelt er denn nicht? Er hat so eine bleiche Haut? Die ist ihm von Natur gegeben.
Weil es regnet, ziehen sie sich mit den Volmar-Kindern auf den Dachboden zurück.
Macht euch nicht so dreckig.
Sie kriechen unter die Balken, verstecken sich, lauschen auf den Atem suchender »Gendarmen«, lachen, wenn sie der Staub zum Husten oder zum Niesen bringt.
Es ist Zeit! wird gerufen.
Noch ein kleines bißchen.
No a bißle.
Wir müssen aufbrechen, sonst kommen wir in die Nacht. Tante Volmar klagt, jetzt hätten sie sich da oben arg dreckig gemacht. Johanna Gok sagt zornig: Das wäscht der Regen den Kindern schon aus dem Gesicht. Sie wundert sich über den entschiedenen Widerstand ihres Sohnes. Bei dem Sauwetter mach i koin Schritt, sagt er.
So rede man nicht mit seiner Mutter.
Aber ’s isch doch wahr.
Wahr sei es zwar, doch er habe sich höflich gegen seine Eltern zu benehmen.
Volmars redeten auf Johanna Gok ein, und sie beschloß, mit den Kindern hier zu übernachten.
Die Kinder umarmten sich, so sei es richtig, da könne man noch eine Weile weiterspielen.
Er durfte bei seinem Vetter im Bett schlafen. Sie erzählten sich, bis ihnen die Augen zufielen, »wüste Geschichten«.
Am anderen Morgen, sehr früh, verabschiedeten sie sich; die Mutter hatte, da sich das Wetter nicht gebessert hatte, eine Kutsche gemietet. Die Volmarschen Kinder liefen ein Stück nebenher, auch der Schreiber, dessen unverhohlen neugieriger Blick den Buben ärgerte.
Den mag i net.
Sei ruhig, solche Urteile gehören sich nicht.
Er machte die Augen zu, dachte, daß die Reise kein Ende nehmen solle. Immer so weiter.
Schläfscht du?
Noi.
Für den Schreiber Blum war der Besuch der Kammerrätin Gok durchaus eine Sensation gewesen; er notierte in seinem Tagebuch: »Vergangenen Samstag machte die verw: Frau KammerRath Gokin, mit ihren 2 Kindern, in erster Ehe mit dem verst: HE: Klosterhofmeister Hölderlen zu Lauffen, einem Bruder der Frau Ober-Amtmännin erzeugt, hier Besuch. Sie kam von Sachsenheim aus zu Fus hieher und wolte gestern wieder dahin zurük; weil es aber regnerisch Wetter war, und ihre beede Kinder nicht fort wolten, so blieb sie auf zureden des HE: Ober-Amtmans noch heute über Nacht. Diesen Vormittag aber lies sie sich nicht länger mehr aufhalten, sondern sie bestelte wegen des üblen Wetters Miethpferde und entlehnte eine Kutsche und fuhr wieder fort. Sie ist eine junge schöne Witwe von ungefähr 26–28 Jaren; voller Anmuth und scheint sehr vernünftig zu seyn. Ihre Kinder ein Knäblein von 11 und 1. Mägdlein von 8. Jaren sind sehr wohl gezogen.« Blums Beschreibung gleicht dem Bild, das man von Johanna kennt. Er wird sie angegafft haben und angezogen worden sein von dem zarten Schmelz dieser Gestalt, der Schwermut, aber auch der Tüchtigkeit. Er hat sie jünger gemacht, als sie damals war. Es ist denkbar, daß sie jünger erschien. Offenbar hat sie seine Phantasie angeregt. Vielleicht hat er sie insgeheim begehrt, die folgende Nacht von ihr geträumt. Hingehört freilich hat er nicht; was er aufschrieb, ist ungenau.
»Die Mutter war damals fast zweiunddreißig Jahre alt. Sie hatte Jahrs zuvor ihren zweiten Mann verloren, hatte seit 177o sieben Kinder geboren und davon drei sterben sehen (ein viertes starb 1783).«
So weit hatte sich Blum nicht erkundigen wollen. Die Kirchenregister von Lauffen und Nürtingen halten alle diese Daten fest:
Johann Christian Friedrich, geboren den 2o. März 1770 – der Hölderlin;
Johanna Christiana Friderica, geboren den 7. April 1771 und gestorben den 16. November 1775 bei den Großeltern in Cleebronn;
Maria Eleonora Heinrica – die Rike – geboren den 15. August 1772.
Das waren Hölderlins Kinder, die Lauffener, denen folgten die Gokschen, die Nürtinger:
Anastasia Carolina Dorothea, geboren den 18. August 1775, gestorben den 19. Dezember desselben Jahres »an Auszehrung«;
Karl Christoph Friedrich – der Karl – geboren den 29. Oktober 1776;
ein Namenloser, von der Hebamme »gäh« getauft, doch auf welchen Namen?, geboren den 16. November 1777 »und in der zweiten Stunden darauf verschieden«;
Friederika Rosina Christiane – sie hätte eine zweite Rike, die Goksche Rike für ihn sein können – geboren den 12. November 1778, gestorben den 20. Dezember 1783.
Sie lebte noch, als Blum dieser Frau nachschwärmte, kränkelte wahrscheinlich schon, stets in der Stube, in der kein Fenster geöffnet werden durfte, damit sich das schwache Wesen nicht erkälte.
Seid still, die kleine Rike braucht Ruhe.
Oder ließ man diese Kinder dahinsiechen, fatalistisch, weil man das Sterben gewohnt war, weil man wußte, daß nicht jedes durchkomme? Ich weiß es nicht.
Ich versuche nur zu korrigieren, indem ich das eine Zitat dem anderen gegenüberstelle:
»Hatte somit viel Schmerz und Leid erfahren, auch Sorge für den großen Haushalt und den Bestand des Vermögens gehabt: bemerkenswert daher, daß Blum nicht an ihr die Spuren des Kummers hervorhebt, auch nicht Züge weltabgewandter Frömmigkeit, sondern Schönheit und Anmut, wie selbst das Bildnis der Jungvermählten trotz seiner künstlerischen Schwächen verrät.«
Offenbar ist sie froh, für einen Augenblick aus der Alltäglichkeit herauszukommen, sie vergißt die Zwänge, die Toten, will sich unterhalten mit den Verwandten, nicht gefragt, nicht getröstet werden. Vielleicht ist sie aber auch ein Hausteufel und ein Straßenengel, lädt den Kummer daheim ab und will als Besuch nur erfreuen. Der Sohn hat sie oft genug ermahnt, nicht so selbstvergessen zu leiden.
Jetzt fahren sie zurück nach Löchgau, ins Pfarrhaus.
Jetzt fährt er, mit andern Schülern und Eltern, zur vierten Prüfung.
Er wird, wie gesagt, nach Denkendorf kommen, auf die Niedere Landesschule, sein Weg ist festgelegt, nur darf er von ihm nicht abkommen.
Auf seine Noten ist die Familie stolz, dreimal »sehr gut«, zweimal »recht gut«, vor allem sein Griechisch stellt die Prüfer zufrieden, hier zeige sich bereits das, »was man genium linguae heißet«.
Gut, Fritz.
Sie feiern.
Köstlin hält eine Rede. Die Mutter hat Kuchen gebacken. Du darfst haben, soviel du willst. Mit Kraz unterhält er sich über die verlorenen Schönheiten des Altertums. Köstlin, der am andren Tischende der Großmutter zugesellt ist, ist auf den Präzeptor neidisch.
Nachher noch ein Privatissimum, Fritz?
Strenget des Kind bloß net zu arg an.
Er fühlt sich nicht angestrengt, vielmehr ernstgenommen.
Einen Monat nach seinem vierzehnten Geburtstag wird seine Konfirmation gefeiert, am 18. April 1784. Den Dekan an der Spitze des Zuges von fünfundfünfzig Konfirmanden, gehen sie durch ein Spalier von Gaffern über die Marktstraße, die Treppe unter der Lateinschule hindurch bis zur Stadtkirche.
In dieser Kirche wurde ich auch konfirmiert.
Es ist nicht verbürgt, wer sein Dekan war. Es könnte Klemm gewesen sein oder Köstlin. Meiner hieß Martin Lörcher. Er schrieb mir unlängst, ich ließ seinen Brief unbeantwortet, weil es einem schwerfällt, an seine Kindheit zu schreiben.
Ich ging denselben Weg hinter dem Pfarrer her und habe diesen Zug kürzlich, als eine meiner Nichten konfirmiert wurde, wieder gesehen: der Geistliche in wehendem schwarzem Talar allen voran. Das Bild bewegte mich. Damals, als ich in einem armseligen, zu engen Anzug in der frommen Kolonne lief, dachte ich nicht an Hölderlin, an alle die Vorgänger, daß es Jahr für Jahr dasselbe sei, die erwartungsvolle Gemeinde, die Choräle und das Fragespiel zwischen Pfarrer und Konfirmanden, von denen die einen die Gebote aufzusagen haben, die andern, nach dem lauernden »Was ist das?« des Pfarrers, die Erläuterungen aus dem Katechismus. Dieses »Was ist das?«, das einem in den Ohren dröhnt, das noch nach Jahren seine Antwort will und das noch durch Hölderlins späte Gedichte geistert. Dieses mich verblüffende »aber was ist diß?«
Nach dieser Prozedur, in der jedes Steckenbleiben sich geradezu dem Vorwurf des Herrn aussetzte, las der Pfarrer die Konfirmationsprüche vor. Der meine steht im 5. Kapitel des Buches der Richter, Vers 31:
»Die den Herrn liebhaben, müssen sein,
wie die Sonne aufgeht in ihrer Macht.«
Ich habe dieses inwendige Strahlen nicht gelernt.
Sein Spruch ist nicht bekannt. Es gibt viele, die für ihn passen könnten. Doch auch bei ihm müßte von einer anderen Sonne die Rede sein.
Es ist ein rührendes Bild, wie sie zurückwandern zum Dekanat, hinter dem Pfarrer her, eingeschüchtert, aufgenommen in die Gemeinde, eingesegnet. Daran werden sie nicht denken, wie wir nicht daran gedacht haben. Sie sind schon ein bißchen müde von dem Trubel, das Fest geht weiter, das große Essen im Kreis der plappernden Verwandten. Und die Geschenke! Ich bekam ein Fahrrad und das neue Testament, herausgegeben 1947 von der Privilegierten Württembergischen Bibelanstalt, »ermöglicht durch eine Materialspende der American Bible Society New York an das Hilfswerk der Evangelischen Kirche Deutschlands«.
Sie warteten vor dem Dekanat auf ihn, die Mutter, die Geschwister, die Großmutter, der Pate Bilfinger, die Volmars aus Markgröningen, die Majers aus Löchgau. Sein neuer Anzug machte ihn steif, der Batist des Hemdes kitzelte ihn am Hals. Sein Haar hatten sie zu sehr gepudert. Er fühlte es, wie eine Haube, den ganzen Tag. Er saß an der Festtafel zwischen Oberamtmann Bilfinger und der Großmutter. Bilfinger redete, erinnerte an die beiden Väter, deren Freund er war, und der Mutter traten die Tränen in die Augen. Köstlin nickte ihm dann und wann aufmunternd zu. Kraz redete, ständig mit dem Mundtuch wedelnd, auf die Witwe des Professors Jäger aus Denkendorf ein.
Frau Jäger hatte dem Konfirmanden Hillers »Geistliches Liederkästlein zum Lobe Gottes« geschenkt, was ihn entzückte, denn es war ein weitbekanntes und von Kraz häufig zitiertes Buch, das er nun selber besaß, neben den Schulschriften, den wenigen Büchern aus Goks Besitz und denen, die ihm Tante Lohenschiold hinterlassen hatte, die von der Mutter aber in Verwahrung genommen worden waren. Köstlin las gerührt und mit allzu heftiger Betonung die Verse vor, die Friederike Jäger als Widmung hineingeschrieben hatte:
»Was hilfft uns Tugend und Vernunfft?
Beleßenheit und vieles Wißen?
Und mit der scharff gelehrten Zunfft
Stehts neue Schlüß auf Schlüße schließen,
Was lernnet man am Schluß dabei?
Daß Menschen Weißheit Thorheit sey.
Ohne, und gegen der überschwenglichen Erkentnus Jesu Christi.«
Niemand hat vorgelesen. Wer hat geredet? Hat tatsächlich einer eine Rede gehalten? Die Konfirmation in Württemberg ist ein Ritual. In Nürtingen hat sich seit meiner Feier im Jahre 1949 nichts geändert. So denke ich in Formen und Formeln zurück. Erlebt man Daten durch Imagination, kann Wahrheit zur Wirklichkeit werden, doch wiederum eine Wirklichkeit, die zwei Wirklichkeiten umschließt: die des Beschriebenen und die des Schreibenden. Die zweite Wirklichkeit wird immer überwiegen.
Also schreibe ich: Köstlin hat vorgelesen. Es ist vorstellbar; es ist auch zu denken, wie er vorgelesen hat.
Hölderlin hat, schon in Nürtingen, Gedichte geschrieben, und »frühzeitig entschied sich jene Vorliebe für die Classiker Griechenlands und Roms, welche einen Hauptzug seines Charakters bildet«. Den Lehrern von Denkendorf hat er wenig später, konventionell und devot, in einem Gedicht gedankt. Hat er Köstlin oder Kraz seine ersten Versuche gezeigt, vorgetragen, oder Freunden wie Bilfinger? Es ist wahrscheinlich.
Über den Winkel von Hardt hat er eines seiner ersten Gedichte geschrieben; es ging verloren; und ein zweites, als er als Dreiunddreißigjähriger von diesem rätselhaften Aufenthalt in Bordeaux nach Nürtingen zurückgekehrt war: »Da nämlich ist Ulrich gegangen.« Dorthin bin ich, in meiner Kindheit, einige Male gewandert, habe vor dem Eingang der Felsspalte gesessen und geträumt, nicht Hölderlins wegen, sondern wegen des Pfeifers von Hardt, meiner Lieblingsgestalt aus Hauffs »Lichtenstein«:
»Die Nacht, welche diesem entscheidenden Tage folgte, brachte Herzog Ulerich und seine Begleiter einer engen Waldschlucht zu, die durch Felsen und Gesträuch einen sicheren Versteck gewährte und noch heute bei dem Landvolk die Ulerichs Höhle genannt wird. Es war der Pfeifer von Hardt, der ihnen auf ihrer Flucht als ein Retter in der Noth erschienen war und sie in diese Schlucht führte, die nur den Bauern und Hirten der Gegend bekannt war.«
Damals habe ich noch nicht gewußt, daß er sich hier öfter aufhielt, jetzt könnte ich, damit ein Stück Wahrheit erhalten bleibe, Karl Gok oder Gustav Schwab zitieren. Ich lasse ihn mit Karl, dem Halbbruder, über den Galgenberg wandern, durch den Wald, und sehe die beiden, wie sie einen Bach überqueren, über Steine springen, es sei ein Tag im Mai gewesen, er war vierzehn und der Bruder noch nicht ganz acht. Sie finden die Ulrichs-Höhle, den »Winkel«, kriechen herum, Fritz erzählt vom Pfeifer, dieser Inkarnation der Treue. Sie sind müd vom Weg; Fritz zieht ein Bändchen aus der Tasche, Klopstocks »Hermanns Schlacht«, und deklamiert. Mit offenem Mund lauscht der kleine Bruder. Er versteht so gut wie nichts, und Fritz will es ihm auch nicht erklären. So sind die Wörter einfach nur schön und fremd, ein Glück für den großen Bruder, der sie alle schon kennt.
Komm, mir müsset hoim; sonscht wird’s Nacht.
In den Köpfen beider brummen die gewaltigen Sätze. Er ist auf den Abschied vorbereitet; im Oktober wird er nach Denkendorf gehen. Es liegt zwar nur zwei Wanderstunden von Nürtingen entfernt; doch schon weit fort.
[Menü]
II
Die erste Geschichte
Manchmal war er ohne Grund den Tränen nah. Ein allgemeiner Schmerz ergriff ihn, und er konnte sich nicht erklären, woher er so unvermutet kam. Dann wollte er sich zurückziehen, was ihm aber nur selten gelang, denn er hatte zu lernen oder der Mutter zu helfen. Er schützte sich durch eine Art Erstarrung, eine Abwesenheit, die ihm als Unwillen ausgelegt wurde. Am liebsten war es ihm in diesem Zustand, allein am Fenster seines Zimmers zu sitzen, auf die Neckarsteige zu schauen und all die Bewegungen da unten wahrzunehmen, wie aus einer übergroßen Entfernung. Er fürchtete sich vor dem eigentümlichen und nicht erklärbaren Leiden.
Komm, hatte sie gesagt, komm, Fritz, und ihn in den Garten hinterm Haus gezogen, dort hatten sie sich unter Büschen zusammengehockt und, so schien es ihm, auf etwas gewartet.
Sie hatte ihn eingefangen. Er kannte sie schon lange, nur vom Sehen; wenn er zur Schule ging, oder an den wenigen freien Nachmittagen, war sie aufgetaucht, meist mit anderen Mädchen, ihr Gesicht hinter der Hand verbergend; sie war ihm aufgefallen; sie war dreizehn, gleich alt wie er, die Tochter des Hofbeamten Breunlin, Suse gerufen, und sie gefiel ihm, weil sie herausfordernder, auch freier wirkte als ihre Spielgefährtinnen.
Ein paarmal war sie zu ihnen ins Haus gekommen, hatte Wein für ihren Vater geholt (aus Goks alten Beständen). Das ist Breunlins Suse, hatte irgend jemand eher mißbilligend bemerkt.
Er hatte keine Zeit, sich für Mädchen zu interessieren wie die Bauernbuben; es war nicht angebracht. Die Mutter und der Diakon wären über solchen Umgang sicher verärgert gewesen. Doch manche Schulfreunde redeten über ihre angeblichen Erfahrungen mit Mädchen, machten Geheimnisse daraus, und alle Andeutungen waren so, daß sie ihn beschämten und verwirrten. Namen wurden genannt von besonders Willfährigen oder Frechen oder Lüsternen.
Von denen träumte er undeutlich, denn die meisten kannte er. Mit niemandem wagte er darüber zu reden. Wenn Kraz die Sinnenlust geißelte, nickte er eifrig und nahm sich vor, noch strenger gegen die unguten und sich wie von selbst einstellenden Gedanken zu sein.
Die Grete.
Das Dorle.
Die Rike. Nicht seine Rike, sondern die Rike vom Neckartor.