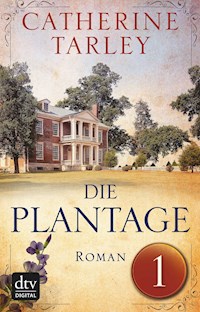9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als Anne während ihrer Hochzeit mit dem Italiener Fabio ein schwerwiegendes Geheimnis ihres Angetrauten entdeckt, flüchtet sie Hals über Kopf nach Rügen – dem Ort ihrer Jugend. Dort trifft sie auf Fritz, der wenig begeistert über den Gast aus Berlin ist und sich störrisch gibt. Während Anne mit der Enttäuschung und Wut über ihre so schnell gescheiterte Ehe kämpft, will Fritz, seit seine große Liebe Janine ihn für einen Bänker verlassen hat, von Frauen nichts mehr wissen. Vielleicht kommen die beiden sich gerade deswegen langsam immer näher …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 459
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Das Buch
»Die Tränen laufen mir jetzt in Sturzbächen die Wangen herunter, und irgendwie ist das ja auch gut so. Muss ja alles raus. Diese tiefe Traurigkeit, die Enttäuschung über das verlorene Glück. Und wenn schon, dann am besten mit Adele. Im Rückspiegel sehe ich, wie die Sonne langsam über dem Berliner Fernsehturm untergeht und den ganzen Himmel in einen riesigen Teppich aus Feuer verwandelt. Würde ich noch so viel malen wie früher, würde ich das vielleicht als Gemälde festhalten – aber möglicherweise würde ein solches Bild wohl zu schnell richtig kitschig wirken. Mir kommt es nämlich ein bisschen so vor, als ob der Himmel sich jetzt auch noch über mich lustig machen würde. Der perfekte Romantik-Kitsch dort hinten und hier, im Schatten, ich, die Belogene und Betrogene. Die, die das Glück einfangen wollte wie das letzte Einhorn.«
Die Autorin
Katharina Jensen, geboren 1984, verbrachte ihre Kindheit und Jugend an der Ostseeküste in Stralsund und auf der Insel Rügen, bevor sie zum Psychologiestudium und arbeiten nach Berlin zog. An die Ostsee, vor allem auf die Insel Rügen, zieht es sie nach wie vor mehrmals im Jahr: Denn was gibt es schöneres, als dort das leichte Wiegen der Dünen im Wind zu beobachten und den Sand zwischen den Zehen zu spüren?
KATHARINA JENSEN
ROMAN
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Originalausgabe 05/2017
Copyright © 2017 by Katharina Jensen
Copyright © 2017 der deutschsprachigen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81637 München
Umschlaggestaltung: Eisele Grafik Design, München unter Verwendung von Gettyimages/Tina Terras & Michael Walter
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-16520-8V003
www.heyne.de
Für alle, die daran glauben, dass es Einhörner geben könnte – also zumindest theoretisch. Und für all die Liebenden, die sich immer wieder das scheinbar Unmögliche trauen …
1.Anne und das letzte Einhorn
Eigentlich wollen wir doch alle das Gleiche: glücklich sein.
Ganze Kilometer voller Ladenregale auf dieser Welt sind mit Glücks-Grußkarten gefüllt. Und das zu recht! Denn anders als Grüße zu besonderen Anlässen oder womöglich gar Beileidskarten kann man einander doch bei jeder Gelegenheit Glück wünschen. Glück kann jeder gebrauchen, ja, es ist eines dieser Dinge, von denen man einfach nicht genug bekommen kann. Schließlich enthält Glück alle Zutaten für ein großartiges Leben: Liebe, Gesundheit, Erfolg und Geld. Es ist so etwas wie der Universalwunsch, der Kleister, der alles zusammenhält. Glück ist uns sogar so wichtig, dass wir es zum Anfassen haben wollen: Nicht umsonst verschenken wir rosarote Schweinchen, vierblättrige Kleeblätter, verrostete Hufeisen, befummeln emsig Schornsteinfeger und freuen uns halbtot, wenn mal ein kleiner Marienkäfer auf unseren Armen landet. Und wenn uns schon keine anhaltende Glückssträhne vergönnt ist, so hoffen wir wenigstens auf den berühmten Glücksmoment. Das nötige Quäntchen Glück. Hauptsache ein bisschen Glück. Glückauf. Glück gehabt.
Ich hatte mir immer eingebildet, dass ich in dieser Sache anders als alle anderen wäre. Aber das bin ich gar nicht. Schließlich jage ich dem Glück ganz genauso hinterher, als wäre es das letzte Einhorn. Ich will es einfangen, in einen hübschen Käfig stecken und in mein Wohnzimmer stellen. Und ich dachte sogar, das wäre mir bereits gelungen. Doch seit heute weiß ich, dass dieser goldene Käfig, den ich für das Glück aufgebaut habe, über einen geheimen Hinterausgang verfügt hat. Denn heute ist mein Glück entwischt, als ich kurz zufrieden und nichts Böses ahnend in eine andere Richtung geschaut habe. Oder genau genommen: Als ich einen Blick auf ein paar Papiere geworfen habe, die mir wohl besser hätten verborgen bleiben sollen.
So ist das mit dem Glück, es ist eine flüchtige Erscheinung. Wie ein warmes Streiflicht der Sonne, vor das der Wind plötzlich Wolken schiebt. Die Wahrheit ist doch die: Das Glück ist ein verdammter Zauberwürfel. Ich dachte für einen kurzen Moment, ich hätte alle sechs Seiten auf die richtige Farbe gedreht. Aber dann, im nächsten Augenblick: Farbchaos auf allen Seiten. Und jetzt stehe ich hier, mitten auf der Prenzlauer Allee, und habe noch nicht einmal mehr Glück im Unglück. Keine Grußkarte der Welt kann mir jetzt noch helfen. Kein Schornsteinfeger, Kleeblatt, Hufeisen oder Marienkäfer. Und das einzige Schwein weit und breit sitzt in einem Opel Astra, direkt an der Ampel neben mir, und popelt, als ob es kein Morgen gäbe.
Hinter mir hupt und tönt es in allen Klangfarben der Tonleiter. Die anderen Autofahrer werden langsam richtig sauer. Wäre heute nicht heute, sondern ein anderer, möglicherweise sogar schöner, womöglich gar glücklicher Tag, könnte ich sie auch verstehen – immerhin habe ich meinen roten Flitzer jetzt schon das dritte Mal in Folge abgewürgt und halte dadurch alle auf.
»Ihr könnt mich alle mal!«, brülle ich bockig. Schließlich ist heute heute. Und heute ist ganz bestimmt kein schöner Tag. Ein schwarzer Audi fährt an mir vorbei, und der Fahrer zeigt mir einen Vogel. Er hat ja recht! Ich fühle mich miserabel und sinke tiefer in meinen Sitz hinein. Aus Versehen schaue ich dann auch noch in den Rückspiegel. Dorthin, wo mein Elend leider sogar für mich sichtbar ist: Ich sehe aus wie der Joker aus dem letzten Batman-Film. Nur schlimmer. Viel schlimmer! Als wenn der Joker zusätzlich zu seiner Fratze noch ein wenig Schminke extra hätte auftragen wollen – und dann in den Regen gekommen wäre. So sehe ich aus!
Mein kunstvoll von der Kosmetikerin aufgetragenes Make-up ist nämlich inzwischen zu grotesken Formen verlaufen. Das Ganze erinnert an einen Rorschachtest, wie ihn Seelenklempner in ihrer Praxis machen, nur eben mitten in meinem Gesicht. Sieht aus wie ein zertrampeltes Blumenbeet, würde der Patient sagen, und der Therapeut würde zustimmend nicken und den Eindruck notieren. Aber wie soll man auch aussehen, wenn sich eine blühende Wiese gerade in ein Trümmerfeld verwandelt hat?
Mein Fuß in diesem teuren weißen Pumps drückt eilig aufs Gaspedal, und der kleine Mini braust los, als wäre er ein Ferrari auf dem Nürburgring. Schau, Anne, denke ich sentimental, wenigstens dein kleiner roter Flitzer bleibt dir. Das Auto war die erste große Anschaffung in meinem Leben, ich hatte es mir selbst zum dreißigsten Geburtstag geschenkt. Damals war ich mit einem gewissen Sven Kunze zusammen, dem Pressesprecher eines der Luxuslabels, für die ich arbeite. Er wollte mir den Mini (und dann auch noch in Rot!) allerdings mit aller Vehemenz ausreden. Das wäre kein Auto, in dem man mich ernst nehmen würde, hatte er gesagt. Als ob ich damit sowieso schon Probleme hätte! Ich habe den roten Mini trotzdem gekauft, und während Sven kurz danach Geschichte wurde, erfüllt mich mein Auto sogar heute noch mit Freude und Stolz. Wenn ich dagegen an Sven denke und an die Art, wie er mich immer kleinhalten wollte, beschleicht mich das Gefühl, dass ich noch nie ein besonders gutes Händchen für Männer hatte. Und dass der rote Mini das tollste Geschenk war, das ich je bekommen habe. Vor allem, weil ich es mir selbst gemacht habe und weil ich bei meiner Entscheidung damals hartnäckig geblieben bin.
Bis vor zwei Stunden hätte ich die Frage nach dem tollsten Geschenk, das ich je bekommen habe, allerdings so beantwortet: der Verlobungsring von Fabio. Natürlich. Bei Kerzenschein und Schnulzenmusik hatte er ihn mir in unserem sauteuren Lieblingsitaliener (der, bei dem auch Brangelina Stammgäste waren, wenn sie in Berlin gedreht haben – tja, aber Brangelina ist ja jetzt wohl genauso Geschichte wie Annefabio) an unserem ersten Jahrestag feierlich angesteckt. Dabei sah er mich wie ein kleines, wuscheliges Hundebaby an, und ich dachte, ich verliere gleich meinen Verstand vor lauter Glück. Oder dachte zumindest, dass ich quasi Angelina Jolie sei oder sonst eine dieser Promi-Frauen, die in ihren perfekten Leben geradezu gesegnet scheinen mit unerträglichem Glück. Aber da wusste ich ja auch noch nichts von diesem verdammten Hinterausgang, auf den das Glück wahrscheinlich schon in genau diesem Moment ein Auge geworfen hatte, um bei der erstbesten Gelegenheit den Hape Kerkeling zu machen, à la »Ich bin dann mal weg!«. Von diesem vermeintlichen Highlight in meinem Leben bleibt jetzt nur noch ein bitterer Nachgeschmack übrig.
Selbst den Verlobungsring habe ich mir vorhin vom Finger gezerrt und auf die edle Auslegware der Adlon Hochzeitssuite geschmissen. Und mit ihm landeten der frisch angepasste Ehering und mein gesamtes Leben auf eben diesem Boden. Ganz verrückt geworden bin ich natürlich nicht: Den Verlobungsring habe ich gleich danach wieder aufgehoben und in meine Tasche gesteckt. Er war einfach viel zu schön, um wie Hausstaub auf dem Boden zu liegen – ich meine, einen Zwei-Karat-Tiffany Soleste im Princess-Schliff wirft man nicht einfach so weg. Außer dem Schmuckstück, das ich allerdings früher oder später doch Fabio zurückgeben werde (schon allein, weil mir mein Stolz nichts anderes erlaubt) und meinem Auto bleibt mir jetzt nicht mehr viel. Die Wohnung, in der wir leben, ähm, lebten, gehört zu großen Teilen (also eigentlich allen) Fabio. Fabio Bartolini, der reiche Start-up-Unternehmer: Er hatte das Penthouse mit dem Geld gekauft, das er damals für sein erfolgreichstes Investitionsprojekt, eine Flirting-App, bekommen hatte: »Zwinker, zwinker! So einfach geht Liebe« – dafür hat er mehr Geld kassiert, als ich in der PR-Agentur in zehn Jahren verdienen würde. Ach was rede ich da, mehr als ich in fünfzig Jahren bekäme! Und da muss ich richtig schuften, auch wenn alle immer denken, dass es eigentlich an Freizeitgestaltung grenzen würde, für Luxuskunden zu arbeiten. Aber ich bekomme ja nicht automatisch was ab von den Gucci-Taschen und Rolex-Uhren. Stattdessen muss ich die blöden Fragen von Horror-Klientinnen wie Frau Schreck und Co. ertragen (Frau Schreck hieß nicht nur so – nomen est omen, mehr muss ich hier nicht sagen), von Leuten, die ständig etwas wollen, und das am besten schon gestern, und für die keine Präsentation und keine Pressemeldung gut genug ist.
Auf jeden Fall: In Fabios Wohnung, von der ich bis gestern das Gefühl hatte, dass sie auch meine wäre, liegen immer noch all meine Sachen. Meine Kleidung, meine Wertgegenstände, eben alles. Ich werde diese Wohnung wahrscheinlich nie wiedersehen – zumindest kann ich mir nicht vorstellen, jemals wieder diese vier Wände zu betreten. Schon gar nicht mit Fabio drin. Mist, jetzt steigen mir schon wieder die Tränen in die Augen. Ich liebe diese Wohnung! Und ich war es doch, die unser Nest am Zionskirchplatz so liebevoll eingerichtet hatte, in dem festen Glauben, dass wir dort für immer leben würden. Irgendwie habe ich schon mein ganzes Leben nach einem echten Projekt gesucht, und damals dachte ich, diese Wohnung einzurichten sei der erste Teil dieses großen Projekts »Fabio und Anne«, das mich erfüllen würde. Wochenlang war ich über Antikmärkte gejagt und hatte die Designerläden auf der Kollwitzstraße durchforstet, bis alles so aussah, wie es aussehen sollte. Fabio hatte mir da ganz freie Hand gelassen, er selbst hat nämlich keinen sehr ausgeprägten Geschmack. Jedenfalls nicht für Interior Design. Der wollte doch tatsächlich einen Sofatisch in Form eines Fußballs kaufen! Bei seiner Kleidung hingegen ist er ganz Italiener: die besten Schuhe, die besten Anzüge, alles handgemacht, alles nur vom Besten. Alles außer seinem Charakter: Der ist wahrlich nicht vom Besten. Der ist vielmehr das Mieseste, was mir je begegnet ist! Wie ein schweineteurer Anzug, bei dem man erst nach dem Kauf entdeckt, dass am Hintern ein riesiger Riss klafft. Und der natürlich ohne Umtauschrecht ist.
Als Fabio damals die fertig eingerichtete Wohnung sah, war er überglücklich: »Das ist das schönste Zuhause, das ich je hatte.« Genau das waren seine Worte. In dem leichten italienischen Singsang, der alle seine Sätze in ein erotisches Feuerwerk verwandelte.
Pah! Wer weiß, wo der Kerl schon gelebt hat und wer ihm alles seine Buden eingerichtet hat. Wer weiß überhaupt irgendetwas über ihn? Ich jedenfalls offensichtlich nicht!
Neben mir klingelt wieder einmal das Handy. Fabio ruft schon seit einer Stunde im Zehn-Minuten-Takt an. Das Telefon, das neben mir auf der teuren weißen Handtasche thront, brummt wie eine gefährliche Hornisse – ich will es auf keinen Fall auch nur anfassen. Am besten stelle ich es jetzt einfach aus. Das hätte ich gleich machen sollen, aber um ehrlich zu sein, wollte ich sichergehen, dass er wirklich anruft. Dass er immerhin das Mindestmaß an Bemühen zeigt. Inzwischen erinnert mich das Summen allerdings einfach nur alle zehn Minuten an mein Elend. Als wenn mein Spiegelbild das nicht schon zur Genüge tun würde!
Die Ampel vor mir schaltet auf Rot, und ich bremse den Mini genauso abrupt ab wie an den Kreuzungen zuvor. Ich bin schon lange kein Auto mehr gefahren, weil Fabio ja lieber Taxi fährt. Und die fehlende Fahrpraxis der letzten Zeit macht sich jetzt deutlich bemerkbar. Gerade stottere ich durch die Straßen wie Boris Becker durch Interviews – vor seinem Sprachtraining. Und quäle mich nun schon mehr als vierzig Minuten lang, den Motor regelmäßig abwürgend, durch den Norden Berlins. Wenn ich es nicht bin, die das Auto vom Fahren abhält, stellen sich mir rote Ampeln in den Weg. Langsam frage ich mich, wie schwer es eigentlich sein kann, dieser verdammten Stadt zu entkommen. Die heiß ersehnte Autobahn ist immer noch nicht in Sichtweite, stattdessen bremse ich mich von einer Straßenecke zur nächsten. Jede Ampel der reinste Vorhof zur Hölle: Auf der rechten Spur neben mir, auf der linken Spur neben mir, an der Tramstation und auf den Überwegen vor mir – überall neugierig glotzende Gesichter. Menschen, die sich freuen, dass sie heute beim Abendessen endlich mal was Ungewöhnliches zu erzählen haben. Nicht dieselbe Leier vom ungerechten Chef oder der zickigen Kollegin, sondern ein wirkliches Ereignis in ihrem Langweiler-Leben: »Heute habe ich was gesehen«, würden sie prahlen, »das glaubst du nicht! Eine Braut, ganz in Weiß mit Tüll und allem Drum und Dran! In einem roten Mini, mitten auf der Prenzlauer Allee! Ich glaube, die war auf der Flucht. Wie in einem Film …« Dabei würden sie strahlen wie Kinder an Weihnachten.
Der Gedanke an Kinder versetzt mir einen Stich, der so plötzlich und so intensiv kommt, dass ich mich kurz zusammenkrümmen muss. Wie oft habe ich mir ausgemalt, wie die Kinder von Fabio und mir aussehen würden. Sein dunkles Haar, meine blauen Augen. Seine Nase für Geschäfte, meine Kreativität. In Wahrheit wären das wahrscheinlich die größten Lügner der Menschheitsgeschichte geworden. Oder besonders naive Dummchen. So wie ich eben. Naiv und blöd, bereit, alles zu glauben, für diesen Traum vom kleinen Glück. Dabei weiß doch jeder, dass es das Glück, genauso wie die Einhörner, gar nicht gibt!
Die Beifahrerin des Golfs neben mir (schon wieder eine rote Ampel!) lässt sogar ihr Fenster herunter und ruft strahlend »Herzlichen Glückwunsch!« zu mir herüber. Ich wünschte, ihre nett gemeinten Worte würden einfach an meiner geschlossenen Scheibe abprallen. Aber sie dringen wie eine giftige Substanz durch alle Ritzen und treffen statt der Fensterscheibe mein Herz. Versetzen ihm einen kräftigen Stoß und verflüchtigen sich dann so schnell, wie sie gekommen sind. Wobei kleine, bittere Splitter bleiben.
Herzlichen Glückwunsch! Zum schlimmsten Tag meines Lebens. Vielen Dank …
Ich hätte im Moment einiges für unauffälligere Kleidung gegeben – gerade dieser Tüllunterrock, der sich wie wild um mich bauscht, ist leider alles andere als leicht zu übersehen –, aber so viel Voraussicht war im Moment höchster Not einfach nicht drin gewesen. Als ich die Wahrheit über Fabio entdeckt habe, war ich viel zu geschockt, um mir über mein Outfit Gedanken machen zu können. Und das soll was heißen! Stattdessen wurde mir erst heiß und kalt, und dann hatte ich das Gefühl, jemand hätte mir einen kräftigen Schlag in die Magengrube verpasst. Und dann noch einen! Fabio hatte derweil nichts ahnend im Bad fröhlich »O sole mio« geträllert. Ich dagegen hatte das Gefühl, keine Sekunde länger in einem Hotelzimmer mit diesem Mann verbringen zu können, und so schoss ich kurz darauf aus dem Adlon wie ein Indianerpfeil. Und ich wollte nicht einmal hören, was er zu seiner Erklärung vorbringen würde. »Anne, du hast das einzig Richtige getan!«, sage ich jetzt laut zu mir selbst, um mir zu bestätigen, dass ich nicht völlig übergeschnappt bin. Es sollte möglichst entschlossen und überzeugt klingen, aber ich piepse leider eher wie eine erkältete Maus. Vom Adlon aus war ich vorhin dann mit dem Taxi nach Hause gefahren und hatte mich dort kurz entschlossen in meinen roten Mini-Flitzer gesetzt. Klar hätte ich noch einmal in die Wohnung gehen und wenigstens ein paar Sachen packen können. Das wäre eine kluge Entscheidung gewesen … aber offensichtlich sind kluge Entscheidungen eben nicht mein Ding. Und außerdem: Keine Ahnung, ob Ihnen schon mal etwas passiert ist, das Ihre ganze Welt zum Einsturz gebracht hat – so wie mir heute. In solchen Momenten denkt man nicht rational. Man denkt eigentlich gar nicht. Vor allem plant man auch nichts mehr. In solchen Momenten ist nur noch Katastrophenalarm angesagt, und überall heulen rote Sirenen. Und man selber heult wie ein Schlosshund, mit den Sirenen im Chor.
Die Hochzeit, unsere Hochzeit, haben Fabio und ich übrigens heimlich geplant. Nach unserer Verlobung wollten wir so schnell wie möglich heiraten – wir konnten es ja gar nicht abwarten, endlich Mann und Frau zu sein. Rückblickend kommt mir das alles wie ein einziger Vollrausch vor. Bis auf unsere Trauzeugen – sein Kumpel Max und meine beste Freundin Moni – wusste niemand von unserem Vorhaben, nicht einmal meine Mutter, und die weiß sonst immer alles. Es sollte ganz und gar romantisch werden. Die intime Hochzeit, das Candle-Light-Dinner am Abend und dann der Überraschungsanruf bei meinen Eltern. Meine Mutter hätte gejuchzt und mein Vater zufrieden gebrummt. Und morgen wären wir dann gemeinsam in die Flitterwochen geflogen. Karibik. Weißer Sand und Kokosnusspalmen. Ein Traum mit Sahnehäubchen. Doch dazu wird es ja nun leider nicht kommen. Stattdessen steht jetzt Albtraum auf dem Tagesplan. Weil ich blödes Huhn mir die Hochzeitsdokumente über unsere Eheschließung noch einmal genau anschauen wollte. Zu genau! Jetzt wundert es mich auch gar nicht mehr, dass Fabio sich um alles Formelle kümmern wollte! Und statt Romantik pur und Flitterwochen in der Karibik bin ich nun auf dem Weg nach … ja, wohin denn eigentlich? Mein Blick fällt auf die Tankanzeige. Mit dem Tank komme ich jedenfalls nicht mal bis Eberswalde. Also setze ich den Blinker rechts und fahre an eine der Tankstellen, die sich hier, kurz vor der Autobahn, in einer solchen Menge aufreihen, als beginne danach das menschenleere Outback. Die anderen Kunden glotzen natürlich wie Mondkälber, als ich in meinem Outfit aus dem Auto steige. Ich tue so, als würde ich deren Blicke gar nicht bemerken und zerre die Tankpistole aus der Zapfsäule, bevor ich sie ungeduldig in die kleine Tanköffnung meines Autos stopfe. Dann falle ich hinter dem Auto so verkrümmt in mich zusammen, dass ich aussehen muss wie der Glöckner von Notre Dame. Ich will hier endlich weg. Ich muss hier weg! Raus aus dieser Stadt, in der mich jeder Pflasterstein an Fabio erinnert. Dahinten zum Beispiel, in dem McDonald’s, haben wir einmal zwei Milchshakes geholt, bevor wir zu meinen Eltern gefahren sind. Oh Gott, ich kann die Tränen einfach nicht stoppen.
»Ist alles okay mit Ihnen?«, fragt plötzlich eine besorgte Stimme von hinten. Sie gehört zu einer älteren Dame, die mich ansieht, als wäre ich ein angeschossenes Reh im Wald. Ihre Stirn runzelt sich so sehr, dass sie aussieht wie die eines Mopswelpen.
»Danke. Es geht schon«, antworte ich, nein, schluchze ich vielmehr zurück. In dem Moment ertönt endlich das ersehnte Klicken, der Tank ist voll. »Ich muss jetzt … ähm … zahlen«, erkläre ich der Mops-Dame mit den vielen Stirnrunzeln und drehe mich schnell von ihr weg. Jetzt muss ich nur noch den Spießrutenlauf in den Shop und zurück überleben. Aber wie sagt meine Mutter immer? »Eine Glawe kann nichts und niemand in die Knie zwingen.« Also einmal tief ein- und ausatmen. Und los. Tatsächlich würdigt mich der Mann an der Tankstellenkasse beim Zahlen nicht mal eines Blickes – ob er öfter Bräute auf der Flucht hier vorbeifahren sieht?
Als ich wieder im Auto sitze, weiß ich endlich, wohin ich fahren werde. Zu meinen Eltern. Wohin denn sonst? Meine Mama wird mich schon wieder aufpäppeln, schließlich ist meine Mutter eine Frau wie ein Baum. Also nicht figürlich, sondern im übertragenen Sinne. Stark. Robust. Unerschütterlich. Stress, welcher Art auch immer, prallt an ihr ab wie Hitze an Teflon. Sie weiß immer einen Ausweg, egal wie ausweglos der Mist scheint, in dem man sich befindet. Allerdings, so ausweglos wie dieser Mist hier war noch keiner zuvor. Nicht mal der Mist, als ich fast durchs Abi gerasselt wäre – und das war schon ziemlich großer Mist. Wenn ich auch bis heute glaube, dass meine miesen Mathe-Noten nicht meine Schuld waren, sondern die dieses schlechten Lehrers. Kein Wunder, was konnte man denn von einem Mathelehrer, der »Ohnewitz« heißt, anderes erwarten.
Ich drücke also aufs Gaspedal, und der Mini fährt wenigstens jetzt gleich auf Befehl meines Fußes mit quietschenden Reifen los. Kurze Zeit später rase ich endlich die Autobahnausfahrt Richtung Norden entlang. Der Zeiger auf dem Tacho bewegt sich zügig und gleichmäßig nach rechts, bis er kurz vor Zweihundert haltmacht – ich muss zufrieden seufzen. Denn ehrlich gesagt habe ich ein Problem damit, mittlere Geschwindigkeiten zu fahren – ich kann nur ganz langsam oder rasend schnell. Der Mittelweg ist nichts für mich. Auch in Teilen meines Lebens, die außerhalb meines Minis stattfinden, neige ich zu solch extremen und exzessiven Entscheidungen. Meine Mutter sagt immer, dass ich eine Dramaqueen sei. Aber ich erwidere dann, dass ich Emotionen einfach nur intensiv erlebe. Was soll daran schlimm sein? Und dass ich eben von Natur aus sensibel und nah am Wasser gebaut bin, dafür kann ich ja nichts. Das ist wahrscheinlich genetisch bedingt oder so. Auch wenn ich mich, bei der Ruhe und Ausgeglichenheit, die meine Eltern immer ausstrahlen, schon oft gefragt habe, ob ich wohl adoptiert bin.
Meine Hand gleitet über das Autoradio, und ich drücke auf den großen Play-Knopf, so groß, dass selbst ein Blinder ihn finden würde (abgesehen davon, dass ein Blinder vielleicht lieber nicht Auto fahren sollte). Die kraftvolle Stimme von Adele erfüllt sofort den kleinen Wagen. Da ich so lange nicht mehr im Mini unterwegs war, habe ich auch Adele ewig nicht mehr gehört. Ehrlich gesagt, bis eben wusste ich nicht einmal, dass die CD hier im Player liegt – ich bin nämlich etwas unordentlich. Kreativ chaotisch, wie ich es gerne nenne. Schlampig, wie meine Mutter es gerne nennt.
Die ersten Klänge von »Turning Tables« ertönen. Ausgerechnet! Ich habe völlig vergessen, wie verdammt traurig jedes einzelne Lied dieses Albums ist – »Suizid-Soundtrack« nennt meine beste Freundin Moni diese Art von Musik. Aber sie hört ja auch am liebsten Indie-Rock und ist sowieso viel härter im Nehmen als ich. Moni wäre vorhin sicher nicht weggelaufen, sondern hätte Fabio mit ihrem Wissen einfach konfrontiert und ihn dann ordentlich zusammengestaucht. Sie hätte Antworten eingefordert und sofort eine großzügige Abfindung herausgehandelt. Aber ich … ach, woher denn. Ich flüchte hier im Mini auf der Autobahn und schluchze laut mit Adele im Chor.
»Close enough to start a war
All that I have is on the floor«, singt Adele.
»Ja genau!«, rufe ich dazwischen. Sie hat ja so recht.
»So, I won’t let you close enough to hurt me
No, I won’t rescue you to just desert me.«
»Nein!«, weine ich, nein, kreische ich vielmehr. Nie mehr!
»I can’t give you the heart you think you gave me
It’s time to say goodbye to turning tables.«
»Belogen und betrogen …«, presse ich hervor.
»I braved a hundred storms to leave you
As hard as you try, no, I will never be knocked down.«
Adele klingt sehr entschlossen.
»Never!«, schluchze ich dagegen kläglich im Chor.
Die Tränen laufen mir jetzt in Sturzbächen die Wangen herunter, und irgendwie ist das ja auch gut so. Muss ja alles raus. Diese tiefe Traurigkeit, die Enttäuschung über das verlorene Glück. Und wenn schon, dann am besten mit Adele. Im Rückspiegel sehe ich, wie die Sonne langsam über dem Berliner Fernsehturm untergeht und den ganzen Himmel in einen riesigen Teppich aus Feuer verwandelt. Würde ich noch so viel malen wie früher, würde ich das vielleicht als Gemälde festhalten – aber möglicherweise würde ein solches Bild wohl zu schnell richtig kitschig wirken. Mir kommt es nämlich ein bisschen so vor, als ob der Himmel sich jetzt auch noch über mich lustig machen würde. Der perfekte Romantik-Kitsch dort hinten und hier, im Schatten, ich, die Belogene und Betrogene. Die, die das Glück einfangen wollte wie das letzte Einhorn.
Da fällt mir ein, ich habe mich Ihnen noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Anne Glawe. Wobei, eigentlich seit heute Bartolini. Nein, natürlich bleibe ich bei Glawe oder … Ach, was weiß ich denn! Sicher ist: Ich bin vierunddreißig Jahre alt, frisch verheiratet, frisch getrennt und nun im viertausend-Euro-teuren Hochzeitskleid auf der Flucht – falls Sie sich das nicht inzwischen sowieso schon gedacht haben. Und im Moment schaffe ich es partout nicht, diesen blöden, sich immer wieder aufbäumenden Tüllrock unter den Lenker zu zwingen.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Liebeskummer-Status:
Von Wolke 7 mit dem Express in die Hölle.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
2.Anne und die Nacht am Strand
Als ich kurze Zeit später (inzwischen im Dunklen) die Straße zum Haus meiner Eltern entlangfahre, bekomme ich es plötzlich mit der Angst zu tun. Was soll ich meiner Mutter sagen? Was meinem Vater? Dass ich heimlich, ohne ihnen im Vorfeld auch nur ein Wort zu sagen, den falschen Mann geheiratet habe? Dass er sich schon jetzt, als die Unterschrift unter der Trauungsurkunde noch frisch geglänzt hat, als riesiger Schwindler entpuppt hat? Oder soll ich das ganze Drama vielleicht kompakt zusammenfassen und einfach nur sagen, dass ich mein Leben so richtig versaut habe? Dass ich mich von einem gut aussehenden Italiener in einen Zustand habe quatschen lassen, der mich anscheinend nicht nur denkunfähig gemacht, sondern sogar dazu geführt hat, dass ich nun ohne Wohnung, ohne meine Habseligkeiten und dafür verheiratet mit einem Blender und Lügner dastehe. Meine Eltern würden an ihrer Erziehung zweifeln und glauben, dass ich jetzt völlig durchgedreht sei. Meine Mutter würde wahrscheinlich die Hände gen Himmel strecken und sich fragen, warum ihre jüngste Tochter immer so ein Drama veranstalten muss, und mein Vater würde mich grummelnd fragen: »Mensch, wie konntest du nur so naiv sein?« Dann würde meine Mutter ihm beipflichten und mit erhobenem Zeigefinger erklären: »Ich hatte bei dem Fabio nie ein gutes Gefühl. Der ist ein Schnacker, das habe ich von Anfang an zu deinem Vater gesagt, nicht wahr, Klaus?« Und Klaus würde nicken, und dann würde Sabine (meine Mutter) ihn über meinen Kopf hinweg fragen, wie es nun weitergehen soll mit mir. Aber bevor mein Vater zu einer Antwort käme, würde meine Mutter schon weiterreden: »Du kommst einfach wieder nach Hause, mein Kind« – das würde sie einfach so beschließen. Und es würde wie eine Drohung klingen.
Verstehen Sie mich nicht falsch, ich liebe meine Eltern. Wirklich. Aber mit vierunddreißig Jahren, als verheiratete, gleich wieder getrennte Frau noch einmal bei den eigenen Eltern einzuziehen klingt wie der Plot zu einem Horrorfilm.
Mit jedem Meter, den ich näher komme an das Haus, in dem ich aufgewachsen bin, wird mir mulmiger zumute. In meinem Bauch zwickt und grummelt es. Das Gefühl erinnert mich an die berühmten Schmetterlinge im Bauch, nur weniger schön und romantisch. Motten im Bauch vielleicht. Oder Käfer. Fiese Käfer mit langen schwarzen, haarigen Beinen. In jedem Fall keine niedlichen Glücks-Marienkäfer.
Ich fahre an die Auffahrt heran und sehe, dass davor, unter einer der hohen Kastanien, schon ein silberner Mercedes geparkt hat. Oh Gott, fährt es mir durch den Kopf, bitte nicht! Das ertrage ich jetzt nicht auch noch! Eine A-Klasse, das spießigste aller Autos – das habe ich bei meiner PR-Arbeit für einen großen Autohersteller gelernt – steht vor der Garage und guckt meinen roten Mini verächtlich an. Ich trete so panisch auf die Bremse, als sei mir ein Einhorn vor das Auto gelaufen, und stoppe mitten auf der Straße. Nein, das kann doch wohl jetzt nicht wahr sein! Die Besitzerin dieser A-Klasse nämlich steht ihrem Wagen, was die Spießigkeit betrifft, in nichts nach. Sie ist der Inbegriff des Moralapostels und sitzt auf einem ach so hohen Ross, dass man meint, ihre kurzen aschblonden Haare müssten ständig den Himmel berühren. Gemeint ist meine Schwester Sonja. Sie ist vier Jahre älter als ich – tut aber gerne so, als hätte sie mir ein ganzes Leben an Weisheit voraus. In unserer Kindheit waren wir noch ein Herz und eine Seele, aber je älter wir wurden, desto größere Abgründe taten sich vor uns auf. Sonja, Lehrerin für Deutsch und Geschichte, hat unsere Heimat nie verlassen und mit siebenundzwanzig den Bankangestellten Christian Ahrens geheiratet. Der ist ein solch langweiliger Ja-Sager, dass Moni und ich ihn nur »Gähn« nennen. Er hat Sonja, unseren groben Schätzungen zufolge, seit der Hochzeitsnacht genau zweimal nackt gesehen: einmal für Lukas, acht, und einmal für Emilia, fünf.
Bei diesen beiden Monstern kann man sich kaum entscheiden, wer verzogener ist. Ich erinnere da nur an das vorletzte Weihnachten: Tatsächlich hatten die beiden Gören am Heiligabend nichts Besseres zu tun, als ihre Geschenke zu zählen und dann in Tränen auszubrechen, weil angeblich die Nachbarskinder viel mehr von ihren Großeltern bekommen hätten. Während meine Mutter ihre Wut darüber an der Gans ausließ und diese maximal brutal auseinandersäbelte, schaute mein Papa so traurig drein, dass ich die undankbare Brut am liebsten an Ort und Stelle vermöbelt hätte. Währenddessen hatten Sonja und Göttergatte Gähn nichts Besseres zu tun, als mit stolzgeschwellter Brust zu loben, wie gut ihre Kinder doch schon rechnen könnten. Und natürlich prompt am ersten Tag, an dem die Geschäfte wieder offen hatten, die lieben kleinen Monster in den nächsten Spielzeugladen zu fahren, um endlich für noch mehr Geschenke zu sorgen.
Und trotzdem tut Sonja so, als hätte sie die perfekten Kinder, den perfekten Mann, ja, eben das perfekte Leben. Mich hingegen vergleicht sie gerne mit dem armen, dicken Kind, das im Sportunterricht als Letztes in das Volleyballteam gewählt wird: Noch immer kein Ehemann. Noch immer keine Kinder. Noch immer eine Karriere ohne jede Sicherheit. Und dann auch noch das »oberflächliche« Leben in der Großstadt! Es ist wirklich völlig egal, zu welcher Tages- oder Nachtzeit ich mit Sonja spreche, sie hat immer einen bissigen Kommentar auf ihren schmalen Lippen. Kann es sich nie verkneifen, zu werten und abzuwerten.
Was ist denn mit deinen Haaren passiert? Soll das so?
Ach Anne, stimmt ja, ich vergesse immer, dass du keine Kinder hast.Du, das kannst du dir nicht vorstellen, so etwas merkt man erst, wenn man jahrelang mit demselben Mann zusammen ist.
Wie, du hast dieses Jahr schon wieder keine Gehaltserhöhung bekommen? Und das bei den vielen Überstunden! Na ja, zu Hause wartet ja eh niemand auf dich.
Anne, Anne, so langsam wird es aber mal Zeit, dein Leben auf die Reihe zu bekommen.
Ich starre auf den Heckaufkleber des Mercedes (»Lukas und Emilia fahren mit« – als ob das irgendjemand wissen will) –, und mein Blick wandert weiter zum Haus meiner Eltern. Terrakotta, im mediterranen Stil, so hatte meine Mutter das Haus vor einigen Jahren streichen lassen. Drinnen sieht es jetzt aus wie in der Toskana – was irgendwie nicht so richtig passt. Denn die Toskana könnte hier im rauen Norden nicht weiter weg sein.
Ich sehe, dass im pseudotoskanischen Wohnzimmer Licht brennt und frage mich, was Sonja um diese Zeit bei meinen Eltern sucht. Warum ist die nicht in ihrem perfekten Spießer-Haus, mit ihrem perfekten Luschi-Mann und den perfekten Rotzgören? Verwirrt schaue ich auf die Uhr. Um diese Zeit gucken meine Eltern normalerweise immer »Das große Fest der Volksmusik«. Meine Vorstellung von »Suizid-Musik«. Aber mein Vater hat vor einer Weile auf fast rührende Altherren-Art seine Leidenschaft für Volksmusik entdeckt und lässt sich darin auch von niemandem beirren. Meine Mutter macht das Gedudel, ja, allein der Anblick von Florian Silberheini natürlich wahnsinnig, sie ist immerhin gute zwölf Jahre jünger als mein Vater und hört am liebsten Andreas Bourani oder alten DDR-Rock. Manchmal außerdem Peter Maffay und besonders gerne Herbert Grönemeyer.
Meine Eltern – sie waren für mich immer das Ideal der großen Liebe. Denn als die beiden sich verliebt haben, hatte keiner so recht daran geglaubt, dass ihre Beziehung lange halten würde. Meine Mutter war damals gerade achtzehn und mein Vater schon dreißig – aber sie hatten sich rettungslos verknallt. Das Ganze auch noch bei der Arbeit, als Mama als Sekretärin in Papas Rohr-Firma anheuerte. Und zusätzlich zu ihrem Altersunterschied waren sie damals schon so gegensätzlich, wie man es sich nur vorstellen konnte. Mama stets quirlig, voller Ideen und mit tausend Plänen, Papa ganz ruhig und immer mit vollem Einsatz bei seiner Arbeit (seiner zweiten großen Liebe, was sogar Mama akzeptieren musste). Aber trotzdem: All ihre Unterschiede schienen sie noch stärker zusammenzuschweißen, und als dann zwei Jahre nach ihrer ersten Begegnung erst meine Schwester und vier Jahre später ich kam, war ihr Glück perfekt. Bis heute – und ich wollte ihnen immer ein bisschen nacheifern, wollte auch dieses ganz große Glück finden. Was ja nun bei Fabio so rein gar nicht geklappt hat.
Und der unterschiedliche Musikgeschmack meiner Eltern scheint bis heute ihr einziges größeres Problem zu sein – meine Mutter weiß allerdings auch, dass mein Vater sowieso spätestens um neun Uhr abends grunzend vor dem Musikantenstadl einpennt und sie dann ungestört den Sender wechseln kann. Ich stelle mir vor, wie sie dort oben, nur wenige Meter entfernt, durchs Programm zappt, bis sie irgendwo einen Krimi findet. Ihr bevorzugtes Unterhaltungsprogramm für einen Samstagabend, das hat sie mir definitiv vererbt. Obwohl … wenn Sonja da ist, machen sie vielleicht etwas ganz anderes.
Ich seufze laut auf und erschrecke mich kurz selbst über diese Unterbrechung der Stille. Wie sehr ich mich nach einer festen Umarmung meiner Mutter sehne – und gleichzeitig schaffe ich es einfach nicht, aus dem Mini zu steigen. Denn daheim müsste ich erzählen, was passiert ist. Und wenn ich einmal erzähle, was passiert ist, dann wäre es Wirklichkeit. Dann kann ich nie wieder so tun, als wäre nichts passiert. Ich weiß auch nicht, woher dieses Bedürfnis kommt, meinen Eltern zu beweisen, dass ich alles im Griff habe. Dass ich erwachsen bin. Kompetent. Sollte zu Hause nicht der Ort sein, an dem man sich guten Gewissens wie ein Kind verhält? Wenn auch eins von vierunddreißig Jahren.
Wie gelähmt sitze ich im Mini vor meinem Elternhaus. Unfähig, in den heimeligen Schoß meiner Eltern zurückzukriechen. Wenn nur wenigstens Sonja nicht da wäre! Mit der Enttäuschung meiner Eltern würde ich schon irgendwie klarkommen, aber nicht mit Sonja Klugscheißer. Ich kann es mir bildhaft vorstellen: Ihr Entsetzen über eine weitere »völlig unverständliche« Entscheidung ihrer kleinen, unfähigen Schwester. Ihr süffisantes Grinsen, ihre tollen Ratschläge und ihre wertenden Blicke. Die ganze Sonja-Show eben.
Nein, ich beschließe, dass das keine Option ist, und lasse kurzerhand den Motor wieder an. Aber wohin dann? Auf einmal bereue ich es zutiefst, dass ich überhaupt Richtung Norden gefahren bin. Jetzt stecke ich hier fest. Dann doch lieber die Toskana! Ich fluche kurz und heftig und beschließe spontan, dass mir nichts anderes übrig bleibt, als noch etwas weiterzufahren. Genauer gesagt, gute fünfundvierzig Minuten weiter. Zwar bin ich dort jahrelang nicht mehr gewesen, aber den Weg würde ich schon noch finden. Als Jugendliche hatte ich nämlich einige Sommer in einem kleinen, etwas angeranzten Ferienlager auf Rügen verbracht. Dort, in den Zickerschen Bergen, habe ich unter anderem zum ersten Mal geknutscht. Und dort geschah es auch, dass mir zum ersten Mal das Herz brach. Wofür jeweils unterschiedliche Männer verantwortlich waren …
Auf einmal kommt es mir wahnsinnig symbolisch vor, jetzt an diesen Ort zu fahren. Vielleicht schließt sich so ein Kreis? Der Kreis des gebrochenen Herzens? Und danach kann ich ein neues Leben voller Liebe anfangen, die nicht wehtut. Eben das große Glück finden. Diese Gedanken stimmen mich ungefähr eine Sekunde lang fast optimistisch – aber dann verfliegt der Optimismus so schnell, wie er gekommen ist, und ich kann mir plötzlich nicht mehr vorstellen, dass ich jemals jemanden wieder so lieben werde wie Fabio. Das Einhorn ist ein für alle Mal abgehauen.
Für alle, die noch nie da waren, muss man erklären, dass die Zickerschen Berge natürlich keine wirklichen Berge sind, zumindest keine, wie sie zum Beispiel die Bayern haben. Mit Fabios geliebtem Kitzbühel, oder wie er es nennt, »Kitz«, haben die Zickerschen Berge nichts gemein – schließlich befinden sie sich an der Ostsee. Zum Skifahren taugen sie nicht, und professionellen Bergsteigern entlocken die Hügel auf der Insel Rügen höchstens ein müdes Lächeln. Ihr höchster Berg, der Baken, bringt aber Flachlandindianer oder eben einfach wahnsinnig untrainierte Menschen (wie mich) durchaus ins Schwitzen. Nicht, dass ich so oft in meinem Leben versucht hätte, den Baken zu erklimmen. Wobei wir auch nach meiner Ferienlager-Zeit hin und wieder Familienausflüge nach Zicker gemacht haben. Aber jetzt war ich schon seit vielen Jahren nicht mehr dort.
Ich lenke den Mini durch meine Heimatstadt, vorbei an der Altstadtmauer und dem Knieperteich, und bin in Gedanken schon in den Zickerschen Bergen. Wie sie, eingeschlossen von Ostsee und Bodden, dort ruhen, und wie alles um sie herum immer gleich bleibt. Inklusive der Bewohner. Die Rüganer, das weiß hier jeder, sind ein eigenes Völkchen. Veränderungsscheu und ohne Kokolores. Vor allem aber sind sie außergewöhnlich maulfaul und stellen keine überflüssigen oder blöden Fragen. Und das ist ja wohl genau das, was ich im Moment brauche.
Ich überquere schließlich den Sund und fahre dann über die prächtige Rügenbrücke, von der man tagsüber einen wundervollen Blick auf Stralsund und seine Silhouette mit den drei Kirchtürmen und den hohen Hafenspeichern hat. Im Dunklen erkennt man jedoch nur die aufflackernden Lichter der entgegenkommenden Wagen. Ich bin trotzdem froh, dass es endlich richtig dunkel ist, so sieht mich wenigstens niemand in meinem Brautkleid. Und das bedeutet: keine blöden Blicke mehr. Oder wenn doch, dann sehe ich sie zumindest nicht. Als ich am anderen Ende der Brücke, auf der Insel, ankomme, fühle ich mich plötzlich wie befreit: Niemand weiß, wo ich stecke. Und so schnell werde ich es auch niemandem verraten – ich muss jetzt einfach mal in Ruhe über alles nachdenken. Moni denkt sowieso, dass ich schon halb in den Flitterwochen bin, und wird sich keine Gedanken machen, wenn sie eine Zeit lang nichts von mir hört. In der Agentur habe ich den dreiwöchigen Urlaub bereits vor Monaten eingereicht, und meinen Eltern schreibe ich später einfach eine kurze SMS: Bei mir ist alles gut, hoffe bei euch auch. Kuss, Anne.
Die Wahrheit ist, ich habe ewig keine Zeit mehr nur mit mir verbracht. Da war immer irgendetwas. Oder irgendwer. Und vor allem Fabio. Ich habe einen so großen Freundeskreis, dass man eigentlich nie allein sein muss. Wir feiern, leiden und lachen zusammen. Obwohl ich zugeben muss, dass ich die meisten dieser Freunde, von denen ein Großteil zur Kategorie »Dauersingles« gehört, in letzter Zeit sträflich vernachlässigt habe. Fabio ist einer dieser Männer, die ungern allein sind. Und ich bin leider eine dieser Frauen, die es ihrem Freund viel zu gerne recht machen. Deswegen hatte ich in den letzten Monaten eher selten Zeit für die früher obligatorischen Mädelsausflüge. Sogar meine beste Freundin Moni blieb da viel zu oft auf der Strecke. Bei meiner Trauung, bei der sie ja immerhin die Trauzeugin war, hatte sie seltsam traurig geschaut – ob sie gedacht hatte, dass sie jetzt noch weniger Zeit mit mir verbringen würde? Und die Freunde von Fabio – mit denen wollte ich ehrlich gesagt auch nie viel Zeit verbringen, was ich aber viel zu oft dann, natürlich Fabio zuliebe, doch tun musste.
Auch sonst habe ich nur noch wenig von dem gemacht, was mich interessiert. Früher habe ich gerne gemalt, aber seitdem ich Fabio kennengelernt habe, blieb mir dafür schlichtweg keine Zeit mehr. Wir haben einfach jede freie Minute miteinander verbracht.
Um ehrlich zu sein, ich weiß gar nicht mehr, wie das ist, allein zu sein. Muss ich dann mit mir selbst sprechen, um meine Stimme nicht zu verlieren? In meinem Job, da quatsche ich nämlich, gezwungenermaßen, den ganzen Tag. Von frühmorgens bis spätabends. Ja, Frau Schreck. Nein, Frau Schreck. Aber sicher doch, Frau Schreck. Machen Sie sich keine Sorgen, Frau Schreck, Sie können sich auf mich verlassen, Frau Schreck. Ich kümmere mich darum, Frau Schreck. Alles schön und gut – aber wer kümmert sich eigentlich um mich? Frau Schreck bestimmt nicht! Also ist das jetzt angesagt: Ich nehme mir einfach mal Zeit und kümmere mich um einen Menschen, den ich viel zu lange vernachlässigt habe: um mich selbst. Und so ein ruhiges Nest wie Zicker ist da genau der richtige Ort dafür.
Als ich schließlich die größeren Orte wie Binz und Sellin passiert habe und mit dem Auto in Zicker einfahre, liegt das kleine Dorf hinter den Hügeln nicht nur ruhig, sondern regelrecht ausgestorben da. Am Ortseingang steht eine zu dieser Zeit verwaiste Bushaltestelle mit einem leicht grünlich schimmernden Reetdach. Der dort hängende Fahrplan scheint nur wenige Touren anzuzeigen, als ich beim Vorüberfahren einen Blick darauf erhasche. Was heißt hier eigentlich fahren: Langsam holpere ich mit dem Mini über das Kopfsteinpflaster, das für eine Zeit, in der noch Kutschen darüberfuhren, sicher geeigneter war. In kaum einem der Wohnhäuser brennt noch Licht, und an den niedrigen Holzzäunen stehen Schilder mit den Worten »Zimmer frei«, als hätte sie dort jemand vergessen. Von den vielen Touristen, die jeden Sommer wie ein Hochwasser die Insel fluten, landen nur die wenigsten in diesem versteckten Örtchen am äußersten, untersten Zipfel Rügens. Wobei es angesichts der vielen dunklen Häuser offensichtlich ist, dass jetzt, im Frühling und damit in der Vorsaison, noch weniger dort los ist als im Sommer. Zicker ist bis heute so unbekannt, dass es noch nicht einmal ein Geheimtipp ist.
Ich lenke den Wagen an einer Wiese vorbei, von der man bis auf die Steilküste von Göhren schauen kann. Davor steht eine Gruppe hoher Birken, aufgereiht wie zum Fahnenappell. Inzwischen fahre ich langsamer als Schrittgeschwindigkeit und mache schließlich an der kleinen Strandstelle hinter der Dorfkirche halt. Der Motor geht zufrieden brummend aus, und dann umgibt mich eine Stille, die ich aus Berlin gar nicht kenne. Ich steige aus und atme den Geruch von Wasser und Algen tief ein. Die Ostsee liegt ruhig da, ganz so, als stelle sie sich tot. Über ihr scheint der Mond, so voll, als hätte ihn gerade jemand aufgepumpt. Natürlich ist gerade Vollmond, das passt. Bei Vollmond werden angeblich mehr Babys geboren, aber auch Verbrechen soll es häufiger geben, wenn der Trabant sich so richtig aufplustert. Ein Thema, an das ich gerade, so ganz allein unterwegs, lieber nicht denken will.
Um mich von solchen Ideen abzulenken, drehe ich mich einmal um meine eigene Achse und betrachte die Kirche hinter mir. Klein, fast niedlich, mit einem kurzen Turm aus Holz, einem korpulenten Rumpf und verschlungenen Wegen drumherum. Der Mond beleuchtet die schlichten Holzkreuze. Mir fällt ein, was mein Vater immer gesagt hat, wenn wir hier waren: »Auf diesen Friedhof kommste nur, wenn du schon drei Generationen vor dir dort liegen hast.« Ich wende mich ab und lasse meinen Blick weiter umherschweifen. Gegenüber der Kirche liegt ein Dreiseithof, mit einem rechteckigen Klinkerhaus in der Mitte und den flacheren Scheunen und Ställen auf den Seiten daneben. Über die lange Auffahrt zum Hof trottet eine Katze durch den Mondschein, die sich noch nicht ganz sicher zu sein scheint, ob sie heute wirklich auf Mausjagd gehen soll. Die Luft ist mild, nur ein leichter Ostwind weht durch die Dünen. Der Frühling scheint in dieser Gegend keine Schwierigkeit zu haben, richtig in Fahrt zu kommen. Danke, globale Erderwärmung.
Ich schaue in den Himmel, der, richtig kitschig, voller Sterne hängt. So viele Sterne habe ich in Berlin noch nie gesehen. Abgesehen von dem Sternenzelt scheint auch die Nacht hier viel intensiver als in der Stadt, in der ich nun schon mehr als ein Jahrzehnt meines Lebens verbracht habe. Berlin ist zwar nicht New York, aber so richtig dunkel wird es auch in der Hauptstadt Deutschlands selten.
Der Sternenhimmel erinnert mich an die Ferienlager früher, in denen wir so oft unter freiem Himmel geschlafen haben. Ich muss so etwa zwölf gewesen sein, als ich hier zum ersten Mal ein paar Wochen im Ferienlager verbracht habe, und dann jedes Jahr, bis ich sechzehn war. Meine Schwester ebenso, wobei die sogar mit achtzehn noch mal mitkam und dort als Betreuerin einen Ferienjob hatte. Ihr Talent, alle herumzukommandieren, fand darin wirklich seinen perfekten Nährboden. Vor allem mir wurde dort dann natürlich gesagt, was ich bitteschön zu tun hätte – und trotzdem, die Zeit in den Ferienlagern und vor allem in diesem wunderbaren Ort gehörte für mich immer zu den schönsten meines Lebens. Selbst wenn es auch in diesen Ferienlagern einige Ereignisse gab, an die ich bis heute lieber nicht denke – was vor allem mit meiner damaligen Erzfeindin, der Prinzessin von Zicker, zu tun hatte. Genau an dem Ort, an dem ich eigentlich alles vergessen wollte, kommen jetzt auf einmal noch mehr unangenehme Erinnerungen hervor. Mit aller Kraft schiebe ich diese Erinnerungen dann aber weg. Jetzt bitte nicht!
Plötzlich überkommt mich eine Müdigkeit, die ich so schon lange nicht mehr gespürt habe. Kurz überlege ich, ob ich irgendwo klingeln soll, um ein Zimmer anzumieten, aber es scheint mir keine gute Idee, die Zicker’sche Ruhe zu stören. Schließlich will ich niemanden aus dem Schlaf reißen, das würde mir sicherlich keinen freundlichen Empfang bescheren. Ich drehe mich einmal um die eigene Achse und erinnere mich dann, dass irgendwo im Auto noch meine Yogamatte und eine alte Picknickdecke herumfliegen müssten. Also drücke ich auf den Knopf für den Kofferraum, der mit einem Beep aufgeht und dann vor mir liegt wie ein schwarzes Loch. Ich leuchte mit meinem Telefon hinein und werde von fröhlichem Chaos empfangen. Fabio hat sich regelmäßig über meine Unordnung beschwert, aber siehe da, jetzt macht sie sich endlich mal bezahlt. Es gibt praktisch nichts, was ich nicht dabeihabe. Unter Pfandgut und ein paar Edekatüten (in die ich jetzt mal lieber nicht gucke, man soll sein Glück ja nicht herausfordern) ziehe ich die besagte Decke hervor. Dort, wo eigentlich der Verbandskasten liegen sollte, steckt eine zerknüllte Fleecejacke, die mal vor Jahren ein Mann in meinem Kofferraum vergessen hat. Lars hieß der … der war auch keine gute Wahl. Aber immerhin: So muss ich jetzt wenigstens nicht frieren. Das spricht für meine Theorie, dass alles im Leben einen tieferen Sinn hat, selbst Typen, von denen man sich später fragt, ob man damals blind, taub oder beides war.
Die pinke Yogamatte finde ich kurze Zeit später unter dem Beifahrersitz. Schnell ziehe ich mir die Jacke an und meine Pumps aus. Dann laufe ich barfuß Richtung Meer – ich schlafe jetzt wirklich einfach am Strand, so wie früher im Ferienlager. Und wenn ich aufwache, sieht die Welt schon ganz anders aus – zumindest hat das meine Oma immer gesagt. Na gut, die meinte natürlich auch, bis zur Hochzeit ist alles vergessen – und wie das ausgegangen ist, brauche ich Ihnen ja nicht zu erzählen … Hundemüde lege ich mich jetzt auf meine pinke Matte, kuschle mich in die Picknickdecke und blicke auf den unfassbaren Sternenhimmel über mir. Und während ich noch dem sanften Brausen des Meeres lausche, spüre ich schon, wie ich langsam eindämmere – und nach und nach in einen traumlosen Schlaf versinke.
Am nächsten Morgen werde ich allerdings denkbar unangenehm geweckt. Und damit meine ich nicht die Tatsache, dass sich mein Rücken anfühlt, als hätte Hulk Hogan darauf Irish Dance geprobt. Eine Art quietschendes, schleifendes Geräusch vermischt sich mit der Erschütterung des Bodens, auf dem ich liege. Ich schrecke hoch und stelle fest, dass die Sonne noch nicht einmal ganz aufgegangen ist. Im ersten Moment begreife ich gar nicht, wo ich bin, und schaue mich orientierungslos um. Etwa zehn Meter entfernt leuchtet eine orangefarbene PVC-Jacke wie eine Boje. Der Inhalt der Jacke, eine kräftige Gestalt, zieht geräuschvoll ein kleines Fischerboot auf Rollen ins Wasser.
»Manno«, murmle ich vor mich hin, »ich schlafe hier. Kann der nicht mal etwas leiser sein?« Der Typ schleift allerdings ungerührt sein Boot ins Meer, und ich lasse mich zurück auf meine Matte fallen. Wenn ich eins hasse, dann vor Sonnenaufgang geweckt zu werden. Überhaupt, zu frühes Aufstehen liegt mir nicht. Früh: ja. Zu früh: auf keinen Fall.
Mürrisch drehe ich mich in die andere Richtung und versuche, mich so geschickt wie möglich zurück in die Decke einzurollen. Dieser Frühlingsmorgen ist eigentlich wirklich angenehm, aber dafür, dass ich heute Abend in der Karibik einen Cocktail am sonnigen Strand schlürfen wollte, ist es dann doch verdammt eisig. Apropos. Bei dem Gedanken an meine geplanten Flitterwochen fällt mir mit einem Schlag das ganze Elend wieder ein. Die Hochzeit. Die Stunde der Wahrheit. Die Flucht. Und dass mein Leben in Berlin, so wie ich es kannte, in tausend Scherben zersprungen ist. Ich kneife die Augen kurz zu und mache sie dann wieder auf. Vorsichtig, als würde ich auf spitzen Nägeln liegen, drehe ich mich und schaue unter die Decke. Jap, das da an meinem Körper ist eindeutig ein Hochzeitskleid. Und damit ist dieser verdammte Albtraum also die Wirklichkeit. Ich stöhne laut auf und vergrabe mein Gesicht so tief wie möglich in der Decke. Unter mir knirscht der Sand.
Vielleicht hast du vorschnell reagiert, flüstert plötzlich eine innere Stimme der Vernunft, die sich bisher fein zurückgehalten hat. Vielleicht ist das Ganze ein großes Missverständnis? Vielleicht kann Fabio ja alles erklären? Vielleicht gibt es eine ganz einfache Erklärung für all das? Vielleicht, vielleicht. Nein! Ich balle die Fäuste. Halt doch die Klappe, du Vernunftstimme du! Jetzt brauche ich deine Ratschläge auch nicht mehr. Das, was ich entdeckt habe, hätte Fabio nicht schönreden können. Wenn er mich auch sonst immer hatte bequatschen können – »Aberrrr Amorrreeee, isch genne diese Tina kaum, wirklisch …« – dieses Mal nicht. Nein, nein, da gibt es nichts zu erklären. Aus dieser Nummer kommt dieser italienische Windbeutel nicht heraus! Damit ist jetzt Schluss!
Ein frischer Wind zieht plötzlich über mich hinüber, und ich kuschle mich noch tiefer in die Decke. Auf einmal bereue ich es zutiefst, dass ich mich in keinen Flieger in die Sonne gesetzt habe, oder wenigstens nach New York oder in irgendeine andere Großstadt gejettet bin, in der man zumindest ein wenig Zerstreuung findet. Jetzt liege ich hier am Arsch der Welt und friere mir selbigen ab. Mutterseelenallein mit meinen Gedanken, die auch schon mal positiver waren. »Oh Gott, bitte mach, dass dieser Albtraum aufhört«, flehe ich leise gen Himmel. Dann weine ich mich noch einmal in den Schlaf.
Zwei Stunden unruhigen Herumwälzens und schlechter Träume später knurrt mein Magen wie ein ganzes Rudel hungriger Löwen. Ich beschließe, dass ich jetzt endlich wieder etwas essen muss, immerhin habe ich seit zwei Tagen nichts Richtiges zwischen die Zähne bekommen. Erst die Aufregung vor der Hochzeit, dann die Aufregung während der Hochzeit. Und dann die unerwartete Aufregung danach. Normalerweise bin ich ein guter Esser (was sich leider auch an meinen Hüften abzeichnet), aber bei den Strapazen der vergangenen Tage konnte ich nicht einmal an so etwas denken wie essen. Wahrscheinlich habe ich bereits einige Kilos abgenommen – wenigstens dieser Gedanke erfüllt mich mit etwas Freude. Die Kirchenglocke hinter mir beginnt zu läuten, und ich zähle müde mit. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Dann ist wieder Stille. Ich bin kein großer Fan von Kirchenglocken, und das Gebimmel der Zionskirche hat mich vor allem am Sonntagmorgen so einige Male in den Wahnsinn getrieben. Aber hier passt es ja irgendwie hin. Warum ich das so empfinde, weiß ich auch nicht genau. Vielleicht, weil die Menschen hier nicht viel mehr haben, als die raue See und den Glauben an Gott.
Schwerfällig hieve ich mich aus dem Sand wie eine alte Omi, die jemand gegen ihren Willen in einen tiefer gelegten Sportwagen verfrachtet hat und die jetzt einen Kran braucht, um wieder hochzukommen, und schleppe mich zurück zum Auto. Ich bin eben keine achtzehn mehr, denke ich und streiche mir mit der Hand über den steifen Rücken. Der Blick in den Rückspiegel entlarvt jedoch das wahre Drama. Was sich dort zeigt, ist wahrlich keines meiner besseren Morgengesichter: Ich sehe aus wie ein gestrandetes Wrack. Überall in meinem Gesicht haben sich verschmierte Mascara und getrocknete Make-up-Reste zu einer fiesen, klebrigen Masse vermischt. Meine gestern noch so kunstvoll hochgesteckten Haare sehen aus, als hätte ich zu lange in einen Ventilator geguckt. Moment mal, hat mir da etwa eine Möwe auf den Kopf geschissen? Ich taste mit der flachen Hand meine Haare ab. Tatsache: leicht feucht. Weiß und grünlich. Widerlich! Vorsichtig tupfe ich den Schiss so gut ich kann mit einem Taschentuch ab. Das Ergebnis ist immer noch deprimierend – so kann ich nirgendwo hinfahren. Nicht einmal in den kleinen Dorf-Supermarkt, den ich auf dem Weg hierher in Lobbe gesehen habe. Wenn ich so, mit dem Make-up-Muster im Gesicht, dem Möwen-Schiss im Haar und noch dazu im Brautkleid, in einem Zicker Supermarkt auftauche, lassen die mich doch gleich in die nächste Psychiatrie einweisen.
Ich werfe also die Yogamatte ins kontrollierte Chaos des Minis und gehe ans Wasser zurück. Zum ersten Mal nehme ich die traumhafte Landschaft, die mich umgibt, bei Tageslicht richtig wahr. Am Übergang zwischen Schilf und Strand bleibe ich stehen, und der Blick auf das, was vor mir liegt, versöhnt mich mit dem bisher nicht besonders erfreulichen Morgen. Auf der rechten Seite vor dem Meer und da, wo die Insel zu Ende ist, zwinkern mir saftige grüne Hügel zu, manche schimmern gelb im schwachen Morgenlicht. Unter meinen nackten Füßen – ja, ich bin immer noch barfuß, und da ich auch nichts anderes dabeihabe als weiße Pumps wird das wohl erst mal so bleiben – knirscht der feine Sand. Vor mir die Ostsee, dieses ungemütliche Meer, das mir selbst im Sommer zu kalt ist, um hineinzugehen und das manche Menschen nur abwertend als Brackwasser bezeichnen. Heute ist sie so klar und blau, mit kleinen, feinen Wellen und hübschen weißen Schaumkrönchen, als hätte sie sich extra für meinen Besuch schön gemacht. Ein paar Meter von mir thront ein riesiger Findling, den das Wasser sanft umspült. Hinter mir die Dünen, in denen sich die Gräser im leichten Wind hin und her wiegen wie tanzende Liebespaare.