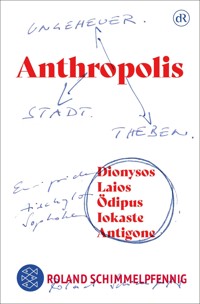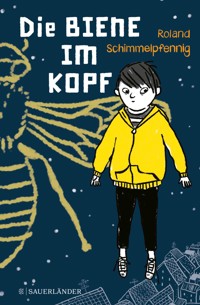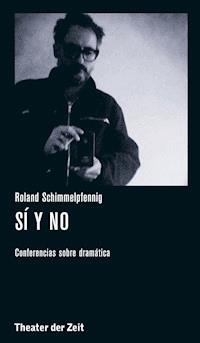An einem klaren, eiskalten Januarmorgen zu Beginn des 21. Jahrhunderts E-Book
Roland Schimmelpfennig
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der erste Roman von Deutschlands meistgespieltem Dramatiker Shortlist für den Preis der Leipziger Buchmesse 2016 Nachts auf einer eisglatten Autobahn, achtzig Kilometer vor Berlin: Ein Tanklaster kippt um und legt sich quer. Auf dem Standstreifen, für den Bruchteil einer Sekunde: ein einzelner Wolf. Bis Berlin folgen wir seinen Spuren, und sein Weg kreuzt sich immer wieder mit den Wegen und Schicksalen unterschiedlicher Menschen. Wie in einem Schwarzweißfilm, in dem gelbes Winterfeuer flackert, ziehen die Bilder und Geschichten dieses Romans an uns vorbei. Sie erzählen vom Suchen und Verlorensein, von der Kälte unserer Zeit und der Sehnsucht nach einem anderen Leben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 198
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Roland Schimmelpfennig
An einem klaren, eiskalten Januarmorgen zu Beginn des 21. Jahrhunderts
Roman
FISCHER E-Books
Inhalt
An einem klaren, eiskalten Januarmorgen zu Beginn des 21. Jahrhunderts
An einem klaren, eiskalten Januarmorgen zu Beginn des 21. Jahrhunderts überquerte ein einzelner Wolf kurz nach Sonnenaufgang den zugefrorenen Grenzfluss zwischen Deutschland und Polen.
Der Wolf kam von Osten. Er lief über das Eis der zugefrorenen Oder, erreichte das andere Ufer des Flusses und bewegte sich dann weiter Richtung Westen. Hinter dem Fluss stand die Sonne noch tief über dem Horizont.
Der Wolf lief im Morgenlicht unter dem wolkenlosen Himmel über weite, schneebedeckte Felder, bis er den Rand eines Waldes erreichte und darin verschwand.
Einen Tag später fand ein Jäger dreißig Kilometer westlich des zugefrorenen Flusses in einem Wald die blutigen Überreste eines Rehs. Neben dem toten Reh im Schnee fand der Jäger die Spuren eines Wolfs.
Das war in der Nähe von Vierlinden bei Seelow. Den letzten Wolf hatte man hier vor über hundertsechzig Jahren gesehen, im Jahr 1843.
Der Wolf blieb bis Mitte Februar in dieser Gegend. Niemand sah den Wolf selbst, man fand nur seine Spur und das blutige Wild im Schnee.
Es war ein sehr kalter und langer Winter. Gegen Ende der zweiten Februarwoche begann es mehrere Tage lang ununterbrochen zu schneien.
Am Abend des 16. Februar geriet auf der völlig verschneiten Autobahn zwischen Polen und Berlin ein Tanklastwagen ins Schleudern.
Der Tanklastwagen stellte sich quer und kippte auf die Seite. Zwei weitere Lastwagen fuhren in den Tanklastwagen hinein und fingen Feuer. Der Tanklastwagen explodierte. Keiner der Fahrer überlebte.
Sechzig Fahrzeuge rutschten in der Folge dieses Unfalls auf der schneeglatten Fahrbahn ineinander und verkeilten sich. Die Menschen kamen nicht aus ihren zerquetschten Fahrzeugen, und das Feuer breitete sich weiter aus.
Das war etwa auf der Höhe des Glieningmoors. Innerhalb kurzer Zeit baute sich ein über vierzig Kilometer langer Stau bis zur polnischen Grenze auf. Die Autobahn wurde in beiden Richtungen gesperrt.
Es wurde Nacht. Die Fahrer der Wagen im Stau machten die Motoren und die Scheinwerfer aus. Der Schnee legte sich auf die Autobahn und auf die stehenden Fahrzeuge in der Dunkelheit.
Auf dem Standstreifen zogen die Feuerwehrautos und Rettungswagen an der nicht endenden Reihe der Fahrzeuge vorbei. Es schneite immer weiter. Alles stand still.
Der junge Pole war auf dem Weg von einem Dorf in der Nähe von Warschau nach Berlin, und er war seit elf Stunden unterwegs. Seit drei Stunden stand er auf der Autobahn im Schnee. Er sah in der Entfernung den Feuerschein der immer noch brennenden Fahrzeuge.
Der explodierte Tanklastwagen und das Feld der ineinander verkeilten Fahrzeuge lagen etwa drei Kilometer vor ihm.
Der Motor des alten Toyota war aus. Der junge Mann fror. Er hatte nicht genug Benzin, um den Motor laufen zu lassen. Manchmal bewegte er den Zündschlüssel um eine halbe Drehung und ließ kurz die Scheibenwischer laufen. Er hatte Angst um die Batterie. Er ließ das Licht in dem Auto aus, er hörte kein Radio. Er saß in dem Toyota in der Dunkelheit.
Das hier dauert noch zwanzig Stunden, hatte er vorhin einen polnischen Lastwagenfahrer auf der Fahrbahn rufen hören. Das hier dauert noch zwanzig Stunden, hatte der Mann immer wieder gerufen.
Der junge Pole stieg aus dem Wagen und machte mit seinem Telefon Fotos von dem entfernten Feuerschein in der Nacht. Dann stieg er wieder in den Wagen. Auf den Bildern war nichts zu erkennen.
Er rief seine Freundin an, Agnieszka, die in Berlin auf ihn wartete.
– Nein, das dauert hier noch Stunden.
– Was machst du?, fragte sie. Hast du eine Decke?
– Ich habe den Schlafsack im Kofferraum.
– Lass den Wagen stehen und lauf zu dem nächsten Dorf.
– Hier ist kein Dorf.
– Da ist irgendwo ein Dorf. Da muss ein Dorf sein.
– Hier ist nichts, man sieht nichts.
– Da muss ein Dorf sein, Tomasz, lauf zu dem nächsten Dorf, du erfrierst da.
– Hier ist kein Dorf. Ich kann den Wagen hier nicht stehen lassen.
Nachdem er eine weitere Stunde in dem Stau gestanden hatte, stieg Tomasz aus dem Wagen, um zu der Unfallstelle vorzulaufen. Bevor er losging, suchte er sich einen Orientierungspunkt, denn er wusste, dass er ohne Orientierungspunkt den eingeschneiten Toyota nicht wiederfinden würde.
Am Straßenrand rechts vor ihm stand ein Schild mit Kilometerangaben, Berlin 80 km.
Ich bin ein Pfadfinder, dachte er, ich bin ein Scheißpfadfinder.
Tomasz lief vor zu der Unfallstelle. Es schneite immer weiter. Die Blaulichter der Rettungswagen drehten sich in der Dunkelheit. Als er näher kam, sah er die weißblauen Flammen der Schweißbrenner, mit denen die Feuerwehrmänner versuchten, die Menschen aus den verkeilten Fahrzeugen zu befreien. Er hörte Rufe und Schreie. In dem dichten Schneetreiben stand ein etwa sechzigjähriger Mann am Rand der Fahrbahn, kräftig, im Unterhemd, blutig, vermutlich ein Fernfahrer.
– Kann ich dir helfen, rief Tomasz dem Mann auf Polnisch zu, er glaubte, ihn zu kennen, aus Warschau, aber der Mann schrie zurück:
– Kümmre dich um deinen eigenen Scheiß.
Ein Hubschrauber landete auf der anderen Seite der Autobahn. Man hatte Scheinwerfer aufgebaut. Rettungssanitäter brachten jemanden auf einer Trage zu einem der Krankenwagen. Sie liefen, so schnell sie konnten. Eine Frau rannte neben der Trage her. Sie schrie immer wieder etwas, ein Wort, vielleicht einen Namen, und dann rutschte sie aus und fiel in den Schnee. Die Sanitäter rannten weiter.
Tomasz drehte um. Er lief zwischen den stehenden Autos zurück in die Dunkelheit.
Drei Rettungswagen mit Blaulicht kamen ihm auf dem Standstreifen entgegen. Er suchte in dem Schneetreiben nach seinem Orientierungspunkt, dem Straßenschild mit den Entfernungsangaben. Er fand den eingeschneiten Toyota und ging um den Wagen herum, um den Schlafsack aus dem Kofferraum zu holen.
Tomasz lebte seit drei Jahren mit Agnieszka in Berlin. Meistens arbeitete er für einen Polen, für Marek. Marek und seine Mannschaft entkernten Häuser, oder sie renovierten sie. Sie machten alles.
In Polen hatte Tomasz immer allein gearbeitet. Er hatte, wenn er außerhalb von Warschau Arbeit bekam, manchmal nachts in dem Schlafsack auf den Baustellen oder im Auto geschlafen, allein – aber in Deutschland ging das nicht mehr.
Seitdem Tomasz in Deutschland lebte, hielt er es nicht mehr aus, allein zu arbeiten. Seitdem er in Deutschland war, hielt Tomasz es nicht mehr aus, allein zu sein.
Das Kofferraumschloss des Toyota war eingefroren. Rechts vor ihm stand das Schild am Straßenrand, achtzig Kilometer bis Berlin.
Dann sah er den Wolf. Der Wolf stand vor dem Schild am Rand der verschneiten Straße, sieben Meter vor ihm, nicht mehr.
Ein Wolf, dachte Tomasz, das sieht aus wie ein Wolf, vermutlich ein großer Hund, wer lässt hier seinen Hund rumlaufen, oder ist das doch ein Wolf?
Er machte ein Foto von dem Tier vor dem Schild im Schneetreiben. Der Blitz in der Dunkelheit.
Einen Augenblick später war der Wolf verschwunden.
Sie hatte einen Bluterguss unter dem rechten Auge und eine aufgesprungene Lippe.
Das Mädchen saß unter dem Vordach der einzigen Bushaltestelle des Dorfes. Das Dorf hieß Sauen, in der Nähe von Beeskow, Landkreis Oder-Spree.
Es war früh am Morgen, sechs Uhr dreißig. Es war noch dunkel. Sie wartete auf den Schulbus. Sie war sechzehn. Ihre Mutter hatte sie am Abend vorher zweimal mit der Faust ins Gesicht geschlagen.
Der Schnee fiel in den Lichtkreis der Straßenlaterne. Das Dorf bestand aus nicht mehr als ein paar Häusern an der Landstraße.
Neben ihr auf der Bank unter dem Vordach der Bushaltestelle saß ihr Freund.
– Lass uns von hier weggehen, sagte sie zu ihrem Freund.
Beide trugen schwere Lederjacken, Springerstiefel, Ketten, Ohrringe, aber sie hatten weiche Gesichter, leichte Körper.
– Wohin willst du gehen?, fragte er.
– Nach Berlin, sagte sie.
Als der Bus kam, waren sie schon weg. Sie liefen nicht die Landstraße entlang. Auf der Landstraße hätte früher oder später jemand angehalten – zwei Kinder früh morgens im Schnee. Sie nahmen Feldwege.
Das Mädchen hieß Elisabeth, und der Junge hieß Micha.
Als sie den Wald erreichten, hörte es zum ersten Mal seit vier Tagen auf zu schneien.
– Fuck, fuck, fuck, sagte Charly und lächelte gleichzeitig und riss die Augen auf, sieh dir das an, sieh dir das an.
Jacky folgte seinem Blick aus dem Schaufenster hinaus auf die Straße, aber da war nichts, nichts Besonderes. Autos, Passanten. Es hatte aufgehört zu schneien.
– Hier haben früher andere Leute gewohnt, das war hier früher anders.
– Charly, du weißt doch gar nicht, wer hier früher gewohnt hat.
– Aber du siehst es doch, du siehst es doch.
– Wir haben hier doch früher auch nicht gewohnt.
– Wir wohnen ja auch nicht hier.
– Doch, wir wohnen hier.
– Wir wohnen nicht hier. Hier.
Berlin, Prenzlauer Berg: Vor 1989 war der Laden eine Bäckerei gewesen. Eine der alten Verkäuferinnen hatte nach der Wende die Bäckerei übernommen und aus ihr mit wenig Geld einen Kiosk gemacht, einen sogenannten Spätkauf. In einem kleinen Käfig hinter dem Tresen hielt sie zwei Kaninchen, aber dann bekam sie Schwierigkeiten mit der Behörde, und die Kaninchen mussten weg. Sie hatte bis spätabends geöffnet und Zeitungen, Zigaretten, Bier, Schnaps, Chips und Cola verkauft, und wenn die alten Leute im Viertel es nicht mehr zu ihr hinunter schafften, kam die Frau mit der Zeitung und dem Bier und den Zigaretten zu ihnen hoch, aber das war jetzt vorbei. Der Laden warf nicht genug ab, die Mieten stiegen in der Gegend, mit 65 hörte sie auf, und dann kamen Charly und Jacky, junge Leute, die übernahmen den Laden, die hatten genau so was gesucht, und die hatten gespart. Sie strichen die Wände neu, schwarz und gold und dunkelrot.
– Du hast so einen komischen Blick, weißt du das, Charly. Du bekommst so einen komischen Blick, du reißt die Augen so auf, was ist mit dir?
– Das wollte ich in diesem Augenblick zu dir sagen, weißt du das? Weißt du das, Schatz? Du siehst sonderbar aus, schon den ganzen Tag, was ist, was denkst du?
– Ich denke, dass irgendetwas nicht stimmt, aber ich weiß nicht, was.
– Ich kann dir sagen, was nicht stimmt, es kommen nicht genügend Leute. Ich meine, der Laden geht gut, aber es kommen trotzdem nicht genügend Leute –
– Das liegt am Wetter, Charly.
– Und dann machst du ein komisches Gesicht und sagst, dass ich ein komisches Gesicht mache. Und dabei riss Charly wieder die Augen auf.
– Glaubst du, dass wir jemals Kinder haben werden?
– Aber sicher, aber sicher, aber findest du nicht, dass das noch ein bisschen früh ist, wir haben doch gerade erst den Laden aufgemacht, wollen wir nicht erst mal hier ankommen, du bist neunundzwanzig –
– Ich werde dreißig, und du hast kaum noch Haare
auf dem Kopf.
– Wir haben noch jede Menge Zeit.
Aber sie wusste, dass das nicht so war. Sie spürte, dass sie niemals Kinder haben würden.
– Aber gut, sagte Charly, gut, was wäre, wenn, was wäre, wenn, denken wir das Ganze einmal richtig durch, denken wir das Ganze einmal richtig von vorne bis hinten durch, und dabei riss er wieder die Augen auf, von vorne bis hinten, fuck.
Der Mann hatte sich eine Thermoskanne Kaffee gemacht, ein paar Brote. Er nahm das Fernglas und die Flinte mit, das Jagdgewehr, aber keinen Hund. Der Hund war vor Weihnachten gestorben. Der alte Mann hatte niemandem gesagt, dass er vor Sonnenaufgang in den Wald gehen würde. Er zog sich die warmen Sachen an, die Stiefel, den langen Mantel, den Hut, und als er den Hof überquerte, pfiff er nach dem Hund, aber der Hund kam nicht, und dann erinnerte er sich, dass der Hund nicht mehr da war.
Es lag hoher Schnee, und der Mann kam auf dem Waldweg nur langsam vorwärts. Er war fast eineinhalb Stunden lang unterwegs, bis er kurz vor der Morgendämmerung den Hochsitz erreichte. Er war nicht gekommen, um irgendetwas zu schießen. Er war nur hier, weil er den Ort liebte, den Hochsitz, die Dämmerung, das Feld vor ihm, den Rand des Waldes gegenüber. Der Mann war oft hier, auch im Winter, am frühen Morgen.
Er hatte von dem Wolf gehört, im Umkreis von Seelow, das lag weiter nördlich von ihm. Er wusste, dass Wölfe wandern. Wölfe leben in Rudeln, aber manche Tiere müssen das Rudel verlassen, und dann wandern sie, um ein neues Rudel zu suchen, und sie können weite Strecken zurücklegen, siebzig Kilometer an einem Tag und mehr.
Der Mann saß oben auf dem Hochsitz und blickte auf das Schneefeld kurz vor Sonnenaufgang. Er trank den Kaffee aus der Thermoskanne. Seine Frau hatte nie gemocht, wenn er allein in den Wald ging, aus Sorge um ihn und auch aus Selbstsucht oder Unsicherheit. Sie hatte nicht gemocht, dass er mit dem Hund wegging und dass er sie nicht mitnahm.
Sie hatte nicht gemocht, dass er sie allein ließ, und sie hatte nicht gemocht, dass er gerne alleine war.
Der Mann war nicht gekommen, um auf etwas zu schießen, er hätte die Waffe auch zu Hause lassen können.
Es wurde hell. Der alte Mann sah an diesem Morgen kein Wild, keine Rehe, keine Wildschweine. Er meinte eine Bewegung am Waldrand auf der anderen Seite des Feldes bemerkt zu haben, aber mit dem Fernglas war nichts zu sehen.
Dann fühlte er sich mit einem Mal nicht gut, ihm war plötzlich übel, er schwitzte an den Handflächen, das Herz raste. So kommt der Tod, dachte er, so ist es.
Nach ein paar Minuten ging es ihm besser, aber er war schweißnass, er wusste, er musste zurück, aber er hatte Angst, dass er es nicht schaffen würde.
Am Ende hatte Tomasz für den Weg von Warschau nach Berlin siebzehn Stunden gebraucht. Er war am späten Vormittag des 16. Februar losgefahren. Am Abend war auf der deutschen Autobahn vierzig Kilometer hinter der polnischen Grenze ein Tanklastwagen ins Schleudern geraten. Der Tanklastwagen hatte sich quergestellt, war umgekippt, hatte Feuer gefangen und war schließlich explodiert. Über sechzig Fahrzeuge bremsten und rutschten ineinander. Es hatte acht Stunden gedauert, bis die Autobahn wieder frei war. Tomasz hatte bis drei Uhr morgens im Stau gestanden – vor ihm der Schein des Feuers in der Dunkelheit, später die Flutlichter.
Er hatte keine zehn Meter von ihm entfernt einen Wolf gesehen, einen Wolf auf dem Standstreifen.
– Was hast du, du hast was, du hast einen Wolf gesehen?, lachte Agnieszka. Du wirst verrückt, mein Herz.
Er war gerade erst angekommen und saß vor ihr, in der kleinen Küche ihrer Wohnung in Neukölln. Es war vier Uhr morgens oder etwas später. Sie hatte fast nichts zu essen im Haus, nur Tee und Bier.
– Ich habe für dich Bier gekauft.
– Hast du keine Suppe, es war so kalt in dem Auto, ich glaube, ich werde krank.
– Du hast keinen Wolf gesehen –
– Ich habe acht Stunden in dem kalten Toyota gesessen.
– Wo hast du einen Wolf gesehen?
Sie hatten eine billige Ein-Zimmer-Wohnung aus den sechziger Jahren. Die Wohnung war niedrig, dunkel und laut. Die Wände waren dünn. Eine Leuchtstoffröhre brannte an der Decke der kleinen Küche.
– Gehst du jetzt auf die Baustelle?
– Ja, sagte er.
– Aha. Ich dachte, du wirst krank.
– Auf dem Standstreifen. Ich hab ihn auf dem Standstreifen gesehen.
Sie lachte. Agnieszka war zweiundzwanzig. Sie war mit Tomasz zusammen, seitdem sie vierzehn Jahre alt war. Er war zwei Jahre älter. Sie kamen aus demselben Dorf, nicht weit von Warschau. Jetzt waren sie seit drei Jahren in Berlin.
Sie putzte Läden, Geschäftsräume, sie putzte Großraumbüros, und sie putzte bei Künstlern, bei Filmleuten, bei Journalisten, sie hütete manchmal abends deren Kinder. Sie war durch Zufall in diese Kreise geraten und dann immer weiterempfohlen worden. Als sie und Tomasz nach Berlin gekommen waren, hatten beide kein Deutsch gesprochen. Jetzt sprach Agnieszka fast fehlerfrei Deutsch, und er verstand immer noch so gut wie kein Wort. Auf den Baustellen arbeitete er fast ausschließlich mit Polen zusammen.
– Am Straßenrand. Auf dem Standstreifen.
Beide arbeiteten viel, so viel wie möglich, Tag und Nacht. Sie schliefen wenig. Wenn er auf der Baustelle fertig war, kam er zu ihr und half ihr beim Putzen, nachts in den verlassenen Büroetagen am Rosa-Luxemburg-Platz oder in der Schönhauser Allee.
Sie arbeiteten von früh um sechs oder sieben bis spät in die Nacht, von Montag bis Samstagmittag. Samstagnacht gingen sie tanzen.
– Ich habe ein Foto gemacht.
Sie sah sich das Bild an.
– Du hast einen Wolf fotografiert.
– Das sage ich doch.
– Glaubst du, dass viele Leute den Wolf fotografiert haben?
– Nein. Niemand.
– Ein Wolf auf der Autobahn, sagte sie. Im Schnee.
– Im Stau. Ein Wolf im Stau.
Sie lachte. Das war witzig gemeint gewesen. Er machte selten Witze. So gut wie nie.
Sie hatten sich fast vier Wochen lang nicht gesehen, er hatte für einen Verwandten in der Nähe von Warschau gearbeitet. Sie sah ihn an. Sie kannten sich, seitdem sie Kinder waren. Seit acht Jahren waren sie zusammen. Sie waren zusammen nach Berlin gegangen, unverheiratet.
In den Augen ihrer katholischen Verwandten lebten sie in Sünde. Sie waren damals mit dem Toyota nach Berlin gefahren. Über Freunde hatten sie die Wohnung in Neukölln gefunden.
Sie ernährten sich von Chips und Cola und Keksen und Tee und Bier, weil ihnen in Deutschland nichts anderes schmeckte und weil sie keine Zeit zum Kochen hatten.
Sie war immer fröhlich, sie konnte immer weitermachen, mich macht nichts kaputt, lachte sie immer, und jetzt, als sie ihn am Küchentisch sitzen sah, merkte sie, dass er nicht mehr konnte. Sie sah, dass ihm langsam die Kraft ausging. Er wurde seit Monaten immer stiller. Er hatte angefangen, wochenweise nach Polen zu fahren, weil da ein entfernter Verwandter Arbeit für ihn hatte.
– Tomeczek, hast du mal darüber nachgedacht, das Bild zu verkaufen?
– Das Bild? Welches Bild?
– Das Foto. Das Foto von dem Wolf.
– An wen soll ich das verkaufen? Wer soll mir das abkaufen?
Der Busfahrer hatte gehalten, und als er das Mädchen und den Jungen nicht sah, hatte er für einen Moment gewartet, morgens um kurz nach halb sieben an der einzigen Haltestelle des Dorfes. Er hatte länger gewartet, als er hätte warten sollen, er hatte wegen des Schnees ohnehin Verspätung, und er kannte die Kinder, sie stiegen jeden Morgen in den Bus, und er kannte die Mutter des Jungen, er war einmal mit ihrer Schwester verheiratet gewesen, lange, lange her.
Später am Vormittag hatte er bei der Mutter des Jungen angerufen, er hatte gefragt, ob alles in Ordnung sei, so macht man das auf dem Land.
Beide hatten kaum geschlafen, Agnieszka und Tomasz, nicht mehr als eine Stunde. Sie hatten im Bett gelegen, ohne sich zu berühren, obwohl sie sich seit fast vier Wochen nicht gesehen hatten, und dann hatte der Wecker geklingelt.
Ein paar Stunden später zeigte Agnieszka das Foto einer Frau, bei der sie putzte. Die Frau arbeitete für eine Zeitung. Sie kaufte Agnieszka das Bild ab, und am nächsten Tag war das Foto überall:
Ein Wolf bei Nacht im Schnee, im Blitzlicht, und hinter dem Wolf ein Schild – achtzig Kilometer bis Berlin.
Der Junge und das Mädchen waren trotz des hohen Schnees schnell, zu schnell, zumindest in den ersten Stunden. Um halb sieben Uhr morgens waren sie in der Dunkelheit an der Bushaltestelle aufgebrochen. Um zehn Uhr morgens lag das Dorf schon fast zwanzig Kilometer hinter ihnen. Sie waren tief im Wald. Sie froren und schwitzten, sie hatten Hunger, und vor allem hatten sie Durst. Sie aßen Schnee. Beide wussten, dass sie nicht weit kommen würden, aber sie liefen trotzdem weiter.
In dem Wald war es fast vollkommen still. Es war ein grauer Tag. Der Junge und das Mädchen sprachen wenig. Sie bewegten sich wortlos nebeneinander, und manchmal blieben sie im Schnee stehen, drehten in der Kälte mit starren Fingern, so gut es ging, Zigaretten und rauchten. Das Rauchen half gegen den Hunger.
Sie liefen durch den Wald, und sie sahen keinen anderen Menschen. An einer Weggabelung stand in dem Wald ein alter Bauwagen. Die Tür war offen. In dem Bauwagen lag viel Müll herum, leere Zigarettenschachteln, Prospekte, alte Zeitungen, leere Bierflaschen, Kippen. Irgendwann hatte es in dem Wagen gebrannt. In einer Ecke des Bauwagens stand ein Ofen, ein kleiner Holzofen.
Sie hatten den Bauwagen am frühen Nachmittag gefunden. Sie trauten sich nicht, in dem Ofen ein Feuer zu machen, weil sie fürchteten, dass der Wagen abbrennen könnte.
Sie sammelten Holz und versuchten, vor dem Wagen ein Feuer anzumachen, aber es gelang ihnen lange nicht. Als das Feuer vor dem Wagen schließlich brannte, war es dunkel. Sie wussten, dass sie wegen der Kälte nicht draußen im Schnee schlafen konnten, auch nicht neben dem Feuer. In dem Bauwagen konnten sie die Nacht überstehen, aber nur, wenn der Ofen in dem Bauwagen brennen würde, ohne dass der ganze Wagen in Flammen aufging. Sie machten ein Feuer in dem Ofen und warteten. Der Wagen fing nicht an zu brennen. Es wurde schnell warm in dem kleinen Raum. Die beiden wurden in der Wärme nach den Stunden im Schnee trotz des Hungers schnell müde. Draußen glühte vor dem Wagen in der Dunkelheit das Lagerfeuer aus.
In der Ferne war ein Rauschen zu hören.
– Vielleicht ist das die Autobahn, sagte er. Oder die Landstraße.
Der Junge und das Mädchen kauerten vor dem Ofen auf dem Boden des Bauwagens. Sie lehnten aneinander und versuchten, nicht einzuschlafen, weil sie immer noch fürchteten, dass der Wagen Feuer fangen und abbrennen könnte, aber es fielen ihnen immer wieder die Augen zu.
Die Mutter des Mädchens unternahm nichts. Es war nicht das erste Mal, dass das Mädchen nicht nach Hause kam.
Aber am Abend stand eine Frau von der Polizei vor der Tür, und dann ging die Suchmeldung hinaus.
Ja, sie und ihre Tochter hatten sich gestritten.
Die Polizistin kam selbst aus dem Dorf. Sie kannte die beiden Jugendlichen, sie kannte die Familie des Jungen, sie kannte auch die Mutter des Mädchens.
Die Mutter des Mädchens, oder genau genommen ihr damaliger Mann, hatte vor etwa fünfzehn Jahren für wenig Geld in dem Dorf das kleine, leerstehende Schulhaus gekauft, und dann war sie an den Wochenenden mit ihrem Mann und dem kleinen Mädchen aus Berlin hergekommen.
Man kannte das Paar aus der Zeitung, aus dem Fernsehen. Der Mann war älter als sie, ein erfolgreicher Maler. Später war der Mann nicht mehr mitgekommen, da war das Mädchen drei.
Nach der Trennung von ihrem Mann bekam die Mutter des Mädchens keine Aufträge mehr oder zu wenige. Sie gab die Wohnung in Berlin auf und zog mit dem Kind in das Dorfschulhaus. Sie war eine Berühmtheit, mit rotgefärbten Haaren und weiten Leinenhosen, wenn sie nicht in dem Overall arbeitete, auf dem Hof vor dem Schulhaus oder in der Werkstatt.
Sie war Anfang dreißig, als sie das Kind bekam, eine erfolgreiche Künstlerin in Berlin. Fünf Jahre später lebte sie alleinerziehend in einem Dorf unweit der polnischen Grenze. Sie trank zu viel, das hatte sie schon immer getan, und sie war jähzornig und selbstgerecht. Mit den meisten Leuten von früher aus der Berliner Zeit war sie zerstritten.
Sie erzählte ihrer Tochter, sie sei wegen ihr aus der Stadt weggezogen. Damit sie, die Tochter, eine bessere Kindheit habe als sie selbst, eine andere Kindheit als ihre eigene in einer Mietskaserne am nordöstlichen Rand von Berlin, Hauptstadt der DDR.
Aber die Gründe wechselten, je nachdem, wie viel sie getrunken hatte. Manchmal sagte sie dem Kind auch, sie hätte als alleinerziehende Mutter aus Berlin weggemusst, weil sie sich das Atelier in der Stadt nicht mehr leisten konnte.
Es gab die Variante, dass ihr die Stadt nach der Geburt nichts mehr zu sagen hatte, dass die Stadt für sie von einem Tag auf den nächsten jede künstlerische Bedeutung verloren hätte, die Partys, die Szene, und es gab die Variante, dass sie während der Schwangerschaft und nach der Geburt dem Kind zuliebe aufgehört habe zu arbeiten – wegen des Lärms, wenn sie mit der Kettensäge oder mit dem Meißel arbeitete –, und diese Zwangspause habe ihr der Markt nie verziehen.