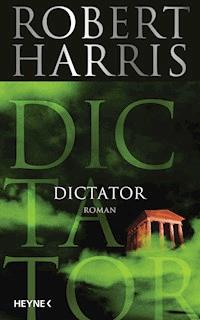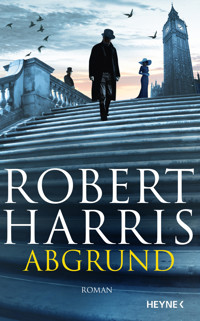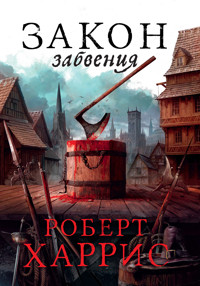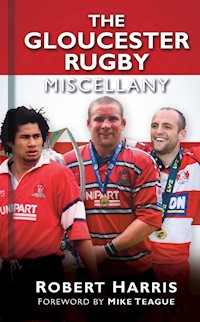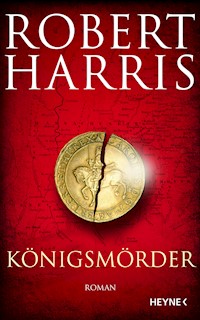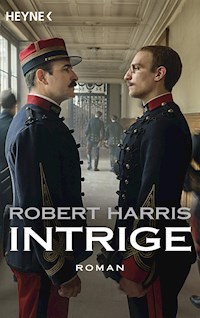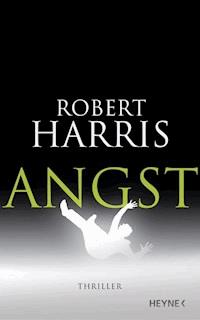
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der beklemmend aktuelle Thriller von Bestsellergarant Robert Harris
Für die Öffentlichkeit ist er ein Unbekannter, aber in den geheimen inneren Zirkeln der Superreichen ist Alex Hoffmann eine lebende Legende – ein visionärer Wissenschaftler, der eine Software entwickelt hat, die an den Börsen der Welt Milliardengewinne erzielt. Nun hat es jemand auf ihn abgesehen, und es beginnt für ihn eine albtraumhafte Zeit aus Angst und Schrecken. Kann er die Geister, die er rief, wieder loswerden? Oder stürzt er unaufhaltbar in den Abgrund – und mit ihm die Finanzmärkte der Welt?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 441
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
ROBERT
HARRIS
ANGST
THRILLER
Aus dem Englischen von
Wolfgang Müller
Die Originalausgabe erscheint unter dem Titel The Fear Index bei Hutchinson, London
Verwendung des Zitats aus Mary Shelley, Frankenstein oder der moderne Prometheus, übersetzt von Ursula von Wiese, mit freundlicher Genehmigung des Manesse-Verlags, München.
Für das Zitat aus Elias Canetti, Masse und Macht:© 1960 Claassen Verlag in der Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin
10. Auflage
Redaktion: Ute Gräber-Seißinger
Copyright © 2011 by Robert Harris
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Satz: Leingärtner, Nabburg
ePub-ISBN 978-3-641-07055-7
www.heyne.de
Für meine Familie:
Gill, Holly, Charlie, Matilda und Sam
Eins
Lernen Sie von mir, wenn auch nicht durch Vorschriften, so doch wenigstens durch mein Beispiel, wie gefährlich Wissen ist und wieviel glücklicher derjenige Mensch, welcher seine Geburtsstadt für die Welt hält, als derjenige, der größer werden will, als es seine Natur erlaubt.
Mary ShelleyFrankenstein, 1818
Dr. Alexander Hoffmann saß im Arbeitszimmer seines Genfer Hauses vor dem Kamin. Im Aschenbecher lag eine kalte, halb gerauchte Zigarre, der Schirm der verstellbaren Schreibtischlampe war weit nach vorn über seine Schulter gezogen. Er blätterte in The Expression of the Emotions in Man and Animals, einer englischen Erstausgabe von Charles Darwins Buch über den Ausdruck der Gemütsbewegungen bei Mensch und Tier. Hoffmann hörte nicht, dass die viktorianische Standuhr im Flur Mitternacht schlug. Ihm war auch nicht aufgefallen, dass das Feuer erloschen war. Seine außerordentliche Fähigkeit zur Konzentration galt allein dem Buch.
Er wusste, dass es 1872 in London von John Murray & Co. veröffentlicht worden war, in einer Ausgabe mit siebentausend Exemplaren, gedruckt in zwei Auflagen. Er wusste auch, dass die zweite Auflage auf Seite 208 einen Druckfehler – »htat« – enthielt. Da sein eigenes Exemplar diesen Fehler nicht aufwies, nahm er an, dass es aus der ersten Auflage stammte, was seinen Wert beträchtlich erhöhte. Er drehte das Buch um und inspizierte den Rücken. Der Einband war original, grünes Leinen mit Goldschrift, der Rücken war oben und unten nur leicht ausgefranst. Das Buch entsprach dem, was man in der Branche ein »gutes Exemplar« nannte, und es war schätzungsweise 15 000 US-Dollar wert. Als die Märkte in New York geschlossen hatten, war Hoffmann vom Büro aus sofort nach Hause gefahren und hatte es kurz nach zehn Uhr zur Hand genommen. Sicherlich, er sammelte wissenschaftliche Erstausgaben, hatte im Internet nach dem Buch gesucht und tatsächlich vorgehabt, es zu kaufen. Seltsam war nur, dass er das Buch gar nicht bestellt hatte.
Sein erster Gedanke war gewesen, dass seine Frau es gekauft hatte, was sie bestritten hatte, er aber zunächst nicht hatte glauben wollen. Während sie in der Küche herumgelaufen war und den Tisch gedeckt hatte, war er hinter ihr hergelaufen und hatte ihr das Buch unter die Nase gehalten.
»Du hast es mir also nicht gekauft?«
»Nein, Alex, tut mir leid. Was weiß ich, vielleicht hast du ja eine heimliche Verehrerin.«
»Bist du dir ganz sicher? Wir haben nicht irgendeinen Jahrestag, und ich habe vergessen, dir etwas zu schenken?«
»Herrgott, es ist nicht von mir, okay?«
Dem Buch hatte kein Begleitschreiben beigelegen, nur die Visitenkarte eines holländischen Buchhändlers: Rosengarten & Nijenhuis, Antiquariat für wissenschaftliche & medizinische Bücher. Gegründet 1911. Prinsengracht 227, 1016 HN Amsterdam, Niederlande. Hoffmann hatte auf das Pedal des Mülleimers getreten und die Noppenfolie und das dicke braune Papier herausgeholt. Auf der leeren Hülle des Pakets klebte ein bedrucktes Etikett, die Adresse war korrekt: Dr. Alexander Hoffmann, Villa Clairmont, Chemin de Ruth 79, 1223 Cologny, Genf, Schweiz. Die Sendung war am Tag zuvor per Kurier aus Amsterdam eingetroffen.
Sie hatten zusammen zu Abend gegessen – Fischpastete mit grünem Salat, die ihre Haushälterin zubereitet hatte, bevor sie nach Hause gegangen war. Danach hatte Gabrielle in der Küche noch ein paar besorgte Last-Minute-Anrufe wegen ihrer Ausstellung am nächsten Tag erledigt, während Hoffmann sich mit dem mysteriösen Buch in sein Arbeitszimmer zurückgezogen hatte.
Als sie eine Stunde später den Kopf zur Tür hereinsteckte, um ihm zu sagen, dass sie zu Bett gehe, las er immer noch.
»Komm bald nach, Liebling«, sagte sie. »Ich warte auf dich.«
Er erwiderte nichts. Sie blieb noch einen Augenblick in der Tür stehen und betrachtete ihn. Mit seinen zweiundvierzig Jahren sah er immer noch jung aus. Ihm war nie bewusst gewesen, wie attraktiv er eigentlich war – eine, wie sie fand, ebenso anziehende wie seltene Eigenschaft bei einem Mann. Allerdings war er nicht anspruchslos, wie sie im Lauf der Zeit festgestellt hatte. Ganz im Gegenteil: Alles, was ihn intellektuell nicht forderte, war ihm in höchstem Maße gleichgültig. Ein Charakterzug, der ihm unter ihren Freunden den Ruf eines ausgesprochenen Rüpels eingebracht hatte. Aber auch das mochte sie. Sein außergewöhnlich jungenhaftes Amerikanergesicht war über das Buch gebeugt, die Brille hatte er hochgezogen und in sein dichtes, hellbraunes Haar geschoben. Der Schein des Feuers spiegelte sich in den Gläsern, die ihr einen warnenden Blick zuzuwerfen schienen. Sie kannte ihn gut genug, um ihn jetzt nicht zu stören. Sie seufzte und ging nach oben.
Hoffmann wusste seit Jahren, dass The Expression of the Emotions in Man and Animals eines der ersten Bücher war, in das jemals Fotografien aufgenommen worden waren. Allerdings hatte er die Bilder noch nie im Original zu Gesicht bekommen. Außer viktorianischen Künstlermodellen zeigten die Schwarz-Weiß-Tafeln Insassen des Surrey Lunatic Asylum in verschiedenen emotionalen Zuständen – Trauer, Verzweiflung, Freude, Trotz, Entsetzen. Das Buch sollte eine Studie über den Homo sapiens als Tier sein: der Maske seiner gesellschaftlichen Umgangsformen beraubt, mit den instinktiven Reaktionen des Tieres. Obwohl die Modelle seinerzeit schon lange genug im wissenschaftlichen Zeitalter gelebt hatten, um daran gewöhnt zu sein, fotografiert zu werden, gaben die verdrehten Augen und schiefen Zähne ihrem Gesicht das Aussehen durchtriebener, abergläubischer Bauern aus dem Mittelalter. Sie erinnerten Hoffmann an einen kindlichen Albtraum – an Erwachsene aus einem altmodischen Märchenbuch, die mitten in der Nacht ins Schlafzimmer des Kindes eindrangen, um es aus dem Bett zu zerren und in den Wald zu verschleppen.
Noch etwas anderes irritierte ihn. Die Visitenkarte steckte zwischen den Seiten, die das Gefühl der Furcht abhandelten, als hätte der Absender seine Aufmerksamkeit gezielt darauf lenken wollen:
Der zum Fürchten gebrachte Mensch steht anfangs bewegungslos wie eine Statue und athemlos da oder drückt sich nieder, als wollte er instinctiv der Entdeckung entgehen. Das Herz zieht sich schnell und heftig zusammen, so daß es gegen die Rippen schlägt oder anstößt …
Hoffmann hatte die Angewohnheit, beim Denken den Kopf zur Seite zu neigen und ins Leere zu starren. Genau das tat er jetzt. War das Zufall? Er kam zu dem Schluss, dass es sich tatsächlich nur um einen Zufall handeln konnte. Andererseits hatten die physiologischen Auswirkungen der Angst einen unmittelbaren Bezug zu VIXAL-4, dem Projekt, an dem er gerade arbeitete. Das weckte in ihm den Verdacht, dass trotz allem mehr dahinterstecken könnte. Aber VIXAL-4 war streng geheim, es war nur seinem Forschungsteam bekannt. Obwohl er sorgfältig darauf achtete, seine Leute gut zu bezahlen – 250 000 Dollar Anfangsgehalt plus wesentlich mehr an möglichen Boni –, war es doch sehr unwahrscheinlich, dass einer von ihnen 15 000 Dollar für ein anonymes Geschenk ausgeben würde. Eine Person jedoch kannte er, die sich einen solchen Betrag locker leisten konnte, die alles über das Projekt wusste und die auch den Witz in einem solchen Geschenk gesehen hätte – wenn es das war: ein kostspieliger Witz. Das war sein Geschäftspartner Hugo Quarry. Ohne auch nur einen Gedanken daran zu verschwenden, wie spät es war, rief er ihn an.
»Hallo, Alex, was gibt’s?« Selbst wenn Quarry die Störung kurz nach Mitternacht merkwürdig vorgekommen wäre, so hätten seine makellosen Manieren es ihm nie erlaubt, sich etwas anmerken zu lassen. Außerdem hatte er sich an Hoffmanns Eigenheiten gewöhnt. Er nannte ihn den »verrückten Professor« – von Angesicht zu Angesicht wie auch hinter dessen Rücken. Es machte einen Teil seines Charmes aus, dass er bei jedem den gleichen Umgangston anschlug, öffentlich wie privat.
Hoffmann, der immer noch den Abschnitt über die Furcht las, sagte zerstreut: »Oh, hi. Sag mal, hast du mir ein Buch gekauft?«
»Glaube nicht, alter Junge. Warum? Hätte ich es tun sollen?«
»Jemand hat mir eine Darwin-Erstausgabe geschickt, und ich weiß nicht, wer.«
»Hört sich ziemlich kostspielig an.«
»Und ob. Du weißt, wie wichtig Darwin für VIXAL ist, deshalb habe ich gedacht, dass du vielleicht …«
»Tut mir leid. Vielleicht einer unserer Kunden? Als kleines Dankeschön, und er hat vergessen, eine Karte beizulegen? Die haben weiß Gott einen Haufen Geld durch uns gemacht.«
»Ja, möglich … Okay, entschuldige die Störung.«
»Schon gut. Also dann, bis morgen früh. Großer Tag morgen. Eigentlich ist es ja schon morgen. Du solltest jetzt im Bett liegen.«
»Ja, bin schon unterwegs. Nacht.«
Wenn die Furcht auf den höchsten Gipfel steigt, dann wird der fürchterliche Schrei des Entsetzens gehört. Große Schweißtropfen stehen auf der Haut. Alle Muskeln des Körpers werden erschlafft. Das äußerste Gesunkensein aller Kräfte folgt bald und die Geisteskräfte versagen ihre Thätigkeit. Die Eingeweide werden afficirt. Die Schließmuskeln hören auf zu wirken und halten den Inhalt der Körperhöhlen nicht länger mehr zurück …
Hoffmann hielt sich das Buch unter die Nase und atmete ein. Eine Mischung aus Leder, Bibliotheksstaub und Zigarrenrauch, so streng, dass er ihn förmlich schmecken konnte, mit einem Hauch einer chemischen Substanz – Formaldehyd vielleicht, oder Leuchtgas. Er musste an ein Laboratorium oder einen Hörsaal aus dem 19. Jahrhundert denken. Für einen Augenblick sah er Bunsenbrenner auf hölzernen Labortischen, Glaskolben mit Säure und das Skelett eines Affen vor sich. Er schob die Visitenkarte des Buchhändlers wieder zwischen die Seiten und klappte das Buch vorsichtig zu. Dann trug er es zum Bücherregal, wo er ihm mit zwei Fingern behutsam Platz schaffte, zwischen einer Erstausgabe von The Origin of Species, die er für 125 000 Dollar bei einer Auktion von Sotheby’s in New York gekauft hatte, und einem ledergebundenen Exemplar von The Descent of Man, das einst Thomas Henry Huxley gehört hatte.
Später würde er versuchen, sich an den genauen Ablauf dessen zu erinnern, was er danach getan hatte. Er schaute sich am Bloomberg-Terminal auf seinem Schreibtisch die Schlussnotierungen in den USA an: Dow Jones, S&P 500 und NASDAQ – all diese Indizes hatten mit Verlusten geschlossen. Er tauschte ein paar E-Mails mit Susumu Takahashi aus, dem für die VIXAL-4-Transaktionen während der Nacht verantwortlichen Händler, der berichtete, dass alles reibungslos funktioniere, und Hoffmann daran erinnerte, dass die Tokioter Börse nach den alljährlichen drei Feiertagen der Goldenen Woche in weniger als zwei Stunden wieder öffnen werde. Sie werde sicher schwach tendieren und die in Europa und den USA in der vergangenen Woche rückläufige Kursentwicklung ihrerseits nachholen. Und es gebe noch etwas anderes: VIXAL beabsichtige, weitere drei Millionen Procter-&-Gamble-Anteile zu 62 Dollar das Stück in Short-Positionen aufzubauen, was ihre Gesamtposition auf sechs Millionen steigern werde. Ein großer Trade: Ob Hoffmann zustimmen wolle? Hoffmann mailte sein Okay zurück, warf dann seine halb gerauchte Zigarre in den Kamin, stellte ein feinmaschiges Metallgitter davor und löschte das Licht im Arbeitszimmer. Im großen Flur überprüfte er, ob die Haustür abgeschlossen war, und schaltete die Alarmanlage mit dem vierstelligen Code 1729 ein. (Die Zahl hatte Hoffmann einem Gespräch entliehen, das die Mathematiker G. H. Hardy und S. I. Ramanujan im Jahr 1920 geführt hatten. Hardy war in einem Taxi mit dieser Nummer ins Krankenhaus gefahren, um seinen im Sterben liegenden Kollegen zu besuchen. »Was für eine langweilige Zahl«, hatte Hardy gesagt, worauf Ramanujan erwidert hatte: »Aber nein, Hardy, ganz und gar nicht. Das ist sogar eine sehr interessante Zahl. Es ist die kleinste Zahl, die sich auf zwei verschiedene Weisen als Summe zweier dritter Potenzen darstellen lässt.«) Hoffmann ließ unten nur eine einzige Lampe brennen – dessen war er sich später sicher – und ging dann die geschwungene weiße Marmortreppe ins Bad hinauf. Er nahm die Brille ab, zog sich aus, wusch sich, putzte sich die Zähne und zog einen blauen Seidenpyjama an. Als er die Weckzeit auf seinem Handy auf 6:30 Uhr einstellte, sah er, dass es 0:20 Uhr war.
Er ging ins Schlafzimmer und war überrascht, dass Gabrielle noch wach war. In einen schwarzen Seidenkimono gehüllt, lag sie rücklings auf der Tagesdecke. Auf der Frisierkommode flackerte eine Duftkerze, sonst lag der Raum im Dunkeln. Die Hände hatte sie unter dem Kopf verschränkt, die Ellbogen steil abgewinkelt, die Beine auf Kniehöhe übereinandergeschlagen. Ein schmaler, weißer Fuß mit dunkelrot lackierten Nägeln zeichnete ungeduldig Kreise in die wohlriechende Luft.
»O Gott«, sagte er. »Ich habe unser Date vergessen.«
»Keine Sorge.« Sie öffnete den Gürtel, öffnete den seidenen Kimono und breitete die Arme aus. »Ich vergesse nie ein Date.«
✳
Es musste um halb vier morgens gewesen sein, als Hoffmann durch irgendetwas geweckt wurde. Er kämpfte sich aus den Tiefen seines Schlafs, öffnete die Augen und blickte in eine himmlische Vision aus gleißend weißem Licht. Sie hatte eine geometrische Form, wie ein Diagramm, mit dicht an dicht verlaufenden waagerechten Linien und in weitem Abstand zueinander stehenden senkrechten Säulen, allerdings ohne eingezeichnete Werte – der Traum eines Mathematikers, der jedoch verpuffte, nachdem er ihn ein paar Sekunden lang mit zusammengekniffenen Augen betrachtet hatte. Was er sah, war das grelle Licht von acht 500 Watt starken Wolfram-Halogen-Überwachungsscheinwerfern, das durch die Jalousieschlitze strahlte. Mit der Wattleistung hätte man ein kleines Fußballfeld beleuchten können. Eigentlich hatte er die Anlage auswechseln wollen.
Die Schaltuhr für die Scheinwerfer war auf dreißig Sekunden eingestellt. Während er darauf wartete, dass das Licht wieder ausging, überlegte er, was die Infrarotstrahlen, die den Garten wie ein Raster durchzogen, unterbrochen haben könnte. Vielleicht eine Katze, dachte er, oder ein Fuchs oder Zweige und Laub, die der Wind abgerissen hatte. Ein paar Sekunden später erlosch das Licht tatsächlich, und das Zimmer versank wieder in tiefer Dunkelheit.
Allerdings war Hoffmann jetzt hellwach. Er griff nach seinem Handy. Es war eines aus einer Kleinserie, die speziell für den Hedgefonds hergestellt worden war und gewisse vertrauliche Anrufe und E-Mails verschlüsseln konnte. Er schaltete es ein und warf auf der Website von Profit & Loss einen schnellen Blick auf die Kurse in Fernost – unter der Bettdecke, weil Gabrielle diese Angewohnheit sogar noch mehr verabscheute als seine Zigarren. Wie vorausgesagt, gaben die Märkte in Tokio, Singapur und Sidney nach, während VIXAL-4 schon um 0,3 Prozent zugelegt hatte, was nach seiner Rechnung hieß, dass er in diesen wenigen Stunden Schlaf fast drei Millionen Dollar verdient hatte. Zufrieden schaltete er das Handy aus und legte es wieder auf den Nachttisch. In diesem Augenblick hörte er ein Geräusch: leise, nicht identifizierbar und doch seltsam beunruhigend, als ob sich irgendwer durchs Erdgeschoss bewegte.
Er schaute zu dem winzigen roten Lichtpunkt des Rauchmelders an der Decke und schob unter der Bettdecke vorsichtig seine Hand hinüber zu Gabrielles Seite. Wenn sie sich geliebt hatten und sie danach nicht einschlafen konnte, war Gabrielle in letzter Zeit immer noch zum Arbeiten nach unten in ihr Studio gegangen. Seine Hand fuhr über die warme wellige Matratze, bis die Fingerspitzen die Haut ihrer Hüfte berührten. Sie brabbelte etwas Unverständliches, drehte sich zu ihm um und zog die Bettdecke fester um ihre Schultern.
Er hörte wieder ein Geräusch, stützte sich auf die Ellbogen und lauschte angestrengt. Er konnte es nicht einordnen, es war ein unregelmäßiges, schwaches Klopfen. Vielleicht die noch ungewohnten Geräusche der Heizung oder eine im Luftzug schlagende Tür. Zu diesem Zeitpunkt war er noch ziemlich ruhig. Das Haus verfügte über erstklassige Sicherheitseinrichtungen, was einer der Gründe gewesen war, warum er es wenige Wochen zuvor gekauft hatte: außer den Flutlichtstrahlern eine drei Meter hohe Mauer mit schweren elektronischen Toren, die das gesamte Grundstück umschlossen, kugelsichere Fenster in allen Erdgeschossräumen und eine über Bewegungsmelder gesteuerte Alarmanlage, die er – da war er sich sicher – eingeschaltet hatte, bevor er schlafen gegangen war. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Einbrecher all das überwunden hatte, war winzig. Außerdem war Hoffmann körperlich fit: Er hatte schon vor langer Zeit festgestellt, dass er bei hoher Endorphinausschüttung besser denken konnte. Er trainierte. Er joggte. In ihm regte sich der atavistische Instinkt, sein Territorium zu schützen.
Er schlüpfte aus dem Bett, vorsichtig, um Gabrielle nicht zu wecken, setzte seine Brille auf, zog Morgenmantel und Hausschuhe an. Unschlüssig stand er da und schaute sich in der Dunkelheit um. Ihm fiel nichts ein, was er als Waffe aus dem Zimmer mitnehmen konnte. Er steckte das Handy ein und öffnete die Schlafzimmertür – erst nur einen Spalt weit, dann ganz. Die Lampe von unten warf ein schwaches Licht auf den Treppenabsatz. Er blieb auf der Türschwelle stehen und lauschte. Die Geräusche – wenn es sie denn gegeben hatte, was er allmählich bezweifelte – waren verklungen. Nach etwa einer Minute ging er zur Treppe und dann sehr langsam hinunter.
Vielleicht lag es daran, dass er vor dem Zubettgehen Darwin gelesen hatte. Jedenfalls registrierte er jetzt, während er die Treppe hinunterging, mit wissenschaftlicher Nüchternheit seine eigenen körperlichen Symptome. Sein Atem ging schneller, und sein Herzschlag beschleunigte sich so stark, dass er sich unwohl fühlte. Seine Haare schienen sich wie Borsten aufzustellen.
Er ging die letzte Stufe hinunter.
Das Haus war eine Belle-Époque-Villa, 1902 erbaut von einem französischen Geschäftsmann, der ein Vermögen damit gemacht hatte, aus Kohleabfällen Öl zu gewinnen. Der Vorbesitzer hatte das Haus bis ins kleinste Detail von einem Innenarchitekten gestalten lassen, sodass Hoffmann nur noch hatte einzuziehen brauchen. Vielleicht war das der Grund, warum er sich nie ganz zu Hause gefühlt hatte. Links von ihm befand sich die Haustür, direkt vor ihm die Tür in den Salon. Rechts führte ein Durchgang ins Innere des Hauses: zum Esszimmer, zur Küche, zur Bibliothek und zu einem viktorianischen Wintergarten, in dem Gabrielle sich ihr Studio eingerichtet hatte. Mit erhobenen, abwehrbereiten Händen stand Hoffmann regungslos da. Er hörte nichts. Aus einer Ecke der Halle zwinkerte ihm das winzige rote Auge des Bewegungsmelders zu. Wenn er nicht aufpasste, würde er selbst den Alarm auslösen. Seit ihrem Einzug hatte er das in Cologny schon zweimal miterlebt – große Häuser, die wie reiche hysterische alte Ladys grundlos hinter ihren hohen, von Efeu überwucherten Mauern losheulten.
Er nahm die Hände herunter und ging quer durch den Flur zu der Stelle, an der ein antikes Barometer an der Wand hing. Er drückte auf einen Schnappverschluss, und das Barometer schwang auf. Dahinter versteckte sich das Fach für den Steuerkasten der Alarmanlage. Er streckte den rechten Zeigefinger aus, um den Code einzutippen, der die Anlage ausschaltete – und erstarrte.
Die Alarmanlage war schon deaktiviert.
Der Finger verharrte in der Luft, während der rationale Teil seines Gehirns nach einer beruhigenden Erklärung suchte. Vielleicht war Gabrielle noch einmal hinuntergegangen, hatte die Anlage ausgeschaltet und dann, als sie zurück ins Bett gegangen war, vergessen, sie wieder einzuschalten. Oder er selbst hatte entgegen seiner Erinnerung vergessen, sie einzuschalten. Oder sie funktionierte nicht richtig.
Er drehte sich langsam nach links und warf einen prüfenden Blick auf die Haustür. Der Schein der Lampe spiegelte sich in ihrem glänzenden schwarzen Anstrich. Die Tür schien verschlossen zu sein, kein Anzeichen, dass sie gewaltsam geöffnet worden war. Wie die Alarmanlage war auch die Tür auf dem neuesten technischen Stand und durch denselben vierstelligen Code gesichert. Er schaute sich um, blickte die Treppe hinauf und in den Durchgang, der ins Innere des Hauses führte. Alles war ruhig. Er ging auf die Tür zu. Er tippte den Code ein und hörte das Klicken der zurückgleitenden Bolzen. Er drückte die schwere Messingklinke hinunter, öffnete die Tür und trat hinaus auf die dunkle Vorderveranda.
Über der tiefschwarzen Rasenfläche stand der silbrig blaue Mond, der wie ein Diskus aussah, der mit hoher Geschwindigkeit die dahineilenden schwarzen Wolkenmassen durchtrennte. Die Schatten der großen Tannen, die das Haus von der Straße abschirmten, schwankten rauschend im Wind.
Hoffmann ging ein paar Schritte hinaus in die Kieseinfahrt – gerade weit genug, um den Strahl der Infrarotsensoren zu unterbrechen und die Scheinwerfer vor dem Haus einzuschalten. Das grelle Licht ließ ihn zusammenfahren und wie einen flüchtenden Sträfling zur Salzsäule erstarren. Er hielt sich schützend die Hände vor die Augen, drehte sich zu dem gelben Licht der Eingangshalle um und sah, dass neben der Haustür fein säuberlich ein Paar großer schwarzer Stiefel stand – als hätte ihr Besitzer keinen Dreck ins Haus tragen oder dessen Bewohner nicht stören wollen. Die Stiefel gehörten nicht Hoffmann, und sie gehörten bestimmt nicht Gabrielle. Außerdem war er sich sicher, dass sie noch nicht dagestanden hatten, als er vor knapp sechs Stunden nach Hause gekommen war.
Während er auf die Stiefel stierte, zog er sein Handy aus dem Morgenmantel und ließ es beinahe fallen, bevor er die 911 wählte. Dann fiel ihm ein, dass er sich ja in der Schweiz befand, und er wählte die 117.
Laut Genfer Polizei, die alle Notrufe aufzeichnete und die später eine Kopie davon anfertigte – klingelte es nur einmal, um 3:59 Uhr. Eine Frau hob ab und sagte mit scharfer Stimme: »Oui, police?«
Ihre Stimme kam Hoffmann in der Stille sehr laut vor. Sie machte ihm bewusst, wie sichtbar und ungeschützt er im Licht der Scheinwerfer war. Er machte ein paar schnelle Schritte nach links, um von der Eingangshalle aus nicht mehr gesehen werden zu können, und gleichzeitig nach vorn, in den Schutz der Hauswand. Er hielt das Telefon dicht an seinen Mund und flüsterte: »J’ai un intrus sur ma propriété.« Auf dem Band sollte sich seine Stimme später ruhig und dünn anhören, fast roboterhaft. Es war die Stimme eines Mannes, dessen Großhirnrinde ihre ganze Kraft auf das Überleben konzentrierte, ohne dass der Mann sich dessen bewusst war. Es war die Stimme nackter Angst.
»Quelle est votre adresse, monsieur?«
Er nannte sie ihr. Während er sich an der Hauswand entlangbewegte, konnte er hören, wie ihre Finger auf der Tatstatur tippten.
»Et votre nom?«
»Alexander Hoffmann«, flüsterte er.
Die Überwachungsscheinwerfer gingen aus.
»Okay, Monsieur Hoffmann. Restez là. Une voiture est en route.«
Sie legte auf. Hoffmann stand allein in der Dunkelheit an der Ecke des Hauses. Für die erste Maiwoche in der Schweiz war es ungewöhnlich kalt. Der Wind blies von Nordost, vom Genfer See. Er konnte hören, wie die Wellen in schneller Folge gegen die nahen Anlegestellen schwappten und die Leinen scheppernd gegen die Stahlmasten der Jachten schlugen. Er zog sich den Morgenmantel enger um die Schultern. Er schlotterte am ganzen Leib. Er musste die Zähne zusammenbeißen, damit sie nicht klapperten. Und doch verspürte er seltsamerweise keine Panik. Er stellte fest, dass Panik und Angst etwas vollkommen Verschiedenes waren. Panik war moralischer und nervöser Zusammenbruch, eine Verschwendung wertvoller Energie, während Angst durch und durch Anspannung und Instinkt war: ein auf den Hinterbeinen stehendes Tier, das einen ganz vereinnahmte, das die Kontrolle über Gehirn und Muskeln übernahm. Er schnüffelte in der Luft und schaute an der Villa entlang in Richtung See. Irgendwo an der Rückseite des Hauses, in einem Raum im Erdgeschoss, brannte Licht. Es tauchte das Gebüsch im Garten in ein zauberhaftes Licht, gleich dem in einer Märchengrotte.
Er wartete eine halbe Minute, dann schlich er sich langsam durch das breite Blumenbeet, das diese Seite des Hauses säumte. Erst war er sich nicht sicher, aus welchem Zimmer das Licht kam. Seit der Makler ihnen das Grundstück gezeigt hatte, war er nicht mehr so weit vorgedrungen. Als er sich dem Lichtkegel näherte, fiel ihm wieder ein, dass es sich um die Küche handelte. Schließlich hatte er sie erreicht, schob den Kopf am Fensterrahmen vorbei und sah im Innern eine Gestalt. Der Mann stand mit dem Rücken zum Fenster an der Arbeitsinsel mit der Granitplatte, die das Zentrum der Küche bildete. In aller Ruhe nahm er nacheinander die Messer aus ihren Schlitzen im Hackblock und schärfte sie mit einem elektrischen Messerschleifer.
Hoffmanns Herz schlug so schnell, dass er das Rauschen seines Pulses hören konnte. Sein erster Gedanke galt Gabrielle: Er musste sie aus dem Haus schaffen, solange der Einbrecher in der Küche beschäftigt war – aus dem Haus schaffen oder zumindest dafür sorgen, dass sie sich im Bad einschloss, bis die Polizei eintraf.
Er hatte immer noch das Telefon in der Hand. Ohne den Blick von dem Einbrecher abzuwenden, wählte er ihre Nummer. Sekunden später hörte er ihr Telefon klingeln – zu laut und zu nah, als dass es bei ihr im Schlafzimmer sein konnte. Im selben Augenblick hob der Fremde den Kopf. Gabrielles Handy lag da, wo sie es liegen lassen hatte, als sie ins Bett gegangen war: auf dem großen Kiefernesstisch. Das rosa Plastikgehäuse mit seinem leuchtenden Display bewegte sich summend über das Holz wie ein auf dem Rücken liegendes tropisches Insekt. Der Einbrecher neigte den Kopf zur Seite und schaute es an. Einige Sekunden lang rührte er sich nicht vom Fleck. Dann legte er mit unverändert enervierender Gelassenheit das Messer zur Seite – Hoffmanns Lieblingsmesser, das mit der langen, schmalen Klinge, das sich besonders gut zum Ausbeinen eignete – und ging um die Kücheninsel herum zum Tisch. Dabei wandte er den Körper halb dem Fenster zu, sodass Hoffmann ihn zum ersten Mal richtig sehen konnte – hohle Wangen, unrasiert, kahler Schädel, an den Seiten lange, dünne, graue Haare, die zu einem fettigen Pferdeschwanz zusammengebunden waren. Er trug einen abgewetzten braunen Ledermantel. Er sah aus wie jemand, der in einem Zirkus oder bei einem Schausteller arbeitete. Er schaute das Telefon an, als hätte er noch nie zuvor eines gesehen, nahm es in die Hand, zögerte kurz, drückte dann auf einen Knopf und hielt es sich ans Ohr.
Eine Welle mörderischer Wut erfasste Hoffmann. Sie überflutete ihn wie Licht. Leise sagte er: »Gottverdammter Wichser, verschwinde aus meinem Haus.« Befriedigt sah er, dass der Einbrecher panisch zusammenzuckte, als hätte von oben ein unsichtbarer Draht an ihm gerissen. Ruckartig drehte er den Kopf hin und her – links, rechts, links. Dann verharrte sein Blick auf dem Fenster. Einen Augenblick lang trafen seine stechenden Augen auf die Hoffmanns, blind, denn er schaute auf schwarzes Glas. Schwer zu sagen, wer von beiden mehr Angst hatte. Plötzlich warf der Eindringling das Telefon auf den Tisch und stürzte erstaunlich flink auf die Tür zu.
Hoffmann fluchte, drehte sich um und hastete den Weg zurück, den er gekommen war. Die Hausschuhe behinderten ihn, er knickte um und humpelte keuchend weiter durch das glitschige Blumenbeet zur Vorderseite der Villa. Als er die Hausecke erreichte, hörte er, wie die Eingangstür zugeschlagen wurde. Er nahm an, dass der Einbrecher sich aus dem Staub machen wollte. Die Sekunden verstrichen, aber der Mann tauchte nicht auf. Er musste sich eingeschlossen haben.
»O Gott«, flüsterte Hoffmann. »O Gott.«
Er hastete weiter zur Vorderveranda. Die Stiefel standen noch da – mit heraushängenden Zungen, alt, kauernd, heimtückisch. Seine Hände zitterten, als er den Sicherheitscode eingab. Er schrie Gabrielles Namen, obwohl das Schlafzimmer an der Rückseite des Hauses lag und sie ihn kaum hören konnte. Die Bolzen glitten klickend zurück. Er stieß die Tür auf und blickte in Dunkelheit. Die Lampe im Flur war ausgeschaltet.
Ein paar Sekunden lang stand er keuchend auf der Türschwelle, schätzte die Entfernung bis zur Treppe ab, kalkulierte seine Chancen und stürzte dann los. »Gabrielle! Gabrielle!« Er hatte die Hälfte des Weges zurückgelegt, als das Haus zu explodieren schien. Die Treppe stürzte ein, die Marmorfliesen platzten aus dem Boden, die Wände schossen davon und verschwanden in der Nacht.
Zwei
Ein Gran in der Wage kann den Ausschlag geben, welches Individuum fortleben und welches zu Grunde gehen […] soll.
Charles DarwinDie Entstehung der Arten,1859
An nichts von dem, was danach geschah, konnte Hoffmann sich erinnern – keine Gedanken oder Träume störten seinen sonst ruhelosen Geist. Bis er schließlich in all dem Nebel – wie eine flache Landzunge am Ende einer langen Reise – allmählich wieder Sinneseindrücke wahrnahm: eisiges Wasser, das ihm am Hals und dann den Rücken hinunterlief, ein kalter Druck auf der Schädeldecke, ein stechender Schmerz im Kopf, ein mechanisches Plappern in den Ohren, der vertraute, süßlich durchdringende Duft des Parfüms seiner Frau. Er begriff, dass er auf der Seite lag und etwas sanft auf seine Wange drückte. Er spürte einen Druck auf seiner Hand.
Er öffnete die Augen und sah nur Zentimeter von seinem Gesicht entfernt eine weiße Plastikschale, in die er sich sofort übergab. Die Fischpastete vom Vorabend hinterließ einen säuerlichen Geschmack in seinem Mund. Er würgte und übergab sich noch einmal. Die Schale verschwand. Ein grelles Licht leuchtete erst in das eine, dann in das andere Auge. Man wischte ihm Nase und Mund ab, ein Glas Wasser wurde ihm gegen die Lippen gedrückt. Patzig wie ein Baby stieß er es erst weg, nahm es dann doch und trank es aus. Dann öffnete er die Augen wieder und schaute sich blinzelnd seine neue Welt an.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!