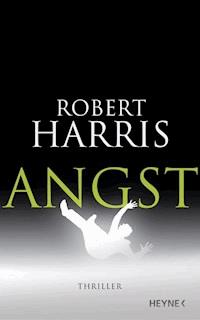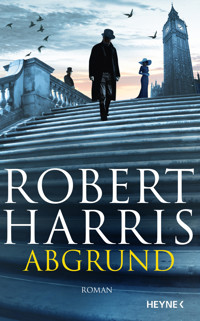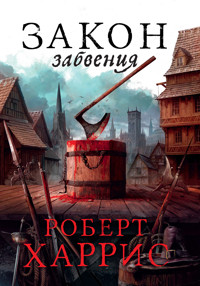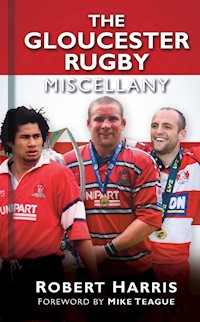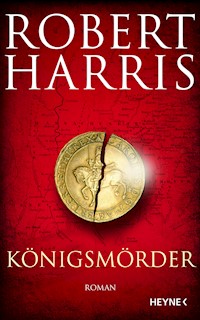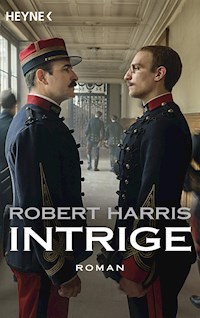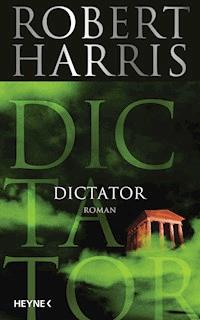
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Cicero
- Sprache: Deutsch
Endlich – das triumphale Finale von Robert Harris’ Cicero-Trilogie
Cicero, größter Redner seiner Zeit, weilt mit seinem Sekretär Tiro im Exil. Da er seinen politischen Feind Caesar zu unterstützen verspricht, kann er nach Rom zurückkehren, wo er sich wieder zu ö entlichem Ansehen emporkämpft. Genial und fehlbar, angsterfüllt und doch unbändig mutig – der mit sich ringende Mensch hinter dem Politiker Cicero macht die Geschichte so unwiderstehlich.
Dictator umfasst bedeutsame Momente der Menschheitsgeschichte: den Untergang der römischen Republik, den folgenden Bürgerkrieg, die Enthauptung von Pompeius und den Meuchelmord an Caesar. Das Thema jedoch ist zeitlos: Wie lässt sich politische Freiheit gegen skrupellosen Ehrgeiz, korrumpierte Wahlen und den verderblichen Einfluss endloser Auslandseinsätze schützen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 712
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Das Buch
Mit seinen 48 Jahren ist Marcus Tullius Cicero, der größte Redner seiner Zeit, allem Anschein nach ein gebrochener Mann. Entmachtet, zusammen mit seinem treuen Sekretär Tiro in den östlichen Mittelmeerraum verbannt, von Frau und Kindern getrennt und seiner Besitztümer beraubt, martert er sich mit Vorwürfen.
Aber er hält sich an den eigenen Aphorismus, dass, solange der Sieche noch atme, Hoffnung bestehe. Indem er seinen politischen Feind Caesar zu unterstützen verspricht, gelingt es ihm nach Italien zurückzukehren. Dort kämpft er sich wieder nach oben: von den Gerichtshöfen zum Senat, bis er kraft seines Wortes abermals zur prägenden Figur in Rom wird, wenn auch nur für eine kurze glorreiche Zeit.
Das langersehnte Finale von Robert Harris’ Cicero-Trilogie umfasst einige der bedeutendsten Momente der Menschheitsgeschichte: den Untergang der römischen Republik, den anschließenden Bürgerkrieg, die Ermordung von Pompeius und den meuchlerischen Anschlag auf Caesar. Das Thema jedoch ist zeitlos: Wie lässt sich politische Freiheit gegen die Dreifachbedrohung aus skrupellosem Ehrgeiz, einem vom Geld beherrschten Wahlsystem und den verderblichen Auswirkungen endloser Kriege im Ausland schützen?
Der Autor
Robert Harris wurde 1957 in Nottingham geboren und studierte in Cambridge. Er war Reporter bei der BBC, Redakteur beim Observer und Kolumnist bei der Sunday Times und dem Daily Telegraph. 2003 wurde er als bester Kolumnist mit dem »British Press Award« ausgezeichnet. Seine Romane Vaterland, Enigma, Aurora, Pompeji, Imperium, Ghost, Titan, Angst und zuletzt Intrige wurden allesamt internationale Bestseller. Robert Harris lebt mit seiner Familie in Berkshire.
ROBERT
HARRIS
DICTATOR
ROMAN
Aus dem Englischen von
Wolfgang Müller
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält
technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung.
Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch
unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung
oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere
in elektronischer Form, ist untersagt und kann
straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte dieses E-Book Links auf Webseiten Dritter enthalten,
so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung,
da wir uns diese nicht zu eigen machen,
sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt
der Erstveröffentlichung dieses E-Books verweisen.
Die Originalausgabe erscheint unter dem Titel
Dictator
bei Hutchinson, London
Copyright © 2015 by Robert Harris
Copyright © 2015 der deutschsprachigen Ausgabe by
Wilhelm Heyne Verlag, München
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: © Eisele Grafik.Design, München
Karten: GeoKarta, Heiner Newe, Altensteig;
Animagic, A. Hancock, Bielefeld
Satz: Leingärtner, Nabburg
e-ISBN 978-3-641-17647-1
www.heyne.de
Für Holly
ANMERKUNGEN DES AUTORS
In Form einer von seinem Privatsekretär Tiro verfassten Biografie erzählt Dictator die Geschichte der letzten fünfzehn Jahre im Leben des römischen Staatsmannes Cicero.
Dass es diesen Tiro gegeben hat und dass er ein solches Buch geschrieben hat, sind belegte historische Tatsachen. Er wurde als Sklave auf dem Familienbesitz der Ciceros geboren, war drei Jahre jünger als sein Herr, überlebte diesen aber bei Weitem und wurde laut Kirchenvater Hieronymus hundert Jahre alt.
»Deine Dienste an mir sind nicht zu zählen«, schrieb Cicero 50 v. Chr. in einem Brief an ihn, »im Haus und auf dem Forum, in der Stadt und in der Provinz, in privaten und öffentlichen Belangen, bei meinen Studien und literarischen Arbeiten …« Tiro war der erste Mensch, der eine Senatsrede im Wortlaut aufzeichnete. Sein unter der Bezeichnung notae Tironianae bekannt gewordenes Kurzschriftsystem wurde von der Kirche noch im neunten Jahrhundert benutzt. Einige Reste dieses Systems haben sogar noch bis in die Neuzeit überlebt. Er schrieb auch mehrere Abhandlungen über die Entwicklung der lateinischen Sprache. Tiros mehrbändiges Werk über das Leben Ciceros nennt der Historiker Asconius Pedianus im ersten Jahrhundert in seinen Kommentaren zu Ciceros Reden als eine seiner Quellen. Plutarch zitiert das Werk zweimal. Aber wie alle anderen literarischen Arbeiten Tiros ging auch seine Biografie über Cicero beim Untergang des Römischen Reiches verloren.
Was für ein Werk mag das gewesen sein? Ciceros Leben war außergewöhnlich, selbst an den Maßstäben jener Zeit gemessen. Verglichen mit seinen Rivalen aus der Aristokratie stammte er aus relativ einfachen Verhältnissen. Obwohl er sich für das Militärhandwerk nicht im Geringsten interessierte, machte er dank seinen Fähigkeiten als Redner und seinem intellektuellen Scharfsinn eine rasante Karriere, durchlief alle Stufen des politischen Systems der römischen Republik, bis er schließlich allen Widrigkeiten zum Trotz im jüngstmöglichen Alter von zweiundvierzig Jahren zum Konsul gewählt wurde.
In seinem krisengeschüttelten Amtsjahr 63 v. Chr. musste er sich mit der Verschwörung des Sergius Catilina zum Sturz der Republik auseinandersetzen. Um die Revolte niederzuschlagen, befahl der Senat unter Ciceros Vorsitz die Hinrichtung von fünf prominenten Bürgern Roms – ein Ereignis, das ihn zeit seines Lebens verfolgen sollte.
Als sich später die drei mächtigsten Männer Roms – Julius Caesar, Pompeius Magnus und Marcus Crassus – im sogenannten Triumvirat verbündeten, um die Macht im Staat auszuüben, entschloss sich Cicero zum Widerstand. Caesar schlug zurück, indem er seine Befugnisse als Oberster Priester einsetzte und den ehrgeizigen aristokratischen Demagogen Clodius – einen alten Feind Ciceros – auf ihn hetzte. Caesar erlaubte Clodius, seinen Stand als Patrizier zu verlassen und Plebejer zu werden, was ihm die Möglichkeit eröffnete, sich zum Volkstribunen wählen zu lassen. Tribunen hatten die Macht, Bürger vor die Volksversammlung zu zerren, sie zu drangsalieren und zu verfolgen. Cicero entschied sich zur Flucht aus Rom. An diesem Punkt in Ciceros Lebensgeschichte setzt Dictator ein.
Mein Ziel ist es gewesen, innerhalb der Konventionen des Romans so präzise, wie es mir möglich war, das Ende der römischen Republik nachzuzeichnen, wie Cicero und Tiro es erlebt haben könnten. Wo immer möglich, habe ich bei Briefen, Reden und der Schilderung von Ereignissen die Originalquellen herangezogen.
Zumindest bis zu den Ereignissen der Jahre 1933 bis 1945 umfasst Dictator wohl die dramatischste Periode der Menschheitsgeschichte. Zur besseren Orientierung in Ciceros an Dramatik kaum zu überbietender Welt findet der Leser am Ende des Buchs Karten, ein Glossar und eine Liste der handelnden Personen.
Robert Harris
Kintbury, 8. Juni 2015
»Die Schwermut der antiken Welt erscheint mir tiefgründiger zu sein als die moderner Menschen, die alle mehr oder weniger annehmen, dass jenseits der dunklen Leere die Unsterblichkeit liegt. Für den antiken Menschen jedoch war das ›schwarze Loch‹ die Unendlichkeit selbst. Seine Träume tauchen auf und verschwinden vor einem unveränderlichen, ebenholzschwarzen Hintergrund. Kein Aufschrei, keine Erschütterungen – nichts als ein starrer, nachdenklicher Blick. Gerade als die Götter schon nicht mehr da waren und Christus noch nicht gekommen, gab es diesen einzigartigen Augenblick in der Geschichte, von Cicero bis Mark Aurel, da stand der Mensch allein. Nirgends sonst finde ich diese besondere Majestät.«
Gustave Flaubert,
Brief an Mme Roger des Genettes, 1861
»Als Lebender vergrößerte Cicero das Leben. Das schaffen auch seine Briefe, wenn auch nur für den einen oder anderen Studenten, der zum banalen Alltag auf Distanz geht, um unter den in Togen gewandeten Menschen Vergils zu leben, den verzweifelten Herren einer größeren Welt.«
D. R. Shackleton Bailey,
Cicero,1971
TEIL EINS
EXILIUM
58 v. Chr. – 47 v. Chr.
NESCIRE AUTEM QUID ANTE QUAM NATUS
SIS ACCIDERIT, ID EST SEMPER ESSE PUERUM.
QUID ENIM EST AETAS HOMINIS,
NISI EA MEMORIA RERUM VETERUM CUM
SUPERIORUM AETATE CONTEXITUR?
Wer nicht weiß, was vor seiner Geburt geschehen ist,
wird immer ein Kind bleiben. Denn was ist
das Leben des Menschen, wenn es nicht durch
die Aufzeichnungen der Geschichte mit
dem Leben seiner Vorfahren verwoben ist?
Cicero, Der Redner, 46 v. Chr.
KAPITEL I
Ich erinnere mich an Caesars schmetternde Kriegshörner, deren Klang uns über die dunkle Ebene Latiums jagte – ein sehnsüchtiges, klagendes Heulen wie von brünstigen Tieren. Und daran, wie sie verstummten und nur noch unser drängendes Keuchen und unsere schlitternden Schuhe auf der eisigen Straße zu hören waren.
Den unsterblichen Göttern hatte es nicht genügt, Cicero von seinen Mitbürgern bespucken und beschimpfen zu lassen, nicht, ihn mitten in der Nacht von den Heimstätten und Altären seiner Familie und seiner Vorfahren vertrieben zu sehen, nicht einmal, ihn bei seiner Flucht zu Fuß aus Rom zu nötigen, das eigene Haus in Flammen aufgehen zu sehen. Zusätzlich zu all diesen Qualen hatten sie noch eine weitere Demütigung für ihn bereitgehalten: ihn zu zwingen, mit anzuhören, wie die Armee seines Feindes ihre Zelte auf dem Marsfeld abbrach.
Obwohl er der älteste der Gruppe war, hielt er mit dem schnellen Tempo von uns anderen Schritt. Noch vor Kurzem hatte er das Leben Caesars in der Hand gehalten. Er hätte ihn zerquetschen können wie ein Ei. Nun führte sie das Schicksal in völlig entgegengesetzte Richtungen. Während Cicero nach Süden eilte, um seinen Feinden zu entkommen, marschierte der Architekt seines Niedergangs nach Norden, um sich beider Provinzen Galliens zu bemächtigen.
Er ging mit gesenktem Kopf, sagte kein Wort. Wahrscheinlich war er zum Sprechen zu verzweifelt. Erst bei Tagesanbruch in Bovillae, wo die Pferde auf uns warteten und wir den zweiten Abschnitt unserer Reise in Angriff nehmen wollten, hielt er beim Einsteigen in die Kutsche plötzlich inne. »Meinst du, wir sollten umkehren?«
Die Frage überraschte mich. »Ich weiß nicht«, sagte ich. »Darüber habe ich noch nicht nachgedacht.«
»Dann denke jetzt darüber nach. Also: Warum fliehen wir aus Rom?«
»Wegen Clodius und seinem Pöbel.«
»Und warum ist Clodius so mächtig?«
»Weil er als Volkstribun Gesetze gegen Euch erlassen kann.«
»Und wer hat es ihm ermöglicht, Volkstribun zu werden?«
Ich zögerte. »Caesar.«
»Genau, Caesar. Glaubst du auch nur einen Augenblick, dass sein Aufbruch nach Gallien exakt zu dieser Stunde Zufall war? Natürlich nicht! Er wartet, bis ihm seine Spitzel melden, dass ich die Stadt verlassen habe, dann setzt er seine Armee in Marsch. Warum? Ich hatte schon immer vermutet, dass er Clodius’ Aufstieg gefördert hat, um mich dafür zu bestrafen, dass ich gegen ihn aufbegehrt habe. Aber was, wenn es von jeher sein Ziel gewesen war, mich aus der Stadt zu vertreiben? Welcher Plan erfordert es, dass erst ich die Stadt verlassen muss, bevor auch er sie verlassen kann?«
Ich hätte die Logik seiner Gedanken begreifen müssen. Ich hätte auf Umkehr dringen müssen. Aber ich hatte, wenn ich ehrlich bin, zu viel Angst davor, was Clodius’ Schläger uns antun könnten, sollten sie uns bei unserer Rückkehr in die Stadt aufgreifen.
»Das ist eine gute Frage«, sagte ich stattdessen. »Und ich habe keine Antwort darauf. Aber würde es nicht einen unentschlossenen Eindruck machen, wenn Ihr plötzlich wieder auftauchtet, nachdem Ihr Euch schon von allen verabschiedet habt? Außerdem hat Clodius Euer Haus niedergebrannt – wohin würden wir gehen? Wer würde uns aufnehmen? Ich glaube, es ist weiser, am ursprünglichen Plan festzuhalten und sich so weit wie möglich von Rom zu entfernen.«
Er lehnte den Kopf an die Seitenwand der Kutsche und schloss die Augen. Ich war schockiert, wie er nach einer Nacht auf der Straße aussah. Haare und Bart hatte er seit Wochen nicht mehr schneiden lassen. Er trug eine schwarze Toga. Dieses öffentliche Zeichen der Trauer ließ ihn viel älter aussehen als die achtundvierzig Jahre, die er tatsächlich war. In dem blassgrauen Licht sah er aus wie ein uralter Bettelmönch. Er seufzte. »Ich weiß nicht, Tiro. Vielleicht hast du recht. Ich habe so lange nicht mehr geschlafen. Ich weiß nicht mehr, was ich denken soll, ich bin zu müde.«
Und so machten wir den verhängnisvollen Fehler, unseren Weg nach Süden an diesem und den folgenden zwölf Tagen fortzusetzen, um einen vermeintlich sicheren Abstand zwischen uns und die Gefahr zu legen.
Um kein Aufsehen zu erregen, reisten wir mit kleinstem Gefolge – ein Kutscher und drei bewaffnete Sklaven, von denen einer vor und zwei hinter uns ritten. Zur Begleichung unserer Reisekosten hatte uns Atticus, Ciceros ältester und engster Freund, eine Kassette mit Gold- und Silbermünzen überlassen, die unter unserer Sitzbank versteckt war. Wir übernachteten nur in Häusern von vertrauenswürdigen Männern, und das auch nur für jeweils eine Nacht. Wir mieden all jene Orte, an denen man Cicero vielleicht vermuten würde, zum Beispiel seine Strandvilla in Formiae, wo ihn seine Verfolger, wie Cicero annahm, sicher als Erstes suchen würden, und die Bucht von Neapel, wohin auf der Suche nach Wintersonne und warmen Quellen bereits Scharen von Römern strömten. Stattdessen strebten wir so schnell wie möglich dem Zeh Italiens zu.
Ciceros während der Reise gereifter Plan lautete, nach Sizilien zu reisen und dort so lange zu bleiben, bis man in Rom nicht mehr gegen ihn agitieren würde. »Der Pöbel wird sich schließlich gegen Clodius wenden«, prophezeite er. »Das liegt in der Natur des Pöbels. Er wird immer mein Todfeind, aber nicht immer Volkstribun bleiben – das dürfen wir nie vergessen. In neun Monaten ist seine Amtszeit abgelaufen, dann können wir wieder zurück.«
Wegen seiner erfolgreichen Klage gegen Verres, den tyrannischen Statthalter der Insel, war er sich seiner wohlwollenden Aufnahme durch die Sizilier sicher – auch wenn dieser Glanzsieg, der seine politische Karriere begründet hatte, schon zwölf Jahre zurücklag und Clodius erst kürzlich als Magistrat in der Provinz amtiert hatte. Ich hatte Briefe vorausgeschickt und Ciceros Absicht kundgetan, um Asyl zu bitten.
Als wir den Hafen von Regium erreichten, mieteten wir ein kleines Boot mit sechs Männern, die uns über die Meerenge nach Messina rudern sollten.
Wir verließen den Hafen an einem klaren, kalten Wintermorgen. Das Meer und der Himmel waren blau – die Trennlinie zwischen dem dunklen Wasser und der hellen Luft war so scharf wie eine Klinge. Die Strecke nach Messina betrug nur drei Meilen, für die wir nicht einmal eine Stunde brauchten. Wir waren schon so nah ans Ufer gerudert, dass wir auf den Felsen Ciceros Anhänger sehen konnten. Doch zwischen uns und der Hafeneinfahrt ankerte ein Kriegsschiff, das die rote und grüne Flagge des Statthalters von Sizilien, Gaius Vergilius, gehisst hatte. Als wir auf den Leuchtturm zuhielten, lichtete das Schiff den Anker, bewegte sich langsam vorwärts und versperrte uns die Durchfahrt. Umgeben von seinen Liktoren, stand Vergilius an der Reling. Er verzog das Gesicht, als er sah, wie ungepflegt Cicero war. Dann rief er einen Gruß zu uns herunter, den Cicero mit freundlichen Worten erwiderte. Sie kannten sich seit vielen Jahren, aus ihrer Zeit im Senat.
Vergilius fragte ihn nach seinen Plänen.
Cicero antwortete, dass er natürlich den Plan habe, an Land zu kommen.
»Das hat man mir berichtet«, sagte Vergilius. »Das kann ich dir aber leider nicht erlauben.«
»Warum?«
»Weil Clodius ein neues Gesetz erlassen hat.«
»Um welches neue Gesetz handelt es sich? Es gibt so viele, man verliert leicht den Überblick.«
Vergilius machte einem seiner Begleiter ein Zeichen, der daraufhin ein Dokument hervorholte und es zu mir herunterreichte. Ich gab es Cicero. Bis zum heutigen Tag kann ich mich daran erinnern, dass es in der leichten Brise wie ein Lebewesen flatterte. Es war das einzige Geräusch in der Stille. Cicero ließ sich Zeit. Als er es gelesen hatte, reichte er es mir kommentarlos.
LEX CLODIA IN CICERONEM
Da M. T. Cicero römische Bürger ohne Anhörung und ohne Urteilsspruch zu Tode gebracht und zu diesem Zwecke die Autorität und Rechtskraft des Senats missbraucht hat, wird seine Ächtung in einem Umkreis von vierhundert Meilen um Rom verfügt. Es wird weiter verfügt, dass ihn niemand unter Androhung des Todes beherbergen oder empfangen darf, dass all seine Liegenschaften und Besitztümer verfallen, dass sein Haus in Rom zerstört und an seiner Stelle ein Schrein für die Freiheitsgöttin Libertas geweiht wird und dass jeder, der zu seinen Gunsten handelt, spricht, abstimmt oder Schritte zu seiner Rückkehr einleitet, als Staatsfeind behandelt wird, es sei denn, diejenigen, die Cicero gesetzwidrig zu Tode gebracht hat, würden wieder zum Leben erweckt werden.
Es musste ein schrecklicher Schlag für ihn gewesen sein. Aber er riss sich zusammen und tat die Sache mit einer beiläufigen Handbewegung ab. »Wann wurde dieser Unsinn öffentlich gemacht?«
»Mir wurde berichtet, dass das Gesetz in Rom vor acht Tagen angeschlagen wurde. Es ist erst gestern in meine Hände gelangt.«
»Nun, dann ist es noch nicht Gesetz und kann auch nicht Gesetz werden, bevor es nicht ein drittes Mal gelesen wurde. Mein Sekretär kann dir das bestätigen.« Er wandte sich zu mir um. »Tiro, nenne dem Statthalter das frühestmögliche Datum, an dem es verabschiedet werden kann.«
Ich versuchte, es auszurechnen. Bevor eine Gesetzesvorlage zur Abstimmung gelangen konnte, musste sie an drei aufeinanderfolgenden Markttagen auf dem Forum verlesen werden. Aber meine Gedanken waren noch so durcheinander von dem gerade Gelesenen, dass mir einfach nicht einfallen wollte, welchen Wochentag wir hatten, ganz zu schweigen davon, welche die Markttage waren. »Von heute gerechnet in zwanzig Tagen«, sagte ich aufs Geratewohl. »Vielleicht fünfundzwanzig.«
»Da hast du’s«, rief Cicero. »Selbst wenn es durchgeht, und ich bin mir sicher, dass es nicht durchgeht, habe ich noch eine Gnadenfrist von drei Wochen.« Er stieg in den Bug des Bootes, stemmte sich breitbeinig gegen das Schaukeln des Rumpfes und breitete bittend die Arme aus. »Mein lieber Vergilius, um unserer alten Freundschaft willen, gestatte mir nach dieser langen Reise wenigstens, dass ich an Land gehen und ein oder zwei Nächte im Kreise meiner Anhänger verbringen kann.«
»Es tut mir leid, aber das Risiko kann ich nicht eingehen. Ich habe meine juristischen Berater konsultiert. Sie sagen, selbst wenn du bis zur westlichsten Spitze der Insel reist, nach Lilybaeum, würdest du dich weniger als dreihundertfünfzig Meilen von Rom entfernt aufhalten, und dann hätte ich Clodius im Nacken.«
Jetzt war es aus mit Ciceros freundlichem Ton. Kühl sagte er: »Du hast nach dem Gesetz kein Recht, die Reise eines römischen Bürgers zu behindern.«
»Ich habe jedes Recht, den Frieden in meiner Provinz zu schützen. Und hier ist, wie du weißt, mein Wort das Gesetz …«
Er schien seine Worte zu bedauern, ja, ich würde sogar sagen, er war beschämt. Aber er ließ sich nicht erweichen, und nachdem sie einige weitere zornige Worte gewechselt hatten, blieb uns keine Wahl, als nach Regium zurückzurudern. Die Leute am Ufer reagierten auf unsere Umkehr mit Schreckensschreien, und zum ersten Mal fiel mir auf, dass Cicero ernsthaft besorgt war. Vergilius war sein Freund. Wenn sich ein Freund so verhielt, dann würde sich schon bald ganz Italien gegen ihn wenden. Eine Rückkehr nach Rom, um das Gesetz zu bekämpfen, war viel zu gefährlich. Er hatte die Stadt zu spät verlassen. Abgesehen von den physischen Gefahren, die die Reise mit sich bringen würde, wäre das Gesetz wahrscheinlich schon verabschiedet, und dann säßen wir fest, vierhundert Meilen von der Grenzlinie entfernt, die das Gesetz vorschrieb. Um den Bedingungen seines Exils zu genügen, musste er sofort ins Ausland fliehen. Wegen Caesar kam Gallien natürlich nicht infrage. Es blieb nur ein Ort irgendwo im Osten – Griechenland vielleicht oder Asia. Unglücklicherweise befanden wir uns auf der falschen Seite des Stiefels. Wir mussten erst auf die adriatische Seite nach Brundisium gelangen, dort ein Schiff finden, das groß genug für eine so lange Reise war, um unsere Flucht dann über das im Winter tückische Meer antreten zu können. Eine ausnehmend üble Lage – wie sie ohne Zweifel von Caesar, dem Paten und Schöpfer von Clodius, auch beabsichtigt war.
•
Nach zwei mühseligen Wochen, oft bei schwerem Regen und auf schlechten Straßen, hatten wir die Berge überquert. Ständig witterten wir Hinterhalte, obwohl wir in den primitiven Dörfern durchweg freundlich empfangen wurden. Wir schliefen in verrauchten, eiskalten Gasthäusern und aßen hartes Brot und fettes Fleisch, das durch den sauren Wein kaum genießbarer wurde. Ciceros Laune schwankte zwischen Zorn und Verzweiflung. Er wusste inzwischen, dass es ein furchtbarer Fehler gewesen war, Rom zu verlassen. Es war Wahnsinn gewesen, das Feld zu räumen und Clodius Gelegenheit zu geben, die falsche Anschuldigung in die Welt zu setzen, er habe römische Bürger ohne Anhörung und ohne Urteilsspruch hinrichten lassen, obwohl in Wahrheit alle fünf catilinarischen Verschwörer sich hatten verteidigen dürfen und ihre Hinrichtung vom gesamten Senat gebilligt worden war. Aber seine Flucht lief auf ein Schuldeingeständnis hinaus. Als er Caesars Trompeten hörte und ihm zum ersten Mal sein Irrtum zu dämmern begann, hätte er seinem Instinkt folgen und umkehren sollen. Er weinte über die Katastrophe, in die seine Torheit und Ängstlichkeit seine Frau und die Kinder gestürzt hatten.
Und als er sich genug für seine Schwäche gegeißelt hatte, fluchte er auf Hortensius und »den Rest der aristokratischen Bande«, die ihm den Aufstieg aus bescheidenen Verhältnissen zum Konsul und Retter der Republik nie verziehen hatten: Sie hatten ihn mit Absicht zur Flucht gedrängt, um ihn zu ruinieren. Er hätte Sokrates’ Beispiel beherzigen sollen, der behauptete, der Tod sei dem Exil vorzuziehen. Ja, er hätte sich entleiben sollen. Er packte das Messer, das auf dem Esstisch lag. Er würde sich umbringen! Ich sagte nichts. Ich nahm seine Drohung nicht ernst. Er konnte kein Blut sehen – nicht das anderer Menschen und schon gar nicht das eigene. Sein Leben lang hatte er Militärexpeditionen, die Spiele, öffentliche Exekutionen oder Bestattungen gemieden – alles, was ihn an die Sterblichkeit des Menschen erinnerte. Ein möglicher Schmerz jagte ihm schon Angst ein, erst recht der Gedanke an den Tod – was, obwohl ich mir natürlich nie die Unverfrorenheit herausnehmen würde, das auch auszusprechen, der entscheidende Grund für seine Flucht aus Rom war.
Als schließlich die befestigten Mauern Brundisiums vor uns auftauchten, entschied er sich gegen ein Betreten der Stadt. Der Hafen sei so groß und geschäftig, so voller Fremder und so vorhersehbar sein Ziel, dass er davon überzeugt war, er sei der naheliegende Ort für einen Anschlag auf ihn. Stattdessen suchte er etwas weiter nördlich an der Küste Zuflucht, im Haus seines alten Freundes Marcus Laenius Flaccus. In jener Nacht schliefen wir zum ersten Mal seit drei Wochen in anständigen Betten, und am nächsten Morgen gingen wir hinunter zum Strand. Die Wellen waren wilder als auf der Sizilien zugewandten Seite. Ein kräftiger Wind schleuderte sie unablässig auf die Felsen und den Kies. Cicero verabscheute Seereisen jeder Art, und diese hier versprach besonders unangenehm zu werden. Und doch war es unsere einzige Möglichkeit zur Flucht. Einhundertzwanzig Meilen hinter dem Horizont lag die illyrische Küste.
Als Flaccus seinen Gesichtsausdruck sah, sagte er: »Kopf hoch, Cicero. Vielleicht geht das Gesetz ja nicht durch, oder einer der Volkstribunen legt sein Veto ein. Es muss doch in Rom noch jemanden geben, der für dich Partei ergreift. Doch sicher Pompeius, oder?«
Cicero schaute mit starrem Blick hinaus aufs Meer und sagte kein Wort. Ein paar Tage später erreichte uns die Nachricht, dass die Vorlage tatsächlich verabschiedet und nun Gesetz sei, weshalb Flaccus nun aus dem einfachen Grund, dass sich auf seinem Anwesen ein verurteilter Verbannter aufhielt, eines Kapitalverbrechens schuldig war. Dennoch versuchte er, uns zum Bleiben zu überreden, Clodius könne ihm nun wirklich keine Angst einjagen. Aber Cicero wollte nichts davon wissen. »Deine Loyalität rührt mich, alter Freund, aber dieses Ungeheuer hat sicher noch in der Sekunde, als das Gesetz verabschiedet wurde, einen Haufen Söldner losgeschickt, die mich festsetzen sollen. Wir haben keine Zeit zu verlieren.«
Ich hatte im Hafen von Brundisium ein Handelsschiff ausfindig machen können, dessen klammer Kapitän gegen ein stattliches Entgelt gewillt war, das Risiko einer winterlichen Fahrt über die Adria zu wagen. Bei Sonnenaufgang des nächsten Tages, als sonst noch niemand auf den Beinen war, gingen wir an Bord. Das Schiff war robust, aus breiten Balken gebaut, mit einer zwanzigköpfigen Mannschaft, die regelmäßig die Handelslinie zwischen Italien und Dyrrhachium befuhr. Ich kannte mich in diesen Dingen nicht aus, aber das Schiff machte auf mich einen sicheren Eindruck. Der Kapitän schätzte,die Überfahrt würde etwa anderthalb Tage dauern, aber wir müssten schnell ablegen, um den günstigen Wind zu nutzen. Während die Seeleute das Schiff seeklar machten und Flaccus am Kai wartete, diktierte Cicero mir schnell noch eine letzte Botschaft an seine Frau und die Kinder. Ich hatte ein gutes Leben, eine erfolgreiche Laufbahn – das Gute in mir, nicht das Schlechte, hat mich in die Tiefe gerissen. Meine liebe Terentia, du treueste und beste aller Frauen, Tullia, meine geliebte Tochter, und du, Marcus, unsere einzig verbliebene Hoffnung – lebt wohl! Ich schrieb die Zeilen nieder und gab sie Flaccus. Er hob eine Hand zum Abschied. Dann wurde das Segel entrollt, und die Leinen wurden losgemacht. Die Ruderer drückten uns von der Hafenmauer weg, und wir legten ab und glitten in den blassgrauen Morgen.
•
Anfangs machten wir gute Fahrt. Cicero stand hoch über uns anderen auf dem Steuermannsdeck, stützte sich auf die Reling und beobachtete, wie der große Leuchtturm von Brundisium hinter uns verschwand. Abgesehen von seinen Sizilienreisen, war es das erste Mal seit seiner Jugend, als er auf Rhodos Molons Rhetorikschule besucht hatte, dass er Italien verließ. Von allen Männern, die ich je kennengelernt habe, war Cicero von seiner Veranlagung her der am wenigsten für das Exil geeignete. Für ein befriedigendes Leben brauchte er die Ingredienzien einer zivilisierten Gesellschaft – Freunde, Nachrichten, Klatsch, Gespräche, Politik, Abendgesellschaften, Theater, Badehäuser, Bücher, prächtige Gebäude. All das entschwinden zu sehen muss eine Qual für ihn gewesen sein.
Dennoch war es in weniger als einer Stunde verschwunden. Im Nichts versunken. Der Wind trieb uns kräftig voran, und beim Anblick der Schaumkronen kam mir Homers »und donnernd wogte die purpurne Flut um den Kiel des gleitenden Schiffes« in den Sinn. Doch dann, am späten Morgen, verlor das Schiff nach und nach an Fahrt. Das große, braune Segel hing schlaff am Mast, und die beiden Steuerleute, die links und rechts von uns an den Ruderpinnen standen, wechselten ängstliche Blicke. Schon bald zogen sich am Horizont dichte schwarze Wolken zusammen, die sich keine Stunde später wie eine Falltür über uns schlossen. Es wurde fast nachtdunkel, die Temperatur fiel. Als der Wind wieder auffrischte, war die See viel rauer als zuvor, aber diesmal peitschten die Böen uns die kalte Gischt von der Wasseroberfläche ins Gesicht. Hagelkörner prasselten auf das schwankende Deck.
Cicero fing an zu zittern, dann beugte er sich vor und übergab sich. Sein Gesicht war aschgrau. Ich legte ihm einen Arm um die Schulter und bedeutete ihm, dass es besser sei, in die Kabine zu gehen. Wir waren die Leiter halb hinuntergestiegen, als das Halbdunkel von einem Blitz zerrissen wurde, dem eine Sekunde später ein ohrenbetäubendes, widerwärtiges Krachen folgte, das sich wie ein brechender Knochen oder ein splitternder Baumstamm anhörte. Ich war mir sicher, dass wir den Mast verloren hatten, denn plötzlich wurden wir hin und her geschleudert. Im Licht der Blitze türmten sich pechschwarz glänzende Berge auf und kippten wieder weg. Das Kreischen des Windes machte es unmöglich, zu sprechen oder etwas zu verstehen. Kurz entschlossen stieß ich Cicero in die Kabine, eilte hinter ihm her und schlug die Tür zu.
Wir versuchten aufzustehen, aber das Schiff hatte Schlagseite, und der Boden stand knöcheltief unter Wasser, sodass wir immer wieder ausrutschten. Das Schiff kippte von einer Seite auf die andere. Wir versuchten, uns an den Wänden festzuhalten, rutschten aber weiter mit losen Werkzeugen, Weinkrügen und Gerstensäcken im Dunkeln hin und her wie hilfloses Vieh, das in seinen Holzverschlägen auf dem Weg ins Schlachthaus war. Schließlich zwängten wir uns in eine Ecke und blieben dort durchnässt und zitternd liegen, während das Schiff uns weiter durchschüttelte. Ich hielt unser Ende für gekommen, schloss die Augen und flehte Neptun und alle Götter an, dass sie uns erretten mögen.
Eine lange Zeit verging. Wie lange, kann ich nicht sagen – sicherlich den Rest des Tages, die ganze Nacht und einen Teil des folgenden Tages. Cicero lag bewusstlos neben mir. Hin und wieder berührte ich seine kalte Wange, um mich zu vergewissern, dass er noch lebte. Jedes Mal öffnete er kurz die Augen und schloss sie gleich wieder. Er habe sich schon damit abgefunden gehabt zu ertrinken, sagte er später, nur sei er so elendig seekrank gewesen, dass er keinerlei Angst verspürt habe. Vielmehr habe er erkannt, dass die Natur in ihrer Barmherzigkeit dem Sterbenden die Schrecken der Vernichtung ersparte und den Tod wie eine willkommene Erlösung erscheinen ließ. Fast die größte Überraschung seines Lebens sei es für ihn gewesen, als er am zweiten Tag aufgewacht sei und erkannt habe, dass der Sturm vorbei war und er sein Leben fortsetzen konnte. »Unglücklicherweise befinde ich mich aber in einer so erbärmlichen Lage, dass ich es fast bedauere.«
Als wir uns sicher waren, dass der Sturm sich endgültig gelegt hatte, gingen wir wieder an Deck. Die Seeleute warfen gerade die Leiche eines armen Teufels über Bord, dem eine ausschwingende Spiere den Kopf zerschmettert hatte. Die Adria war ölig glatt und ruhig, so grau wie der Himmel, und die Leiche versank fast ohne einen Spritzer. Im kalten Wind lag ein Geruch, den ich nicht genau bestimmen konnte, es roch nach Verrottung, nach Verwesung. Etwa eine Meile voraus sah ich eine Wand aus blankem, schwarzem Fels aus dem Wasser ragen. Ich nahm schon an, der Sturm hätte uns zurückgetrieben, zurück nach Italien. Aber der Kapitän lachte nur über meine Unwissenheit und sagte, das sei die illyrische Küste, das seien die berühmten Felsen, die die Zufahrt zur antiken Stadt Dyrrhachium bewachten.
•
Anfangs hatte Cicero vorgehabt, nach Epirus weiterzureisen, eine Gebirgslandschaft südlich von Dyrrhachium, wo Atticus ein großes Anwesen besaß, zu dem auch ein befestigtes Dorf gehörte. Es handelte sich um eine überaus triste Region, die sich nie von der schrecklichen Strafe erholt hatte, die der Senat hundert Jahre zuvor über sie verhängt hatte. Weil sie sich gegen Rom gestellt hatten, waren alle siebzig Städte dem Erdboden gleichgemacht und alle einhundertfünfzigtausend Bewohner als Sklaven verkauft worden. Trotzdem behauptete Cicero, dass ihn die Einsamkeit eines derart öden Fleckens nicht gestört hätte. Kurz bevor wir Italien verließen, hatte Atticus jedoch Cicero mitgeteilt, dass er zu seinem »großen Bedauern« höchstens einen Monat bleiben könne, sonst würde seine Anwesenheit bekannt und er selbst könnte nach Paragraph zwei von Clodius’ Gesetz wegen Beherbergung eines Verbannten zum Tode verurteilt werden.
Sogar als wir in Dyrrhachium an Land gingen, war Cicero noch unentschieden, wohin er reisen wollte – nach Epirus im Süden, wo er nur vorübergehend Unterschlupf finden konnte, oder nach Macedonia im Osten, wo sein alter Freund Appuleius Saturninus Statthalter war, und von da weiter nach Griechenland und Athen. Die Entscheidung wurde ihm schließlich abgenommen. Am Kai wartete ein Bote auf ihn – ein sehr nervöser junger Mann. Er schaute sich nach allen Seiten um, ob uns auch niemand beobachtete, dann zog er uns schnell in ein verlassenes Lagerhaus und überreichte uns einen Brief. Er war von Statthalter Saturninus. Er befindet sich nicht in meinem Archiv, da Cicero ihn mir, nachdem ich ihn vorgelesen hatte, wegnahm und zerriss. Dennoch erinnere ich mich noch genau an seinen Inhalt. Saturninus müsse ihm zu seinem »großen Bedauern« (wieder diese Floskel!) und trotz ihrer jahrelangen Freundschaft mitteilen, dass er Cicero nicht in seinem Haus aufnehmen könne, da es »mit der Würde eines römischen Statthalters unvereinbar ist, einem verurteilten Verbannten Beistand zu leisten«.
Hungrig, ausgelaugt, die Kleidung noch klamm von der Überfahrt, sank Cicero auf einem Stoffballen zusammen und schlug die Hände vors Gesicht. Der zerrissene Brief lag zu seinen Füßen. In diesem Augenblick sagte der Bote nervös: »Herr, ich habe noch einen zweiten Brief …«
Er war von einem untergeordneten Beamten des Statthalters, dem Quästor Gnaeus Plancius. Seine Familie waren alte Nachbarn von Ciceros Stammsitz in Arpinum. Plancius schrieb, dass sein Brief geheim sei und dass er ihn mit demselben Boten schicke, da dieser vertrauenswürdig sei; dass er mit der Entscheidung seines Vorgesetzten nicht einverstanden sei; dass es ihm eine Ehre sei, dem Vater des Vaterlandes seinen Schutz anzubieten; dass Geheimhaltung überlebenswichtig sei; dass er schon auf dem Weg zur Grenze Macedonias sei, um ihn dort zu treffen; und dass eine Kutsche bereitstehe, um Cicero umgehend und im Interesse seiner persönlichen Sicherheit aus Dyrrhachium herauszuschaffen. Ich ersuche Euch dringend, Eure Abreise keine Stunde länger hinauszuzögern. Näheres unter vier Augen.
»Vertraut Ihr ihm?«, fragte ich.
Cicero schaute auf den Boden und erwiderte mit leiser Stimme: »Nein. Aber habe ich eine Wahl?«
Mithilfe des Boten organisierte ich, dass unser Gepäck vom Schiff zur Kutsche des Quästors gebracht wurde – ein trostloses Vehikel, kaum besser als eine Gefängniszelle auf Rädern, ohne Federung und mit Metallgittern vor den Fenstern, sodass ein fliehender Fahrgast zwar hinausschauen, von außen aber nicht gesehen werden konnte. Wir rumpelten vom Hafen in die Stadt und reihten uns in den Verkehr auf der Via Egnatia ein, der großen Überlandstraße, die bis nach Byzantium führte. Es fing an zu graupeln. Ein paar Tage zuvor hatte ein Erdbeben die Gegend erschüttert, die in dem Schneeregen ein erbärmliches Bild abgab. Leichen lagen aufgereiht am Straßenrand, hier und da waren kleine Gruppen Überlebender zu sehen, die sich zwischen den Ruinen in provisorischen Zelten drängten oder zusammengekauert an rauchenden Feuern saßen. Es war dieser Geruch nach Zerstörung und Verzweiflung, den ich draußen auf dem Meer gerochen hatte.
Wir durchquerten die Ebene, hielten auf die schneebedeckten Berge zu und übernachteten in einem kleinen Dorf, das zwischen bedrohlich aufragenden Gipfeln eingeklemmt war. Das Gasthaus war verdreckt, in den Räumen im Erdgeschoss liefen Ziegen und Hühner herum. Cicero aß wenig und sprach nichts. In dem fremden, öden Land mit seinen wild aussehenden Menschen war er schließlich in tiefe Verzweiflung verfallen. Am nächsten Morgen konnte ich ihn nur unter Mühen zum Aufstehen bewegen und überreden, die Reise fortzusetzen.
Zwei Tage lang führte die Straße hinauf in die Berge, bis wir einen großen See erreichten, dessen Ufer von Eis gesäumt war. Auf der anderen Seite befand sich der Ort Lychnidus, der die Grenze zu Macedonia markierte. Hier, auf dem Forum, erwartete uns Plancius. Er war Anfang dreißig, kräftig gebaut, trug militärische Uniform und wurde von einem Dutzend Legionären begleitet. Als sie sich plötzlich in Bewegung setzten und auf uns zumarschierten, geriet ich kurz in Panik und befürchtete, dass wir in eine Falle getappt waren. Aber die Wärme, mit der Plancius Cicero umarmte, und die Tränen in seinen Augen überzeugten mich sofort, dass er ein aufrichtiger Mensch war.
Er konnte sein Entsetzen über Ciceros Aussehen nicht verbergen. »Ihr braucht Ruhe, um wieder zu Kräften zu kommen«, sagte er. »Aber unglücklicherweise müssen wir gleich wieder aufbrechen.« Und dann erzählte er uns, was er nicht gewagt hatte, uns in seinem Brief mitzuteilen. Ihn hätten zuverlässige Informationen erreicht, dass drei der Verräter, die Cicero für ihre Rolle bei der Verschwörung des Catilina ins Exil geschickt hatte, auf der Suche nach ihm seien. Autronius Paetus, Cassius Longinus und Marcus Laeca hätten geschworen, ihn umzubringen.
»Dann gibt es auf der Welt keinen sicheren Ort mehr für mich«, sagte Cicero. »Wie sollen wir überleben?«
»Wie gesagt, unter meinem Schutz. Kommt mit mir nach Thessalonica, unter meinem Dach seid Ihr sicher. Bis zum letzten Jahr war ich Militärtribun, und ich stehe immer noch im aktiven Dienst. Es werden also Soldaten zu Eurem Schutz bereitstehen, solange Ihr Euch innerhalb der Grenzen Macedonias aufhaltet. Mein Haus ist kein Palast, aber es ist sicher und steht Euch zur Verfügung, solange Ihr es benötigt.«
Cicero schaute ihn an. Abgesehen von Flaccus’ Gastfreundschaft, war das seit Wochen – ja, seit Monaten – das erste echte Hilfsangebot. Dass es von einem jungen Mann kam, den er kaum kannte, während alte Verbündete wie Pompeius sich von ihm abgewandt hatten, berührte ihn tief. Er wollte etwas sagen, aber die Worte blieben ihm im Hals stecken, und er musste den Blick abwenden.
•
Die Via Egnatia führte einhundertfünfzig Meilen über die Berge Macedonias, dann hinunter in die Ebene von Amphaxis und bis zum Hafen von Thessalonica, wo die Reise schließlich endete – im Norden der Stadt, in einer einsamen Villa abseits einer belebten Durchgangsstraße, zwei Monate nach unserer Flucht aus Rom.
Fünf Jahre zuvor war Cicero der unumstrittene Herrscher über Rom gewesen, in der Zuneigung der Menschen nur übertroffen von Pompeius Magnus. Jetzt hatte er alles verloren – Ruf, Stellung, Familie, Besitz, Land und seinen Seelenfrieden. Aus Sicherheitsgründen konnte er die Villa tagsüber nicht verlassen. Seine Anwesenheit wurde geheim gehalten, am Eingangstor wurde eine Wache postiert. Dem Personal erzählte Plancius, sein anonymer Gast sei ein alter Freund, der an tiefer Trauer und Melancholie leide. Wie alle guten Lügen hatte das den Vorzug, wahr zu sein. Cicero aß und sprach wenig und verließ fast nie sein Zimmer. Seine Weinkrämpfe waren manchmal im ganzen Haus zu hören. Er empfing keine Besucher, sogar seinen Bruder Quintus, der nach Beendigung seiner Amtszeit als Statthalter von Asia auf der Rückreise nach Rom war, musste ich abwimmeln. Du würdest deinen Bruder nicht wiedererkennen, schrieb er ihm entschuldigend. Er ähnelt in nichts dem Mann, den du kennst, er ist ein Schatten seiner selbst.
Ich tat mein Bestes, Cicero aufzumuntern, aber ohne Erfolg. Wie konnte ich, ein Sklave, seinen Verlust begreifen, ich, der ich nie etwas von Wert besessen hatte, was ich hätte verlieren können? Rückblickend weiß ich, dass meine Versuche, ihm Tröstung durch die Philosophie zu verschaffen, seinen Kummer nur noch verstärkten. Als ich es einmal mit dem Argument der Stoa versuchte – wenn allein die Tugend glücklich mache, dann seien Besitztümer und Stellung nicht vonnöten –, schleuderte er mir einen Schemel an den Kopf.
Wir waren zu Frühlingsanfang in Thessalonica angekommen. Ich machte es mir zur Aufgabe, Briefe an Ciceros Familie und Freunde zu schreiben, sie vertraulich über sein Versteck zu informieren und sie zu bitten, ihm unter Plancius’ Adresse zu schreiben. Diese Botschaften benötigten drei Wochen bis Rom, und es dauerte weitere vier Wochen, bis die ersten Antworten eintrafen. Die Nachrichten, die sie enthielten, waren alles andere als ermutigend. Terentia berichtete, dass man die verkohlten Mauern ihres Hauses auf dem Palatin niedergerissen habe, sodass auf dem Grundstück – welche Ironie! – Clodius’ Schrein zu Ehren der Freiheitsgöttin Libertas errichtet werden konnte. Die Villa in Formiae war gebrandschatzt, und auch der Landsitz in Tusculum war geplündert worden. Dort hatten Nachbarn sogar einige der Bäume aus dem Garten abtransportiert. Ohne Dach über dem Kopf hatte Terentia zunächst Zuflucht bei ihrer Schwester im Haus der Vestalinnen gefunden.
Aber dieser gottlose Lump Clodius ist unter Missachtung aller heiligen Gesetze in den Tempel eingedrungen und hat mich zur Basilica Porcia gezerrt, wo er die Frechheit besaß, mich vor dem Mob über meinen eigenen Besitz auszufragen. Natürlich habe ich mich geweigert zu antworten. Dann forderte er von mir, ihm unseren kleinen Sohn als Geisel für mein Wohlverhalten auszuliefern. Zur Antwort zeigte ich auf das Gemälde, dass Valerius bei seinem Sieg über die Karthager zeigt, und erinnerte ihn daran, dass meine Vorfahren in ebenjener Schlacht gekämpft haben. Meine Familie, die sich nie vor Hannibal gefürchtet habe, werde sich nun gewiss nicht von ihm einschüchtern lassen.
Die Notlage seines Sohnes erregte Cicero am meisten: »Die oberste Pflicht eines Mannes ist es, seine Kinder zu beschützen, und ich sitze hier und bin machtlos.« Marcus und Terentia fanden schließlich Unterschlupf im Haus von Ciceros Bruder, während seine angebetete Tochter Tullia bei ihren Schwiegereltern unterkam. Wie ihre Mutter, so versuchte auch Tullia, ihre Schwierigkeiten herunterzuspielen, und doch konnte man zwischen den Zeilen die Wahrheit leicht herauslesen: Sie pflegte ihren kranken Ehemann, den sanftmütigen Frugi, dessen Gesundheit noch nie die beste gewesen war und dem die Belastung ganz offensichtlich zusetzte. O meine Geliebte, mein Herz verlangt nach dir, schrieb Cicero an seine Frau. Der Gedanke, dass du, liebste Terentia, einst Schirm und Schutz für jede unglückliche Seele, nun so gequält wirst … Tag und Nacht sehe ich dein Bild vor mir … Lebt wohl, meine fernen Lieben, lebt wohl.
Die politischen Aussichten waren genauso trübe. Clodius und seine Anhänger hielten nach wie vor den Tempel des Castor in der südlichen Ecke des Forums besetzt. Sie nutzten ihn als ihr Hauptquartier und konnten so die Abstimmungen durch Einschüchterung beeinflussen und nach Belieben jeden Gesetzesantrag durchdrücken oder blockieren. Unter anderem erfuhren wir von einem neuen Gesetzesantrag, in dem die Annektierung Zyperns und die Besteuerung seines Reichtums »zum Wohle des römischen Volkes« – im Klartext, für das Gratisgetreide, das Clodius an jeden Bürger ausgab – verlangt und Marcus Porcius Cato mit der Ausführung dieses Gaunerstücks beauftragt wurde. Natürlich wurde der Antrag verabschiedet. Welche Wählergruppe hätte jemals eine Steuer abgelehnt, die jemand anderes belastete, besonders wenn sie auch noch einem selbst zugutekam? Cato hatte sich zunächst geweigert. Aber Clodius drohte ihm mit Strafverfolgung, wenn er dem Gesetz nicht gehorche. Da Cato die Verfassung heilig war, glaubte er keine andere Wahl zu haben. Er segelte mit seinem jungen Neffen Marcus Junius Brutus nach Zypern, und damit hatte Cicero seinen wortgewaltigsten Anhänger in Rom verloren.
Gegen Clodius’ Einschüchterungen war der Senat machtlos. Sogar Pompeius Magnus (»der Pharao«, wie Cicero und Atticus ihn unter vier Augen nannten) begann nun den übermächtigen Volkstribunen zu fürchten, den Caesar mit seiner Hilfe installiert hatte. Es gingen Gerüchte um, dass er die meiste Zeit mit seiner jungen Frau Julia, der Tochter Caesars, im Bett lag, während sein öffentliches Ansehen immer mehr abnahm. Um Cicero aufzuheitern, schrieb ihm Atticus Klatschbriefe über Pompeius, von denen einer erhalten geblieben ist.
Du erinnerst dich sicher noch, wie der Pharao vor ein paar Jahren den König von Armenia wieder auf seinen Thron gesetzt und dessen Sohn als Geisel mit nach Rom gebracht hat, um sicherzustellen, dass der alte Herr nicht aus der Reihe tanzt? Also, kurz nach deiner Abreise aus Rom wollte Pompeius den lästigen Burschen aus dem Haus haben und quartierte ihn bei Lucius Flavius ein, dem neuen Prätor. Natürlich hat unser kleiner Schönling [so nannten Atticus und Cicero Clodius gern] schnell davon erfahren, hat sich bei Flavius zum Abendessen eingeladen und den Prinzen nach dem Essen einfach mitgenommen. Warum, höre ich dich fragen. Weil Clodius sich entschlossen hatte, den Prinzen anstelle seines Vaters auf den Königsthron von Armenia zu setzen und Pompeius die Reichtümer des Landes wegzuschnappen und sich selbst einzuverleiben. Unfassbar. Aber es kommt noch besser. Der Prinz wird also per Schiff nach Hause geschickt. Er gerät in einen Sturm, muss wieder umdrehen und segelt in den Hafen zurück. Pompeius schickt Flavius sofort nach Antium, damit er ihm seine Nobelgeisel wieder zurückholt. Aber Clodius’ Leute warten schon, und in der Via Appia kommt es zum Kampf. Viele werden getötet, darunter auch Pompeius’ enger Freund Marcus Papirius.
Seitdem sieht es für den Pharao schlecht aus. Neulich, als er auf dem Forum war, um sich den Prozess gegen einen seiner Anhänger anzuschauen (Clodius stellt sie einen nach dem anderen vor Gericht), da hat Clodius mit einer Bande seiner Schläger einen Gesang angestimmt. »Wie heißt der notgeile Imperator? Wie heißt der Mann, der so dringend einen Mann sucht? Wie heißt der Mann, der sich mit einem Finger am Kopf kratzt?« Nach jeder Frage schwang er die Falten seiner Toga hin und her – so wie es der Pharao macht –, und der Mob brüllte wie ein Zirkuschor den Namen: »Pompeius!«
Im Senat rührt keiner einen Finger, um ihm zu helfen. Alle glauben, dass er die Schmach redlich verdient hat, weil er dich im Stich gelassen hat …
Aber wenn Atticus glaubte, solche Nachrichten hätten Cicero getröstet, so täuschte er sich. Im Gegenteil, er fühlte sich dann nur noch isolierter. Cato nicht mehr in Rom, Pompeius eingeschüchtert, der Senat machtlos, die Wähler bestochen und Clodius’ Pöbel als Gesetzgeber – Cicero verzweifelte an der Aussicht, dass sein Exil vielleicht nie rückgängig gemacht würde. Er haderte mit den Umständen, unter denen wir zu leben gezwungen waren. Für einen kurzen Aufenthalt im Frühling mochte Thessalonica ja ganz schön sein. Aber als die Monate dahingingen und der Sommer kam, wurde aus Thessalonica ein Höllenschlund. Die Luft war feucht. Mückenschwärme überfielen uns. Nicht der leiseste Windhauch rührte sich, und die Mauern der Stadt speicherten die Hitze noch, sodass die Nächte mitunter drückender waren als die Tage. Ich schlief im Zimmer neben Cicero – zumindest versuchte ich es. In meiner winzigen Zelle kam ich mir vor wie ein Spanferkel im Steinofen. Der Schweiß, der sich unter meinem Rücken sammelte, fühlte sich wie zerlaufenes Fleisch an. Oft hörte ich Cicero nach Mitternacht im Dunkeln herumstolpern, hörte, wie seine Tür sich öffnete, wie er mit nackten Sohlen über die Mosaikfliesen tapste. Dann schlich ich mich aus dem Zimmer und behielt ihn aus einiger Entfernung im Auge. Meist setzte er sich im Innenhof auf den Rand des ausgetrockneten Brunnens mit der von Staub verstopften Fontäne und schaute hinauf zu den leuchtenden Sternen, als könnte er an ihrer Konstellation ablesen, warum sein Glück ihn so grausam im Stich gelassen hatte.
Am nächsten Morgen rief er mich oft in sein Zimmer. »Tiro«, flüsterte er dann und umfasste fest meinen Arm. »Ich muss raus aus diesem Drecksloch. Ich verliere hier den Verstand, ich kenne mich selbst kaum noch.« Aber wohin konnten wir gehen? Er träumte von Athen oder vielleicht Rhodos. Aber Plancius wollte nichts davon wissen: die Gefahr eines Attentats sei sogar noch größer geworden, beschwor er Cicero, seit Gerüchte über seine Anwesenheit in der Gegend umgingen. Mit der Zeit kam mir der Verdacht, dass er es auch ein wenig genoss, einen so berühmten Menschen unter seinem Dach zu haben, und dass er uns deshalb nicht ziehen lassen wollte. Ich teilte Cicero meinen Verdacht mit, worauf er sagte: »Er ist jung und ehrgeizig. Vielleicht spekuliert er darauf, dass sich die Lage in Rom ändert und er politisch davon profitieren könnte, dass er mir Unterschlupf geboten hat. Wenn dem so ist, dann macht er sich etwas vor.«
Eines Spätnachmittags, als die grausame Hitze des Tages schon ein wenig nachgelassen hatte, ging ich mit einem Packen Briefe für Rom in die Stadt. Es war schwer, Cicero überhaupt dazu zu bringen, seine Korrespondenz zu beantworten. Und wenn er es tat, dann diktierte er meist nur eine Liste von Klagen. Ich stecke immer noch hier fest, habe niemand, mit dem ich reden, und nichts, worüber ich nachdenken kann. Für jemand, der so trübsinnig ist wie ich, könnte es keinen unpassenderen Ort geben, einen Schicksalsschlag ertragen zu müssen. Aber er schrieb wenigstens. Zusätzlich zu dem vertrauenswürdigen Durchreisenden, dem man hin und wieder Briefe mitgeben konnte, hatte ich eine Vereinbarung mit einem einheimischen macedonischen Kaufmann namens Epiphanes getroffen, der ein ImportExport-Geschäft mit Rom unterhielt und mir Kuriere vermittelte.
Wie die meisten Menschen in diesem Teil der Welt war er ein ehrloser Halsabschneider. Aber ich hoffte, dass die Summen, die ich ihm zahlte, ausreichten, seine Verschwiegenheit zu gewährleisten. Er besaß ein Lagerhaus am Hang über dem Hafen, in der Nähe der Porta Egnatia, wo über den dicht gedrängten Dächern immer ein rötlich grauer Schleier aus Staub hing, den der Verkehr auf der Straße zwischen Rom und Byzantium aufwirbelte. Auf dem Weg zu seinem Schreibzimmer überquerte man einen Hof, wo seine Wagen be- und entladen wurden. Und dort stand an jenem Spätnachmittag ein Streitwagen. Die Stangen ruhten auf Steinblöcken, die ausgespannten Pferde soffen geräuschvoll aus einem Wassertrog. Der Anblick war inmitten der üblichen Ochsenkarren so ungewöhnlich, dass ich zu dem Wagen ging und ihn mir genauer anschaute. Anscheinend hatte er eine rasante Fahrt hinter sich, jedenfalls war er so verdreckt, dass man seine ursprüngliche Farbe kaum noch erkennen konnte. Aber er war schnell und stabil, gebaut für den Krieg. Ich ging die Treppe hinauf ins Schreibzimmer und fragte Epiphanes nach dem Besitzer.
Er schaute mich mit einem spöttischen Grinsen an. »Seinen Namen hat er mir nicht gesagt. Nur, dass ich ein Auge auf den Wagen und die Pferde haben soll.«
»Ein Römer?«
»Ohne Zweifel.«
»Allein?«
»Nein, er war in Begleitung … ein Gladiator vielleicht. Jedenfalls beide jung und kräftig.«
»Wann sind sie gekommen?«
»Vor einer Stunde.«
»Und wo sind sie jetzt?«
»Wer weiß?« Er zuckte mit den Achseln und entblößte seine gelben Zähne.
Mir dämmerte eine furchtbare Erkenntnis. »Hast du meine Briefe geöffnet? Hast du mich beschatten lassen?«
»Mein Herr, ich bin schockiert … also wirklich …« Er breitete die Arme aus und richtete stumme, flehentliche Blicke an unsichtbare Geschworene. »Wie kann man nur auf so einen Gedanken kommen?«
Epiphanes! Für einen Mann, der seinen Lebensunterhalt mit Lügen bestritt, log er ausgesprochen schlecht. Ich drehte mich um, lief aus dem Zimmer und weiter die Stufen hinunter und verschnaufte keine Sekunde, bis ich unsere Villa sah, vor der nun zwei übel aussehende Gesellen herumlungerten. Als die beiden Fremden sich zu mir umdrehten, verlangsamte ich meinen Schritt. Ich konnte es förmlich riechen, dass man sie geschickt hatte, damit sie Cicero umbrachten. Einer hatte eine wulstige Narbe, die von der linken Augenbraue bis zum Kinn verlief. (Epiphanes hatte recht gehabt: ein Kämpfer, der geradewegs aus einer Gladiatorenkaserne kam.) Der andere hätte Hufschmied sein können – Vulcanus höchstpersönlich, nach seinem stolzierenden Gang zu urteilen. Er hatte sonnenverbrannte Waden und Unterarme, und das Gesicht war so schwarz wie das eines Nubiers. »Wir suchen das Haus, in dem Cicero wohnt«, rief er mir zu. Als ich den Ahnungslosen zu spielen versuchte, schnitt er mir das Wort ab. »Sag ihm, Titus Annius Milo aus Rom ist da und möchte ihm seine Aufwartung machen.«
•
In Ciceros Zimmer war es dunkel, die Kerze war aus Luftmangel erloschen. Er lag mit dem Gesicht zur Wand auf der Seite.
»Milo?«, wiederholte er mit ausdrucksloser Stimme. »Was ist das für ein Name? Ein Grieche?« Dann drehte er sich auf den Rücken und stützte sich auf einen Ellbogen. »Moment … heißt so nicht ein Volkstribun, der gerade gewählt wurde?«
»Genau das ist er. Er ist hier.«
»Aber warum ist er als gewählter Volkstribun nicht in Rom? In drei Monaten beginnt seine Amtszeit.«
»Er sagt, er will Euch sprechen.«
»Ziemliche lange Anreise für einen kleinen Plausch. Was wissen wir von ihm?«
»Nichts.«
»Vielleicht will er mich beseitigen.«
»Vielleicht. Er ist in Begleitung eines Gladiators.«
»Das macht ihn nicht gerade vertrauenswürdiger.« Cicero legte sich wieder auf den Rücken und dachte nach. »Was soll’s«, brummte er. »Ob ich tot bin oder lebe, wo ist der Unterschied.«
Er hatte sich so lange in der Dunkelheit verkrochen, dass ihn das Tageslicht blendete, als ich die Tür öffnete. Cicero hielt sich die Hände vor die Augen. Steifbeinig und abgemagert, die Haut wächsern, Haare und Bart grau und struppig – er sah aus wie eine lebende Leiche, die gerade ihrem Grab entstiegen war. Kein Wunder, dass Milo ihn nicht erkannte, als er auf meinen Arm gestützt den Raum betrat. Erst als er die vertraute Stimme hörte, die ihm einen guten Tag wünschte, holte unser Besucher tief Luft, drückte die Hand aufs Herz und senkte das Haupt. Dann verkündete er, dass dies der größte Augenblick und die größte Ehre seines Leben sei, dass er Cicero zahllose Male in den Gerichtshöfen und auf der Rostra habe reden hören, aber nie geglaubt hätte, den Vater des Vaterlandes jemals persönlich zu treffen, ganz zu schweigen davon, ihm – wie er zu hoffen wage – einen Dienst erweisen zu dürfen …
ENDE DER LESEPROBE