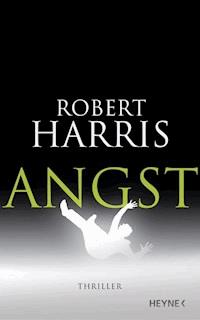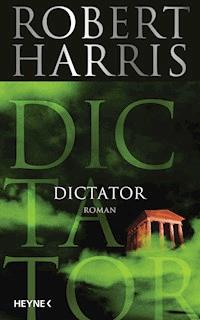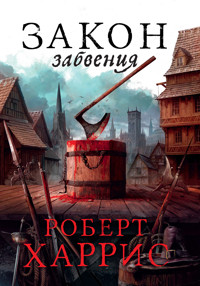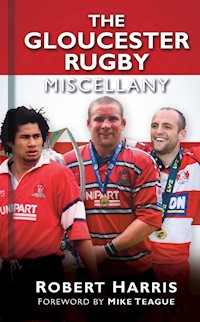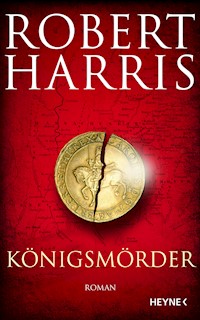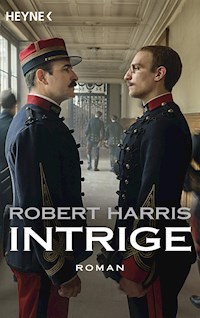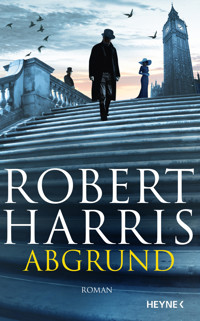
19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sommer 1914. Die Welt am Rande der Katastrophe.
In London hat die 26-jährige Venetia Stanley – aristokratisch, klug, unbekümmert – eine Affäre mit Premierminister H. H. Asquith, einem Mann, der mehr als doppelt so alt ist wie sie. Er schreibt ihr wie besessen Liebesbriefe und teilt ihr die heikelsten Staatsgeheimnisse mit.
Während Asquith das Land unfreiwillig in den Krieg gegen Deutschland führt, untersucht ein junger Geheimdienstoffizier die widerrechtliche Enthüllung streng geheimer Dokumente – und plötzlich wird aus einer intimen Affäre eine Angelegenheit der nationalen Sicherheit, die den Verlauf der politischen Geschichte verändern wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 600
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
ROBERT HARRIS
ABGRUND
ROMAN
Aus dem Englischen von Wolfgang Müller
Die Originalausgabe erscheint unter dem Titel Precipice bei Hutchinson, London
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2024 by Canal K
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München,in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Eisele Grafik·Design, München, unter Verwendung von © Arcangel (lee avison, Sacha Bloor), Figurestock, Getty Images (shomos uddin, deepblue4you, badlatitude, redhumv, O F Change), Shutterstock (Yodchai Prominn)
Satz: satz-bau Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-28477-0V002
FÜRGEORGEHARRISPARR – WILLKOMMEN
Übersicht
Inhaltsverzeichnis
Anmerkung des Autors
Teil eins
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
Teil zwei
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
Teil drei
KAPITEL 12
KAPITEL 13
KAPITEL 14
KAPITEL 15
KAPITEL 16
KAPITEL 17
KAPITEL 18
Teil vier
KAPITEL 19
KAPITEL 20
KAPITEL 21
KAPITEL 22
Teil fünf
KAPITEL 23
KAPITEL 24
KAPITEL 25
KAPITEL 26
KAPITEL 27
Teil sechs
KAPITEL 28
KAPITEL 29
KAPITEL 30
KAPITEL 31
KAPITEL 32
Historische Anmerkungen
Danksagungen
Sie wollen gleich weiterlesen? Unsere Empfehlungen für Sie…
Newsletter-Anmeldung
Anmerkung des Autors
Alle im Text zitierten Briefe des Premierministers sind – was erstaunen mag – authentisch, ebenso die Telegramme, Zeitungsberichte und offiziellen Dokumente wie auch der Briefwechsel zwischen Venetia Stanley und Edwin Montagu.
Die Briefe von Venetia Stanley an den Premierminister sind allerdings vollständig erfunden.
Paul Deemer ist ein fiktiver Charakter.
Teil eins
FRIEDEN
2. Juli bis 23. Juli 1914
KAPITEL 1
An einem Donnerstag Anfang Juli 1914 ging eine junge Frau am Spätvormittag mit nassem dunklen Haar vom Serpentine-See im Hyde Park mit großen Schritten auf der Oxford Street in Richtung Marylebone. In der einen Hand hielt sie einen cremefarbenen Sonnenhut aus Leinen, in der anderen ein marineblaues Handtuch, in das ein feuchter Badeanzug und ein Paar Seidenstrümpfe eingewickelt waren.
Obwohl sie es offensichtlich eilig hatte, verfiel sie nicht in einen Laufschritt – es war einfach zu heiß, und auf den Bürgersteigen herrschte schon dichtes Gedränge. Es hätte zudem nicht ihrer Art entsprochen, in der Öffentlichkeit körperliche Anstrengung zu zeigen. Aber sie ging, groß und schlank und aufrechten Kopfes, so schnell und zielstrebig, dass ihr die meisten Passanten unwillkürlich Platz machten.
Es war kurz nach Mittag, als sie um die Ecke in die Straße mit der georgianischen Häuserreihe bog, wo sich die Londoner Stadtresidenz ihrer Eltern befand. Am Straßenrand stand der Postbote, der seine Mittagszustellung gerade erledigt hatte und vor dem Eingang des herrschaftlichen weißen Stuckgebäudes seine Tasche inspizierte.
Glücklicherweise hatte sie es rechtzeitig geschafft.
Sie überquerte die Straße, wünschte dem Postboten einen schönen Tag, schlüpfte an ihm vorbei unter den Säulenvorbau und betrat durch die breite Tür das hochsommerlich stickige Halbdunkel der Eingangshalle.
Die Briefe lagen in ihrem Drahtkorb.
Sie konnte den vertrauten Umschlag gerade noch herauspicken, bevor der Diener aus den Tiefen des Hauses auftauchte, um die Post ihres Vaters zu holen. Sie verbarg den Brief unter ihrem Hut, reichte dem Diener den restlichen Stapel und war schon halb die Treppe nach oben gegangen, als ihre Mutter, Lady Sheffield, ihr aus dem Frühstückszimmer etwas zurief: »Wie war das Wasser, Liebling?«
Ohne stehen zu bleiben, rief sie zurück: »Himmlisch!«
Sie schloss ihre Zimmertür hinter sich, warf die Badesachen auf den Boden und den Hut auf den Toilettentisch, zog das Kleid über den Kopf und ließ sich aufs Bett fallen.
Sie lag rücklings da und hielt den Brief mit beiden Händen hoch.
An die ehrenwerte Venetia Stanley, 18 Mansfield Street, Portland Place, London, W.
Sie schob den Finger unter die Lasche, riss den Umschlag auf und zog ein dickes, einmal gefaltetes Blatt Briefpapier mit Datum des Tages heraus.
2. Juli 1914
Meine Stimmung ist heute Morgen doch um einiges besser – vor allem dank Dir. Ich hoffe, ich habe Dich gestern nicht über Gebühr deprimiert. Du warst sehr liebevoll und mitfühlend und hast mir wie immer geholfen. Ich bin Dir aufrichtig aus tiefstem Herzen dankbar. Vermutlich springst Du in diesem Augenblick in Gesellschaft von Lady Scott irgendwo ins Wasser. Vor mir liegt ein ziemlich trübseliger Tag, unter anderem habe ich um halb fünf eine Unterredung mit dem König. Ottoline hat mich für heute zum Abendessen gebeten, es ist also gut möglich, dass ich Dich dort zu sehen bekomme … Sei gesegnet, mein Liebling.
Keine Unterschrift. Seit kurzem ließ er Vorsicht walten und benutzte weder ihren noch seinen Namen.
Sie las den Brief noch einmal. Er erwartete sicher eine prompte Antwort und würde sich Sorgen machen, wenn sie ausbliebe, obwohl nichts von Bedeutung geschehen war, seitdem sie sich gestern gesehen hatten. Sie ging mit dem Brief zum Toilettentisch, setzte sich, betrachtete gleichgültig ihr Spiegelbild und nahm ein Blatt Papier. Sie schraubte die Kappe von ihrem Füllhalter, dachte kurz nach und begann dann schnell zu schreiben.
Ich bin gerade von einem belebenden Bad im Serpentine zurück. Gegen Kathleens kraftvolles Kraulen ist mein lahmes Brustschwimmen eine Schande. Bemerkenswerterweise haben wir es geschafft, eine ganze Stunde lang ihren verstorbenen Mann oder auch nur den Südpol mit keinem einzigen Wort zu erwähnen. Das muss ein neuer Rekord sein. Der See war herrlich kühl, wenn auch voller Leute. Was für ein Sommer – fast so heiß wie der vor drei Jahren! Ich bin so froh, dass Du wieder fröhlicher bist. Du wirst schon eine Lösung für diesen irischen Schlamassel finden. Das schaffst Du doch immer. Mein Liebster, ich kann heute Abend nicht zu Ottoline kommen, da ich Edward & dem Kosaken versprochen habe, mich ihrer mitternächtlichen Bootsfahrt von Westminster nach Kew anzuschließen. Du weißt, ich wäre viel lieber bei Dir. Aber wir sehen uns morgen. Alles Liebe.
Wie immer war ihre unverkennbar stilvolle Schrift allem Schreibtempo zum Trotz gestochen scharf. Auch sie unterschrieb nicht. Sie blies über die glänzende schwarze Tinte und schrieb die Adresse auf den Umschlag – An Herrn Premierminister, 10 Downing Street, London, SW. Dann klebte sie eine Pennymarke darauf und klingelte ihrer Zofe Edith, einer verlässlich diskreten Deutschschweizerin, und schickte sie zum Briefkasten. Im London des Jahres 1914 wurde die Post zwölfmal am Tag ausgetragen. Er würde den Brief am Nachmittag in Händen halten.
*
Seine Antwort traf abends um acht Uhr ein, als sie gerade die Treppe in die Halle hinunterging, um Maurice Baring zu begrüßen, ihren Begleiter für den Abend. Sie hörte das Klappern des Briefschlitzes. Aus den Augenwinkeln sah sie Edith zum Drahtkorb gehen.
»Hallo, Maurice, mein Lieber.« Sie streckte die Hand aus. Der reiche Vierziger neigte zur Glatze und war ein Literat, von dem 1905 Vergissmeinnicht und die Lilie im Tal erschienen war, ein modernes Märchen, das inzwischen leider Gottes vergessen war. Er trug Frack mit weißer Krawatte, im Knopfloch steckte eine rote Nelke. Als er sich zum Handkuss vorbeugte, strich ihr sein weicher Schnurrbart über das Handgelenk, und sie konnte den exquisiten Limonenduft der Haarpomade riechen. Beunruhigt über die modernen Sitten, denen ihre Tochter frönte, und zunehmend besorgt hinsichtlich deren Heiratsfähigkeit im Alter von knapp siebenundzwanzig Jahren, hatte Lady Sheffield sie vorher gefragt, ob sie sich in seiner Begleitung denn »sicher« fühle.
»Und wenn ich ein Jahr lang auf einer einsamen Insel nackt mit Maurice festsäße, Mama, ich wäre sicher.«
»Venetia!«
»Aber es stimmt doch!«
Edith wartete, bis ihre Herrin vor die Haustür trat, nestelte dann an deren Kleid herum und schob ihr dabei den Brief in die Hand. Venetia öffnete ihn, als sie neben Maurice im Fond seines Wagens saß. Eine offenbar um Viertel nach vier schnell hingekritzelte Notiz, was bedeutete, dass er sie verfasst hatte, kurz bevor er die Downing Street zum Treffen mit dem König verließ oder während er bereits im Palast auf die Audienz wartete.
Wenn irgend zu vermeiden, Geliebte, gehe nicht auf diese infernalische Bootsfahrt, sondern komm zu Ottoline. Könntest Du es nicht einrichten, schon zum Essen zu erscheinen? Das wäre so schön. Wenn nicht, freue ich mich aber, Dich danach dort zu sehen. Versuch es.
Ganz der Deinige
Sie runzelte die Stirn. Infernalische Bootsfahrt … Er könnte recht haben. Sie selbst hatte Bedenken, seit sie die Einladung angenommen hatte, wenn auch aus anderen Gründen. Nach ihrer Erfahrung war das Schlimme an Partys auf Schiffen, dass man sie zwar leicht betrat, es aber nicht annähernd so leicht war, dann wieder herunterzukommen, und es gab nur wenige Dinge, die sie so verabscheute wie das Gefühl, in der Falle zu sitzen.
Maurice hatte wohl ihren veränderten Gesichtsausdruck bemerkt. »Ärger mit einem Verehrer?«
»Du weißt nur zu gut, Maurice, dass ich keine Verehrer habe.«
»Oh, da wäre ich mir nicht so sicher …«
Sie achtete nicht sonderlich auf den Ton seiner Bemerkung und auch nicht auf das breite, anzügliche Grinsen dabei. Großer Gott, war sie schon eine so alte Jungfer, dass sogar Maurice einen Annäherungsversuch in Betracht zog?
Sie sagte: »Ich nehme an, dass es jetzt wohl zu spät ist, die Bootsfahrtgeschichte noch abzublasen und stattdessen zu Ottoline zu gehen, oder?«
»Was ist denn das für eine sonderbare Idee? Wir sind bei Ottoline doch gar nicht eingeladen. Und außerdem, die Bootsfahrt wird sicher amüsant. Alle werden da sein.«
Mit alle meinte er »die Koterie«, wie sie sich selbst nannten – oder »die korrupte Koterie«, wie die Presse sie zu bezeichnen pflegte. Dabei handelte es sich um etwa zwei Dutzend Freunde, die als Gruppe auftraten, manchmal im Café Royal, gelegentlich im Varieté oder bei einem Boxkampf im Eastend, meist aber in der »Höhle des goldenen Kalbs«, einem berüchtigten Kellernachtclub in der Nähe der Regent Street. Die genaue Zahl der Mitglieder schwankte gemäß einem mysteriösen Kollektivurteil, wonach jemand amüsant oder langweilig war.
»Genau«, sagte sie skeptisch. »Es werden wohl alle da sein.« Sie stopfte den Brief in ihre Handtasche und ließ die Schließe zuschnappen.
Sie gehörte nicht zu den tonangebenden Figuren der Koterie. Sie trank nicht wie Sir Denis Anson, der junge Baronet, der zwei Flaschen Champagner leeren konnte, noch bevor der Abend überhaupt begonnen hatte, und nahm auch keine Drogen wie Lady Diana Manners (»die schönste Frau in England«), die gern Chloroform schnüffelte. Sie war nicht intellektuell wie Raymond Asquith, dessen Vater, der Premierminister, den Brief in ihrer Handtasche geschrieben hatte, oder unabhängig, weil reich wie die erst achtzehnjährige Reederei-Erbin Nancy Cunard. Sie ließ sich mit ihnen treiben, um ihre Langeweile zu lindern, um ihre Mutter zu ärgern und weil nichts, was sie anstellten, sie schockieren konnte. Und sie hatten noch eine Eigenschaft, die sie anzog: nicht direkt Zynismus – obwohl Raymond, der älteste und geistreichste unter ihnen, ein Zyniker wie aus dem Buche war –, sondern mehr die eigentümliche Aura der Losgelöstheit vom Leben. Sie hatte unter ihnen das Gefühl, als ob nichts wirklich wichtig wäre: weder ihnen noch der Welt, noch gar ihr selbst. Ähnlich erging es auch den anderen.
In dieser vertrauten Stimmung von Gleichgültigkeit ergab sie sich allem, was die Nacht auch bieten mochte, glitt sie lautlos im luxuriösen Kokon von Maurice’ Rolls-Royce Silver Ghost dahin: als Erstes zu einem Dinner zu sechst in der russischen Botschaft am Belgrave Square mit dem »Kosaken« Constantin Graf von Benckendorff, dem Sohn des Botschafters, der die Bootsfahrt mit Raymonds Schwager Edward Horner organisiert hatte; und danach im Rolls zurück zum Fluss, wo sich die anderen nach ihren eigenen Abendessen einfanden – insgesamt sechzehn Gäste, die aus Privatwagen und Taxis quollen: Claud Russell und Alfred Duff Cooper, beide im diplomatischen Dienst im Außenministerium, jeder mit zwei Flaschen Bollinger unterm Arm, die sie von der Tafel von Duffs Mutter gerettet hatten; Duffs Schwester Sybil Hart-Davis; Mannequin und Schauspielerin Iris Tree, die sich zu allen möglichen Gelegenheiten ihrer Garderobe entledigte; der mit der Schwester des Kosaken verheiratete Barrister Jasper Ridley; und natürlich Raymond, seine Frau Katharine und deren Bruder Edward Horner, ebenfalls ein junger Anwalt …
Sie küssten und umarmten einander und plauderten in einem fort davon, wie sehr sie doch alle ihren Spaß hätten – die jungen Frauen in ihren unterschiedlichen Kleidern, so farbenprächtig wie Paradiesvögel, die Männer in ihrer monochromen Uniform aus schwarzem Frack, weißer Krawatte und Zylinder. Unter den Augen der neugierigen Zuschauerschar, die an der Brüstung lehnte, ergossen sie sich die Steinstufen vom Uferdamm zur Westminster Pier hinab. Unter ihnen Venetia, die ihr grünes Seidenkleid anhob, damit der Saum nicht über den Boden schleifte.
Das Schiff war ansehnlicher, als sie erwartet hatte, ein langer viktorianischer Vergnügungsdampfer, der Platz für fünfzig Passagiere bot und den Namen King trug. Ein hoher Schornstein erhob sich zwischen Vorder- und Achterdeck, auf denen farbig verspiegelte Lampions aufgespannt waren. Auf der schwarz schimmernden, öligen Flussoberfläche zersplitterten zitronen-, limonen- und rosafarbene Kugeln und fügten sich wieder zusammen. Es war eine heiße Nacht – hell und still mit einem halb vollen Mond. Durch die Fenster der Mittschiffskajüte sah sie einen Tisch, auf dem zwischen Eiskübeln voller Champagnerflaschen und flackernden Kandelabern ein Büfett angerichtet war. Das Quintett im Bug, das aus Musikern von Thomas Beechams Orchester in Covent Garden bestand, begann genau in dem Augenblick den Schlager des Sommers, »By the Beautiful Sea«, zu spielen, als Big Ben, dessen rundes Zifferblatt wie ein zweiter Mond gelb leuchtete, elf Uhr schlug.
Denis ging als Erster an Bord. Er lief die Gangway hinunter, packte einen der Pfosten, an denen die Lampions aufgehängt waren, und kletterte auf die Reling. Er kauerte kurz auf dem schmalen Geländer und richtete sich dann, schwankend zwischen Deck und Fluss, zu voller Größe auf und breitete die Arme aus, bis er das Gleichgewicht gefunden hatte. Die Zuschauer auf dem Uferdamm applaudierten. Er wandte sich unsicher um und bewegte sich wie ein Seiltänzer langsam in Richtung Heck, wobei er vorsichtig, Ferse an Zehen, einen Fuß vor den anderen setzte. Als er das Ende erreichte, drehte er sich zur Pier um. Eine Viertelminute stand er da – sein Schattenriss hob sich gegen den Fluss und die Lichter am Ufer gegenüber ab – und taumelte am Rand der Katastrophe.
»O Vinny, schau dir Denis an!«, sagte Diana. »Der kann doch nicht jetzt schon so betrunken sein.«
»Der ist sehr betrunken«, sagte Venetia. »Sonst würde er das nicht machen.«
Plötzlich warf er die Hände in die Luft, fiel hintenüber aufs Deck und verschwand aus dem Blickfeld. Alle lachten und johlten, nur Venetia nicht. Was für ein geistloser Nichtsnutz er doch war, dachte sie. In diesem Augenblick stand ihr Entschluss fest.
»Maurice, es tut mir furchtbar leid, aber ich fühle mich nicht wohl. Verzeihst du mir, wenn ich mich heimlich davonmache?«
»O nein, wirklich? Muss das sein? Was für ein Jammer …« Er schaute sich um. Die anderen gingen im Gänsemarsch an Bord. Sie wusste, dass er sich ihnen nur zu gern anschließen würde, aber zu sehr Gentleman war, sie allein zu lassen. »Ich gebe nur eben Bescheid, dann bringe ich dich nach Hause.«
»Nein, bleib du nur. Ich will dir nicht den Abend verderben. Darf ich deinen Fahrer bitten, mich nach Hause zu bringen?«
»Natürlich … Aber bist du dir wirklich sicher, dass …«
»Entschuldige mich einfach bei Conny und Edward, ja? Ich melde mich morgen bei dir.«
Sie merkte, dass sie selbst ein bisschen angetrunken war. Sie ging vorsichtig die Stufen hinauf und drehte sich auch nicht um, als Raymond ihren Namen rief: »Venetia!« Es klang in ihren Ohren wie eine Rüge. Sie fühlte sich gleichermaßen schuldig und beschwingt, als schliche sie sich in der Pause eines schlechten Theaterstücks davon. Hinter ihr stieß das Schiff ein kurzes, warnendes Tuten aus. Als sie den Uferdamm erreicht hatte und zurückschaute, hatte es sich schon ein Stück von der Pier gelöst. Sie stützte sich mit den nackten Ellbogen auf die kühle Steinbrüstung und sah ihm eine Weile hinterher – den Lampions und den auf dem Deck wuselnden Gestalten. Sie lauschte den Klängen der Kapelle, dem Lachen und dem Singen, das die sommerliche Luft klar zu ihr herübertrug:
By the sea, by the sea, by the beautiful sea,
You and I, you and I, oh how happy we’ll be …
Sie blieb, bis das Schiff unter der Westminster Bridge verschwand, dann machte sie sich auf die Suche nach Maurice’ Silver Ghost. Fünf Minuten später glitt sie die Parliament Street hinauf an der Zufahrt zur Downing Street vorbei. In der dunklen Seitenstraße leuchteten die roten Rücklichter eines Automobils, und ihr ging der Gedanke durch den Kopf, dass er vielleicht gerade vom Abendessen zurückkam. Sie dachte kurz daran, den Chauffeur halten und sie aussteigen zu lassen, verwarf den Gedanken aber sofort wieder. Sie war beschwipst. Vielleicht war es auch gar nicht er. Und selbst wenn, es schickte sich nicht.
KAPITEL 2
Die Nacht war kurz, die Luft warm, der Himmel ein fiebriges Sternenzelt. Als die Sonne am nächsten Morgen früh um 3 Uhr 45 über London aufging, war es, als wäre sie nie untergegangen.
Im dritten Stock der extravaganten viktorianisch-gotischen Trutzburg an der Themse in Westminster, bekannt als New Scotland Yard, befand sich in dem runden Türmchen an der südwestlichen Ecke das Dienstzimmer für die Nachtschicht der Metropolitan Police. Der diensthabende junge Detective Sergeant schaute von seiner Zeitung auf und bemerkte das Tageslicht, das an den Rändern der Holzfensterläden einsickerte.
Es war eine ruhige Schicht gewesen. Seine älteren Kollegen hatten ihren höheren Dienstrang geltend gemacht und waren nach und nach früher nach Hause gegangen, bis schließlich nur noch er zurückgeblieben war, um die Stellung zu halten. Die Luft in dem kleinen Büro war erdrückend, es roch nach abgestandenem Pfeifenrauch und Männerschweiß. Er schob den Fensterrahmen nach oben, klappte die Läden auf, stellte sich dann hemdsärmelig mit aufgeknöpfter Weste ans offene Fenster und betrachtete das herrliche Panorama: das blitzende Sonnenlicht auf dem den Gezeiten unterworfenen Fluss, die Sturzflüge der kreischenden Möwen über dem Uferschlick, die gewaltige, stumme Baustelle am gegenüberliegenden Ufer, wo eines Tages das neue Hauptquartier des London County Council stehen würde, den einzelnen roten Omnibus, der die Brücke von Waterloo in Richtung des Parlamentsgebäudes überquerte, und schließlich den Vergnügungsdampfer mit dem hohen Schornstein und den gelöschten Lampions, der direkt unter ihm an der Westminster Pier vertäut war.
Er sah traurig, grau, ermattet aus.
Auf dem Weg oberhalb des Schiffs sah er ein gutes Dutzend eleganter Gestalten, die regungslos auf dem Boden saßen, herumstanden oder an der Steinbrüstung lehnten – Männer in Frack und weißer Krawatte, Frauen in Abendkleidern und, wie es schien, ein Quartett Musiker mit ihren Instrumentenkästen. Die ganze Gruppe wurde von zwei uniformierten Polizisten beobachtet. Vier Automobile, davon eines ein Rolls-Royce, parkten auf dem Uferdamm. Die Fahrer standen rauchend beisammen.
Er hatte das wunderliche Tableau wohl einige Minuten lang betrachtet, ohne recht schlau daraus zu werden, als hinter ihm zum ersten Mal seit Mitternacht das Telefon klingelte.
Er trat vom Fenster zurück, nahm mit einer Hand den Fernhörer und der anderen den Einsprechtrichter und sprach sorgfältig in das Mikrofon. »Scotland Yard, Nachtdienst.«
»Und mit wem bitte spreche ich?« Eine blecherne Männerstimme am anderen Ende der knisternden Leitung. Der Anflug eines irischen Akzents.
»Detective Sergeant Paul Deemer. Wer spricht da?«
»Sehr schön, Detective Sergeant Paul Deemer, hier ist Superintendent Patrick Quinn am Apparat. Ich nehme an, Sie wissen, wer ich bin.«
»Jawohl, Sir.« Plötzlich war er ganz Aufmerksamkeit. Bei Quinn handelte es sich um den Chef der Special Branch, die unter anderem den bewaffneten Schutz prominenter Würdenträger versah. Zu Beginn seiner Laufbahn war er Königin Victorias Leibwächter gewesen. »Guten Morgen, Sir.«
»Ist ein Inspector anwesend?«
»Noch nicht, Sir. Der erste kommt nicht vor sechs.«
Quinn schnalzte mit der Zunge und sagte dann: »Also, hören Sie zu. Heute Nacht ist es zu einem tödlichen Unfall auf einem Flussdampfer gekommen. Zwei Männer werden vermisst, vermutlich ertrunken.«
»Ja, Sir.«
»An Bord waren auch der Sohn des Premierministers und der Sohn des russischen Botschafters. Man hat mir berichtet, das Schiff sei inzwischen zur Westminster Pier zurückgekehrt. Es heißt King.«
Deemer ging mit der Telefonapparatur zum Fenster. Die Gruppe war immer noch unten versammelt. »Ich glaube, ich kann es vom Büro aus sehen, Sir. Handelt es sich um die beiden Männer, die vermisst werden?«
»Nein, nein, die beiden sind Gott sei Dank wohlbehalten. Aber Sie verstehen sicherlich, warum man mich deshalb zu Hause aus dem Bett geklingelt hat.« Er schien darüber nicht sonderlich glücklich zu sein. »Ich brauche einen Beamten, der da runtergeht und die Sache in die Hand nimmt, der überprüft, dass die Umstände keinen Verdacht erregen, und der die Anwesenden nach Hause schickt, bevor dort irgendwelche Reporter auftauchen. Können Sie das für mich erledigen, Detective Sergeant Paul Deemer?«
»Ja, Sir.«
»Guter Mann. Informieren Sie mich gelegentlich, wie Sie vorangekommen sind. Und nicht vergessen, gehen Sie respektvoll vor.«
Bevor Deemer antworten konnte, hatte Quinn bereits aufgelegt.
Er nahm seine Jacke von der Stuhllehne und zog sie an, knöpfte sie zu, richtete im Spiegel über dem Kamin seine Krawatte, leckte sich über die Finger und glättete sein Haar und den Schnäuzer. Dann nahm er den Bowler vom Hutständer, verließ den Raum und ging mit schnellen, klackenden Schritten die drei Treppen nach unten. Eigentlich hätte er das Dienstzimmer nicht unbesetzt lassen dürfen, aber hier drehte es sich immerhin um den Befehl des Superintendenten. Außerdem war er beflissen und ehrgeizig. Die Tragödie, die gerade stattgefunden hatte, das ahnte er, bot ihm eine günstige Gelegenheit.
Er überquerte den Innenhof und trat leicht außer Atem hinaus auf den Uferdamm. Sein Herz pochte. Am Tor blieb er kurz stehen, um sich in einen angemessen ruhigen Zustand zu versetzen, überquerte dann die breite, leere Straße und ging an den Chauffeuren vorbei die Stufen zum Ufer hinunter. Zuerst zeigte er den beiden Wachtmeistern seinen Dienstausweis. Sie beäugten ihn recht skeptisch. Deemer hatte wiederholt festgestellt, dass es im Polizeidienst nicht gerade von Vorteil war, wenn man für sein Alter jünger aussah.
»Also dann«, sagte er mit forscher Stimme, die Autorität ausstrahlen sollte. »Es handelt sich hier um einen tragischen Vorfall. Haben Sie die Namen der vermissten Männer aufgenommen?«
Der ältere der beiden Beamten zog seinen Notizblock aus der Tasche. »Sir Denis Anson und ein William Mitchell.«
»Was ist vorgefallen?«
»Anson ist reingesprungen.«
»In die Themse?« Ein absurder Gedanke.
»Das andre Opfer, Mitchell, ist ihm hinterhergehechtet, um ihn zu retten, und dann selbst in die Bredouille geraten. War einer von den zur Abendbelustigung engagierten Musikern. Und ein dritter Gentleman, ein Mr Benck-en-dorff …« Er sprach den Namen aus, als wäre der irgendwie verdächtig, und zeigte mit dem Daumen auf einen jungen Mann, der mit um die breiten Schultern gewickelter Decke trübsinnig auf den Stufen saß. »Der ist dann auch reingesprungen, konnte die beiden aber nicht mehr erreichen, bevor sie untergegangen sind.«
Deemer machte sich Notizen. »Wo genau ist das passiert?«
»Höhe Battersea Bridge. Sie waren auf dem Rückweg.«
»Und wann?«
»Irgendwann kurz nach zwei.«
»Konnten die Leichen geborgen werden?«
»Die Wasserpolizei in Chelsea sucht noch nach denen.«
Deemer sah auf. »Es besteht also Hoffnung?«
»Eher nicht. Kapitän White meint, dass die Strömung im ablaufenden Wasser ziemlich stark war. Sie haben eine Stunde lang gesucht und dann aufgegeben. Schätze mal, wir können alle Mann nach Hause schicken. Kein Verbrechen, an dem Sie sich ein paar Sporen verdienen könnten, Sergeant.« Sein Kollege grinste süffisant.
»Haben Sie schon die Aussagen der Zeugen an Bord aufgenommen?«
»Mehr oder weniger. Nicht alle haben was gesehen – und die das haben, sagen alle das Gleiche.«
»Ich benötige nachher Ihre Notizen. Warten Sie hier.«
Er machte sich auf den Weg zu Benckendorff hinüber. Dort angekommen, ging er vor ihm in die Hocke.
»Alles in Ordnung, Sir? Ich bin von der Polizei. Soll ich einen Krankenwagen rufen?«
Der Russe hob den Kopf. Auf dem blassen Gesicht waren schwarze Streifen zu sehen. Wahrscheinlich Öl. Er stank nach fauligem Wasser. »Nein, ich bin nur erschöpft, das ist alles.«
»Sie waren sehr mutig, Sir.«
Benckendorff schüttelte den Kopf. »Nein, nein, mutig war der Musiker. Ich bin nicht mal in die Nähe gekommen. Eine derart starke Strömung ist mir noch nie untergekommen – als hätte mich ein Teufel an den Beinen gepackt, um mich nach unten zu ziehen …«
»Sie sollten nach Hause gehen, raus aus den nassen Kleidern und dann ins Bett. Wir werden Sie nicht länger aufhalten. Wer der Anwesenden ist Mr Asquith?«
Benckendorff bewegte leicht den Kopf und nickte zu einer Gestalt hin, die ausgestreckt auf dem Kai lag, die Beine übereinandergeschlagen, die Arme über der Brust verschränkt. Der Zylinder saß auf dem Gesicht, wie wenn der Liegende ungestört schlafen wollte.
Deemer ging zu ihm und hüstelte verlegen. »Sir?«
Der Mann bewegte eine Hand krebsartig über die Brust und nahm langsam den Hut vom Gesicht. Er hatte blondes Haar und ein weiches, glatt rasiertes, schmales Gesicht. Die Augen waren so blau wie der Himmel. »Ja?«
»Ich bin Detective Sergeant Deemer. Man hat mich geschickt, um sicherzustellen, dass es Ihnen gut geht.«
»Mir geht es gut, Sergeant. Mit geht es blendend, danke. Ich bin wirklich keiner von denen, um die Sie sich Sorgen machen sollten.« Er setzte sich auf und sah sich um. »Tja, schätze, wir bringen das lieber gleich hinter uns.« Er rappelte sich auf und klopfte den Schmutz vom Frack. »Jemand muss es Sir Denis’ Mutter beibringen. Am besten tue ich das. Vorher möchte ich aber noch meine Frau nach Hause bringen.«
»Verstehe.«
Inzwischen hatten sich die meisten aus der Partygesellschaft zu ihnen gesellt. Ein kleiner, rotgesichtiger Mann hatte seinen Mantel über die schmalen Schultern der Frau gelegt, die sich an seinem Arm festhielt.
»Lady Diana fühlt sich äußerst schwach und sollte sich unbedingt hinlegen«, sagte er. »Ich muss also darauf bestehen, dass Sie uns augenblicklich gehen lassen.«
»Sei kein Esel, Duff«, murmelte Raymond. »Das Prozedere stehen wir jetzt auch noch durch. Lass den Mann seine Arbeit machen.«
»Ich weiß, das ist einfach furchtbar, was Denis und diesem armen Geiger zugestoßen ist«, sagte die Frau zu Deemer. »Aber wir warten hier jetzt schon stundenlang.«
Sie hatte sehr große blaue, merkwürdig leere Augen, wie die einer Puppe. Deemer fragte sich, ob sie etwas genommen hatte.
Zustimmendes Gemurmel von den anderen Gästen. Ihre Einstellung, als hätten sie Anspruch auf eine besondere Behandlung, war ihm egal. Wäre es nach ihm gegangen, hätte er sie gern noch ein, zwei Stunden länger warten lassen. Aber Quinn hatte ihn nun einmal angewiesen, sie alle nach Hause zu schicken, bevor jemand von der Presse antanzte. Also sagte er: »Einverstanden, Sie können gehen«, und fügte hinzu, als sie sich schon umdrehten: »Aber möglicherweise müssen wir Sie später für ein paar Fragen noch einmal kontaktieren. Dafür benötige ich Name und Adresse aller Personen, die an Bord waren.«
»Ich habe die Gästeliste, wenn Ihnen das weiterhilft«, sagte einer der jungen Männer.
»Und wer sind Sie, Sir?«
»Edward Horner. Ich habe zusammen mit Graf Benckendorff den Dampfer gemietet.«
Er zog einen zerknüllten Papierbogen aus der Innentasche. Deemer überflog die Namensliste schnell und gab sie ihm dann mit einem Bleistift zurück.
»Wenn Sie bitte alle neben Ihrem Namen die Adresse notieren würden, bevor Sie gehen. Danke.«
Die Liste ging herum, und während alle entrüstet tuschelten, kritzelte jeder nachlässig seine Adresse auf das Papier. Wie blasiert sie doch waren! Wenn gerade ein Freund von ihm ums Leben gekommen wäre, dachte er, und die Leiche noch fehlte, dann wäre seine erste Priorität nicht, endlich nach Hause zu gelangen.
»Entschuldigen Sie bitte!« Er musste lauter sprechen und mit der Hand in der Luft wedeln, damit sie ihm ihre Aufmerksamkeit schenkten. »Eine letzte Frage, wo Sie alle noch da sind. Sir Denis ist aus eigenem Antrieb in den Fluss gesprungen, richtig? Es hat ihn also nicht jemand gestoßen.«
»Großer Gott«, rief der rotgesichtige Mann. »Was wollen Sie damit andeuten?«
»Nun ja, sein Verhalten erscheint mir doch ziemlich töricht. War er betrunken?«
»Ach was«, sagte Raymond bestimmt. »Er war nüchtern. Es war eine vollkommen bewusste Entscheidung seinerseits, ins Wasser zu springen.« Bildete sich Deemer das nur ein, oder wechselte der Mann dabei einen kurzen Blick mit Lady Diana? »Er war ein guter Schwimmer. Bevor er gesprungen ist, hat er seine Uhr und den Frack aufs Deck gelegt – fragen Sie den Kapitän. So war er eben. Letztes Jahr in Italien, da ist er durch den Canal Grande geschwommen.« Achselzuckend fügte er hinzu: »Unglücklicherweise ist London nicht Venedig.«
»Nein, Sir«, stimmte Deemer ihm höflich zu, obwohl er nie in Venedig gewesen war oder England auch nur je verlassen hatte. »Sicher nicht.«
Er schaute zu, wie sie Graf Benckendorff auf die Beine halfen und dann zusammen die Treppe hinaufgingen. Nachdem sich alle voneinander verabschiedet hatten und in ihren Wagen davongefahren waren, schickte er die beiden Wachtmeister auf ihr Revier, damit sie ihren Bericht verfassten, und wandte sich den vier überlebenden Musikern zu. Sie behaupteten, dass sie viel zu sehr mit ihrer Musik beschäftigt gewesen seien, als groß auf die Passagiere zu achten. Auf der Rückfahrt hätten sie mitbekommen, wie Anson über Bord gegangen sei, mit dem Spielen aufgehört und einen der Gäste rufen hören: »Denis, alles in Ordnung?« Und sie hätten den zurückrufen hören: »Schnell! Schnell!« Und da sei Mitchell aufgestanden und habe die Jacke ausgezogen. Die Gäste hätten alle wie gelähmt dagestanden.
»Ich hab noch gesagt, sei kein Vollidiot, aber er hat mich nicht beachtet«, sagte der Kapellmeister. »Er ist über die Reling rüber, und das war das Letzte, was ich von ihm gesehen hab. Der Mann hat einen kleinen Jungen. Erst ein Jahr alt.«
»Und Sir Denis Anson – war der nüchtern, soweit Sie das beurteilen können?«
Zum ersten Mal wirkte der Kapellmeister nicht mehr so überzeugt. »Darüber können wir nichts sagen, Sir. Wir waren nur für die musikalische Unterhaltung zuständig.«
Deemer nahm ihre Namen und Adressen auf und betrat dann das Schiff.
Kapitän William White war ein knapp sechzig Jahre alter, aus der Royal Navy ausgeschiedener Mann. Er führte Deemer auf dem Dampfer herum, von der Kajüte bis zum Achterdeck, wo die Musiker unter der inzwischen eingerollten Markise gespielt hatten. Er zeigte auf die Reling.
»Da ist der Gentleman rumgeturnt. Drei Mal ist er hochgestiegen, und jedes Mal habe ich ihn am Bein gepackt und gesagt, er soll da wieder runter. Als ich ihm dann kurz den Rücken zugekehrt hab, ist er wohl wieder hochgeklettert. Ich habe alle Maschinen gestoppt, aber da war er schon gut fünfzehn Schritt weit abgetrieben. Er wollte natürlich zurückschwimmen, aber die Strömung war einfach zu stark – bei ablaufendem Wasser erwischt einen auf dem speziellen Abschnitt die Strömung von der West London Railway Bridge her, die alles nach unten zieht. Das war der Augenblick, wo der Musiker ins Wasser gesprungen ist und nicht lange danach der Russe. Der muss ein verdammt guter Schwimmer sein. Und ein Wunder, dass wir es geschafft haben, ihm die Leine zuzuwerfen.«
»War Sir Denis Ihrer Meinung nach betrunken?«
Der Kapitän schaute auf das Deck. »Das weiß ich nicht.«
»Kommen Sie, Kapitän. Niemand, der nüchtern ist, springt um zwei Uhr nachts in die Themse. Was haben die denn alle getrunken?«
»Hauptsächlich Champagner. Sie haben in der Kajüte zu Abend gegessen.«
»Zeigen Sie mir den Ort.«
Der Kapitän führte ihn über das Schiff zurück. Der Esstisch war abgeräumt, das Tischtuch zusammengefaltet, das Geschirr in Kisten verstaut.
Deemer sah sich in der Kajüte um und runzelte die Stirn. »Sie sagen, sie haben Champagner getrunken?«
»Genau.«
»Wo sind die leeren Flaschen?«
»Die leeren Flaschen?« Der Kapitän setzte ein verwundertes Gesicht auf und rief nach draußen: »Mr Lewis!«
Der Bestmann erschien in der Tür. »Kapitän?«
»Was ist mit den ganzen Flaschen passiert?«
Lewis zögerte. »Die Männer haben sie nach dem Unfall über Bord geworfen, Sir.«
Es entstand eine Pause. Deemer klappte sein Notizbuch zu und steckte es in die Innentasche. »Also gut. Was genau ist hier passiert? Raus mit der Sprache, von Mann zu Mann, oder ich nehme Sie beide fest.«
White und Lewis schauten sich an. Schließlich machte White eine Handbewegung, als würfe er ein schlechtes Kartenblatt weg, und sagte: »Na los, erzählen Sie es. Sie haben es gesehen, nicht ich.«
»Es war eine Wette«, sagte Lewis. »Mr Asquith hat mit der hübschen Frau gewettet.«
»Lady Diana?«
»Er hat mit ihr um zehn Pfund gewettet, dass sie Anson nicht dazu bringen kann, rüber zum Ufer zu schwimmen. Ich hab nicht gehört, was genau sie zu ihm gesagt hat, aber er brauchte nicht groß überredet zu werden. Er hat ihr seine Jacke und seine Uhr gereicht und ist dann einfach … gesprungen.«
Deemer wandte sich an den Kapitän. »Haben Sie die Sachen?«
White verschwand und kam kurz darauf mit einem Frack und einer goldenen Taschenuhr zurück. Deemer durchsuchte die Jacke und nahm eine Brieftasche und einen Schlüsselbund heraus. Er öffnete die Uhr. Innen im Deckel war eine Inschrift eingraviert: Für Denis zum 21. Geburtstag. Nutze deine Zeit klug. In Liebe, Mama.
»Was für eine Verschwendung von Leben«, sagte er. »Von zwei Leben.«
»Von uns wissen Sie das aber nicht«, sagte der Kapitän.
Deemer war plötzlich sehr müde. Ohne ein weiteres Wort verließ er mit den Sachen des Vermissten die Kajüte, ging über die Gangway auf die Pier und schleppte sich dann die Stufen hinauf. Der Morgenverkehr auf dem Uferdamm und über die Westminster Bridge hatte eingesetzt, und es wurde bereits warm. Im Dienstzimmer angekommen, studierte er an seinem Schreibtisch die Gästeliste. Asquith, Manners, Baring, Cunard, Tree … Sie las sich wie der Gesellschaftsteil in der Zeitung. Ihm fiel auf, dass zwei Gäste, Russell und Duff Cooper, als Adresse das Außenministerium angegeben hatten. Die von Raymond und Katharine Asquith lautete 49 Bedford Square. Nur hinter einem einzigen Namen stand keine Adresse. Hinter dem von Venetia Stanley.
KAPITEL 3
Maurice hatte sie am frühen Morgen angerufen und ihr die Neuigkeit mitgeteilt. Seine nasale Stimme bohrte sich in ihren Kater: »Es hat leider einen entsetzlichen Unfall gegeben …«
Sie nahm die Nachricht ohne sonderliche Regung auf, und das schockierte sie weitaus mehr als die Tragödie selbst. Sie hörte Maurice zu und sagte die erwartbaren Dinge – »o nein, der arme Denis, das ist ja schrecklich«. Sie war sich ihrer distanzierten Reaktion bewusst. Was um Himmels willen war nur mit ihr los? Die Geschichte des Mannes, der beim Versuch, einen anderen Menschen zu retten, sein Leben weggeworfen hatte, machte sie weitaus betroffener, obwohl sie den Mann nicht einmal kannte. Sie empfand seine Tat als außerordentlich bemerkenswert – als heroisch, als geheimnisvoll. Ihre Fragen nach dem Musiker schienen Maurice zunehmend zu irritieren, der sich offensichtlich nicht damit abgegeben hatte, Genaueres über den Mann herauszufinden. »Ja, ja, natürlich, ganz deiner Meinung, es muss etwas unternommen werden, um seiner Familie zu helfen. Ich nehme an, die Ansons werden sich darum kümmern. Aber ehrlich, Venetia: Denis, der hatte noch sein ganzes Leben vor sich …«
»Was er getan hat, hört sich wirklich völlig verrückt an«, sagte sie. »Selbst für seine Verhältnisse. Was in aller Welt hat ihn da geritten?«
»Nun ja, unter uns …«
Unter dem Siegel der Verschwiegenheit erzählte er ihr von Raymonds Wette mit Diana und dass sie sich alle darauf verständigt hätten, nichts darüber zu sagen. »Du kannst dir ja vorstellen, was es für Raymonds politische Laufbahn bedeuten würde, wenn das in die Presse gelangt. Und was Diana betrifft, du weißt ja selbst, dass die Zeitungen sie nur zu bereitwillig als eine Art narzisstische Femme fatale beschreiben …«
»Wie die nur auf so einen Gedanken kommen können.«
»Jedenfalls bin ich froh, dass du von der ganzen Geschichte verschont geblieben bist.« Er gähnte. »Ich leg mich noch ein paar Stunden aufs Ohr. Kann ich dich später zum Tanztee bei Eddy abholen?«
»Tut mir leid, Maurice, ich habe schon andere Pläne.«
»Andere Pläne! Du hast immer andere Pläne.«
*
Im Lauf des Vormittags erreichte sie ein halbes Dutzend Anrufe von Mitgliedern der Koterie, die ihr alle ganz im Vertrauen die Sache mit Raymond und Diana erzählten. Ihre Berichte stimmten überein, nur die Höhe des Wettbetrags variierte: Manche sprachen von fünf, andere von zwanzig Pfund.
Am Nachmittag zog sie das schwarz-weiß gestreifte Satinkleid an, von dem sie wusste, dass es sein Lieblingskleid war, dazu einen runden, flachen Strohhut mit rotem Band. Kurz vor halb vier schlüpfte sie unbemerkt aus dem Haus und schlenderte in der warmen Sonne um die Ecke in Richtung Portland Place.
An der Kreuzung mit der New Cavendish Street rief ein Zeitungsjunge in traurig leierndem Cockney-Singsang die Schlagzeile des Evening Standard aus: »Themse-Tragödie: Baronet immer noch vermisst!« Sie sah zu, wie er zügig die Schlange seiner Kunden bediente, Zeitungen faltete und Münzen einsteckte. Zum ersten Mal spürte sie einen Anflug von aufrichtiger Trauer. Vortags um diese Zeit hatte Denis wahrscheinlich in seinem Club Karten gespielt, um Einsätze, die er sich mit seiner Apanage eigentlich nicht leisten konnte. Jetzt machte er Geld für einen grauenhaften Pressezaren.
Sie ging weiter die Straße hinunter und blieb dann am Randstein stehen. Sie wusste, dass er pünktlich sein würde: Das war er immer. Ein paar Minuten später bog die große Limousine, ein Sechs-Zylinder-Napier, an der Kirche All Souls um die Ecke. Die Karosserie war so auf Hochglanz poliert, dass sich die wenigen hochsommerlichen Wolken in der schwarzen Haube spiegelten, als der Wagen vor ihr zum Stehen kam. Der Chauffeur Horwood stieg aus und ging um den Wagen herum, um ihr den Schlag zu öffnen. Wie üblich vermied er jeden Augenkontakt.
Der geräumige Innenraum hinten war wie eine altmodische Equipage in Leder und Walnussholz ausgekleidet. Als sie einstieg, fiel ihr sofort auf, dass die Sichtblende der Trennscheibe, die den Fond vom Fahrer trennte, bereits heruntergezogen war. Die Tür schloss sich. Er beugte sich vor und drückte auf der Konsole vor ihm auf einen Knopf. Auf dem Armaturenbrett leuchtete ein Lämpchen auf, das Horwood anwies loszufahren. Während der Napier sich in Bewegung setzte, glitt Venetia über die Lederbank und küsste ihn auf die Wange.
Der Premierminister schaute sie lächelnd an. »Hallo, mein Liebling«, sagte er.
*
Mindestens einmal in der Woche unternahmen sie zusammen eine Spazierfahrt, gewöhnlich für anderthalb Stunden am Freitagnachmittag, entweder aufs Land oder einfach nur in London. Natürlich trafen sie sich auch oft zwischendurch, zum Lunch oder Dinner und an den Wochenenden auf dem Land, aber dann waren sie immer in Gesellschaft anderer Menschen. Der Wagen war der einzige Ort, wo sie sicher sein konnten, allein zu sein.
Liebte sie ihn? Sie wusste es nicht. Sie wusste, dass sie ihn lieber mochte als jeden anderen Mann, der ihr über die Jahre nachgelaufen war – lieber als den reizenden, aber hässlichen Edwin Montagu, Parlamentarier und Staatssekretär für Finanzen, der ihr bereits zweimal einen Antrag gemacht und sich sogar ein Haus in Westminster gekauft hatte in der Hoffnung, dort mit ihr zusammenleben zu können; lieber als Maurice »Bongie« Bonham-Carter, des Premierministers lediger Privatsekretär und Büroleiter, der sie geküsst und ihr leidenschaftliche Briefe geschrieben hatte; mehr als Raymond, der sie unzweideutig hatte wissen lassen, dass er einer Affäre mit ihr nicht abgeneigt sei; mehr als ihren stattlichen Schwager Major Anthony Henley, der das Gleiche angedeutet hatte; und ganz bestimmt lieber als Maurice Baring.
Sie mochte ihn für seine Güte, für seine Schlauheit, seine Berühmtheit und die Macht, die er mit leichter Hand zu tragen wusste. Ihr Vater hatte für die Liberalen im Parlament gesessen: Sie war inmitten von Gesprächen über Politik aufgewachsen. Jetzt war sie wahrscheinlich die bestinformierte Frau im Land. Und wenn sie ehrlich war, dann genoss sie den Kitzel – die Heimlichkeit, das Gesetzwidrige, das Risiko.
Wie üblich hatte er einige offizielle Akten mitgebracht, die er ihr zeigen wollte. Sie lagen auf dem Platz zwischen ihnen. Ihrer beider ineinander verschränkten Hände ruhten auf dem Ordner.
»Ich war krank vor Sorge«, sagte er. »Als du nicht bei Ottoline aufgetaucht bist, habe ich angenommen, dass du auf dieser vermaledeiten Dampferfahrt bist, Liebling. Ich wünschte, du hättest mir kurz Bescheid gegeben, dass alles in Ordnung ist.«
»Ich dachte, Raymond hätte es dir gesagt.«
»Hat er auch, aber ich hätte es gern von dir selbst gehört.« Er hob ihre Hand an seine Lippen und küsste sie. »Der arme Anson. Er war ein alberner Bursche, aber ich hab ihn gemocht – diese animalische Energie, wenn auch ohne jedes Ziel. Für seine Mutter ist es schrecklich.«
»Wie geht es Raymond?«
»Er ist aufgewühlt, aber bemüht, es nicht zu zeigen. Er macht sich hauptsächlich Sorgen wegen der Untersuchung. Er hat Angst, dass sie Diana als Zeugin vernehmen. Offenbar besteht die Herzogin von Rutland darauf, dem Untersuchungsrichter persönlich beizubringen, dass ihre Tochter zu schwach sei, als Zeugin auszusagen.«
»Ist das klug?«
»Nein. Aber es ist wichtig, dass sie nicht in den Zeugenstand gerufen wird. Auch für Raymond. Gott, was für ein Schlamassel!«
Er wandte sich grübelnd ab. Das Kinn sank ihm auf die Brust. Sie begriff, dass er von der Wette wusste – noch ein Problem, worum er sich zusätzlich zu allen anderen kümmern musste. Er hatte ein schönes Profil – ein edler Kopf, wie die Büste eines römischen Senators, mit dichtem grauen, nach hinten gekämmten Haar. Es reichte zwei Fingerbreit über den Kragen. Seine Frau hieß ihn immer, sich die Haare schneiden zu lassen, aber Venetia war der Ansicht, es verleihe ihm ein poetisches Aussehen, das zu ihm passe. Unter der gelassenen, Respekt einflößenden Maske verbarg sich ein romantisches, leidenschaftliches Wesen. Sie schaute an ihm vorbei durch das große Fenster auf die Passanten auf der Straße, die keine Ahnung hatten, wer da an ihnen vorbeifuhr: der Premierminister Hand in Hand mit einer Frau, die nicht einmal halb so alt war wie er. Wenn die wüssten – was gäbe das für einen Skandal! Plötzlich sah sie das Bild von Denis vor sich, wie er schwankend auf der Reling balancierte. Vielleicht waren sie sich gar nicht so unähnlich.
Sie fragte sich, wohin sie wohl diesmal fuhren. Er verriet es ihr nie im Voraus. Es machte ihm Spaß, sie zu überraschen.
»Reden wir über etwas anderes«, sagte sie. »Erzähl mir, was gerade los ist.«
»Erst du. Erzähl mir aus deinem Leben.«
»Aber mein Leben ist langweilig.«
»Nein, ist es nicht, nicht für mich.«
So seltsam es war, sie wusste, dass er es ernst meinte. Er war ein geselliger Mensch – zu gesellig, sagten seine Feinde. Im Gegensatz zu den meisten politischen Freunden ihres Vaters lockte er seine Mitmenschen gern aus der Reserve, hörte er lieber zu, als selbst zu reden, gab er Frauen den Vorzug vor Männern. Sein Charme lag darin, die schwerwiegendsten Angelegenheiten des Staates zu behandeln, als wären sie völlig belanglos, wohingegen er über die nebensächlichsten Belanglosigkeiten – Kleidung, Kartenspiel, Silbenrätsel, Golf, Poesie, beliebte Romane – mit der äußersten Ernsthaftigkeit diskutierte. Während also der Wagen um den Regent’s Park herum und dann durch Camden hindurch in Richtung Norden glitt, erzählte sie ihm von ihren Neffen und Nichten, und was Iris und Nancy so trieben, und was es Neues bei Selfridge’s gab, und was sie vielleicht am Abend auf dem Ball der Islingtons trüge – vorausgesetzt, der würde jetzt noch stattfinden. Das alles lenkte ihn ab und schien ihn aufzuheitern. Schließlich erreichten sie die Hampsteader Heide. Er drückte einen anderen Knopf auf der Konsole, woraufhin der Wagen angehalten wurde.
»Lass uns ein paar Schritte gehen«, sagt er. »Ich möchte dir etwas zeigen.«
Er öffnete selbst die Tür – Horwood blieb diskret sitzen – und ging hinten um den Wagen herum, um dann den Schlag auf ihrer Seite zu öffnen. Sie befanden sich in einer ruhigen, schmalen Straße, die im Schatten von Platanen, Pappeln und Linden lag. Einige wenige Leute gingen spazieren. Niemand erkannte ihn. Er deutete mit seinem Gehstock auf ein Haus.
»Dort hat Keats gelebt.«
Er schloss die Augen und rezitierte:
»O Sorgen, euch guten Morgen!
Ich dachte schon, den letzten Abschied fänd ich.
Doch munter bliebet ihr, die mich liebet;
Ach freundlich seid ihr mir und stets beständig …«
Er öffnete die Augen wieder, drehte sich um und deutete mit dem Stock jetzt auf das Haus gegenüber. »Und dort habe ich mit meiner ersten Frau gewohnt. Seit zwanzig Jahren bin ich nicht mehr hier gewesen.« Er bot ihr seinen Arm. Sie nahm ihn, und sie überquerten die Straße.
Das Haus war von der Straße zurückgesetzt, halb verborgen von den Obstbäumen im Vorgarten – georgianisch, weiß getüncht, gebogener Fenstersturz. Die Bienen summten in der orange Blüte. Die Stadt schien fünfzig Meilen entfernt zu sein.
»Was für ein hübsches kleines Haus.«
»Nicht wahr? Hier habe ich die glücklichste Zeit meines Lebens verbracht – als die Kinder klein waren und meine Anwaltspraxis gerade in Schwung kam.« Er hielt sich die Hand über die Augen und schaute blinzelnd zwischen den Bäumen hindurch. »Auf dem Rasen da hinter dem Haus habe ich mit den Jungs Kricket gespielt. Wir hatten kein Geld. Ich war völlig unbedeutend, gerade erst ins Parlament gewählt. Aber irgendwie war ich mir absolut sicher, dass eine großartige Zukunft vor mir lag. Ist das nicht seltsam? Die arme Helen hat das nicht mehr erlebt. Wohlgemerkt, sie hätte es gehasst. Sie liebte ihr Heim und die Kinder. Die Politik hat sie verachtet.«
»Dann war sie jedenfalls anders als Margot.«
»Kein Mann kann jemals mit zwei so unterschiedlichen Frauen verheiratet gewesen sein.«
»Sollen wir klingeln und fragen, ob wir uns ein bisschen umsehen dürfen? Die Besitzer haben bestimmt nichts dagegen.«
Er sah immer noch zum Haus. »Raymond war erst dreizehn, als sie gestorben ist. Beb war zehn. Oc acht, Violet vier. Cys war noch ein Baby. Fünf Kinder! Da hatte ich eine Menge zu bewältigen, denn kurz danach war ich auch schon Innenminister. Raymond war ein großartiger Junge. Ist natürlich auch ein großartiger Mann … Aber ich frage mich, ob er sich anders entwickelt hätte, wenn …« Er hielt inne und wandte sich zu ihr um. »Nein, Liebling, ich würde lieber nicht hineingehen, wenn es dir nichts ausmacht. Das war schon genug der Reise in die Vergangenheit für einen einzelnen Tag. Sollen wir nicht lieber im Park ein bisschen frische Luft schnappen?«
Sie gingen bis zum Ende der Straße und folgten dann ein paar Minuten lang einem Waldweg, wobei sie bummelnden Familien und einem Eisverkäufer auf einem Fahrrad begegneten, und erreichten schließlich einen von Hampsteads Teichen, wo sie sich auf eine Bank mit Blick aufs Wasser setzten. Sie hielten sorgsam Abstand und spielten ein von ihm erfundenes Spiel: Wer von ihnen kannte die meisten Wasservögel? Sie nannten abwechselnd eine Art … Sumpfhuhn, Stockente, Schwan, Haubentaucher, Lachmöwe … Er gewann, weil plötzlich eine Mandarinente vor ihnen auftauchte. »Die überleben hier nicht lange«, sagte er wehmütig. »Die Gewöhnlichen hacken auf ihnen herum. Sind zu exotisch für diese trübe Welt …«
Auf der Rückfahrt war er ungewohnt still. Er starrte auf die städtischen Straßen, die freudlos hell und staubig in der hochsommerlichen Hitze lagen. Nach einer Weile ließ sie seine Hand los und griff nach dem Aktenordner. Sie sah ihn um Erlaubnis bittend an.
Er nickte. »Natürlich, nur zu. Deshalb habe ich sie ja mitgebracht.«
Die Unterlagen drehten sich ausschließlich um Irland. Volkszählungsdaten, Karten des Nordens. Verschiedene Grafschaften, Städte, sogar kleine Dörfer, ein Flickenteppich in Dunkelrot, Blutrot und Rosarot. Je dunkler die Farbe, desto dichter die katholische Bevölkerung. Die Katholiken bestanden darauf, in Zukunft von Dublin regiert zu werden; ihre protestantischen Nachbarn lehnten es ab, das Vereinigte Königreich zu verlassen. Die Torys sicherten den Protestanten ihre Unterstützung zu, selbst wenn sie gegen die Regierung zu den Waffen griffen.
Allmählich wurde ihr vom Lesen in dem schaukelnden Wagen übel. Sie sah auf und bemerkte, dass er sie anschaute.
»Noch nie hatte ich es mit einem Problem zu tun, das mir so unlösbar erschienen ist – und ich habe mich in den letzten sechs Jahren weiß Gott mit einigen Schwierigkeiten herumschlagen müssen.«
»Kannst du die Entscheidung hinauszögern?«
»Wir haben sie schon so weit wie möglich aufgeschoben. Die Nationalisten haben uns unmissverständlich zu verstehen gegeben, wenn wir in dieser Sitzungsperiode gesetzlich nicht vollumfänglich die Homerule verfügen, dann entziehen sie uns ihre Unterstützung. Was heißt, dass wir der Mehrheit verlustig gehen und es zu Neuwahlen kommt, die wir wahrscheinlich verlieren werden. So oder so bedeutet das Bürgerkrieg.«
»Es wird sich schon eine Lösung finden. Darin bist du großartig.« Sie hielt ihm den Ordner hin.
»Behalt ihn. Gib ihn mir zurück, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Vielleicht fällt ja dir eine Lösung ein.«
»Das bezweifle ich.« Der Gedanke, dass ihr auf ihrem Bett in der Mansfield Street liegend eine Lösung für die Irlandfrage einfiele, war geradezu absurd. Das war ihm sicher auch klar, aber sie fand die Geste dennoch rührend. Sie strich ihm mit der Hand übers Haar. »Alles wird gut werden. Ich vertraue auf dich.«
Er legte den Arm sanft um sie. »Du weißt, dass ich mit niemand sonst so reden kann, ja? Was würde ich bloß tun, mein Liebling, wenn ich mich dir nicht mehr anvertrauen könnte?«
Sie fuhren Primrose Hill hinunter. In dem dichten Verkehr war der Wagen fast zum Stillstand gekommen. Ihr fiel auf, dass die Leute sich umdrehten und zum Wagen gafften.
»Moment«, sagte sie.
Sie löste sich aus seinen Armen, rutschte zur Beifahrerseite und zog die Sichtblende herunter. Er tat das Gleiche auf seiner Seite. Als Letztes kniete sie sich auf die Sitzbank und zog auch die Heckscheibenblende herunter. Jetzt waren sie vollkommen gegen fremde Blicke abgeschirmt, und sie wandte sich wieder ihm zu.
Sie hätten genauso gut in einer kleinen Wochenendwohnung in Paris oder Venedig sein können. Nur der Sonnenschein, der golden durch den gelblichen Seidenstoff drang, milderte das dunkle Innere ihrer privaten Welt.
*
Um zehn nach fünf – alles wieder schicklich zurechtgerückt – öffnete sie die Haustür ihres Elternhauses. Edith erwartete sie schon nervös in der Halle.
»Ein Herr erwartet Sie, Miss. Ich habe ihn ins Frühstückszimmer geführt.«
»Wer ist es denn? Hoffentlich nicht Mr Baring.«
»Nein, Miss.« Sie reichte Venetia die Karte.
Detective Sergeant Paul DeemerMetropolitan Police
New Scotland Yard
Sie drehte die Karte um, ob vielleicht auf der Rückseite eine Nachricht stand. »Du lieber Himmel! Was um alles in der Welt will der denn?«
»Das hat er nicht gesagt, Miss.«
Der Mann stand vor dem Kamin. Er war jünger, als sein Rang es vermuten ließ, etwa ihr Alter, und trug einen offensichtlich billigen, aber säuberlich gebügelten dunklen Anzug. Einige andere Dinge fielen ihr auf – die spiegelblanken schwarzen Schuhe, der Bowler in seiner Hand, der Bartschatten am Kinn, das auf eine gewöhnliche Art gute Aussehen.
»Ich bin Venetia Stanley. Was kann ich für Sie tun?«
»Guten Tag, Miss Stanley. Es tut mir leid, dass ich Sie behelligen muss. Ich ermittle in dem tragischen Unfall, der sich letzte Nacht auf dem Fluss ereignet hat.« Er zog einen Notizblock hervor. »Würden Sie mir bitte ein paar Fragen beantworten?«
»Eine Ermittlung?« Plötzlich überkam sie eine Ahnung von Gefahr, und sie wurde sich bewusst, dass sie immer noch den Regierungsordner in der Hand hielt. Sie drückte ihn sich an die Brust und verschränkte die Arme darüber. »Was gibt es da zu ermitteln?«
»Es ist nichts Schlimmes, seien Sie dessen versichert.« Er klappte den Notizblock auf. »Ich nehme die Aussagen aller Zeugen auf, aber Ihre fehlt uns noch. Sie haben sich heute Morgen von der Anlegestelle entfernt, ohne uns vorher Ihre Adresse zu hinterlassen.«
»Das liegt daran, dass ich heute Morgen nicht an der Anlegestelle war.«
»Wie das?«
»Weil ich gar nicht auf dem Boot war.«
Er schaute kurz verdutzt drein, dann hellte sich sein Gesicht wieder auf. »Ah, verstehe. Deshalb die Verwirrung. Mr Horner hat uns die Passagierliste gegeben, aber nicht erwähnt, wer davon auch tatsächlich an Bord gegangen ist. Das ist die Erklärung. Ich bitte um Entschuldigung.« Er neigte den Kopf leicht zur Seite und sah sie an. »Darf ich fragen, Miss Stanley, warum Sie nicht an Bord gegangen sind?«
Sie geriet gewöhnlich nicht so leicht in Verlegenheit, spürte aber, wie sie jetzt rot wurde. Sie drückte den Ordner fester an die Brust. »Es war spät. Und ich war müde. Da habe ich beschlossen, nach Hause zu fahren und zu Bett zu gehen.«
Warum hörte sie sich so schuldbewusst an? Wie lächerlich! Aber dem Mann schien nichts aufzufallen.
»Durchaus verständlich. Und eine weise Entscheidung, wie sich im Nachhinein herausgestellt hat. Sie haben sich eine sehr betrübliche Begebenheit erspart.« Zu ihrer Beruhigung steckte er endlich den Notizblock wieder ein. »Nun, dann wünsche ich Ihnen noch einen angenehmen Abend. Ich finde allein hinaus.«
Er nickte kurz, als er sich an ihr vorbeischob, und ging hinaus in die Halle.
»Wie haben Sie mich eigentlich gefunden?«, rief sie ihm hinterher. »Wo Sie doch meine Adresse nicht hatten.«
»Im Adelsalmanach von Debrett.«
Er öffnete die Haustür und trat ins Freie. In der Sekunde, wo die Tür sich hinter ihm schloss, eilte sie im Frühstückszimmer ans Fenster. Er blieb auf der anderen Straßenseite stehen und sah zum Haus herüber. Für eine merkwürdig lange Zeit rührte er sich nicht vom Fleck, dann setzte er den Bowler auf und ging davon.
*
Der Premierminister schrieb ihr sofort nach seiner Rückkehr in die Downing Street eine Nachricht.
17 Uhr 30, 3. Juli 1914
Ich erfahre gerade, dass der Islington-Ball wegen der Tragödie auf der Themse abgesagt ist. Ich vergaß Dir zu erzählen, dass ich eine beunruhigende Vorahnung hatte, als ich Dich gedrängt habe, die Dampferfahrt nicht mitzumachen und stattdessen zu O. zu kommen. Später im Bett habe ich geträumt, dass die von Edward initiierte Unternehmung Schiffbruch erleidet. Ist das nicht recht merkwürdig?
Unser Gespräch war einfach himmlisch, mein Liebling, unvorstellbar, dass zwischen uns jemals Missverständnisse aufkommen könnten.
In inniger Liebe
KAPITEL 4
Deemer ging zum U-Bahnhof Oxford Circus und stieg in die drückend heißen Katakomben der Central London Railway hinunter. Nach achtzehn Stunden Dienst, in denen er überall in London Zeugenaussagen aufgenommen hatte, war er todmüde.
Ein heißer, nach Öl und Metall stinkender Luftschwall aus dem Tunnelmaul kündigte die Ankunft der Bahn in Richtung Osten an. Er hielt sich an einem der Griffe fest und schwankte fünfundzwanzig Meter unter der Stadt schweigend im Gleichtakt mit den anderen Fahrgästen hin und her – wie Seegras auf dem Meeresgrund. Eine halbe Stunde später stieg er an der Station Angel aus und gelangte erleichtert wieder an die frische Luft.
Er wohnte in Islington allein in einem kleinen, dreizimmrigen Reihenhaus. Vorn und hinten befand sich ein winziger Garten, und neben der Haustür rankten sich an dem verrußten Mauerwerk blauviolette Glyzinien empor. Er hatte das Häuschen mit dem Vorhaben gemietet, das Mädchen zu heiraten, in das er schon zu Schulzeiten verschossen war, bis er schließlich feststellte, dass er sie nicht mehr liebte, und die Verlobung auflöste. Sie hatte umgehend jemand anderes geheiratet, woraufhin er sich fragte, ob seine Entscheidung richtig gewesen war. Er war einsam, aber das störte ihn nicht groß. Das Alleinsein hatte auch etwas Belebendes. Es verlieh einem den besonderen Biss. Und seine Arbeit beanspruchte ihn vollends.
Er nahm die Milchflasche, die vor der Tür stand, schraubte sie auf und schnüffelte daran – die Milch war in der Hitze sauer geworden. Er ging ins Haus und inspizierte als Erstes die Speisekammer. Viel fand er nicht – ein Stück schwitzenden Cheddarkäse, ein bisschen Zwieback, eine Flasche warmes Bier. Er nahm alles mit nach draußen in den Garten hinter dem Haus und setzte sich dort auf die Holzbank. Er hörte die spielenden Kinder im Park nebenan und plaudernde Stimmen aus dem Albion-Pub gegenüber – beruhigende Geräusche. Eine bis auf einen weißen Stern auf der Brust kohlschwarze Katze aus der Nachbarschaft rieb sich an seinen Beinen. Er nahm die Milchflasche, goss etwas von der sauren Milch in eine Untertasse und schaute der Katze beim Schlecken zu.
Seine Gedanken waren bei Venetia Stanley. Sie machte ihn neugierig. Laut Adelsalmanach war das herrschaftliche Wohnhaus in Marylebone lediglich die Londoner Adresse der Stanleys. Als Hauptwohnsitz war Alderley House in Cheshire verzeichnet, ein weiteres Haus besaßen sie in dem walisischen Ort Penrhos. Er fragte sich, womit eine unverheiratete, offenbar intelligente junge Frau, die je nach Jahreszeit zwischen ihren Anwesen hin- und herpendelte und sich die Zeit mit Menschen vertrieb, die mitten in der Woche nächtliche Dampferfahrten unternahmen und tödliche Wetten untereinander abschlossen, sich wohl sonst beschäftigte. Ein ziemlich nutzloses Dasein, wie er fand.
Als er seine Mahlzeit beendet hatte, spülte er sorgfältig den Teller, das Messer, das Glas und die leere Untertasse der Katze ab, ging dann nach oben und zog sich dort mit der gleichen Bedächtigkeit aus, stellte die Schuhe nebeneinander und hängte den einzigen guten Anzug, den er besaß, auf den Bügel. Er zog die dünnen Vorhänge zu und legte sich im sommerlichen Abendlicht aufs Bett, schloss die Augen, schlief zwölf Stunden durch und fuhr am nächsten Morgen zurück zu Scotland Yard, um das Wochenende durchzuarbeiten, obwohl er eigentlich keinen Dienst hatte.
*
An jenem Freitagabend wurde in der Nähe von Wandsworth Mitchells Leiche aus der Themse gezogen. Sir Denis Anson blieb noch knapp zwei weitere Tage verschwunden. Die Strömung hielt die Leiche in der Nähe der Fundamente der West London Railway Bridge unter Wasser, bevor sie schließlich am Sonntag in der Abenddämmerung an die Oberfläche getrieben wurde.
Nachdem er den Befund des Pathologen erhalten hatte, schrieb Deemer am folgenden Nachmittag seinen Bericht. Die Todesursache in beiden Fällen war Ertrinken. An keiner der beiden Leichen waren Verletzungen festzustellen, außer Abschürfungen an Ansons Gesicht, die der Gerichtsmediziner für postum zugezogen hielt und der Berührung mit dem Flussbett zuschrieb. Eine abschließende Feststellung der Todesursache wurde für den übernächsten Tag am Untersuchungsgericht von Lambeth anberaumt.
Deemer strengte sich an, einen möglichst lückenlosen Bericht zu erstellen. Er legte penibel alle Umstände der Tragödie dar – einschließlich der Wette und des Alkoholkonsums. Es wurden acht Seiten, mit denen er zu dem Schluss kam, dass kein Verbrechen verübt worden sei. Als er fertig war, ging er damit nach oben in den Flur, wo sich die Räume der Special Branch befanden. Er hatte gehofft, den Bericht Quinn persönlich überreichen und diese mythische Gestalt dabei von Angesicht zu Angesicht kennenlernen zu können. Sein Assistent teilte ihm jedoch kühl mit, dass der Superintendent beschäftigt sei, sodass Deemer genötigt war, den Bericht im Vorzimmer abzugeben.
*
Ein paar Stunden später an jenem Montagabend, kurz vor Mitternacht, kehrte der Premierminister vom Abendessen mit dem Taxi in die Downing Street zurück. Wie üblich hatte er dem Fahrer, der keine Ahnung hatte, wen er beförderte, genaue Anweisungen gegeben. Taxifahrer neigten dazu, die von der Whitehall abzweigende Downing Street mit der Down Street an der Piccadilly zu verwechseln, und schon einige Male hatte er nach einer in Gedanken versunkenen Fahrt aufgeschaut und sich am gleichnamigen U-Bahnhof in Mayfair wiedergefunden. Er beklagte sich nicht. Er war stolz darauf, in einem Land, einem Empire mit gut 440 Millionen Menschen zu leben, wo der Regierungschef nicht erkannt wurde und dessen Amtssitz am Ende einer Seitenstraße lag, die kaum jemand kannte.
Er bezahlte den Fahrer, stieg aus und blieb vor der Tür stehen, um in seinen Taschen den Schlüssel zu suchen. Nach einem Abend mit reichlich Champagner und Brandy war er – wenngleich im Kopf noch vollkommen klar – etwas wackelig auf den Beinen. Er öffnete die dunkelgrüne Tür, schloss hinter sich ab und ging die Treppe hinauf. Das Haus lag still da, obwohl siebzehn Bedienstete in dem Anwesen schliefen – ein Butler, eine Haushälterin, eine Köchin, drei Diener, acht Dienstmädchen (drei für die Hausarbeit, drei für die Küche und je eine Zofe für Margot und Violet), eine Gouvernante, ein Faktotum und ein Pförtner. Das war das Allernotwendigste, was Margot zur Führung eines anständigen Haushalts für angemessen erachtete. Sie nutzte einen der drei Salons im ersten Stock als ihr Schlafzimmer, und dort traf er sie auch an. Mit einem Schultertuch über dem Nachtgewand saß sie aufrecht im Bett und schrieb in ihr Tagebuch. Als er hineinging, um ihr eine gute Nacht zu wünschen, legte sie es beiseite.
»Henry, Liebling.«
»Liebling.« Er küsste sie auf die Stirn.
»Wie war das Essen?«
»Gut.« Er war am Bedford Square gewesen und hatte mit Raymond und Katharine zu Abend gegessen. Margot hatte wegen Kopfschmerzen in letzter Minute einen Rückzieher gemacht. Sie war Anfang des Jahres fünfzig geworden. Ihre Migräneanfälle waren eine ständige Heimsuchung.
»Ist er für den Gerichtstermin gewappnet?«
»Ich glaube ja. Wenigstens scheint er völlig unbesorgt zu sein.«
»Wann macht sich Raymond eigentlich jemals über irgendetwas Sorgen? Wenn er sich etwas mehr Sorgen gemacht hätte, dann wäre diese elende Geschichte überhaupt nicht passiert. Hast du gewusst, dass einige von ihnen tatsächlich in der Oper waren – noch bevor man Denis’ Leiche gefunden hat?« Respektlos, abgestumpft, nichtsnutzig und gotteslästerlich waren nur einige wenige der Attribute, mit denen sie die Koterie bedacht hatte, als sie von dem Unglück erfuhr, um gleich darauf in eine allgemeine Tirade über die Verkommenheit der modernen Welt zu verfallen – Kubisten, Futuristen, Wischiwaschi-Komponisten, Debussy, Politiker, die zum Bürgerkrieg in Irland aufhetzten, meuternde Armeeoffiziere, Zynismus, sensationslüsterne Zeitungen, Suffragetten, die Bilder aufschlitzten …