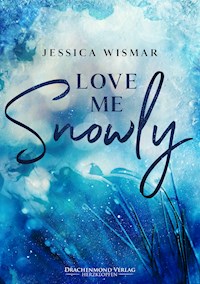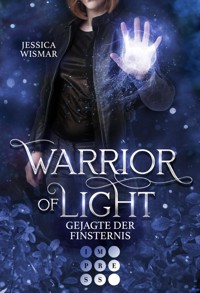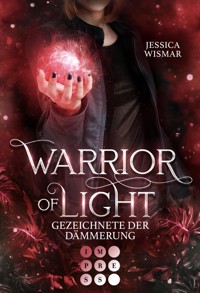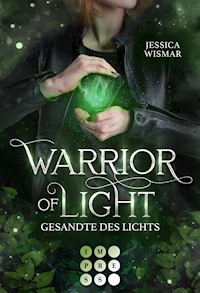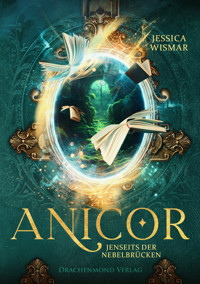
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Drachenmond Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Liv sucht händeringend einen Job, auch wenn ihr gesundheitlicher Zustand dazu verleitet, jeden Tag zu leben, als wäre er ihr letzter. Es scheint Schicksal zu sein, als sie über einen Aushang in einer Buchhandlung stolpert. Der schnittige Besitzer Keylam weckt von der ersten Sekunde an ihr Interesse, besonders, da er sich mit skurrilen Gestalten umgibt, die Liv direkt in ihr Herz schließt. Gerade als Liv das Gefühl hat, es würde endlich einmal gut im Leben laufen, holt ihre Krankheit sie ein. Doch statt dem Ende eröffnet sich Liv eine unglaubliche Welt der Fabelwesen – und Keylam ist ein Teil davon. Bald schon muss Liv erkennen, dass diese so faszinierende Welt ebenso im Verfall begriffen ist wie Liv auch. Mit Keylams Hilfe macht sie sich auf die Suche nach Heilung und stolpert in einen jahrhundertealten Kampf, der nicht nur ihr Leben bedroht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 549
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anicor
Jenseits der Nebelbrücken
Jessica Wismar
Copyright © 2024 by
Drachenmond Verlag GmbH
Auf der Weide 6
50354 Hürth
https://www.drachenmond.de
E-Mail: [email protected]
Lektorat: Stephan Bellem
Korrektorat: Lillith Korn
Layout Ebook: Stephan Bellem
Kartendesign: Francesca Peluso
Umschlagdesign: Christin Thomas – Giessel Design
Bildmaterial: Shutterstock
ISBN 978-3-95991-895-4
Alle Rechte vorbehalten
Inhalt
Forschungsbericht Keylam Warren
Kapitel 1
Forschungsbericht Keylam Warren
Kapitel 2
Forschungsbericht Keylam Warren
Kapitel 3
Forschungsbericht Keylam Warren
Kapitel 4
Forschungsbericht Keylam Warren
Kapitel 5
Forschungsbericht Keylam Warren
Kapitel 6
Forschungsbericht Keylam Warren
Kapitel 7
Forschungsbericht Keylam Warren
Kapitel 8
Forschungsbericht Keylam Warren
Kapitel 9
Forschungsbericht Keylam Warren
Kapitel 10
Forschungsbericht Keylam Warren
Kapitel 11
Forschungsbericht Keylam Warren
Kapitel 12
Forschungsbericht Keylam Warren
Kapitel 13
Forschungsbericht Keylam Warren
Kapitel 14
Forschungsbericht Keylam Warren
Kapitel 15
Forschungsbericht Keylam Warren
Kapitel 16
Forschungsbericht Keylam Warren
Kapitel 17
Forschungsbericht Keylam Warren
Kapitel 18
Forschungsbericht Keylam Warren
Kapitel 19
Forschungsbericht Keylam Warren
Kapitel 20
Forschungsbericht Keylam Warren
Kapitel 21
Forschungsbericht Keylam Warren
Kapitel 22
Kapitel 23
Forschungsbericht Keylam Warren
Nachwort
Drachenpost
Ich widme dieses Buch
meiner wilden kleinen Tochter.
Forschungsbericht Keylam Warren
Mainz, 05. Juni 2023
Hinweis 43: Grimoire der Familie Beauchamp
Gefunden in der Familiengruft
Ausführlich gesichtet
Keine weiterführenden Hinweise, keine Erwähnung der Prophezeiung oder der Familie Warren.
Es ist jedes Mal dasselbe, ich weiß gar nicht, warum ich mich immer noch auf die Suche mache, nach so vielen Jahren. Jedem noch so kleinen Hinweise gehe ich nach, nur um wieder in einer Sackgasse zu landen. Vielleicht muss ich mich damit abfinden, dass es keinen anderen Weg gibt, Vanir aufzuhalten.
Ich habe den Eindruck, die Zeit wird knapp. Es sind inzwischen zu viele zerstörte Brücken, als dass es noch ein Zufall sein kann. Ganz zu Anfang habe ich mich gefragt, wie viele Jahre er ohne den Widerstand der Althea unsere Welt noch aussaugen kann, ehe sie stirbt. Vielleicht habe ich jetzt meine Antwort: 14.
Noch bin ich nicht bereit, meine letzte Reise zu beginnen, aber ich habe doch auch Angst, dass ich den Zeitpunkt verpasse. Wenn Anicor stirbt, bedeutet das nicht nur meinen Tod. Rational betrachtet ist es also sehr simpel, was bedeutet schon ein Leben im Vergleich zu Millionen? Ich wünschte, es wäre so einfach …
* * *
Du hast jetzt ein Bewerbungsgespräch? Das ist nicht dein verdammter Ernst!«, zischte Taylor so leise wie möglich. Ihr Blick huschte flink über die Reihen schwarz gekleideter Menschen, als wollte sie prüfen, ob sie jemand gehört hatte. Dann funkelte sie mich wieder an. »Deshalb wolltest du hinten stehen!«
Erwischt. »Ich konnte ja nicht ahnen, dass es so lange dauert.« Gelogen. Aber Taylor begriff die Sinnlosigkeit dieser Ausrede nicht. Hätte ich wirklich nicht damit gerechnet, säße ich jetzt vorne neben meiner Mutter und müsste mich nicht auf Zehenspitzen recken, um einen Blick auf die aktuelle Rednerin zu erhaschen. Ich könnte in dieser brütenden Hitze sitzen, stattdessen rann mir von der kaum nennenswerten Anstrengung, einfach nur zu stehen, der Schweiß zwischen den Brüsten hinunter.
»Deshalb nimmt man sich ja auch den ganzen Tag frei, wenn man auf eine Beerdigung geht«, beharrte Taylor im Flüsterton.
Ich schnaubte pietätlos und zog sofort schuldbewusst den Kopf ein. Aber auch mich schien niemand gehört zu haben, oder sie waren so freundlich, es zu ignorieren. »Das ist die fünfte Beerdigung dieses Jahr und ich brauche wirklich dringend einen Job, wie soll ich sonst die Miete bezahlen?«
»Tante Libbie ist gestorben! Bezahl deine Miete wann anders.«
»Scht!«, zischte ein junger Mann schräg vor mir und warf uns einen vernichtenden Blick zu.
Mist. Er hatte ja recht. Bemüht lauschte ich den Worten der Frau in der weißen Robe. »… ihre Seele wird verbunden mit der Mutter ihren Frieden finden. Libbie ist zu Anicor gegangen.«
Alle neigten den Kopf und versanken in stummer Andacht. Ich kannte den Ablauf inzwischen schon auswendig. Dieser mir so fremde Glaube war allgegenwärtig in meinem Leben. Selbst meine Eltern folgten den Traditionen, die ich inzwischen selbst als Ungläubige gut kannte. Zum Beispiel war der etwa ein Meter lange Holzkasten, den wir gleich in das vorgegrabene Loch lassen würden, aus schnell verrottendem Holz, ohne Lasur, dafür mit aufwendigen Schnitzereien verziert. Statt eines Körpers war er gefüllt mit Muttererde, verschiedenen Samen und Libbies Asche. Alles zielte darauf ab, den Körper so schnell wie möglich wieder mit der Natur zu vereinen. Dass wir dazu ein Loch auf dem Friedhof nutzten, lag nur an den strengen Regeln in Deutschland. Schließlich durfte man die Asche eines Menschen nicht einfach irgendwo verstreuen.
Alle anderen Details waren Teil dieses Glaubens, dessen Kern die Verbundenheit mit Mutter Natur war, Anicor nannten sie sie. Und auch wenn ich dieses Leitmotiv schätzen konnte, mit Glauben hatte ich nichts am Hut.
Nach einiger Zeit des stummen Gedenkens hoben alle wieder ihren Kopf und die Frau in der weißen Robe verließ die Kopfseite des Miniatursarges. Nun trat ein Mann an ihre Stelle, den ich gut kannte: Onkel Arnold. Innerlich stöhnte ich auf. O verdammt, noch eine Rede und wie ich diesen Mann, dessen Herz mindestens so groß war wie sein fülliger Bauch, kannte, auch nicht eben kurz. Ein schneller Blick auf die Uhr zeigte, dass jeder Puffer aufgebraucht war. Ich musste sofort los, wenn ich es noch schaffen wollte. Schweren Herzens und mit einer stummen Entschuldigung in Richtung Sarg wandte ich mich zum Gehen um, doch Taylor packte meinen Arm und sah mich eindringlich an. Ich spürte die Wärme ihrer Finger durch den Stoff meiner schwarzen Bluse. »Du weißt genau, dass du problemlos wieder bei deinen Eltern leben könntest. Und auch mein Sofa ist immer bereit für dich.«
Zögernd sah ich zu Onkel Arnold, der eine Erinnerung mit den Trauergästen teilte, um Libbie zu gedenken. Ich fühlte mich wirklich mies. Dennoch verkniff ich mir die Entschuldigung, um nicht schon wieder zu reden. Libbie hätte es verstanden. Sie war eine der Wenigen, die mich immer noch bestärkt hatte, auf eigenen Beinen zu stehen. Ich würde ihr sonniges Gemüt vermissen, sehr sogar, und ihren Rückhalt.
Mit einem eindringlichen Blick flehte ich Taylor an, Verständnis zu haben, oder wenigstens Akzeptanz. Dann wand ich mich aus ihrem beschwörenden Griff und kehrte der Trauergemeinde den Rücken. Mit jedem Schritt wurde mir das Herz schwerer. Tief in mir weinte ein Teil bitter um den geliebten Menschen. Dieser Teil machte mir die Glieder schwer. Es fühlte sich an, als würde ich mich durch kniehohen Morast kämpfen, jeder Zentimeter weg von Libbie kostete mich all meine Willenskraft. Was ich gerade tat, war … falsch und richtig zugleich. Zu gehen nagte an mir und doch hatte ich ein tiefes Bedürfnis, dieses verdammte Bewerbungsgespräch zu führen. Es war meine Form von nicht aufgeben. Ich brauchte das, damit ich nicht vollkommen verzweifelt auf dem Sofa versackte, damit ich überhaupt wieder aufstehen konnte. Ich war so müde, so unendlich müde von diesem Mist, der sich mein Leben schimpfte, und genau das durfte ich nicht aussprechen, genau das musste ich in die hinterste Ecke meines Verstandes verdrängen.
»Okay, fein. Aber nur, weil Libbie es so wollen würde«, schnaufte Taylor plötzlich neben mir. Ich blieb wie angewurzelt stehen, sah über ihre Schulter zu der Trauergemeinde, von der ich mich inzwischen über hundert Meter entfernt hatte, und dann wieder in das zarte Gesicht meiner besten Freundin, die mich aus ihren giftgrünen Augen heiter anstrahlte.
»Ich dachte, du hast es eilig?« Sie schmunzelte, eindeutig zufrieden über meine perplexe Reaktion, und strich sich eine blonde Strähne keck hinters Ohr. Dann drangen ihre Worte zu mir durch und ich fiel ihr ganz kurz um den Hals. Beruhigend sog ich tief die Luft ein, wobei mir ihr frischer Duft in die Nase stieg und ein Gefühl von Geborgenheit auslöste. Nur ganz kurz erlaubte ich mir die Erleichterung und Dankbarkeit auszukosten, dann setzte ich meinen Stechschritt fort.
»Was tust du hier?«, fragte ich im Eilen, als sie mein Tempo hielt. Ich hatte so eine Ahnung, aber ich wollte es doch hören, ich musste sicher sein, dass ich ihre Geste nicht fehlinterpretierte.
»Das, was Freunde eben tun.« Sie zuckte mit den Schultern, was im Laufen etwas seltsam aussah. Ein Lächeln wollte sich in meine Mundwinkel stehlen, aber noch traute ich der Sache nicht.
»Gerade eben hast du noch -«
Taylor winkte ab. »Ja, ja. Erst habe ich dir gesagt, was ich von der Aktion halte. Du hast dich dennoch anders entschieden, daher stehe ich jetzt an deiner Seite. So macht man das doch.« Sie griff nach meiner Hand und drückte sie. »Außerdem muss ich jetzt dafür sorgen, dass es sich auch lohnt, wenn du schon Onkel Arnolds Rede schwänzt.«
Jaaa, also das … »Entweder sie wollen mich oder eben nicht.«
»Nein, nichts da. Du brauchst gar nicht so zu tun, als läge es nicht in deiner Macht, diese Entscheidung zu beeinflussen. Zum Teil hast du das durchaus selbst in der Hand. Es kommt eben auch auf die Performance im Gespräch an. Also los, wir üben jetzt.«
Ich seufzte entnervt auf, vor allem, weil ich einsah, dass sie recht hatte. »Du weißt genau, wie schlecht ich darin bin«, beschwerte ich mich, gerade als wir durch das Eisentor traten und den Friedhof verließen.
»Ja. Und genau deshalb üben wir jetzt. Außerdem bist du ganz genial darin, deine Schwächen aufzuzählen, worauf es allerdings ankommt, ist, ein realistisches Gesamtbild zu liefern.«
Ich stockte im Gehen. »Ach?«, meinte ich ungläubig. »Nicht darauf, mich gut zu verkaufen?«
»Bitte«, ätzte Taylor. »Als könnte ich dich je zu so etwas Aufgesetztem bringen. Hör auf, mich zu beleidigen, indem du andeutest, ich würde dich so schlecht kennen.«
Punkt für sie.
»Meinetwegen, also ein realistisches Bild. Gebe ich das nicht, wenn ich immer ehrlich antworte?«
»Nein. Denn du, meine Liebe, gehst dermaßen hart mit dir selbst ins Gericht, dass es beim Zusehen wehtut.«
Verlegen schmunzelte ich, weil ich nicht wusste, wie ich darauf reagieren sollte, zumal ich nicht wirklich widersprechen konnte. Ich wusste, dass es in der Natur der Menschen lag, bei sich selbst einen härteren Maßstab anzulegen als bei anderen, dass man sich selbst viel weniger verzieh und mit Fehlern viel intoleranter umging. Diese Erkenntnis zu haben, war allerdings etwas ganz anderes, als auch danach zu handeln.
Wir kamen bei der U-Bahnstation an und flogen regelrecht die Treppen runter. Um nicht zu stolpern, hielt ich den Stoff meines knöchellangen schwarzen Rockes hoch und achtete penibel genau auf die Stufen. Auf dem letzten Absatz allerdings erinnerte mein Körper mich doch noch daran, weshalb ich mehr als fünf Minuten für diese Strecke eingeplant hatte.
Meine Ohren rauschten und meine Beine fühlten sich plötzlich wie Wackelpudding an. Routiniert griff ich nach dem Geländer, verharrte an Ort und Stelle und konzentrierte alles darauf, stehen zu bleiben. Von außen nach innen krisselte mein Sichtfeld, bis ich nichts mehr sah, das Rauschen der Autos über uns, das Stimmengewirr der strömenden Menschen auf der Treppe um uns herum und sogar die blechernen Töne des Saxophons, das direkt vor uns in der Unterführung gespielt wurde, verstummten in einer Welt aus weicher Watte.
Der Ablauf war mir so in Fleisch und Blut übergegangen, dass ich einfach nur abwartete, bis meine Sinne zurückkehrten. Angst verspürte ich schon lange nicht mehr, wenn mich mein Körper mal wieder im Stich ließ. Inzwischen schaffte ich es sogar regelmäßig, nicht tatsächlich umzukippen, und das hier war auch einer der schwächeren Anfälle, immerhin konnte ich ihn im Stehen aushalten.
Als mir heiß wurde, wusste ich, dass ich den Berg überschritten hatte. Kurz darauf kehrte mein Blickfeld zurück. Ich sah hinab auf Taylors Hand, die fest meinen Oberarm umfasste und die ich nun wieder spüren konnte.
»Danke«, brachte ich belegt heraus, als ich den Druck wahrnahm, der mich offensichtlich aufrecht gehalten hatte – von wegen alleine stehen geblieben. Ich lehnte mich aus ihrem Halt, dann lächelte ich meine Freundin matt an. Die Sorge in ihren Zügen war nicht zu übersehen, doch schnell war dieser Ausdruck hinter Taylors perfekter Sonnenscheinmaske verschwunden.
»Gehts wieder?« Kein Mitleid, kein sorgenvoller Ton, lediglich ein Erkundigen. Sie wusste genau, wie sehr ich es hasste, so schwach zu sein, und dass es für mich nichts Schlimmeres gab, als ein großes Ding aus meinen Anfällen zu machen.
»Ja, ja. Geht schon.«
Taylor nickte, ließ mich los und setzte den Weg die Treppe hinunter fort, langsamer jetzt allerdings.
Ich löste den Klammergriff um das Geländer und wurde mir der rauen und von der Sonne heißen Oberfläche bewusst. Ein kurzer Blick zeigte ein teils moosbewachsenes, teils undefinierbar verdrecktes Geländer. Das Moos hatte vermutlich verhindert, dass ich mir die Hand an dem Metall verbrannte, aber der restliche Belag. War das da … uäh, das war eindeutig Vogelkot. Ein schneller Blick zu der Stelle, an der eben noch meine Hand gelegen hatte, erleichterte mich. Exkremente waren hier zum Glück nicht Teil der Patina. Ich widerstand dem Drang, meine Hand an meinem Rock abzuwischen, und folgte der zierlichen Silhouette, die sich gerade zwischen einer Gruppe Jugendlicher hindurchzwängte, die dermaßen langsam schlenderten, dass ich die nächste Bahn sicher auch noch verpassen würde. Die Luft unten im Gang war kühler als oben auf der Straße und mein Kreislauf dankte mir die erträglichere Temperatur.
Als die Masse an Menschen allzu dicht wurde, packte Taylor meine Hand mit überraschend starkem Griff für ihre schmalen Finger. Sie zog mich mit sich in schlängelnden Linien von Lücke zu Lücke, sodass wir tatsächlich rasch durch den vollgestopften Gang kamen und die Treppen hinunter zum Gleis nehmen konnten. Der barsche Wind, der uns entgegenschlug, gepaart mit dem charakteristischen Rauschen, trieb mich noch etwas mehr an, die U-Bahn musste gerade eingefahren sein.
Taylor war anscheinend zu demselben Schluss gekommen, sie beschleunigte ebenso ihre Schritte. Wir joggten beide die letzten Stufen und schlüpften gerade so noch durch die sich im Schließen begriffenen Türen.
Einfach, weil es so typisch für mich wäre, versicherte ich mich mit einem schnellen Blick hinauf zum Leuchtschild, dass wir im richtigen Zug waren, korrekte Linie und korrekte Richtung. Die Türen schlossen sich und ich seufzte erleichtert auf. Ein Blick auf meine Smartwatch ließ das Hochgefühl allerdings am Bahnsteig zurück, als der Zug sich in Bewegung setzte
»Dreck.«
»Zu spät?«
»Ja. Selbst wenn alles gut läuft, werde ich mindestens zwei Minuten zu spät kommen.«
»Wie viele Stationen?«
Taylor ruckte den Kopf in Richtung eines leeren Vierers und ich verstand die implizite Frage: Lohnt sich Hinsetzen?
»Fünf,« antwortete ich und machte mich bereits auf den Weg zu den freien Plätzen.
Erschöpft plumpste ich auf den Sitz am Fenster und lehnte die Stirn gegen die kühle Scheibe. Einen Moment lang schloss ich die Augen und atmete einfach nur durch. Der Geruch von Feuchtigkeit und dem schwarzen Gummi der Fensterisolierung stieg mir in die Nase, doch ich war zu müde, den Kopf wieder anzuheben. Meine Atmung wollte sich nicht so recht beruhigen und das Stechen in meiner Brust war auch nicht ohne. Ich hatte es so satt.
»Wir waren beim realistischen Bild. Komm schon, Liv, nenn mir deine Stärken.«
Ich schnaubte.
Das penetrante Piepen meines Weckers ersparte mir, eine Antwort geben zu müssen. In Gedanken ging ich die Informationen durch, die ich gestern über die Firma ergoogelt hatte, während ich meine Handtasche öffnete, das Handy herausfummelte, den Wecker ausschaltete und dann eine der Tabletten aus dem Seitenfach griff. Ich prüfte schnell, dass es die Richtige war, ehe ich sie einwarf und das Riesenteil herunterzwängte.
Taylor verzog nur ganz leicht ihr Gesicht. Ich wusste genau, was gerade in ihr vorging. Sie hasste Tablettenschlucken und brachte das nur mit viel Wasser zustande. Aber würde ich zu jeder meiner Pillen ein ganzes Glas Wasser kippen, wie sie das tat, wenn sie mal ein Schmerzmittel oder so nehmen musste, wäre ich ein wandelnder Wasserkanister. Wobei ich zugeben musste, dass die Brummer von Eisentabletten mit ein wenig Wasser wirklich leichter zu schlucken wären.
Genauso schnell wie das Unbehagen sich auf Taylors Züge geschlichen hatte, verbannte sie es wieder und setzte eine geschäftige Miene auf, während sie die Beine überschlug. »Im Ernst. Du willst diesen Job doch. Immerhin bist du gerade frühzeitig von Libbies Beerdigung weg, du musst diese Stelle wirklich dringend brauchen.«
»Das tue ich«, murmelte ich. Taylor hatte nicht unrecht, wenn ich meine Prioritäten so setzte, wie ich es eben getan hatte, musste ich auch alles geben. Wenigstens dieses eine Mal. Egal, ob ich für die Stelle jeden Tag von Mainz nach Frankfurt pendeln musste. Immerhin war es ein Job in einer Tierklinik und damit einer der wenigen, die ich wirklich gerne machen wollte.
»Also dann, deine Stärken.«
Zunächst atmete ich tief ein, ließ alle Zweifel und Widerstände mit der Luft zwischen meinen Lippen ausströmen und hob den Blick ins Unbestimmte. Was war eine Stärke? Ich konnte schon das ein oder andere ganz gut, aber das als Stärke zu bezeichnen wäre ganz schön übertrieben. Vielleicht mein Durchhaltevermögen, immerhin war es das zirka hundertste Gespräch, das ich allein dieses Jahr führte. Man könnte es allerdings auch Wahnsinn nennen, dass ich es immer wieder versuchte und tatsächlich glaubte, das Ergebnis würde irgendwann ein anderes sein.
Selbst wenn ich Mal im Bewerbungsgespräch überzeugte, führte das doch nie zu der Festanstellung, die ich so dringend brauchte. Wie oft das Arbeitsverhältnis noch in der Probezeit beendet worden war, früher auch von mir aus, aber seit einem Jahr nur noch vom Arbeitgeber. Meinen Zustand hatte ich mir kaum ausgesucht und ändern konnte ich ihn auch nicht, dennoch kostete er mich regelmäßig meine Beschäftigung.
»Liv?«
»Ich denke ja nach!«, beschwerte ich mich pampig.
Taylor seufzte schicksalsergeben auf und warf die Hände in die Luft. »Wie wäre es mit deiner Auffassungsgabe.«
»Was?«
Taylor fixierte mich tadelnd aus ihren giftgrünen Augen, als hätte ich mich absichtlich begriffsstutzig gegeben. Sie lehnte sich zurück und entspannte ihre Züge. »Du begreifst neue Aufgaben unglaublich schnell und kannst dich in so ziemlich jeden Job einarbeiten. Das zeugt übrigens auch von Flexibilität und einer aufgeschlossenen Weltanschauung.«
Wow, so dachte sie von mir? Ich zog erstaunt die Augenbrauen hoch und konnte meine Freundin nur anstarren.
»Denk doch mal nach. Egal, was du anpackst, du findest eine Lösung. Das Fest im Karateverein deiner Cousine, das Theaterstück in der Schule meiner Schwester, dann das Dachfenster im Haus von Libbie, das du mit ihrem Mann zusammen ausgetauscht hast. Von Handwerk über Organisation, selbst bis hin zu künstlerischen Dingen, du bekommst es immer alles irgendwie hin, ganz ohne irgendeine Ausbildung, einfach weil du dich schnell und gut in die Dinge einarbeiten kannst.«
»Ich kann googeln, das ist aber auch schon alles.«
»Nein, ist es nicht. Ich kann auch googeln und würde mir nie zutrauen, ein altes Fenster aus der Wand zu stemmen und dann auch noch ein neues einzubauen. Wenn ich es recht bedenke, kannst du beherzt mit auf die Liste setzen.« Sie lehnte sich vor, umfasste meine Hände und sah mir direkt in die Augen. Ich entdeckte in ihrem Blick, wie sehr sie an mich glaubte und wie überzeugt sie davon war, dass ich diese Stärken besaß.
»Meinetwegen«, lenkte ich ein und erwiderte den Druck ihrer Hände. »Aber was bringt mir das für eine Stelle als Assistentin in einer Veterinärklinik?«
»Das bringt in jedem Job was. Bei uns in der Firma motzen immer alle, wie unselbstständig die Leute sind, die von der Uni kommen, und dass man die eigentlich alle komplett neu anlernen und ausbilden müsste. Da hätte jemand mit deinen Stärken schnell die Nase vorn.«
Ich zuckte mit den Schultern und schaute aus dem Fenster. »Ihr sucht nicht zufällig gerade jemanden?«, bemerkte ich tonlos und meinte es auch gar nicht ernst. Mochte stimmen, was Taylor sagte, aber in eine Firma wie ihre kam ich doch überhaupt gar nicht erst rein, so ganz ohne Abschluss. Als ob eine der größten Unternehmensberatungen Deutschlands jemand Ungelernten einstellte. Die vorbeirauschenden Lichter in der Tunnelwand verschwammen zu einem orangegelben Streifen. »Ich weiß gar nicht, warum ich dahinfahre.«
»Na, mit irgendwas wirst du sie neugierig gemacht haben, sonst hätten sie dich wohl kaum zu einem Gespräch eingeladen.«
»Oder sie haben die Unterlagen nicht mal richtig gelesen, wie der Zoo.«
Taylor verzog das Gesicht. »Ja, das war nicht gerade professionell.«
»Leicht untertrieben«, murmelte ich und betrachtete gedankenverloren das verschwommene Grau der Tunnelwand. Immerhin hatten die komplett meine Zeit verschwendet und dann auch noch die Frechheit besessen, sich bei mir zu beschweren, warum ich mich überhaupt bewarb, wenn ich den nötigen Abschluss gar nicht hatte. Sie waren es doch gewesen, die meine Bewerbung nicht gelesen hatten. Aber sich aufzuregen, brachte nichts. Es war wichtiger, den Fokus auf das anstehende Gespräch zu richten. Ich drehte mich wieder Taylor zu und straffte entschlossen die Schultern. »Also Auffassungsgabe.«
»Ja!«, bekräftigte Taylor, lehnte sich zurück und hob die Finger, um meine Stärken daran abzuzählen. »Und Flexibilität. Außerdem einen unbändigen Willen.«
Jetzt schmunzelte ich. »Wow, ich bin ja ein echter Hauptgewinn.«
»Das bist du«, bestätigte Taylor ganz ernst und mir wurde der Hals eng.
Einen Moment lang genoss ich das warme Gefühl, das ihre inbrünstige Parteinahme in mir weckte. Dann holte ich tief Luft und versuchte, noch ein wenig mehr Zweifel loszulassen, als die U-Bahn in eine Haltestelle einfuhr.
»Okay, ähm. Vielleicht noch teamfähig und lösungsorientiert?«, schlug ich unsicher vor. Doch noch ehe Taylor Zeit hatte zu reagieren, fiel mir schon das Gegenargument ein. »Na ja, aber das sagen bestimmt alle von sich.«
»Nein, sag das. Es stimmt, es ist ehrlich und sie werden schon sehen, dass du bei diesen Punkten besser bist als andere.«
»Sofern sie mir eine Chance geben.«
»Ja.«
Ruckelnd setzte die Bahn sich wieder in Bewegung und verließ den Untergrund. Überrascht, dass ich so in das Gespräch mit Taylor vertieft war, dass mir der Großteil der Fahrt entgangen war, schaute ich auf die Uhr. »Verdammt, in genau vier Minuten müsste ich in der Klinik sein.« Bis zur nächsten Haltestelle fuhren wir noch zwei Minuten und ich war noch erschöpft von dem schnellen Marsch zur U-Bahn.
Kurz wägte ich ab, ob ich das Risiko eingehen und die dreihundert Meter joggen sollte, aber direkt umzukippen, war vielleicht nicht der beste Start in ein Bewerbungsgespräch. Dabei fiel mir ein … wieder öffnete ich meine Tasche und frohlockte, als ich den kleinen Inhalator entdeckte. Ich nahm eine Dosis Asthmaspray und sog tief die Luft ein.
»Willst du echt in dem Outfit gehen?«, fragte Taylor leicht pikiert.
Ich sah an mir herab und bemerkte den schwarzen knöchellangen Rock, den ich zur Beerdigung getragen hatte. »Was? Nein. Ich ziehe mich noch um.« Was ich hatte auf der Toilette vor Ort machen wollen. Aber Moment … Kurzentschlossen stand ich auf, streifte den Rock ab – ignorierte die gaffenden Blicke – und krempelte die Hosenbeine der Jeans, die ich darunter getragen hatte, herab. Perfekt, zwei Minuten weniger, die ich zu spät kommen würde.
Als ich hochblickte, nachdem ich den dünnen Rock in meine kleine Handtasche gezwängt hatte, grinste mich meine Freundin breit an. »Typisch!«
»Was?«
»Füg einfach pragmatisch und organisiert zur Liste hinzu.«
Widerwillig zog ich die Augenbrauen zusammen. »Ich kann kaum organisiert als Stärke nennen, wenn ich zu spät komme.«
Taylor wiegte den Kopf. »Na gut, Punkt für dich.«
Die Bahn bremste ab und ich positionierte mich schon mal vor der Tür. Auch wenn ich es vermutlich bereuen würde, ich wusste jetzt schon, dass ich gleich losjoggte. Ich konnte doch nicht in die Klinik geschlendert kommen, wenn ich unpünktlich war, wie sah das denn aus? Außerdem konnte ich so die Zeit minimieren, die ich tatsächlich zu spät kam.
Die Bahn hielt, ich drückte auf den Türöffner, sagte über die Schulter: »Wünsch mir Glück.« Dann klappte die Tür auf und ich rannte los.
Taylors: »Du brauchst kein Glück!«, scholl mir über den Bahnsteig hinterher.
* * *
»Und, wie lief es?« Taylors Stimme aus dem Handy an meinem Ohr war unangenehm laut und ich stellte den Ton flink etwas leiser.
»Ich kaufe mir gerade einen Pott Eis. Ben and Jerrys. Den größten, den sie haben. So lief es!«, knurrte ich und schob die Abdeckung der Kühltruhe mit mehr Schwung auf als nötig. Ich war so wütend, so verdammt wütend.
»Oje.«
»Ja, genau.«
Ich griff nach einem Becher Cookie Dough und wollte gerade schon die gläserne Abdeckung wieder schließen, da blieb mein Blick an den Preisschildern über der Truhe hängen. Einen Herzschlag lang war es mir egal, dass vor dem Komma eine fünf stand. Ich schmeckte quasi schon die Mischung aus Vanille, Schokolade und Cookieteig auf meiner Zunge. Dann schloss ich die Augen und hatte alle Mühe, gegen den Kloß in meinem Hals anzuschlucken. Wut, Scham und der pure Frust ließen meine Schultern herabsacken. Ich stellte den Eisbecher zurück, schloss die Abdeckung wieder und starrte hinab auf das Sortiment. Heiße Tränen sammelten sich in meinen Augen.
»Was ist passiert?«, fragte Taylor leise nach, als ich einige Momente nur geschwiegen hatte.
Ich kehrte der Kühltruhe den Rücken zu und stapfte unverrichteter Dinge in Richtung Kasse. »Wir sind gar nicht erst bis zu meinen Stärken gekommen. Bei dem Gespräch war auch eine Ärztin aus dem Klinikteam anwesend und die kannte mich schon aus der Praxis am Römer.«
»Die Praxis, die dich noch in der Probezeit wieder entlassen hat, weil du so oft krank warst?«
»Das haben sie so nie gesagt.«
»Natürlich nicht, da hättest du dich dann ja einklagen können. Aber allen war klar, warum«, echauffierte Taylor sich.
Ich schwieg. Dagegen konnte ich nichts sagen.
Auch sie sprach nicht sofort weiter und das verstand ich sogar. Was sollte sie auch sagen? Das war einfach Mist und es fühlte sich so dermaßen unfair an.
»Scheiße«, murmelte sie mitfühlend.
»Du sagst es.« Meine Kehle wurde immer enger, das war alles so … gemein. Warum war mein Leben so? Den Kampf gegen die Tränen verlor ich etwa auf Höhe der Kassen und die letzten Schritte aus dem Laden heraus musste ich halb blind hinter mich bringen. So fest ich konnte, presste ich das Handy an mein Ohr. Dieses Gefühl, sich nicht einmal das Frustessen leisten zu können, das war so …
»Das Gespräch war nach drei Minuten vorbei. Ich bin schon fast wieder zu Hause. Ganz ehrlich, ich bewerbe mich in Frankfurt einfach auf keine Stellen mehr. Das ist bisher nur schiefgelaufen. Erst das unfaire Feuern in der Praxis am Römer, dann der Mist im Zoo und jetzt das.«
»Soll ich vorbeikommen? Wir könnten einen Film schauen. Oder gegen die Ungerechtigkeit wettern oder was immer du brauchst, Süße.«
Gerade so verkniff ich mir ein Schluchzen. »Nein«, brachte ich mit brüchiger Stimme heraus. »Ich will nur allein sein.« Mich unter der Bettdecke verkriechen und alles hinausbrüllen. Es war ja nicht nur das Gespräch oder die Enttäuschung darüber, nicht einmal eine Chance bekommen zu haben. Das Schlimmste war, dass ich für den Mist Libbies Beerdigung früher verlassen hatte, dabei war Libbie mir wirklich wichtig gewesen.
Dazu kam Mamas Enttäuschung. Natürlich hatte sie mein Fehlen bemerkt und mehrmals versucht anzurufen. Als ich sie nach dem Gespräch zurückgerufen und es ihr erklärt hatte, war mir die geballte Enttäuschung durch das Telefon bis in die Knochen gesickert. Sie hatte sich zuvor Sorgen gemacht, dass ich verschwunden sei, weil es mir so schlecht ginge, doch als sie den wahren Grund erfahren hatte … den Ton, in dem sie fein gesagt hatte, hatte ich schon lange nicht mehr gehört und gegen die vernichtende Kritik am Ende unseres sehr kurzen Telefonats konnte ich nichts einwenden. Du weißt ganz genau, wie selbstsüchtig diese Entscheidung war, sonst hättest du mir vorher davon erzählt und dich nicht klammheimlich weggeschlichen. Und damit hatte sie dann auch aufgelegt.
Immer mehr Tränen trübten mir die Sicht und bahnten sich schließlich ihren Weg meine Wangen hinab. Verzweifelt wischte ich sie mir mit dem Handballen weg und wünschte, ich wäre nicht so ein Haufen Mist. Eine Fehlentscheidung nach der nächsten über die letzten zwei Jahre hinweg und nun stand ich inmitten meiner Grube aus Versagen und musste angekrochen kommen, um nicht obdachlos zu werden.
Ein eiskalter Klumpen in meinem Magen drückte mir die Galle die Kehle hinauf bei der Vorstellung, meine Eltern um Geld anbetteln zu müssen. Ich wusste, sie würden keine Sekunde zögern, darum ging es nicht. Sie liebten mich, taten alles für mich und hielten mir den Rücken frei, wann immer ich sie ließ. Aber genau das war das Problem, ich war abhängig, nicht in der Lage, auf eigenen Beinen zu stehen, und dabei hatte ich das so gewollt.
»Bist du noch da?«, riss Taylors Stimme mich aus dem Abwärtsstrudel meiner Gedanken. Ich hatte tatsächlich vollkommen vergessen, dass ich noch das Telefon an mein Ohr gepresst hielt.
»Ja.«
»Ach Mensch. Ach Liv, ich würde dich gerade so gerne in den Arm nehmen.«
Ich schniefte. »Das wäre schön«, gestand ich leise.
»Gut, dann treffen wir uns gleich an deiner Wohnung. Keine Widerrede.« Und ehe ich die Chance hatte, nein zu sagen, legte sie auf.
Ich sah hinab auf das Handy und lächelte matt. Sie wusste immer, was ich brauchte und wonach ich gleichzeitig doch nie fragen würde. Womit hatte ich nur eine Freundin wie sie verdient?
Ich setzte mich wieder in Bewegung und dachte darüber nach, ob ich von Taylor immer nur nahm, oder ob ich ihr auch etwas gab? War unsere Freundschaft eine Einbahnstraße? Ich hoffte nicht, doch mir fiel gerade keine Szene ein, bei der ich mal angerannt gekommen war. Wozu auch? Ihr Leben schien perfekt. Aber konnte das stimmen? Konnte irgendjemandes Leben perfekt sein? Irgendwie glaubte ich das nicht und daher nahm ich mir vor, sie gleich zu fragen. Vielleicht hatte sie mir in letzter Zeit aufgehört, von ihren Problemen zu erzählen, weil ich so viele eigene hatte, aber das wollte ich so nicht. Ich wollte für sie da sein.
Erst nach diesem Entschluss nahm ich wieder bewusst meine Umgebung wahr und stockte. »Moment mal.« Irritiert sah ich mich um, suchte bekannte Punkte, um mich zu orientieren. Wo zur Hölle war ich? Also es passierte mir ja oft, dass ich wie auf Autopilot lief, wenn ich in Gedanken versank, aber mein Körper fand dann jedes Mal zielsicher heim. Der Rewe war nur drei Straßen von meiner Wohnung entfernt und den Weg beherrschte ich im Schlaf. Also warum war ich jetzt … Ah, da vorne, den Kiosk erkannte ich. Wow, ich war zwei Straßen zu früh abgebogen.
Erstaunt sah ich mich genauer um, an dieser Gasse war ich bisher immer nur vorbeigelaufen. Sie war schmaler als meine Straße und obwohl die Autos dicht an dicht standen, war außer mir keine Person in Sicht. Es kribbelte in meinem Nacken und ich rollte mit den Schultern, um die plötzliche Gänsehaut zu vertreiben. Schnell heim. Was war ich froh, dass gerade später Mittag und nicht Nacht war. Trotzdem trieb das mulmige Gefühl mich vorwärts. Ich wollte mich gerade in Bewegung setzen, als etwas im Augenwinkel meine Aufmerksamkeit erregte.
Ohne es zu merken, war ich direkt vor dem Schaufenster einer Buchhandlung stehen geblieben. Wow, da lebte ich jetzt seit fast drei Jahren zwei Straßen parallel von dieser und wusste nicht einmal, dass hier eine schnuckelig anmutende Buchhandlung existierte. Durch das Glas sah ich dunkle Regale, einen alten Ledersessel und so ein Globusteil, in dem häufig Whisky versteckt war. Und im Gegensatz zu der Buchhandlung in der Fußgängerpassage lagen im Schaufenster keine Kinderbücher oder Bestseller. Ich entdeckte eine uralt aussehende Karte, auf der noch Seemonster eingezeichnet waren, ein uriges Regal mit einer alten Brockhaussammlung, die so wirkte, als könnten es tatsächlich Bücher der ersten Auflage sein. Kurz davor, die Hand an die Scheibe zu legen, um so nah wie möglich herantreten zu können, ohne mit der Nase ans Glas zu stoßen, entdeckte ich das weiße Rechteck, das zwischen all den Brauntönen meine Aufmerksamkeit geweckt hatte und auf einer Staffelei stand:
Vollzeitkraft gesucht, ab sofort!
Bei Interesse am Tresen melden.
Für eine geschlagene Sekunde starrte ich das Stück Leinwand einfach nur an und fragte mich, ob es so etwas wie Schicksal nicht doch gab. Direkt voller Hoffnung huschte ich zum Eingang, drückte die Glastür an ihrem großen Messinggriff auf und vernahm ganz stilecht das helle Bimmeln einer Glocke. Ein Schmunzeln entspannte meine Züge und als der Duft von Büchern und Holz mich begrüßte, fühlte ich mich sofort wohl hier. Die Tür fiel hinter mir zu und sperrte die vielen kleinen Geräusche der Stadt aus, die ich erst durch ihre Abwesenheit wahrnahm. Ich wurde mir der angenehmen Temperatur bewusst, die hier drinnen herrschte, atmete tief durch und spürte ein ungebetenes Kribbeln in Beinen und Händen. Nicht jetzt!
Entschieden trat ich weiter in den Laden. Ein kurzfloriger Teppich schluckte die Geräusche meiner Schritte und hätte ich nicht ein ganz klares Ziel gehabt, hätte dieser Ort mich zum Verweilen und Stöbern eingeladen. Mein Blick glitt über all die Regale aus dunklem Holz mit den Verzierungen, denen ich glatt zutraute, handgeschnitzt zu sein.
»Ja, bitte? Kann ich Ihnen helfen?«, erklang eine tiefe Stimme von rechts. Zwischen den beiden hüfthohen Sideboards hier vorne direkt im Eingangsbereich kam ein Mann auf mich zu. Er ließ gerade eine goldene Uhr in die Tasche seiner perfekt sitzenden Weste gleiten. Das filigrane Goldkettchen an der Uhr baumelte noch leicht, als er vor mir stehen blieb. Einen Moment musste ich einfach starren, ich hatte noch nie einen so perfekt gekleideten Mann in einer Buchhandlung gesehen, schon gar nicht so einen jungen. Lederschuhe, dunkelblaue Stoffhose, Gürtel in demselben Braunton wie die Schuhe, dazu ein weißes Hemd mit hochgekrempelten Ärmeln und darüber diese marineblaue Weste mit goldenen Knöpfen.
»Brauchen Sie ein Telefon? Soll ich jemanden für Sie anrufen?«, fragte er und verlagerte sein Gewicht, als wäre ihm mein Starren unangenehm. Himmel, was machte ich hier gerade für einen ersten Eindruck?
»Nein, danke.« Was waren das denn für seltsame Fragen?
»Sicher? Ich dachte nur …« Er ließ den Satz unvollendet und sah mir auf eine Weise ins Gesicht, die mich stutzig machte. Dann griff er in seine Hosentasche und förderte ein Taschentuch zutage. Ein Stofftaschentuch, so eines von der alten Sorte, mit eingestickten Initialen, ein K und ein W, die ineinandergriffen. Das Stück sah wirklich schick aus und irgendwie passte es zu ihm. Süß, dass er so etwas heutzutage tatsächlich noch benutzte. Und ein winziges bisschen schrullig, auf die gute Art. Moment mal, wieso reichte er mir ein Taschentuch?
»Danke, aber das brauche ich nicht.«
»Eine Kundentoilette befindet sich oben im ersten Stock, falls Sie sich frisch machen wollen«, bemerkte er leise, als würde er mir den Tipp geben, nach dem ich begehrlich gesucht hatte.
»Wie bitte?« Und gerade, als er den Blick betreten senkte, fiel bei mir der Groschen. Ich hatte geweint, nicht eben wenig und ich war geschminkt gewesen. Dreck! »Erster Stock, sagten Sie?«
»Ja, die Treppe ist dort hinten am Ende der Regalreihe«, beschrieb er mit unüberhörbarer Erleichterung in der Stimme.
Meine Wangen glühten vor Hitze. Was für ein peinlicher Auftritt! Ich huschte zwischen Reiseromanen und englischer Literatur hindurch und kam an den Fuß einer Wendeltreppe aus schwarz lackierten Eisenstäben. Bei jedem Schritt erklang ein sanft schwingender Ton und das heimelige Gefühl dieses Ortes wurde nur noch verstärkt. Jetzt wollte ich diesen Job noch mehr. Irgendwie musste ich meinen katastrophalen ersten Eindruck geraderücken.
Oben auf der Galerie angekommen, empfing mich eine offene Fläche mit roten Lesesesseln und kleinen Tischchen. Dahinter entdeckte ich eine Tür mit zwei Figuren in Gold, die wohl eine Frau und einen Mann symbolisieren sollten. Ich huschte über den grauen Teppichboden, der den Lesebereich farblich vom Rest abtrennte, und schlüpfte in ein kleines Badezimmer, dessen Armaturen und Kacheln auf Alt gemacht waren. Schwarz und Gold zwischen weißen Kacheln in sechseckiger Form. Es sah stilvoll und altertümlich zugleich aus.
Im ovalen Spiegel über dem eckigen Waschbecken sah ich dann das ganze Ausmaß der Katastrophe. Die Wimperntusche bildete schwarze Ringe unter den Augen und deutlich sichtbare Spuren meine Wangen hinab, der strenge Pferdeschwanz hatte auch schon bessere Zeiten gesehen, woran vermutlich mein kleiner Sprint von der U-Bahn zur Klinik schuld war, und die Bluse war unanständig weit aufgeknöpft. Nach diesem Desaster eines Gesprächs war ich immer noch ganz schön erhitzt gewesen von der kleinen Sporteinlage zuvor und hatte die obersten zwei Knöpfe geöffnet. Irgendwie hatte der dritte Knopf sich aber inzwischen auch gelöst und im richtigen Winkel lugte der Spitzen-BH darunter hervor. Wow, schlimmer ging es ja kaum.
Rasch schloss ich die Bluse höher, rubbelte das verlaufene Schwarz von den Wangen und bemühte mich, aus den Klecksen unter meinen Augen Linien zu formen, indem ich die Farbe von innen nach außen wegstrich. Ich kniff mir in die Wangen, um etwas Farbe unter das ungesunde Kalkweiß zu bekommen, und band den Pferdeschwanz neu, um die verirrten Strähnen wieder in die gebändigte Masse aus rotbraun einzupflegen.
Auf dem Weg hinunter rief ich mir noch mal das Gespräch mit Taylor in Erinnerung und betete meine Stärken herunter. Auf jeder Stufe fiel mir ein anderer möglicher erster Satz ein, doch keiner wollte mich so recht überzeugen. Plötzlich stand ich vorm Tresen und musste mich für einen entscheiden.
»Hi, ich bin Liv.«
Er hob den Blick von dem Bildschirm, an dem er zu arbeiten schien. Noch ehe er antworten konnte, fuhr ich fort.
»Ich habe das Schild im Schaufenster gesehen. Suchen Sie noch jemanden?«
Er zögerte einen Moment lang. Ich erwartete regelrecht, dass er mich herablassend musterte, eine Augenbraue hochzog und nein, danke sagte. Stattdessen sah er mir so intensiv in die Augen, dass ich zurückweichen wollte.
»Erfahrung?«, fragte er knapp.
»Im Buchhandel? Keine.«
Sein Mundwinkel zuckte. »Warum wollen Sie die Stelle?«
Ich war kurz davor, eine ganze Kanonade an fadenscheinigen Gründen abzufeuern, mich eben gut zu verkaufen, doch ein leises Stimmchen hielt mich davon ab. »Ganz ehrlich? Ich brauche dringend einen Job. Ich muss Miete zahlen und bin langsam verzweifelt.«
Erwartungsvoll hielt ich seinem strengen Blick stand. Dann schlich sich ein zartes Schmunzeln in seine Mundwinkel, nur ganz kurz, aber es weckte Hoffnung.
»Ich weiß nicht, ob ich diese Direktheit schätzen soll oder der Mangel an Anstand mich ärgert.« Da war sie auch schon, die hochgezogene Augenbraue. Aber auch er war hier gerade vollkommen ohne scheinwahrende Maske. Das gefiel mir.
»Mal im Ernst, ich könnte Ihnen jetzt all meine Stärken aufzählen, erklären, weshalb ich diesen Job gut machen werde, und Ihnen einen frisierten Lebenslauf unterjubeln. Aber das bringt keinen von uns weiter. Sie werden mir einfach eine Chance geben müssen und ich werde Sie selbstverständlich überzeugen, denn ich lerne schnell. Was haben Sie schon zu verlieren?«
»Zeit?«, schlug er vor.
»Stimmt. Aber wenn ich gut bin, gewinnen Sie eine Arbeitskraft und sind die lästige Suche los.« Nun musste ich selbst schmunzeln, so verwegen zu sein, machte überraschend viel Spaß. Wohin Verzweiflung einen führen konnte, erstaunte mich doch.
»Keylam«, meinte er und hielt mir die Hand entgegen. Es brauchte zwei Herzschläge, ehe ich begriff und freudestrahlend seine Hand packte. »Liv!«
Er schmunzelte und ich hätte wetten können, dass unter den getrimmten Bartstoppeln Grübchen versteckt waren. »Also dann, ich würde sagen, wir fangen direkt an, dich einzuarbeiten. Der Stundenlohn wäre für den Anfang dreizehn, Urlaubstage insgesamt dreißig, du würdest in einer Fünf-Tage-Woche arbeiten und außer den offensichtlichen Anforderungen, gehört zu deinen Aufgaben die Assistenz für den Buchclub. Solltest du die Stelle besetzen, wird Zack dich diesbezüglich einweisen. Eine Probezeit von zwei Monaten, in der wir beide das Arbeitsverhältnis jederzeit beenden können, ist Teil des Vertrags. Beginnen werden wir mit dem Ordnungssystem. Ich erwarte in einer knappen Stunde eine Gruppe Touristen und heute Abend findet eine Lesung statt. Der perfekte Tag, um mich … Wie sagtest du? Ach ja, zu überzeugen.« Er funkelte mich erwartungsvoll an. »Noch Fragen?«
Amüsiert musterte ich seine Züge ganz genau. Er testete mich doch gerade. Seltsamerweise machte mir das Spaß. Er warf mir eine Herausforderung vor die Füße, und ich war so was von bereit, sie anzunehmen. Ich hatte nicht mal Angst zu versagen oder einen schlechten Eindruck zu machen. Vielleicht war das die Atmosphäre hier drin oder ich hatte inzwischen so viele Klatschen vom Leben bekommen, egal wie sehr ich mich bemühte, es diesem oder jenem potentiellen Chef recht zu machen, dass ich schlichtweg meinem Bauchgefühl folgte. Oder aber die Tatsache, dass ich mir wirklich alles gemerkt hatte, was er mir gerade um die Ohren gehauen hatte, fütterte mein Selbstbewusstsein. »Nein, keine Fragen.«
Er zog skeptisch eine Augenbraue hoch.
Das ließ mich nun ganz offen grinsen. »Na los, das Ordnungssystem. Wenn ich nur eine Stunde habe, will ich so viel wie möglich lernen, damit ich hilfreich sein kann.«
Sein Gesicht hellte sich in Erheiterung auf. »Kluge Antwort.«
»Ja, gell. Dachte ich mir auch.«
Ein leises Lachen entschlüpfte seinen Lippen und ich hatte große Mühe, weiterhin zu übersehen, wie attraktiv ich ihn fand. Den Gedanken schob ich schnell beiseite. Ich musste glänzen, nein, ich musste herausragend sein. Dieser Job war mein letzter Funken Hoffnung.
Forschungsbericht Keylam Warren
Mainz, 28. Juni 2023
Zwischenbericht
Es bleibt mir gerade weder Zeit noch Kraft, Hinweisen nachzugehen. Zwei weitere Brücken sind zerstört. Das nimmt Ausmaße an, die ich nicht mehr abfangen kann. Durch den Bann kann ich pro Monat zwei, maximal drei Brücken erschaffen. Mainz ist einfach zu groß, als dass das ausreichen würde, weshalb wir bisher auf bereits bestehende Brücken zurückgegriffen haben. Doch allein diesen Monat wurden zwölf Brücken zerstört. Ich versuche, Kontakt zu den Penhaligan aufzunehmen, kann sie jedoch nirgendwo aufspüren. Und selbst wenn, weiß ich nicht, ob sie die Zusammenarbeit nicht immer noch an unerfüllbare Bedingungen knüpfen. Ich hoffe, dass ich sie bald aufspüren kann, Mainz braucht Hilfe. Dabei weiß ich nicht einmal, wie viele von ihnen noch leben, aber ich weiß, dass ich ohne Hilfe das Sterben nicht mehr aufhalten kann, solange die Tenebris jede Brücke zerstören, die sie finden. Zack hat es durch Zufall beobachtet, die kaputten Brücken sind nicht Anicors Verfall geschuldet, sondern ein mutwilliger Akt. Vanir ist wahnsinnig.
* * *
Das helle Klicken des Türschlosses erklang. Mit einem bereits halb ins Regal geschobenen Buch in der Hand sah ich hinüber und konnte es kaum glauben. Der Tag war schon rum?
Keylam kam zwischen den hüfthohen Regalen hindurch auf mich zu und strich gedankenverloren über die kleine Taschenuhr, ehe er sie wieder in seine Weste gleiten ließ. »Neunzehn Uhr, Feierabend.«
»Ich räume die nur noch schnell ein«, entgegnete ich und hob das Buch in meiner anderen Hand leicht an. Und danach musste ich bei Taylor zu Kreuze kriechen, die ich vollkommen vergessen hatte. In einer schnellen Nachricht hatte ich mich zwar schon entschuldigt und ihr knapp erklärt, weshalb ich nun doch nicht nach Hause gekommen war, um mich von ihr trösten zu lassen, aber heute Abend musste ich es auch wieder gut machen, immerhin war sie den ganzen Weg quer durch die Stadt gekommen und ich hatte sie einfach versetzt. Aber zuerst brachte ich meine Schicht hier zu Ende und hoffte, dass ich einen guten ersten Tag hingelegt hatte.
Keylam lehnte sich mit der Schulter an das massive Regal und beobachtete, wie ich das Buch nun vollends zwischen seine Nachbarn schob. Unter seinem Blick wurde mir warm und ein Knoten bildete sich in meiner Brust. Hatte ich mich gut geschlagen oder wenigstens gut genug? Eigentlich hatte ich ein recht optimistisches Gefühl, aber wer wusste schon, was für Ansprüche dieser Mann hatte? Mit gereizten Nerven scannte ich das Regalbrett, fand die Markierung am Regalboden, die ich suchte, und ging dann in die Hocke, um im untersten Fach die Lücke für das nächste Buch in meinen Händen zu finden. Starrte er immer noch?
»Wie hat es dir gefallen?«
Ich stutzte, runzelte die Stirn und sah kurz hinab auf das Buch in meiner Hand. »Was?«
Seine unbewegte Miene wurde unter einem erheiterten Funkeln weicher. »Dein erster Tag«, half er mir auf die Sprünge.
Ach so, ja, das ergab viel mehr Sinn. Ich hatte schon angenommen, er meinte das Buch in meinen Händen, das ich keineswegs je gelesen hatte. »Gut.«
Er wartete lange genug, dass mir klarwerden konnte, wie aussagelos meine Antwort war, ehe er etwas erwiderte. »Aha.«
»Sogar sehr gut«, beeilte ich mich zu sagen. »Ich glaube, dein Ordnungssystem habe ich weitestgehend durchblickt, an der Kasse komme ich zumindest mit den grundlegenden Bedienungen gut klar und das Ambiente liebe ich ziemlich.«
Seine Augenbrauen schnellten in die Höhe. Dann ließ er seinen Blick langsam schweifen, als betrachtete er den Verkaufsraum zum ersten Mal. »Die Einrichtung ist mehr historisch gewachsen.«
Heißt? Wie gerne würde ich nachfragen, aber war das angemessen? Und wenn ich nicht nachfragte, glaubte er dann, ich hätte zu wenig Interesse?
Keylams Blick fand zu mir zurück. Er stieß sich vom Regal ab und trat noch einen Schritt auf mich zu. »Du hast mich nicht enttäuscht, was schon mehr ist, als die meisten vor dir geschafft haben. Du kannst also morgen wiederkommen. Wir öffnen um zehn, aber sei bitte schon um halb da.«
Pure Freude durchströmte mich, doch statt sie zu genießen, hing mein Verstand sich an der vorherigen Aussage auf. Was meinte er mit historisch gewachsen? Gab es zu jedem dieser teils sehr alten Einrichtungsdetails eine eigene kleine Geschichte? Ich wettete, er war ein spannender Diskussionspartner. Wie gern ich das genau jetzt testen würde, aber heute war nicht der Tag dafür. Wenn alles gut ging, hatte ich noch genug Zeit, um herauszufinden, ob er nur intelligent und belesen wirkte oder es tatsächlich war.
Stattdessen schob ich schnell das Buch an seinen Platz, erhob mich und kam auf ein anderes Thema zurück. »Du meintest vorhin, der Buchclub käme heute zusammen.« Doch ehe er antworten konnte, strafte mein Körper mich für diese unbedachte Handlung. Ein allzu vertrautes Bitzeln jagte durch meine Beine und ich spürte den Moment, an dem sich entschied, ob ich gleich umkippte oder nicht. Das anschwellende Kribbeln warnte mich, entweder ich setzte mich sofort hin oder ich verlor den Kampf um mein Bewusstsein. Also was soll es sein, Liv? Die gut sozialisierte Version meiner selbst gewann die spontane Entscheidung und noch, während ich die Zähne zusammenbiss und gewappnet das Kinn reckte, mit dem festen Entschluss einfach willensstark genug zu sein, begriff ich, wie dumm diese Entscheidung gewesen war.
Ich verlor das Gefühl für meinen Körper, hörte seine Antwort nicht mehr und so fest ich auch auf seine sich bewegenden Lippen starrte, das Sichtfeld wurde von außen nach innen durch verzehrende Schwärze immer kleiner, bis ich nichts mehr sah, hörte oder fühlte.
Ich riss die Augen auf, das erleichternde Ende eines harten Kampfes gegen diesen so verhassten Zustand. Das Gute war, ich hatte inzwischen Übung darin, gegen die alles dämpfende Weichheit der Bewusstlosigkeit anzukämpfen und mich durch den zähen Morast zurück zur Oberfläche durchzuboxen. Jedes Mal war das Erwachen wie das erste Luftschnappen nach einem langen Tauchgang. Und jedes Mal kamen nach den Sinnen erst mein Verstand und dann auch die Gefühlswelt zurück.
Heute wurde ich von einer Welle aus den verschiedensten Emotionen begrüßt. Als Erstes kam Erleichterung, dass ich wieder sehen konnte. Dann Irritation, ob es wirklich so still war oder mein Gehör noch nicht wieder funktionierte. Doch das leise Rascheln von Stoff war mir Antwort genug. Aber klar war es leise, immerhin war ich in einer geschlossenen Buchhandlung. Nach dem Begreifen, was passiert war, wo ich mich befand und wer bei mir war, kamen Sorge, Frustration und schließlich Resignation.
Wie konnte mir das nur passieren? Wieso diese unüberlegte Entscheidung, stehen zu bleiben. Ich wusste es doch eigentlich besser. Hätte ich mich nur unter irgendeinem Vorwand hingesetzt, ich hätte ja noch mal eines der Bücher in der unteren Reihe prüfen können. Aber nein, ich hatte die dämliche Entscheidung einer Anfängerin getroffen. Wieso nur? Und diese Frage leitete meine Verwirrung ein. Mir war es heute so gut gegangen, ich war schlicht nicht davon ausgegangen, dass es so schlimm um meinen Kreislauf bestellt war. Aber vermutlich war das bloß ein Trugschluss gewesen, weil mich die Arbeit abgelenkt hatte.
Eine Hand huschte durch mein Sichtfeld, griff nach etwas, das sich als kühler Stoff auf meiner Stirn entpuppte, als es wieder zurück auf meine Haut gelegt wurde, vermutlich mit der anderen Seite, denn nun spürte ich ganz deutlich kühle Feuchtigkeit. Automatisch griff ich danach und wollte mich aufsetzen, als starke Hände mich an der Schulter zurückdrückten. »Nicht so schnell.«
Und damit wurde mir dann auch das ganze Ausmaß der Situation bewusst. Ich war ohnmächtig geworden; an meinem ersten Tag, direkt vor meinem Chef. Wow.
Heiße Tränen der Scham füllten meine Augenwinkel. Ein Gedanke jagte den nächsten, während ich die Tränen bekämpfte. Jetzt auch noch loszuflennen, kam überhaupt nicht infrage. »Das war’s dann wohl mit der Stelle«, entschlüpfte es mir. Die Enttäuschung wurde schnell von verzweifeltem Frust abgelöst. Ich konnte nichts dagegen tun. Egal wie engmaschig ich kontrolliert wurde, wie viele ätzende Eisenpräparate, Vitamine und andere Ergänzungsmittel ich auch brav einnahm, es änderte nichts. Kein Arzt hatte bisher eine echte Antwort, geschweige denn eine Lösung gefunden. Ich konnte nichts tun und jetzt würde mir mein Zustand, der für sich schon belastend genug war, schon wieder einen Job nehmen.
Sein Gesicht erschien plötzlich in meinem Blickfeld und ich sah ihn direkt an. Er war unfassbar nah und Hitze stieg in mir auf.
»Geht es dir besser?«
»Ja, klar«, kam die automatische Lüge über meine Lippen. Ruckartig setzte ich mich auf und wäre fast mit ihm zusammengestoßen, wenn er nicht flinker, als ich ihm zugetraut hätte, aus meiner Reichweite gewichen wäre. Erstaunt sah ich ihn an, doch dann schälte sich langsam das feuchte Tuch von meiner Stirn und plumpste in meinen Schoß. Betreten griff ich danach und wollte schon aufstehen, da berührte er mich sachte am Arm und fragte: »Soll ich jemanden anrufen?«
»Was? Nein! Alles gut. Das passiert mir häufiger«, beeilte ich mich zu sagen und begriff zu spät, dass ich ihm in dem Versuch zu demonstrieren, dass ich gut mit der Situation umgehen konnte, verraten hatte, dass er dabei war, ein körperliches Wrack einzustellen.
»Also ich meine … Ich will nicht sagen … Das war nicht so schlimm, weil …« Schließlich brach ich ab, ließ die Schultern sinken und kam auf die Beine. Jetzt noch zurückzurudern, war lächerlich.
Keylam folgte mir direkt, eine Hand in meine Richtung erhoben, als wäre er bereit, mich aufzufangen. Womöglich sogar mich schon wieder aufzufangen. Wie sonst war ich in die liegende Position gekommen? Und überhaupt, wo hatte er so schnell den Lappen herbekommen? Ich starrte auf das feuchte Stück Stoff in meiner Hand und erkannte das Taschentuch, das er mir heute Mittag schon angeboten hatte. Auf dem Tresen hinter ihm entdeckte ich eine offene Wasserflasche und so setzte sich das Bild zusammen.
»Danke«, meinte ich geknickt und reichte ihm das Taschentuch zurück, das von meiner Stirn inzwischen aufgewärmt war.
»Nichts zu danken.«
Ich sog tief die Luft ein und stieß sie anschließend wieder aus. Aufschieben brachte ja doch nichts. Müde sah ich auf in sein Gesicht. Er wirkte nachdenklich, vermutlich weil er darüber nachsann, wie er mir freundlich absagte. Nun, das konnte ich ihm ersparen. »Schon klar«, brummte ich und mein Unmut gewann den Kampf. Ich hätte zwar lieber Größe gezeigt, aber ehrlich gesagt war ich das alles so leid, für Größe hatte ich einfach keine Energie mehr. Mürrisch schob ich mich an ihm vorbei in Richtung Tresen.
Es dauerte einen kurzen Moment, ehe er nachhakte: »Was ist klar?«
Ich trat um den Tresen herum und griff nach meiner kleinen, aber durch den Rock sehr vollgestopften Handtasche, die ich dort deponiert hatte, und richtete mich mit so viel Würde, wie ich erübrigen konnte, auf. Dennoch war mein Ton gereizt, aber wer konnte mir das schon verdenken? »Es tut dir leid, aber dir ist klar geworden, dass du doch keine Hilfe benötigst. Oder du kannst es dir nicht leisten. Oder, oder, oder. Glaub mir, ich habe schon jede Ausrede gehört.«
Keylams Augen weiteten sich, bis er mich anstarrte wie ein Reh im Scheinwerferlicht. Dann fing er sich sichtlich, legte eine glatte Miene auf und bemerkte in kühlem Ton: »Ich weiß nicht, wovon du sprichst.«
Mir klappte die Kinnlade herunter. Kurz war ich versucht, das blanke Ignorieren dessen, was gerade passiert war, hinzunehmen, doch etwas in mir wollte das nicht. Sei es Stolz, Trotz oder ungesunde Neugier, aber ich hakte tatsächlich nach: »Ich soll immer noch morgen früh um halb zehn zur Arbeit erscheinen?«
»Natürlich.«
»Obwohl ich gerade umgekippt bin?«
»Ich verstehe nicht, was das eine mit dem anderen zu tun hat.«
Ich schnaubte. »Blödsinn.«
Er zog die Augenbrauen hoch.
»Ach komm, du willst mir doch nicht allen Ernstes vormachen, du wärst der letzte ehrenhafte Arbeitgeber in dieser gottverdammten Stadt.«
Stille.
Puh, da hatte sich wohl eine Menge in mir angestaut. Ich hatte wirklich alles versucht: Ernährung umstellen, Schlafhygiene, Meditation, Yoga, Sport in allen anderen Varianten, hatte zahllose Ärzte konsultiert und trotzdem war ich keinen Schritt weiter als vor drei Jahren, als die Anfälle begonnen hatten.
»Nur um das richtig zu verstehen, du verlierst häufiger dein Bewusstsein?«
Wozu jetzt noch leugnen. »Hundert Punkte für den Herrn in der Weste«, rief ich, als wäre ich die Moderatorin einer Gameshow.
Sein Mundwinkel zuckte. Er schob eine Hand in die Hosentasche und hob leicht das Kinn. »Und wenn ich deine Worte richtig interpretiere, hast du deshalb schon Mal einen Job verloren?«
»Einen?«, schnaubte ich sarkastisch.
Er nickte bedächtig. »Deshalb gehst du automatisch davon aus, dass ich jetzt, da ich das von dir weiß, ebenso entscheide.«
»Natürlich. Ich kann das ja sogar nachvollziehen. Im Ernst, welcher Chef will schon eine tickende Zeitbombe, die bei jeder möglichen Situation einfach umkippen könnte?«
»Zynisch«, bemerkte er.
Ich zuckte mit der Schulter und zeigte dann einen winzigen Abstand mit Daumen und Zeigefinger. »Vielleicht ein wenig.«
Keylam trat auf mich zu, kam so nah, bis er kurz davor war, in meinen persönlichen Raum einzutreten, und sah mit einem intensiven Blick auf mich herab, sodass unweigerlich eine Gänsehaut meine Arme und meinen Nacken eroberte, und ich war mir nicht sicher, ob es die gute oder die schlechte Sorte Gänsehaut war.
Mit leiser und leicht rauer Stimme sagte er: »Du könntest mir noch bei den Vorbereitungen für den Buchclub helfen. Auf lange Sicht wird das komplett in deinen Aufgabenbereich fallen, da kannst du das auch direkt schon heute lernen.«
Ungläubig starrte ich ihn an. Seine eisblauen Augen huschten hin und her, sein Blick so eindringlich und seine Nähe … alles zusammen fühlte sich wie eine Umarmung an, als würde er mich von der unfairen Welt abschirmen wollen, die bisher mein Leben gewesen war, als verspräche er mir, dass es von nun an anders werden würde. Und auch wenn ich ihm das nie geglaubt hätte, wenn er es mir gesagt hätte, so schaffte es seine Handlung durch die zynischen Mauern meines Selbstschutzes hindurch und säten eine zarte Pflanze der Hoffnung. Er zeigte mir eine weitere Aufgabe, eine die auf lange Sicht ganz mir zufallen würde.
»Wollen wir?«, fragte er leise.
Ich nickte lediglich. Mehr brachte ich nicht heraus. Ahnte er auch nur im Entferntesten, was er mit dieser Reaktion in mir bewegte? Wie könnte er, wenn doch selbst mir erst nach und nach bewusst wurde, was diese eine freundliche Geste in mir auslöste.
»Nun gut. Dann zeige ich dir jetzt mal das Buchclubzimmer und erkläre dir deine Aufgaben.«
Kein Mitleid, keine übergriffige Schonung, nichts von dem, was gute Samariter mir sonst entgegenbrachten. Im Leben waren mir zwei Sorten von Menschen in der Arbeitswelt begegnet, jene, die mich vor jedweder Anstrengung bewahrten, natürlich nur zu meinem eigenen Schutz, und jene, die mich so schnell wie möglich loswerden wollten, mehr zu ihrem eigenen Schutz. Was fing ich nur mit diesem Mann an, der in keine dieser beiden Kategorien passen wollte?
Zack kam exakt um halb acht. Das Buchclubzimmer entpuppte sich als quadratischer Raum mit einem alten Perserteppich und einem eigenen Zugang zur Straße, durch den ein auffallend breitschultriger Mann eintrat. Er streifte sich eine nasse Kapuze vom Kopf und schüttelte sich leicht, ehe er ganz eintrat. Verdammt, es regnete? Ich linste über seine Schulter durch die Tür nach draußen und bemerkte den grauen Schleier herabfallender Tropfen. So ein Mist, ich hatte keinen Schirm dabei. Zack schien mich erst jetzt zu bemerken, denn er stockte im Gehen und starrte mich einen kurzen Moment lang fassungslos an. Ohne eine Begrüßung sah er über meinen Kopf hinweg Keylam an, der hinter mir gerade den Wasserkocher auf dem kleinen Tischlein an der Wand platzierte. »Wer ist das?«
Charmant.
»Das ist Liv, meine neue Mitarbeiterin. Liv, dieser Charmebolzen ist Zack. Keine Sorge, der ist immer so ein Sonnenschein.«
Ich schmunzelte über den trockenen Ton in seiner Stimme.
»Mieses Timing, Key. Richtig mieses Timing«, knurrte Zack.
»Du hast doch so darauf beharrt, dass ich Hilfe benötige. Und für deinen kleinen Club jeden Donnerstag alles herzurichten ist auch etwas, worauf ich gerne verzichte«, bemerkte Keylam kühl und schob eine Hand lässig in die Hosentasche.
»Das ist nicht witzig. Ich habe dafür keine Zeit.«
»Ich muss nicht bleiben. Ich kann das auch nächsten Donnerstag lernen«, beeilte ich mich, zu sagen.
»Ja, geh.«
»Nein, sie bleibt.«
Die beiden Männer starrten sich fest an. Irritiert schaute ich von einem zum anderen und zurück. So wie Keylam mir gerade eben noch von Zack und dem Buchclub erzählt hatte, wäre ich nie darauf gekommen, dass die beiden sich nicht verstanden. Das hier schien sich zu einem Streit auszuwachsen, wie löste ich nur diese Situation?
»Fein, bleib. Aber verschwinde mal für fünf Minuten, ja?«, wandte dieser Zack sich an mich und wedelte mit einer prankenartigen Hand in Richtung Verkaufsraum.
»Klar.« Ich ließ den Stapel Bücher, die ich eigentlich gerade austeilte, einfach auf den nächstbesten Stuhl plumpsen und huschte zur Tür in den Laden rüber. Ich hörte noch Keylam hinter mir sagen: »Ich finde, du solltest dich später für so viel Unhöflichkeit bei ihr entschuldigen.« Dann fiel die Tür ins Schloss und ich sah mich im dunklen Verkaufsraum um. Was jetzt?
Die Regale waren schon wieder alle aufgefüllt, die herausgezogenen Bücher einsortiert, der Tresen abgewischt und die Kasse sogar schon geschlossen. Hier gab es nichts mehr für mich zu tun. Nach einer Beschäftigung suchend ließ ich meinen Blick schweifen. Da entdeckte ich vorne links im Laden den alten Ledersessel mit diesem Globustischlein daneben.
Ich zuckte mit den Schultern. Es gab nichts Sinnvolles mehr zu tun und hier neben dem Tresen hörte ich die Stimmen der beiden Männer noch gedämpft durch die Tür. Natürlich war ich neugierig, inwiefern meine Anwesenheit mieses Timing für Zack war oder was er so Dringendes mit Keylam zu besprechen hatte, doch weder das eine noch das andere ging mich etwas an.
Ehe ich der Versuchung erlag, dem Gespräch zu lauschen, huschte ich auf Zehenspitzen hinüber und befingerte ganz vorsichtig den Globus. Das ganze Konstrukt stand auf drei parallel zueinander laufenden Beinen aus dunklem, glattem Holz. Sie endeten eine Handbreit unter Hüfthöhe in einem Ring, in den der Globus eingelassen war. Meine Finger fanden einen kleinen Metallhaken, den ich zur Seite schob und dann konnte ich die obere Hälfte öffnen. Wie von selbst hatte meine Vorstellungskraft Whiskyflaschen in das Innere gezaubert, doch stattdessen lag darin ein grober Stein auf schwarzem Samt. Ich dachte sofort an einen Bergkristall und diverse esoterisch angehauchte Vorurteile ratterten durch meine Gedanken. Doch dann bemerkte ich, dass der Stein pulsierte. Im Innern glomm etwas Blauviolettes, das definitiv heller und matter im Wechsel wurde. Automatisch streckte ich die Finger danach aus, wollte den Stein genauer untersuchen, ob das blauviolette Glimmen wohl batteriebetrieben war? Da hörte ich die Stimmen lauter werden und eine Tür, die geöffnet wurde.
Aufgeschreckt eilte ich weg von dem Tischlein, hätte fast vergessen, den Globus wieder zu schließen, hechtete noch mal zwei Schritte zurück, klappte den Deckel so leise, wie ich konnte, zu und eilte dann zu den Regalen hier vorne links hinter dem Schaufenster. Alibimäßig zog ich willkürlich ein Buch heraus und tat, als würde ich den Klappentext lesen.
»Es reicht jetzt«, knurrte Keylam und lief mit ausholenden Schritten in den Verkaufsraum.
»Das geht nicht. Wir brauchen eine Brücke!«
»Ich kann dir nicht helfen.«
»Kannst du nicht oder willst du nicht?«
Keylam wirbelte herum und starrte den anderen Mann mit so viel Zorn in den Zügen an, dass ich zusammenzuckte, obwohl ich an die zehn Meter weit weg stand.
Zack ging einen Schritt auf Keylam zu, die Hände flehend erhoben. »Bitte. Es ist Vollmond!«, insistierte der große Mann, der immer noch seine nasse Regenjacke trug und sicher auf den Teppich tropfte.
Halt mal, was hatte er gerade gesagt?