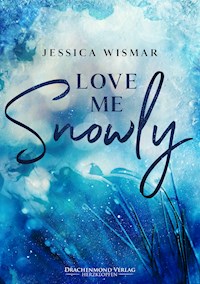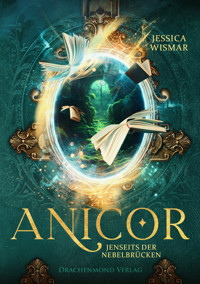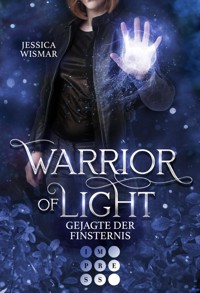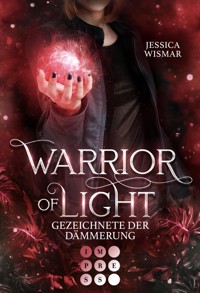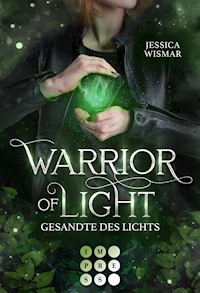
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Wachse über dich hinaus und werde zur Anführerin in einer Prüfung, die dir alles abverlangt: dein Wissen, deine Gabe und nicht zuletzt dein Herz! Eigentlich will Miko die berüchtigten Abschlussprüfungen der St. Mountain Academy of Fighters so schnell wie möglich hinter sich bringen – und das am besten mit einem schlechten Ergebnis! Sie träumt vom ruhigen Bürojob, und nicht davon, in die Schlacht zwischen Gut und Böse zu ziehen. Doch die letzte Prüfung der angehenden Kriegerin des Lichts wird ein Kampf um Leben und Tod. In der Arena ist sie gezwungen, das Leben des Mannes aufs Spiel zu setzen, der ihr alles bedeutet. Miko kann Luca nur retten, wenn sie ihr größtes Geheimnis offenbart: Eine Gabe, die sie zu etwas ganz Besonderem macht in einer Welt, in der nur die Stärksten überleben … Nervenaufreibende Romantasy voll magischem Knistern! Tauch ab in Jessica Wismars neuer Fantasy-Trilogie und werde zur Kriegerin zwischen Licht und Dunkelheit. //Dies ist der erste Band von Jessica Wismars Buchserie »Warrior of Light«. Alle Bände der Reihe bei Impress: -- Warrior of Light 1: Gesandte des Lichts -- Warrior of Light 2: Gezeichnete der Dämmerung -- Warrior of Light 3: Gejagte der Finsternis Diese Reihe ist abgeschlossen.//
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Impress
Die Macht der Gefühle
Impress ist ein Imprint des Carlsen Verlags und publiziert romantische und fantastische Romane für junge Erwachsene.
Wer nach Geschichten zum Mitverlieben in den beliebten Genres Romantasy, Coming-of-Age oder New Adult Romance sucht, ist bei uns genau richtig. Mit viel Gefühl, bittersüßer Stimmung und starken Heldinnen entführen wir unsere Leser*innen in die grenzenlosen Weiten fesselnder Buchwelten.
Tauch ab und lass die Realität weit hinter dir.
Jetzt anmelden!
Jetzt Fan werden!
Jessica Wismar
Warrior of Light 1: Gesandte des Lichts
Wachse über dich hinaus und werde zur Anführerin in einer Prüfung, die dir alles abverlangt: dein Wissen, deine Gabe und nicht zuletzt dein Herz!Eigentlich will Miko die berüchtigten Abschlussprüfungen der St. Mountain Academy of Fighters so schnell wie möglich hinter sich bringen – und das am besten mit einem schlechten Ergebnis! Sie träumt vom ruhigen Bürojob, und nicht davon, in die Schlacht zwischen Gut und Böse zu ziehen. Doch die letzte Prüfung der angehenden Kriegerin des Lichts wird ein Kampf um Leben und Tod. In der Arena ist sie gezwungen, das Leben des Mannes aufs Spiel zu setzen, der ihr alles bedeutet. Miko kann Luca nur retten, wenn sie ihr größtes Geheimnis offenbart: Eine Gabe, die sie zu etwas ganz Besonderem macht in einer Welt, in der nur die Stärksten überleben …
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Vita
Nachwort
© Annika Kitzmann
Neujahr 1990 wurde Jessica Wismar als zweite von vier Töchtern geboren. Was mit dreizehn Jahren als emotionales Ventil diente, wurde über die Jahre zu einer Leidenschaft und Texte, die zunächst nur für sie selbst bestimmt waren, dürfen jetzt auch andere begeistern. Als Mittlere war es für Jessica schon immer wichtig auch die andere Seite zu verstehen, was sie in ihre Charaktere einfließen lässt. Dadurch werden die Figuren facettenreich, was einen bis zum letzten Wort mitfiebern lässt.
Ich widme dieses Buch Juli, denn jene, die erst mal still sind, haben am Ende häufig die besten Ideen.
PROLOG
Einen Monat zuvor
»Willst du das wirklich tun, Traian?«
Er drehte sich fort von ihr, fort von dieser Frage, die drohte, bis tief in sein Innerstes vorzudringen. Fein säuberlich zog er die Mauer um sein Herz hoch und schloss alles dahinter ein. Denn nur so konnte er den Weg, den er eingeschlagen hatte, weiterverfolgen. Seit er die Abschlussprüfung der Kinder des Lichts leitete, war diese härter geworden. Was er sich dieses Jahr vorgenommen hatte, übertraf jedoch alles zuvor Dagewesene. Die Umstände im Krieg gegen die Dunkelheit zwangen ihn zu härteren Maßnahmen. Sie brauchten bessere Absolventen, mehr Krieger und Kriegerinnen, die fähig waren, die Ausbildung für den Außendienst zu meistern. Dieses Fernhalten aller Schwierigkeiten von ihren Kindern war nicht sehr hilfreich, auch wenn er den Wunsch verstand, ihnen wenigstens eine schöne Kindheit zu bieten. Ihr Leben danach war schließlich von Krieg und Tod bestimmt.
»Ich bin der Prüfungsleiter und wir brauchen herausragende Absolventen, jetzt mehr denn je.«
»Aber das ist so … brutal. Ausgerechnet dieses Jahr; denkst du nicht, ein anderer –«
Traian wirbelte herum. »Der Krieg ist brutaler. Kein anderer kann diese Prüfung so leiten wie ich. Kein anderer kann herausfinden, wer von diesen Kindern geeignet ist. Sollte ich recht haben …« Er brachte den Satz nicht zu Ende. Doch Fia wusste bereits von seiner Befürchtung, es könnte ein Leck in den eigenen Reihen geben, auch wenn sie es beide nie ausgesprochen hatten.
Sie wrang ihre Hände, wandte den Blick ab. »Lass uns hoffen, dass du nicht recht hast«, flüsterte sie.
Er trat vor, legte einen Finger unter ihr Kinn, wartete, bis sie ihn ansah, und funkelte die Schattenkriegerin mit all der Entschlossenheit an, die in ihm tobte. »Hoffen können wir uns nicht leisten.«
Fia schluckte schwer. »Also wirst du tun, was deine Aufgabe ist, und ich werde tun, was meine Aufgabe ist.«
Angespannt presste er die Lippen zusammen. »Sei vorsichtig.«
Sie lachte hart auf und entzog ihm ihr Kinn. »Ich bin weder deine Tochter noch deine Frau, also reiß dich mal zusammen.«
Traian mahlte mit den Zähnen. Nein, das war sie nicht, dennoch war sie Familie und das, was einer Tochter am nächsten kam. »Trotzdem«, stieß er hervor.
Fia legte ihre emotionslose Maske an, einer der Gründe, weshalb sie so jung bereits eine Schattenkriegerin war. Wenn sie ihn so anschaute, konnte er nie sagen, was in ihr vorging. »Es wird Zeit. Die zehn Zyklen sind bereit für ihre Abschlussprüfungen«, bemerkte er so nüchtern er konnte.
Kurz blitzte Sorge in ihren Augen auf, dann trat sie mit ihrer gewohnt selbstsicheren Haltung zurück. »Mögen wir uns wiedersehen, wenn das Glück uns hold ist.« Sie streifte das Armband der Meera über und war von einer auf die andere Sekunde verschwunden.
Traian ließ die Schultern hängen. Das Glück war ihnen schon lange nicht mehr hold.
KAPITEL 1
Was für eine Nacht
Ich schreckte hoch, Dunkelheit umfing mich. Es musste mitten in der Nacht sein. Warum war ich aufgewacht? Verwirrt blinzelte ich und erkannte nur ganz schwach die Umrisse meiner Zeltnachbarin. Mila lag vollkommen still neben mir und ich hörte ihren ruhigen Atem. Dann vernahm ich das stetige Prasseln auf der Zeltplane. Donner grollte. Doch zwischen den normalen Geräuschen eines Gewitters erschollen Rufe und noch mehr Lärm, den ich in meinem müden Zustand nicht direkt zuordnen konnte.
Müde sank ich zurück und robbte tiefer in den Schlafsack hinein. Ich war gerade dabei, mir auf der unbequemen Isomatte eine erträgliche Position zu suchen, da registrierte ich Schreie. Sofort setzte ich mich wieder auf.
»Mila! Wach auf!« Voller Unbehagen schüttelte ich meine Zeltnachbarin an der Schulter. Etwas ging draußen vor und meine Intuition sagte mir, dass Mila unbedingt aufwachen musste.
Ich kämpfte mich aus meinem Schlafsack frei. Die selbst im Zelt kühle Nachtluft jagte prompt eine Gänsehaut über meine nackte Haut. Fröstelnd schlang ich die Arme um mich und bereute es, nur T-Shirt und Shorts angezogen zu haben. Die waren zwar perfekt für den Thermoschlafsack, doch außerhalb war das bisschen Stoff eindeutig zu wenig.
Neben mir rappelte Mila sich träge auf. »Was ist los?«, murmelte sie verschlafen und rieb sich die Augen.
»Keine Ahnung!« Woher sollte ich das denn wissen? Wir befanden uns beide in diesem blöden Zelt und ich konnte genauso wenig durch die dünne Zeltplane sehen wie sie. Ich hasste Camping.
Donner zerriss die Nacht und Blitze warfen flackernde Schatten an unsere Zeltwand. Draußen schien das absolute Chaos zu herrschen. Es wurde gerannt und geschrien. Meine anfängliche Unruhe wurde zu einem Hauch Panik. Im Lager gab es nur angehende Krieger und Kriegerinnen, was im Namen des Lichts konnte die dazu bringen, so zu kreischen? Die hektischen Schreie direkt vor unserem Zelt zogen mir die Brust zusammen, meine Hände zitterten so heftig, dass ich den Reißverschluss in der Plane nicht direkt zu fassen bekam. Dabei wusste ich nicht einmal, was los war.
»Mach schon, du Scheißteil«, fluchte ich, doch es dauerte noch gefühlte Ewigkeiten, bis ich endlich das Metall richtig zwischen den Fingern hatte. Mit einem sirrenden Laut öffnete ich die Zeltplane und auch gleich das Fliegengitter mit. Ich kämpfte mich aus den vielen Stoffschichten – wo kam nur so viel Stoff her? – und patschte mit den nackten Füßen raus in den Schlamm. Der Regen prasselte eiskalt auf meine Haut und durchnässte binnen Sekunden mein dürftiges Outfit. Normalerweise würde ich bei so einem Wetter im Zelt bleiben, ganz sicher. Ich war ein Stubenhocker, ein Warmes-Bett-Genießer. Eben das Gegenteil von Outdoorjunkie.
Ich versuchte mir in der Dunkelheit einen Überblick über das Lager zu verschaffen. Mein Zelt lag relativ zentral, am Rand des Mädchenabschnitts. Suchend drehte ich mich nach links. Irgendwo dort vor mir befand sich das Zelt von Sascha, Luca und Toni. Wenn ich nur zu ihnen gelangen könnte, doch ich erkannte in den vorbeihuschenden Lichtkegeln der Taschenlampen nur hektisch umherstürzende Umrisse, die mich ohne Zweifel umrennen würden. Ausweichen war in dieser Dunkelheit kaum drin. Meine Augen brachten mir gerade herzlich wenig, so fast vollkommen ohne Licht. Dafür hörte ich umso mehr. Namen wurden schrill durch die Nacht gerufen. Platschende Schritte und ein ohrenbetäubendes Rauschen, das unwirklich nah schien. Die gehetzte Stimmung steckte mich an. Panik kroch durch meine Adern und brüllte mir zu, ebenso kopflos loszurennen, weg von irgendwas, das ich in diesen Lichtverhältnissen beim besten Willen nicht erkennen konnte.
»Was ist hier los?«, wollte Mila wissen, die sich auch endlich aus unserem Zelt geschält hatte.
»Ich weiß so viel wie du.«
Die Rufe und Schreie prasselten aus allen Richtungen auf uns ein. Plötzlich rannte jemand von hinten gegen mich. Ich erwartete, dass ich auf dem Boden aufschlug, doch dieser Jemand riss mich irgendwie mit sich. Ich wollte Mila anpflaumen, was das sollte. Irgendwie ging ich davon aus, dass sie kopflos losgerannt war. Zeitverzögert spürte ich die Eiseskälte und schluckte unverhofft Wasser. Ich hustete, spuckte angewidert die erdig schmeckende Brühe aus und wollte mich schon beschweren, da tauchte ich unvermittelt unter. Was immer gerade passierte, Mila jedenfalls war es nicht gewesen.
Ich verlor den Halt und dann vollkommen meine Orientierung, schlug hart gegen etwas, ehe ich es endlich wieder an die Wasseroberfläche schaffte und hustend nach Atem rang.
Dann begriff ich es endlich. Wasser! Strampelnd versuchte ich mich irgendwie an der Oberfläche zu halten. Wo kam nur so viel Wasser her? Ich erinnerte mich nicht einmal an einen Bach. Als wir heute Mittag den Berg, hier hinauf auf die Ebene, erklommen hatten, war der Boden trocken gewesen. Ich hatte mich zwar nicht größer umgesehen, aber einen Bach hätte ich bestimmt bemerkt, auch wenn unser Lager mit hundertfünfzig Kindern des Lichts gigantische Ausmaße angenommen hatte. Wobei … jetzt schien davon nicht mehr viel übrig zu sein. Mit Entsetzen dachte ich an meine Klamotten, meine Lieblingssneaker und meinen Glücksteddy. Hatte irgendwas davon diese Wassermassen überlebt?
»Hilfe!«, schrie jemand in meiner Nähe.
Oh, gute Idee! »Hilfe!«, brüllte ich ebenfalls.
»Hilfe! Hilf mir! Hilfe!!!«, schallte es zurück.
Blöde Idee! Wie bitte schön sollte mir in dieser Dunkelheit jemand anderes helfen? Du musst dir schon selbst helfen.
Erneut erklangen die Rufe in meiner Nähe. Dann verschluckte die Person sich und versuchte halb hustend, halb rufend weiterhin dieses eine Wort aus ihrer Kehle zu schmettern. Als ob das was brachte. Wir beide waren auf uns allein gestellt.
Ich prallte mit der Schulter gegen etwas Hartes und keuchte vor Schmerz auf. Ständig brach eine Welle über mir zusammen. Meine Füße und Knie stießen an Gegenstände, vielleicht sogar den Boden, doch die Wassermassen rissen mich erbarmungslos weiter, noch ehe ich hätte stehen oder mich an etwas festhalten können. In diesem Moment war ich zum allerersten Mal in meinem Leben unendlich froh, über Selbstheilungskräfte zu verfügen. Vielleicht war ich auch dank meiner seltenen Gabe so irrational nüchtern.
Natürlich leckte die Panik an meinem Bewusstsein, nur irgendwie glaubte ich, dass das hier gut enden würde. Zugegeben, der erste Schock hatte mich eiskalt erwischt, aber mal ehrlich, das war nicht so richtig echt, konnte es gar nicht. So viel Wasser war kaum natürlich. Außerdem waren wir auf diesem Berg für unsere Abschlussprüfung. Deshalb hatte ich mich ja auch nicht davor drücken können. Ich hätte zwar nie erwartet, dass ein künstliches Unwetter unsere Prüfung war, aber mir war es nur recht, wenn ich nicht kämpfen musste. Wahrscheinlich würde mich am Ende jemand aus dem Wasser fischen und alles wäre gut. Ich würde dann wahrscheinlich durch die Prüfung fallen, doch dafür konnte ich nach Hause in mein warmes, molliges Bett.
Bumm.
»Au!« Ich fluchte derbe. »Das hat wehgetan, verdammt!«, brüllte ich und schluckte als Belohnung die nächste Matschwelle, die über mir zusammenschwappte. Ich spuckte das dreckige Wasser aus und kämpfte gegen den Hustenreiz an.
»Hilfe!«, erklang wieder die winselnde Stimme, näher nun.
Ich und mein dämlicher Helferwahn.
Seufzend kämpfte ich mich auf die Schreie zu. Ehe ich die Quelle der Hilferufe jedoch erreichen konnte, wurde es plötzlich hell vor mir. Ich hörte auf zu paddeln und sah dem Lichtpunkt entgegen, auf den ich unaufhaltsam zutrieb. Es vergingen weitere quälende Sekunden, bis ich das Tor zum Eingang dieses dämlichen Camps erkannte.
Jetzt gewann die Furcht doch einen Moment lang die Oberhand. Denn die rauschenden Wassermassen reichten bis knapp unter die Decke dieses seltsamen Tores. Sofort poppte das Bild dieses Ungetüms vor meinem inneren Auge auf. Beim Reingehen hatte ich mich noch gewundert, wozu man einen zehn Meter langen und etwa vier Meter breiten Torbogen aus massivem Stein brauchte, der fast einem kleinen Tunnel glich, als würde man hinein in eine mittelalterliche Burg laufen. An den Rändern der gewölbten Decke, die etwa in zwei Metern Höhe lagen, hing quer gespannt ein Gitter aus eckigen Metallstreben und in der Mitte baumelte eine einzelne Lampe mit verwittertem Lampenschirm und einer alten Glühbirne. Keine von den modernen LED-Lampen oder auch nur eine Energiesparlampe, nein, so ein uraltes Ding, das ein diesiges gelbliches Licht abstrahlte. Der Schirm befand sich knapp unter dem Gitter und die Aufhängung der Lampe war durch eine Masche gefädelt. Wie lange diese Konstruktion gegen die Wassermassen bestehen würde, blieb jedoch abzuwarten.
Ich schluckte schwer. Auf einen Ritt durch diese schäumenden Stromschnellen konnte ich gut verzichten, selbst wenn hinter dem Tor vielleicht alles vorbei war. Doch ich hatte keine Ahnung, was mich dort in der Schwärze hinter dem spärlichen Lichtkegel wirklich erwartete, und ich wusste auch noch nicht, was mit meinen Jungs war.
Ich paddelte etwas mittiger, damit das Wasser mich nicht gegen die Mauerpfeiler am Rand schleuderte, aber der Sog war so heftig, dass ich das Zentrum schnell wieder mied. Kaum in das Tor hineingetrieben, stieß ich mich nach oben. Ich bekam tatsächlich das Gestänge unter der gewölbten Steindecke in die Finger und konnte mich festhalten.
Freudig überrascht über diesen unerwartet erfolgreichen Versuch, stieß ich ein triumphierendes »Ha!« aus. Nur hielt dieses Hochgefühl kaum eine Sekunde. Schon wurden meine Beine von den Wassermassen mitgezogen und ich brauchte meine ganze Kraft, um nicht mitgerissen zu werden. Meine feuchtkalten Finger glitten langsam über das raue Metall des Gestänges und ich umfasste in einer Woge der Panik die dünnen Streben fester. Der abblätternde Lack schnitt mir scharf in die Haut. Das würde ich nicht lange durchhalten! Meine Finger schmerzten bereits.
Entschlossen machte ich eine Art Klimmzug, was das Beste war, was ich an Kraftübung hinbekam, hob meine Hüfte aus dem Wasser und versuchte mich mit den Fußgelenken in dem Netz aus Metallstreben zu verkeilen. Meine tauben Füße rutschten ab und meine untere Körperhälfte platschte zurück ins Wasser. Verzweifelt krallte ich mich an dem Gitter fest, als der Strom erneut an meinem Körper zerrte.
In dem Moment erklang wieder der Hilferuf. Diesmal jammernd. Ich schaute mich um. Hinter mir hing Mila auf genau dieselbe Art an dem Gestänge. Meine zugeloste Zeltnachbarin, mit der ich vor heute kaum mehr als drei Worte gewechselt hatte, musste mich gesehen und meine Position nachgeahmt haben.
»Hiev die Beine aus dem Wasser. Zieh sie nach oben!«, schrie ich gegen das Tosen an.
»Ich kann nicht mehr.«
»Doch, klar. Komm schon, Mila«, munterte ich sie auf, drehte mich dann aber nach vorne und konzentrierte mich auf meinen eigenen zweiten Versuch. Ich würde selbst nicht mehr lange durchhalten, wenn ich nicht bald meine Beine aus dem Sog herausbekam, und ich ging fest davon aus, dass wirklich jeder kräftiger war. Niemand an der St. Mountain Academy of Fighters hatte so wenig an seinen körperlichen Fähigkeiten gearbeitet wie ich. Besonders unsere Lehrerin für Survivaltrainings war nicht müde geworden, mein Verhalten als pure Arbeitsverweigerung zu bezeichnen.
»Bitte hilf mir«, flehte Mila mit tränenerstickter Stimme hinter mir, gerade als ich meinen linken Fuß durch eine vielleicht zehn Zentimeter große Gittermasche schob. Manchmal war es von Vorteil, klein zu sein.
Schließlich bekam ich den zweiten Fuß in dem Gitter verhakt und das Brennen auf meinem Fußrücken verriet mir, dass ich Haut gelassen hatte. Bloß war mir das herzlich egal. Erleichtert konnte ich endlich die Spannung meiner Körpermitte aufgeben und mich wieder nach Mila umschauen.
Ich bekam den Schock meines Lebens. Da trieb etwas auf uns zu, das entsetzlich nach leblosem Körper aussah. Ein blasses Gesicht als heller Punkt in der Dunkelheit der Wassermassen, regungslos. Ich musste mich irren. Die miesen Lichtverhältnisse spielten mir einen Streich. Doch nein, je näher der Körper trieb, desto klarer nahmen meine Augen wahr, was mein Verstand nicht akzeptieren wollte. Arme und Füße ragten als schlaffe Mahnmale aus dem Wasser und der ovale helle Klecks in den dunklen Strömen war zweifellos ein Gesicht. Das konnte nicht sein. Das hier war nur eine dumme Prüfung. Leblose Körper konnten da unmöglich existieren. Wir waren Kinder.
»Nicht erschrecken, Mila!«, rief ich.
In diesem Moment stieß der Körper gegen meine ahnungslose Zeltnachbarin. Als sie herunterschaute, entdeckte sie das blickstarre Gesicht und kreischte vor Entsetzen aus voller Kehle.
»Halt dich fest!«, brüllte ich gegen ihre Panik an, doch schon entglitt ihr das Metall und sie platschte in das Wasser. Sie tauchte kurz unter und dann … hinter mir erst wieder auf. Ich griff nach ihr, verlor dabei fast selbst den Halt und trotzdem hatte ich keine Chance, an sie heranzukommen. Schnell packte ich das Gitter fester.
»Hilf mir!«, schrie sie mit ausgestreckter Hand in meine Richtung und die Wiederholung dieser geflehten Bitte ging gurgelnd unter, als ihr Körper von der Dunkelheit geschluckt wurde.
Fassungslos starrte ich auf den Punkt, an dem sie untergetaucht war. Sie … das … sie war weg. Einfach so. Sie war am Ende des Torbogens untergegangen und das war’s. Das konnte nicht sein. Wahrscheinlich sah ich sie nur nicht, weil hinter dem Torbogen alles schwarz war. Mila musste dahinter wieder aufgetaucht sein.
Ich horchte, so gut das bei dem Lärm der rauschenden Wassermassen möglich war, doch kein weiterer Hilferuf erklang. So angestrengt ich auch lauschte, das einzige Geräusch blieb das stetige Tosen. Mila war weg. Egal wie sehr ich mir auch einreden wollte, dass das hier nicht passieren konnte, es passierte. Da war ein lebloser Körper an uns vorbeigetrieben. Mila hatte sich nicht festhalten können und sie war tatsächlich in dem Strom untergegangen und nicht mehr aufgetaucht.
Ich fühlte mich taub und leer, die Eiseskälte, die mir in die Knochen kroch, passte zu meinen Gefühlen. Wo waren unsere Lehrerinnen und Lehrer?
Die Hilflosigkeit war grauenvoll. Ich hing hier wie ein Faultier an seinem Baum und nur meine nackten kalten Beine und meine vor Kälte bereits steifen Finger bewahrten mich vor demselben Schicksal, das Mila ereilt hatte. Ich konnte gar nichts tun, außer zu hoffen, dass dieser Albtraum genau das war, ein Albtraum.
Aber je länger ich in meiner Hilflosigkeit gefangen war, desto sicherer wurde ich mir, dass das die bittere Realität war. Was immer schiefgegangen war, wir hatten Mila und noch jemanden verloren.
Das war unfassbar. Ja, wir wurden seit dem Eintritt in die Academy of Fighters für alle möglichen Herausforderungen trainiert. Survivalcamps, Schwertkampf, Giftkunde, Artefaktenlehre, Heilen mit und ohne Gabe, Kampfstrategie und viele Fächer mehr, die wir in den bis zu sieben Jahren Schulzeit absolvieren mussten, aber wer rechnete denn mit so was? Und selbst wenn, wir waren Schülerinnen und Schüler. Es sollte einen doppelten Boden geben. Wo war unser Netz, das uns auffing? Warum war niemand hier, um uns zu retten? Schlimm genug, dass wir, kaum aus der Schule heraus, ständig mit dem Tod durch die Schergen der Dunkelheit rechnen mussten. Diese Wesen, die uns so ähnlich und doch ganz anders waren, entstellte Körper, Seelenlose, die gnadenlos ihr Ziel verfolgten: die Öffnung eines Dimensionsportals. Wieso barg dann eine einfache Abschlussprüfung unserer Schule die Möglichkeit unseres Todes? Das ergab überhaupt keinen Sinn!
Ich spürte Tränen über meine Wangen rinnen. Die Überlebensangst, die sich tief in meine Eingeweide fraß, umklammerte nun auch mein Herz. Ich hatte Freunde im Camp. Toni, Sascha und Luca waren seit einem halben Jahr Teil meines Lebens und inzwischen so was wie Familie für mich. Hatten sie diesen Horror einer Prüfung überlebt? Sie mussten. Ich könnte es nicht ertragen, einen von ihnen zu verlieren.
Zitternd blickte ich hinab auf die reißende Flut und fragte mich, woher überhaupt so viel Wasser auf einmal gekommen war. Doch im nächsten Moment fiel es mir wie Schuppen von den Augen. In den männlichen Kriegerstämmen existierten Gaben, die es einem ermöglichten, Elemente zu beeinflussen. Diese Wassermassen waren nie im Leben natürlichen Ursprungs, wahrscheinlich war nicht einmal dieses Gewitter normal. Jemand, wenn auch jemand sehr Mächtiges, hatte diese Flut ganz absichtlich durch unser Zeltlager gelenkt. Was für ein Wahnsinn, so viele Leben so schamlos zu gefährden. Kämpften wir nicht alle auf derselben Seite?
Ich schob diese Gedanken beiseite, als mir bewusst wurde, dass meine Finger drohten, den Halt zu verlieren. Wenn ich nur wüsste, wie ich aus dieser Situation herauskam. Ich war nicht besonders kräftig und hatte die größten Zweifel daran, mich lange genug festhalten zu können. Sollte das hier alles gemacht sein, konnte ja auch niemand sagen, wann dieser reißende Strom unter mir nachließ. Gerade hasste ich mich dafür, den Survivalunterricht nie sehr ernst genommen zu haben. Aber ich wollte nicht in den Außendienst, mir war es vollkommen sinnlos erschienen, etwas zu lernen, was ich niemals einsetzen wollte. Die Front war kein Ort für mich. Ich hatte sogar immer wieder gefragt, ob ich wirklich an dieser Prüfung teilnehmen musste, wenn ich doch in den Innendienst wollte. Immerhin war ja klar, dass jeder, der durchfiel, in den Innendienst kam. Allerdings war die Antwort jedes Mal gleich ausgefallen: Alle mussten die Prüfung absolvieren, schließlich wisse man nie, wann man in eine herausfordernde Situation kam.
»Verarscht ihr mich?!«, schrie ich in die Nacht. »Wollt ihr mich hier eigentlich verarschen?« Zornentbrannt brüllte ich auf, rüttelte an dem Gitter und begann dann loszuheulen. Ich hatte so entsetzliche Angst um die anderen. Nicht nur um die drei Jungs, um alle Jugendlichen, die im Lager panisch umhergerannt und die letzten Jahre mit mir auf dieselbe Schule gegangen waren. Auch wenn ich kaum einen von ihnen wirklich kannte, so waren wir doch alle Kinder des Lichts und teilten dasselbe Schicksal.
Ich zitterte vor Kälte und konnte nicht aufhören zu weinen. Bald schon brannten meine Muskeln, meine Hände fühlten sich schmierig an und ich begriff, dass ich sie mir aufgerissen hatte. Meine Gelenke wurden steif und ich hatte keine Zeit mehr, Angst zu haben und zu weinen. Ich musste durchhalten.
Ich schaute in alle Richtungen. Links und rechts begrüßten mich die massiven Steinwände, über mir nur noch mehr Stein und das Metallgitter. Die Düsternis, die in Richtung Campausgang lag, verlockte mich nicht sehr. Bestimmt hätte ich die Prüfung verloren, wenn ich die Barriere verließ, die rund um das Prüfungsareal gezogen war. Und solange ich nicht wusste, was aus Toni, Luca und Sascha geworden war, konnte ich nicht einfach aufgeben. Vielleicht brauchten sie mich … na ja, meine Gabe. Tonis charmantes Lächeln tauchte vor meinem inneren Auge auf, dann Saschas scharf geschnittenes Gesicht und schließlich Lucas strahlend blaue Augen. Die Wärme, die mich nun durchströmte, gab mir einen Motivationsschub. Ich würde durchhalten, ich konnte das. Mit meiner Gabe und ihren Gesichtern vor Augen.
Ich legte den Kopf in den Nacken und sah in die Richtung, aus der ich gekommen war. Ans dortige Ende des langgezogenen Torbogens würde ich schon klettern können, aber wohin dann? Wo die Wassermassen in den Durchgang gezwängt wurden, schlugen immer wieder dicke Äste gegen das Metall, an dem ich mich gerade festhielt. Den Aufprall mancher Äste spürte ich sogar hier in der Mitte des Gitters als Vibration. Wenn mich einer von denen traf …
Also ausharren? Etwas Besseres fiel mir jedenfalls nicht ein.
KAPITEL 2
Reiß dich zusammen!
Das Zeitgefühl entglitt mir komplett, als ich mein ganzes Sein darauf ausrichtete, nicht loszulassen. Nur wie lange würde ich hier hängen können?
»So lange du eben musst!«, knurrte ich mich selbst an. Aufgeben kam nämlich nicht infrage. Ich wollte nicht dort in der Dunkelheit verschwinden. Nie hätte ich geglaubt, dass das in dieser Prüfung überhaupt eine Option war. Mein unerschütterlicher Glaube an die Lehrerinnen und Lehrer war dahin. Diese blasse, leblose Leiche ging mir einfach nicht mehr aus dem Kopf. Das Bild, wie sie beinahe friedlich auf uns zugetrieben war, hatte sich eingebrannt. Die leeren Augen starrten mich weiterhin blicklos an. In meinem Kopf griff die Leiche nach Mila und zog sie in die Tiefe. Tränen rannen über meine Wangen. Innerlich flehte ich um Hilfe, nur war ich mir sicher, dass keiner kommen würde. Und auch wenn mir das Geheule nichts brachte, ich bekam weder die Angst noch die Wut in den Griff, egal wie sehr der rationale Teil von mir wusste, dass keins von beidem hilfreich war.
Ich schaute zu der Lampe, einfach damit ich mich irgendwie ablenken konnte. Der Schein blendete mich allerdings so sehr, dass meine Augen bald brannten. Ich drehte den Kopf zur Seite und beobachtete, wie das schaukelnde Licht groteske Schatten an die Wand warf. Zumindest schien der Wasserpegel seit einiger Zeit nicht weiter angestiegen zu sein und die Sorge, ich könnte mitgerissen werden, wenn der Torbogen erst einmal ganz gefüllt war, verebbte. Dennoch verfluchte ich meine Situation. Ich wollte hier weg. Jetzt sofort! Ich wollte einfach nicht mehr. Bitte.
Erst flehte ich, dann weinte ich und schließlich brüllte ich vor Wut. Ich rüttelte sogar zornentbrannt an den Gitterstäben, was ich sofort wieder ließ, als meine Hände schmierig vom Blut wurden. Schnell schloss ich die Wunden und unterdrückte den Impuls, meine Hände an meinem pitschnassen T-Shirt abzuwischen. Ich traute meiner Griffkraft nicht zu, einhändig hier zu baumeln, so steif, wie meine Glieder sich anfühlten.
Irgendwann begann ich die Gitterstäbe zu zählen. Ich musste die grausigen Bilder, die die Angst in meinen Kopf pflanzte, loswerden. Mila, dazu erdachte Bilder von Luca, Toni und Sascha, die eines schlimmer als das andere waren … Ich zählte und zählte und verzählte mich absichtlich, damit ich von vorne anfangen konnte. Ich zählte so lange, dass ich erst verzögert bemerkte, wie der Himmel langsam heller wurde. Die ersten Strahlen krochen über das Firmament und vertrieben die durchdringende Schwärze, hier drinnen im Tor vermutlich deutlich langsamer als draußen.
Jetzt schaute ich mich wieder mit dem Ziel um, einen Ausweg zu finden, und begriff, dass der Strom unter mir deutlich an Höhe verloren hatte. Mein Blick wanderte sofort zur Seite und ich erkannte an dem guten Stück feuchter Mauerwand, dass der Wasserstand nur noch bis zur Hälfte der Bogenseiten reichte. Ich ließ den Kopf in den Nacken fallen, um zum Anfang des Torbogens spähen zu können. Der Abstand zwischen Gitter und Wasseroberfläche war tatsächlich deutlich größer geworden. Gut.
Ich löste meine verschränkten Füße und keuchte auf vor Schmerz. Meine Muskeln brannten entsetzlich, meine steifen Gelenke rebellierten. Wieder war ich unendlich dankbar für meine Gabe und heilte kurzerhand meine beanspruchten Extremitäten. Einige Wunden ließ ich jedoch übrig, denn wenn ich auf andere treffen würde, wollte ich nicht aus einem unbedachten Impuls heraus mein Geheimnis offenbaren. Keiner wusste, wozu ich fähig war, nicht einmal die Jungs, und so sollte es auch bleiben.
Heilerin zu sein ist eine Ehre, jeder will dein Freund sein, erklang die Stimme meiner Tante in meinem Kopf. Die Vorstellung, dass jemand mich nur wegen meiner Gabe um sich haben wollen könnte, war grauenvoll. Schlimm genug, dass meine Tante es Herrn Senger gesagt hatte, dem Lehrer für Heilkunst; wenigstens war er verschwiegener als meine Tante. Ich hasste es, Waise zu sein, vor allem dank ihrer zweifelhaften Fürsorge, die mehr meiner Gabe gegolten hatte als mir. Wie die Liebe von Eltern aussehen konnte, hatte ich das erste Mal mit sechs Jahren entdeckt und seither sehnte ich mich danach. Es war bloß eine Kleinigkeit gewesen, an einer Eisdiele hatte eine Mutter ihr Kind vor einer Wespe beschützt und ihm dann die Hände und den Mund sauber gewischt. Tanta Hilda hatte im nächsten Moment eine ihrer Zurechtweisungen auf mich niedergehen lassen, als ich mein eigenes Eis verputzt hatte: Kind, wie siehst du denn aus? Eine Heilerin sollte mehr Würde haben. Wenn du nicht richtig essen kannst, bekommst du eben kein Eis mehr. Und das war keine leere Drohung gewesen. Ich hatte tatsächlich nie wieder eine Eiskugel an einer Eisdiele bekommen.
Ächzend schüttelte ich die Erinnerungen ab und hangelte mich zum Rand des Gitters. Ich war inzwischen siebzehn Jahre alt und hatte Hilda seit fünf Jahren nicht mehr besucht. Diese Zeit bei ihr lag hinter mir und mit ihr die Sehnsucht nach Eltern. Ich hatte etwas Besseres gefunden, ich hatte eine echte Familie.
Wie Luca es mir erst vor drei Wochen gezeigt hatte, versuchte ich meine Beine seitlich am Gitterende hochzuschwingen. Ich brauchte drei Anläufe, bis ich meine Hacke von oben in das Gitter verkeilt bekam. Keuchend schöpfte ich Kraft, dann zog und zerrte ich, bis ich mich auf den Zwischenboden hievte. Ein angestrengtes Stöhnen entkam meinen Lippen. Das Metall bohrte sich in meine Rippen, aber ich konnte mich einfach nicht mehr rühren. Ein vorwitziges Blatt eines im Gitter hängen gebliebenen Astes kitzelte an meiner Nase und ich pustete es weg.
Schließlich setzte ich mich vorsichtig auf, darauf bedacht, nicht an den Stein zu stoßen, umfasste den Torbogen und kletterte ganz hinauf. Vorsichtig richtete ich mich auf, stemmte die Arme in die Seiten und sah mich um. Der heranbrechende Tag tauchte den Berg vor mir in unwirkliches Zwielicht. Der Hang, auf dem unser Zeltlager auf halber Höhe aufgeschlagen worden war, bestand zu großen Teilen nur noch aus einer gigantischen Matschfurche, entwurzelten Bäumen und zerbrochenen Ästen. Dafür wand sich relativ zentral ein an die zehn Meter breiter Fluss hinab, direkt auf mich zu. Von den Zelten oder anderen Kindern war weit und breit nichts zu sehen.
Ich ließ meinen Blick weiter schweifen, entdeckte jedoch bloß links und rechts vom Torbogen die Mauer, die das Gelände der Prüfung magisch vor Eindringlingen schützte, waren es nun Menschen oder die Diener der Finsternis. Hinter mir lag die Welt außerhalb des Camps, doch dort waren nur noch mehr Grün und der braune Strom, der sich durch die Landschaft bis hinunter zu dem See fraß, an dem wir gestern Mittag angekommen waren.
Mit wackligen Beinen setzte ich mich in Bewegung und balancierte über das Mauerstück links von mir. Während ich von dem heißen Flirren der Barriere begleitet wurde, hielt ich Ausschau nach einem Baum, über den ich herabklettern konnte. Ich lief und lief, aber ohne Erfolg. Es dauerte so lange, dass ich darüber nachdachte, die drei Meter einfach runterzuspringen. Ich war nicht geschickt, hatte nackte Füße und der Boden war matschig. Ich war todmüde. Das musste doch schiefgehen. Andere Heilerinnen und Heiler wären ohne Zweifel gesprungen. Wie oft hatte Tante Hilda gesagt: Was soll’s, du kannst dich ja heilen.
Diese Worte klangen mir immer in den Ohren, sobald ich vor so einer Entscheidung stand. Aber wenn man nicht preisgeben wollte, was man konnte, und bei so einem Sturz beobachtet wurde, musste man sechs Wochen mit Gips herumrennen. Einen Sommer lang war mir das sehr auf die Nerven gegangen. Außerdem gab es da ein moralisches Stimmchen in mir, das es einfach nicht richtig fand, so verschwenderisch mit dieser Gabe umzugehen.
Allerdings ragte weit und breit kein Baum nah genug an diese verdammte Mauer heran. Hier waren Bäume. Hunderte bestimmt. Einige lagen im Morast, das große Wurzelnetz in den Himmel gereckt, doch allesamt zu weit entfernt, als dass ich sie als Hilfe nutzen könnte. Nicht einmal an herabhängende Äste kam ich heran. Toni hätte sie wahrscheinlich problemlos gegriffen bekommen. Und auch Luca mit seiner unmenschlichen Sprungkraft wäre sicher an einige herangekommen, doch ich …
Seufzend drehte ich um und lief zurück zu einem Stück Mauer, wo mir der Boden näher vorgekommen war. Außerdem hatte der Grund dort nicht ganz so matschig ausgesehen.
Es waren etwa hundert Schritte, dann war ich wieder an der Stelle.
»Warst du nicht eben noch näher?«, fragte ich den Boden unter mir vorwurfsvoll.
Ich hasste Sprünge aus der Höhe. Die Jungs hatten mir erklärt, was ich machen musste, nur hatten wir das, im Gegensatz zum Kämpfen, nie wirklich geübt. Diese unverbesserlichen Optimisten hatten tatsächlich eine Kriegerin aus mir machen wollen, damit ich in dieser Prüfung nicht komplett versagte, aber was brachte mir der dumme Schwertkampf, wenn eine Scheißwasserlawine mich beinahe in den Tod riss?
Wieder tauchten die blasse Leiche vor meinem inneren Auge auf und Mila, wie ihr das Gitter entglitt und sie einfach untertauchte. Ich hatte sie nicht erreichen können, das war mir klar … theoretisch, in meiner Vorstellung allerdings vollführte ich einen beeindruckenden Stunt und zerrte sie aus den Fluten. Ich wusste, es war unmöglich gewesen. Nur wurde dieses Wort gerade als Heilerin neu definiert. Ich wünschte mir so sehr, dass ich etwas hätte ausrichten können. So musste Sascha sich fühlen, wenn er eine Vision von etwas hatte, das er nicht ändern konnte, wie diesen Winter, als er den Tod von Lucas Bruder gesehen hatte.
»Jetzt musst du erst mal von dieser verdammten Mauer runter. Sonst richtest du gar nichts aus«, beschwerte ich mich bei mir selbst und schob den Schmerz in meiner Brust bei dieser Erinnerung beiseite.
Ich starrte auf den Boden, der sich noch weiter zu entfernen schien.
Die Jungs!, erinnerte ich mich an den Grund, weshalb ich unbedingt hier herunter und zurück auf diesen verdammten Berg musste. Weshalb ich nicht aufgeben konnte und weitermachen musste.
Angespannt holte ich Luft. Ich würde springen. Jetzt … gleich … sofort … also sofort gleich.
»Scheiße!«, stieß ich wütend hervor. »Du feiges Huhn.«
Ich schloss die Augen, presste meine Kiefer fest zusammen und zählte bis drei … und sprang. Ein Quieken entwich mir und ich riss die Augen wieder auf. Gerade noch rechtzeitig, um den Boden zu sehen, der mir entgegenraste. Bei der Landung ging ich so gut ich konnte in die Hocke und rollte mich ab. Kurz verharrte ich am Boden kniend und horchte in mich hinein. Das war nicht wirklich flüssig gewesen, aber offensichtlich flüssig genug, dass ich mir nichts verstaucht oder gebrochen hatte.
Ich sprang auf die Beine, drehte mich zur Mauer um und schrie »Ha! Ha!«
Wie albern.
Doch es half. Es lenkte mich von dem vergangenen Horror und der Angst vor dem, was mich gleich erwarten würde, ab.
Ich runzelte die Stirn und betrachtete die Mauer genauer. War das …? Ich trat auf die Wand aus Stein zu und sah mir die Stelle gründlich an. Da war tatsächlich ein Loch in der Mauer. Ich ging noch etwas näher heran und hätte fast laut aufgelacht. Ein Loch! Und zwar ohne die pulsierende Energie einer Barriere.
Freiheit! Hier konnte ich unbemerkt nach draußen und diesem Horrorberg entfliehen. Wie gerne ich dort raus wäre. Freunde zu haben, konnte auch ganz schön nerven. Seufzend wandte ich dem Loch den Rücken zu, marschierte parallel zu dem verdammten Fluss rechts von mir diesen vermaledeiten Berg wieder hinauf und wischte mir den Matsch von der Schulter, den meine Abrollaktion in den dünnen Stoff meines Schlafhemdchens einmassiert hatte. Das Motivshirt klebte unangenehm an meinem Rücken. Wenigstens konnte man den Ich-bin-faul-Spruch auf der Brust noch lesen. Komplett bescheuert, dass mir das in dieser Situation wichtig war. Schnell stapfte ich weiter, über mich selbst den Kopf schüttelnd.
Meine nackten Füße waren so taub von der Kälte, dass ich nicht einmal mehr spürte, ob ich auf weichem Matsch oder spitzen Stöcken lief. Ich riss mir bestimmt Wunden in die Fußsohlen, aber das war okay. Wenn ich erst einmal Schuhe anhatte, konnte ich sie heilen, ehe sie sich durch den ganzen Dreck entzündeten.
Nichtsdestotrotz wurde jeder Schritt zurück den glitschigen Hang hinauf zu einem Kampf. Mir graute vor dem Anblick dessen, was von unserem Lager übrig war. Aus der Ferne hatte ich nicht einmal mehr weiße Tupfen ausmachen können. Meine Hoffnung klammerte sich an den Umstand, dass man die Ebene, auf der unsere Lager aufgestellt war, von unten nicht ganz einsehen konnte und die Lichtverhältnisse nicht die besten gewesen waren. Ich schüttelte den Kopf, vertrieb die Horrorszenarien, die mein Gehirn mir einflüsterte, und fokussierte mich auf den Aufstieg. Was brachte es, mich jetzt verrückt zu machen? Ich würde gleich schon sehen, was von unserem Zeltplatz übrig war.
Als ich schließlich die Stelle erreichte, die gestern Abend unser Lager gewesen war, voller aufgeregt schnatternder Prüflinge, die den Beginn der Prüfung kaum hatten abwarten können, konnte ich nur noch stumm starren. Alles war mit Schlamm überzogen. Die Wassermassen hatten sich ein Bachbett gegraben, das mitten durch die Zeltstadt führte. Es schlängelte sich mal nach links und mal nach rechts, unaufhaltsam den Berg hinunter. Zumindest war von dem reißenden Strom kaum mehr als ein klägliches Rinnsal übrig und der zehn Meter breite Strom, den ich von unten zu sehen geglaubt hatte, war das schlammige Flussbett, das die Wassermassen zurückgelassen hatten. Am Rand dieser matschigen Schlange entdeckte ich vereinzelte Zelte, die braun von Matsch oder halb unter Ästen vergraben waren, weshalb ich vermutlich ihr Weiß von unten nicht mehr hatte sehen können. Manche der Planen waren aufgerissen, bei anderen Zelten das Gestänge zerknickt, nur ein einziges stand einsam da und hatte der unbändigen Kraft des vergangenen Sturms getrotzt.
Zu meiner großen Erleichterung entdeckte ich nun auch einige Gestalten, die zwischen den Überresten unserer Behausungen herumliefen, Äste hochhoben oder zur Seite warfen und sich immer mal wieder bückten, um etwas aufzuheben. Vermutlich sammelten sie brauchbare Reste unseres Gepäcks ein. Leider kam mir keiner von ihnen bekannt vor und jetzt aus der Nähe wurde mir auch klar, warum ich sie von weiter weg nicht erkannt hatte. Der Dreck auf ihren Körpern ließ sie fast mit der schlammigen Umgebung verschmelzen.
»Hallo?«, rief ich eher kläglich. Was sagte man in so einer Situation? Na, auch überlebt? Ich schnaubte. Eher nicht!
Der Junge, der mir am nächsten war, richtete sich auf.
»Hallo. Schön, dass du es geschafft hast.« Er lächelte mich mit seinem dreckverschmierten Gesicht traurig an. Seine braunen Haare waren zur Hälfte unter Matsch vergraben, die restlichen standen wild in alle Richtungen ab.
»Ja«, antwortete ich. Schwache Leistung. »Gibt …« Ich räusperte mich. »Gibt es noch mehr?« Die flehende Hoffnung in meinem Innern betete für ein Ja.
Der Junge sah sich um. »Die anderen sind dort hinter dem Buckel mit den dicken Steinen. Wir suchen nur nach brauchbaren Dingen. Essen, Kleidung. Du weißt schon.« Er zuckte mit den Schultern.
Der Kloß in meinem Hals wurde etwas kleiner. Die Jungs konnten dort hinter dem Hügel sein. »Okay, danke.«
Er schaute an mir herab. Ich konnte mir gut vorstellen, wie ich aussah. Durch den Aufstieg war meine spärliche Kleidung weitestgehend getrocknet, aber es blieb Schlafunterwäsche. Wie froh ich jetzt war, mich nicht getraut zu haben, vor meiner unfreiwilligen Zeltnachbarin blankzuziehen. So trug ich wenigstens noch einen BH unter diesem zerfetzten Stück nutzlosen Stoffes.
»Komm her, hier sind einige Sachen, die überlebt haben«, bemerkte er und winkte mich heran.
Ich marschierte zu ihm und entdeckte einen Haufen Kleidung in der Tasche, die er über der Schulter trug. Da gab es allerdings ein Problem. Ich war klein. Egal welches Kleidungsstück ich in die Hand nahm, es war eindeutig nicht für Personen meiner Statur gemacht. Und einen Gürtel fand ich natürlich ebenfalls nicht. Resigniert zog ich einen schwarzen Rock heraus, das einzige Kleidungsstück in XS. Besser als nichts. Ich wollte direkt in den Rock steigen, doch dann wurde ich mir meiner schmutzstarrenden Füße und Beine bewusst. Nur wo bekam ich Wasser zum Saubermachen her?
Mein Gesicht musste Bände sprechen, denn der Junge meinte hilfsbereit: »Da vorne ist ein eingeknicktes Zelt, in dem sich eine Menge Regenwasser gesammelt hat«
»Danke.« Ich wollte schon los, als ich auf meine Füße schaute. »Ich brauche Schuhe.« Ich hatte vermutlich die verdammt noch mal kleinsten Füße der Welt.
»Welche Schuhgröße hast du?«
»Fünfunddreißig.«
»Mann, du bist ein Glückspilz. Lyca hat ihre Tasche gerettet und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie fünfunddreißig trägt. Wahrscheinlich hast du keine große Auswahl, aber ihre könnten passen«, gab er mir einen weiteren hilfreichen Tipp.
»Danke, äh …« Ich hatte keine Ahnung, wie er hieß.
Mit einem Lächeln auf den Lippen schmierte er seine Hand an der Hose ab und streckte sie mir entgegen. »Ron.«
»Danke, Ron.« Matt lächelte ich ihn an, während ich einschlug. Anschließend stapfte ich in Richtung des neuen Lagers davon. Es war keine nennenswerte Distanz, die ich zu überwinden hatte, vielleicht zweihundert Meter, was ich irgendwie grotesk fand. Gestern Nacht musste für alle der blanke Horror gewesen sein. Warum wollten sie nicht mehr Abstand? Mich jedenfalls trieb es so weit weg vom alten Lager wie möglich.
Ich bog um den Steinhaufen und hätte fast entsetzt aufgekeucht. Hier saßen höchstens zwanzig Kinder des Lichts in kleinen Gruppen zusammen. Die meisten sortierten Kleidung und andere Campingutensilien, aber einige lehnten auch apathisch aneinander und starrten blickleer in die Gegend. Zwanzig von einhundertfünfzig und kein einziges Gesicht, das mir bekannt vorkam. Panik kroch meine Kehle hinauf und schnürte sie zu.
Ganz ruhig. Bestimmt waren die meisten ausgeschwärmt wie dieser Ron, um Herr der Lage zu werden, sich umzusehen und so weiter. So würden es Luca, Toni und Sascha definitiv machen. Sie gehörten zu den stärksten Kriegern meines Jahrgangs. Sie würden nicht einfach nur herumsitzen, niemals.
Die Panik niederringend ließ ich meinen Blick über die Gruppe schweifen, die in einer kleinen Senke zwischen moosbewachsenen Felsen saß. Wie sollte ich diese Lyca finden?
»Lyca?«, rief ich einfach irgendwann, als ich es aufgab, ihre Fußgrößen abzuschätzen. Was für ein sinnloses Unterfangen auf diese Distanz.
»Hier. Hi.« Ein junges Mädchen, wahrscheinlich zwei Jahre jünger als ich und damit vermutlich im jüngsten der drei teilnehmenden Prüfungsjahrgänge, stand mit erhobener Hand auf. Sie war, unfassbar, tatsächlich noch ein bisschen kleiner als ich. Sehr sympathisch.
Ich ging auf sie zu. »Ron schickt mich. Er meinte, du könntest mir vielleicht helfen. Ich habe keine Schuhe und wir könnten dieselbe Größe haben«, erklärte ich und kam mir so entsetzlich dreist vor. Ich wusste gar nicht, wie ich das hatte ernsthaft so ausdrücken können.
»Tut mir leid. Ich will nicht sagen, dass du mir Schuhe geben musst. Es ist nur, ich hab–«
»Ach Quatsch. Natürlich bekommst du Schuhe. Komm her und schau, ob die hier dir passen«, meinte das Mädchen sofort hilfsbereit und ich seufzte erleichtert auf. Lyca band sich flink die braune Lockenmähne zurück, beugte sich über ihre Tasche und zog ein Paar schwarze Lederstiefel mit Nieten daraus hervor. Nicht gerade mein Stil, aber das war mir so was von egal, Hauptsache, sie passten.
»Ich würde sie zu dem Zelt da vorne mitnehmen, damit ich mich erst waschen kann«, bemerkte ich.
»Vernünftig.« Lyca nickte nach einem kurzen Blick auf meine Beine und Füße. »Ich habe leider nur die«, entschuldigte sie sich, als sie mir die Boots reichte. »Hier, das kannst du sicherlich auch gebrauchen«, sagte sie mit entschuldigendem Lächeln, als sie mir Socken und ein Shirt hinhielt.
»Danke!«, stieß ich unendlich erleichtert hervor. »Die sind jetzt wahrscheinlich gar nicht so verkehrt.«
»Wahrscheinlich.«
Ich wanderte wieder zu unserem ursprünglichen Lager zurück und ging zu dem eingeknickten Zelt am Rand des Lagers, das Ron mir gezeigt hatte. Es hatte nicht sehr viel abbekommen, aber es war leicht eingefallen und in der Mitte der Plane hatte sich eine große Pfütze sauberen Wassers angesammelt.
Das Waschen und notdürftige Trocknen mit meinem zerrissenen Nachthemdchen war eine beruhigende Arbeit. Zumindest so lange, bis meine Gedanken abschweiften und ich mich fragte, wo all die anderen sein konnten. Mein Blick glitt zu der Schlammfurche, unter der einige Zelte begraben sein mussten. Konnte es sein … konnten die Bewohner dieser Zelte … Ich unterband den Gedanken, schüttelte den Kopf und redete mir ein, dass wenn ich es hinausgeschafft hatte, alle anderen auch entkommen sein mussten. Hektisch führte ich meine Katzenwäsche fort und schlüpfte in Lycas Kleidung und den erbeuteten Rock.
Als ich fertig angezogen war, schaute ich an mir herab und musste einfach schmunzeln. Schwarze Nietenboots, die über die Knöchel reichten und aus denen grau melierte Wollsocken hervorlugten, dann ein schwarzer High-Waist-Tellerrock, unter dem ich noch meine grauen Shorts trug. Darüber ein beiger Sweater mit Ärmeln, die nur bis knapp über den Ellbogen reichten, und ein selbst ausgeschnittener Kragen, der so breit war, dass er mir ständig über eine meiner Schultern rutschte. Das Beige war mit schwarzgrauen Schatten auf alt oder vielleicht eher rockig gemacht. Außerdem verliehen zwei schwarze Balken und die große kantige Fünf in der Mitte dem Ganzen eine Footballoptik. Alles in allem Klamotten, die ich nie tragen würde. Ich mochte schlichte, pragmatische Kleidung, T-Shirts und Jeans in gedeckten Farben. Doch ob ich so was je wiedersehen würde, blieb abzuwarten. Zumindest musste ich mir mit meinen kurzen Haaren keine Gedanken darüber machen, wo ich ein Haargummi herbekam. Ich kämmte sie mit den Fingern zurück und ging dann zum neuen Lager.
Dort hatten sie inzwischen ein Feuer entzündet und begonnen, neue Schlafplätze herzurichten. Aus Zeltplanen spannten sie Dächer, unter denen sie sich zusammenrotteten. Ich schaute mich aufmerksam um. Aus meinem Jahrgang war immer noch weit und breit niemand zu sehen. Das war gar nicht so verwunderlich, nicht wahr? Sicherlich waren sie als Älteste alle unterwegs, um Feuerholz zu holen und so einen Kram eben. All die Dinge, die man in den Survivalcamps lernen sollte, die ich allerdings nicht interessant gefunden hatte. Die anderen in meinem Jahrgang dagegen waren hervorragende Schüler und Schülerinnen gewesen, welches Kind des Lichts wollte das auch nicht sein? Immerhin bekamen wir vom ersten Tag an eingetrichtert, dass wir nur so im Außendienst überleben konnten. Und während alle anderen daraus die Konsequenz gezogen hatten, sich wirklich anzustrengen, war mein Schluss gewesen, dass ich einfach in den Innendienst gehen würde.
Ron trat plötzlich neben mich und legte mir väterlich eine Hand auf die Schulter. »Hey, wie heißt du eigentlich?«
»Mirakova«, nannte ich meinen Namen, obwohl er sich ungewohnt auf meiner Zunge anfühlte. Seit die Jungs vor einem halben Jahr in mein Leben getreten waren und mir einen Spitznamen verpasst hatten, benutzten ihn nur noch meine Lehrerinnen und Lehrer. Mit meinen siebzehn Jahren sollte ich Spitznamen vermutlich albern finden, aber ich mochte es, sehr sogar. Es fühlte sich warm und nach Familie an, wenn meine Jungs ihn nutzten.
»Also, Mirakova. Vielleicht kannst du dich ja nützlich machen und irgendwo mit anpacken.« Er lächelte mich freundlich an.
»Wo sind denn die anderen?«
Seine Miene trieb mir einen Schock in die Knochen. Ich hielt den Atem an und wollte die Antwort gar nicht mehr hören.
»Es gibt keine anderen. Das sind alle.«
Ich konnte die Worte kaum realisieren. Sie waren weg? Luca, Sascha und Toni … Tränen stiegen mir in die Augen und ließen meine Sicht verschwimmen. Das ging nicht. Das durfte nicht sein! Das …
Gelähmt vor Schmerz und Trauer versuchte ich zu begreifen, wie das möglich sein sollte. Das war es nicht. Es war nicht möglich. Tonis neckende Sprüche, sein immer fröhliches Wesen, er sollte einfach weg sein? Und Sascha … Er war ein Seher, wieso sollte er das hier nicht überlebt haben? Er hätte doch bestimmt eine Vision bekommen. Eine Welt ohne seine stoische Miene, ohne seinen Kontrast aus harter Mauer und sanfter Seele, das ging nicht. Und Luca … Mein Herz zog sich schmerzhaft zusammen und ein Schluchzer stahl sich über meine Lippen. Warme Hände manövrierten mich zu einer Plane, auf der ich mich zusammenrollte, meine Beine anzog und bitterlich weinte. Ich sollte sie alle verloren haben?
Ich dachte an Toni, das war leichter, als an Luca zu denken. Nie wieder sollte ich sein ausgelassenes Lachen hören, nie wieder die kleinen Grübchen in den Wangen sehen, wenn er verwegen schmunzelte? Der Schmerz, der mich überrollte, war unerträglich. Er mit seiner unendlichen Körperstärke hätte doch jeden umfallenden Baum zur Seite schieben können. Dann Sascha, er war oft so kühl, so perfekt, so diszipliniert, wieso nur hatte seine Gabe ausgerechnet jetzt versagt? Und Luca … Der Schmerz in meiner Brust war überwältigend. Meine Freunde und einfach jeder, der die letzten sieben Jahre Teil meines Lebens an der Academy gewesen war, war tot.
Irgendwann raschelte die Plane, als jemand sich neben mich kniete und mir einen dampfenden Becher unter die Nase hielt. »Hier, iss etwas.«
Essen, wozu …? Die Jungs würden nicht wiederkommen, wenn ich etwas aß. Was in den letzten Stunden passiert war, sollte nicht möglich sein, durfte nicht möglich sein. Ich gehörte zu den Schwächsten in meinem Jahrgang, wahrscheinlich war ich sogar die Schwächste. Ausgerechnet ich hatte als Einzige überlebt? Welche Ironie des Schicksals. Das war einfach nur aberwitzig. Niemand hätte je auf mich gesetzt und dann war ich die Einzige. Das war …
»… sehr unwahrscheinlich«, murmelte ich und setzte mich ruckartig auf.
»Doch, du solltest etwas essen«, beharrte das Mädchen, das neben mir saß und mir eine Schale mit dampfender Flüssigkeit hinhielt.
Aufgeregt packte ich sie an den Schultern, wobei das dampfende Gebräu überschwappte, und schüttelte sie euphorisch. »Nein! Es ist sehr unwahrscheinlich, dass ausgerechnet ich überlebt haben soll. So unwahrscheinlich, dass es einfach nicht stimmen kann. Ich muss sie nur suchen!«, rief ich lachend aus.
Schon sprang ich auf die Beine.
»Schön für dich, aber das war ja wohl unnötig«, motzte sie und sah demonstrativ auf ihren nassen Schoß, auf dem Suppennudeln verteilt lagen.
»Ja, sorry deswegen«, meinte ich schnell und rannte los. Wenn das Wasser sie mitgerissen hatte, dann war der Rand des Flusslaufes der wahrscheinlichste Ort. Den ganzen Berg hinab bis zum Tor hastete ich das inzwischen beinahe ausgetrocknete Bachbett entlang, das ich beim Aufstieg bewusst gemieden hatte. Zu viele miese Erinnerungen, die mir gerade vollkommen egal waren. Das Wasser hatte tiefe Furchen in den Boden gegraben. Dort lagen abgerissene Äste, mitgeschwemmte Kleidung und sogar aus dem Boden gewaschene Steine. Aber sonst fand ich nichts, keinen einzigen Prüfling, weder meine Jungs noch sonst jemanden.
Mit gerunzelter Stirn stand ich am Rand des Torbogens, der die halbe Nacht mein bester Freund gewesen war, und starrte den Wasserlauf bitterböse an. Jetzt, da das Wasser kaum mehr als ein Rinnsal bildete, stapfte ich durch den schlammigen Torbogen und fand am Ende die Barriere. Dahinter gluckerte das Wasser ungehindert weiter und ich beobachtete, wie die Schlammschlange sich bis hinunter in das kleine Waldstück am Seeufer schlängelte. Wenn jemand mitgerissen worden war, fand ich ihn vielleicht dort unten. Hinter der Barriere, außerhalb des Camps. Dort, wo wir nicht hindurften, das war uns ganz klar beim Betreten des Camps gesagt worden. Aber das war mir egal, ich hatte ein Ziel! Und so leicht gab ich sicher nicht auf. Endlich, nach sechseinhalb wirklich harten Jahren voller Einsamkeit und Ausgrenzung, hatte ich Freunde gefunden und ein wundervolles letztes Schulhalbjahr erlebt. Diese verdammten Scheißwassermassen nahmen sie mir nicht weg! Nicht alle auf einmal. Das war zu unwahrscheinlich. Ich musste nur da raus und das Ende dieses dämlichen Wasserstroms finden.
Siedend heiß fiel mir das Loch in der Mauer wieder ein. Ich konnte raus!
Sofort joggte ich los. Nach einer gefühlten Ewigkeit kam ich schwer atmend an der Stelle an, an der die Erde von meinem Abrollen auffallend geplättet war, und zwängte mich durch das Loch. Manchmal war es auch einfach gut, so klein zu sein. Die Bruchkanten der Mauer kratzten mir dennoch die Haut über der Wirbelsäule auf. »Au!«, stieß ich aus, als das scharfe Brennen meinen Rücken hinaufjagte.
Im Bruchteil eines Moments heilte ich die aufgeschürfte Haut und eilte im Laufschritt an der Mauer zurück, bis ich endlich am Platz vor dem Tor ankam. Der Anblick, der sich mir bot, ließ mich jedoch fassungslos erstarren. Hier war kein Wasser, kein einziger Tropfen. Und auch kein Matsch. Es hatte ganz sicher nicht einmal geregnet. Der Boden war staubtrocken, ganz im Gegensatz zu dem, was ich gerade eben noch von der anderen Seite der Barriere aus gesehen hatte. Der See, an dem wir gestern mit unseren Bussen angehalten hatten, lag vollkommen ruhig da. Keine Anzeichen des Schlammes, den der Fluss eigentlich in den See gespült haben müsste, was ich schließlich auch von innerhalb der Barriere beobachtet hatte … nun ja, geglaubt hatte zu beobachten.
Außerdem saßen überall zahlreiche Jugendliche auf unzähligen Taschen herum. Im ersten Moment war ich erleichtert, das mussten all die ausgeschiedenen Prüflinge meiner Schule sein. Doch schon bei der ersten Gruppe wurde mir klar, dass ich mich irrte. Denn die hochgewachsenen jungen Frauen mit den geflochtenen Haaren, den grimmigen Mienen und den überdurchschnittlich muskulösen Körpern, selbst für Krieger des Lichts, ließen mich erahnen, dass sie nicht von der St. Mountain Academy of Fighters waren. Das mussten Schülerinnen der North African Academy of Fighters sein, der Schule der Amazonen.
Mit zögernden Schritten bahnte ich mir meinen Weg durch die Gruppen und suchte nach dem Wasser. So irritiert ich auch von den anderen Jugendlichen war, ich hatte ein Ziel und ehrlich gesagt war mir vollkommen schnuppe, warum sie hier auf ihren Taschen hockten. Irgendwo musste das verdammte Wasser doch hin sein. Plötzlich hörte ich das Geplätscher, nach dem ich gesucht hatte. Na endlich. Schnurstracks marschierte ich auf das Geräusch zu, wobei ich durch eine zusammenstehende Gruppe hindurchpflügte.
»He, du!«, sprach einer mich an.