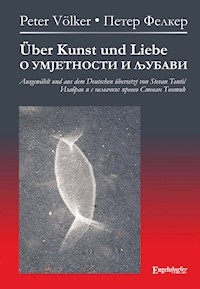Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Engelsdorfer Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Über das Lieben lernen: Entfremdung der Menschen von sich selbst und Manipulation in der Konsum- und Leistungsgesellschaft können liebend überwunden werden. Dieser Gedanke zieht sich durch den Roman »Anima Keltoi« wie ein Ariadnefaden. Jannis, ein intelligenter, erfolgreicher Mann, gesellschaftlich integriert, lebt allein bestens situiert in Hamburg und arbeitet über digitale Kommunikationsmittel zusammen mit Carlos aus Montevideo und Prishani aus Südafrika an weltumspannenden Logistik-Konzepten. Er wurde als Baby von einem bei Lübeck wohnenden Ehepaar adoptiert. Seine Beziehungen zu anderen Menschen – auch zu befreundeten Frauen – sind sachlich geprägt. Jannis leidet darunter, dass sein emotionales Empfinden stark eingeschränkt ist. Er wurde nach der Geburt per Genschere mit aus archäologischen Funden extrahierten keltischen Genen im Rahmen von illegalen Experimenten manipuliert. Durch die Wiederbegegnung mit einer ehemaligen Schulfreundin, Vania, die Archäologin mit dem Schwerpunkt Keltenforschung ist, lernt Jannis auf einer gemeinsamen Studienreise mit ihr nach Griechenland lieben und erschließt sich eine neue Dimension des Lebens.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 434
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anima Keltoi
Für Elke
Peter Völker
ANIMA KELTOI
Roman
Engelsdorfer Verlag Leipzig 2024
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.
Copyright (2024) Engelsdorfer Verlag Leipzig
Alle Rechte beim Autor
Titelbild © Holger Müller (Bad Sachsa)
Hergestellt in Leipzig, Germany (EU)
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH, Rudolstadt
www.engelsdorfer-verlag.de
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Kapitel I
Winterabend
Elbeuferspaziergang
Schattensuche
Schanzenviertel
Sternverleihung
Hafensucht
Kapitel II
Kraftort
Lichtpunkt
Tagträume
Abflug
Prishani
Hotelempfang
Kongress-Zwielicht
Südfahrt
Schreckensnachricht und Abschied
Kapitel III
Aufbruch
Hügelmystik
Sonnentag
Grabesunruhe
Vorfreude
Kapitel IV
Liebeserwachen
Mykenische Spurensuche
Lebenslust
Lakonisches Lächeln
Zauberstadt
Allein
Wiedersehen
Auf der Fähre – Venedig
Kapitel V
Heimathafen
Analyse
Lebensnest
Realität
Angstlos
Urvertrauen
Schicksalsstrom
Danke
Vita
Weg und Liebe
Ein Weg ist nur ein Weg, wenn er begangen wird.
Wird der Weg nicht begangen, ist der Weg kein Weg.
Eine Liebe ist nur eine Liebe, wenn sie gelebt wird.
Wird die Liebe nicht gelebt, ist die Liebe keine Liebe.
KAPITEL I
Winterabend
Die ersten Pendelfähren zur Musical-Nightshow tuckern durch leichtes Pulverschneetreiben, das sich in Miniaturkristallen auf Lebendiges wie Totes herabsenkt, zwischen Landungsbrücken und Musical-Konzerthaus. Vom Appartement aus sehe ich schemenhaft Menschen hinter erleuchteten Fenstern der Fähre. Dicht gedrängt stehen sie, sicher voller Vorfreude auf die Vorstellung. Einige vielleicht Hand in Hand frisch verliebt. Die Fähre schaukelt quer zum Strom. An der Anlegestelle auf den Landungsbrücken, deren Poller zum Festtäuen der Fähren mit Schneehauben geschmückt sind, warten noch Hunderte von Besuchern, die vor Kälte schlottern. Sie gleichen dem Schwarm Krähen auf den Dächern der Silogebäude drüben im Hafen. Den Blick aus meinem Fenster genieße ich jeden Tag aufs Neue.
Schwer tue ich mir mit den Blicken nach innen. So oft fliege ich über die tiefen Abgründe der Meere und finde, solange ich zurückdenken kann, nicht die Tiefe in mir selbst. Ich wohne gern hier. Hafen bedeutet für mich Ankunft und Abschied, frohes Erwarten und Sehnsucht nach Ferne zugleich. Getrieben von einem Wunsch nach Erlösung aus Ungewissheit, habe ich mich seit einiger Zeit auf die Suche nach dem Unergründlichen in mir selbst begeben. Mich fröstelt, obwohl es in meinem Zimmer wohlig warm ist. Aus meinem Nest sehne ich süchtig in die Weite und bin doch hin und her gerissen zwischen drinnen und draußen.
Wie oft saß ich jung und voller Tatendrang auf der Brüstung der Landungsbrücken unterhalb der U-Bahn-Station, ließ die Beine baumeln. Weit in die Hafenbecken kann man von dort schauen und am Horizont spannt sich die Köhlbrandbrücke wie ein Scherenschnitt über den Himmel. Die „Rickmer Rickmers“, ein ausgedienter China-Segler, lag vor Anker unter mir und ich stellte mir vor, ich steche mit ihm in See, einem ungewissen Ziel entgegen. Die schwimmenden Kais stöhnten, wenn ein vorbeiziehender Ozeanriese von Schleppern gezogen das Brackwasser aufwühlte, als schrien sie nach Freiheit, wollten mit auf große Fahrt. Doch unsichtbare Stahltrossen unter Wasser hielten sie unbarmherzig zurück. Und ich litt mit ihnen, fühlte mich ebenso gefesselt ob all meiner abenteuerlichen Reisen. Ich gäbe alles, könnte ich diese Taue in mir kappen.
Erst wenn sich eine der Flussfähren dem Anlegesteg tänzelnd näherte, verließ mich diese Wehmut. Ich beobachtete oft die von Bord schwärmenden Menschen, Hafenarbeiter, Ausflügler, Schulklassen, hörte, wie sich ihre Stimmen mit dem Gekrächze der Möwen und dem Quietschen der Kräne von der anderen Elbseite mischten und hoffte jedes Mal, einen vertrauten Menschen zu erkennen. Aber in all den Jahren begegneten mir dort nur Fremde.
Noch heute gehe ich manchmal an jenen für mich magischen Ort, stelle mich auf den Anleger, lasse die Menschen an mir vorbeiströmen, suche flüchtige Körpernähe in der Masse und lausche in ihre vergänglichen Gespräche hinein. In solchen Momenten fühle ich mich wie ein Suchender im Niemandsland, als liefe ich barfuß im Treibsand und die Tiefe in mir sei unerreichbar.
Ab und zu suche ich um Mitternacht die Tower-Bar des Hafenhotels oberhalb der Landungsbrücken auf. Wie ein mit dem Messer gespitzter Bleistift ragt eine verglaste Pyramide aus dem Traditionshotel. Ich mag diese Bar. Viele meiner Einfälle, meinen Beruf betreffend, verdanken ihre Geburt diesem Ort. Cocktails beruhigen den Geist und Glenn-Miller-Musik vertreibt Sehnsucht und Sorgen. Nach allen Seiten ergießt sich das Lichtermeer der Stadt und nach Süden hin glänzt das von Nebellampen gelblich eingefärbte Hafengebiet. Es sieht aus, als treibe ein gigantisches unbekanntes Flugobjekt durch den Nachtnebel. Meist sitze ich allein dort, lasse diese Stimmung stundenlang auf mich wirken, hänge Gedanken nach, ohne sie festzuhalten und ihren Sinn zu ergründen. Fast alle Geschäftsfreunde, die mich ab und zu besuchen, führe ich dorthin und sie sind ausnahmslos beeindruckt, wenn über Hamburg der Tag versinkt und sich das Lichtermeer in der Dämmerung ausbreitet und sich schließlich zum Lichterglanz, zum Sternenhimmel in der Dunkelheit entfaltet.
Das ohrenbetäubende Tuten eines Ozeanriesen, der dem emsigen Treiben der Pendelfähren für ein paar Minuten Einhalt gebietet, reißt mich aus meinen Gedanken und katapultiert mich in meine Realität. Ein prächtiges, hell erleuchtetes Schiff fährt an meinem Fenster vorbei zum Bananenbecken, das sich nicht weit von meiner Wohnung erstreckt. Der Frachter trägt den Namen „Rio de la Plata“ und fährt unter der Flagge Uruguays.
Erinnerungen an Lateinamerika steigen in mir auf, als ich das erste Mal Carlos in Montevideo besuchte, der Stadt alten kolonialen Glanzes und brutaler Realität zugleich. Carlos und Prishani aus Südafrika arbeiten mit mir über mehr als fünfzehn Jahre in einem weltumspannenden Logistikunternehmen zusammen. Ein amerikanischer Job-Headhunter hat uns drei zusammengeführt. Wer uns dazu ausgesucht hat, haben wir nie erfahren. Wir wurden offensichtlich zeitgleich und unabhängig voneinander aufgefordert, uns zu bewerben. Wir drei beschäftigen uns mit der Optimierung von Warenströmen und kommunizieren in Englisch.
Carlos ist ein Aktivist in der linken Bewegung Uruguays, „Frente Amplio“. Dieses Bündnis ist heute Mehrheitspartei im uruguayischen Parlament. Carlos, mittelgroß, hat eine drahtige Figur, ein ovales Gesicht mit einem schwarzen Zehn-Tage-Bart und sanften braunen Augen, die im Kontrast zu seinem ganzen äußerlichen Wesen stehen, das immer auf dem Sprung zu sein scheint. Während der Militärdiktatur war er in der Tupamaro-Guerilla-Bewegung aktiv. Einmal nahm er mich mit zu einer Sitzung der ehemaligen Guerillas und wir diskutierten stundenlang mit den alten Frauen und Männern der Revolution unter einem riesigen Holzstern an der Wand, dem Symbol ihrer Bewegung, in der karg eingerichteten Halle ihres Versammlungshauses. Nachts gingen wir in eine der Tango-Bars, waren dort umgeben von ästhetisch anmutenden Tänzerinnen und Tänzern. Aber die traurigen Augen der Ex-Revolutionäre gingen mir nicht aus dem Sinn und so konnten mich die Blicke der Schönen nicht zum Tanz verführen.
Das Bankenviertel in Montevideo steht mit seinen Palästen den europäischen Finanzstandorten in nichts nach. Einmal aßen wir auf Einladung eines Bankangestellten, der mit Carlos befreundet ist, in der Kantine einer Bank. Carlos erzählte mir, dass das Geldinstitut rund 80 Angestellte habe und nur gegründet worden sei, um mit dem Vermögen einer uruguayischen Großfamilie auf den Finanzmärkten zu jonglieren. Wahrscheinlich sei das Waschen von Drogengeldern das Kerngeschäft der Bank. Ich traute meinen Ohren nicht.
Tage danach fuhren wir mit einem Auto zu Carlos Freunden in die Grenzregion, in der sich Argentinien, Brasilien und Uruguay küssen. Carlos wirkte nervös und nachdenklich und entspannte sich erst im Laufe der Fahrt. Das Durchfahren unendlicher Weiden, unterbrochen nur von ein paar schnell wachsenden Eukalyptushainen als Schattenspender für die Rinderherden und als Holzressource für die Menschen, machte schläfrig. Nördlich von Bella Union tauchten am Rande der Nationalstraße unvermittelt Verkehrsschilder auf: „Rio de Janeiro 2.200 km“, stand da. Carlos, der sensible Rebell, bemerkte mein Erstaunen und wechselte ein paar Worte mit dem Fahrer. Wenige Minuten später passierten wir die Grenze nach Brasilien, machten auf einem Rastplatz halt.
„Ich denke, wir sollten mal auf brasilianischem Boden ein Fußballmatch Uruguay – Deutschland austragen“, posaunte Carlos und kramte einen Fußball aus dem Kofferraum. Auf einer Wiese markierten wir Torpfosten aus unseren Hemden und kickten voller Übermut, bis wir völlig durchgeschwitzt nach tropisch feuchter Luft schnappten. Wie Kinder tollten wir über den Rasen, vergaßen unser kalkuliertes Dasein. Bei ausgeglichenem Spielstand beendeten wir die Partie, legten uns auf die Wiese, sahen zu, wie die Wolkenberge vorbeizogen, plauderten, dankten Carlos für seinen Einfall, genossen noch lange unsere jugendliche Spontanität. Die Bilder dieser Reise leben jedes Mal auf, wenn Carlos anruft oder wenn wir am PC zusammenarbeiten, und mir ist dann, als schaute ich aus auf das Treiben in den Straßen der uruguayischen Metropole.
In brutalem Kontrast zu der Leichtigkeit unserer Reise stand Jahre später für mich die Begegnung mit Juliana, einer Aktivistin der Tupamaro-Bewegung gegen das Militärregime. Ich traf mich mit ihr in einem Café in Montevideo. Sie wollte mich um Unterstützung für ein freies Radioprojekt bitten, hatte sie mir am Telefon mitgeteilt. Jetzt saß die Frau, so um die 60 Jahre alt, vor mir. Während wir uns unterhielten, hielten mich ihre großen fast schwarzen Augen, die in ein rundliches Gesicht eingebettet waren, gefesselt. Um ihre Nasenwurzel herum überraschten mich Sommersprossen, und ihre kurz geschnittene dunkelblonde Frisur verlieh ihr einen fast jugendlichen, frechen Ausdruck. Hinter den Augen verbarg sie ihre Gefühle, das glaubte ich deutlich zu spüren.
Der Radiosender war nach dem Ende der Militärdiktatur von der linken Bewegung gegründet worden, um neben dem von der konservativen Regierung kontrollierten staatlichen Rundfunk eine unabhängige Berichterstattung zu gewährleisten. Schnell begriff ich durch ihre Worte die Bedeutung dieses Projektes für die Demokratisierung des Landes und sagte ihr eine persönliche, bescheidene finanzielle Unterstützung zu. Während unserer Unterhaltung blitzte es in ihren Augen, dass ich manchmal erschrak. Zurück in Hamburg, wollte ich um Geldspenden werben, bot ich ihr an. Sie sagte nichts, aber ihrem Gesicht entnahm ich nun Freude. Alle Details des Vorhabens teilte sie begeistert mit und die Zeit im Café zerrann zwischen ihren Worten.
Abends traf ich Carlos, erzählte ihm von meiner Begegnung mit Juliana. Sorgenvoll sein Blick, nervös seine Hände. Ja, Juliana, sei eine ganz besondere, starke Frau. Sie habe im Widerstand gelebt und als sie von den Militärs verhaftet wurde, habe sie unglaublich schreckliche Dinge über sich ergehen lassen müssen und trotzdem sei sie nicht zerbrochen. Ich ahnte bei der Begegnung mit ihr, dass hinter ihrer Fassade eine verletzte Seele verborgen schien. Eine der führenden Köpfe der Tupamaro habe mir gegenübergesessen, fuhr Carlos fort. Sie wäre als zwanzigjährige Frau zunächst über fantasievolle Widerstandsaktionen in die Tupamaro-Bewegung gelangt. Dann aber, als die Militärs ihre ganze Brutalität einsetzten, sei sie zusammen mit ihrem Freund in den bewaffneten Widerstand hineingeschlittert. Die beiden heirateten mit zweiundzwanzig Jahren und hätten sich ganz der Widerstandsbewegung verschrieben. Das Schlimmste sei aber nach der Verhaftung, die unausweichlich war, auf sie zugekommen. Sie und ihr Mann seien in ein Militärgefängnis verschleppt worden. Sechs Jahre seien sie dort gefoltert, misshandelt worden.
In diesem Moment schien es mir, als säße ich ihr immer noch im Café gegenüber. Wenn ich das gewusst hätte! „Das ist ja schrecklich, Carlos.“
„Diese Traumata wirst du nie mehr los“, antwortete er. Die Uruguayer könnten und wollten heute offen darüber reden, das sei die einzige Chance, damit umzugehen als Mensch, die Traumata zu verarbeiten. „Deshalb erzähle ich dir das auch bis zum bitteren Ende. Sie hat mir alles anvertraut.“ In den Jahren im Militärgefängnis sei sie unzählige Male von Wärtern vergewaltigt worden. Dabei sei sie nackt in einen Raum geführt worden, in dem eine Pritsche stand. Auf dieser fielen mehrere Wärter hintereinander über sie her, erzählt Carlos und kann seine Betroffenheit nicht mehr verbergen. Immer habe ihr an einen Stuhl gefesselter Ehemann, von dem niemand wisse, was aus ihm geworden ist, zusehen müssen. Aus diesen Vergewaltigungen sei ein Mädchen hervorgegangen, das man ihr wenige Monate nach der Geburt wegnahm. Nie habe sie es wiedergesehen. „Sie sagte mir einmal, dass nicht die Gräueltaten selbst die große Angst in ihr ausgelöst hätten, sondern das Warten darauf.“ Sie habe nie gewusst, wann sie aus der Zelle geholt wird. Ich kann Carlos Bericht kaum noch ertragen. Carlos meint, es sei eine Realität dieser Welt. Juliana habe außerdem Scheinerschießungen und Folterexzesse wie Elektroschocks und unter Wasser tauchen erlebt. Einmal habe sie ihm gesagt, sie habe das nur ertragen können, weil sie ihren Freiheitswillen und ihre politische Überzeugung all die Jahre gespürt habe, und sie habe immer gewusst, was passieren würde, wenn ihre Feinde sie fassen würden. Nur mit diesem Feindbild in sich habe sie ihre Traumatisierungen überleben können.
„Danke, Carlos, dass du mir das erzählt hast“, sagte ich und schwieg lange.
„Sie hat mich vorhin angerufen und gesagt, dass sie sich sehr über deine Spendenaktion für das Radio freut. Das ist auch eine Realität.“
Ich nahm diese Eindrücke mit in eine schlaflose Nacht, reflektierte das von Carlos Erzählte. Warum kann man im Leben nichts rückgängig machen? Das wäre doch ein würdiges Experiment der Evolution gewesen, denke ich. Zwei Tage zuvor hatten wir ein Elendsviertel besucht. Ein stinkender Abwasserfluss, der Giftfracht von der naheliegenden Lederfabrik mit sich führt, Babys und Kleinkinder, die über die Müllhalde krabbelten und nach Essbarem suchten, neben sich Pferde, die es ihnen gleichtaten. Mit Pferdekarren fuhren die Eltern nachts in die Großstadt, suchten den Müll vor den Häusern auf Verwertbares ab. Der Anblick dieses Elends war kaum zu ertragen gewesen. Was für ein Leben im Vergleich zu meiner Welt.
*
Vom Hafen her höre ich das Posaunen eines Containerschiffes. Seit Wochen brüte ich erfolglos über dem Entwurf eines Logo für ein weltweites Logistikkonzept und der Kongress in Südafrika, auf dem es diskutiert und beschlossen werden soll, rückt näher. Keine Idee für das Symbol fliegt mir zu, bin zu abgelenkt. Ich öffne das Fenster, denn in der Wohnung ist es feuchtwarm und erschrecke. Ein paar Möwen fliegen dicht vor meiner Nase auf, verlieren sich in der Winternacht. Über die Eisenbahnbrücke zum Hauptbahnhof rattern fast minütlich Züge. Im „Medien-Hochhaus“ leuchten noch einige Fenster. Lange stehe ich im nasskalten Luftzug und blicke über den Hafen. Die letzten Show-Besucher sind übergesetzt worden.
Und wieder überkommt mich diese seltsame Leere, als bilde sich in meinem Inneren ein Vakuum, das alle Empfindungen verschlingt. Und, obwohl mich das berufliche Leben umspült wie das Meer ein winziges Eiland, so bleiben doch viele Geheimnisse des Lebens für mich unter den Wellen verborgen. Bei meinen Reisen durch die Welt habe ich alle beruflichen Ziele erreicht, werde von meinen Geschäftspartnern geschätzt, aber dabei bin in mir selbst nicht begegnet. Ich durchdenke die Welt schematisch, erfolgs- und leistungsorientiert. Ich plane und baue mir meine Welt und mein Leben wie ein Ingenieur, ohne die Vielfalt und Breite des menschlichen Seins zu begreifen und erfühlen zu können. Wenn überhaupt, spiele ich auf der Klaviatur des Lebens nach vorgegebenen Kompositionen. Spielerisch gesammelte Erfahrungen sind mir als Erwachsener bis heute fremd. Dies hat zu einer Lethargie dem Sinnlichen gegenüber geführt und manchmal steigen Bedenken mir selbst gegenüber auf. Ich kann dies nicht deutlich beschreiben, weil auch sie an der Oberfläche meiner Persönlichkeit haften bleiben.
Diese unsicheren Empfindungen sind permanent unterschwellig in mir vorhanden und ziehen sich wie ein Sumpf unter mein pralles reales Leben, das ich dennoch oberflächlich genieße und zu schätzen weiß. Je älter ich werde, desto bewusster wird mir diese Situation, dieser Widerspruch in mir. Als Kind reflektierte ich das Dasein, fühlte mich geborgen. Aber mit Abstand betrachtet, holte mich schon in meiner Kindheit ein Schatten des teilnahmslosen Fühlens ein. Der Drang des berauschenden Erforschens der Welt und das wilde Erkunden und Herumtollen waren mir eher fremd als Kind. Ertragen konnte ich es, denn ich war von meinen Eltern wohl behütet. So entschloss ich vor ein paar Wochen, all diese unerklärlichen Empfindungen, vor allem meine Schwäche oder gar Unvermögen emotional zu empfinden, in einer Therapie aufzuarbeiten. Die Erkenntnisse daraus bleiben bisher in sich selbst stecken. Wege aus dieser Misere sind noch nicht in Sicht.
Solchen Gedanken darf ich jetzt nicht nachhängen. Übermorgen gehe ich zur Therapie, muss wach und achtsam bleiben, mich konzentrieren auf meine Aufgabe. Ob ich noch einmal zu den Fährschiffen hinuntergehe? Vielleicht fliegt mir an meinem Hamburger Lieblingsort, den Landungsbrücken, die langsam vom dichten Nachtnebel verschlungen werden, eine Idee zu. Ach was, wenn ich unten bin, werde ich mich nach meinem warmen Zimmer sehnen. Also zwinge ich mich zu bleiben, spüre die Stahltrossen der Landungsbrücken in mir, brühe mir einen Tee auf und setzte mich an den Bildschirm. Ich korrespondiere mit Carlos im Chat, was mir ein wenig über die Schwermut der Stunde hinweghilft.
„Hallo Carlos, mir fällt kein Logo für unser Konzept ein. Was soll ich tun? Hast du eine Idee?“
„Keine Ahnung. Komm her und gehe mit mir in eine Bar aus, dann wirst du inspiriert. Heute Abend ist ein Tango-Festival in den Straßen“.
„Mach keine Späße. Du weißt, wie sehr ich unter Druck stehe“.
„Kein Mensch steht unter Druck, wenn er nicht will.“
„Ach, Carlos!“
„Du, ich habe heute Abend echt keine Zeit mit dir zu reden. Ich bin verabredet, und das geht vor. Verstehst du?“
„Wo geht’s denn hin?“
„Wir! Wir gehen. Ich kenne sie seit drei Tagen. Kein Logo kann mich davon abhalten, Jannis. Sie ist wunderbar feurig. Nimm zu Prishani Kontakt auf. Auch sie ist ein Schatz und du weißt, sie mag dich. Nein, sie ist verrückt nach dir.“
„Hör auf Carlos!“
„Mach‘s gut, ich schreibe dir morgen, falls mir was einfällt.
„Schönen Gruß an Prishani.“
Carlos ist ein intelligenter Mann, aber wenn er eine Frau im Kopf hat, ist es aus mit ihm. Er hat recht, vielleicht sollte ich mich an Prishani wenden. Ein neuer Auftrag eines südafrikanischen Unternehmens machte zu Beginn unserer Zusammenarbeit ein persönliches Treffen mit ihr notwendig. Der Flug über die Sahara unvergessen; ein Gemälde der Natur offenbarte sich von der Höhe aus betrachtet, von einem universellen Künstler aus unterschiedlichen Wüstenformen geschaffen, ich erkannte darin den Meister der Schöpfung. Sie holte mich am Flughafen ab. Und ich muss gestehen, sie zog mich vom ersten Moment an. Ihr graziler Körper, ihr weicher Gesichtsausdruck, pechschwarze Augen im dunkelhäutigen Gesicht, verwirrten mich. Ihr nahe, schien es mir, als seien ihre Nasenflügel durchsichtig, so zart waren sie in ihr Gesicht eingefügt.
Im Taxi saßen wir dicht beieinander, unsere Beine berührten sich in den Kurven. Ich glaubte, ihren Blutstrom an meinen Waden zu spüren und war wie elektrisiert. Während der Tagung suchten und trafen sich unsere Blicke, doch unsere Körper fanden keine echte Nähe vor meiner Abreise. Die Zuneigung verfing sich im Gestrüpp von Vernunft und Sachlichkeit. Erst beim nächsten Besuch in Kapstadt, zwei Jahre später, entlud sich unsere Lust in einer Nacht am Strand. Seit dieser Zeit träume ich oft von ihr. Geblieben ist ein Gefühl zwischen erotischer Anziehung und Vertrautheit. Soll ich ihr heute Abend noch im Chat schreiben? Auch in Johannesburg ist es spät. Vielleicht ist sie ausgegangen – wie Carlos. Einen Versuch mache ich.
„Hallo Prishani, bist du zuhause?“
„Jannis, wie schön von dir zu hören“, antwortet sie ein paar Minuten später im Chat. „Worte von dir tun gut.“
„Ich bin nervös, kann nicht arbeiten, irgendwie fehlen mir Antrieb und Inspiration. Ich müsste das Logo noch kreieren. Was soll ich machen, hast du einen Rat für mich?“
„Denke nicht nur ans Arbeiten, ruhe dich aus. Die kreativen Ideen müssen geflogen kommen, die kann man nicht erzwingen und sie kommen immer überraschend. Was beschäftigt dich, Jannis?“
„Das Logo und die Präsentation rückt näher. Mein Kopf ist hohl.“
„Du hast so viel Fantasie. Ich vertraue ihr und du solltest dir selbst auch vertrauen.“
„Ich muss oft an dich denken. An unsere Nacht am Strand.“
„Ich auch, Jannis“, sagt sie mit scheuer Stimme, in der ein Hauch von Unsicherheit mitschwingt.
„Ich glaube, ich lege mich jetzt hin. Ich melde mich morgen noch einmal. Ich umarme dich.“
„Schlaf gut, Jannis.“
„Ja, du auch. Einen dicken Kuss!“
Wieder allein. Die Fenster beschlagen. Winzige Sturzbäche rieseln die Scheiben hinunter, ergießen sich auf das Fensterbrett. Draußen muss es bitterkalt sein. Wieder schaue hinaus in den Hafen, als suchte ich etwas, das im Nebel auf mich wartet. Je näher ich den Fensterscheiben komme, desto rätselhafter das Bild der Rinnsale. Eine Grafik des Zufalls der Stunde entsteht. Am oberen Teil des Fensters lösen sich zwei Tropfen, vereinigen sich kurvenreich mit anderen zu Miniaturflüssen, zeichnen ein geheimnisvolles Gebilde, verbinden sich mit den Silhouetten des Hafens, die sich in der Scheibe spiegeln. Wie kann das sein? Eine unsichtbare Hand scheint am Fenster zugange zu sein. Mit der Fingerspitze folge ich den winzigen Wasserstrahlen und zeichne sie nach, verändere ihren Lauf, füge eigene Linien hinzu. Meine Kreativität scheint sich mit dem Zufall zu verbinden. Eine Figur, mein Logo, entsteht und ich weiß, dass mir etwas geschenkt wurde. Später übertrage ich das Symbol in meinen Laptop, schlafe erleichtert ein.
Elbeuferspaziergang
In dieser Nacht schlafe ich unruhig, werde öfter wach und träume wild. Nichts in diesen Träumen ist real, sondern mit fremden Gefühlen wie Hass, Sucht und Leidenschaft unterlegt. Bizarr anmutende Menschen ohne Gesicht hasten durch Wälder und Auen meiner Träume. Flüsse und Seen ohne Ufer durchschwimme ich angstbesetzt. Noch eine Weile nach dem Aufwachen sind die Bilder in mir lebendig und die Geister des Traums scheinen um mich zu sein. Die Traumbilder haben sich aufgelöst. Auf dem Küchentisch liegt der Zettel, auf den ich die Skizze des Symbols aufgezeichnet hatte. Welch ein verrücktes Erlebnis! Die Form des Symbols passt zu meinem Konzept. Ein großer Kreis für die Erde, zwei kleinere oben angedockte Ovale für die Partnerverbindungen und unter dem Erdkreis ein Rhombus als Basis und Zeichen für leistungsstarke Verkehrswege. Durch ihn verlaufen zwei wellige Linien, die Energie und Fortschritt symbolisieren. Ich kann es immer noch nicht glauben. Das müsste es sein. Gieße mir einen Kaffee auf und blättere in der Sonntagszeitung. Jetzt ist der Druck aus meinem Kopf gewichen. Trotz alledem beschleicht mich eine gewisse Unruhe, ich weiß aber auch, dass ich kompetent bin und sachlich funktionieren werde, wenn ich auf dem Kongress bin.
Bald muss Barbara kommen, mich abzuholen. Wir sind uns seit vielen Jahren verbunden und ich schätze sie sehr. Manchmal frage ich mich, wie es wäre, wenn sich eines Tages unsere Beziehung auflösen würde. An die Antworten will ich nicht denken. Bis auf pubertäre mehr oder weniger erfolgreiche Versuche, die eigene Sexualität zu entdecken hatte ich als Erwachsener nur ganz wenige sexuelle Erfahrungen in Abständen zwischen denen oft Jahre lagen. Ich suchte nach mehr Gefühl und fand es nicht in mir. Erst Barbara und die freundschaftliche Zuneigung, die ich zu ihr fühlte, öffneten mich, die Lust anzunehmen. Unsere Beziehung blieb auf die Lustbefriedigung und gemeinsame erlebte Events beschränkt, was ich aber neben dem Sex als angenehm empfand. So etwas wie Liebe, was immer das auch bedeutet, zu empfinden, blieb mir fremd. Das ist einer der Gründe für meine Therapie.
In den ersten Jahren unserer Beziehung hatten wir nach anfänglichen kleinen Unsicherheiten intensiven Sex, nutzten jede Gelegenheit, uns zu treffen. In den letzten Jahren hat sich unsere Beziehung verändert, ist stiller geworden. Heute schlafen wir ab und zu noch miteinander, genießen weiterhin das gemeinsame Erleben von Ausflügen, Spaziergängen, Kinovorstellungen, Theateraufführungen, Musikveranstaltungen und vieles mehr. Ich frage mich heute, ob ich nur ihre Nähe suche. Und ich glaube, bei ihr ist es ähnlich. Es ist eher Barbaras liebevolle Vernunft und Handlungskraft, die mich anzieht und mir guttut. Es gibt nichts, was wir uns nicht mitteilen könnten – kein Graben, kein Geheimnis ist zwischen uns.
Auf die Frage, was Liebe ist, sagte sie einmal philosophisch, dass man auch in einer von Liebe erfüllten Beziehung immer bei sich selbst bleiben soll. „Aber die liebende Hingabe an den geliebten Menschen schenkt dir auch, das befreit sein. „Uff, wo habe ich das denn hergeholt“, schob sie lachend nach. Sie hatte den Kern meiner emotionalen Unsicherheit berührt. Mitte 40 hatte ich keine Vorstellung davon, was Liebe ist. Das ist meine bittere Lebenserkenntnis.
Wir lernten uns vor rund zehn Jahren hier in Hamburg im Restaurant des alternativen Kinos „Abaton“ vor einem Spielfilm kennen. Der Raum war voller kinobegeisteter Menschen und nur noch ein Stuhl neben mir frei. Ohne meine Antwort auf ihre Floskel „Darf ich?“ abzuwarten, hatte sie Platz genommen und schaute mich forsch an. „Natürlich können Sie sich setzen“, sagte ich, obwohl mein Angebot längst überholt war. Sie grinste. Dieses Selbstbewusstsein imponierte mir, und das bewundere ich noch heute an ihr. Es entwickelte sich ein lebhaftes Gespräch über den verheerenden Zustand dieser Welt, in dessen Verlauf sich herausstellte, dass wir denselben Film besuchen wollten, den uralten Streifen „Casablanca“, der nun gar nichts mit sozialen, ökonomischen und ökologischen Problemen zu tun hatte. Den Weltschmerz hinter uns lassend, orientierte sich unser Gespräch immer mehr an persönlichen Themen, Interessen und Gewohnheiten. Schließlich kamen wir überraschend unkompliziert überein, am kommenden Wochenende einen gemeinsamen Ausflug mit dem Touristenschiff „Hafen Hamburg“ auf die Insel Helgoland zu machen. Während des Films vereinigten sich zunächst scheu unsere Hände bald danach unsere Lippen. Wir trennten uns nach der Vorstellung sichtlich sexuell angeregt. Diese Erregung entlud sich nach Tagen bei einem Besuch in ihrer Wohnung.
*
Es klingelt, und ich öffne die Tür. Wie immer perfekt für den Anlass gekleidet, steht sie vor mir; diesmal mit Wanderstiefeln und selbstgestrickten Handschuhen und einer vom eisigen Wind geröteten Nasenspitze. Unter ihrer Wollmütze, die sie tief ins Gesicht gezogen hat, quellen ihre dunkelbraunen Herbstlocken an diesem Wintermorgen hervor; ihre Augen leuchten freudig, ihr schlanker Körper ist energiegeladen auf dem Sprung zum Tun, sie wirkt ausgefüllt und lebendig. Sie hat einen kleinen Tick. Immer wenn sie einen Vorschlag macht, zwinkert sie.
„Barbara, bin ich froh, dich zu sehen“, sage ich und drücke ihr einen Kuss auf die kühle Wange.
„Ich auch. Du, wollen wir gleich los oder bist du noch nicht fertig?“
„Komm noch auf einen Sprung rein, ich würde gerne meinen Kaffee austrinken.“
Sie schlüpft an mir vorbei in die Wohnung.
„Gestern Abend hatte ich ein seltsames Erlebnis“, sage ich und erzähle ihr die Fenstergeschichte mit dem Logo.
„Siehst du, dir fliegen die guten Einfälle zu. Dafür mag ich dich.“
Barbara rutscht zu mir herüber, stößt dabei fast meine Tasse mit dem Ellenbogen um, legt ihre Hand in meine. Wie angenehm, ihre Haut auf meiner zu spüren.
*
Klirrende Kälte empfängt uns draußen. Die Sonne durchdringt noch nicht den Nebel, der über dem Hafen hängt. Wie festgefroren sitzen Möwen auf dem Geländer des Anlegers, als müssten sie erst aufgetaut werden, bevor sie fliegen können. Wir laufen auf der Aussichtsplattform am Baumwall entlang Richtung Landungsbrücken. Die „San Diego“ und die „Rickmer Rickmers“ liegen schläfrig angetaut am Kai. An der U-Bahn-Station Landungsbrücken herrscht buntes, lebendiges Treiben. Vom Fischmarkt her strömen die Menschen zurück, vollgepackt mit Obst- und Fischtüten. Einige tragen riesige tropische Zimmerpflanzen vor sich her. Grüne Pracht vor Bäuchen, die die Menschen gesichtslos macht, überragt die Menge und schenkt Pflanzen in Töpfen Beine. Ob sie, die eigentlich in den feucht-warmen Regenwald gehören, den Frostmorgen überleben und die hanseatischen Wohnzimmer erreichen werden?
„Lass uns ein paar Stationen mit der Bahn fahren und dann weiterlaufen?“
„Nein, du Faulpelz“, antwortet Barbara, nimmt mich an der Hand, zieht mich auf dem Steg zum Landungsbrücken-Anleger. Dort erwarten uns die Schreie der Hafenrundfahrt-Animateure: „Hafenrundfahrt mit Speicherstadt, meine Damen und Herren. Ein einmaliges Erlebnis für Landratten. Haaafenrundfahrt!“.
Auf der Plattform verschmelzen Passanten und Fähren zu dieser einmaligen Hamburger Hafenatmosphäre. Menschenschicksale lösen sich im Gewimmel auf. Wir schlendern weiter, vorbei an den Hafen-Cafés und Restaurants, hinter deren beschlagenen Scheiben sich die Gäste aufwärmen, vorbei an Touristenläden und den Büros der Schifffahrtsgesellschaften.
„Wollen wir die Stahltrossen der Landungsbrücken nicht kappen und auf große Fahrt gehen, Barbara? Von dieser Idee war ich schon als Junge beseelt, und ich werde sie nicht los. Etwas Unerklärliches verbindet mich mit diesem Ort.“
„Du Träumer. Du gehst doch in deinem Beruf oft genug auf große Fahrt.“
„Klar, weiß ich, aber ich nutze meine Abenteurerfahrten jenseits der beruflichen.“
„Ach, Jannis, meine Wurzeln sind tief im sandigen Boden Hamburgs verhaftet. Da ist die große Fahrt nichts für mich“, sagt Barbara mit Denkerinnenfalten auf der Stirn.
„Weißt du, hier auf den Landungsbrücken habe ich noch nie einen Bekannten getroffen. Ist das nicht seltsam?“
„Wen suchst du, Jannis?“
„Ich weiß es nicht. Vielleicht mich selbst.“
Je näher wir dem Fischmarkt kommen, desto dichter die Menschenmenge. Marktschreier übertönen nun das Rauschen der Stadt und des Hafens. „Aale für alle!“, schreit ein Verkäufer von geräucherten Fischen. Schlepper ziehen ein Containerschiff zum Hafenbecken. Die weißen Fähren wirken winzig neben dem Riesen, wie Delphine, die nahe neben einen Walbuckel tummeln. Bratwürstchen-, Kaffee- und Fischbrötchendüfte vermischen sich zum typischen Fischmarktgeruch. An den Frühstücksbuden schlürfen Prostituierte heiße Schokolade oder Kaffee, plaudern mit zufällig angeschwemmten Fremden, bemühen sich krampfhaft, die letzte Nacht zu vergessen, und ihr Make-up verliert sich in den Falten ihres Lebens.
Ein breitschultriger, tagelang unrasierter Mann öffnet seinen Mantel, bietet goldene Uhren an, die wie Christbaumschmuck im Mantelfutter hängen. Ein anderer will Hunde verkaufen, nachts eingefangen. Hasen, Hühner, Enten und Gänse warten in den Käfigen eines Bauernstandes auf ihre Mörder und aus den Kaschemmen am Rand des Platzes dringt Hans-Albers-Gesang zu uns. In einer der Kneipen scheint eine Schlägerei zu wüten, denn in kurzem Abstand fliegen zwei Volltrunkene aus der Tür. Am Anleger vor dem alten Kühlhaus wechseln frisch gefangene Heringe, Aale und Schollen aus Fischkuttern die Besitzer. All diese Bilder, Geräusche und Gerüche sauge ich in mich auf, während wir schweigend vom Menschenstrom gen Övelgönne getrieben werden.
Den Fischmarkt lassen wir hinter uns, gehen an geschlossenen Fischkontoren und einer Zufluchtsstätte für alte ausrangierte Matrosen vorbei und sehen bald die alten Kapitänshäuser Ovelgönnes ans Elbufer geschmiegt. Der anschließende Fußweg gehört für mich zu den schönsten Passagen der Stadt. Rechts gepflegte, wohl mit Schiffslack gestrichene Häuschen, geschmackvoll mit kunsthandwerklichen Accessoires geschmückte Türen. An einer Tür lädt eine schmiedeeiserne Sonne, die ein verträumter Künstler entworfen haben muss, die Gastfreunde zum Eintritt ein. Zu jedem Haus gehört unterhalb des Elbwanderwegs ein Miniaturgarten zum Fluss hin und nach einem breiten Sandstreifen fließt die graue Elbe und führt Eisschollen mit sich. Ein betörendes Bild. Im Sommer schmücken Blumenkästen die Fenster; jetzt sind die Pflanzen in Kellern verbannt. Mein Blick fällt in eine der Wohnstuben, in der sich eine Katze auf dem Klavier räkelt. Ich rieche den Frühstückstee durch die Wände, höre die Melodie des Morgens. Eine grauhaarige Frau erscheint am Fenster, blickt durch uns hindurch zum Strom. Wonach sie schaut, sich wohl sehnt?
„Jannis, ich möchte zur Strandperle. Weißt du noch, damals, nachdem wir uns kennengelernt hatten?“
Und ob ich wusste. Die ganze Nacht lagen wir im warmen Sand vor einem Weidenbusch. Dicht neben uns grölten angetrunkene Jugendliche. Es störte uns nicht, Mitsommersonne schien in uns hinein. Der Elbwind strich zeitlos durch unser Dasein. Momente, die für mich einmalig waren und Perlen in meinem Leben geblieben sind.
„Jetzt im Winter ist der Kiosk geschlossen, Barbara.“
„Nicht für uns. Wir haben die Fantasie, dass er geöffnet ist.“
Über versandete Stufen gehen wir zur Elbe hinunter, wo noch in den sechziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts eine Badeanstalt die Wasserratten anlockte. Die Verkaufsbude aus Plankenholz ist verrammelt. In meiner Fantasie sehe ich junge Frauen und Männer in Badekleidung in der Schlange stehen, hungrig auf ein Fischbrötchen oder durstig auf ein Bier. An ihren Rücken klebt Elbsand, und ich höre deutlich ihre Stimmen aus dieser Zeit.
Ein Ozeanriese zieht an uns vorbei, versperrt die Sicht nach Finkenwerder ins „Alte Land“, wo die Knospen der Apfelbäume auf den Plantagen den Frühling noch fest eingeschlossen halten. Ich bin weit gereist, kenne, außer den Landungsbrücken, keinen anderen Ort, wo Geborgenheit und Fernweh sich so nahe sind wie hier am Elbufer. Bei Lotsenhöft steigt gerade ein Elblotse an einer Seiltreppe die Schiffssteilwand hinab, wird mit einem Schlepper an Land gesetzt. Und bald erklimmt der Hafenlotse die Schiffssteilwand. Mir wird bewusst, dass ich keinen Lotsen im erwachsenen Leben habe, fast alles selbst erdenke und umsetze. Stumm stehen wir am Elbstrand, schauen eine Weile weiter dem Schauspiel an der Schiffswand zu.
„Du, Jannis, was macht die Therapie? Hilft sie?“, durchbricht Barbara das Schweigen.
„Ach, meine Therapeutin ist sehr verständnisvoll. Wir sind noch nicht weit gekommen in den wenigen Gesprächen. Ein Erfolg hat sich eingestellt: Ich habe meine Psychopharmaka gegen Johanniskraut eingetauscht. Wenn die Melancholie und die Leere in mir auftauchen, füllen mich nun Blumen aus und keine Chemikalien.“
„Ist das nichts? Machst du weiter?“
„Ja, ich will.“
„Du schaffst es. Ich weiß es.“
„Du bist lieb. Wenn ich nur wüsste, was ich da erreichen soll.“
„Jetzt habe ich aber Hunger! Ich muss in irgendetwas reinbeißen, sonst vernasche ich dich“, sagt sie ablenkend und klappst mir auf den Po.
„Ich kenne ein nettes Lokal hinter Teufelsbrück in Nienstedten, den ‚Schlag‘. Noch fünfzehn Minuten. Wollen wir?“
„Oh ja.“
Rechts des Elbufers auf der Höhe des Teufelsbrück-Anlegers taucht der Jenisch-Park am Elbhang auf. Hier liege ich oft im Sommer auf einer Decke, wenn ich mir neue Logistik-Konzepte ausdenken muss. Ich liebe den Park, denn er ist naturbelassen mit weitläufigen Wiesen, kleinen Rinnsalen, Tümpeln und einem uralten Baumbestand. Im Angesicht der Elbe, wo sich Vogelstimmen mit dem fernen Summen des Hafens vermischen, kann ich mich gut konzentrieren und meine Aufgaben durchdenken.
Ein sonderbares Erlebnis hat mich hier heimgesucht. In der Nähe habe ich ein Jahr gewohnt. An einem Abend im „Schlag‘„ habe ich vielleicht ein paar Menschen das Leben gerettet“, erzähle ich Barbara. Es war schon spät und das Lokal war rammelvoll, als die Tür aufging und ein sichtlich angetrunkener Mann mit Vollbart eintrat. Beide Arme waren mit Seefahrtmotiven tätowiert. Zunächst nahm ihn niemand wahr. Doch nachdem er an der Theke, wo auch ich saß, zwei Korn getrunken hatte, trat er plötzlich zwischen die Tische und zückte ein aufgeklapptes Rasiermesser. Ich sehe es wie heute vor mir. Die Klinge war rot eingefärbt. Er fuchtelte zunächst unbeholfen damit herum. Die Gespräche verstummten. Unverständliche Worte murmelte er vor sich hin. Dann ging er zu einem der Tische, hielt das Messer unvermittelt an den Hals einer Frau. Die Gäste neben ihr wichen zurück. Er lachte schallend, nahm das Messer vom Hals der jungen Frau, murmelte erneut etwas in seinen Bart, drehte sich trotz seines angetrunkenen Zustandes blitzschnell herum und legte die Klinge an den Hals einer Jugendlichen am Nachbartisch. In dem Raum regte sich nichts mehr. Niemand stand der jungen Frau zur Seite. Selbst Frank, der Wirt, erfahren mit Betrunkenen, stand wie versteinert hinter dem Tresen. Das Gesicht des Mannes hatte sich verfinstert. Er ließ nicht mehr von der jungen Frau ab und fuchtelte mit dem Messer vor ihrem Gesicht herum. Die Stimmung im Gastraum war angsterfüllt und gelähmt. Ich bin kein Held, und ich weiß bis heute nicht, woher ich den Mut nahm, mich von meinem Stuhl zu lösen und auf den Mann zuzugehen. Ich stellte mich vor ihn und sprach ihn ruhig und freundlich an. „Geben Sie mir das Messer“, sagte ich in einer für mich ungewöhnlichen, fast stoischen Ruhe. Er nahm das Messer vom Hals der Frau, drehte sich langsam zu mir um. In seiner Hand lag die Klinge. Seine Augen funkelten. Ich erschrak über seinen Gesichtsausdruck, blieb aber äußerlich ruhig, denn ich ahnte den Schmerz hinter seiner brutalen Fassade. „Geben Sie mir das Messer“, wiederholte ich und für einen Augenblick kreuzten sich unsere Blicke. In dieser Sekunde entschied er über Leben und Tod, das spürte ich. Dann senkte er seinen Blick, klappte das Rasiermesser zusammen und reichte es mir. Er verließ rasch und unerkannt, wie er gekommen war, das Restaurant, ohne ein Wort zu verlieren. Bis heute habe ich dieses Rasiermesser aufbewahrt.
„Ist das schaurig! Da willst du mich hinführen?“, sagt Barbara und presst sich fest an mich.
„Keine Angst, der Schlag ist ein schönes Lokal und hat mir viele Freunde beschert. Hier kehrte ich zuerst ein, als ich damals nach Hamburg zog, wurde von Matrosenbräuten, Hafenarbeitern, Motorradfahrern, Elbjoggerinnen und ehemaligen Kapitänen freundlich als neuer Gast am Stammtisch aufgenommen.“
„Gut, dann gehen wir.“
*
„Das Essen war Klasse“, sagt Barbara, als wir unseren Spaziergang fortsetzen. „Der Frank hat dich ja sehr gern.“
„Ja, ich habe viele schöne Abende dort verbracht.“
„Das merkt man. Wer war diese Gertrud, die dich so angehimmelt hat? Eine alte Liebe?“
„Nein, eine sehn- und liebessüchtige Matrosenbraut, immer auf der Suche nach Zärtlichkeit und Wärme zwischen den Heimataufenthalten ihres Mannes alle paar Monate. Mein Verhältnis zu ihr war vertraut, aber rein platonisch. Ich habe knapp fünf Jahre keinen Kontakt mehr zu ihr.“
„Dafür musstet ihr euch auch so lange umarmen.“
Nicht mehr am Elbufer gehen wir weiter, sondern durch einen kleinen Laubwald mit vereinzelten Fichten, der sich an den Elbhängen nach Blankenese hin erstreckt. Ich habe Barbara einen Nachtisch in Witthüs Teestuben versprochen. Der Pfad ist kaum zu erkennen. Laub alter Bäume bedeckt Wiesen und Weg, bei jedem Schritt raschelt es. Ein Eichhörnchen kreuzt unseren Weg, ist sofort wieder hinter einem der Stämme verschwunden. „Witthus Teestuben“ ist weithin für seine romantische Lage und Atmosphäre und seinen Früchtequark bekannt. Irgendwann taucht das alte, weiß getünchte herrschaftliche Haus zwischen Baumriesen auf. Bald empfängt uns der Duft von Kaffee und Kuchen. Wir steigen die wenigen Treppenstufen hinauf und betreten die Gaststube. Ein gemütlicher Raum mit Holzdielen und alten Kaffeehausmöbeln lädt uns ein, am Fenster Platz zu nehmen. Auf dem schlichten Holztisch steht eine Vase mit Strohblumen auf einem gehäkelten Deckchen. Barbara ist angetan von der Gastlichkeit des Raumes.
„Hier musst du den Früchtequark probieren, Barbara, sonst versäumst du etwas ganz Wichtiges in deinem Leben“.
„… und Früchtetee trinken“, ergänzt sie.
Kurz darauf steht beides vor uns. Kaum wagen wir, das kulinarische Kunstwerk mit Löffeln zu zerstören so liebevoll ist es in einem Glaspokal angerichtet. Doch der Geschmacksinn siegt über das Auge. Wir genießen die Stunde, plaudern, lassen unsere Gedanken schweifen. Solch ein Augenblick müsste ewig andauern, denke ich. Das Café ist erfüllt von Kuchen-, Kaffee- und Teedüften, von Plaudertönen und von Gemütlichkeit.
Als wir zum Aufbruch rüsten, dreht sich eine alte Frau zu uns um und sagt: „Ich habe ein wenig gelauscht, ich konnte ja nicht weghören. Sie müssen sehr glücklich sein, Sie beide. Ich bin richtig neidisch.“
Barbara und ich schauen uns verdutzt an, lächeln, sagen nichts, verlassen die Teestube, gehen wieder hinunter zum Strom. Wintersonne hat sich gegen Nebel durchgesetzt und wärmt uns ein wenig, als wir an den schmucken Häusern Blankeneses vorbeischlendern. Noch über eine Stunde bis „Schulau.“ Etwas zügiger gehen wir nun, denn der kurze Auftritt der Sonne geht bald zu Ende. Es ist später Nachmittag, als wir von dem Steg aus, der über die Kohlehalden des Wedeler Kraftwerks führt, schemenhaft den Schuler Anleger von „Willkommhöft“ und das dazugehörige Gasthaus sehen. Wir lauschen am Elbufer den Ansagen ausgedienter Kapitäne über riesengroße Lautsprecher, die zum Strom ausgerichtet sind. Ein Schiff aus Übersee wird mit der Nationalhymne seines Ursprungslandes begrüßt. Wir erkennen die Melodie nicht. Matrosen winken vom Schiff dankend zurück. Im Winter ist Willkommhöft einsam. Die Fährverbindung zu den Landungsbrücken ist eingestellt, die Terrasse geschlossen, nur drinnen im Restaurant verlieren sich Gäste. Eine Fischbrötchenbude mit heruntergelassenem Visier lässt den begehrten Ausflugsort des Sommers erahnen.
Ein Sommerausflug hierher kommt mir in den Sinn. Es wimmelte nur so von Sonntagsgästen. Die Tische waren durchweg besetzt, so dass die Kellner ihre Last hatten, die vielen Wünsche zu befriedigen. Am Nachbartisch bediente ein blonder Kellner, so um die fünfzig Jahre alt. Er verhandelte mit einer Gruppe Ausflügler über die offensichtlich überfällige Lieferung des Mittagsmenüs. Ich bemerkte, dass er nicht ganz nüchtern war, denn er wackelte beträchtlich und seine weiße Weste wies deutliche Spuren übergeschwappter Suppe auf. Dann verschwand er in kurvenreichem Gang zur Küche. Nach wenigen Minuten trat er wieder aus der Tür, auf beiden Armen eine ganze Reihe von Tellern, ging noch ein paar Schritte zum Mittelgang zwischen den Tischreihen, hielt einen Moment inne, konzentrierte sich, kniff die Augen zusammen und schritt unvermittelt in dem gut zwanzig Meter langen Gang auf uns zu. Und mit jedem Schritt erhöhte sich seine Geschwindigkeit und die Arme verkrampften sich beim Balancieren der Tellerlast. Schließlich stürzte er in beachtlichem Tempo an seinem Ziel vorbei und donnerte auf den Steinfußboden. Scherben und Speisen verteilten sich unter den Tischen erschrockener Gäste. Den Kellner schien der Sturz nicht sonderlich zu beeindrucken. Unbeholfen stand er auf, wischte sich kurz mit der Schürze über das Gesicht und schrie wie selbstverständlich in Richtung Küche: „Tine, bring man rasch den Besen und ein paar Lappen raus. Hier ist ein Malheur passiert.“ Mit diesen Worten wich der Schrecken an den Tischen und selbst die hungrigsten Gäste lachten nun, was ich als unhöflich dem Kellner gegenüber empfand.
Jetzt ist es still und kalt. Die Sonne hat ihr Wärmevorhaben aufgegeben. Barbara und ich gehen über mit Möwenkot bespritzte Planken zur Elbe. Fest verankert steht die Plattform im Strom. Ab und zu spritzt eiskaltes Wasser auf die Holzplanken und gefriert. Heute kein Glück. Weder vom Hafen noch von der Elbmündung her nähert sich ein weiteres Schiff, das es zu verabschieden oder zu begrüßen gäbe. Wir sind ein wenig enttäuscht, denn Willkommhöft ohne Musik und Kapitänsinformationen wirkt trostlos verlassen. Der Strom ergießt sich breit, von Deichen gesäumt, auf denen sich Schafe im Wind ducken. Wegen aufziehenden dichten Nebels ist das andere Ufer nicht zu sehen. Nicht weit von hier, elbabwärts, liegt der Ausflugshof „Fährmannssand“.
Eine halbe Stunde später sitzen wir an Bord des kultigen Restaurant- und Theaterschiffes „Batavia“, das festgefroren in einem der Wedeler Wiesenkanäle liegt. Bei Jazzmusik und Grog wärmen wir uns auf. Draußen hat ein strammer Nordwestwind eingesetzt und vertreibt den Eisnebel.
„Weißt du noch, Jannis, als wir im Sommer hier waren? Es war schwül heiß an diesem Tag, und wir hatten zuvor Fährmannssand besucht. Wir träumten von einem gemeinsamen Urlaub, bevor das Unwetter kam. Ich sehe alles vor mir, fühle wie damals.“
„Ja, Barbara“, sage ich, und die Bilder dieser Stunde leben in mir auf.
Schattensuche
Die Entscheidung, die Therapie zu beginnen, ist mir nicht leichtgefallen. Zunächst war ich fest davon überzeugt, alles allein zu bewältigen und zu verstehen, wobei mir das Verstehen meines Selbst besonders schwerfällt. Außerdem ahne ich durch die Erfahrungen mit meinen Mitmenschen, besonders meinen Freunden, dass es hinter dem Erfolg und dem Spaß im Menschsein noch eine andere Dimension gibt. In meinem Beruf bin ich zielstrebig, kompetent und anerkannt, verdiene gut. Ich bin weit gereist und intelligent, habe einen kritischen Verstand, und habe Sex mit Barbara. Doch dies trügt, weil ich nicht bis zum Grund meiner Seele fühlen kann, die Erlebnisse werden abgespeichert. Emotionen wie Liebe, Freude, Furcht, Traurigkeit dringen gar nicht oder selten nur mühsam unter meine Haut. Ich erfahre täglich, dass ich anders bin. Nehme ich Menschen wahr, die emotional reagieren und kommunizieren, sei es nun auf der Trauer- oder der Freudeseite, wirkt es befremdlich auf mich, macht mich unsicher. Auf der anderen Seite weiß ich gar nicht, wie sich das anfühlt, tief in sich hineinzuhorchen. Ist es überhaupt erstrebenswert und gut, so tief zu empfinden? Ist da vielleicht ein Abgrund, in dem man versinken kann? Wie oft habe ich nachts wachgelegen und mich in Gedankenschleifen verfangen, um diese Fragen zu beantworten. Es ist mir nicht gelungen.
Barbara sagte mir einmal, dass neben unserem Verstand eine Macht und ein Begleiter in uns wohnen, der das Fühlen steuert und so erst Erfüllung gebiert. Erst die Emotionen schenkten den Menschen die ganze Bandbreite ihrer kreativen Existenz. Ich war neidisch auf ihre Erkenntnis gewesen, weil ich das nicht nachempfinden konnte. Ohne Emotionen grabe sich ein Mangel in die Persönlichkeit und weine danach, beseitigt zu werden, hatte sie weitergedacht. Und diesem Weinen hätte man sich zu stellen. Wie klug sie das gesagt hatte. Wenn ich anderen Menschen begegne, die bedrückt sind, nehme ich das achtsam wahr, verspüre aber keine empathische Traurigkeit unter meiner Oberfläche. Ich kenne nur das Wort Trauer, nicht seine lebendige Variante. Von der Therapie verspreche ich mir, dass ich sie besiegen kann, die Leere, die Kälte, die Schatten, die Grenzen in mir. Ja, das sage mir ich oft. Eine unbekannte Stimme in mir treibt mich seit geraumer Zeit an, nach dem Sinn und Grund zu forschen. So bin ich auf der Suche nach Erkenntnis in der Therapie und auf der Suche nach meinen Emotionen.
*
Was haben Sie gestern gemacht, Jannis? Hatten Sie einen schönen Sonntag? fragt Gudrun, meine Therapeutin.
„Die Sonntage können nicht schön sein, wenn wir sie nicht schön machen.“
„Was haben Sie genau unternommen?“
„Ich habe mit Barbara einen ausgedehnten Spaziergang am Elbufer gemacht., das wir oft aufsuchen.“
„Exakter, bitte, Jannis.“
„Ich habe mich treiben lassen, wie die Eisschollen auf der Elbe. Ich fühlte mich wohl, habe alles wach wahrgenommen, wie die Sonntage so sind.“
„Gut so! Den ganzen Tag?“
„Fast den ganzen Tag und die Nacht haben wir auch gemeinsam verbracht. Am Samstag ging es mir nicht so gut, jedenfalls tagsüber.“
„Was war?“
„Eine gewisse Unruhe.“
„Beschreiben Sie genauer!“
„Manchmal ist mir, als werfe ich keinen Schatten in der Sonne. Verstehen Sie?“
„Nicht ganz.“
„Kennen Sie nicht das Gefühl, alles um Sie herum lebt, liebt, das Sonnenlicht fällt auf die Menschen, wärmt sie, und Sie selbst spüren nichts Warmes?“
„Bitte nicht so abgehoben, Jannis, wie ist das wirklich, was fühlen Sie dann genau?“
„Ich nehme das Geschehen in mich auf, mehr nicht. Ich kann es nicht besser beschreiben. Ich muss es erst lernen.“
„Versuchen Sie es!“
Gudrun ist eine praktizierende Psychotherapeutin und hat Psychologie und Philosophie studiert. Neben ihrem Beruf als Psychotherapeutin leitet sie Seminare in der Psychologiefakultät der Universität. Sie sieht nicht wie eine strenge Wissenschaftlerin aus. Ich schätze sie auf Ende 40. Für eine Frau ist sie ziemlich groß und schlaksig. Ihre halblangen glatten blonden Haare sind ab und zu ein wenig zerzaust. Meistens trägt sie verwaschene schwärzliche Jeans und Pullover unterschiedlicher Farbe. Immer hat sie einen kleinen ledernen Rucksack dabei, da sie mit dem Fahrrad zu ihren Terminen fährt, hat sie mir nebenbei einmal gesagt. Im vergangenen Jahr hat sie ein Buch mit dem Titel „Leben … einfach leben“ veröffentlicht. Franz, ein Bekannter von mir, der als Assistent an der Universität arbeitet, erzählte mir, dass sie jahrelang mit schwer gestörten Kindern und in den letzten Jahren mit lebenslang Gefangenen in „Santa Fu“ gearbeitet hat.
Sie hat hier in der psychiatrischen Klinik ein Zimmer für ihre Therapiestunden angemietet. Bei meiner ersten Sitzung vor zwei Wochen hatte mich die Atmosphäre abgestoßen. Die langen Gänge sind schmuddelig und im Zimmer bröckelt der Putz der Wände. Ich fragte sie, ob wir unsere Gespräche nicht woanders führen könnten, und sie antwortete: „Es ist die richtige Kulisse für die gestörte menschliche Seele.“ Ich hinterfragte diesen Satz nicht. Was ich ihr noch nicht offenbart habe, ist, dass ich immer schwarz-weiß und oft von kriegerischen Orgien träume. Die Figuren meiner Träume sind schattenlos. Neben solchen Bildern empfinde ich im Traum Meerwasser im Gesicht und Nebel um mich herum. Nach solchen wirren Träumen fällt es mir schwer, in meine Welt zurückzukommen. Warum ich ihr das bisher verschwiegen habe, ist mir rätselhaft. Das nächste Mal werde ich es ihr sagen.
Wir sitzen an einem alten Glastisch mit zerkratzter Oberfläche auf zwei Plastikstühlen. Die Wände sind leer und verschmiert, an einer Stelle sieht es nach einem vertrockneten Blutfleck aus. Aber sie hat recht. Wenn wir miteinander reden, versinkt das Äußere und ich kann durch die Glasplatte des hässlichen Tisches meine Füße – meine Wurzeln – sehen und mich konzentrieren.
„Haben Sie je geweint?“, fährt sie fort.
„Ich weiß nicht.“
„Haben Sie geweint?“
„Nein, ich glaube nicht.“
„Denken Sie bitte nach.“
„Nein, solange ich zurückdenken kann, habe ich nicht geweint.“
„Wie erklären Sie sich das? Waren Sie nie traurig?“
„Ich habe nie darüber nachgedacht. Traurig, nein, erschöpft war ich schon, aber zum Weinen hat es nie gereicht.“
„Wirklich nicht?“
„Nein.“
„Finden Sie das merkwürdig?“
„Nein. Vielleicht.“
Diese Fragen sind mir unangenehm, wühlen mich seltsam auf. Ich schaue durch das Fenster auf die umstehenden grauen Universitätsgebäude. Warum müssen Häuser des Wissens, der Forschung, der Kultur, der Kreativität so trist sein, frage ich mich. Die kahlen Äste der uralten Platanen zwischen den Uni-Hochhäusern werden kräftig vom Wind bewegt. Ich will meine Probleme doch lösen. Oder nicht? Das ist eine schwierige innere Prüfung für mich, weil mich ein möglicher neuer Weg auch verunsichert. Ich muss mich jetzt vollkommen zur Therapie bekennen. Gudrun erläuterte mir bei unserem ersten Gespräch, dass eine Therapie nur dann Erfolg habe, wenn der oder die Betroffene sie auch ernsthaft wolle. Sei das nicht der Fall, wären alle Bemühungen umsonst.
Jetzt fällt mir noch eine Bemerkung von ihr aus der vorletzten Sitzung ein. Sie sagte, dass nichts schwieriger sei, als körperliche und psychische Prägungen aufzuknacken und zu verändern. Man müsse sehr viel Einsicht haben und jede Menge Geduld, bevor sich ein neuer Weg in Körper und Geist auftue. Hinzu komme, dass sich Menschen mit psychischen Störungen nicht selten eine Wand aus Verdrängung aufbauten, die es erst einmal zu demontieren gelte. Das sei nicht einfach, weil der Mensch Kontrolle über sein Leben anstrebe und jede Veränderung auch die kleinste einen Kontrollverlust bedeute. Da hat sie mich erkannt. Psychotherapeutinnen müssen selbst sehr empathisch und geduldig sein. Letztendlich will ich Klarheit für mich. Ob ich ein schwerer Fall für sie bin? Sie merkt meine Unkonzentriertheit, bittet mich mit stoischer Ruhe, ich solle im Gespräch bei ihr bleiben. Warum setze ich ihr so viel inneren Widerstand entgegen?
„Können Sie sich vorstellen, dass Weinen erleichtert“, nimmt sie den Faden wieder auf.
„Weiß ich nicht, ich glaube nicht. Ist es wichtig für mich?“
„Beantworten Sie es sich selbst.“
„Kann ich nicht.“
„Versuchen Sie es.“
„Ich habe keine Erfahrungen zum Traurig sein.“
„Sie sind kein Kind mehr.“
„Ich kann Ihnen nicht mehr sagen, wirklich nicht.“
„Gut, Jannis. Erzählen Sie mir noch einmal, wie es ist, wenn Sie sich schlecht fühlen. Ich muss Ihnen sagen, Sie wirken so ruhig und abgeklärt. Beschreiben Sie Ihre Angst.“
„Es ist keine Angst.“
„Was ist es dann?“
„In mir scheint ein tiefer Abgrund zu sein, der nicht zu mir gehört. Die Medikamente, die Sie verschrieben haben, verhindern nicht, dass ich den Abgrund erahne, auch wenn sie mich beruhigen.“
„Was für ein Abgrund? Ein See?“
„Kein See. Ein See ist mit Wasser gefüllt. Mein Abgrund ist leer.“
„Ist die Leere Ihre Sorge?“
„Sie ist einfach da und bisher für mich unergründlich. Nur manchmal nehme ich in diesem dunklen Abgrund ein sonderbares Fünkchen wahr, das mir entgegen leuchtet, aber sobald ich es länger betrachte, verschwindet es.“
„Seltsam. Das müssen wir weiter erkunden.“
Obwohl ich bei diesen Fragen abblockte, bleibt sie weiterhin hartnäckig auf Linie. Ich weiß nicht, warum ich hier und jetzt so defensiv reagiere. Möglicherweise, weil sie mich noch mit verbundenen Augen an meinen Abgrund führt oder habe ich selbst Hemmungen, in der Therapie einen Schritt weiter zu denken? Ich muss das abstellen. Erneut mahnt sie mich, weiter konzentriert bei der Sache zu bleiben. Sie wechselt das Thema.
„Wie kommt es, dass Sie so ein erfolgreicher Logistikexperte geworden sind, wenn diese Leere, dieser Abgrund in Ihnen ist?“
„Mein Wissen macht mich unabhängig und gibt mir Halt. Schule und Studium sind mir leichtgefallen und meine Prüfungen absolvierte ich fehlerlos. All das kommt mir heute im Beruf zugute. Ich kann glasklar denken, analysieren, planen und umsetzen. Das ist nicht mein Problem, was fehlt sind tiefschürfende Gefühle.“
„Jannis, jetzt haben wir mehr Klarheit für künftige Gespräche!“
„Bin ich ein schwieriger Fall für Sie?“
„Einfach und schwierig zugleich.“
„Wissen Sie, ich leide nicht, ich möchte nur den Ursprung meines Bewusstseins ergründen. Können Sie mir erklären, was Liebe ist?“
„Das kann ich nicht. Für das Wort gibt es wahrscheinlich Tausende von Definitionen, aber es ist das Geheimnis dieses seelischen Zustandes, dass man ihn nur selbst ergründen kann. Das müssen Sie selbst rausbekommen, Jannis. Ich kann Ihnen nur den Rat geben, dabei nicht zu kompliziert zu denken. Wenn Sie sie entdecken, wird sie sich Ihnen ganz einfach und schlicht zeigen, und dennoch, sie zu leben, ist die höchste Kunst menschlicher Schöpfungskraft.“
„Das hört sich wie ein Widerspruch an.“
„Ist aber keiner, Jannis, es ist die Art der Liebe. Die Liebe existiert nicht in einem Wort, sie muss gelebt werden. Eine Liebe, die nicht alltäglich gelebt wird, ist keine Liebe. Wenn Sie erst einmal einen Menschen beseelt hat, dann nimmt sie das Ruder in die Hand und viele Probleme, von denen man glaubte, sie seien nicht zu bewältigen, lösen sich in Wohlgefallen auf. Und, was noch beeindruckender ist, ein Mensch, der liebt, ist zu Handlungen fähig, die vorher unvorstellbar waren. Das Gehirn setzt eine ungeahnte Kreativität und Energie frei.“
Jetzt ärgere ich mich über mein zurückhaltendes Verhalten. Klar, ich will die Therapie und ihre Erkenntnisse. Da ist aber auch die Gefahr, die mühsam im Leben aufgebaute Kontrolle zu gefährden. Was kommt nach dem Kontrollverlust? Worauf lasse ich mich auf dem neuen Weg ein? Kann ich ihn überhaupt gehen? Ich weiß, dass ich mich im Therapiegespräch ganz öffnen muss. Ich möchte sie nicht verletzen. Was mich aber mehr als alles andere bewegt, ist die Frage nach dem, was die Welt um mich herum als Liebe bezeichnet, die Medien, die Psychologie, die Kirche, die Frauen.