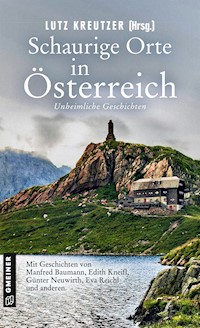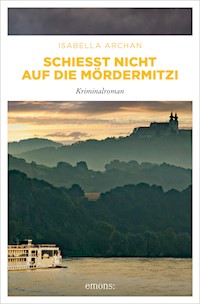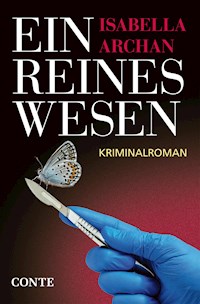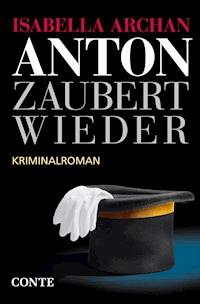
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Conte Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Willa Stark
- Sprache: Deutsch
Anton ist verdächtig, schweigt und stammt aus Graz. Nachdem er in der Wohnung der Ermordeten aufgegriffen wurde, schweigt er so beharrlich, dass die Kölner Kripo eine neue Karte spielen muss: Willa Stark.Willa ist 30, frustriert und arbeitet wieder in Österreich. Als der Anruf ihrer früheren Kollegen aus Köln kommt, macht sie sich auf in die Domstadt, wo Anton tatsächlich mit ihr spricht.Aber der Mörder sucht weiterhin nach Opfern: weiblich, alleinstehend, zurückgezogen lebend. Isabella Archan setzt ihre Erfolgsreihe um Willa Stark fort. Im dritten Teil liegt der Fokus auf der Ermittlerin, die zurück nach Köln darf und dort in einen schwierigen Fall einsteigt. Dass sie sich in einen Verdächtigen verliebt und dazu noch ihr Onkel auftaucht, vereinfacht ihre Rückkehr nicht. Und plötzlich geht es für Willa nicht mehr um die Jagd – es geht ums Überleben …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 363
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
»Wir sind genau das, wofür wir uns entschieden haben.«
Die Brücken am Fluss
»Die Welt hat Zähne. Und mit denen beißt sie zu, wann immer sie will.«
Stephen King
I. Neunziger
1
Der Bub ist klein.
So unfassbar klein. Deshalb kann der Bub nicht helfen.
Vielleicht ist er sechs, vielleicht fünf. Es kann auch sein, dass der Bub erst vier Jahre alt ist. Ein zartes, schmächtiges Kind mit hellen Haaren.
Geht er noch in den Kindergarten oder schon zur Vorschule?
Der Bub kann sich nicht erinnern, ob Fräulein Carmen seine Lehrerin oder die Leiterin des Kindergartens ist. Ihr Name fällt ihm ein, weil er ihn so mag. »Fräulein Carmen, das klingt verboten«, hat mal einer von den Erwachsenen gesagt. Das hat dem Buben gefallen, auch, wenn der Bub nicht weiß, was an dem Namen denn verboten sein soll und wie etwas Verbotenes zu klingen hat. Hübsch ist Fräulein Carmen auf jeden Fall, und der Bub mag sie.
Er kann in seinem Kopf schon zwei mal sieben rechnen. Und drei mal vier. Auch Zahlen zusammenzählen geht richtig gut. Er schreibt schon seinen Namen und einzelne Wörter. Fräulein Carmen und die Mama loben den Buben oft.
Ihm fällt der kleine Zaubertrick ein, mit dem er die Mama heute Abend so zum Lachen gebracht hat, dass sie gesagt hat, jetzt wird sie gleich platzen. Natürlich hat der Bub seine Mutter nicht zum Platzen bringen wollen, das sollen nur Luftballons am Ende einer Party, aber dass sie sich den Bauch gehalten hat vor Lachen, fand er schon gut. Coool, würde der Tobi sagen, der manchmal beim Mittagessen neben dem Buben sitzt und kräftiger als er ist. Tobi haut ihn auch hin und wieder, aber noch öfter sagt Tobi Wörter wie cool und saugeil.
Das ist lustig.
Nicht lustig ist der Kerl, der über die offene Terrassentür ins Wohnzimmer gekommen ist und Mama einen Schrei hat ausstoßen lassen.
Der Bub sitzt am Boden, auf dem Teppich, die Vorhänge wehen nach innen, die Tür zum Garten ist weit offen, Wärme kommt von draußen herein, Wärme und Wind. Der Bub trägt schon seinen Schlafanzug, es ist längst Schlafenszeit, aber er ist noch dabei, einen zweiten lustigen Zaubertrick zu lernen. Das hat ihm die Mama erlaubt.
Das Tolle an dem neuen Zauberkasten ist, dass es eine Anleitung in Bildern gibt, und der Bub kann Bild für Bild anschauen und nachzaubern. Den Zauberkasten hat dem Buben der neue Freund von Mama geschenkt, der Jürgen. Ihn mag der Bub. Aber heute Abend ist auch der Jürgen nicht da. Niemand sonst ist im Haus außer dem Buben und der Mama.
Und dem Kerl, der einfach hereinspaziert ist, als würde er hier wohnen.
Er ist groß, viel größer als der Jürgen, und hat Haare, die zu Berge stehen. Er trägt Handschuhe, obwohl es warm ist. In seiner Hand glitzert etwas Spitzes. Das schaut gefährlich aus.
»Was wollen Sie?«, fragt die Mama, nach dem Schrei. Und: »Mein Mann ist oben. Ich brauch’ nur rufen.«
Aber das ist gelogen, denn Papa ist seit langer Zeit schon bei der Angelika und die beiden wohnen woanders.
Der Kerl scheint gewusst zu haben, dass die Mama lügt und ist nicht erschrocken. Er wedelt mit der Handschuhhand, im Licht der Lampe glitzert das Spitze wie ein Eiskristall.
Mama hat den Hörer vom neuen schnurlosen Telefon in der Hand, das hat sie vom Jürgen geschenkt bekommen wie der Bub seinen Zauberkasten, hebt ihn aber nicht ans Ohr. Stattdessen beginnt ihr ganzer Arm zu zittern, so sehr, dass ihr der Hörer aus der Hand fällt. Er landet auf dem Boden, hoffentlich ist er nicht kaputt, das wäre echt blöd.
Wieder wedelt der Handschuhkerl mit den Handschuhhänden. Das Glitzern zeigt in die Richtung des Buben, der die gemalten Karten für den nächsten Zaubertrick um sich herum auf dem Teppich ausgebreitet hat. Vor dem Buben steht ein schwarzer Zauberhut mit einer hellen Krempe dran. Daneben liegt der Zauberstab, der aber rot ist.
»Wenn du schreist, ist er tot«, sagt der Kerl und zeigt weiter auf den Buben.
Die Mama nickt, und das Zittern geht von ihrem Arm auf ihren ganzen Körper über. Der Bub möchte aufstehen und zu ihr rennen, doch er bewegt sich nicht. Das spitze Glitzern und die Stimme des Kerls sorgen dafür, dass der Bub sich nicht traut, zu ihr zu laufen.
Der Bub guckt nur. Mit riesengroßen Augen.
»Gehen Sie wieder, bitte«, flüstert die Mama. Ihre Stimme klingt klein, als ob sie auch ein Vorschul- oder Kindergartenkind wäre.
Der Kerl geht aber nicht, sondern setzt sich auf einen der Stühle am Esstisch. So, als ob er Hunger hätte und die Mama ihm was kochen soll. Der Kerl schlägt mit der freien Handschuhhand auf die Tischplatte, es kracht.
Der Bub erschreckt sich und beginnt zu weinen.
Laut.
»Wenn er nicht gleich aufhört, dann stech’ ich ihn ab«, sagt der Kerl.
Und endlich bewegt sich die Mama, kommt zum Buben, sinkt vor ihm auf die Knie, und sagt »Pscht«.
Nur »Pscht«.
Dann drückt sie dem Buben ihren Zeigefinger an den offenen Mund. Es ist das letzte Mal, dass sie ihn berührt, deshalb gibt es für den Rest seines Lebens keine wertvollere und innigere Berührung als die eines Fingers auf den Lippen.
Der Bub schließt seinen Mund. Brav. Sein Weinen hört wie von Zauberhand auf.
Es wird still um sie beide.
Fast hat der Bub den Kerl am Esstisch vergessen. Der beginnt mit seinen Handschuhfingern auf der Tischplatte zu trommeln.
»Schick’ ihn weg oder soll er zuschauen?«
Der Kerl grinst jetzt breit.
Die Mama schaut den Kerl an, dann zurück zum Buben.
Mamas Augen sind so groß.
So groß wie Riesenräder am Rummel. Der Bub kann das Blau darin sehen und etwas, das wie Gold aussieht. Seine Mama hat Goldaugen. Das vergisst der Bub nie.
»Gehst du nach oben und spielst ’was, ja, mein Buberl?«
Der Bub gehorcht sonst nicht immer, wenn die Mama ihn wegschickt. Er bleibt dann einfach oder trödelt oder muss ihr unbedingt noch was zeigen. Außerdem fühlt sich der Bub immer so allein, wenn Mama nicht da ist.
Doch ihr Ton hat diesmal etwas, obwohl sie so leise redet, das macht dem Buben nicht nur Angst, da ist noch mehr. Angst hat er schon, seit der Kerl hereingekommen ist. Mamas Ton lässt den Buben folgsam sein. Ohne Widerrede. Ohne Betteln oder Jammern.
Der Bub hebt wie zum Abschied eines der gemalten Bilder hoch. Darauf hält ein Zeichenjunge eine Karte ebenfalls nach oben. Dann lässt der Bub es los. Das Bild segelt in den Zauberhut und verschwindet wie in einem schwarzen Loch. Es ist das vorletzte Bild aus der Reihe. Im letzten verbeugt sich der Zeichenjunge und man kann klatschende Hände sehen. Doch dieses Bild bleibt im Zauberkasten liegen.
»Bitte, geh jetzt. Du kannst auch den CD-Player anmachen, dir das Betthupferl anhören. Es is’ alles gut, mein Buberl. Mein einziger Schatz.«
Mehr sagt sie nicht. Berührt ihn nicht mehr.
Die Mama geht an den Esstisch zu dem Kerl, setzt sich neben ihn hin. Als ob sie ihn kennen würde.
Der Bub steht auf.
Der Bub geht nach oben in sein Zimmer.
Der Bub hört die CD.
Der Bub schläft ein.
Der Bub träumt.
In seinem Traum wird der Bub doch wieder wach. Geht aus seinem Zimmer. Über die Treppe nach unten. Setzt sich wieder auf den Teppich neben dem Zauberkasten. So ganz leise. Ohne einen Laut von sich zu geben.
Weil er so still ist, bemerken die beiden Erwachsenen am Tisch ihn nicht.
Der große Kerl mit den zu Berg stehenden Haaren fährt mit seiner Handschuhhand über den Arm seiner Mama. Fährt in ihr Haar, über ihre Brüste. Der Kerl stöhnt und die Mama fängt an zu weinen.
Aber sie bewegt sich nicht. Läuft nicht weg. Sitzt da wie eine Puppe.
Selbst als der Handschuhkerl mit seiner Handschuhhand unter ihr Kleid fährt, sagt sie nichts, rührt sich nicht.
Der Bub schließt seine Augen, im Traum schließt er sie wieder und wieder, weil er sonst nicht aufhören könnte hinzusehen. Der Bub hört, wie seine Mama wimmert, noch nie hat er seine Mama wimmern hören.
Der Kerl stöhnt jetzt so laut, er gurgelt, er quakt wie ein blöder Frosch oder eine dumme Ente. Der Kerl macht so viele Geräusche, aber am Ende flucht er nur mehr. Böse Wörter, die der Bub zwar aus dem Kindergarten oder der Vorschule kennt, aber nie vor der Mama aussprechen darf, ohne dass sie böse wird.
Und die Mama. Wimmert immer weiter. Kann nicht aufhören.
Bitte, denkt der Bub, bitte, lass die Mama in Ruh’.
Die Zeit macht einen Sprung, es ist, als wäre etwas passiert und dann gelöscht worden. Das geht in Träumen.
Der Wind draußen ist stärker geworden, man kann einen ersten Donner hören.
Der Bub hat seine Augen wieder aufgemacht. Wann ist das denn passiert?
Die Mama sitzt immer noch am Tisch. Auch der Handschuhkerl ist dort. Doch er sitzt jetzt nicht mehr, sondern steht über die Mama gebeugt.
Die Vorhänge vor der Terrassentür wehen ganz weit hoch. Mamas Kleid weht auch nach oben. Gibt einen Blick auf ihre nackten Oberschenkeln frei. Immer noch bewegt sie sich nicht. Sie wimmert nicht mehr. Gar keinen Laut macht sie mehr. Wieder muss der Bub an eine Puppe denken. Weiß ist Mamas Haut, wie Porzellan.
Die Nachbarin, die Tante Hedi, hat viele solcher Puppen. So weiß und so unbeweglich. Tante Hedi gibt ihnen Namen und spricht mit ihnen, aber ihre weißen Körper bewegen sich nie und ihre Augen sind immer offen, auch wenn die Nachbarin, die Tante Hedi, ihnen Schlaflieder vorsingt. Manchmal kann der Bub die Tante Hedi singen hören. Sie singt, ihr Mann, der Onkel Richard, redet laut über Sport. Gleichzeitig. Lustig.
Tante Hedi und Onkel Richard, die beiden sind wie Oma und Opa.
Nicht die richtigen, die sind schon im Himmel, hat die Mama dem Buben erzählt, aber er findet, Hedi und Richard sind cool. Besser als die echten Großeltern, die er ja nicht kennt.
Immer noch geht der Traum weiter. So lang schon.
Der Bub sitzt und wartet.
Der Bub wartet darauf, dass zwischen den Erwachsenen am Tisch weiter etwas passiert. Etwas, das er kennt, das er einordnen kann. Dass sie reden oder essen oder sich streiten oder was auch immer. Wenigstens berührt der Handschuhkerl seine Mama nicht mehr. Stattdessen hat der Kerl seine Hände über sein Gesicht gelegt und Laute quellen zwischen seinen Fingern hervor, Seufzen oder vielleicht Stöhnen.
Der nächste Donner ist schrecklich laut, plötzlich geht das Licht aus.
Der Bub erschrickt gewaltig, bleibt aber immer noch sitzen.
Nach der ersten totalen Dunkelheit im Wohnzimmer kann er wieder Konturen erkennen. Vom Nachbarhaus scheint Licht aus den Fenstern, überspringt den schmalen Gartenstreifen zwischen ihnen, gibt seinen letzten Rest an das Wohnzimmer ab.
Es blitzt. Ganz schön gewaltig.
Im Traum blinzelt der Bub, schaut zum Tisch, und da ist der Kerl weg.
Einfach so.
Das könnte ein Trick aus dem Zauberkasten sein. Nur besser, nur größer. So groß, dass die Zuschauer vor Staunen platzen könnten. Vielleicht ist der Kerl im Zauberhut verschwunden wie die Karte vorhin.
Der Kerl ist weg, nur die Mama sitzt immer noch da.
Der Bub beginnt zu zählen.
Das haben die Tante Hedi und der Onkel Richard ihm beigebracht. Wenn es blitzt, dann zählt man langsam die Zwanziger hoch, um zu erkennen, wie weit das Gewitter noch entfernt ist.
Einundzwanzig, zweiundzwanzig, dreiundzwanzig …
Es donnert.
So nah schon.
Der Wind ist zu einem Sturm geworden, der Regen setzt ein.
Die Vorhänge werden nass, das ist blöd.
Mamas Kleid wird auch nass, denkt der Bub, und das ist der Moment, in dem der Bub aufsteht und durch das dunkle Wohnzimmer tappt.
Der Bub stößt sich an der Kante des Tisches, er kann einen der Stühle fühlen. Ob das der Stuhl ist, auf dem der fremde Kerl gesessen hat, bevor ihn der Zaubertrick hat verschwinden lassen?
Der Bub bewegt sich an der Tischkante entlang, bis er endlich zu der Mama kommt.
Gleich kann er sie fühlen. Gleich ist er wieder in ihren Armen.
Gleich is’ alles gut, Buberl. Du, Mamas einziger Schatz.
Wieder ein Blitz, so grell.
Erhellt das Zimmer für Sekunden.
Der Bub sieht die Mama. Steht direkt neben ihr. Er ist jetzt so nah.
Puppenmama.
Porzellanmama.
Ihr Kopf liegt auf der Tischplatte, ihr Gesicht ist dem Buben zugewandt. Ihre Augen offen. Große offene Augen.
Erstarrtes Blau. Gefrorenes Blau.
Sie blinzelt nicht.
Dunkel.
Einundzwanzig, zweiundzwanzig, drei…
Donner.
Mama?
Der Bub rutscht neben ihr nach unten. Kann in der Dunkelheit den Stoff ihres Kleides fühlen, weich und feucht, der Sturm hat die Regentropfen tatsächlich bis hierher getrieben.
Der nächste Blitz. Der nächste Windstoß.
Ihr Kleid hebt sich.
Wieder wird ihr Schenkel sichtbar. Ihr Knie. Der Bub klammert sich daran. Doch das Weiß ihrer Haut ist kalt wie Eis, da gibt es keine warme Stelle mehr.
Einundzwanzig – Donner. So laut. So nah.
Und so kalt ist die Mama geworden.
Die Regentropfen treffen auch den Buben. Gleich wird der nächste Blitz alles wieder grell und hell machen. Wer weiß, was er dann sehen wird?
Besser die Augen vorher wieder zumachen.
Es ist sicher alles miteinander ein Traum, denkt der Bub, also macht das alles zusammen nichts aus?
Als der Bub aus dem Traum schließlich erwacht, ist er in eine Decke gehüllt.
Er schwitzt.
Der Bub ist nicht mehr im Wohnzimmer, sondern sitzt auf einer der Treppenstufen, die nach oben in sein Zimmer führen.
Es ist hell, jemand muss das Licht repariert haben. So hell und so warm.
Und Leute sind da. So viele.
Nicht mehr der riesige Handschuhkerl, sondern viele fremde Leute. Sie laufen herum und tummeln sich im Zimmer. Sie tragen weiße Anzüge und sehen aus, als würden sie Astronaut spielen, nur ohne Helme. Der Bub beugt seinen Kopf etwas nach vorne und versucht, bis zum Tisch zu gucken. Nach seiner Mama will er schauen. In dem Moment tritt einer der Männer auf den Zauberhut, der immer noch auf dem Teppich liegt. Ganz breit gedrückt wird der schöne Hut mit der weißen Krempe. Beim nächsten Schritt tritt derselbe Mann auf den Zauberstab, der Bub kann das Knacken bis zur Treppe hören, als das rotbemalte Holz bricht.
Der Bub will aufstehen, aber die Decke ist fest um seinen Körper gewickelt und hindert ihn daran.
Plötzlich ist Tante Hedi da.
So kreidebleich hat er sie noch nie gesehen. Sind denn heute alle zu weißen Puppen geworden? Nein, denn die Tante Hedi bewegt sich, stürzt auf den Buben zu, weint und schluchzt und ein wenig Rotz rinnt aus ihrer Nase auf die Wolldecke.
»Gott, oh Gott, oh Gott!«, sagt sie immer wieder und drückt den Buben an sich.
Das lässt ihn noch mehr schwitzen.
Der Bub will Tante Hedi sagen, dass sie ihn bitte aus der Decke auswickeln soll, aber sie weint so laut, dass sie ihn nicht hören kann.
In der offenen Eingangstür steht ein breiter Mann mit rötlichen Haaren und einem Kugelbauch. Er zwinkert dem Buben zu, dann dreht er seinen Kopf, ruft nach draußen.
»Verdammt und Sakra noch einmal, wer kümmert sich denn um das Kind?«, schreit der rothaarige Dicke lautstark, sein Kopf dreht sich zurück, dann ist er mit zwei Schritten beim Buben an der Treppe. Tante Hedi wird zur Seite geschoben und bleibt auf der Treppenstufe mit all ihrem Rotz im Gesicht sitzen.
Der breite Mann hebt den Buben wie eine Feder hoch und trägt ihn nach draußen.
Dort parken gleich fünf Polizeiwagen, das beeindruckt den Buben. Der dicke Mann trägt ihn weiter zu dem Rettungswagen, der etwas abseits, hinter all den anderen Autos steht. Hinter dem Rettungswagen kann der Bub weitere Leute sehen, die einfach nur dastehen und gucken.
Der Rothaarige setzt den Buben erst im Inneren des Rettungswagens ab. Auf einer Trage. Das gefällt dem Buben nicht, er mag es nämlich gar nicht, wenn er zum Arzt muss, der setzt ihn auch immer auf so ein Ding.
Mir ist heiß, will der Bub sagen, doch der dicke Mann scheint seine Gedanken erraten zu haben und wickelt ihn aus der Decke aus.
»Zu heiß! Geht’s dir gut, mein Kleiner?«
Der Bub nickt.
Dann schüttelt der Bub den Kopf.
»Ich hab’ schlecht geträumt. Ich will zu meiner Mama.«
Der Rothaarige mit dem Kugelbauch sieht den Buben an. Nimmt die kleinen Hände des Buben in seine großen. Etwas glitzert in seinen Augen. Es ist kein Gold.
2
Als es vorbei war, der Regen schon längst aufgehört hatte, hielt der große Kerl in seinem schnellen Gehen inne und blieb neben einer Straßenlaterne stehen. Er hatte keine Ahnung, wo er war, wie weit er gelaufen war. Die Erschöpfung ließ ihn keinen weiteren Schritt mehr machen, er war ohne Unterbrechung gerannt, immer weiter, immer fort.
Im Licht der Laterne glitzerten seine nassen Haare, sein Körper schlotterte trotz der Schwüle nach dem Gewitter.
Er schloss seine Augen, sein Atem kam stoßweise aus seinem Mund.
Er spulte in seinem Kopf die Stunden zurück, zurück zu dem Haus, der Frau, dem Kind.
Er sah sich am Esstisch sitzen.
Seine Ellbogen auf der Tischplatte aufgestützt, die glatt und kühl gewesen war. Sein Gesicht in seinen Handflächen vergraben. Lange Zeit. Hinter seinen Lidern waren scharfe blitzartige Streifen explodiert, in seinen Ohren hatte es gerauscht.
Das Jetzt und das Vorher vermengten sich.
Er schien sich in der Dunkelheit zu verlaufen, es wurde stiller in seinen Gedanken, in seinem Herzen. Er kam zu einem Punkt, an dem seine gesamte Existenz zu schrumpfen begann, er war nur noch Stille und Dunkelheit, auf einem kleinen Punkt zusammengepresst, bereit, endgültig zu verschwimmen, zu verschwinden.
Ein letzter, weit entfernter Donner ließ ihn hochfahren.
Im Lichthof der Laterne, von Dunkelheit umgeben, war ihm, als müsste er diesen Film, dieses Geschehen einfach durchspielen, bevor es in den Brunnen der Verdrängung fallen konnte.
Also, noch mal von vorn.
Er sitzt am Esstisch.
Es ist dunkel in dem fremden Wohnzimmer, die Lampe ist ausgegangen, die Terrassentür steht immer noch offen. Das einzige Licht kommt vom Nachbarhaus, dort sind alle Fenster zur Gartenseite hin erleuchtet und ein Schatten läuft an den Vorhängen vorbei.
Ein Blitz. Der nächste Donner.
Er kann nicht länger hier sitzen und warten.
Warten, worauf?
Die Sache ist ohnehin vorbei.
Die Sache hat, wenn man es so sehen will, nie stattgefunden. Aus all seinen blumigen Phantasien ist nur der letzte Akt geblieben, der sich nicht hat vermeiden lassen.
Er legt seine Hände auf der Tischplatte ab. Reibt sie aneinander. Haut auf Haut. Sie schmerzen, als hätte er damit eine schwere Arbeit verrichtet.
Verdammt, wann hat er sich die Handschuhe ausgezogen?
Der missglückte Versuch einer Vereinigung brennt lichterloh, aber der Rest ist zerfallen in gezackte Bilder, den Blitzen am Himmel gleich.
Nicht nur seine Handschuhe sind weg. Auch das Taschenmesser. Lächerlich klein und kurz, aber in seiner Wirkung unübertroffen.
Es wird also Spuren geben. Jede Menge.
Er muss plötzlich grinsen. Wozu hat er überhaupt Handschuhe getragen? Er hätte sowieso andere saftige Pfützen hinterlassen. Die Betonung liegt auf hätte, denn ja, er hat versagt. Versagt!, in großen Lettern an die Wand geschrieben.
Sie war schön gewesen, sein Traum in all den feuchten Nächten. Von dem Moment an, als er sie in der Therme gesehen hat. Es war der Eröffnungstag des neuen Schwimmbeckens gewesen, es hat ein Gewinnspiel gegeben, er hat an dem Glücksrad gestanden, sie hat ihre Adresse auf einer Karte eingetragen, ihn angelächelt. Wie eine Aufforderung, sie einmal zu besuchen. In seinen Phantasien hat es immer funktioniert, warum heute nicht? Warum hat ihn sein Körper in diesem einen realen Moment so im Stich gelassen?
Nein, nicht sein gesamter Körper, nur ein Teil hat schlaff zwischen seinen Beinen gebaumelt. Es wäre sinnlos gewesen, sich die Hose aufzumachen. Dieses Versagen wird bleiben, wer weiß, vielleicht für den Rest seines Lebens.
Hat sie darüber gelacht?
Nein, sie hat in ihrer ganzen Angst nicht einmal mitbekommen, dass sein Teil schlapp machte und es keinen Höhepunkt an diesem Abend geben würde.
Er hätte ihr also gar nicht seine Hände um den Hals legen müssen, oder?
Der nächste Blitz.
In der kurzen Helle sieht er sie am Tisch sitzen. Nicht mehr aufrecht, ihr Kopf auf der Tischplatte abgelegt. Ihre Arme nach unten hängend.
Einer Puppe gleich.
Immer noch schön, immer noch begehrenswert. So wird sie bleiben. Er wird altern, Falten bekommen, eine Sehhilfe brauchen, einen Stock zum Gehen, er wird sich mit allerlei Wehwehchen herumschlagen und seine Vitalität, sein Gedächtnis und seine Fähigkeit, das Wasser zu halten, verlieren.
Sie nicht, niemals. Er hat ihr einen Gefallen getan.
Vielleicht muss man es so sehen.
In der wiederkehrenden Dunkelheit verschwinden die Umrisse ihres Körpers. Es donnert wieder, er spürt den Windstoß, dessen Ausläufer bis in das Wohnzimmer dringt.
Regen beginnt zu prasseln. Wie ein Nachhall seiner Tat. Zwischen seinen Beinen tut sich immer noch nichts.
Er steht auf, schiebt den Sessel nach hinten und beginnt, sich vorzutasten. Seine Handschuhe liegen hier irgendwo. Doch sobald er den Bereich um den Tisch verlassen hat, schlägt er sich das Schienbein an. Es tut für einen Moment richtig weh, eine alte Wut kommt in ihm hoch. Er hebt seinen Fuß und tritt ziellos in die Dunkelheit hinein, um diesem heißen Schmerz ein Kontra zu geben, aber sein Bein fährt nur durch warme Luft. Dafür stößt er sich beim nächsten Schritt wieder.
Es ist sinnlos. So wird er nie den Weg zum Lichtschalter finden oder es kann auch sein, dass durch das Gewitter der Strom ausgefallen ist.
Scheiß auf die Handschuhe.
Er ist ohnehin erledigt.
Vor Jahren, als er als jung und dumm gewesen war, sein Leben da bereits verpfuscht, war er wegen Diebstahl und Gewalt gegen einen seiner Mitschüler zu einer Jugendhaftstrafe von einem halben Jahr verurteilt worden. Da hat die Polizei ihm bei der Verhaftung seine Fingerabdrücke abgenommen. Wie lächerlich schnell wird sein Profil im Polizeicomputer auftauchen, wenn sie hier erst mal die Spuren ausgewertet haben.
Polizist. Das wäre er gerne geworden. Diesen Weg hat er sich endgültig verbaut. Auch so ein Traum, der geplatzt ist, wie der von heute Abend. Wenn sie ihn schnappen, wird es keine kurze Haftdauer im Jugendknast. Also, Zeit, zu verschwinden. Aus der Stadt, aus dem Land. Wenn er erst mal über die Grenze ist, kann er sich immer noch überlegen, wie es weitergeht.
Zuerst muss er hier aus dem Haus raus.
Es blitzt wieder.
Wie hat es ihm einmal im Jugendknast einer seiner Mithäftlinge erklärt? Man muss nach dem Blitz zählen, um herauszufinden, wie nah das Gewitter ist.
Einundzwanzig, zweiundzwanzig … Der Donner kracht direkt über dem Haus.
Er beginnt langsam Richtung offener Terrassentür zu gehen, Schritt für Schritt, er hat keine Lust, sich wieder wo anzustoßen.
Beim nächsten Blitz sieht er das Kind.
Es sitzt auf dem Teppich. Bewegungslos, wie seine Mutter am Esstisch.
Für einen Augenblick spürt er das Bedürfnis, sich zu dem Kleinen dazuzusetzen, ihm zu erklären, warum er heute hier aufgetaucht ist, warum die Sache schiefgegangen ist und dass es ihm tatsächlich leid tut, dass der Kleine jetzt ohne seine Mutter wird aufwachsen müssen. Einen Moment überlegt er, was dieses Erlebnis für das Kind bedeuten wird, für seine Entwicklung, sein zukünftiges Leben. Er sieht sich selbst, seine traurige Kindheit, geprägt von Ignoranz und Gewalt. Es ist wie ein Blick in einen langen Tunnel, an dessen Ende statt hellem Licht nur stumpfes Grau wartet. Seine Kindheit ist vorbei und was geht ihn der fremde Balg an?
In diesem Moment donnert es so heftig, dass Gläser in einem Schrank klirren und sein Herz vor Schreck für eine Sekunde aussetzt.
Scheiße.
Er muss weg.
An der Terrassentür umschlingen ihn Sturm und Nässe in einer Heftigkeit, die ihm kurz den Atem nimmt. Er überlegt, ob er nicht besser das Gewitter drinnen abwarten soll. Was, wenn ihn auf der Flucht ein Blitz trifft oder er von einem umstürzenden Baum erschlagen wird? Trotz der beschissenen Aussichten, die seine Tat mit sich bringt, will er alt werden. Aber die Zeit drängt. Er geht. Kaum, dass er auf die Terrasse hinausgetreten ist, wird er klatschnass. Der Wind peitscht die Regentropfen auf seinen Körper.
Trotzdem wirft er einen letzten Blick zurück in das dunkle Wohnzimmer, versucht, in all den grauen Klumpen das Kind zu erkennen, doch es ist unmöglich, einen Menschen von einem Möbelstück zu unterscheiden.
Hier stoppte er seine Erinnerungen.
Der Film war zu Ende. Seine Tat unumkehrbar. Er rutschte an der Laterne nach unten. Eine Weile hockte er so da, von allen Gedanken, Rückblenden und Bildern entleert.
Ein Kerl auf der Flucht.
Schließlich kam er mit einem lauten Ächzen hoch, machte einen Schritt, noch einen, die Dunkelheit verschluckte ihn wieder.
Die Laterne mit ihrem Lichthof blieb einsam zurück.
3
Es war ein gutes Treffen von Hauptkommissaren, Inspektoren, Kriminalisten und Spurenermittlern gewesen. Ein gutes Seminar.
Peter Kraus, Hauptkommissar bei der Kölner Mordkommission, war zu Gast bei den Kriminalistentagen in Graz in der Steiermark. Er hatte selbst zwei Vorträge und eine Diskussionsrunde besucht, bevor er seinen eigenen Vortrag hielt: SOKO – Teamführung.
Er hatte über die wesentlichen Punkte, ein Team zu gründen, zu führen und vor allem zu Bestleistungen anzuspornen, referiert. Trotz anfänglicher Aufregung hatte er sich nur zweimal versprochen und es am Ende genossen, dass der Hörsaal in der Grazer Universität bis auf den letzten Platz gefüllt gewesen war.
In der Fragerunde war allerdings mehr über den Fall der »Schwarzen Witwe« diskutiert worden, der gerade die Schlagzeilen beherrschte. Elfriede Blauensteiner hatte fünf Menschen vergiftet, aus Habgier, konnte aber nur in drei Fällen angeklagt werden. Auch danach, bei Kaffee und Kuchen, hatten Kraus und einige der anwesenden Herren samt einer einzigen Dame über weibliche Serienmörder gefachsimpelt.
Bevor abends sein Zug zurück nach Köln fahren sollte, besuchte er einen Kollegen auf der Polizeiinspektion in der Schmiedgasse, Alfred Höllerer, mit dem er bei einem grenzübergreifenden Fall zusammengearbeitet hatte. Dieses Zusammentreffen hatte vor zehn Jahren stattgefunden und Kraus war damals noch ein junger Kommissar gewesen. Wie die Zeit rannte.
Alfred Höllerer hatte zwei große Braune auf den Tisch gestellt, und Peter Kraus merkte, wie ihm die Stärke des österreichischen Kaffees langsam aber sicher aufs Herz schlug. Dazu hatte der Kollege einen Ordner zwischen ihnen ausgebreitet. Er setzte sich und wischte sich den Schweiß von der Stirn.
»Das is’ einmal ein Sommer, was? Der Fall vor dir is’ frisch und bringt uns auch zum Schwitzen.«
Der Blick auf das erste Bild machte die Idee von Peter Kraus, hier ein gemütliches Stündchen zu verbringen, schnell zunichte.
Ein Wohnzimmer war abgebildet. Eine Frau, die an einem Esstisch in einer seltsam schrägen Haltung saß. Oder hingesetzt worden war. Ihr Kleid war vorne aufgerissen. Ihr Kopf lag auf der Tischplatte, zur Seite gedreht, ihr langes blondes Haar verdeckte das halbe Gesicht.
Foto Nummer zwei zeigte die Frau näher. Jetzt konnte man das Gesicht sehen, sie war jung, sicher noch keine dreißig. Ihre Augen waren weit geöffnet, ihre Augäpfel quollen hervor, und ihre Zungenspitze lag links über den Lippen. Peter Kraus schluckte, solche Bilder waren nicht leicht anzusehen.
Bild drei und vier waren Großaufnahmen des Halses. Würgemale.
»Is’ erst vorgestern passiert. Hier in der Nähe.«
Peter Kraus fiel sein eigener aktueller Fall ein; erst letzte Woche hatte ein Familienvater seine untreue Ehefrau erschossen. Lieber hätte er mit dem Inspektor über die schöne Stadt Graz an der Mur oder zumindest über ihre jeweiligen Familien geplaudert, aber anscheinend gab es zwischen zwei Kriminalisten zum großen Braunen als Konversation nur die Mordsthemen.
»Ich nehme an, ihr habt den Mörder nicht, sonst würdest du nicht so sauertöpfisch gucken, Alfred.«
»Eine Sauerei war das, das kann ich dir sagen. Die Frau tot im Wohnzimmer und neben ihr ein kleiner Bub.«
Peter Kraus lief eine Gänsehaut über den Rücken. Wenn Kinder in Fälle involviert waren, machte ihm das mehr zu schaffen. Seine drei Töchter waren siebzehn, sechzehn und zehn und insgeheim hätte er gern noch einen Jungen dazu gehabt.
Er hob den Stapel Fotos an und blätterte in den Akten.
»Ist das Kind auch ermordet worden?«
Höllerer seufzte. Er war selbst Vater von insgesamt vier Sprösslingen.
»Nein, das zum Glück nicht, aber wir wissen nicht, ob er nicht während des Tötungsvorganges anwesend war. Der Bub spricht nicht. Überhaupt nix. Is’ zurzeit bei den Nachbarn, die haben die Frau auch gefunden. Wir gehen von einer versuchten Vergewaltigung aus. Das Opfer ist misshandelt worden. Am Ende erwürgt. Warum der Täter die Frau nach ihrem Tod an den Tisch gesetzt hat, das ist allerdings schräg. Als ob er sie hätt’ drapieren wollen.«
»Oder so tun, als hätte die Tat nicht stattgefunden. Werdet ihr einen Psychologen hinzuziehen?«
»Der is’ schon da. Jetzt grad is’ er wieder bei dem Buben, kommt dann hierher. Aber, wie gesagt, der Bub macht seinen Mund nicht auf. Weint nicht. Schaut nur mit großen Augen, dass es einem das Herz brechen kann. Auch, wenn wir so manches g’wohnt sind.«
Der Grazer Inspektor nahm den letzten Schluck aus seiner Tasse und drückte auf eine Taste seines Telefons.
»Die Kollegen draußen müssten schon die nächsten großen Braunen fertig haben.«
Peter Kraus winkte ab.
»Für mich nicht mehr, mir ist leicht schwindlig.«
»Aber geh’. Einer geht noch.«
Widerrede zwecklos, also musste das Herz des Kölner Hauptkommissars einen weiteren starken Kaffee aushalten. Bei den sommerlichen Temperaturen hätte Peter Kraus lieber nur Wasser getrunken.
»Keine Sorge, Peter. Ich lass uns auch ein Mineralwasser bringen, bei der Hitz’ trifft uns sonst noch der Schlag.«
Höllerer stand nun doch auf und verließ kurz das Amtszimmer.
Peter Kraus erhob sich ebenfalls und ging ans Fenster. Er bemerkte, dass sich große Schweißflecken unter seinen Achseln auf dem hellblauen Hemd gebildet hatten. Es war ein extrem heißer Sommertag.
Trotzdem wäre er lieber draußen gewesen, hätte sich die Stadt angesehen, lieber die Hitze als hier wieder Bilder von Toten. Dazu die Sache mit dem Kind. Es war keine gute Idee gewesen, hierherzukommen, er hätte nach seinem Vortrag und der Gesprächsrunde in der Uni einfach touristisch unterwegs sein sollen. Zu spät.
Höllerer kam mit einem vollen Tablett zurück.
»Das Mineralwasser, der Kaffee und ein Topfentascherl dazu. Musst du probieren.«
Der Inspektor stellte alles auf seinem Schreibtisch ab, schob die Akten beiseite, nahm eines der Fotos in die Hand.
»Da könnt’ ich deine Hilfe benötigen.«
»Inwiefern?«
»Wir haben die ersten Spuren ausgewertet. Schau, da am Hals, da kannst du schon auf dem Bild den wunderbaren Abdruck von einem Finger sehen. Das weitere Kuriose dabei ist, dass wir Lederhandschuhe am Boden gefunden haben. Der Täter ist also mit Handschuhen gekommen, hat diese aber für den Tötungsvorgang ausgezogen. Wollt’ die Frau anscheinend mit bloßen Händen erwürgen.«
»Unbändige Wut. Wenn er die Vergewaltigung nicht durchziehen konnte, hat der Täter sich auf diese Weise Macht verschaffen wollen. Wollte, dass sie ihn zumindest so zu spüren bekommt.«
»Das klingt interessant, Peter. Wenn du magst, bleib hier, ich würd’ mich gerne immer mal austauschen.«
»Dafür gibt es ja das Telefon. Oder, schau!« Peter Kraus holte aus seiner Hose ein großes klobiges Handy heraus. »Das ist die Zukunft, Alfred. Wir werden bald alle mit so einem Ding herumlaufen und jederzeit erreichbar sein.«
Höllerer sah sich das Mobiltelefon an.
»Super Teil, Peter. Und ich hab’ mir schon gedacht, was hat der denn in seiner Hose, als du hereingekommen bist.«
Sie lachten.
Dann nahm der Inspektor den ernsten Faden wieder auf.
»Z’rück zu der Frau. Antonia Mürz.«
»Du sagst, ihr habt einen Fingerabdruck?«
»Ja. Und einen Namen dazu. Einen dringend Tatverdächtigen sozusagen.«
»Oh! Dann ist der Fall so gut wie gelöst.«
Peter Kraus schenkte sich ein Glas Wasser ein und trank es in einem Zug leer.
»Ja und nein, Peter. Der Mann heißt Gerhard Lahm. Fünfundzwanzig Jahre alt. Ist vorbestraft. Hat als Teenager eine Zeit in der Justizanstalt Gerasdorf verbracht, das ist eine Einrichtung speziell für jugendliche Straftäter in Niederösterreich. Danach ist er mit seiner Mutter vor deren Tod in die Steiermark gezogen, nach Köflach. Dort ist seine letzte gemeldete Wohnstätte, zumindest hier in Österreich.«
»Ist seine Mutter auch Opfer eines Verbrechens geworden?«
»Nein, die ist an Krebs gestorben, vor einem Jahr. Gerhard Lahm hat die Schule nicht beendet und zuletzt in Köflach in der Therme gearbeitet. Was er an dem Abend in Graz wollte, oder ob er das Opfer schon länger gekannt hat, wissen wir nicht. Die Nachbarn der getöteten Frau haben ihn auf dem Bild aus den Polizeiakten nicht wiedererkannt.«
»Was brauchst du von mir?«
»Der Mann ist deutscher Staatsbürger. Seine Mutter war Deutsche, is’ mit ihrem Sohn vor zwölf Jahren nach Österreich gekommen, stammt ursprünglich aus Bergisch-Gladbach, das ist doch bei dir ums Eck. Sie hat bei uns in der Tourismusbranche gearbeitet. Sein Vater ist zwar Wiener, hat aber die Mutter nie geheiratet.«
Peter Kraus runzelte die Stirn.
»Aber die Fahndung habt ihr schon rausgegeben?«
»Ja sicher, Peter. Das läuft. Auch die deutschen Behörden verständigt. Trotzdem wollt’ ich gern, dass du dich mit einklinkst. Wenn es für dich in Ordnung geht.«
Der Kölner Hauptkommissar seufzte. Seine Dienststelle war mit Fällen überhäuft, aber es konnte nicht schaden, wenn er eine Kopie der Akten mitnahm. Er nickte.
»Das geht in Ordnung, Alfred.«
»Ich danke dir. Ich lass’ dir gleich alles kopieren. Ich kann dir sagen, der Blick von dem Bub, der wird sicher noch länger in meinem Kopf bleiben.«
Höllerer schüttelte sich, als hätte er wie Peter Kraus eine Gänsehaut bekommen.
»Jetzt aber, trink und iss, sonst wird dein Kaffee kalt und das Topfentascherl trocken.«
Schließlich hatten sie doch noch eine halbe Stunde, um über ihre Familien zu reden und die Arbeit ruhen zu lassen.
»Kann ich noch was für dich tun, Peter?«, fragte Höllerer am Ende, als Peter Kraus gerade die Dienstnummer seines Kollegen in sein Handy einspeicherte.
»Kannst du mir noch ein paar Tipps zur Stadt geben? Ich habe ein paar Stunden, bis mein Zug zurückfährt, und von hier aus bin ich quasi schon im Zentrum.«
Der Grazer Inspektor lächelte.
»Ein paar Stunden reichen für unser schönes Graz nicht. Aber wenn du jetzt aus der Schmiedgasse raus bist, gehst du links, direkt in die Stubenberggasse, dann noch mal links in die Frauengasse, rechts in die Jungferngasse und da bist du mitten in der Fußgängerzone. Dann die Herrengasse hoch bis zum Hauptplatz. Dort gibt es die besten Frankfurter Würstel am Standl. Oder eine Krainer, die ist auch herrlich fettig. Dazu Senf und frisch geriebenen Kren, da läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen.«
Peter Kraus hatte eben seinen letzten Bissen von dem Topfentascherl gegessen. Würde er länger hier sein, hätte er sicher schnell ein paar Kilo mehr auf der Wampe, so wie sein Kollege jetzt schon.
»Wenn ich mich verlaufe, dann ruf ich dich mit meinem Handy an, Alfred.«
Höllerer grinste.
»Dass diese Dinger sich durchsetzen, glaub’ ich ja nicht.«
4
Willa rannte.
Der Schweiß rannte auch, ihre Stirn, ihren Hals, ihren Oberkörper hinunter. Eigentlich war es zu heiß zum Rennen, aber Willa musste ihn unbedingt kriegen. Fassen. Dingfest machen.
Den Dieb, der der alten Frau die Handtasche geklaut hatte.
Sie hatte alles beobachtet, am Hauptplatz, in der Grazer Innenstadt, direkt am Würstelstand.
Willas Mutter Anna hatte ihr nur einen Zwanziger und ein paar Schillinge in die Hand gedrückt. Wie so oft in den letzten Monaten hatten die Medikamente ihren Geisteszustand getrübt und mit einem milden abwesenden Lächeln hatte sie ihre Tochter zum Spielen hinausgeschickt. Wie Willa den Zustand ihrer Mutter einschätzte, würde sie sich hinlegen und sicher nicht vor dem Abend wieder aufstehen, nur um sich dann vor den Fernseher zu setzen.
Willa war gerade zehn und ein paar Monate dazu, aber sie hatte die Position der Erwachsenen übernommen, seit Onkel Willi im Gefängnis saß. Das Familienoberhaupt der Kleinfamilie Stark, die aus Anna, Willa und Annas Bruder Willi bestand, saß wegen des Totschlags an seiner Verlobten Heidi ein. Das Urteil war seit sieben Wochen rechtskräftig.
Seither hatte Anna Stark, schon mit dem Leben als alleinerziehende berufstätige Mutter überfordert, bereits drei Nervenzusammenbrüche gehabt. An Arbeit war im Moment nicht zu denken, und Willa fragte sich, mit ihren zehn und den paar Monaten, scheinbar als Einzige, wie sie über die Runden kommen sollten, wenn der Zustand ihrer Mutter zu lange andauern und ihnen das Krankengeld gekürzt würde.
Seit der Sache mit Onkel Willi, also seit dem Verbrechen, war ihre heile kleine Kinderwelt schneller den Bach hinuntergegangen, als sie jetzt rennen konnte. Dafür hasste sie ihren Onkel im gleichen Ausmaß und mit derselben Tiefe, mit der sie ihn, ihren Vaterersatz, all die Jahre zuvor geliebt hatte.
Was war bloß passiert? Wie konnte ein so liebenswürdiger Mensch wie der Willi zum Mörder werden?
Ihre Mutter hatte es ihr versucht zu erklären, auch der Anwalt. Ebenso ihre Klassenlehrerin, Frau Drücker, die Willa in der Schule als Einzige noch wie früher behandelte.
Für die anderen, vor allem für ihre Mitschüler war sie von der völlig normalen Willa zum Mörderkind, Gfrast, zur Killer-Miachn und anderen bitterbösen Bezeichnungen degradiert worden. Natürlich gab keiner der Lehrer ihr solche schlimmen Beinamen, aber sie behandelten Willa so, als ob das Mädchen durch die Tat ihres Onkels mitschuldig geworden wäre.
Nur Frau Drücker nicht: »Dein Onkel hatte einen Aussetzer, wie wir alle ihn bekommen können, wenn unsere Gefühle für einen anderen Menschen zu stark sind und wir uns betrogen oder hintergangen meinen. Ich habe selbst mal meinem Exmann eine Bratpfanne über den Schädel gezogen. Doch meine Kraft hat nur zu einer Beule gereicht. Einer Riesenbeule.«
Willas Klassenlehrerin hatte bei der Erinnerung gegrinst.
»Es ist Gerechtigkeit, nach der wir suchen, Mädel. Und manchmal lässt uns diese Suche wie durchgeknallte Psychopathen aussehen. Es tut mir echt leid um deinen Onkel, Mädel, aber du bist sicher nicht schuld. Der sitzt jetzt eh im Häfn ein.«
Und wegen dieser Gerechtigkeit rannte Willa an diesem heißen Sommertag durch die Grazer Fußgängerzone.
Sie rannte vom Würstelstand am Hauptplatz los. Hierher war sie mit der Straßenbahn gefahren, zu ihrem Lieblingsstand, den sie früher immer mit ihrer Mutter und ihrem Onkel Willi, jetzt Totschläger, besucht hatte. Hatte sich ein Paar Frankfurter Würstel mit Senf und Kren und einer frischen Semmel dazu gönnen wollen, danach mit der Schloßbergbahn auf den Schloßberg hoch, zum Uhrturm und den Kasematten.
Doch kaum war sie am Stand angekommen, hatte sie den Dieb beobachtet, den Lumpen, der die Handtasche der älteren Frau gepackt hatte und losgerannt war.
Willa hinterher, am Trinkbrunnen vorbei. Sie scheuchte eine Horde Tauben auf, die sich dort niedergelassen hatte. Sie war getrieben von diesem Gefühl der Wiedergutmachung. Wenn sie nur dieses eine Verbrechen aufklären, diesen einen Übeltäter fangen könnte, würde alles besser werden.
Hinter Willa begann die alte Frau schrill zu schreien: »Der Lump hat mir mein Tascherl g’stohlen!«
»Haltet den Dieb!«, rief ein Mann, vermutlich der Standbetreiber. Die Stimmen verblassten hinter ihr, je weiter sie sich entfernte und das Böse jagte.
Der Dieb hatte sich kurz umgedreht, gesehen, dass jemand hinter ihm her war, hatte dann einen Zahn zugelegt, war am Rathaus vorbei weiter in die Herrengasse hineingelaufen.
Immer weiter lief er, die Fußgängerzone entlang, Passanten anrempelnd, keuchend und ohne Stopp. Willa, trotz ihrer erst zehn, schaffte es, zumindest die ersten hundert Meter, ihm auf den Fersen zu bleiben. Ihr ganzer Körper pumpte und arbeitete, die Hitze, die Aufregung, die Verfolgungsjagd. Aufgeben kam nicht in Frage, hier war sie im Namen der Gerechtigkeit. Das Seitenstechen und die schwindende Kraft ließen die Hetzjagd immer quälender werden. Willas Sicht wurde von Schweißperlen, die ihr über die Stirn in die Augen liefen, getrübt, ihr Herz klopfte lauter als all der Straßenlärm. Gleich würde sie am Ende ihrer Kräfte sein.
Bitte, Gott, hilf, dachte sie, schrie sie in ihrem Kopf. Wenn nicht beim Willi oder bei der Mama, dann wenigstens jetzt.
Als hätte sie da oben jemand gehört, stolperte der Dieb vor ihr, als er auf Höhe der Jungferngasse war, immer noch in der Fußgängerzone. Weit war er nicht gekommen.
Der Lump stolperte nicht nur, er legte einen imposanten Sturz hin, so, als hätte ihm jemand bei vollem Schwung ein Bein gestellt. Sein Körper drehte sich einmal um die eigene Achse, wurde ausgehoben und knallte dann auf das Pflaster.
Im hohen Bogen wurde die Handtasche nach vorne geschleudert, öffnete sich und der Inhalt verteilte sich wie ein Hagelschauer über den gesamten Bürgersteig.
Willa war so in ihrem Schwung, dass sie fast zu spät angehalten hätte und an dem Dieb, der Handtasche und dem verstreuten Inhalt vorbeigerannt wäre.
Sie stoppte abrupt und kam keuchend vor dem Mann zum Stehen, der in einer unglücklich gekrümmten Haltung am Boden lag.
»Du Volldepp!«, brüllte Willa. Sie keuchte mehr als sie schrie, meinte mehr einen anderen als den Lump am Boden. »Du damischer, beschissener Volldepp, du!«
Jetzt, wo sie angehalten hatte, wurde die Hitze in ihr noch größer, eine Hitze, die sie aufzufressen schien. Die Passanten um sie herum waren neugierig zum Stehen gekommen, ein Mann hatte sich neben den Gestürzten gekniet, eine junge Frau war dabei, die Sachen aus der Handtasche aufzusammeln.
Willa begann langsam, die Szenerie um sich herum wahrzunehmen.
»Nicht dem da helfen!« Jetzt war nur noch Heiserkeit in ihrer Stimme. »Das ist doch ein Dieb. Ein Verbrecher. Der hat doch die Handtasche g’stohlen. Der muss doch verhaftet werden.«
Tränen begannen über ihr Gesicht zu laufen, vermischten sich mit dem Schweiß, schmeckten salzig und bitter. Eine Hand legte sich auf das völlig erschöpfte Mädchen, strich ihr über den Kopf.
Willa fuhr herum.
Ein großer Mann stand hinter ihr, in einem hellblauen Hemd mit Schweißflecken unter den Achseln. Seine Hakennase ragte beeindruckend aus seinem Gesicht hervor, doch seine Augen waren mild.
»Kleines. Es ist gut. Alles gut. Atme durch. Was ist passiert?«
In genau diesem Moment tauchte der Würstelstandbetreiber auf. Er musste hinter dem Verbrecher und Willa hergerannt sein, hatte die beiden endlich eingeholt. Er zeigte auf den gefallenen Dieb.
»Der Lump hat einer alten Dame die Handtasche gestohlen. Vielleicht kann einer die Polizei rufen.«
Der Passant, der neben dem Dieb am Boden kniete, mischte sich ein.
»Er hat sich aber auch den Kopf angeschlagen, er blutet. Ich würd’ auch schnell einen Notarzt rufen, dalli!«
Der Große mit dem hellblauen Hemd und der Hakennase zog aus seiner Hosentasche ein etwas unhandliches Mobiltelefon. Die Blicke der Leute richteten sich darauf, ein kurzes Staunen. Zu der Zeit konnte man damit noch beeindrucken.
»Ich bin die Polizei«, sagte er lapidar und begann auf die Knöpfe des Handys zu drücken. »Nicht aus der Stadt hier, nicht aus Österreich, aber ich nehme sofort Kontakt mit den Kollegen vor Ort auf.«
Er wechselte schnell ein paar Sätze, kniete sich zu dem Passanten dazu und leistete bei dem Dieb am Boden Erste Hilfe, indem er ihn auf die Seite drehte und seinen Kopf vorsichtig in eine gesenkte Position bewegte. Dann stand er wieder auf, bat die Leute, ein paar Schritte zurückzutreten, sprach die junge Frau an, die inzwischen die Handtasche und all den Kram aufgehoben hatte.
Kurz darauf war die Sirene zu hören und, erst als das Polizeifahrzeug in der Jungferngasse hielt, gefolgt von einem Krankenwagen, kam er wieder zu Willa zurück.
Willa hatte alles atemlos staunend verfolgt und sah den Mann mit einer Mischung aus Ehrfurcht und Trotz an. Wenn er jetzt mit ihr schimpfen wollte, würde sie sich zur Wehr setzen. Sie hatte nur getan, was getan werden musste.
Der Mann ging vor ihr in die Knie, kam zu ihr auf Augenhöhe.
»Hast du das beobachtet? Den Diebstahl?«
»Ja, am Würstelstand am Hauptplatz.«
»Bist du ihm hinterher gelaufen?«
»Ja, schon.«
Wieder strich er ihr über den Kopf.
»Tolle Leistung, Mädchen. Meine jüngste Tochter ist ungefähr in deinem Alter. Wir leben in Köln. Ich arbeite dort bei der Kriminalpolizei.«
Bevor er Willa mehr erzählen konnte, war einer der Streifenpolizisten bei ihm und unterbrach sein Gespräch mit Willa. Der Mann stand wieder auf, wurde von ihr weggezogen.