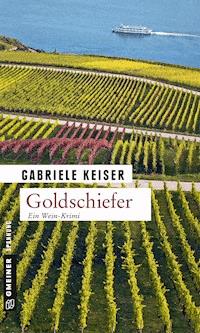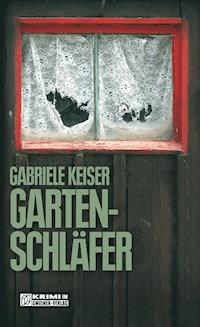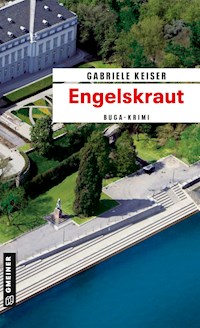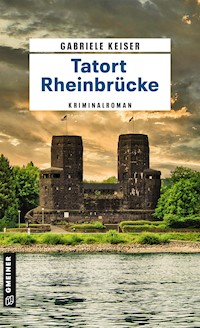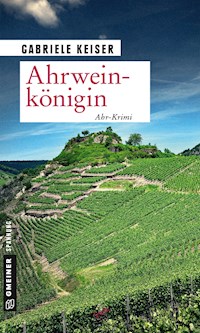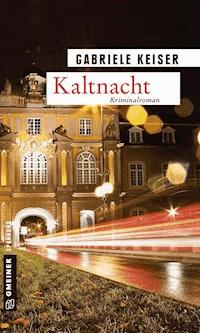Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissarin Franca Mazzari
- Sprache: Deutsch
Kriminalkommissarin Franca Mazzari findet beim Walken in den Weinbergen zwischen Rhein und Mosel die Leiche der vierzehnjährigen Hannah. Ihr Schädel ist zertrümmert und alles deutet auf einen Unfalltod hin. Das Obduktionsergebnis spricht jedoch eine andere Sprache: Hannah wurde ermordet. In den Mittelpunkt der Ermittlungen rückt Andreas Kilian. Er ist seit einigen Wochen zu Gast auf dem Weingut von Hannahs Familie und hat eine Vorliebe für junge Mädchen ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 334
Veröffentlichungsjahr: 2009
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Titel
Gabriele Keiser
Apollofalter
Erster Fall für Franca Mazzari
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2006 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 07575/2095-0
Alle Rechte vorbehalten
2. Auflage 2006
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: Hermann Schausten
Gesetzt aus der 9,5/13 Punkt GV Garamond
ISBN 13: 978-3-8392-3262-0
Bibliografische Information
der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese
Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet
über http://dnb.ddb.de abrufbar.
Widmung
Für meine Kinder Elisa und Frederik
Zitat
Ein Engel spielte sanft auf blauen Tasten,
Langher verklungene Phantasie.
Und alle Bürde meiner Lasten,
Verklärte und entschwerte sie.
Aus: An Apollon
von Else Lasker-Schüler
Prolog
Nun komm endlich! Komm!
Seine Augen brannten vom angestrengten Schauen. Eine kleine Ewigkeit stand er schon hier, und dort drüben bewegte sich immer noch nichts. Ungeduldig trommelte er mit den Fingerkuppen auf die Kante des Fensterbretts. Ein Stück des gelblich gewordenen Lacks splitterte ab und segelte auf den Boden. Das Trommeln wurde lauter und ging in ein Geräusch über, das sich anhörte, als tripple sein Kanarienvogel über den Holztisch. Er fuhr sich mit der Zunge über die Lippen, die sich trocken und rissig anfühlten.
Melisande, wo bleibst du denn?
Im Nachbarhaus waren neue Mieter eingezogen, eine Mutter und ihre kleine Tochter. Von hier aus konnte er direkt in das Mädchenzimmer sehen.
»Andreas«, rief seine Mutter von unten. »Kommst du?«
»Gleich«, rief er zurück und rührte sich nicht von der Stelle. Es war bereits dunkel draußen. Schon so oft hatte er hier gestanden und gewartet. Manchmal hatte er Glück und er konnte einen Blick auf Melisande werfen.
Drüben flammte Licht auf. Sein Herz begann schneller zu klopfen. Ein Schatten huschte an der Wand entlang. Da war sie! Sein Atem ging rascher. Melisande war tatsächlich in ihr Zimmer gekommen. Mit weit geöffneten Augen starrte er in das hell erleuchtete Rechteck des Fensters. Seine Nasenflügel bebten. Seine Hand tastete nach dem Fernglas. Er versuchte, sich so wenig wie möglich zu bewegen. Jegliche Aufmerksamkeit wollte er vermeiden.
Fest krampften sich seine Hände um die geriffelte Plastikoberfläche des Fernglases, während sein Blick suchend umherirrte. Endlich hatte er sie eingefangen. Ihre Silhouette zeichnete sich scharf vor dem Hintergrund des Mädchenzimmers ab. Sie trug die Haare zu einem lockeren Knoten gedreht auf dem Hinterkopf. Ein paar dünne Strähnen hatten sich gelöst und hingen ihr ins Gesicht. Gebannt sah er auf das wunderschöne Geschöpf dort drüben, das zum Greifen nah schien. Zwölf Jahre war sie alt. Er flüsterte ihren Namen. Melisande. Leicht flatternde Silben. Melisande, ein Name wie ein Engel, der geradewegs vom Himmel auf die Erde herabschwebt.
Er beobachtete, wie sie sich an den Schreibtisch setzte, ein Heft in die Hand nahm und darin blätterte. Wahrscheinlich machte sie Hausaufgaben. Wie sie den Kopf geneigt hielt, so anmutig, erinnerte sie ihn an eine Primaballerina. Sie hob die Arme und löste ihr Haar, das ihre Schultern berührte. Das Licht ihrer Schreibtischlampe fiel darauf und ließ es an den Rändern rötlich leuchten. Es sah aus wie ein Glorienschein.
Ganz fest hielt er sie mit seinem Blick. In seinen Händen. Seine Augen hinter den gläsernen Linsen wanderten ihr Profil entlang, tasteten über die Linie der kleinen Nase, umschmeichelten das Oval ihres kindlichen Gesichts. Mit einer beiläufigen Bewegung strich sie sich die Haare hinters Ohr und gähnte, wie ein Kätzchen, ohne die Hand vor den Mund zu halten. Ein Lichtstrahl verfing sich in ihrem Ohrläppchen, in dem ein winziger goldener Ohrring steckte.
Hinten an der Wand stand ihr Bett. Es war aufgedeckt. Ein paar Plüschtiere saßen auf dem Kopfkissen. Eine Katze, ein Löwe und ein weißer Teddy mit dunklen Knopfaugen und einer roten Schleife um den Hals.
Er ließ das Fernglas sinken und grub die Zähne in die aufgesprungenen Lippen. Er stellte sich vor, wie sie seinen Namen sagte. Mit ihrer hellen, mädchenhaften Stimme.
Jetzt stand sie auf, trat ans Fenster und öffnete es. Unwillkürlich ging er einen Schritt zur Seite, versteckte sich hinter dem Vorhang. Er wollte auf keinen Fall, dass sie ihn bemerke. »Spanner!«, hörte er sie bereits verächtlich sagen. »Du kommst dir wohl besonders toll vor mit deinem Fernglas in der Hand?«
Er merkte, wie sein Körper zu zittern begann. Schnell kniff er die Lider zusammen und rief sich ein anderes Bild in Erinnerung. Ein schöneres, angenehmeres. Er sah sich dabei zu, wie seine Hände durch ihr Haar glitten, das sich anfühlte wie Seide. Zimtfarbene Seide. Er roch ihren Duft nach Vanille und Honig. Ihre Haut war zart wie eine Aprikose. Und ihr Mund eine Himbeere. Eine reife Himbeere, die er mit den Lippen pflücken durfte.
Sein Herz pochte lauter, während seine Hände die Oberschenkel entlang streiften und zwischen die Beine drängten. Als er die Augen wieder öffnete und vorsichtig durch den Vorhangspalt hindurchlugte, war sie gerade dabei, sich auszuziehen.
Er konnte sein Glück kaum fassen. Schnell griff er wieder nach dem Fernglas. Hielt es erneut vor die Augen.
Zuerst streifte sie den Pulli ab, danach den Rock. Nun trug sie nur noch ein Höschen, das weiß leuchtete. Er sah ihre knabenhaften Brüste. Winzige Erhebungen mit kleinen Knospen drauf.
Der Schweiß brach ihm aus. Sein Gesicht brannte wie Feuer, als sie das Höschen abstreifte. Ein Anblick, der ihm wie ein Stromstoß durch den Körper fuhr. Mit der einen Hand hielt er das Fernglas fest, mit der anderen zog er den Reißverschluss seiner Hose auf, während er weiter zu ihr hinüberstarrte. Seine Finger berührten blanke Haut. Die Erregung ließ ihn taumeln. Ihr Bild glitt weg. Sofort fing er es wieder ein. Hechelte wie ein Hund. Seine Brust hob und senkte sich in kurzen Abständen. Kehlige Laute drangen aus seinem Mund. Sein Körper zuckte und vibrierte. Er schwebte, er flog. Ein Wirbel, eine nicht enden wollende Himmelfahrt. Warmer, süßer Nektar durchflutete seinen Körper, und die Welt um ihn herum begann in einem unwirklichen Glanz zu flimmern.
Plötzlich wurde die Stille von einem Geräusch durchbrochen. Abrupt hielt er in seinem Tun inne. Seine Mutter stand in der Zimmertür und schaltete das Licht ein. Vollkommene Verblüffung im Gesicht. Erschrocken blinzelte er, fuchtelte mit den Händen und versuchte, seine Blöße zu bedecken.
Mit großen Augen sah sie an ihm herunter, wollte etwas sagen, machte aber sofort den Mund wieder zu.
Er stand da wie eine Salzsäule. Die Hose war ihm in die Kniekehlen gerutscht. Krampfhaft hielt er die Hände schützend vor seinen Schoß. In der einen Hand noch immer das Fernglas.
»Schämst du dich denn gar nicht?«, sagte sie schließlich leise, drehte sich um und ging aus der Tür.
1
Drüben auf der anderen Rheinseite tauchte eine Häuseransammlung auf. Dazwischen zwei Kirchtürme. Dann war der Ort auch schon vorbei. So schnell, dass der in Großbuchstaben ans betonierte Ufer gemalte Name bereits vorübergehuscht war.
In der Scheibe blickte ihm sein Gesicht entgegen. Undeutlich nur, nicht mehr als ein Schemen. Andreas Kilian. Ein Mann in mittleren Jahren mit schütterem Haar und hässlichen Tränensäcken unter den Augen. Nicht zu vergessen der verkniffene Zug unter dem ergrauten Schnurrbart.
Angewidert wandte er den Blick von der schattenhaften Spiegelung, lenkte ihn nach draußen, wo sich auf der Kuppe des gegenüberliegenden Hügels ein Schloss mit Türmchen und Zinnen erhob.
Den Rhein mochte er nicht, seit er ihn als Kind zum ersten Mal gesehen hatte. Als etwas Bedrohliches hatte er ihn im Gedächtnis behalten. Ein breiter, dunkler Strom, der Schiffe tragen und Kinder verschlucken konnte. Er wandte sich wieder dem Buch auf seinem Schoß zu. Aus den Augenwinkeln beobachtete er, wie der Mann, der ihm im Zugabteil gegenübersaß, umständlich eine Butterbrottüte aus einer seiner zahlreichen Taschen kramte. Ein älterer Herr mit einer markanten Hakennase, in Strickweste, Cordhosen und braunen Schnürschuhen. Pergamentpapier raschelte. Der Geruch von Butter und Käse streifte Kilians Nase. Der Mann begann geräuschvoll zu kauen. Als er auch noch eine Banane schälte, meinte Kilian, es hier nicht mehr aushalten zu können. Nichts hasste er mehr als den Geruch reifer Bananen, dem er in diesem engen Zugabteil gnadenlos ausgesetzt war.
Er schloss die Augen und versuchte, flach zu atmen. Sofort sah er eine riesige Obstschale vor sich, die in der Küche seiner Eltern stand. Äpfel, Birnen, und obenauf eine Bananenstaude. Vitamine. »Ihr müsst Obst essen!«, das war der ständige Leitspruch seiner kriegsgeschädigten Mutter. Das, was sie jahrelang hatte entbehren müssen, war ihr unendlich kostbar geworden. Sie hatte nie verstanden, dass ihr Sohn keine Bananen mochte. Dass ihm allein der Gedanke daran Brechreiz verursachte.
Das Buch auf seinem Schoß rutschte herunter. Er bückte sich und hob es wieder auf. Dabei begegnete er dem Blick des Mannes. Dieser hatte inzwischen alles aufgegessen und wischte sich mit einer Serviette die Krümel von der Cordhose. Den Abfall steckte er in die silberfarbene Klappe unter dem Fenster. Es roch immer noch penetrant nach Banane.
»Interessante Lektüre?« Der Mann beugte sich vor, um den Titel des Buches zu entziffern. Auch beim Sprechen erzeugte er dieses merkwürdige Geräusch, das offenbar von einem schlecht sitzenden Gebiss herrührte.
Kilian zuckte mit den Schultern. Der Name Nabokov würde diesem Mann sicher nichts sagen. Zudem hatte er keine Lust auf ausgetauschte Nichtigkeiten mit Menschen, die er nie wiedersehen würde.
»Sprich, Erinnerung ...«, entzifferte der alte Mann. »Ja, die Erinnerungen. Wenn wir die nicht hätten. Was wäre der Mensch ohne Erinnerung? Nichts als eine seelenlose Hülle.« Er sah Kilian freundlich mit seinen wässrig blauen Augen an, die entzündet aussahen. Wartete auf Zustimmung, die ihm Kilian nicht erteilen wollte.
Aber so schnell gab der andere nicht auf. »Wo steigen Sie aus, wenn ich fragen darf?«
Kilian seufzte leise. »Koblenz«, sagte er schließlich, als der Alte seinen rotumrandeten Blick nicht von ihm abwenden wollte.
»Dann haben Sie’s ja gleich geschafft. Bei mir dauert’s noch ein Weilchen. Ich muss weiter nach Köln. Kennen Sie Koblenz?«
»Nein.«
»Schöne Stadt. Historisch höchst bedeutsam. Wenn man sich dafür interessiert«, begann der andere zu schwärmen. »Also, ich habe mich immer für Geschichte begeistert. Schon in der Schule war das mein Lieblingsfach. Hier in dieser Gegend treffen Sie überall auf die Spuren der Römer und Kelten. Die Festung Ehrenbreitstein hoch über dem Rhein – das muss man einfach gesehen haben. Und Schloss Stolzenfels. Lassen Sie sich das nicht entgehen. Ein Kleinod, sag ich Ihnen. Übrigens, der Koblenzer Schängel, der hat’s faustdick hinter den Ohren.« Nun schaute er listig.
»So«, erwiderte Kilian und strich sich über den gestutzten Schnauzbart. Von einem Schängel hatte er noch nie etwas gehört und er glaubte auch nicht, dass ihn dessen Eskapaden interessierten.
»Nächster Halt Koblenz«, schnarrte eine gelangweilt klingende Stimme durch den Lautsprecher. Kilian stand auf und griff nach seiner Reisetasche.
»Auf Wiedersehen«, rief ihm der alte Mann nach. »Und grüßen Sie mir Confluentia.«
Als Kilian aus der Abteiltür trat, bremste der Zug mit einem Ruck. Er verlor das Gleichgewicht, griff auf der Suche nach einem Halt ins Leere und stieß heftig gegen eine junge Frau, die vor ihm stand. Sie drehte sich zu ihm herum, in den Augen ein ärgerliches Aufblitzen.
»Entschuldigen Sie bitte«, murmelte er unterwürfig.
Ihre Miene wandelte sich binnen Sekunden in ein freundliches Lächeln. »Nichts passiert«, meinte sie gönnerhaft und wandte sich wieder nach vorn.
Nach einem kurzen Zwischenstopp setzte sich der Zug erneut in Bewegung. Vorsorglich hielt Kilian sich am Fenstergriff fest. Die junge Frau, eigentlich noch ein Mädchen, stand unbeweglich vor ihm. Sie trug das Haar zu einem Pferdeschwanz hochgebunden. Ihre Schultern waren schmal. Um ihren Hals lag ein dünnes Goldkettchen, und in ihrem Nacken kräuselten sich flaumige Härchen.
Er spürte einen unwiderstehlichen Drang, ihren Hals zu berühren. Die Hände um diesen schlanken Nacken mit dem zarten Flaum zu legen. Mit den Daumen ihre Konturen nachzuzeichnen. Mit einer Hand umkrampfte er den Tragegriff seiner Reisetasche, mit der anderen hielt er sich weiterhin am Fenstergriff fest. Es kostete ihn Anstrengung, diesen Drang zurückzuhalten. So sehr, dass ihm Schweißperlen auf die Stirn traten.
Hinter ihm in dem schmalen Durchgang des Waggons hatte sich eine Schlange Wartender aufgereiht. Als der Zug mit einem endgültigen Ruck zum Stehen kam, achtete er da-rauf, nicht wieder die Balance zu verlieren.
»Koblenz Hauptbahnhof. Willkommen in Koblenz.«
In einem Pulk von Reisenden verließ er den Bahnsteig. Die Treppe mündete in eine Unterführung. Eine Weile ging er hinter der jungen Frau her in Richtung Ausgang. Bis sie von einem wartenden jungen Mann in die Arme geschlossen wurde, der ihr ein freudestrahlendes »Annette!« zurief und sie heftig an sich drückte. Kilian lief an dem Pärchen vorbei, das in seinen Leidenschaftsbezeugungen die Welt um sich herum vergaß.
Die Koblenzer Bahnhofshalle wirkte frisch renoviert. Glänzend polierte Steinböden. Hohe, weißgekalkte Decken. Ein Imbissstand bot belegte Brötchen und Pizzastücke an. Vor dem Buchladen gleich neben dem Haupteingang würde Marion Lingat auf ihn warten, hatte sie gesagt. Das sei nicht zu verfehlen.
Forschend blickte er in die Gesichter der Umstehenden, erwartete ein Aufblitzen des Erkennens. Aber niemand machte den Eindruck, als ob er ihn erwarte. Enttäuscht sah er auf die Uhr. Der Zug war pünktlich gewesen. Unschlüssig stellte er seine Tasche zwischen die Beine. Er hasste Unpünktlichkeit. Fünf Minuten würde er ihr geben.
Marion Lingats Stimme hatte jung geklungen, als sie mit ihm telefonierte. Er hatte versucht, sich vorzustellen, wie sie aussah. So wie sie sprach, mit dieser selbstbewussten Art, musste sie hübsch sein. Unattraktive Frauen redeten anders. Ihr Alter schätzte er um die dreißig. Wahrscheinlich war sie blond und schlank. Nun, er würde sich überraschen lassen.
Einmal dachte er, dass sie es sei. Die Dame, die etwas von Marilyn Monroe hatte, kam zielstrebig auf ihn zugestöckelt, aber nur um neben ihm in den Buchladen einzubiegen. Er sah ihrem wiegenden Po in dem engen Rock nach und spürte Erleichterung, dass dies nicht Marion Lingat war.
Die fünf Minuten waren vorüber. Er bückte sich, hob seine Tasche hoch und lief zur Tür hinaus. Er schauerte, als er auf den Vorplatz trat. Obwohl die Sonne schien, waren es höchstens zwölf, dreizehn Grad. Viel zu kühl für Anfang Juni. Die Taxis standen Stoßstange an Stoßstange. Er steuerte das vorderste an. Eine ältere Dame mit gelblich blond gefärbter Dauerwelle legte die Bildzeitung beiseite und stieg aus. »Na, junger Mann, wo soll’s denn hingehen?« Ihre Stimme klang dunkel und heiser, offenbar eine starke Raucherin.
»Nach Winningen, bitte.«
Mit geübten Handgriffen verfrachtete sie die Reisetasche im Kofferraum. »Auf geht’s.«
Kilian nahm auf dem Rücksitz Platz und sah nach draußen. Koblenz war eine Stadt wie jede andere. Weder besonders hässlich noch besonders schön, war sein erster Eindruck. Enge Straßen, graue, schmucklose Häuserreihen. Er lehnte sich entspannt zurück. Ein durchdringendes Hupen schreckte ihn wieder auf.
»He, du Pappnas’! Willst du mich heut noch rüberlasse?« Die resolute Chauffeuse versuchte ungeduldig, sich in den fließenden Verkehr einzufädeln, was ihr mit einem kräftigen Tritt aufs Gas endlich gelang. Wenn sie weiterhin so forsch fuhr, war er entweder viel früher als gedacht am Ziel – oder er landete in einem Krankenhausbett.
Der Weg führte über eine Brücke. Links lag die Mosel. Das Wasser stand ziemlich hoch. Zwischen den Baumreihen, die das Ufer säumten, tauchte ein Sportboot auf, dessen stumpfer Bug das Wasser durchpflügte, eine weiße Spur hinter sich herziehend.
»Kennen Sie Winningen?«, fragte die Taxi-Fahrerin.
Er verneinte, als er ihren Augen im Rückspiegel begegnete.
»Ich will Ihnen eins sagen: Winningen ist das schönste Dorf von ganz Deutschland – und das mein’ ich nicht nur, weil ich von dort stamme.« Sie wandte sich zu ihm um, Begeisterung im Blick.
Kilian brummte etwas Unverständliches und hoffte, sie möge sich wieder aufs Fahren konzentrieren. Ein Ortsschild tauchte auf. Güls. Was für ein Name. Dazu musste man die Lippen spitzen und die Zunge am Gaumen entlang rollen, um ihn auszusprechen.
»Der Winninger Wein gehört zu den Spitzenweinen auf der ganzen Welt«, lobte sie überschwänglich weiter. »Das kommt durch die einmalige Lage. Mediterranes Klima haben wir dort auf den Moselterrassen. Und Ende August, da feiern wir das Moselfest. Das ist das älteste Weinfest von ganz Deutschland. Von überall her kommen dann die Leut.« Wieder drehte sie sich zu ihm um. »Da müssen Sie unbedingt wieder kommen.«
Wieso glaubte alle Welt, ihm sagen zu müssen, was er zu tun habe?
»Oder machen Sie sich nichts aus Wein?«, fragte sie nach einer Weile, nachdem keine Reaktion von ihm kam.
»Nein.« Er hoffte, das hatte schroff genug geklungen. Er hatte keine Lust, sich zu unterhalten. Und er wollte nicht, dass sie sich dauernd zu ihm umdrehte. Stoisch blickte er nach draußen. Auf die vorbeiziehenden Häuser auf der rechten und den Fluss auf der linken Seite der Straße, dessen grünes Wasser immer wieder zwischen Weiden und Gebüsch hindurchschimmerte. Nun tauchten die Weinberge auf. Akkurat gepflanzte Rebstöcke. Die einzelnen Reihen sahen aus wie mit dem Lineal gezogen. Auf eine Mauer hatte man weithin sichtbar mit weißer Farbe »Winninger Röttgen« gepinselt.
»Wo genau wollen Sie eigentlich hin?«, fragte die Taxifahrerin, als sie die Eisenbahn-Unterführung passierten.
»Zum Löwenhof.«
»Ach, das Vier-Mädel-Haus. Wusste gar nicht, dass die an Gäste vermieten.«
Der Weg führte durch schmale holprige Gassen und an eng aneinander gebauten Fachwerkhäusern vorbei, die aussahen, als würden sie einander stützen. Romantisch nannte man das wohl, wenn man Sinn für so etwas hatte. Über die Straße spannten sich Drähte und Vorrichtungen, an denen dichtbelaubte Weinreben entlang kletterten.
Als sie den Dorfrand erreicht hatten, hielt die Taxifahrerin vor einem weißen, langgezogenen Gebäude, vor dessen hoher Treppe ein aus Stein gehauener Löwe saß. Neben dem Löwen öffneten sich die roten Knospen eines üppigen Rosenstocks. »So, da wären wir.« Sie stieg aus, um seine Reisetasche aus dem Kofferraum zu hieven. »Schönen Aufenthalt wünsch ich Ihnen.«
Kilian rundete den Fahrpreis großzügig auf. Sie sah erstaunt auf den Schein und bedankte sich überschwänglich.
Das Weingut war umsäumt von kerzengerade angeordneten Weinreben. Etliche Steintröge und Holzfässer waren mit bunt blühenden Blumen bepflanzt. Rosa und weißer Oleander verströmte einen heimatlich anmutenden Duft. Auch die graublauen Steinguttöpfe – ähnlich jenen, in denen seine Großmutter früher Sauerkraut und saure Gurken aufbewahrt hatte – ließen für einen flüchtigen Moment Bilder aus seiner Vergangenheit aufblitzen. Er ging die hohe Treppe hinauf und betätigte einen Türklopfer aus goldfarbenem Messing. Ein Löwenkopf. Ein junges Mädchen öffnete ihm. Vielleicht zwölf oder dreizehn Jahre alt. Er dachte, sein Herz setze mit dem Schlagen aus. Wie vom Blitz getroffen starrte er sie an.
»Herr Kilian?«, fragte sie stirnrunzelnd und mit einer Stimme, die ein Echo in ihm hervorrief. Melisande, dachte er. Melisande. Wie ist so etwas möglich? Seit wann werden Träume Wirklichkeit? Er spürte, wie sich in ihm etwas zu regen begann. Etwas, das lange Zeit geschlafen hatte.
»Wo ist denn Mama?« Sie trat aus dem dunklen Rechteck heraus und sah ihm über die Schulter. »Hat Mama Sie nicht abgeholt?«
Er konnte nicht aufhören, sie anzustarren. Dichte, dunkle Wimpern umrandeten aquamarinblaue Augen. Eine schmale, fast knabenhafte Gestalt. Geflochtene hellbraune Zöpfchen, in denen Sonnenreflexe glänzten. Mit einer anmutigen Bewegung strich sie einen ihrer Zöpfe zurück. In ihrem Ohrläppchen glänzte ein niedliches goldenes Knöpfchen. Ein ovales Gesicht, das so wunderbar unschuldig wirkte. Und zugleich so verheißungsvoll. Im selben Augenblick dachte er: Reiß dich bloß zusammen, Kilian!
Umständlich räusperte er sich. »Mich hat leider niemand abgeholt.« Er versuchte ein unbefangenes Lächeln und hoffte, dass es ihm gelang.
»Oh, das tut mir aber leid.« Sie grub die Zähne in die Unterlippe. Zog die Augenbrauen zusammen. Das Aquamarinblau ihrer Augen verdunkelte sich. »Das ist mal wieder typisch«, formulierte ihr Herzmund, der ihn an eine reife Himbeere erinnerte. »Na ja, kommen Sie rein. Ich bin Hannah.« Lächelnd streckte ihm das Mädchen die Hand entgegen, die er augenblicklich ergriff. Eine zarte, weiche Mädchenhand. Bei ihrer Berührung dachte er einen wunderbaren Moment lang, er hielte das Paradies fest.
2
Es gab durchaus Tage, an denen Kriminalhauptkommissarin Franca Mazzari ihren Beruf liebte. Sie empfand sich als gute Demokratin, die die Gesetze ihres Landes achtete und für gewöhnlich hielt sie sich daran, diese mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln zu verteidigen. Auch stand sie dahinter, ihre Dienste für ein Land einzusetzen, in dem die Todesstrafe als menschenverachtend galt und dessen Rechtsprechung als Höchststrafe »lebenslänglich« vorsah – ein Urteil, das dann gefällt wurde, wenn ein Mensch einen anderen erwiesenermaßen mit Absicht getötet hatte.
Ein solches Urteil hatte sie sich für den Angeklagten Julius Melzer erhofft – stattdessen war er gerade freigesprochen worden. Im Namen des Volkes. Obwohl sämtliche der mühsam zusammengetragenen Ermittlungsergebnisse dafür sprachen, dass Melzer seine Lebensgefährtin vorsätzlich umgebracht hatte. Doch weil ihm die Tat nicht zweifelsfrei nachzuweisen war, hatte die Kammer »in dubio pro reo« entschieden.
Franca Mazzari trat aus dem Gerichtsgebäude, verfluchte im Stillen die blinde Justizia und schüttelte fassungslos den Kopf. Da hatte man sich abgerackert, unzählige Zeugen befragt und alles akribisch festgehalten, bis sich aus einem unsäglichen Morast nach und nach brauchbare Mosaiksteinchen freilegen ließen. Diese hatte sie mit nervenzehrender Geduld aneinandergefügt und in die richtige Reihenfolge zu bringen versucht. Unendlich viele Überstunden waren da zusammengekommen, die in einem ganzen Berufsleben nicht mehr abgefeiert werden konnten. Und jetzt war alles für die Katz.
Natürlich hatten sie und ihre Kollegen nicht sämtliche Mosaiksteinchen gefunden, dafür hatte Melzer bestens gesorgt. Aber das Fragment ergab ein klares Bild. Für diejenigen, die sehen konnten!
Wäre sie Julius Melzer bei einem anderen Anlass begegnet, hätte sie ihn durchaus als »gutaussehend« und »charmant« bezeichnet. Vielleicht sogar als »vertrauenswürdig«, obwohl das unter den gegebenen Umständen schwer einzuschätzen war. Sowohl ihre Menschenkenntnis als auch ihre kriminalistische Erfahrung mahnten sie bei diesem Angeklagten zu höchster, wenn nicht gar allerhöchster Vorsicht. Während ihrer Befragungen hatte sich Francas Hypothese immer mehr verfestigt, dass der Angeklagte ein kaltblütiger Gewaltverbrecher war, der seine wahre Persönlichkeit hinter der Maske des Unschuldslamms verbarg. Einer, der zu jener Sorte Männer gehörte, die glaubten, sich alles erlauben zu können und damit in der Regel ungeschoren davonkamen.
Es gab Zeugenaussagen, dass Julius Melzer manches Mal die Hand ausgerutscht war. Dass er mit einer Schere seine Lebensgefährtin erstochen hatte, war schließlich der Endpunkt eines Jahre andauernden Beziehungskrieges. In einem wahren Blutrausch hatte er hinterrücks auf sie eingestochen. Insgesamt zweiundvierzig Mal. Anschließend war er äußerst geschickt vorgegangen. Er legte falsche Fährten und vernichtete sämtliche Spuren, die auf ihn verwiesen. So stand es in der Anklage.
Doch der Beschuldigte war nicht nur ein äußerst gutaussehender, sondern auch ein smarter Mann. Vor Gericht gab er eine bühnenreife Vorstellung ab, mit der er letztendlich seinen Freispruch erwirkt hatte.
»Damit hätte ich wirklich nicht gerechnet«, bemerkte Francas jüngerer Kollege, der neben ihr vor dem Justizgebäude stehen geblieben war. Bernhard Hinterhuber hatte ebenfalls genug Arbeitsstunden investiert und damit manchen Ehekrach zu Hause heraufbeschworen. Im Gegensatz zu ihrem Kollegen war Franca jedoch niemandem Rechenschaft schuldig und so gab es auch keinen Partner zu Hause, der sich über zu viele Überstunden beschwerte. Trotzdem ärgerte sie sich. Und nicht zu wenig.
»Das war doch die reinste Farce da drinnen«, begann sie zu wettern. »Oder siehst du das anders?«
Bernhard Hinterhuber nahm seine Goldrandbrille ab und begann, heftig mit einem Taschentuch darüber zu reiben. »Ich könnte ...«, begann er zwischen den Zähnen hervorzupressen.
»Ja?«, ermunterte ihn Franca, den Blick aufmerksam auf ihn gerichtet. So gern würde sie erleben, wie Hinterhuber die Contenance verlor. Nur ein einziges Mal sollte der korrekte Sittenwächter von ihm abfallen, damit sie endlich den richtigen Bernhard Hinterhuber kennen lernte. Einen Menschen mit Gefühlswallungen. Doch diesen Gefallen tat er ihr auch diesmal nicht. Er vollendete seinen Satz nicht, sondern machte lediglich eine abfällige Handbewegung, bei der beinahe seine Brille heruntergefallen wäre.
Also hielt auch sie sich zurück. Gegenüber Hinterhuber zwang sie sich oft, ihr Temperament im Zaum zu halten. Seit ihm einmal herausgerutscht war, angesichts ihrer Ausdrucksweise könne man denken, sie sei in der Gosse großgeworden, zügelte sie ihre lautstarken Gefühlsausbrüche. Und auch mit ihrer Sprachwahl ging sie sorgsamer um. Wenigstens in seiner Gegenwart.
»Schon erstaunlich, wie dieser Smartieboy alle um den Finger gewickelt hat«, sagte sie in gemäßigtem Tonfall. »Da konnte man durchaus was dabei lernen.«
Hinterhuber hatte seine Brille wieder aufgesetzt und bedachte sie mit einem schrägen Blick. »Meinst du?«
Die Version des Angeklagten war natürlich eine ganz andere gewesen als die von Polizei und Staatsanwaltschaft. Melzer hatte angegeben, zum Tatzeitpunkt außer Haus gewesen zu sein. Nichtsahnend sei er von einer Fortbildung heimgekommen und habe sich auf einen gemütlichen Abend gefreut. Wie gelähmt sei er gewesen, als er seine Freundin blutüberströmt auf dem Sofa vorfand, hatte er mit zittriger Stimme berichtet. Anschließend sei er schreiend aus dem Haus gelaufen, um Hilfe zu holen. Die Nachbarn, die erst seit kurzem im Haus nebenan wohnten, bestätigten dies und bedauerten den armen Mann, den sie als freundlich und zuvorkommend erlebt hatten.
Für Julius Melzer sprach sein sympathisches Äußeres. Er wirkte absolut nicht so, wie man sich gemeinhin einen Verbrecher vorstellte. Zudem übte er einen ehrbaren Beruf aus. Er war Arzt, führte eine Allgemeinpraxis und konnte auf eine Reihe zufriedener Patienten verweisen, die allesamt bereit waren, zu seinen Gunsten auszusagen.
»Glauben Sie wirklich, dass so ein Gewaltverbrecher aussieht?«, fragte eine korpulente Patientin, die als Zeugin geladen war. Dabei deutete sie auf den sichtbar gedrückten Angeklagten. Sie schüttelte heftig den Kopf. Die Empörung leuchtete ihr aus dem runden Gesicht. »Dass Sie überhaupt so etwas denken können! So viele Jahre ist er schon mein Arzt. Und immer hat er mir geholfen. Ich kann nur Gutes über Dr. Melzer sagen. Einer wie er macht so was nicht. Nicht mit diesen Händen. Das sind heilende Hände.«
Sie war nicht die Einzige, von der solche Lobeshymnen zu hören waren. Während der gesamten Verhandlung war Julius Melzer taktisch klug vorgegangen. Er ließ vornehmlich andere für sich sprechen und schwieg lange zu den ihm gegenüber geäußerten Vorwürfen.
»Mein Mandant ist weder Mörder noch Totschläger«, äußerte sein Verteidiger im Schlussplädoyer. »Einer, der auf den Eid des Hippocrates geschworen hat, hat sich dazu verpflichtet, das Leben zu schützen, nicht es zu nehmen. Er ist zutiefst erschüttert über den Tod seiner langjährigen Lebensgefährtin und es schmerzt ihn in besonderem Maße, dass er hier auf der Anklagebank sitzt, während der wirkliche Täter draußen frei herumläuft.«
Julius Melzer setzte noch eins drauf. »Ich schließe mich dem Plädoyer meines Anwaltes an«, sagte er mit demutsvoll gesenktem Kopf. »Ich habe meine Lebensgefährtin über alles geliebt und hatte keinen einzigen Grund, sie zu töten. Ich bitte das Gericht, mir Glauben zu schenken.« Danach sah es so aus, als ob er zusammenbräche. Eine reife schauspielerische Leistung, die auch den letzten Zweifler zu überzeugen vermochte.
Hätte Franca es nicht besser gewusst, auch sie wäre ihm vielleicht auf den Leim gegangen. Während der Verhandlung hatte sie Julius Melzer nicht aus den Augen gelassen. Aus den zahlreichen Vernehmungen kannte sie seine Körpersprache und wusste sie zu deuten. Irgendwann während der Verhandlung hatte sie das Lächeln in seinen Augen gesehen. Das Lächeln des Triumphes, das er für einen winzigen Augenblick nicht verbergen konnte. Nun hatte er erreicht, was er wollte. Als freier Mann durfte er den Gerichtssaal verlassen.
Warum sollte man sich da noch Mühe geben? Da war es doch besser, pünktlich nach Dienstschluss nach Hause zu gehen, sich ein Gläschen Wein zu gönnen und es sich gut gehen zu lassen anstatt die ganze Nacht in einem stickigen Büro zu hocken, während alle anderen ihren freien Abend genossen.
Wütend scharrte sie mit dem Fuß. »Ich verstehe einfach nicht, wie alle Welt auf so einen geschniegelten Typen hereinfallen kann. Denen muss doch klar sein, wie sie manipuliert wurden. Wie er sie mit seinem Unschuldsblick angesehen hat. ›Aber liebe Leute, ich doch nicht‹«, ahmte sie die Sprechweise von Julius Melzer nach. »Und immer schön das Köpfchen gesenkt. Wie man es in diesen tollen Seminaren lernen kann: ›Wie verkaufe ich am besten meine Mitmenschen für dumm?‹« Mit einer abrupten Bewegung warf sie den Kopf mit dem dunkelblonden Kurzhaar nach hinten. Die heilige Wut begann sich langsam Bahn zu brechen.
»Sollen wir noch einen trinken gehen?«, wurde sie in ihrem Redestrom von Hinterhuber gebremst.
»Wenn du meine schlechte Laune ertragen kannst.«
Er grinste sie an. »Ist das denn was Neues?«
»Na, hör mal. Wo ich doch sonst die Ausgeglichenheit in Person bin.« Jetzt grinste auch sie über das ganze Gesicht. Der Donner hatte sich entladen. Das Gewitter war vorbei. Ach Hubi, mein Goldstück. Mein Sonnenschein. Wie dieser schmalbrüstige Goldrandbrillenträger es immer wieder schaffte, sie aufzuheitern.
»Ins Grand Café?«
»So nobel?«
»Man muss auch seine Niederlagen mit Würde ertragen«, erwiderte er.
3
»Kommen Sie doch mit, wir sind gerade beim Essen.« Hannah sprach, als ob sie gewohnt sei, mit Gästen Konversation zu machen. »Hier entlang.«
Er folgte ihr durch einen dunklen Flur, den ein angenehmer Duft nach Essen durchwehte. Sie blieb stehen und hielt ihm die Tür auf. »Bitteschön.«
Ein höfliches Mädchen, das wusste, was sich gehörte.
»Mama hat’s mal wieder nicht auf die Reihe gekriegt. Herr Kilian musste mit dem Taxi herkommen«, sagte sie mit unüberhörbarem Vorwurf in der Stimme.
Am Esstisch, der für fünf Personen gedeckt war, saßen zwei Frauen. Eine ältere um die siebzig und eine jüngere, die vielleicht die Tochter war. Allerdings wiesen die beiden Frauen wenig Ähnlichkeit miteinander auf. Während die Ältere dünn und schmal war und fast zerbrechlich wie eine Märchenfee aussah, musste die Jüngere ungefähr doppelt so viel Gewicht auf die Waage bringen.
Die Ältere stand auf und trat auf ihn zu. Ihre zierliche Gestalt reichte ihm bis zu den Schultern. Als sie zu ihm aufsah, bemerkte er die geplatzten Äderchen auf ihrer knitterigen, pergamentartigen Haut. Durch ihr schütteres, rötlichbraun gefärbtes Haar schimmerte die Kopfhaut.
»Herr Kilian. Herzlich willkommen. Lingat.« Ihr Händedruck war erstaunlich fest. »Ich möchte mich für meine Tochter Marion entschuldigen. Schön, dass Sie trotzdem den Weg hierher gefunden haben. Bitte nehmen Sie doch Platz.« Sie wies auf einen leeren Stuhl. »Unsere Gäste schätzen den familiären Rahmen. Ich hoffe, das kommt Ihnen entgegen. Meine Enkelin Hannah haben Sie ja schon kennen gelernt. Das hier ist meine Tochter Irmtraud.« Sie wies auf die füllige Frau, die verschüchtert lächelte. Auf ihrer rechten Wange prangte ein schlecht überschminktes Feuermal.
»Sie haben sicher Hunger nach der langen Fahrt. Ich hoffe, Sie mögen Rindfleisch mit Meerrettichsoße? Vorweg gibt es Markklößchensuppe. Das ist ein traditionelles Winzeressen. Was möchten Sie trinken? Ein Gläschen Wein?«
»Nein, danke. Keinen Wein. Wasser bitte.« Er setzte sich auf den ihm zugewiesenen Platz.
»Wein ist gesund. Da bekommt einem das Essen besser«, warf die Füllige mit einem Kichern ein. »Das hat mein Vater immer behauptet.«
Mit ihren rundlichen Formen erinnerte sie ihn entfernt an die Statur seiner Großmutter. Allerdings waren bei Irmtraud Lingat Busen, Bauch und Hüfte noch etwas üppiger ausgeprägt, was sie unter einem sackartigen braunen Kleid zu verstecken suchte.
»Irmchen«, tadelte die Mutter die Tochter mit abschätzigem Blick. »Wenn Herr Kilian doch keinen Wein mag. Ist eben nicht jedermanns Geschmack, nicht wahr?«, wandte sie sich mit gekünstelt freundlicher Miene an ihn.
Er überlegte, ob er etwas Erklärendes antworten sollte, ließ es dann aber sein. Die Suppe erinnerte ihn an zu Hause. Wenn er aus der Schule kam, hatte oft ein großer Topf mit dampfender Markklößchensuppe auf dem Herd gestanden. Manchmal hatte er drei Teller geschafft, so gut hatte sie ihm geschmeckt. Auch diese hier war nicht schlecht.
Besteck klapperte auf Porzellan. Niemand sprach mehr etwas. Dann wurde der Hauptgang serviert. Das Rindfleisch war ausgesprochen zart. Wahrscheinlich Tafelspitz. Die Meerrettichsoße trieb ihm die Tränen in die Augen. Aber es schmeckte vorzüglich. Er nahm einen Schluck Wasser und spürte die Blicke von drei weiblichen Wesen auf sich gerichtet. Wie sie ihn abtasteten. Musterten. Ihn einzuschätzen versuchten. Ab und zu begegnete er den neugierigen Augen des Mädchens. Hannah hieß sie. Nicht Melisande. Melisande war ein Traum. Aber Hannah saß leibhaftig hier mit ihm am Tisch. Er fing ihren Blick auf. Wieder fiel ihm das Edelstein-Blau ihrer Augen auf. Er lächelte sie an. Wie verdammt hübsch du bist, kleine Hannah. Er konzentrierte sich wieder auf sein Essen. »Es schmeckt sehr gut«, lobte er und dachte an seine einsamen, schnell und fantasielos zusammengewürfelten Mahlzeiten. »So was Köstliches habe ich lange nicht gegessen.«
»Für die Küche ist Irmchen verantwortlich.« Die Mutter wies gönnerhaft auf ihre Tochter.
Wie auf ein Stichwort hin begann Irmchen loszusprudeln. »Ich koche leidenschaftlich gern. Manchmal kriege ich Aufträge für große Gesellschaften. Da muss man sich ganz schön ranhalten, sag ich Ihnen. Bis man erst mal alles geplant hat, dann die vielen Einkäufe. Aber das Kochen macht mir wirklich großen Spaß. Man muss den Zutaten ihre Geheimnisse entlocken. Damit sie sie auf dem Teller entfalten können.«
»Irmchen, du musst nicht gleich Herrn Kilian mit deinem Lieblingsthema überfallen«, stoppte die Alte die Tochter, die sich bei den tadelnden Worten ihrer Mutter verschämt über ihren Teller beugte. Das Feuermal unter der Schminke blühte, während sie mit hastigen Bewegungen Essen in sich hineinschaufelte.
Fast wie früher bei uns zu Hause, dachte Kilian. Trautes Heim, Glück allein. Merkwürdig, dass ihm die Seniorin anfangs wie eine Märchenfee vorgekommen war. Nun erinnerte sie ihn eher an eine böse Hexe.
Zu Hause war seine Mutter immer der Rammbock gewesen. Die Schwiegertochter. Das Flüchtlingsmädchen aus Ostpreußen, das sich im Haus seines Vaters eingenistet hatte. Das war die Meinung seiner Großmutter. Honig hätte sie ihrem Sohn ums Maul geschmiert. Den Verstand hätte sie ihm verkleistert. Großmutter scheute sich nicht, dies laut und vor allen Leuten zu äußern. Und seine Mutter hatte eingeschüchtert und mit gehetztem Blick geschwiegen. So wie Irmchen.
»Sie müssen sich nicht von diesem Dragoner am oberen Tischende schikanieren lassen«, hätte er ihr am liebsten zugerufen. Aber es lag ihm fern, sich in die Familienangelegenheiten anderer Menschen einzumischen.
In diesem Moment ging die Tür auf. »Herr Kilian. Sie sind schon da! Oh, entschuldigen Sie bitte vielmals.« Eine Frau kam auf ihn zugestürmt, viel jünger als Irmchen. Viel schlanker und auch viel hübscher. Marion Lingat sah in etwa so aus, wie er sie sich vorgestellt hatte. Nur war ihr Haar nicht blond, sondern hellbraun. Etwas dunkler als das von Hannah. »Ich hab fest drauf vertraut, dass die Deutsche Bundesbahn mal wieder einhält, was man ihr so gern nachsagt. Aber wenn man sich einmal drauf verlässt, ist sie natürlich pünktlich.« Lachend zuckte sie mit den Schultern. »Die Stadt war total verstopft. Es ging überhaupt nichts voran. Ganz Koblenz war offenbar zum Einkaufen unterwegs. Als ich am Bahnhof ankam, waren Sie längst weg.«
»Du hast nicht zufällig wieder mal vergessen, wo du dein Auto abgestellt hattest?« Merkwürdig, wie es dieser bissigen alten Hexe gelang, mit einem einzigen Satz den frischen Wind, den Marion Lingat mitgebracht hatte, sofort wieder zu vertreiben.
Marion lachte nervös.
»Das ist einfach kein Benehmen. Was muss Herr Kilian für einen Eindruck von uns bekommen?« Die Alte saß da mit zusammengekniffenen Augen und versteinerter Miene.
Er fühlte sich unbehaglich. Das Essen schmeckte ihm längst nicht mehr so gut wie am Anfang.
Marion setzte sich auf den verbliebenen freien Platz und entfaltete ihre Serviette. »Na, hat Irmchen wieder was Köstliches gezaubert? Sie müssen wissen, meine Schwester ist eine wahre Kochkünstlerin«, richtete sie sich an Kilian. »Wenn Gäste da sind, gibt sie sich ganz besondere Mühe.«
»Rindfleisch mit Meerrettich ist doch nichts Besonderes«, wehrte Irmchen bescheiden ab.
»Also ich freu mich immer auf das Ergebnis deiner Künste«, sagte Marion gönnerhaft und begann zu essen. »Hmmm. Köstlich.« Sie warf ihrer Schwester einen anerkennenden Blick zu, den diese freudig auffing.
Es gefiel ihm, wie Marion Lingat von ihrer Schwester sprach. So herzlich und anerkennend. Ihre Augen waren graublau. Etwas heller als die ihrer Tochter. Und genauso dicht bewimpert. Abwechselnd betrachtete er Mutter und Tochter und versuchte, die eine in der anderen zu finden.
»Hatten Sie eine gute Reise?«, wandte sich Marion wieder an ihn.
»Ja. Danke.«
»Mit dem Wetter haben Sie leider nicht so viel Glück. Normalerweise ist es bei uns Anfang Juni schon richtig sommerlich warm. Und sie sollen ja was von Ihrem Urlaub haben.«
»Ich mache keinen Urlaub.«
»Nicht?« Nun waren drei weibliche Augenpaare auf ihn gerichtet.
»Ich schreibe an einem Buch über seltene Schmetterlingsarten. Hauptsächlich bin ich wegen des Apollofalters hier.«
»Ein Schmetterlingsliebhaber«, sagte Irmchen.
»Parnassius apollo vinningensis«, sagte Hannah. »So heißt der Moselapollo. Der ist nach unserem Ort benannt worden.« Sie sagte das mit einigem Stolz.
»Du interessierst dich für Schmetterlinge?«, wandte er sich an sie.
»Sie interessiert sich für alles Mögliche.« Eine Mutter, die mit unverhohlenem Stolz ihre Brut ins rechte Licht rückt.
»Nur nicht für das Weingut«, schob die Hexe in säuerlichem Tonfall nach.
»Sie macht schon genug«, warf Marion scharf ein, als ob sie auf diesen Einspruch nur gewartet hätte. »Wenn es nach dir ginge, müsste jeder von uns Tag und Nacht in den Weinbergen schuften.«
Man sah es der Alten am Tischende an, dass sie liebend gern etwas Heftiges erwidert hätte, aber sie bezwang sich im letzten Moment, kniff die Lippen zu einem schmalen Strich zusammen, und es war wieder eine Weile still am Tisch.
»Sie könnten Glück haben und den Apollofalter schlüpfen sehen«, sagte Hannah. »Im Uhlen gibt es viele Stellen, wo man Schmetterlingspuppen finden kann. Das ist der Felshang mit den vielen steilen Terrassen unterhalb der Autobahnbrücke. Hauptsächlich dort wächst die weiße Fetthenne. Also die Wirtspflanze der Apolloraupe«, fügte sie hinzu. Es klang fachmännisch. »Wenn Sie wollen, begleite ich Sie.«
Er sah sie verzückt an. Das spontane Angebot hatte ihn vollkommen verblüfft. »Das wäre wirklich sehr freundlich«, versuchte er verhaltener zu sagen als ihm zumute war.
»So, jetzt gibt’s noch Nachtisch.« Irmchen war aufgestanden und stellte eine Schüssel mit Erdbeeren auf den Tisch, die mit einem Minzezweig dekoriert war. »Ich hab etwas Neues ausprobiert.« Sie suchte Kilians Blick und sah ihn mit verschwörerischer Miene an, während sie Schälchen austeilte. »Bitte, bedienen Sie sich. Und dann sagen Sie mir, was Sie davon halten.«
Er schöpfte sich ein wenig von dem Fruchtbrei in sein Schälchen.
»Ich bin gespannt, ob Sie es herausschmecken.« Es hörte sich an, als habe sie dieses Dessert ganz speziell für ihn kreiert.
Gehorsam probierte er als Erster. »Köstlich«, sagte er überrascht. Die Erdbeerstücke, die in einer fruchtigen Soße schwammen, schmeckten ein wenig nach Minze und nach etwas unbekanntem Scharfen. »Eine äußerst interessante Geschmacksnote.«
»Wirklich?« Wieder errötete Irmchen tief. Ihre Augen strahlten und das Feuermal auf ihren dicken Backen glühte. »Es ist ein Hauch grüner Pfeffer dran. Meine Anregungen hole ich mir aus Kochbüchern. Als ich das mit dem Pfeffer las, dachte ich erst, das funktioniert nicht. Aber dann habe ich es einfach ausprobiert. Und ich finde, es hat was.«
»Es hat was ganz Entschiedenes«, stimmte er zu.
»Sie können gern noch einen Nachschlag haben. Wollen Sie?«
»Hannah, zeigst du Herrn Kilian das Zimmer?«, sagte Seniorin Lingat nach dem Essen.
»Du musst mir das nicht extra sagen, Oma.« Hannah stand auf und griff sich seine Reisetasche. »Hätt’ ich sowieso gemacht.«
»Nicht doch«, sagte er und nahm ihr die Tasche wieder aus der Hand. Für Sekunden berührten sich ihre Finger. Ein Stromstoß durchfuhr ihn. Bis hinunter zu den Lenden. »Die ist zu schwer für dich.« Das süße Gift begann bereits zu wirken. Er hoffte inständig, dass niemand ihm etwas anmerkte.
Hannah lachte. Ein kokettes Blitzen in den Augen. »Ich bin eine starke Frau.«
Das Herz stach ihm in der Brust. Diese unschuldigen blauen Augen. Diese erfrischende Naivität. Oh Hannah. Hannah. Kleine Fürstin aus dem Märchenland, der ich hier so unverhofft begegne.
»Das bezweifle ich nicht. Aber es ist ziemlich unhöflich von einem Mann, eine junge Frau sein Gepäck tragen zu lassen«, sagte er in nüchternem Tonfall, der ihm schwer fiel.
»Wenn Sie meinen. Ein Stockwerk höher.« Hannah zeigte mit dem Daumen nach oben und ging voran. Er maß mit gierigen Blicken ihr Hinterteil, das prall von engem Jeansstoff umschlossen wurde. Der winzige Rand ihres Unterhöschens lugte aus dem Bund hervor. Darüber schimmerte ein Streifen goldbrauner Haut.
»Erwartet ihr noch andere Gäste?«, fragte er und hatte Mühe, seine Stimme normal klingen zu lassen.
Sie schüttelte den Kopf. »Momentan vermieten wir nur ein Zimmer. Die anderen müssen erst noch renoviert werden.« Sie öffnete die Tür und machte eine einladende Geste. Seine Tasche stellte sie auf einem Stuhl ab. »Das hier ist unser bestes. Gefällt es Ihnen?«
Der Raum war mit wenigen Möbeln ausgestattet und wirkte trotz der hellen Raufasertapete etwas düster. Der Teppichboden, ein billiger Nadelfilz, wies zahlreiche Flecken auf. Von der Decke baumelte ein mit helllila Kunstseide bespannter Ballon, auf dem Generationen von Fliegen ihre Hinterlassenschaften abgelegt hatten. Lediglich der pastellfarbene Blümchenvorhang, der sich vor dem offenen Fenster bauschte, und die Tagesdecke aus dem gleichen Stoff verliehen dem Zimmer einen Hauch von Freundlichkeit.
»Ja, ich finde es ganz hübsch.« Das war zwar übertrieben, aber was wollte er mehr? Er hatte dieses Angebot auch deshalb ausgewählt, weil es eines der preiswertesten war.