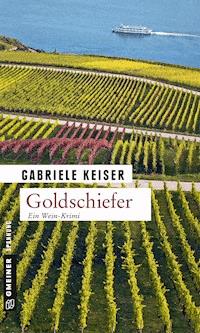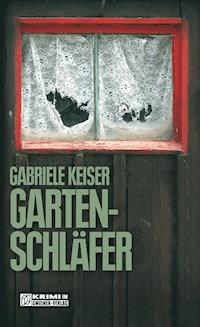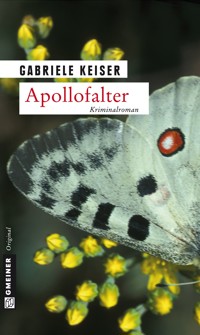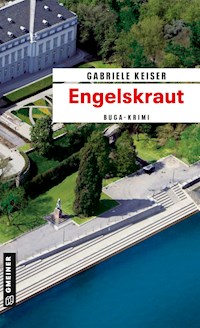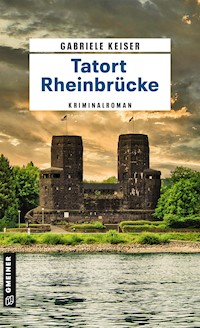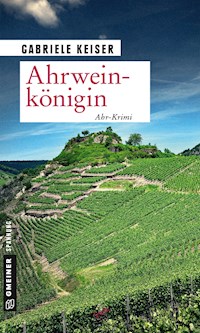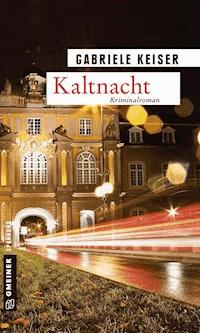Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Rhein-Mosel-Vlg
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Kriminalkommissarin Helena Rosenberg wurde – nicht ganz freiwillig – von Berlin nach Bonn versetzt. Glaubte sie, ihren neuen Job ruhig angehen zu können, muss sie schon bald in einem ersten Fall ermitteln: Ein ehemaliger Politiker wurde in seiner Wohnung auf dem Venusberg erschlagen. Nicht genug damit, kommt es kurz darauf zu einer Schießerei in einem Bonner Elite-Internat, zu der Helena zusammen mit ihrem Chef beordert wird. In diesem Roman wird ein Kapitel deutscher Geschichte thematisiert, dessen Wurzeln bis tief in die Ideologie der Nazizeit zurückreichen. Eine Pädagogik mit Idealen von bedingungslosem Gehorsam, Gewalt und Einschüchterung beeinflusst bis heute die Kindererziehung und bereitet nicht selten den Nährboden für unsägliche Verbrechen, die auch noch viele Jahrzehnte nach Kriegsende ihren Nachhall finden können. Wie schon in ihrer Franca-Mazzari-Serie sind Gabriele Keisers Charaktere lebensecht und authentisch. Eindringlich und rasant erzählt sie in diesem Roman davon, dass niemand seiner Vergangenheit entkommen kann, besonders dann nicht, wenn die Seele erst einmal massiv verletzt wurde.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 397
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© 2020 – e-book-Ausgabe RHEIN-MOSEL-VERLAG Zell/Mosel Brandenburg 17, D-56856 Zell/Mosel Tel 06542/5151 Fax 06542/61158 Alle Rechte vorbehalten ISBN 978-3-89801-907-1 Ausstattung: Stefanie Thur Titelfoto: Zapylaieva Hanna/shutterstock.com Autorinnenfoto: Sandra Jungen
Gabriele Keiser
Versehrte Seelen
Kriminalroman
Rhein-Mosel-Verlag
Willst du deine Vergangenheit kennen, dann betrachte dich selbst in der Gegenwart, denn sie ist das Resultat deiner Vergangenheit. Buddha (Siddhartha Gautama)
Bonn-Bad Godesberg Prolog
Er steht vor dem Spiegel und starrt in das Gesicht eines gealterten Mannes mit todtraurigen Augen.
Wer bist du? Wer? Ein Gespenst aus der Vergangenheit?
Hast du jemals gewusst, wer du wirklich bist?
Hitze kriecht in ihm hoch, als verstörende Erinnerungen sein Hirn durchdringen, die weiterwandern bis tief in sein Herz. Im Zeitlupentempo kristallisieren sich einzelne Splitter heraus.
Da sind endlose Korridore mit glänzend gebohnerten Fußböden. Das Geräusch von Schritten. Trippeln von Kinderfüßen, denen schnelle Erwachsenenschritte folgen. Über allem liegt der durchdringende Geruch von Desinfektionsmitteln.
Dann sind da der Mann und die Frau, die er Eltern nennen soll. Zwei wohlgenährte Menschen irgendwo draußen im Dorf beim Sonntagsspaziergang mit dem zierlichen Kind in der Mitte. Grüßen nach rechts und nach links. Stolz in den Gesichtern. Unser Junge!
Er will sich unsichtbar machen. Will weg. Irgendwohin, er weiß nur nicht, wo. Nur weg von hier.
Der Junge – etwas größer nun – in der gekachelten Futterküche. Immer in Bewegung. Stets getrieben von einer fahrigen Unruhe. Vor den stampfenden Kühen an klirrenden Ketten hat er Angst. Der Hofhund bellt ihn wütend an, wenn er in seine Nähe kommt. Und dieser Gestank von Mist und Fäkalien ist nicht zum Aushalten.
Der Mann, den er Vater nennen soll, trägt eine Gummischürze. In der Hand hält er den Bolzenschussapparat. Das Schwein, das der andere Mann festhält, quiekt und zappelt wie verrückt.
Nein, will er schreien, nein!
Komm Junge, stell dich nicht so an. Soll doch mal was werden aus dir.
Vater setzt den Apparat an und jagt dem Tier das Metall ins Hirn. Sofort sackt das Schwein in sich zusammen.
Er kann nicht hinsehen. Seine Beine drohen ihm wegzuknicken. Er zittert am ganzen Leib, wendet den Kopf.
Blut tropft aus der Schnauze des Tiers. Der andere Mann versetzt dem Schwein einen schnellen Stich in die Halsschlagader.
Der Junge spürt, wie ihm die Galle hochkommt. Dreht sich um. Rennt. Scharfe Worte werden ihm nachgeschleudert.
Willst du wohl hier bleiben, du Bengel!
Kann nicht. Muss raus, weg, nur weg. Draußen vorm Stall übergibt er sich.
Komm sofort her! Wer soll denn das Blut rühren?
Jeder Schritt kostet Überwindung. Doch er kehrt zurück. Gehorsam sein, das hat man ihm eingebläut. Sonst passiert was ganz Schlimmes.
Zögerlich taucht seine Hand in die Schüssel. Er schließt die Augen, will das nicht sehen, aber dem metallischsüßlichen Geruch kann er nicht ausweichen. Er spürt das warme Blut, das soeben noch durch den Körper des Tieres geflossen ist und nun zwischen seinen Fingern hindurchrinnt.
Schon wieder wird ihm übel. Er reißt die Augen auf, die Hand schnellt vor den Mund. Die Schüssel fällt, Blut fließt auf den Boden.
Das gibt’s ja wohl nicht! Jetzt sieh dir das mal an. Nichts kann man dir auftragen, aber auch gar nichts. Was soll bloß aus dir werden? Geh mir aus den Augen!
Er hat es vermasselt. Wie so oft.
Böse Blicke treffen ihn. Wieder einmal wird er weggescheucht.
Er verkriecht sich irgendwohin, wo ihn keiner findet. Versucht, sich abzuschotten, einzuspinnen in seine eigene Welt. Dem Raunen zu entkommen, das ihm in die Ohren dringt, egal, wo er ist. In der Küche. Im Stall: Man kann sagen was man will, er hört einfach nicht. Jede Nacht das nasse Bett. Das geht so nicht mehr. Ich hab alles probiert. Wirklich alles. Irgendwann muss einfach mal Schluss sein.
Hat es damals angefangen? Diese Seelenqual? Oder viel früher? Als er in seinem Gitterbett stand und mit großen Augen in die Welt blickte, die an der Wand hinter den anderen Bettchen endete.
So sehr wollte er ein gutes Kind sein. Doch nie war es genug. Nie.
Jetzt steht er vor dem Spiegel und betrachtet sein fleckiges, schlecht rasiertes Erwachsenengesicht.
Du bist niemand und niemand wird dich vermissen.
Die Erkenntnis schießt wie ätzende Säure durch sein Hirn. Hinterlässt eine brennende Bahn. Ein wütender Komet.
Niemand wird mich vermissen. Niemand. Das ist das Schlimmste.
Wie von fern hört er eine mahnende Stimme: Du musst zur Besinnung kommen, Junge.
Ha! Zur Besinnung kommen!
Schon wieder überrollt ihn eine Erinnerung. Seine Hände beginnen unkontrolliert zu zittern. Sein ganzer Körper schlottert. Höllische Schmerzen jagen durch sein Hirn. Er will die Wand einrennen, den Kopf dagegen knallen. Mit einem Ruck reißt er die Spiegeltür auf, wühlt hektisch in dem Schränkchen. Einzelne Arzneimittelpackungen fallen heraus auf den Boden. Er bückt sich, hebt eine davon auf, starrt darauf.
Tot sein heißt, nicht mehr denken müssen, nicht mehr grübeln, warum und weshalb die Dinge sind wie sie sind. Und welchen Sinn das Ganze hat, das man Leben nennt.
Das deine ist doch sowieso nur ein Drecksleben. Mach endlich Schluss! Dann hast du’s hinter dir.
Ein allzu verlockender Gedanke, der ihn nicht zum ersten Mal streift: Frei sein. Für immer.
Der Boden unter seinen Füßen bekommt Risse. Will ihn verschlingen. Sein Herz schlägt schneller.
Abtauchen, denkt er, untergehen. Wegtreten. Ja, wegtreten. Bei dem Wort lacht er auf. Nicht mehr erreichbar sein für diese Welt und dieses ganze Elend. Aber vor allem: Das pochende Toben hinter seiner Stirn wird er dann ein für allemal los sein.
Seit drei Nächten hat er nicht mehr geschlafen. Seitdem dieser Student angerufen hat, wütet in seinem Inneren ein Krieg. Alles, was er vergessen wollte, ist wieder da. Übergroß und leuchtend wie Höllenfeuer.
Eine Schlinge legt sich um seinen Hals. Angst drückt auf sein Herz. Er muss etwas tun. Irgendwas.
Er denkt an Thomas, seinen einzigen Freund. Den man vor vielen Jahren an einem sonnigen Tag aus dem Rhein fischte. Weil er nicht mehr klargekommen war. Zwölf Jahre war er geworden. Dann war Schluss. Ein für allemal.
So lange her und doch scheint es ihm, als wäre es erst gestern gewesen. Weil dieser Student all das aufgewühlt hat, was er so mühsam hatte vergessen wollen. Unmögliches verlangte er von ihm. Völlig absurd, das Ganze.
Oder war es doch nicht so unmöglich?
Bonn, Polizeipräsidium 1. Kapitel
»Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Rosenberg, na, bereit zu frischen Taten?«
Forschen Schrittes ging Konrad Wieland auf Helena zu und drückte ihre Hand so fest, dass es schmerzte. Freundlich wirkende braune Augen, unter denen schwere Tränensäcke hingen, fixierten sie.
»Morgen«, murmelte Helena und zog schnell ihre Hand zurück.
Argwöhnisch betrachtete sie das runde Gesicht ihres Chefs, seine Glatze mit dem graumelierten Haarkranz. Die Lesebrille baumelte an einem Band vor seiner nicht allzu schmalen Brust, der Bauch unter dem dezent gestreiften Hemd wölbte sich durch die gerade Haltung noch mehr nach vorn.
Mit seiner gesamten Präsenz strahlte Kriminalkommissar Konrad Wieland eine ordentliche Portion Selbstbewusstsein aus und damit die Überzeugung, dass die eigenen Entscheidungen die richtigen sind. Er war einer, der, unangefochten von allen Widrigkeiten, die das Polizistenleben bereithielt, mit sich zufrieden war, einer, der gern in seiner Wirkungsstätte, dem Polizeipräsidium arbeitete, aus dem einfachen Grund, weil er hier etwas galt. Bereits bei ihrem ersten Gespräch hatte er mit unverhohlenem Stolz verlauten lassen, dass er in mehr als dreißig Dienstjahren beinahe alle seine Fälle gelöst habe. »Was ja nicht jeder von sich behaupten kann, nicht wahr?«
»Haben Sie sich denn schon ein bisschen in unserem schönen Bonn eingelebt?«, fragte er jetzt.
Helena musste an sich halten. Gegen bestimmte Sprüche war sie allergisch. Bereits zwei davon hatte ihr Chef innerhalb weniger Minuten geäußert. Insofern war ihre Antwort eher eine gemäßigte Verlegenheitsäußerung.
»Nun ja«, antwortete sie gedehnt. »Gestern war ich auf dem Alten Friedhof.«
Wieland lachte auf. »Die Toten lassen Sie wohl auch in Ihrer Freizeit nicht los, was? Aber stimmt schon, der Alte Friedhof ist wirklich sehenswert. Schillers Frau liegt da begraben, Beethovens Mutter und …«
»Die Berühmtheiten interessieren mich nicht«, fiel sie ihm ins Wort. »Dort ist es grün und es gibt viel Schatten. Aber vor allem ist es ruhig.« Und man wird nicht behelligt vom Geschwätz seiner Mitmenschen, fügte sie im Stillen hinzu.
In ihrer Wohnung war es am gestrigen Sonntag unerträglich heiß gewesen, und sie hatte sich zu träge gefühlt, irgendetwas zu unternehmen. Die ausladenden Baumkronen waren von ihrem Wohnzimmerfenster aus zu sehen. Das Areal wirkte ein wenig wie der Dorotheenstädter Friedhof in der Nähe ihrer ehemaligen Berliner Wohnung. In der Kapelle war es schön kühl gewesen. Dort hatte sie eine Weile gesessen und über Gott und die Welt nachgedacht. Und sich zum hundertsten Mal gefragt, ob die Entscheidung, Berlin zu verlassen, richtig war. Die Königswinterer Straße war nicht die Keithstraße. Und der Rhein war weder die Spree noch die Havel. Wahrhaftig nicht.
»Klar. Berühmtheiten habt ihr in eurem Berlin genug. Ich kann mir gut vorstellen, dass Bonn dagegen ein bisschen mickrig wirkt. – Aber immerhin waren wir auch mal Hauptstadt. Wenn auch ein paar Nummern kleiner.« Er zwinkerte ihr zu und lachte lauthals.
Sie atmete tief durch, widerstand dem Impuls, genervt mit den Augen zu rollen und wartete ab, bis sein Lachanfall vorbei war und er sich wieder beruhigt hatte. Sagte sich, dass dieser ältere Herr, der wahrscheinlich eine geduldige Frau zu Hause, nette Kinder und einen Stall voller Enkel hatte, eine vollkommen andere Sozialisation als sie selbst genossen hatte und folglich auch einen anderen Blick auf die Welt.
Kurz dachte sie an eine seiner markanten Äußerungen bei ihrer ersten Begegnung: Wichtig ist Verständnis zeigen. Das gilt für Täter und Opfer gleichermaßen. Rumpoltern gibt’s bei uns nicht. Das können die im Fernsehen so machen meinetwegen. Aber im Umgang mit dem Verbrechen können wir zeigen, dass wir mehr sind als Polizisten. Nämlich Seelsorger oder Beichtvater, Sozialarbeiter oder auch Psychologe, je nachdem, was die Lage erfordert. Das ist ja gerade das Spannende an unserem Beruf.
Hehre Worte.
»Und wir zwei beide, wir werden es wohl jetzt eine Weile miteinander aushalten müssen.«
Manchmal sind wir ganz schöne Quatschbacken, nicht wahr, Herr Kriminalkommissar?
Helena Rosenberg aus Berlin. Bei der Nennung ihres Namens hatte er gestutzt. Nur ganz kurz. Aber sie hatte das kleine Zucken bemerkt, das er sofort überspielen wollte. Eine Reaktion, die sie nur allzu gut kannte. Sie hatte gehofft, dass nicht der übliche Kommentar folgen würde, wenn sie ihren Namen sagte. »Die schöne Helena. Und der Nachname – klingt irgendwie …«
Nein, Konrad Wieland hatte sich jeglichen Kommentar verkniffen, dafür war sie ihm dankbar. Obwohl sie durchaus darauf vorbereitet gewesen war.
Ja, mein Name klingt jüdisch. Und meine Vorfahren sind höchstwahrscheinlich Überlebende von Auschwitz. Aber in meiner Familie hat dies niemanden interessiert. Jedenfalls wurde nie darüber gesprochen. Ihr würde auch viel besser gefallen, sie sei ein Abkömmling von Julius und Ethel Rosenberg, die in New York auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet wurden. Unschuldig, wie sich danach herausstellte. Aber es gab keine Belege für irgendwelche verwandtschaftlichen Beziehungen.
Ihr Chef kniff ein wenig die Augen zusammen. »So ganz klar ist mir allerdings immer noch nicht, warum Sie Berlin gegen Bonn ausgetauscht haben.«
Vorsicht, Helena. Überleg gut, was du antwortest.
»Ab und an sollte man seinen Horizont erweitern.« Sie lächelte gequält und hoffte gleichzeitig, dass dies nicht zu schnippisch geklungen hatte. Dieser Mann, von dem gleichzeitig etwas Väterliches und Überhebliches ausging, meinte es wahrscheinlich gut mit ihr, jedenfalls hatte er ihr dies bereits wortreich zu verstehen gegeben. Und sich gleich am Anfang alles durch forsches Auftreten zu verscherzen, war nicht besonders klug. Diesmal galt es in besonderem Maße, ihre manchmal etwas vorlaute Klappe im Zaum zu halten.
Ralf hatte mal geäußert, dass sie das Aussehen eines Welpen hätte, den man behüten und vor der bösen Welt beschützen möchte, aber sobald sie den Mund aufmache, erinnere sie an einen kläffenden herrenlosen Straßenköter. Und sie solle sich dringend abgewöhnen, ständig mit dem Mittelfinger herumzufuchteln. Ralfs Worte hatten Gewicht und gaben ihr zu denken. Sie war in sich gegangen und hatte an ihrer Art zu kommunizieren und an ihrer Gestik gearbeitet. Die Arbeit dauerte an. Immerhin gelang es ihr jetzt besser, in gewissen Situationen den Mund zu halten, wo sie früher einfach losgeblökt hätte.
»Den Horizont erweitern?« Wieland grinste. »Och nee. Geben Sie es ruhig zu: Sie denken doch sicher, Sie sind hier in der tiefsten Provinz gelandet.« Wieder zwinkerte er ihr zu. »Aber Sie werden sehen, auch die hat ihre Herausforderungen.« Mit diesen Worten legte er eine Pistole auf den Schreibtisch. »Passen Sie gut drauf auf.«
Sie quittierte den Erhalt der Waffe, er verabschiedete sich. »Bis nachher.«
Es war eine Walther P99. Sie nahm sie in die Hand. Strich über das schwarze Metall. Etwas ungewohnt fühlte sie sich an. Ihre Berliner Dienstwaffe war eine SIG Sauer P225 gewesen. Sie würde baldmöglichst zum Schießkino gehen müssen, um sich mit der Handhabung der neuen Waffe vertraut zu machen.
Sie legte die Pistole zurück auf den Schreibtisch und sah sich in ihrem Büro um. Ein kleiner Raum, kaum zehn Quadratmeter, etwas größer als eine Gefängniszelle. Immerhin eine Einzelzelle. Überschaubar, funktionell, schmucklos. Die einzige Dekoration bestand bisher aus einem Monatskalender an der Wand mit Fotos von Berlin, den sie aufgehängt hatte. Ein bisschen alte Heimat in ihrer neuen Wirkungsstätte.
Helena hatte auf einem eigenen Büro bestanden, die allzu große Nähe anderer Menschen machte sie nervös. Sie betrachtete die Dinge lieber aus der Distanz: Sachen, Fälle, Menschen. Mit dieser Haltung kam sie ganz gut klar, auch wenn sie öfter befremdliche Blicke trafen, wenn sie diese Einstellung laut äußerte.
Sie fuhr den Computer hoch. Packte die wenigen Gegenstände aus, die sich in einem mitgebrachten Karton befanden und räumte sie ein. Den lachenden Buddha, der sie ein wenig an ihren neuen Chef erinnerte, stellte sie auf den Schreibtisch. Dabei streifte sie die Walther. Sie nahm die Pistole und legte sie in die untere verschließbare Schublade ihres Schreibtischs.
Was beim Friseur der Kamm ist, ist beim Polizisten die Waffe. Diese Weisheit hatte einer ihrer Ausbilder gern mit glänzenden Augen von sich gegeben. Sie hatte nicht widersprochen, obwohl ihr eine entsprechende Antwort auf der Zunge lag. Das wunderte sie noch heute.
This is my rifle, this is my gun, one is for killing, the other’s for fun. Ein Lied der Soldaten im Vietnamkrieg, das Stanley Kubrick in seinem Film Full Metal Jacket zu neuem Leben erweckt hatte. Rifleman’s Creed, auf YouTube und in ihrem Kopf jederzeit abzurufen, hörte sich an wie eine Liturgie, vorgetragen von zackigen Männern, die sich abwechselnd in den Schritt fassten und ihre Gewehre reckten.
Dass man ein erotisches Verhältnis zu Waffen entwickeln konnte, hatte sie nie verstanden. Dann doch lieber ein erotisches Verhältnis zu dir, Dicker. Sie grinste den lachenden Buddha an.
Im Ablagekörbchen befanden sich einige Infozettel, Broschüren, Hausnachrichten und die Umlaufmappe. Daneben ein Stapel Akten, zum Eingewöhnen, wie ihr Chef mit seinem üblichen Augenzwinkern gesagt hatte.
Sie begann zu lesen. War ja doch allerhand los im kleinen Bonn. Auf dem Flur hörte man hin und wieder gedämpfte Stimmen, Telefonklingeln und Türenklappern. Sonst blieb alles ruhig.
Um die Mittagszeit holte Konrad Wieland sie zum Essen in der Kantine ab. Ein vertrauter Geruch empfing sie. Hier roch es nach Fritierfett und Fertigsoßen, nicht viel anders als in der Berliner Kantine. Ihr Chef stellte sie einigen Kollegen vor, deren Namen sie sofort wieder vergaß.
Wieland bestellte sich Schweinebraten mit Rotkraut und Knödeln, sie begnügte sich mit einem Salat.
»Noch nicht mal einen Nachtisch? Kein Wunder, dass Sie so dünn sind«, meinte er schmunzelnd.
Das hörte sich ja an, als ob er sie für magersüchtig hielt. Dabei brachte sie bei ihren 1,67 Metern immerhin 62 Kilo auf die Waage. Sie verkniff sich eine Antwort und lobte sich innerlich dafür, dass es ihr gelungen war, den Mund zu halten.
Eine halbe Stunde später saß sie wieder in ihrem Büro.
Ihr Telefon klingelte zum ersten Mal. Eine noch ungewohnte Tonfolge. Sie nahm ab.
»Na, wie ist es denn so in Bonn am Rhein, schöne Helena?«, flötete eine rauchige Baritonstimme.
»Chris!«, rief sie freudig aus. Er war der Einzige, der sie ungestraft so nennen durfte. Ihr Lieblingsmensch aus Berlin, den sie am meisten vermisste. »Hier ist der Hund begraben.« Sie lachte.
»Hab ich dir doch gleich gesagt. Wärste mal bei uns geblieben. Alle vermissen dich und fragen nach dir.«
»Das ist schön zu hören.« Sie sah Chris vor sich, seine weichen Züge. Ein Verwandlungskünstler, mal Mann, mal Frau, ganz so wie es zu seiner Stimmung passte. Um seinen sinnlichen Mund und die tiefblauen Augen mit den langen Wimpern beneidete ihn jede Frau. Und wenn er sich aufbrezelte und perfekt gestylt im Glitzerfummel den Po schwang, sah ihm garantiert jeder Mann nach.
Chris, der Paradiesvogel, der auf den ersten Blick äußerst kokett und ein wenig verrucht wirkte, war, wenn man ihn näher kannte, ein loyaler Freund, dem man alles anvertrauen konnte. Auch das Unaussprechliche. Der ein großes Herz und für alles Verständnis hatte. Und einen Drang zur grenzenlosen Offenheit. Vor ihm konnte man einfach keine Geheimnisse haben.
»Chris, du weißt, weshalb ich gehen musste. Gerade du weißt das am allerbesten.«
»Ich hätte dich halt gern dabeigehabt, wenn wir unseren Club eröffnen.« Sie konnte sich seine schlanken Hände vorstellen, die beim Reden immer in Bewegung waren.
»Seid ihr schon so weit?«, fragte sie.
»Ein bisschen dauert es schon noch, ein paar Wochen vielleicht. Wenn alles gut geht. Ist noch ’ne Menge zu tun. Aber du, wir haben eine neue Diseuse aufgetan. Eine Stimme, so ein bisschen wie Romy Haag, ganz nah dran am Leben. Die würde dir auch gefallen.«
Sie sah alles lebhaft vor sich: Den Glitzer, den Glamour, diese Alternativwelt, zu der sie sich bisweilen stark hingezogen fühlte und die in Berlin einen Gegenpol zu ihrer seriösen Arbeit dargestellt hatte.
»Kann sie auch das ›Blaue Klavier‹?«
»Natürlich! Willst du mal hören? Warte, ich spiel’s dir vor.«
… Und der Wind singt mir ein Lied. Von Meer und Sand in den Haaren. Von Heimkehr und Abschied …« Etwas verzerrt klang die Stimme einer Sängerin mit tiefer Stimme aus dem Telefonhörer. »Wenn die Wunden längst verheilt sind, tun die Narben weh. Du brauchst dein ganzes Leben, um die Kindheit zu verstehn …«
Wilde Sehnsucht pochte in ihrer Brust. Sie atmete tief durch. »Ich will sehen, was sich machen lässt, Berlin ist ja nicht aus der Welt. Und diese Sängerin würde ich sehr gern live hören.«
Als sie nach einer Weile auflegte, umspielte ein Lächeln ihre Lippen. Ein Anruf von Chris, und die Welt war in Ordnung. So einfach waren die Dinge manchmal.
Heute Abend würde sie die CD von Rosenstolz auflegen. Die ältere mit den verrückten, zweideutigen Liedern, die Anna und Peter oft vor kleinem Publikum performt hatten und für die sie nicht selten ausgebuht worden waren. Aber sie hatten unbeirrt ihr Ding weitergemacht, bis sie schließlich als das erfolgreichste Pop-Duo Deutschlands gefeiert wurden. Doch Helena gefielen die alten Lieder besser. Die neuen waren ihr zu kommerziell und angepasst.
Sie freute sich auf den Abend. Da würde sie in dieser Musik schwelgen und von Berlin träumen. Denn träumen durfte sie, das konnte ihr niemand verbieten.
Bonn, Venusberg 2. Kapitel
Heribert Blankenhain steckte den Brief zurück in den Umschlag und blieb eine Weile regungslos sitzen. In seinem Kopf formierten sich Bilder, die er nicht sehen wollte. Gedanken, die er nicht denken wollte. Etwas Bedrohliches machte sich in ihm breit, das ihm auf die Brust drückte.
Dann sagte er sich: Nein, sowas macht mir keine Angst. Sowas doch nicht. Als er aufstand, spürte er einen wohlbekannten Stich im Nacken. Mit beiden Händen strich er sich darüber, knetete die Haut mitsamt der darunterliegenden Muskulatur, bis der Schmerz ein wenig nachließ. Dann ging er mit langsamen Schritten zum Fenster, dessen Flügel weit offen standen.
Draußen flimmerte die Luft. Ein leichter Sommerwind bewegte die Blätter der Bäume, die das abschüssige Grundstück begrenzten. Entferntes Kinderjuchzen war zu hören, begleitet von Wasserplantschen, ein Geräusch, das ihn an eine lange zurückliegende Zeit erinnerte. Tief atmete er ein und versuchte, seinen heftigen Herzschlag zu beruhigen. Er vernahm einen schwachen Blütenduft, den er jedoch nicht näher zu bestimmen vermochte. Dort unten hinter Dächern und Baumkronen lag die Stadt, seine Stadt. Die er mit einem Mal mit ganz anderen Augen betrachtete.
Er schüttelte den Kopf, gab sich einen Ruck und ging zurück an den Schreibtisch. Während er seinen Füllfederhalter aufschraubte, glitt sein Blick über den Briefumschlag hinweg zu dem blauen Schnellhefter voller eng bedruckter Blätter, mit deren Korrektur er beschäftigt war.
Es war merkwürdig, das eigene Leben ausgebreitet auf einer begrenzten Anzahl von Papierseiten vor sich zu sehen und immer wieder festzustellen, welch kompliziertes Geflecht dieses Leben war, das aus unendlich vielen wechselseitigen Bezügen bestand. Besonders jetzt nach der Lektüre dieses Briefes musste er sich eingestehen: Es war unmöglich, alles zu erzählen. Vielmehr galt es, einzelne Augenblicke zu isolieren, diese aus der Rückschau zu beleuchten und in einen zeitlich relevanten Zusammenhang zu bringen.
Noch einmal besah er sich das überarbeitete Kapitel, in dem er versucht hatte, die falsch klingenden Worte durch richtige zu ersetzen, doch es schien noch immer zu vieles verkehrt. Er suchte nach anderen, nach adäquateren Ausdrücken, die die Dinge konkreter benannten.
Die Glocken der Heilig Geist-Kirche begannen zu läuten. Schon sechs Uhr. Er war so sehr in seine Arbeit vertieft gewesen, dass er gar nicht merkte, wie die Zeit verging.
Das Glockengeläut strukturierte die zerfließende Zeit, gebot Einhalt und war normalerweise eine gute Orientierungshilfe. Das hatte er verinnerlicht, jedoch in letzter Zeit überfiel ihn nicht selten der Drang, sich dagegenzustemmen und die Zeit aufzuhalten. Nichts mehr sollte sich verändern, alles sollte so bleiben wie es war. Das verlieh ihm Sicherheit.
Im Zimmer war es drückend warm. Auf seiner Stirn hatten sich Schweißperlen gebildet, die er mit einer trägen Bewegung wegwischte. Das Unterhemd klebte am Körper wie eine zweite Haut. Ein einzelner Schweißtropfen kroch seinen Arm entlang und verfing sich im aufgekrempelten Hemdsärmel. All das mochte er gar nicht. Weil es ihm ein Gefühl von Ungepflegtheit vermittelte.
Das Telefon klingelte. Er nahm ab. Nannte seinen Namen.
Hörte jemanden atmen.
»Hallo. Wer ist da?«, fragte er ungehalten. »Hallo? So sprechen Sie endlich. Hallo?« Doch die Verbindung war bereits abgebrochen.
Da war ein Stechen in seiner Brust. Etwas Undefinierbares schien sich eng und enger um seinen Oberkörper zu schnüren. Obwohl er alles tat, die diffuse Bedrohung zurückzudrängen, die er seit dem Erhalt des Briefes verspürte, kam er kaum dagegen an. Er schluckte heftig. Sein Hals fühlte sich ausgetrocknet an.
In der Küche schenkte er sich ein Glas Wasser ein, das er mit hastigen Schlucken trank und der kühlen Flüssigkeit nachspürte, die durch seine Kehle rann.
Er zwang seine Gedanken in eine andere Richtung. All die großen und kleinen Freuden, die sein Leben reich gemacht hatten, daran wollte er sich erinnern. Da gab es einiges, was nicht in seine offiziellen Memoiren gehörte. Jeder Mensch hatte schließlich seine Geheimnisse. Aber er war sich immer treu geblieben. Selbst seine ärgsten Feinde mussten ihm bescheinigen, dass er stets eine klare Linie verfocht und dass man sich auf ihn verlassen konnte.
Harald Juhnkes Lied geisterte durch seinen Kopf. Ein Lied, das er sich immer wieder gern anhörte. In dem er sich wiederfand.
Ich hatte Glück, verdammt viel Glück … I did it my way.
Erleichtert spürte er, wie sich der Druck auf der Brust langsam zu lösen begann. Er hatte alles unter Kontrolle.
Es war gut, mein Leben, sagte er sich, und wandte sich erneut den bedruckten Blättern zu. Aufregend, nicht immer geradlinig, aber erfüllt. Und von so einem Briefeschreiber lass ich mir nicht alles kaputt machen! Ist wahrscheinlich sowieso gelogen, was der mir weismachen will.
Das war bestimmt er vorhin am Telefon. Ja, Blankenhain war sich ziemlich sicher. Feiger Hund! Erst so einen Brief schreiben und dann kneifen.
Erneut nahm er seinen Füllfederhalter zur Hand. Die gelebte Zeit noch einmal Revue passieren lassen bedeutete unweigerlich, etliches umzudeuten. Keinem Leser war zuzumuten, was in subjektiven Wahrnehmungen unmittelbar niedergeschrieben worden war. Aus der Vergangenheit heraus war vieles anders zu interpretieren als im Moment der Gegenwart. Und manches war auch zu privat für die Öffentlichkeit. Es gab nun mal Dinge, die niemanden etwas angingen. Hatte nicht jeder irgendwo tief im Keller eine Leiche vergraben? Die große Linie musste stimmen, die Essenz, das war wichtig. Diese herauszuarbeiten war sein Ziel.
Kurz kam ihm in den Sinn, was mit seinen Tagebüchern geschehen würde, wenn er nicht mehr war. Würden sie irgendjemanden interessieren? Oder würden sie in einem Müllcontainer verschwinden? Das war vielleicht sogar besser so. Doch insgeheim hoffte er, dass Monika sie in wohlmeinende Hände abgab. Eine der großen Bibliotheken, das konnte er sich gut vorstellen.
Blankenhain war vielleicht nicht der geborene Familienmensch. Doch seine Kinder und seine Frauen hatte er stets als wichtig erachtet. Es freute ihn sehr, dass er in der letzten Zeit einen engeren Kontakt zu seiner Tochter gefunden hatte. Mit ihr zusammen war er dabei, sein Leben zu rekonstruieren, vielmehr sprach er in ihrer Gegenwart auf Band und sie tippte das Erzählte anschließend ab. Er konnte nicht gut mit einem Computer umgehen und wollte dies auf seine alten Tage auch nicht mehr lernen. Monika machte das gern, das hatte sie ihm wiederholt bestätigt.
»Das ist ja auch für mich interessant, dein Leben, Papa. Gerade weil ich so wenig von dir weiß. Und so wenig von dir hatte als Kind.«
Den leicht bitteren Ton wollte er nicht hören. Obwohl er ihn durchaus wahrgenommen hatte. Es stimmte schon, er hatte nie viel Zeit für seine Kinder gehabt. Seine Tage waren randvoll gefüllt gewesen mit wichtigen Aufgaben, wie sollte man sich da angemessen um die Belange kleiner Menschlein kümmern. Seine Frauen hatten ihm immer den Rücken frei gehalten. Das war eben das Los aller Politikerehen.
Monika, seine Jüngste, schien ihn am besten zu verstehen. Besser als seine beiden Söhne. Zumindest wusste sie, wie man ihn nehmen musste. Sicher, er war kein einfacher Mensch, das gab er unverhohlen zu. Gerade ihre letzte Begegnung hatte wieder einmal einen heftigen Disput zur Folge gehabt, was ihm im Nachhinein leid tat. Vielleicht hatte er doch zu heftig reagiert. Dass sie seine Reaktion als äußerst unangebracht empfand, hatte sie ihm unmissverständlich klargemacht.
Ihm war klar, dass er polarisierte. Das war eben seine Natur. Und wer kam schon gegen seine Natur an? In seiner aktiven Zeit war er stets für deutliche Ansagen gewesen. Auch wenn ihm das viele übelnahmen. Aber das Nettigkeitsgesabbel der ehemaligen Kollegen war absolut nicht sein Ding. Weder im Beruf noch zu Hause. Manchmal, in stillen Momenten kam ihm in den Sinn, dass sich seine Söhne vielleicht deshalb so distanziert verhielten. Von Walter, der als Arzt in Hamburg lebte, erhielt er hin und wieder eine Karte, zum Geburtstag oder zu Weihnachten. Ernst, dessen jüngerer Bruder, hatte sich schon lange nicht mehr gemeldet. Aber der war von jeher das Sorgenkind gewesen. Vom Studieren hielt er nichts, nur vom Demonstrieren und vom Hausbesetzen. Eine Haltung, die vollkommen konträr zu der politischen Marschrichtung seines Vaters stand und die er stets lautstark missbilligt hatte. Was er Ernst mehr als deutlich zu verstehen gegeben hatte. Und seine Frauen … ach nein, verstehe einer die Frauen. Darüber wollte er jetzt nicht nachdenken. Er wollte seinen Frieden, wollte sich daran erfreuen, dass Monika ihn regelmäßig besuchte und mit ihm zusammen Ausflüge in die Vergangenheit unternahm.
Sein Ich in der Welt erkunden, seinen Weg inmitten der Welthistorie, so hatte sie es an einer Stelle formuliert. Sein Leben war eine rückwärts betrachtete Entdeckungsreise, und seine Tochter half ihm dabei, manches in den Tiefen seines Gedächtnisses wiederzufinden, das er selbst vergessen glaubte. Vor allem aber verstand sie es großartig, seine Gedanken in eine angemessene Sprache zu transferieren. Sie hatte eine wahrhaft schriftstellerische Gabe, die sie vervollkommnen sollte. Er würde ihr bei einer möglichen Veröffentlichung helfen, noch immer waren seine Verbindungen zu den wichtigen Menschen dieser Republik intakt.
Wieder blieb sein wandernder Blick an dem Briefumschlag haften, den er an den Rand des Schreibtischs geschoben hatte. Das Schreiben war unfrankiert, aber korrekt mit seiner Adresse und der Adresse des Absenders versehen - einem ihm unbekannten Namen. Der Mann hatte den handschriftlich verfassten Brief nicht aufgegeben, sondern ihn eigenhändig in Blankenhains Briefkasten gesteckt. Diese Tatsache bereitete ihm ein wenig Sorge.
Er konnte nicht aufhören, den Inhalt zu überdenken, der, das gab er zu, seine Selbstsicherheit gehörig ins Wanken gebracht hatte. Doch allzu absurd klang das, was darin stand. Eine Behauptung, die sich auf eine Begebenheit gründete, die fast sechzig Jahre zurücklag. Man denke: sechzig Jahre! Das war mehr als ein halbes Leben. Und dies sollte jetzt noch Relevanz besitzen? Lächerlich. Am besten, er vernichtete den Brief, bevor er in falsche Hände geriet.
Er schreckte auf, als es an der Tür klingelte. Sekundenlang dachte er, er habe sich das nur eingebildet, doch es klingelte erneut. Wer konnte das sein? Er bekam nicht viel unangemeldeten Besuch. Hoffentlich war es nicht die alte Schellenbrink, die ging ihm mit ihrem Getue in letzter Zeit gewaltig auf den Keks.
Vielleicht war es Monika? Die hatte zwar angekündigt, sie wolle übers Wochenende wegfahren. Aber womöglich war etwas dazwischen gekommen. Oder sie war früher zurück als gedacht. Es könnte durchaus sein, dass ihr die kleine Auseinandersetzung leid tat und sie war gekommen, um sich zu entschuldigen. Seine Hoffnung zerstob, als ihm einfiel, dass sie bis jetzt noch jeden ihrer Besuche telefonisch angekündigt hatte.
Das Dunkle, Bedrohliche kroch erneut in sein Gehirn. Die Ahnung, dass es derjenige war, der vorhin seine Nummer gewählt hatte, verstärkte sich. Dieser Briefeschreiber, der nicht locker ließ.
Einen Moment überlegte er, das Klingeln zu ignorieren, das zunehmend ungeduldiger wurde. Wer immer vor seiner Tür stand, er gab nicht so leicht auf.
Gut, er würde sich stellen. Die Dinge zurechtrücken. Alles klären und danach konnte jeder in sein Leben zurückkehren.
Als er aufstand, durchzuckte ihn der Schmerz in kleinen wiederkehrenden Wellen und verstärkte sich bei jedem Schritt. Am Montag muss ich zum Arzt, dachte er. Unbedingt. Das kann man nicht länger anstehen lassen. Eine Spritze und alles würde gut werden. Es war ja nicht das erste Mal.
Das Schloss klickte leise, als er die Tür öffnete.
Bonn, Venusberg 3. Kapitel
Mühsam setzte die alte Dame einen Fuß vor den anderen. Keuchte. Stieg Stufe um Stufe die Treppe hinauf. Sicher, sie hätte den Aufzug nehmen können. Doch sie mied ihn, so lange es ging. Dieser schwebende Käfig bereitete ihr Platzangst, auch wenn er eigentlich eine Erleichterung sein sollte. Doch sie fürchtete stets, die Tür könne sich nicht mehr öffnen und sie wäre eingesperrt wie damals im Bunker. Außerdem wollte sie in Bewegung bleiben. So verordnete sie sich selbst Treppenstufengehen, auch wenn ihr dies zunehmend schwerer fiel.
Die Dame mit den weißen ondulierten Löckchen trug eine Seidenbluse mit gebundener Schleife, einen dunklen Rock und nicht ganz passende braune Schnürschuhe. Ihre Füße hatten sich im Lauf der Jahre verformt. Angefangen hatte dies mit viel zu kleinen Schuhen im Krieg, als man alles verloren hatte und nahm, was andere übrig ließen. Und sich auch noch dankbar dafür erweisen musste.
Einige Orthopäden hatten sich an ihr abgearbeitet. Doch Füße, die sich im Kindesalter verformt hatten, wurden nie mehr so wie sie sein sollten. Auch wenn man sie zu richten versuchte. Das kann man auch auf den Charakter übertragen, dachte sie oft, wenn sie heutigen Kindern begegnete. So ohne Respekt vor dem Alter. Ohne Rücksicht. Und mit einer Ausdrucksweise, die einem die Röte ins Gesicht trieb. Ganz anders als wir früher waren. Wir haben gehorcht und gekuscht. So verkehrt war das nicht, wie uns das alle einreden wollen. Wir wussten wenigstens, was sich gehört.
Nur noch zwei Stufen. Dennoch verharrte sie einen Moment. Sie atmete schwer. Sie musste zugeben, dass das Treppensteigen ihr unsägliche Mühe bereitete. Vielleicht sollte sie ihre Angst überwinden und doch den Aufzug benutzen. Wenigstens ab und zu.
Von oben kamen leichte Schritte die Treppe herunter. Eine junge Frau im luftigen Sommerkleid tänzelte ihr entgegen. »Hallo Frau Schellenbrink.«
Sie grüßte höflich zurück. Der Name der jungen Hausbewohnerin, die noch nicht allzu lange hier wohnte, fiel ihr nicht auf Anhieb ein.
Die junge Frau blieb auf dem Treppenabsatz stehen. »Also, jetzt sagen Sie mal ehrlich, das ist doch nicht mehr normal, wie das hier stinkt.«
»Wie bitte?«
»Hier stinkt’s bestialisch.« Die junge Frau deutete auf die Wohnungstür von Herrn Blankenhain.
»Also, ich rieche nichts.«
»Wirklich nicht?« Ungläubiger Gesichtsausdruck. Die junge Frau schluckte. Suchte nach einem Taschentuch, drückte es auf die Nase. »Das kann man nicht mehr aushalten. So schlimm ist das. Und Sie riechen wirklich gar nichts?«
Die ältere Dame zierte sich ein wenig. Sie dachte daran, wie ihre fünfzehnjährige Enkelin, die sie in vielem nicht mehr verstand, letztens respektlos geäußert hatte: Also bei dir stinkt’s vielleicht, Oma. Das war ihr furchtbar unangenehm gewesen.
»Haben Sie den Herrn Blankenhain in den letzten Tagen gesehen?«, fragte die junge Frau.
Ach ja, Heribert. Sie hatte sich schon öfter gefragt, weshalb er sich so rar machte. Im Alter sollte man doch zusammenhalten. Schließlich war niemand davor gefeit, alt zu werden. Auch wenn er so tat, als könne er noch immer Bäume ausreißen.
Frau Schellenbrink schüttelte den Kopf. »Er ist nicht mehr besonders gesellig. Früher ja, da blieb er immer mal stehen für ein Schwätzchen. Aber in letzter Zeit …« Das Alter veränderte die Menschen. Sie wusste schließlich, wovon sie sprach. »Womöglich hat er nur vergessen zu lüften«, meinte sie halbherzig.
»Also ungelüftet riecht anders«, erwiderte die junge Frau und blickte vielsagend.
»Sie meinen doch nicht …?« Frau Schellenbrink schlug entsetzt die Hand vor den Mund.
»Ich denke, da sollte sich mal einer kümmern.«
»Sie glauben …?« Frau Schellenbrink wagte nicht weiterzusprechen. Blitzartig fielen ihr Schlagzeilen ein, die von älteren Menschen berichteten, die tagelang, gar wochenlang tot in ihrer Wohnung lagen, ohne dass es jemand bemerkte. Und sie dachte an den anklagenden Tenor solcher Artikel: Unsere Gesellschaft droht zu vereinsamen. Niemand kümmert sich mehr um die Alten und Alleinlebenden.
Aber nein, nicht in ihrem Haus. Da passierte so etwas nicht. In ihrem Haus achtete man aufeinander.
»Haben Sie denn schon mal bei ihm geklingelt?«, stammelte sie.
»Geklingelt. Geklopft. Da tut sich nix. Ich ruf jetzt die 110.«
Bonn, Hollsteinkolleg 4. Kapitel
Das Gespräch mit Paul Behrends ging Henrike Leipold nicht mehr aus dem Kopf. Erziehungswissenschaften und Psychologie habe er studiert und schreibe gerade an seiner Doktorarbeit. Nun benötige er ihre Hilfe. Sie sei doch Lehrerin für Geschichte.
»Hauptsächlich für Deutsch«, hatte sie geantwortet, »und ja, auch für Geschichte. Aber nur im Nebenfach.«
Es ginge um das Thema Heimerziehung. Ungefähr ab dem zweiten Weltkrieg bis in die Anfänge der siebziger Jahre.
Krieg und Nachkriegszeit. Das erschien ihr eine große und unterschiedlich geprägte Zeitspanne für eine Doktorarbeit. »Ich wüsste jetzt nicht, wie ich Ihnen da helfen könnte«, hatte sie etwas ratlos eingeworfen.
»Meine Recherchen haben ergeben, dass es dazu in Ihrer Schule höchstwahrscheinlich Unterlagen gibt.«
»Was für Unterlagen denn? Und warum wenden Sie sich nicht an den Direktor?«, hatte sie überrascht und gleichzeitig etwas abwehrend geantwortet.
Er habe bereits mit dem Direktor gesprochen, versicherte Paul Behrends. »Herr Novak blockt jedes Mal ab und zeigt kein großes Interesse, Licht in diese dunkle Angelegenheit zu bringen.« Obwohl er bereits mehrmals nachgehakt habe, sei er immer wieder vertröstet worden. Deshalb wende er sich jetzt an sie.
Henrike war erst seit einem Jahr Lehrerin am Hollsteinkolleg, ihr war bekannt, dass das Internat auf eine lange und nicht ganz lineare Geschichte zurückblickte. Doch Genaueres dazu wusste sie nicht.
»Ihr Haus hat eine sehr große Bedeutung für meine Recherchen«, sagte der Student eindringlich. »Es war eines der wenigen Kinderheime, das den Krieg unbeschadet überstanden hat.«
»Es ist immer ein christliches Haus gewesen, das früher von Diakonissen geleitet wurde«, sagte sie. »Was wollen Sie denn herausfinden?«
»Nun. Es geht darum, die Rolle der Heime im Kriegs- und Nachkriegs-Deutschland zu untersuchen«, begann er zu erläutern. »Was dort die Regel war, wurde lange Zeit als ein Randphänomen angesehen, nicht weiter bemerkenswert. Aber da liegt einiges im Argen. Das will ich in meiner Dissertation herausarbeiten.«
»Also, dass in unserem Haus was nicht mit rechten Dingen zuging, wie Sie andeuten, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen«, hatte sie widersprochen. »Das hätte man doch längst herausgefunden. Ständig hört man von runden und eckigen Tischen zu diesem Thema.« Ein leidiges Thema, gewiss. Das man nur allzu lange negiert hatte. Doch erst kürzlich hatte sie von einer Studie gehört, die die Kirche selbst in Auftrag gegeben hatte. An einem katholischen Internat in der Eifel waren über Jahrzehnte hinweg Jungen gequält und missbraucht worden. Doch der Kölner Kardinal war nicht auf Abwehrhaltung gegangen, sondern hatte sich schockiert und bestürzt gezeigt. Man werde alles daransetzen, die Vorfälle lückenlos aufzuarbeiten, hatte er erklärt. Die Opfer waren in aller Form um Vergebung gebeten worden.
»Was wissen Sie denn von der Vergangenheit Ihres Hauses?«, fragte Behrends.
»Nun … äh …«
»Sehen Sie. Wahrscheinlich hat man Ihnen gesagt, dass die kirchliche Leitung des Heims die Garantie dafür bot, bei Ihnen sei alles bestens gewesen. Dieses Argument höre ich leider immer öfter.«
Oh nein, hoffentlich war das nicht so ein Spinner und Quertreiber, die überall nach Ungemach suchten. »Und das Bewusstsein hierfür möchten Sie ändern?« Sie merkte, dass ihre Stimme leicht spöttisch klang. Was ihr augenblicklich leid tat. Aber der Student machte einen reichlich missionarischen Eindruck auf sie. Vielleicht hätte er besser Theologie studieren sollen.
»Ich kann Ihnen versichern, dass ich fast täglich auf Ungeheuerliches stoße. Die Rolle der Kinderheime ist noch lange nicht aufgearbeitet. Auch nicht mehr als siebzig Jahre nach dem Krieg«, sagte er. »Wie heikel das Thema immer noch ist, merkt man ja auch an der Reaktion Ihres Direktors.«
»Und was erwarten Sie von mir?«, fragte sie leicht ungehalten.
»Nun, was ich bis jetzt herausgefunden habe, ist ziemlich schlimm. Und ich nehme mal an, Ihr Direktor möchte ungern an das erinnert werden, was seine Schule mit der damaligen Zeit verbindet. Wie so viele in seiner Lage, leider. Dabei können wir doch nur aus unserer Vergangenheit lernen und es nützt niemandem, wenn wir sie verleugnen.«
»Was meinen Sie denn konkret?«, fragte sie irritiert.
Er zögerte einen Moment. »Ich habe unter anderem herausgefunden, dass mit ziemlicher Sicherheit während des Krieges im Hollsteinhof Tötungen im Rahmen der ›Aktion T4‹ durchgeführt wurden.«
»Was sagen Sie da?«, rief sie entsetzt aus. Ihr Herz begann Blut in ihr Hirn zu pumpen. Der Zeit des Nationalsozialismus mit all seinen Grausamkeiten und Auswüchsen hatte sie sich während des Studiums in besonderem Maße gewidmet. So auch der »Aktion T4«, wie die Nazis ihr »Euthanasieprogramm« bezeichneten, diese unvorstellbare systematische Ausrottung so genannten »unwerten Lebens«. All dies war jedoch sehr weit weg gewesen, war theoretisches Wissen, das an einen anderen Ort und in eine andere Zeit gehörte. Und nun sollte dies so nah gerückt sein, dass sie sich an einem Ort befand, wo solche Verbrechen ausgeführt wurden? Sie konnte es nicht fassen.
»Hauptsächlich war der Hollsteinhof eine so genannte Zwischenanstalt. Die meisten Kinder wurden in die Tötungsanstalt Hadamar weiter transportiert, da war dann Endstation. Aber es gibt Hinweise, dass auch an Ort und Stelle getötet worden ist. Dazu genügte ein Giftcocktail aus Hustensaft und Luminal. Das zumindest haben meine Recherchen ergeben. Als Todesursache wurde dann Lungenentzündung oder sowas Ähnliches angegeben.« Er hielt einen Moment inne. »Sie wussten nichts davon?«
»Nein. Und ich kann das auch nicht glauben. Unsere Schule ist sehr modern …«
»Heute ja«, fiel er ihr ins Wort. »Doch das war nun mal nicht immer so. Aber nicht die Kriegsjahre sind mein eigentliches Thema, sondern die Nachkriegsjahre der so genannten Fürsorgeheime, wie der Hollsteinhof eines war. Nach dem Krieg hatte sich kaum etwas in Bezug auf die Pädagogik geändert. Noch immer lehrte man nach den Prinzipien Gehorchen und Bestrafen. Die Kinder wurden systematisch entrechtet.«
»Das mag ja sein«, räumte sie ein. »Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass dies am Hollsteinhof der Fall war. Das Heim galt als vorbildlich.«
»Sehen Sie. Deshalb wäre es doch wichtig, die Originalakten einzusehen und zu prüfen, ob meine Mutmaßungen stimmen. Und dazu bräuchte ich Ihre Hilfe.«
»Ich habe keine Ahnung, wo diese Akten lagern könnten«, rief sie aus.
»Nun, das dürfte doch nicht allzu schwer herauszufinden sein«, meinte er. »Sie sind vor Ort. Und wenn Sie Ihren Direktor danach fragen, hat das eine andere Gewichtung als wenn ich das tue. Sie können ja einfach behaupten, es handele sich um ein Schülerprojekt. Vielleicht ist er dann mitteilsamer. Wissen Sie, das Schlimme ist, dass meine Recherchen ständig dadurch behindert werden, weil Akten angeblich nicht mehr auffindbar sind. Vieles mag ja tatsächlich vernichtet worden sein, aber ich werde das Gefühl nicht los, dass man meine Forschung absichtlich blockiert.«
Sie schluckte und schwieg.
»So eine schlimme Sache aufzudecken, müsste doch auch in Ihrem Sinne sein«, appellierte er an ihr Gewissen. »Und zwar möglichst, bevor jemand auf die Idee kommt, alles durch den Schredder zu jagen.«
Seitdem wurde Henrike von einer diffusen Beklommenheit beherrscht. Sie hatte viel über die Worte des Studenten nachgedacht. Hatte Bücher hervorgeholt über diese Naziaktionen, in denen Wörter wie »Menschenmaterial« und »Ballastexistenzen« vorkamen, die man »ausmerzen« müsse. Auch von »Auslöschungsakten« war die Rede. Begriffe, die zum damaligen offiziellen Sprachgebrauch gehörten und an denen sich offenbar niemand störte. Immerhin ging es hier um Menschenleben. Sie hatte redlich versucht, sich in diese Denkweise hineinzuversetzen, doch sie war immer wieder an Grenzen gestoßen.
»Euthanasie« war eine aus dem Griechischen stammende Bezeichnung und bedeutete ursprünglich einen guten, angenehmen und leichten Tod, jedoch die Nazis hatten dieses Wort für ihre Zwecke umgedeutet und ihm eine schlimme, eine furchtbare Bedeutung verliehen. Hilflose Kinder waren nach fragwürdigen Diagnosen aussortiert und getötet worden – und niemand gebot Einhalt. Gab es Schlimmeres?
Seit sie wusste, dass ihre Schule damit in irgendeiner Verbindung stand, war sie bestrebt, den Dingen weiter auf den Grund zu gehen.
Es war nicht allzu schwer gewesen, herauszufinden, dass die gesuchten Akten in einer der Kammern auf dem Dachboden zu finden sein müssten.
Sie erbat sich die Schlüssel vom Hausmeister und stieg die Treppen nach oben bis unters Dach, dorthin, wohin sich normalerweise kein Mensch verirrte. Etliche der oberen Räume standen leer. In manchen fanden sich einige ausgediente Möbelstücke. Metallbetten mit dreiteiligen, durchgelegenen und verfleckten Matratzen zeugten davon, dass hier einstmals Schlafzimmer untergebracht waren. Fadenscheinige Vorhänge hingen an Fetzen herunter. Auf wackeligen Holzschemeln standen abgeplatzte Emailleschüsseln, offenbar frühere Waschgelegenheiten. Fließend Wasser gab es hier oben nicht.
Schließlich hatte sie das Archiv gefunden.
Ein Gefühl von Unwirklichkeit umgab sie, als sie nun etwas ratlos in einem riesigen verwinkelten Raum voller verstaubter und von Spinnweben durchzogener Regale stand, die mit ausgeblichenen grauen Kartons und Schriftstücken jeglicher Art überladen waren. Durch die blinden Fenster drang ein diffuses Licht. Die Luft roch muffig. Hier oben war offensichtlich schon Jahre niemand mehr gewesen. Sie lief an Regalen voller Schuber und aufeinandergestapelter Ordner entlang und wusste nicht, wo in diesem Sammelsurium sie zu suchen anfangen sollte. Ein wenig hatte sie auch Angst davor, auf was sie da womöglich stoßen könnte.
Um sie herum tanzten Staubteilchen und sie musste husten, als sie den erstbesten Pappkarton herauszog, den Deckel öffnete und hineinsah.
Akten aus der Nachkriegszeit befanden sich darin. Eine der an den Ecken abgestoßenen beigen Meldekarten wies als Einweisungsdatum den Januar 1962 auf. Die Unterlagen aus der Nazizeit mussten folglich woanders lagern. Sie schob den Karton zurück ins Regal.
Beim genaueren Hinsehen sah sie ab und an Vermerke, die auf Jahreszahlen hindeuteten. Doch sehr geordnet schien das alles nicht zu sein. Einzelfallakten mit persönlichen Angaben und Berichten lagen neben Sammelakten, offenbar nach dem Zufallsprinzip archiviert.
Sie begann zu schwitzen. Hier auf diesem Dachboden war es unerträglich heiß. Sie ging in die Hocke und zog aus dem unteren Regalboden einen Schuber heraus. Auf dem bräunlich verblichenen Kartondeckel war mit Frakturschrift ein Name vermerkt. Staub flog auf, der in der Nase kitzelte. Sie schlug die zuoberst liegende Akte auf. Auf der ersten Seite die üblichen Nazi-Insignien: Hakenkreuz und Reichsadler. Auf bröseligem, vergilbtem Papier standen Namen, Geburtsort und Geburtsdatum eines Jungen, der 1941 geboren war. Dahinter war eine Nummer vermerkt. Als Dreijähriger war er in das Kinderheim Hollsteinhof eingewiesen worden. Kopfschüttelnd las sie einen Antrag auf Pflegschaft, der abgelehnt wurde, da das Kind geistig nicht gesund sei und als minderbegabt angesehen werden müsse. Deshalb sei es nicht vermittelbar.
Es war eine dünne Akte. Als Todesdatum war der 14. April 1944 vermerkt. Todesursache: »Lungenentzündung«. Er war auf der Krankenstation des Heims verstorben.
Sie nahm eine weitere Akte zur Hand. Dieser Junge war bei seiner Einweisung etwas älter gewesen. Auf dünnen Durchschlägen mit der Schreibmaschine getippt wurde über die Entwicklung des Kindes und angeordnete Erziehungsmaßnahmen berichtet. Von Umerziehung war die Rede und von einem angeforderten Ariernachweis. Dazwischen viel handgeschriebener Schriftverkehr. Gestorben war er im Mai 1944. Auch seine Todesursache lautete »Lungenentzündung«. Ähnliches fand sich auch in den anderen Akten, die sie durchblätterte.
Ihre Kehle wurde eng. Der Student hatte die Wahrheit gesagt! Aber Beweise für herbeigeführte Tötungen fanden sich nicht.
Ein muffiger Geruch entströmte all diesen Akten, die sie nacheinander aufschlug. Zusammengepappte, vom Alter verkrustete Seiten trennte sie vorsichtig voneinander. Manche Blätter trugen deutliche Spuren von Silberfischchen.
Sie suchte weiter, las Namen und persönliche Angaben der sogenannten Zöglinge oder Pfleglinge. Jeweils mit Aktenzeichen versehen. Da waren neben Amtsschreiben im schönsten Bürokratendeutsch Meldekarten, Geburtsurkunden und auch schulische Unterlagen abgeheftet.
Überall stieß sie auf ähnliche Beschreibungen und Vermerke. Auffallend oft las sie Worte wie »Aussonderung«, »lebensunwert«, »unbildbar«, »arbeitsscheu«. Ab und an war »angeborener Schwachsinn« vermerkt.
Furchtbar, diese Sprache. Und so entlarvend. Ihr Unbehagen wuchs, je mehr Akten sie zur Hand nahm.
In einer Mappe befanden sich Schwarz-Weiß-Fotos mit gezackten Rändern, die das ehemalige Hauptgebäude des Hollsteinhofes zeigten, davor wehende Hakenkreuzfahnen. Eine Gruppe Jungen stand vor der hohen Mauer, die Rechte zum Hitlergruß erhoben.
Auch Broschüren und zugestaubte Bücher lagen in den Regalen.
In einer Druckschrift waren Aufnahmerichtlinien zur Vorsortierung und Erziehungsprognose von Heimkindern genannt. Psychiater wiesen darauf hin, dass Kinder und Jugendliche häufig erblich vorbelastet seien, deshalb seien im Vorfeld Diagnosen und Prognosen zu stellen, um »kindliche Psychopathen« oder »notorisch vorbelastete Schulschwänzer« auszusortieren. Diese sollten in halbgeschlossene oder ganz geschlossene Abteilungen weitergeleitet werden oder auch in eine »Idiotenanstalt«. Es gelte »durch Sichten und Sieben« die »erbgesunden« herauszufiltern und die anderen in entsprechend dafür geeignete Heime einzuweisen.
Sie richtete sich auf. Ihr Rücken tat weh. Ihre Augen brannten. Das T-Shirt klebte an ihrem Körper, ihre Kehle war gereizt und sie musste ständig husten. Doch offenbar hatte sie gefunden, wonach der Student suchte. Hier lagen die Nachweise für seine Vermutungen. Aber wie sollte sie all diese Unterlagen sichten? Das konnte sie unmöglich allein schaffen. Vielleicht sollte sie tatsächlich ein Projekt daraus machen. Sie würde es sich nochmal durch den Kopf gehen lassen. Diese Vergangenheit musste aufgearbeitet werden. Unbedingt.
Bonn, Hollsteinkolleg 5. Kapitel
Die hohe Mauer mit den Glasscherben war nicht mehr da. Auch das schwere Eisentor war verschwunden. Überhaupt sah alles viel zugänglicher aus als damals. Der Park war äußerst gepflegt, wofür sicher festangestellte Gärtner sorgten. Die Bäume rings um das Gelände waren hoch gewachsen, die Wege teilweise gekiest, der Springbrunnen mit dem Wasserspeier war neu. Ebenso ein kleiner Pavillon mit verschnörkelten Seitenwänden, an denen weiße Kletterrosen emporrankten.
Auch das Hauptgebäude hatte sich verändert, ein paar Anbauten waren hinzu gekommen. Mit dem vielen Glas wirkte es wie eine gelungene Kombination von alt und modern, wenn man es nüchtern betrachtete. Lediglich die kleineren Häuser, die darum gruppiert waren, sahen noch genauso aus wie damals. Bimssteinmauern, holzverkleidete Giebel, weiße Fensterrahmen, grüne Klappläden, denen man einen neuen Anstrich verpasst hatte. Auf den schiefergedeckten Dächern wuchsen Moos und Flechten.
Verträumt und märchenhaft. So hatte das Gelände ursprünglich auf ihn gewirkt. Sein neues Zuhause. Hier kann man sich wohlfühlen, hatte er gedacht. Auch heute noch sah es aus wie die reinste Idylle.
Abrupt blieb er stehen. Das war das Haus, in dem er gewohnt hatte. Auf dem Dach saß reglos ein Rabe, der ihn zu beäugen schien. Die Sonne reflektierte das Licht und zwang ihn, die Augen zusammenzukneifen.
Hinter dem vergitterten Fenster im Erdgeschoss war das Schlafzimmer gewesen. Noch immer schmerzte sein Herz, wenn er an den Freund dachte, der im Bett neben dem seinen schlief. Thomas, der zarte, sensible Junge, der jeden Abend in die Kissen weinte, der so anders war als die anderen und damit ihm selbst so ähnlich.