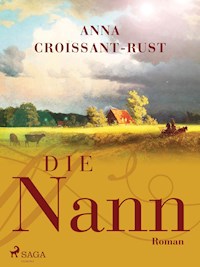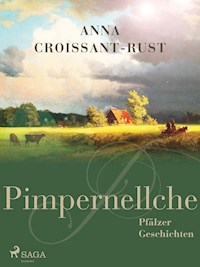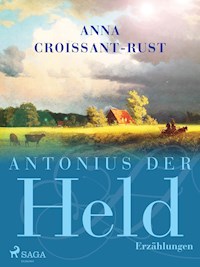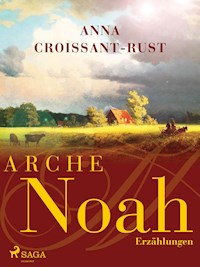
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In ihren berührenden Novellen zeichnet die Autorin ein liebevolles Bild der Menschen in ihrer bayerischen Heimat. Dabei sind es die sogenannten "einfachen" Menschen, die sie porträtiert. Das alte Mütterchen, das mit einem Karren bei jedem Wetter das Gebäck von Mittenwald aus in die umliegenden Dörfer bringt und nur ein einziges Mal in ihrem Leben ausgefallen ist. Die Stammtischgäste, alle männlich, die sich in ihrer Pause in die Gaststube der "Post" begeben und die Kellnerin in ihre nicht immer angenehmen Gespräche ziehen. Und die kleine Nonne in dem weißen Kloster hoch über dem Eisack, deren fortgesetzte Verfehlung darin besteht, sehnlichst aus dem Fenster auf die Welt unterhalb des Klosters zu blicken.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 352
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anna Croissant-Rust
Arche Noah
Saga
Die Brodm’ri
Täglich zieht die Alte ihren Karren von der Scharnitz nach Mittenwald und wieder zurück. Ob es krachend kalter Winter ist und der Weg so voller Eisplatten, dass sie alle Augenblick nach rückwärts rutscht, und wie ein braves Ross die Eisen einhauen muss, um nur weiter zu kommen, ob es schneit, dass sie kaum die Landstrasse zu erkennen vermag, oder die Sonne herunterbrennt, dass ihr der Kopf zerspringen möchte, ob das Schneewasser im Frühjahr, wenn es „aper“ wird, auf der Landstrasse dahinschiesst, wie wenn diese ein Bachbett und der in seinem vollen Rechte wäre, oder im Herbst der wüste Wind durchs Tal pfeift und sie fast umwirft: das alte Weiblein zieht gleichmütig seinen Karren hin und her, über eine Stunde hin, weit über eine Stunde zurück. Es fällt ihr nimmer ein, etwa hinauf nach dem jähen Absturz der Karwendelwand zu schauen und drüben nach dem kühnen Aufbau des Wettersteins, sie trabt wie ein alter Gaul ihre Strasse in Staub und Schnee, in Regen und Wind. Ihr gilt’s gleich, ob sie allein unterwegs ist, oder ob sich ein Jäger oder Grenzer ihr zugesellt, oder gar Touristen, die nach Seefeld wandern, nach dem Hinterautal vielleicht, wo die junge grüne Isar schäumend aus der Einsamkeit stürmt; ob geputzte Städter „in Toilette“ sie überholen (o idyllisches nachbarliches Paradies von Partenkirchen!) zur Zeit der „Saison“, wo das biedere Volk der Mittenwalder seinen echten und innigen Nationalgesang mit der echten und innigen Melodie anzustimmen pflegt: „Kennst du das Tal am Fusse des Karwendelbergs?“ Der M’ri gilt das alles gleich, wenn sie auch gern ein paar Worte im Vorbeigehen redet; sie hat nur den einen Gedanken: ihre Wecken und Semmeln, von denen sie für jeden Haushalt in der Scharnitz eine bestimmte Anzahl ohne Zoll über die Grenze bringen darf. Tapfer aufgeladen hat sie jeden Tag, die Scharnitzer lieben das Brot, das die Mittenwalder Bäcker „bachen“, voraus das des Fasel, des Zunterer, in dem alten Fuggerhaus an der Hauptstrasse. Dort hält immer der Karren der Alten, während sie ihre anderen kleinen Besorgungen im Markte macht. Da buckelt sie frisch und geschäftig in den Läden herum, immer murmelnd, immer ihre Aufträge wiederholend. Nie schreibt sie sich etwas auf, es ist aber doch noch nie vorgekommen, dass sie etwas vergessen hat. Ihr Amt nimmt sie deshalb auch so in Anspruch, dass sie während des Einkaufens auf keinen Gruss hört und niemanden sieht. Erst, wenn sie beschaulich ruhend auf ihrem Bänklein sitzt im Laden der klugen und hübschen „Faselin“, die so viel von der alten Mittenwalder Chronik zu erzählen weiss, ist sie zugänglich, und die M’ri und ich halten stets einen kleinen Schwatz, während die „Bäckin“ die Semmeln und Wecken abzählt. Manchmal treffen wir uns auch auf der Landstrasse, wo sie immer gern eine Stehpause macht und plaudert.
Gewöhnlich gehen unsere Gespräche so an: „Grüss Gott, M’ri, wie geht’s?“
„Wie geaht’s? Alleweil ziahchen und ziahchen!“ Dabei lacht sie über ihr ganzes braunes, verrunzeltes und verwittertes, gutes, altes Gesicht, in dem die schwarzen Augen ganz verschmitzt glitzern können, wie die Augen einer Jungen.
Sag ich: „Eine Hitz ist’s, schauderhaft!“ oder: „Aber der Wind heut, M’ri, hat er dich denn nicht umgeschmissen?“ „O mei’, ischt gleich,“ meint sie und wischt den Schweiss von der Stirn oder die Tränen aus den Augenwinkeln, die ihr der Sturm draussen bei der grossen wilden Wiese, beim Schaudriwaudriraut, wo er gar so unheimlich fauchen kann, herausgepresst hat. Und dann trabt sie wieder ihre Strasse weiter, gelassen und fröhlich.
Einmal treffe ich sie, als ich eben ins Hinterautal will, hart hinter der Scharnitz, hoch oben am Wald krabbelt sie herum und recht Laub zusammen. Einen hohen Haufen hat sie schon aufgeladen und trägt noch immer mehr zu. Sobald sie mich sieht, kommt sie über die steile Anhöhe herunter wie eine Junge. Ich hab ihr Kuchen mitgebracht, den sie geheimnisvoll schmunzelnd verschwinden lässt.
„Wie geht’s, M’ri?“
Sie deutet auf den grossen Haufen „Straa“, den sie schon zusammengetragen und nachher ins Dorf bringen will zu ihrer Tochter. „Alleweil ziahchen und ziahchen.“ Ich sehe mir den hohen Streuhaufen an: „Und heut warst du schon in Mittenwald?“ Sie schaut mich verwundert und ganz verständnislos an und nickt. Währenddem kommt ein Blondkopf auf sie zugesprungen und hält sich halb hinter ihrer Schürze verborgen; von dieser gedeckten Stellung aus sieht er argwöhnisch auf mich. Fast verschämt zieht sie den Kuchen aus der Tasche und schiebt ihm ein tüchtiges Stück in den Mund, während sie nur ein bisschen versucht. Der hübsche Krauskopf, der mir so feindselige Augen anmacht, gehört ihrer Tochter, bei der sie auch wohnt, und der sie die Streu bringen will. Ein sauberes, kleines, weisses Haus haben sie miteinander, alles voller Blumen und Vögel, ich hab mir’s nachher angeschaut.
Immer wieder erzählt sie mir von ihrem Schwiegersohn, der „Jager“ beim Fürsten ist und oft „langs“ Zeit nicht daheim; dass er kreuzbrav und sauber ist und so „viel guat“ mit ihr.
„Und die Kinder?“
„Alleweil mehrer werd’n s’.“
„Ein Stück? Zwei — drei?“
Sie nickt: „Mög’n aa mehrer werd’n, wie’s kimmt.“
„Da muss die Grossmutter Kinder warten?“
Sie macht die Bewegung des Fahrens. Auch die „ziahcht“ sie! „Mei’, sekkier’n di’ halt!“ — Ob sie nie krank war, frag ich sie wieder einmal.
Krank? Sie denkt einen Augenblick nach. Eigentlich nie. Nur einmal ja, ist ihr’s zu Herzen gegangen, aber nicht das Kranksein, nein, das nicht arbeiten Können war’s, das Faulenzen, das Zuschauenmüssen, wie die anderen arbeiteten, das Hände-in-den-Schoss-legen. Der „Verdruss“ hätte sie beinahe umgebracht, meint sie, es sei die schlimmste Zeit ihres Lebens gewesen! Nun erzählt sie ausführlich, sehr wichtig, aber immer dabei schmunzelnd, immer ein wenig belustigt, mit einer gewissen humorvollen Ueberlegenheit: Also der Wind wehte wieder einmal recht wüst durchs Tal, so, wie’s die Mittenwalder haben wollen, damit es schön Wetter bleibt. Er knatterte und brüllte und wütete herum, wie wenn aller Dinge letztes Ende wäre. Die M’ri sass gemütlich in der Stube und freute sich ihrer Ruhe nach dem Strauss mit dem Sturm. Eben war sie von Mittenwald gekommen, hatte ihre Wecken und Semmeln abgeliefert und löffelte ihren Kaffee. Da hört sie das grosse Scheunentor draussen wütend schlagen.
„So lass es doch,“ sagt ihr die Tochter ärgerlich, „bleib sitzen.“
Die Junge bleibt, der Alten lässt es keine Ruhe. Wohl hätte sie ebensogut durch das Haus, den Gang und den Stall hinten herum nach der Scheuer gehen können, aber das ist ihr zu weit. Schnell läuft sie aussen herum, in den immer rasender werdenden Sturm hinein. „Bautz! Bautz! — Bumm!“ schlägt das Tor mit dumpfem Krachen auf und zu, auf und zu, dass man meint, es müsse splittern. Die Alte rennt hin und will’s aufhalten, beide Arme stemmt sie dagegen — ein neuer wilder Windstoss und schon liegt sie auf dem Rücken; mit aller Wucht ist das schwere Tor auf ihre Arme geflogen und hat sie umgeworfen. Da liegt sie und kann sich nicht mehr rühren, kann nicht mehr aufstehen, und in den Schultern brennt’s und reisst’s und tobt’s. —
„Boade sein’s ausg’fall’n g’wes’n, boade!“ sagt sie und zwinkert, wie wenn das ein köstlicher, von ihr ausgeheckter Schabernack gewesen sei, sich beide Achseln auszufallen!
Als der Arzt kam, schlug er freilich über diese Art der Schelmerei die Hände über dem Kopf zusammen. Beide Achseln! Und dabei sass sie ganz vergnügt im Bett und wartete darauf, dass er schnell den kleinen Schaden repariere, damit sie morgen wieder ihren Karren nach Mittenwald „ziahchen“ könne!
Später erzählte der Doktor das alles in der „Post“ in Mittenwald; auch dass sie keinen Schnaufer, keinen Schrei getan, als er ihr die Achseln einrichtete.
„Is es jetzt g’schehg’n?“ Das war alles, was das alte Weiblein frug.
Heute konnte sie sich noch kindisch darüber freuen, dass die Leute sich alle über sie verwundert und die Köpfe über sie geschüttelt hatten.
„Des sell ischt doch nir g’wesen,“ meint sie, „aber das Feiern!“ Sie war glücklich, als sie sich wieder vor ihren Wagen spannen konnte; unnütz sein, das war schlimmer als krank sein, das war beinahe der Tod!
Was sie wohl machen wird, die Alte?
„Alleweil ziahchen und ziahchen.“
Tirili-Tirili
Der kleine Bahnbeamte, der soeben mit hochgeschlagenem Kragen, die Hände in den Taschen seines langen Mantels vergraben, den Zug abgefertigt hatte, drehte sich auf dem Absatz herum, warf einen kurzen Blick nach dem Bureau und schlug fröstelnd einen schnellen Trab an über die Strasse herüber nach der „Post“. Schnee lag in der Luft, ein wüster Wind wehte vom Brenner her und wirbelte den Staub der hartgefrorenen Strasse hoch auf. Es dämmerte, die Wolken hockten förmlich wie Klumpen auf den Tannen der Vorberge, und die Lärchen am Abhang schwankten wild hin und her.
Da und dort in den engen Gassen des Dorfes taten sich die kleinen rötlichen Glühbirnen wie viele müd blinzelnde Augen auf, und das Nebenzimmer der „Post“ mit seinem grellgelben Vorhange strahlte dem Erfrorenen wie eine Verheissung entgegen. Nur ein paar Minuten Zeit hatte er, zu einem heissen Schwarzen, oder zu einem „Stamperl“ Schnaps. Aber er freute sich auf die paar Minuten, er freute sich auf die kurze Ruhe am grossen, runden Tisch, auf die Stammtischgenossen, den neuen Gast, den jungen Adjunkten, der den Bezirksrichter zu vertreten hatte und so prachtvoll zu erzählen verstand, freute sich auf die ganze, aus Lärm, Tabaksqualm, Weindunst und fröhlicher Laune gemischte Atmosphäre, die er ein paar Augenblicke unter der Dienstpause geniessen wollte.
Anspruchsvoll war er nämlich gar nicht, der kleine, geschniegelte Bahnbeamte, der zuvor auf einem ganz verlorenen Posten gewesen, so dass ihm Brunnach, mit allem, was drum und dran war, bis jetzt noch als Paradies erschien. „Das unbeschriebene Blatt“ hiess ihn sein älterer, eleganter Kollege noch immer, obwohl der kleine Geschniegelte zwar etwas tappig, aber mit allem Jugendfeuer Anstrengungen machte, dass dies Blatt baldigst beschrieben werde; vor allem wollte er es den Even des Brunnacher Paradieses nach jeder Richtung hin erleichtern, sich auf diesem bis jetzt noch schneereinen Blatt einzuschreiben. Und besonders viel Mühe hatte er sich gegeben, die imposante Kellnerin in der „Krone“ um diese Gunst zu bitten; jedoch die hochbusige Walküre, eine echte Saisonkellnerinnen-Erscheinung, deren Frisur, Füsse und weisse Schürzen gleich achtunggebietend waren, hatte bis jetzt noch keine Zeit zu der kleinen Uebung gefunden, da sie zu sehr anderweitig beschäftigt war.
„Schnee kriegen wir,“ sagte das unbeschriebene Blatt beim Eintreten und rieb sich halb vor Kälte und halb vor Behaglichkeit die roten Hände. Dann setzte sich der Kleine, seinen angelaufenen Zwicker eifrig putzend, im Mantel zwischen die Stammtischler. Herrgott wie gemütlich! Alle waren sie da, gerade heute, wo er Dienst hatte! Nur der Adjunkt fehlte, aber sein Gedeck stand bereit.
„Schnee!“ äffte ihn der fuchsrote Doktor mit seiner heiseren Stimme spöttisch nach. „Da sagen’s uns was Neues! Da brauchen wir grad Ihnen dazu! Da schaun’s meine g’frörten Händ’ an! Des weiss ich schon lang!“ Und er streckte dem Eingetretenen seine blauroten, hochangeschwollenen Hände hin, die dieser, etwas eingeschüchtert durch des Doktors Schreien, an das er sich noch immer nicht gewöhnt hatte, blöde durch seinen Zwicker betrachtete.
„Ja, schauen’s nur!“ schrie der Doktor wieder. „Sie sitzen fein im warmen Bureau.“
„Oder in der ‚Krone‘,“ zeterte in der höchsten Fistel der blasse, sanftgescheitelte Kontrollor entgegen, und ein gurgelndes Lachen erhob sich am untern Tisch.
„Schtad!“ kommandierte der Doktor und putzte seine Pfeife so energisch aus, dass die Asche überall herumspritzte. „Ihr sitzt’s alle im Bureau und in die Wirtshäuser und mich fragt koan Mensch, ob ich fort will oder nit. Glaubt’s, das ist ein Vergnügen, bei zwanzig Grad Kält’ umeinander kraxeln, wenn’s vom Brenner ower pfeift?“
„Jojo,“ sagte in der untern Ecke eine Stimme. „Sie fahren jo alleweil, Doktor.“ Das war der zweite Bahnbeamte, ein sehr grosser, schlanker, schwarzhaariger Kerl, der einstmals ganz Brunnach in Aufregung gebracht hatte, als er, direkt von Wien importiert, in Zylinder und Lackschuhen beim Sonntagsfrühschoppen erschienen war. Die Aufregung fing beim weiblichen Teil auf eine, für den schönen Jungen sehr angenehme Weise an, endete aber nicht gerade siegreich im Herrnstüberl. Da er indes ein Mann von Humor und Geschmack war, lachte er selbst tüchtig mit, trug seinen Zylinder noch ein paar Sonntage und zwar etwas aufs linke Ohr gerückt, welch kleine Nuance einer gutmütigen und feinen Selbstverspottung glich und auch so aufgefasst wurde. Dann begrub er ihn und seine Lackschuhe zum Bedauern der Witib Strasser endgültig in deren, das heisst seinem grossen Kleiderschrank. Besagte Witwe war mitsamt ihrer Tochter so tief in die Bewunderung des jungen Adonis verstrickt, dass er in ihrem Hause sass wie’s Häschen im Kraut, etwas zum Schaden des zweiten Zimmerherrn, des k. k. Gerichtssekretärs, aus dessen Zimmer verschiedene Kissen und Decken und Bilder verschwanden, um drüben bei dem schönen Wiener zu erscheinen. Deshalb liebte auch der k. k. Gerichtssekretär, der dick und schwammig war und eine Glatze hatte, den eleganten Bahnbeamten durchaus nicht, und setzte sich — auch heute war dies der Fall — möglichst weit von ihm weg.
Die allgemeine, fast hysterische Entflammung der Damenwelt hatte allmählich abgeflaut, weil der also Verehrte seine Siege denn doch allzu gelassen trug. „Er ischt decht unnahbar,“ sagten zornig und traurig die Damen. „Er ist blasiert,“ fassten die Herren unter Anführung des k. k. Sekretärs ihre Meinung zusammen. In Wahrheit langweilten den Angeschwärmten sowohl die Liebe, wie sie ihm von der Brunnacher Damenwelt entgegengebracht wurde, wie die Unterhaltung und die Witze, die ihm die Herren kredenzten. Zuerst hatte er sondiert, — vielleicht gab es doch den einen oder andern am Stammtisch, mit dem man ein wirkliches Gespräch führen konnte; dann hatte er es mit der Musik versucht, es blieb aber nur bei den Versuchen, alles Ernsthafte glitt an den Stammtischlern ab. Nun tat er eben mit, da er keine energische, widerstandsfähige Natur war, versank langsam in dem allgemeinen Schlammbach, aber mit der Miene eines Halbschlafenden, den dies alles nicht berührt, und der gut eines Tages mit zwei Füssen ans Land springen und sich schütteln konnte, um mit einer schönen Verbeugung zu verschwinden.
Vorderhand sass er aber noch jeden Tag in der „Post“, wenn er keinen Dienst hatte, machte seine schönen Augen nur halb auf und sah elegant und gelangweilt aus, wie eben jetzt. Und das reizte den Doktor jedesmal.
„Wos? Reden’s doch nit so dalket! Weil Sie mich anmal haben einsteigen sehen! Was wissen denn Sie von Gebirg, Sie Salontiroler! Als ob man überall hinfahr’n kannt’! Wegen jeden alten Krachzer muss i am Berg auffi, und wegen jeden Lackl muss i mir d’ Füass’ und d’ Händ’ derfrörn!“
„Wie viel Füss’ und Händ’ sich der schon derfrört hat!“ gluckste der dicke, stoppelköpfige Steuereinnehmer, und hob prustend und grunzend das Fett seines rundlichen Leibes auf und ab, „derweil sitzt er alleweil do in der Poscht, wenn mir da sein, und trinkt.“
„Du spar dir deine Reden! Vom Trinken derfst grad du reden!“ fauchte ihn der Doktor über den Tisch hinüber an; aber der Dicke lachte und prustete unbekümmert und schäkernd weiter, wobei er die sehr kleinen und listigen Aeuglein hinter der Brille zusammenkniff. So sass er da, wie ein feister, fröhlicher, verkleideter Franziskaner, der, soeben dem Kloster entlaufen, sich einen winzigen Schnurrbart aufgeklebt hat, der nicht recht halten will und sich mit allen Borsten auf der Oberlippe sträubt.
Den Doktor erbost dies Lachen: „Ja,“ schreit er, „du giebsch’ koan Ruah, bis di’ a Schlagerl trifft, und a Schlagerl trifft di’ so g’wiss wie nur was.“
Doch je zorniger der Doktor wird, desto aufgeräumter wird der Dicke: „Nachher will i luschdi’ sein bis an mein seligs End’! Prost! Prost!“ und er stösst mit allen an und giesst seinen Wein auf einmal hinunter.
„Rosele!“ flötet er dann mit gespitzten Lippen, „Rosele!“ und noch einmal zärtlicher und höher: „Rosele!“
Endlich bequemt sich die untersetzte, in der Gegend der Hüften und ihrer Fortsetzung nach rückwärts besonders umfangreiche, grellblonde Kellnerin, sich von einem Tische in der Bauernstube geräuschvoll zu erheben. Sie bebt vor Entrüstung, denn sie wurde mitten in einer Unterhaltung in der halbdunklen Bauernstube gestört, einer Unterhaltung, die soeben ins Handgreifliche übergehen wollte, und da sie es liebte, ihrer Entrüstung, ihrem Zorn, sowie auch ihrer Liebe durch mehr oder minder kräftige, zitternde und schaukelnde Bewegungen der Hüften Ausdruck zu geben, die sich dann wellenförmig nach rückwärts fortsetzten, gab sie auch jetzt ein schönes Beispiel erregter Gefühle, aber es war nicht Liebe, die diesmal das Wellenspiel hervorrief.
„Pff! holde Rose!“ rief scheinbar erschrocken die Achseln hinaufziehend der Kontrollor, und blähte die Nüstern seiner Stulpnase auf, „sind Sie nicht so stachlig, wir lieben Sie ja alle!“ damit versuchte er den Arm um ihre grösste Rundung zu legen und so dem ausdrucksvollen Wellengekräusel Einhalt zu tun.
„Sie sein mir der rechte Bräutigam,“ schnauzte die Hebe den blassen Kontrollor mit den dünnen Haaren an, „weg mit die Bratzen,“ und mit einem Ruck versuchte sie seinen mageren Arm wegzustossen. „Auslassen oder —“ die Bewegungen ihrer Rundung beschrieben förmliche Halbkreise: „Heiraten’s nur und bringen’s die Gnädige her, ich werd’ ihr ein Licht aufstecken, wos Sie für aner sind!“
Aus irgendeinem Grunde, der nur ihr und dem Kontrollor bekannt war, stellte sie sich plötzlich ganz unerwartet mit aufgestemmten, auch sehr ausdrucksvollen Armen vor ihn hin und schrie: „So? Und was Sie von Innsbruck verzählt ham, und was Sie da alles treiben? Pfui Teufel! Und in die „Krone“ gehn Sie etwa nit? Sie? Manen Sie, man weiss das nit?“
Der graublonde Kontrollor aus Mähren, der aber ein waschechter Böhme war, versuchte krampfhaft zu lachen und im Spass seine feuchte Hand auf ihren Mund zu legen. Sie schob seine Finger weg und wischte sich energisch ab. „Vor dir graus’ i mir,“ sagte sie in ehrlichem Ekel.
„Aber vor dem draussen hast dich nicht gegraust!“ bemerkte giftig der Abgeblitzte; doch seine Worte gingen im allgemeinen Gelächter unter. Alle gönnten’s ihm, sogar der stattliche Wirt lachte behaglich vor sich hin, und der Wiener diesmal ganz laut. Der Doktor sass da, die breiten Hände auf den sehnigen Schenkeln, und horchte, Mund und Nase aufgerissen, zu: „Aha!“ sagte er, „die red’t deutsch, er aber red’t böhmisch.“
„Bravo!“ rief der Schreiber vom Bezirksgericht, der sich bis jetzt nicht gerührt hatte, und ganz unten in der Ecke sass, seine krummen Reitbeine ausgespreizt, anzusehen wie ein ausgedienter Kavallerist, oder wie ein fettgewordener Jockei.
„Was bravo!“ schnauzte ihn der Steuereinnehmer an, durch irgendeine Gedanken- oder Gefühlsassoziation, über die er sich wohl selbst kaum Rechenschaft gab, und bei der ihm niemand gefolgt war, plötzlich wütend: „Ich hab das Rosele gerufen, ich. Und ich will was von ihr und zu mir muss sie her!“
„Schnell, Röschen,“ sagte mit herabgezogenen Mundwinkeln der böhmische Mähre mit der unzweideutigen Stumpfnase, und hatte noch immer hektisch rote Verlegenheits-Wängelchen, „wenn der Steuereinnehmer wütend wird —“
„Oder verliebt,“ schaltete der Forstkommissär ein, der meistens halb schlief und nur zum Trinken aufwachte.
„Vor so einem alten Krampen werd’ ich mir grad fürchten?“ sagte das Röschen mit den Dornen verächtlich und trat mit etwas minder schaukelnder Mittelpartie zu dem Alten.
„War ner der schöne Herr Adjunkt aus dem Inntal do,“ lispelte der Steuereinnehmer dem Busen der Rose nahe, und reichte ihr mit zärtlichem Aufblick das leere Fläschchen, „na warst du mit uns auch liebenswürdiger!“
Ungestüm aber, und unerwartet entriss ihm die Rose von Brunnach das „Vierdele“, worauf begreiflicherweise ein lautes und allgemeines Hallo am Stammtisch entstand; denn das gehörte sich so.
„Woll, neidig seid’s ihm, weil er gebildeter ischt,“ warf die streitbare Hebe im Hinauseilen über die Schulter zurück, und hielt diesmal Körper und Kopf bocksteif. Die Tafelrunde stiess ein kurzes, meckerndes Lachen aus, dann wurde es sehr still. Der Doktor räusperte sich, der Schreiber grinste dem Kontrollor zu, der Sekretär trank, der stattliche Wirt, der ganz und gar einem idealen Andreas Hofer glich in seiner ernsten Würde, den blühenden Farben, dem traditionellen Hoferbart und dem schlicht gescheitelten Haar, sah auf die Uhr, der dicke Steuereinnehmer nahm umständlich sein blaues Taschentuch, das zu einem länglichen Paket geballt war und zog es ein paarmal unter der Nase hin und her, der kleine Bahnbeamte sah nervös auf die Uhr und schrie: „Ich muss fort, ich muss fort!“
„Warum kommt der Adjunkt heute nicht?“ fragte der schöne Wiener, der eigentlich aus der Bukowina stammte und nur längere Zeit in Wien gelebt hatte, weshalb er von der Tafelrunde der „Bukowiener“ getauft worden war.
„Teufel, wenn er nur gekommen wäre!“ sagte der kleine, zierliche Bahnbeamte, dem Brunnach noch ein Paradies schien, und der den „Bukowiener“ Kollegen heiss um seine Schönheit und Eleganz, den stellvertretenden Bezirksrichter aber um seinen Geist, seine Vornehmheit und seine Herkunft beneidete, denn er wusste, dass des Adjunkten Vater ein berühmter Musiker gewesen.
„Servus! Gute Nacht!“ rief er, griff grüssend noch einmal an die Mütze, machte eine zierliche, fast kokette Verbeugung, die ihn selbst entzückte, und ging, eine Zigarette anzündend, weg.
„Jo, warum ist er denn nicht do?“ fragte der beneidete Bukowiener den Wirt, der bedauernd die Achseln zuckte.
„Hm! hm!“ machte bedeutungsvoll der Kontrollor, und in die tiefe Stille, die dem „hm! hm!“ folgte, hinein sagte der Doktor: „Mir sein alle Surrogat hier“, damit ein Lieblingswort des „Bukowieners“ variierend.
In diesem Augenblick stellte das Röschen, das gewiss echt und kein Surrogat war, den Wein des Steuereinnehmers sehr nachdrücklich und sehr schnell auf den Tisch, denn die Türe tat sich auf und der von der Abteilung Bahn gewünschte, von den andern „beschwiegene“ Adjunkt trat herein, den weiten Mantel voll weisser Flocken.
Das Röschen hüpfte an ihm herum, um ihm den Mantel abzunehmen, und an ihr hüpfte Verschiedenes mit, die weissen Flocken hüpften auch, aber der grosse breitschulterige und doch schlanke, elastische Adjunkt kam gemessen auf den Tisch zu.
„Prachtvoll schneit’s, wie um Weihnachten. Es wird aber nicht lange dauern, die Sterne wollen schon wieder durchkommen,“ und, indem er die Hände, die sich ihm entgegenstreckten, schüttelte, setzte er sich zwischen den Wiener und den Wirt und trank mit Behagen von dem Roten, den ihm das Rosele, nun ganz dornenlose Hingabe, gebracht.
Der Stellvertreter des erkrankten Bezirksrichters war noch nicht lange aus dem Inntal in das einsame Gebirgsnest verschlagen worden. Es war, als brächte er aus seinem breiten, sonnigen Tal einen Strom köstlicher Luft mit, Heiterkeit und Schönheit, zugleich etwas Fremdes, Neues, Anziehendes, das die ganze Tafelrunde im Anfang gelockt hatte; es war wie ein wohltätiges Bad, in dem sie alle untergetaucht waren. Wenn er erzählte, konnte es im Anfang passieren, dass sie auf ihre Pfeifen vergassen, oder gar aufs Trinken, dass sie sassen und sassen und die Atmosphäre genossen, die dieser feine und bewegliche Geist mitgebracht. Aber eines hatte sie von Anfang an verstimmt: waren sie so recht animiert von seiner Erzählung, war es spät geworden und sie wollten anfangen, in altgewohnter Weise über das Gehörte Witze zu machen, oder lustig zu sein auf ihre Art, wollten sie sich jetzt erst recht in die Gemütlichkeit setzen und nachdrücklich ans Trinken gehen, konnte er eine eigentümliche Art haben — sie war fraglos verletzend —, ohne einen Grund anzugeben, einfach seinen Hut zu nehmen, auch noch recht freundlich zu grüssen und dann, gewöhnlich mit dem „blasierten Bukowiener“ zu verschwinden.
Sie hatten ihn des öfteren bestürmt, dazubleiben, aber er sagte jedesmal ruhig lachend: „Nein, nein! Wozu? Ich will noch etwas lesen,“ oder: „ich habe noch zu tun“, sogar seelenruhig: „ich will schlafen gehen!“ Waren das Gründe? Ich will lesen, ich will schlafen gehen! Das war ganz und gar unkameradschaftlich, das musste verstimmen, wenn das keine Ueberhebung war?! — Im Grunde verachtete er sie gewiss und er tyrannisierte sie ohne Frage, denn anstatt zu „karteln“ und lustig zu sein, sassen sie wie die Oelgötzen, konnten das Maul halten und ihm zuhören. Riss einer einmal eine saftige Zote, wieherte er nicht mit wie die andern, sass nur steif da und blies Rauchringeln in die Luft. Manchmal liess er sich herab zu sagen: „Das war einmal ausnahmsweise gut.“
Die ersten Abende waren sehr animiert gewesen, sie fanden, er erzählte witzig und gut; dann war er ein freier Kopf, und man brauchte sich den Schnabel vor ihm nicht zu verbinden. Aber auf die Dauer bedrückte sein Wesen doch, das ihnen voll unausgesprochener Prätension zu stecken schien, und sie rächten sich nach seinem Weggehen jedesmal, indem sie in eine Art verbissene Lustigkeit verfielen und in wüstem, sinnlosem Lärm, in Geschrei, Gejohl und Betrunkenheit bis tief in den Morgen hinein sich gleichsam für jede Art der Enthaltsamkeit rächten, zu der sie durch ihn verurteilt wurden, wobei der schöne Wiener, seine tadellos beschuhten, wohlgeformten Beine ausstreckend, auch hie und da mittat, mit resigniertem, fast ärgerlichem Ausdruck in einer Ecke sass, sehr viel Schnäpse trank und von Zeit zu Zeit einen grellen Pfiff ausstiess.
Des imposanten Wirtes kriegerische Figur erschien wohl in Zwischenräumen unter der Türe; sowie die späteren Nachtstunden oder besser die ersten Morgenstunden anrückten, war er verschwunden und der Schauplatz blieb der Tafelrunde und dem in schön geschwungenen Rundungen sich bewegenden Rosele allein überlassen, welch angenehmen Zustand der einem verfetteten Jockei ähnelnde Gerichtsschreiber in Verbindung mit dem k. k. Sekretär stets mit dem herrlichen Lied begrüsste:
„Ziwui, ziwui, ziwui,
Jetzt schlagt’s schon halber drui.“
Eine derartige Nachfeier lag heute, für Nasen mit feiner Witterung unschwer erkenntlich, in der Luft; und als der Adjunkt mit seinem prachtvollen altmodischen Musikerkopf, mit seinem mächtigen dunklen Haupte, in dem ein Paar feurige und doch stille Augen in tiefen Höhlen sassen, von seinem Abendmahl aufsah, begegnete er einigen mürrischen und einigen fast unverhohlen hämischen Gesichtern.
„Was gibt es Neues beim k. k. Gericht?“ frug der Doktor, dem nicht ganz klare Situationen unbehaglich waren.
„Neues?“ Der Adjunkt lachte herzhaft. „Etwas Köstliches! Drei Frauenspersonen haben sie mir heut zugeführt, drei arme zusammengefrorene Weiberleute, die von Sterzing über den Brenner herübergekommen waren, blau wie die Zwetschgen, und die keinen Gewerbeschein, keinen Pass, nichts besassen —“
„Gewerbeschein?“ unterbrach grinsend der keinerlei Ausweis.“
„Herrgott,“ antwortete ärgerlich der Adjunkt, „die Frauensleute wollen Musik machen, sich ihren Unterhalt mit Musik verdienen, und hatten keinerlei Ausweis.“
„Jung?“ frug gespannt der k. k. Gerichtsschreiber.
„Teilweise. Die eine schon etwas übertragen.“
„Jo jo, die Hab ich gesehen; die eine hot eine Harfen gehobt, jo, die andere eine Violine, wos?“ fragte der Bukowiener in seinem drolligen Deutsch.
„Surrogat?“ meckerte der Kontrollor.
„Ganz und gar nicht,“ erwiderte ernsthaft der Adjunkt, „hören Sie nur. Was sollte ich mit den drei Weiberln machen? Zitternd standen sie in meinem Bureau, das zum Glück gut geheizt war, so dass sie sich wenigstens auswärmen konnten. Einsperren kann ich sie doch nicht lassen, auf dem Schub fortbringen geht auch nicht, sie haben mich zu arg gedauert, besonders die Kleine, ein etwa sechzehnjähriges Ding mit kohlpechschwarzen grossen Augen.“
„Sein sie Welsche?“ frug der Steuereinnehmer interessiert, und die Stammtischler rückten alle näher zusammen. Aber der Adjunkt hatte die Frage überhört. „Ich besinne mich hin und her, endlich fällt mir etwas ein, auf das ich sehr stolz bin, ein beinahe salomonisches Urteil. Die drei mussten mir den Beweis erbringen, dass sie das Recht hatten, sozusagen ambulante Musik zu machen: ich liess sie einfach musizieren. Sie wissen ja, mein Alter war Musiker von Fach in Wien, ich wäre beinah auch einer geworden, vielleicht ist es sogar schad um mich, — kurz und gut, ich hab von Kindesbeinen an nur gute Musik gehört und bin immer noch ein leidenschaftlicher Musiker. Versprochen hab ich mir natürlich nichts, aber helfen wollte ich den drei Weiblein. Als sie gestimmt hatten, und die Aeltliche, die die Harfe regierte, mit einer etwas blechernen Stimme anhub — sie sang rein, zitterte aber vor Angst — wollte mich schon ein Schauer überschleichen: ‚Du Esel, was hast du dir denn angetan!‘ Doch da setzte die Violine ein, zaghaft zuerst, dann immer sicherer, und nun tönte eine Stimme drein, so hell und rein, so sicher und überlegen: „Tirili-Tirili“, wie eine Lerche stieg die Stimme aus der jungen Brust, und ihr schloss sich die warme satte Stimme der Braunen mit der Violine an; nicht einmal der schüttere Alt der Dünnen, Langen und Aeltlichen machte sich schlecht. Ich muss meine Niedertracht schon ganz eingestehen, Lied um Lied und Stück um Stück liess ich die drei singen und horchte nur und horchte. Lauter gute Musik und alles ohne Noten, wie die Zigeuner. Es wurde immer besser, immer sicherer wurden die drei; das war eingesetzt wie auf einen Schlag, ein voller runder Ton, kein Schwanken oder Zaudern, Sapperment, das sass, mir zitterte das Herz vor Vergnügen!“
„Sind es Zigeuner?“ frug der Bukowiener.
„Keine Idee!“
„Dann sein sie Behmen!“ sagte glänzenden Anges und voller Stolz der blasse, sanftgescheitelte Kontrollor mit der Stulpnase.
„Ja, aus Mähren!“ schrien alle durcheinander, und der Tumult wollte sich nicht legen.
„Weiter, weiter,“ drängte endlich der bukowienerische Bahnbeamte. „Wos hoben sie gesungen?“ indem er sich förmlich einen Weg aus dem Gewieher und Gelächter herausbahnte.
„Keine Potpourris oder Opern oder so etwas. Viel altmodisches Zeug, kleine klassische Stücke, Lieder; sie musizierten alle drei immer eifriger. Die Schwarze, Kleine wurde ganz blass, ihr feines, schlankes Körperchen, das fast noch ein Kinderkörperchen war, bebte vor Hingebung, und der Braunen mit der Violine, einem schönen, üppigen Frauenzimmer mit ein paar dicken dicken Zöpfen und strahlenden Augen, stieg langsam die Röte vom Hals bis zur Stirne. Ich lockte sie dann alle drei noch auf den Hof des Bezirksgerichts herunter, die Herren kennen ja den grossen Hof, unter dem Vorwand, ich müsse hören, wie sich die Sache im Freien mache. Werden die Arrestanten eine Freude gehabt haben, als das Singen und Harfengerupfe drunten anfing und die Violine mit ihren schönsten Läufen dazwischen jubelte! Kein schlechtes Instrument übrigens, und mit Leidenschaft gespielt. Ich hab’s den armen Teufeln gegönnt, dass sie einmal einen Ohrenschmaus hatten. Kopf an Kopf drängten sie sich an die kleinen Fenster und hängten sich an die Gitter. Aber auch aus unsern k. k. Stuben, beim Hausmeister, beim Messner, zuletzt sogar beim Pfarrer fuhren die Köpfe durchs Fenster, männliche und weibliche, und alles horchte lächelnd wie bei einem Konzert. Nur ich stand mit strenger Amtsmiene und bösen Falten auf der Stirne und sah mir immer das kleine Mädel an, das so jubelnd sang wie eine Lerche: „Tirili-Tirili“. — Zuletzt begehrte ich noch: ‚Gott erhalte Franz den Kaiser‘, und schaut, es war wirklich schön, trotz der miserablen Kälte auf dem Hof wie auf einmal alles aus allen Fenstern mitbrummte, mitsummte, mitflötete, mitsang.“
„Patriotismus,“ sagte gedehnt und verächtlich der brennrote Doktor, der sich gern als Spötter gab, wenn’s billig war.
„Patriotismus! — Die liebe, wundervolle Melodie war’s, die uns mit fortriss! Der Pfarrer, die Arrestanten, die drei „inkriminierten“ Frauenzimmer, der Messner, das k. k. Gericht und der stellvertretende k. k. Bezirksrichter, alles war ein Herz und eine Seele, und so haben wir die Strophen des schönen Liedes dreimal gesungen und es war uns festlich und gut zumut dabei.“
„No und?“ drängte die Tafelrunde.
„Und? Ich sagte dann, nachdem ich mein Musikergewandl schnell wieder ausgezogen hatte und in meine Richtertoga geschlüpft war, sehr ernst: „Also den Beweis habt ihr erbracht; ihr könnt musizieren, wo und wie viel ihr wollt, und den Schein werd’ ich gleich ausstellen, kommt nur mit.“
„Weiter,“ drängte der Forstkommissär, der den ganzen Abend das Maul kaum aufgemacht hatte, und nahm die Pfeife aus den Zähnen.
„Droben Hab ich den amtlichen Schein ausgestellt und Hab verstohlen der Alten ein bisschen „pink pink“ in die Hand gemacht.“
„Der Alten?“ frug grinsend der graugrüne Kontrollor aus „Mähren“ mit der „mährischen“ Braut, deren Bild er gern in sehr vorgerückter Stunde zeigte, ein Bild, an dem besonders eine sehr dünne Taille und ein sehr mächtiger Busen auffielen.
„Was war’s nachher mit die Jungen?“ fragte ungeduldig der Doktor und spie auf den Boden, welchem Vorgang der Adjunkt etwas verwirrt, der Bukowiener mit zugekniffenen Augen folgte. „Ich muass ham zu meiner Frau!“
„Die Braune hat die Violine so sorglich in ein Tuch gepackt, wie es nur irgendein in sein Instrument verliebter Musiker tun kann —“
„Und die Klane, die Schwarze, die Geschmeidige?“ ereiferte sich der dicke Steuereinnehmer, spitzte den Mund dabei und tätschelte das blaue, zu einem länglichen Kiffen geformte Taschentuch liebevoll, wie wenn er das Körperchen der Kleinen zwischen seinen dicken, weichen Fingern hätte.
„Mein Gott, als ich der Aeltlichen den Schein und das Geld gab, machte sie Anstalten, mir die Hand zu küssen, und auch das reizende, kleine Ding kam unschlüssig auf mich zu, während die üppige Braune in ihrem schäbigen Mäntelein eine Verbeugung machte, wie eine Dame. Der Harfenrupferin wehre ich, und der Kleinen halte ich ein Richtergesicht entgegen. Da schaut sie mich mit ihren blitzenden Augen an, ganz schelmisch, springt den andern nach und wirft mir unter der Türe noch eine Kusshand zu und einen Blick — Augen hatte der Balg! —“
„Und Sie?“ Der Kontrollor legt sich halb über den Tisch.
„Ich?“ lacht der Adjunkt. „Nichts! Aus ist’s.“
„Gut Nacht!“ schreit der Doktor, reisst seinen Mantel vom Nagel und haut die Türe hinter sich zu.
Die andern sitzen stumm und glotzen entweder in ihre Gläser oder in die Luft.
„Rosele, Röschen, Rose von Brunnach, schnell einen Wein zur Stärkung,“ flötet der Kontrollor und versucht, Zeigefinger und Daumen weniger heftig, als innig und nachdrücklich in Roseles liebliche Rundung zu bohren: „Du bist ja doch die Rose von Brunnach!“
„Und Sie sein der Dorn von Brunnach,“ erwidert prompt die Rose, die gern geistreich und „fesch“ antwortet, und wackelt diesmal zur Abwechslung mit dem Kopf. „Lassen Sie aus, oder i bin glei’ ganz stuff mit Ihnen!“ schreit sie und schlägt den verlobten Kontrollor auf die Hand, dass es klatscht.
Damit ist der Bann gebrochen.
Der Herr Schreiber zieht langsam ein Spiel Karten an sich und beginnt es zu mischen, während der Sekretär zuerst leise, dann halblaut ironisch vor sich hinsummt: „Tirili-Tirili!“ Und bald summt und singt und grinst und johlt und zirpt und gröhlt die Runde: „Tirili-Tirili“, sogar der kleine Bahnbeamte, der schnell noch einmal auf ein Stamperle Schnaps herübergesprungen kommt und gar nicht weiss, um was es sich handelt, kräht bald übermütig mit: „Tirili-Tirili!“, um ja keine Gelegenheit zu versäumen, sich endlich als „smarten“ jungen Mann oder vielleicht gar als beschriebenes Blatt zu zeigen.
Der „Bukowiener“ aber macht zum erstenmal an diesem Abend seine Augen ganz auf, weiche, glänzende, etwas träumerische Augen; er hebt sein Glas und lässt es fest mit dem des Adjunkten zusammenklingen, indem er ihm unmerklich blinzelnd zunickt, einen Gruss, wie sich etwa zwei heimlich Verbündete grüssen.
Das Nönnlein vom Kloster Ladins
Hoch über dem Eisack, auf schroffem Fels, steht vas weisse Kloster und schaut mit vielen blinkenden Fenstern und mit drei wuchtigen Türmen über das Tal hin. Fast gemahnt es an eine Festung, die hellen Klostermauern an eine Kaserne, selbst die Kirche trägt kriegerisch ihr behelmtes Haupt.
Am Himmel drängen und jagen sich Frühjahrswolken, graue und weisse, runde, dicke, die wie Watte aussehen, und langgestreckte, zerrissene, die gierig wie wilde Wölfe in die anderen hineinfahren; dazwischen werden grosse Stücke grellblauen Himmels kaleidoskopartig hin und her geschoben.
Der Fluss geht mit gelber, träger, und doch eiliger Flut, an den Weinbergsmauern ist schon das Rebholz gehäuft, grün leuchten die Matten und wie Riesensträusse da und dort, unten und oben, einzeln und zu langen Reihen aufmarschiert, oder wie zu einem Feldlager über den riesigen Anger hin verteilt, die Obstbäume.
Darüber reihen sich, mit einem dicken Schneepelz angetan, die hohen Berge am Himmel. Zu ihnen steigen die Wälder hinauf, die einen lichtgrünen Schimmer von jungen Birken und jungen Lärchen tragen, wie ein leises, frohes Lachen; zu ihnen steigen die Matten, die Felder, die Weinberge steil empor, als ob alles nach oben sich ringe. Die Matten zum Berg, der Berg zum Felsen, der Felsen zum Wald, der Wald zu dem Schrofen, der Schrofen zum Schnee und zum Himmel.
Wenn die Sonne scheint, schiesst sie förmlich grell durch die Wolken, als wolle sie mit einemmal alles aus der Erde zaubern. Und die Menschlein krabbeln und hasten in den Wegen und Steigen, in den Weinbergen und Feldern, zwischen den grellgrünen Wiesen und braunvioletten Feldern, in die der Pflug tiefe Schrunden reisst. Von oben sieht es aus, als seien sie von einer Gigantenhand wahllos ausgestreut, und hasteten nun durcheinander, wie ein aufgestörtes Ameisennest, verwirrt und in zitternder Gier sich wieder zusammenzufinden.
Zug um Zug braust und rumort durch das Tal, aufwärts dem Brenner zu, abwärts nach dem Süden. Und die Amsel singt den ganzen Tag, den ganzen Tag.
Ein Nönnlein steht Tag für Tag in dem grossen Gang des weissen Klosters; am Fenster steht sie und drückt die Nase platt und schaut auf die eilenden Wolken und schaut auf die eilenden Züge; auf die krabbelnden Menschen schaut sie, die da unten so emsig schaffen, die hin und her rennen können wie sie wollen, lachen und schreien wie sie wollen; auch die Amsel hört sie, die so laut und beharrlich singt.
Ein warmer, fester, vertraulicher, ach so vertraulicher, heimatlicher Geruch von Dünger steigt ihr in die Nase: das Nönnlein schlürft förmlich diesen heimatlichen Frühjahrsgeruch; mit geblähten Nüstern, zitternd vor Heimweh, dicke Kindertränen in den Augen, presst sie sich ans Fenster.
„Nicht so sinnlich, Schwester Eudoxia!“ mahnen die vorbeihuschenden Nonnen, sanft die eine und scharf tadelnd die andere.
Zweimal hat man sie schon zur Aebtissin geführt, weil sie immer da oben steht und in die Welt hineinsieht, auf das winkelige, buckelige Städtchen, auf die Schienen, die sich dehnen, südwärts, der Heimat zu, auf die Züge, die vorüberpoltern und schwerfällige Rauchwolken langsam hinaufschicken. Die Aebtissin sprach gütige und dann harte Worte, trotzdem hat sie sich wieder an das Fenster geflüchtet mit ihrer grossen Sehnsucht.
Morgen darf sogar die Muttergottes auswandern! Morgen wird sie zu Tal getragen, mitten in den Anger blühender Obstbäume hinein, in das weisse Kapellchen, das sich, wie mit einem gestärkten Röcklein angetan, unten spreizt und sein grauschwarzes Dach mit dem kleinen Türmchen wie einen lustigen Kopfputz trägt. Die Muttergottes darf den Berg hinuntersteigen; morgen wird sie herabgenommen, feierlich führt man sie durch die Kirchenpforten, die Klostertüre ist auf, das grosse Tor wird geöffnet, die Mauern tun sich auseinander. — Es gibt einen Weg hinunter über den steilen Fels, es gibt einen Weg ins Städtlein, es gibt einen Weg — — einen Weg in die Heimat!
„Pink! Pink!“ machen da unten die Maurer. Sie bereiten der Himmelskönigin den Weg, sie weissen und kalken die Wände, sie arbeiten am Tor; das Nönnlein hört sie lachen und schwätzen und singen. Ein paar junge Kerle sind darunter, Italiener, ein halbverwehter Tabakgeruch, eine verwischte Welle von Gelächter und derben Reden kommt herauf. Nun ist alles wieder still, sie sind fort. Sie sind fort und haben das Tor aufgelassen!
Einen Augenblick steht das Nönnlein mit brennroten Wangen, die Hand, eine derbe, breite Bauernhand, auf das rauhe Gewand gedrückt; mit runden, hastigen, bedrückten Kinderaugen sieht sie blitzschnell um sich, nach rechts und links, den langen Gang hinauf und hinunter — und schon fliegt sie über die Stiege, den zweiten Gang, die zweite Stiege, den untern Gang, die breite Treppe, das Tor, die Pforte. — Grosser Gott, sie sind offen! Nun noch der Hof, das äussere Tor, und hinunter, hinunter, fliegt das dunkle Nonnenkleid. Steine poltern unwirsch nach, Geröll schiesst in die Tiefe, das Nönnlein hört nichts; sie hat nur das Sausen und Brausen ihres erregten Blutes im Ohr; sie rennt, dass sie ordentlich dicke, glühende Backen kriegt, ihr ist, als sei die wilde Jagd hinter ihr her, sie wieder einzufangen. Immer schneller wird ihr Lauf, der Schleier weht wie eine Flagge des Aufruhrs hinter ihr drein, fängt sich an einem Rosenstrauch und wird weggezerrt, dass er in Fetzen geht. Die kleine Nonne sieht nicht Weg noch Steg und dennoch fliegt sie in ihrem Taumel sicher vorwärts, über Nebenpfade, die sie nie betreten, überquert Wiesen, um den Weg abzukürzen, findet schmale, schwindelnde Pfade an der Felswand hin.
Abhänge, Felder, Bäume, Gärten, Häuser, Scheunen, Hecken, alles rast an ihr vorbei. Menschen bleiben stehen, rufen, schreien, lachen hinterdrein. Hinunter, immerzu hinunter. Sie schiesst in die engen Gassen, wie ein Schemen drückt sie sich in der Sonne an der Mauer hin, klein, dunkel, verängstigt. Kaum findet sie noch Atem, in vollem Lauf über den Platz zu rennen; da ist schon die Brücke, der Fluss, den sie so oft von oben gesehen, die weisse, staubige Strasse, die im Bogen nach der Bahn zieht, die Schienen, Herrgott die Schienen! Ihr ist’s, als müsse sie in die Knie sinken, gerade da von dem Bahnhof, im Staub der Strasse, und müsse ihn küssen, diesen Staub, und dann fortstürzen über die Schienen weg, geradewegs in den Zug hinein, der Heimat zu!
Da gibt’s ihr einen Ruck, dass sie mitten im Staub der Landstrasse, wie erstarrt, stehen bleibt. Tut sich nicht die Erde vor ihr auf? Es würgt sie in der Kehle und nur ein heiseres, fast bellendes, kurzes Schluchzen kommt heraus. In ihren Ohren ist ein Klingen und Läuten, ein Poltern und Dröhnen, als brause der Zug schon heran; sie steht vor der Freiheit; einen finsteren, feuchten, endlos langen Gang hat sie durchkeucht, nun liegt weit und licht das ganze Land vor ihr. Soll sie wieder umkehren müssen, wieder diesen engen, dunklen Gang zurücktappen, immer weiter, immer weiter? Wie mechanisch streckt sie die leeren Hände aus — sie muss zurück, sie werden sie zurückschleppen, sie hat kein Geld!
Das ganze, kleine, rundliche Nönnlein zittert vom Kopf bis zu den Füssen; einen Augenblick macht sie eine Bewegung, als wolle sie den Weg wirklich nach oben nehmen; dann hebt sie mit einem Ruck das heilige Gewand, wie ein Pfeil ist sie in der Restauration neben dem Bahnhof verschwunden, hat auch gleich mit echtem Bauernspürsinn die Küche gefunden und steht dort, hochrot, von Schweiss überströmt, mit zur Bitte gefalteten Händen vor der Wirtin.
Die Wirtin ist keine Wirtin „wundermild“, keine jener runden, gutmütigen, behäbigen Tiroler Wirtinnen, deren Herz man erweichen kann; lang ist sie und hager, die Knöpfe ihres dunkelgrauen Kleides verschliessen einen strengen und kargen Busen. Sie trägt ein Netz auf dem Kopfe und ein schwarzes Samtband davor, die wenigen Haare sitzen wie numeriert, jede Falte ihrer Schürze sieht nach Eigensinn und Widerstand aus. Das Nönnlein erkennt mit Schrecken an den Runen, in die sie ihr Gesicht legt, dass sie genau weiss, was sie dem Ruf ihres Hauses, das ein „chrischdliches“, und überhaupt, was sie der heiligen katholischen Kirche schuldig ist. Nicht dass sie etwa schimpft oder überrascht tut, dass ihr das Nönnlein ins Haus geweht wurde, bewahre! Sie stemmt nur die knochigen Hände in die Seite, dass die Ellenbogen eckig, wie ornamental zu ihr gestimmte Henkel an beiden Seiten ihres schlanken Leibesgefässes abstehen, und betrachtet die Zitternde von oben bis unten, als hätte sie all ihr Lebtag noch keine Ordens „schwäschder“ gesehen.