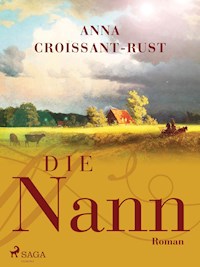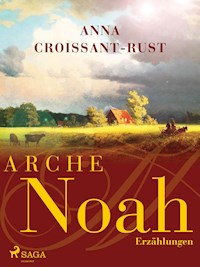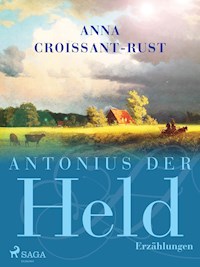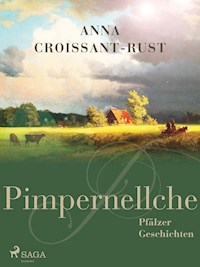
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Band versammelt die drei Erzählungen Pimpernellche, Nikolaus Nägele sowie Duo, Trio und Duo. Die Titelgeschichte, der mit Abstand längste der drei Texte, erzählt die Geschichte der Nelly Heß, genannt Pimpernellche, "ein kleines, altgescheites, naseweises, phantastisches und dabei doch überaus schüchternes Persönchen". Doch die scheinbare Idylle ihres Kinderlebens hat ein Ende, als der Vater plötzlich tot im Bett liegt und sich herausstellt, dass sein Geschäft "kapores" – bankrott – ist. Wie gut, dass Pimpernellche in ihrem Vetter Franz einen treuen Freund hat … 1901 wurde Pimpernellche als erstes Werk der bedeutenden naturalistischen Autorin in der hochrenommierten Literaturzeitschrift Die Insel abgedruckt. Anna Croissant-Rust (1860–1943) wurde in Bad Dürkheim geboren und lebte lange Jahre in München sowie in Ludwigshafen. In München hatte sie Kontakte zur Schwabinger Künstler- und Literatenszene sowie zur Zeitschrift "Die Insel" und zu dem Verleger Georg Müller. Ihre 1890 erschienene Erzählung "Feierabend, eine Münchner Arbeiter-Novelle" wurde als "Meisterwerk des Naturalismus" gefeiert und machte die Dichterin weithin bekannt. Sie war das einzige weibliche Mitglied der 1895 von Michael Georg Conrad gegründeten Gesellschaft für modernes Leben. Ihre Erzählungen und Romane sind von hoher sozialer Einfühlungsgabe und humorvollen Charakterzeichnungen geprägt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 159
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anna Croissant-Rust
Pimpernellche
Pfälzer Geschichten
Saga
Pimpernellche
Pimpernellche war nur ihr Schmeichelname, der Vater hatte sie so getauft und niemand nannte sie mehr anders; eigentlich hiess sie Nelly, Nelly Hess und war ein kleines, altgescheites, naseweises, phantastisches und dabei doch überaus schüchternes Persönchen, für das der Name nicht schlecht passte. Er kam nicht etwa daher, dass sich Nelly viel im Garten herumgetrieben hätte, wo das wohlschmeckende Kräutlein Pimpinell neben den anderen Salatkräutern gedieh, dem feinblättrigen Estragon und dem rauhen Borasch, er gefiel eben dem Vater und war gar nicht verwunderlich, wenn man das Kind kannte. Es war etwas Erfahrenes, Überlegtes in seinem Wesen, das sich sehr gut durch das „Pimper“ ausdrückte, und wieder etwas Weiches, Ratloses, dem das „Nellche“ entsprach. Stirn und Nase sahen ganz resolut aus, letztere ein keckes Stumpfnäschen, aber Kinn und Mund zerflossen hilflos. Ganz gewiss keine Schönheit, das kleine Pimpernellche, und doch unter den Vieren Vaters Liebling, die Älteste, die Vernünftigste, und in seinen Augen auch die Liebenswerteste.
Nein, vom Garten kam der Schmeichelname nicht, den sah Pimpernellche selten genug; sie hatte sich schon früh gewöhnen müssen, der Mutter die meisten Pflichten abzunehmen. Diese sass die meiste Zeit im Lehnstuhl, durch eine Krankheit am Gehen verhindert, die ihr selbst als kein grosses Kreuz erschien, weil sie ihr erlaubte, still zu sitzen, die Arme bequem auf die Lehnen zu legen und zuzuschauen, wie andere arbeiteten. Und es bekam ihr sichtlich, so zu leben, ihr Teint und ihre Hände, die sie sehr liebte, blieben blütenweiss, und ihr Körper wurde schön rundlich, was immer die Sehnsucht ihrer mageren Mädchenjahre gewesen war.
War Pimpernellche dem Vater gegenüber die Liebenswürdige, Verständige, so war sie den zwei Brüdern, den „Buwe“ gegenüber immer hartnäckig und widerhaarig, und stets tobte zwischen den dreien der wildeste Kampf, von seiten des männlichen Teiles mit Knüffen und Püffen, von seiten des weiblichen mit spitzen Redensarten, weisen Sprüchen und gelegentlicher Heulerei geführt. Trat der ernste Vater ins Haus, so verstummte alles, nur vor der Mutter gabs oft hässliche Zänkereien, für die immer Pimpernellche verantwortlich gemacht wurde, denn Mutter und Brüder lehnten sich gegen die Rechte auf, die ihr vom Vater eingeräumt wurden, und bildeten eine wortlose, aber sehr merkbare Verschwörung unter sich.
Immer sollte Pimpernellche nachgeben, immer hörte sie dasselbe von der Mutter: „Du bist die älteste, gieb du nur nach.“ Das Nachgeben war gerade nicht ihre Sache, es stimmte schon eher zu ihren Pflichten, dass sie den „Buwe“ weise Reden hielt und als leuchtendes Beispiel eines einwandfreien Lebenswandels sichtbar und merkbar vor ihren Augen umherging. In der Schule war sie stets unter den ersten, was man den „Buwe“ niemals nachsagen konnte, und hatte sie im Zimmer bei der immer schläfrigen Mutter zu bleiben, um lange Strümpfe und kurze Socken zu stricken, so that sie’s ohne Murren, obwohl sie auch mit den andern gern getollt hätte. Nun dafür sorgte die Mutter schon, dass ihr das Tollen verging, sie hielt sie mit Launen und Wünschen und Befehlen so in Atem, dass Pimpernellche froh war, wenn sie nur einmal Ruhe gab. Freilich, während das Mädchen in der Schule war, schlief sie, was ihre liebste Beschäftigung war, kam die Kleine aber heim, so ging der Tanz los. Und dabei durfte sie nicht allen Wünschen nachgeben, der Vater erlaubte es nicht, denn die Mutter wünschte unvernünftig und kehrte sich gar nicht daran, dass sie schlecht standen, so oft’s ihr auch der Vater sagte. Mehr wie einmal hatte es Pimpernellche erlebt, dass sie sich einfach die Ohren zuhielt und zu schreien anfing: „Du hoscht mich geheirat’t, unn mir versproche, mich uff de Händ zu trage, des muscht du halte. Ich will nix Wüschtes höre, ich kann’s nit, geh fort, geh nor fort!“
Alles in ihrem unverfälschten Pfälzer Dialekt, der den Vater zur Verzweiflung bringen konnte. Dass er nicht gern in den „Gemächern“ der Mutter war, auch zu Haus nicht gerade mit freudestrahlendem Gesicht herumging, fand Pimpernellche selbstverständlich. Sie war die einzige, die bei ihm sein durfte, wenn er abends in seinem Zimmer arbeitete, und wenn er oft dasass, den Kopf in den Händen bergend, und ins Leere stierend, nahm ihr kleines sommersprossiges Gesicht den Ausdruck sorgender Wichtigkeit und ängstlicher Ratlosigkeit an. Sahen’s denn die andern nicht, dass er sich kümmerte?
Sie sah’s doch! Über ihre Märchenbücher schaute sie weg und las ihm die Sorgen von der Stirne ab. Aber sie hatte auch gleich einen Trost bei der Hand. Sie sollten nur warten, bis sie einmal gross war, und was in ihr alles steckte! In ihrem phantastischen kleinen Kopf, der mit Märchen und Geschichten vollgepfropft war, gingen die wunderlichsten Pläne durcheinander, die sie niemandem verriet, die sie in ihre Strümpfe mit einstrickte und in ihren Schulranzen mit einpackte. Sie gewöhnte sich, den Kopf wichtig und sorgend auf einer Seite zu tragen und den Leuten bekümmerte Gesichter anzumachen, dabei zwinkerten aber ihre Augen so verheissungsvoll, wie wenn sie sagen wollte: „Lasst nur mich erst wachsen und gross sein!“
Nicht, dass sie etwa immer voll Ernst und Strenge und Thätigkeit gewesen wäre, sie war sogar zu Zeiten wieder von krampfhafter Lustigkeit befallen, aber alle ihre Äusserungen der Lebensfreude fielen so kläglich plump und unbeholfen aus, dass die andern sie nur hänselten und sie dann mit zornrotem Kopf davonlief.
Nur einer störte sich nicht an ihren eckigen Sprüngen und blödsinnigen Lachausbrüchen, die kein Ende nehmen wollten, und an ihrem unmotivierten Kichern — das war Vetter Franz, der ihr altgescheites Wesen sowohl wie ihre Kummergesichter mit dem ihm angeborenen Phlegma übersah und sich lieber von ihr herumzerren liess als von ihren Brüdern braun und blau schlagen.
Sie waren Freunde und er empfing sie so manchen freien Nachmittag in dem alten Patrizierhause. War die erste, wichtigste Frage „Is die Mamme drinn?“ mit Kopfschütteln beantwortet, so begannen sie ihr Wesen in dem grossen Hause, das von oben bis unten nicht vor ihnen sicher war. Auf dem Speicher spielten sie Komödie, wobei Franz allerdings meistens passiv blieb, und im Keller Räuber bis „se“ heimkam und die beiden aufstöberte. Erwischte sie dann Pimpernellche bei ihrem langen roten Zopf, so blieb die Hand gewiss nicht dort, sondern machte sich nachdrücklich über den Kopf her, und ihre Hand spürte man! Pimpernellche zog sich in richtiger Erkenntnis der Sachlage immer gern aus ihrem Bereich zurück und betrat nie das Haus, wenn auf ihre durch die Thürspalte geflüsterte Frage: „Is se drinn?“ Franz mit umwölkter Stirn bejahend antwortete.
„Se“ war natürlich Franzens Mutter, eine hagere, starkknochige Frau mit gelbem Teint, die mit Vorliebe grüne und lila Hutbänder trug, was ihre Hautfarbe sehr erhöhte. Sie wurde von Pimpernellches Brüdern „Orangenkönigin“ genannt, von der Mutter ihres Geschmackes wegen belächelt und von Franz und seinem Vater mit ziemlich hartnäckiger Schweigsamkeit behandelt, von allen aber eigentlich gefürchtet. Raste sie zu irgend einem Zimmer hinein, so schwiegen Mann und Kind, und hörte man ihren derben Schritt im Hausgang, so wurden die Dienstboten mäuschenstill.
Zur Zeit, als Pimpernellches Vater anfing mit schweren Sorgen herumzugehn, zerkriegte sich die Freundin und Kousine mit dem Freund und Kousin Franz. Eines Nachmittags nämlich, sie tragierte ihm eben eine grosse „königliche“ Szene oben auf dem Speicher vor, frug er sie plötzlich, von Kauen erschwert — er kaute immer an etwas, diesmal an einem „Schmeerche“, einem dicken Stück Brot mit Eingemachtem — „du, isch wohr, ehr gehn kapores, ehr machen bankrott?“
Leichenblass, heulend und wortlos warf sie ihm ihre Papierkrone an den Kopf und raste über die vier Treppen hinunter, über die Strasse und die heimischen Stiegen hinauf, immer noch angethan mit dem langen rotgeblumten Kattunvorhang, der hinter ihr dreinschleppte, in den sie sich verwickelte und die Treppen zur elterlichen Wohnung hinauffiel, noch jämmerlicher schreiend. Sollte sie es der Mutter sagen? Um keinen Preis der Welt. Sie mochte ärgerlich und immer ärgerlicher fragen: „Was hoscht dann?“ ihr sagte sie kein Wort. Oder etwa den Brüdern, die sie wie besessene Derwische umtanzten und sich in die Finger bissen vor Vergnügen über ihren Aufzug? Nein, das trug sie allein. In ihren Kattunvorhang gewickelt, sass sie auf einem Schemelchen am Ofen und liess die Mutter schelten und die „Buwe“ lachen.
Solch eine Roheit! Das hätte sie von Franz nicht erwartet. „Ehr gehn kapores“. Kapores hatte er gesagt! Dieser Ausdruck! Und das war doch gar nicht wahr, nein, so schlimm stand’s gewiss nicht. Am Abend stellte sie sich mit Herzklopfen beim Vater ein und nachdem sie lange stumm bei ihm gesessen und vor Aufregung Gesichter geschnitten hatte, traute sie sich endlich mit ihrer grossen Frage heraus: „Machen wir Bankrott?“
„Wie kommst du zu der Frage?“
Sie hatte gar nicht geglaubt, dass der Vater so bös aussehen könne! Die zwei dicken Falten auf der Stirn! Hätte sie doch lieber nicht gefragt! Das Weinen würgte sie und sie rutschte vor Scham und Ratlosigkeit auf ihrem Stuhl hin und her. Am Ende hatte sie dem Vater viel weher mit ihrer Frage gethan wie Franz ihr!
Und sie bot solch ein Bild des Schmerzes, dass der Vater sie auf die Kniee nahm, ihr zuredete und sie zu beschwichtigen versuchte, als ihre Thränen nun wirklich in ausgiebiger Weise rannen. Nein, es war nicht gar so schlimm, wenn es auch nicht gut stand. Sie und die andern alle sollten sich nur merken, dass sie sparen mussten, und alle sollten ihre Pflicht thun, wie er sie that.
Pimpernellche hielt sich steif auf den Knieen des Vaters und traute sich nicht seine Liebkosungen zu erwidern, nur als er ihr sagte: „Du bist ja mein verständiges Mädchen“, nickte sie heftig mit dem Kopf, denn all ihre Pläne fielen ihr wieder ein.
„Ich will helfen“.
An Franz ging sie wie ein Automat vorbei, nur drehte sie den Kopf zur Seite. Er hatte sie zuerst in gutmütiger Weise wieder angeredet, doch da sie ihn keines Blickes würdigte, bespöttelte er sie nach Jungenart wie die andern.
Also Franz war verloren, und die „Buwe“ freuten sich noch dessen und lachten sie aus. Jetzt blieb ihr nur mehr die kleine Schwester, das goldlockige Sannchen, das sie sowieso schon zärtlich geliebt hatte.
Von nun an konzentrierte sich alles auf die Kleine, kein Opfer war ihr zu viel, sie versagte sich alles und gab dem kleinen, von allen verzogenen Nesthäkchen, was sie nur entbehren konnte.
Es gehörte zu ihren grössten Freuden, die kleine Schwester im weissen Kleidchen in den Park zu führen. Sie hatte ihr von ihren Sparpfennigen eine blaue Schärpe gekauft und war vor Entzücken ausser sich, wenn sich alles nach dem reizenden Kinde umdrehte, das jeden anlachte und seine Goldlocken kokett über die Schultern warf, das zierliche Knixe machen konnte und die Füsschen setzte wie eine Prinzess. Da stand Pimpernellche daneben in seiner jungen Ältlichkeit und war so stolz, wie wenn sie die Mutter Sannchens gewesen wäre.
Die Kleine ward nicht nur von Pimpernellche, sondern auch von den Buwe und von der Mutter erst recht verzogen, und war zu Zeiten ein recht garstiges, eigensinniges Kind, das ausser sich geraten konnte, wenn es nicht sofort alles bekam, was es begehrte, ganz wie die Mutter.
Vor dem Vater hatte Sannchen Furcht, ihm zeigte es nur seine liebenswürdigen Eigenschaften und verstand es, ihm so zu schmeicheln, dass er der reizenden Kleinen kaum etwas abschlagen konnte. Nur in der letzten Zeit wollte er sie nicht sehen.
Spät am Abend kam er vom Geschäft heim und schloss sich in sein Zimmer ein, die halbe Nacht arbeitend. Das eine oder andre Mal erlaubte er Pimpernellche bei ihm sitzen zu dürfen, doch bedrückte sein düsteres, sorgenvolles Wesen das Mädchen so, dass es oft still aus dem Zimmer schlich und in seinem Bette weinend einschlief.
An einem Novembermorgen in aller Frühe fuhr Pimpernellche erschreckt aus dem Schlaf in die Höhe. Es war einer jener grauen, schweren Tage, wo die Frühlichter braunrot brennen und dicke Nebel in den Strassen liegen, die klebrig und schwarz sind. Rieke, das Dienstmädchen, stand mit einer qualmenden Lampe vor dem Bette der Mutter und suchte sie zu wecken.
Riekens gutmütiges, dummes Gesicht war von Thränen überströmt, ihre Hände zitterten, und sie brachte nichts heraus wie: „Der Herr, der Herr!“ Die Mutter wehrte schlaftrunken und scheltend ab, da sprang Pimpernellche mit einem Schrei aus dem Bett: „Der Vater, der Vater!“ und lief im Hemd nach seinem Zimmer, alle Thüren hinter sich auflassend. Bald erfüllten ihre Rufe und ihr lautes, schmerzliches Weinen das Haus. „Mutter! Mutter!“ zum ersten Mal rief sie die Mutter um Hilfe und klammerte sich an sie an, als diese endlich verstört und selber weinend wie ein Kind nachkam.
Da lag der Vater tot und kalt auf dem Divan, ganz wie wenn er schliefe, die grosse Lampe mit dem grünen Seidenschirm brannte noch wie sie die ganze Nacht gebrannt, die Bücher lagen aufgeschlagen und ein Glas Wasser stand halb ausgetrunken auf dem Tisch.
Das kleine Dienstmädchen erzählte unter Schluchzen, dass der Herr einmal in der Nacht geläutet habe, dass es ihm nicht gut gewesen sei, dass sie aber niemanden hätte wecken dürfen. Doch weil er so schlecht ausgesehen habe, sei sie wach geblieben und habe vorhin nachgesehen, und da sei er schon ganz kalt dagelegen.
Pimpernellche starrte das graugelbe Gesicht des Toten an. Konnte das sein? Gestern noch war sie bei ihm gesessen, und er hatte sie scherzend zu Bett geschickt und heute lag er tot? Es konnte nicht sein, es konnte nicht sein! So grausam durfte doch Gott nicht strafen!
Sie schleppte sich in die Schlafkammer zurück, wo die in Eile verlassenen Betten wirr durcheinander lagen, auf den Knieen liegend vergrub sie den Kopf in die Kissen und klagte und schrie und verzweifelte an Gott und beschwor ihn wieder: „Lass es nicht wahr sein, lass es nicht wahr sein!“
Sollte sie denn gar Keinen haben? Und sie rief in leidenschaftlichen Tönen nach dem Toten, sie sah ihn vor sich und bedeckte ihn mit Küssen. Wie ein ungestümer Quell brach ihre versteckte scheue Zärtlichkeit hervor, ein ungeheueres Schuldgefühl peinigte sie, dass sie dem Toten nicht mehr Liebe gezeigt, und sie presste ihr flammendes Gesicht in die kalten Bettlaken, während ihr magerer Körper vor Kälte zitterte.
Draussen fiel lautlos ein wässriger Schnee, der sich an die Fenster legte und träge wieder zerfloss; zögernd kam die Helle in einem breiten Streifen durch’s Fenster gekrochen.
Plötzlich überkam das vor Frost zitternde Kind ein ungeheures Mitleid mit sich selbst, mit dem armen Kinde, dem man alles, alles nahm, dem nichts blieb wie Härte und Lieblosigkeit, sie fühlte ein Bedürfnis, sich das zu sagen, sich gleichsam zu schlagen mit dem eigenen Schmerz, und fühlte eine Genugthuung vor Frost erstarrt da zu liegen in Leid und Weh. Zuletzt kroch sie aber doch in die Kissen und als sie wieder warm war und drüben die Stimme der Mutter in den schrillsten Tönen klagen hörte, zog sie sich an, um zu ihr zu gehn.
Das war nun das vernünftige, altgescheite Pimpernellche wieder, das die Mutter tröstete; nicht wie ein Kind die Mutter, sondern wie eine Mutter ihr Kind. Nicht mit weichen Worten und Liebkosungen, sondern klar und vernünftig suchte sie ihr zuzureden. Aber das half alles nichts. Sie schrie nur immer: „Er war immer so, alles heimlich, und jetzt macht er’s Widder so! ach Gott! ich überleb’s nit! Nit ämol im Bett g’storbe! und die Buwe sin doch aach noch da!“
Ja freilich waren die noch da und mitten im Studium und sollten nun weiter lernen, obwohl sie faule, nichtsnutzige Schlingel waren, die einer strengen Zucht bedurft hätten. Und sie war auch da und wollte lernen und zwar noch recht viel und Sannchen — oh, sie wusste alles!
Wer frug denn jetzt danach? Wenn nur der Vater gelebt hätte, lieber hätte sie nun geputzt und gefegt ihr Leben lang, aber da trugen sie ihn fort und liessen sie mutterseelenallein für immer, denn das fühlte sie, die Mutter und die Brüder waren ihr nicht näher gekommen durch den Tod des Vaters.
Den ersten Tagen des leidenschaftlichen Schmerzes folgte eine Zeit dumpfer Trauer und Leere. Es war Pimpernellche, als hätte sie nichts mehr auf der Welt zu thun, bis der Vormund kam, der die ganze Familie versammelte, schliesslich aber alle hinausschickte und nur Pimpernellche behielt, weil er mit der konfusen Mutter und den Buwe, die ihn nur stier und schläfrig anschauten, nichts anfangen konnte.
Der Vormund war Franzens Vater, ein gutmütiger Mann von etwas phlegmatischem Temperament, der nur durch den Willen seiner Frau zu irgend etwas von Wichtigkeit angetrieben werden konnte, und der sich ohne ihre Zustimmung kaum einen Entschluss zu fassen getraute. Die Rolle des Vormunds machte ihm nicht nur keinen Spass, sondern beängstigte ihn. Entschlüsse fassen, dirigieren müssen war nicht seine Sache und jemandem Schmerz zufügen noch weniger. So sass er missmutig und beinahe verlegen Pimpernellche gegenüber und versuchte ihr die Verhältnisse klar zu machen.
Das kleine Persönchen, noch schmächtiger und eckiger aussehend in dem schwarzen Trauerkleide, hörte mit leidlicher Fassung die umständlichen Auseinandersetzungen des Vormundes an. Also es stand schlimm. Etwas würde ja wohl bleiben vom Verkauf des Geschäftes, vom Vermieten des Hauses, natürlich müssten sie sich auf das alleräusserste einschränken, die Wohnung verlassen und die kleinste im Haus dafür nehmen, das Dienstmädchen fort thun — Pimpernellche sprang mit einem Schrei auf. Das ging sie an. Das hiess nichts anderes, als sie müsse den Dienstboten machen, weg vom Institut, von allem Schönen und Hohen, alle, alle Träume begraben! —
Sie fing bitterlich zu weinen an, so dass der Vormund versprach, er wolle sich alles noch einmal überlegen, genau berechnen. Aber nach ein paar Tagen kam er wieder und nun war’s für immer aus, denn „sie“ wollte es durchaus nicht.
Pimpernellche war in diesen Tagen ein paar Stufen von der erträumten Leiter ihrer Herrlichkeit heruntergestiegen. Sie legte mit tragischen Geberden die „Schauspielerin“ beiseite, die sie bis jetzt als „hehres Ziel“ vor Augen gesehen, und machte sich daran, die Kosten für einen Gelehrtenberuf zu berechnen, denn etwas Besonderes musste doch aus ihr werden, das war von jeher bei ihr festgestanden. Aber auch dieser schöne Wahn sank und sie stieg tiefer und tiefer. Sie musste wohl Erzieherin oder Lehrerin werden. So brachte sie also dies grosse Opfer, wenn auch von Zeit zu Zeit ihre Phantasie wieder aufschäumte und sie höher hob, sie blieb doch zuletzt bei der Lehrerin und den Kampf wollte sie mit dem Vormund ausfechten.
Es wurde aber gar keiner, denn gegen „ihren“ Willen und „ihre“ Meinung war nichts zu thun. Wie hatte sie nur glauben können! Überdies wusste ihr der Vormund ihre Pflicht so klar zu machen und behandelte sie ganz als Erwachsene, dass sie, die eine gute Portion Pflichttreue vom Vater geerbt, sich ergab. Natürlich drapierte sie sich in dieses ihr grosses Märtyrertum und es war ihr ein Sporn, vom Vormund quasi als Haupt der Familie behandelt zu werden.
Nur hatte sie sich’s doch leichter gedacht. Die ewigen Schimpfereien und Heulereien der Mutter, die die Wohnung nicht verlassen und keine ihrer Bequemlichkeiten entbehren wollte, die Brüder, denen es gar nicht einfiel, sich einzuschränken, und die kleine Schwester, die ganz naiv weiter begehrte, verleideten ihr alles und nahmen ihr das bischen guten Willen und verwandelten es in Bitterkeit. Sie war sich klar, dass sie Jahre zu diesem Dasein verdammt war, und dass es ihr kaum gelingen würde sich davon loszumachen.