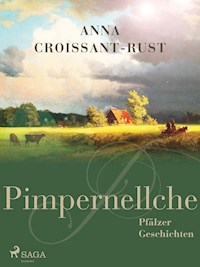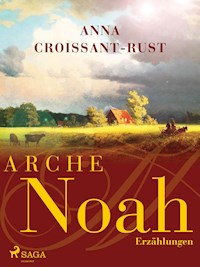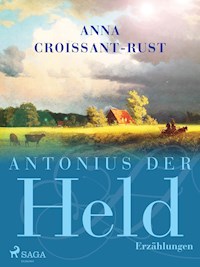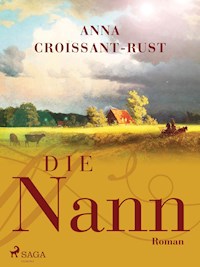
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Kuchler-Anderl hat soeben seine zweite Frau begraben. Hinterlassen hat ihm die "welsche Marietta" aus Italien ihre kleine Tochter, die Nann. Doch der Vater glaubt nicht, dass der "blonde Balg", der so gar nicht in das kleine Tiroler Bergdorf passt, sein Kind ist und er lässt das die Kleine auch spüren. Die überforderte Tochter Juli muss nun die Rolle der Ersatzmutter übernehmen und die kleine Nann gegen "den bösen Vater" in Schutz nehmen. Für Juli und Nann beginnt ein hartes Leben. Noch schlimmer ergeht es ihrer Schwester Moidl, die der jähzornige Vater vom Hof gejagt hat. Anna Croissant-Rust erzählt mit tiefer Menschlichkeit und bemerkenswertem Realismus die Geschichte vom entbehrungsreichen Bergbauerleben zu Beginn des 20. Jahrhunderts.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 373
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anna Croissant-Rust
Die Nann
Roman
Saga
1
Langsam kam der Kuchler-Anderl den sonnigen Abhang herauf gegen sein kleines Haus zu. Alle paar Schritte blieb er stehen und schaute umher. Er trug seine Feiertags-Montur und war rasiert, denn er hatte gerade sein Weib eingraben lassen, das zweite, die Marietta. Drunten in St. Jodok sassen die andern noch beim Leichentrunk, seine Mädeln, der Bub, der Anderl, und ein weitschichtiger Vetter aus der Freundschaft. Das heisst aus der seinen, denn das Weib war eine Welsche gewesen, und von ihrer Sippschaft wollte er nichts wissen. Es wäre wohl besser gewesen, er hätte von ihr, von der Schwarzen, auch nie etwas gewusst!
Musste ihn denn der Teufel auf Arbeit über den Brenner führen und musste er gerade in dem Wirtshaus hängenbleiben, wo sie den Roten schenkte? Alle hatten es ihm gesagt, es wird nichts Gutes daraus mit der welschen Hexe – er hatte sie kaum ein Jahr, und schon lag sie auf dem Schragen, und in der Wiege schrie der kleine Balg, das Mädel mit den weissen Haaren.
War das je bei den Kuchlers vorgekommen, dass sie Kinder hell von Haut und Haar bekamen? Braun waren sie, die Haut wie Leder, schwarz und straff das Haar; er war so, seine Geschwister alle und die Kinder von der Ersten.
Kuchlergesichter, dunkle, zerknitterte Gesichter, knochig, hager, mit schwarzen Augen und buschigen Brauen, der Körper langgestreckt und sehnig. Nur der Balg war anders, der Marietta ihr Kind. Schneeweiss lag’s drinnen, die Haare waren in Locken geringelt, der Mund klein, alles zart und fein.
Anderl spuckte heftig aus und trat gleich mit dem Fuss auf die Stelle im niederen, borstigen Grasboden.
Ja, wenn sie keine Kellnerin gewesen wäre und wenn die Fremden nicht in sein Haus gekommen wären, sie zu besuchen! Sein Kind ist’s nicht, und wenn sie noch einmal an sein Bett kommt in der Nacht und es ihm schwört und noch einmal darüber stirbt, er glaubt’s nicht, er nicht! Genau so wird er’s wieder machen, sich umdrehen, der Wand zu, und sie schreien und heulen lassen.
Dem Kuchler-Anderl ist heiss geworden; er wischt sich den Schweiss aus dem borstigen Haarschopf und bleibt stehen, keuchend und müde. Seine Augen irren an den kahlen Felswänden hin und her, und seine Gedanken werden wirr.
Nicht einmal zum Sterben ist er vor ihrem Bett gestanden, sollte er sich denn von seinen grossen Kindern auslachen lassen? Dass die ihn verlachten und verhöhnten, dass er sich das junge Weib ins Haus geholt, sah man ihnen ja von weitem an. Wenn sie’s auch nur verstohlen taten, denn vor ihm getrauten sie sich nicht, da kannten sie seine Fäuste und seinen Stecken zu gut. Freilich, in den Ecken zusammenhocken, wenn sie einmal heimkamen, scheele Augen nach ihm hin machen und heimlich lachen und wispern, das konnten sie. Und erst das Ellbogenstossen und Indie-Seite-puffen, als sie den blonden Balg sahen!
So rächten sie sich für alle Schläge, die ihr Rücken empfangen, für alles verschluckte Weinen, für ihr ganzes armseliges Leben bei ihm. So sagten sie. Wenigstens die Grossen. Die hatte freilich die Marietta gleich aus dem Haus gehabt, und ihm war’s recht so. Wie hätte denn das auch gut getan, das junge Weib und die grossen, verstockten Kinder! Er wurde so oft genug daran erinnert, dass er grau zu werden anfing, wenn er das Weib mit den zwei Jüngsten, die zu Haus geblieben waren, scherzen und lachen hörte. Der alte Anderl setzte sich auf den Rasen nieder, umfasste seine mageren Knie mit den Händen und stierte vor sich hin.
Jawohl, das hatte es ihm angetan, ihre Fröhlichkeit und Genügsamkeit. Mit einem bunten Lappen war sie zufrieden, mit einem Stück Band, zu essen verlangte sie fast gar nichts und richtete das Haus zusammen, dass es eine Art hatte.
War das eine Wirtschaft gewesen, früher, als die Erste starb, Herrgott, wenn er daran dachte!
Die Faulheit von den zwei grossen Mädeln, der Schmutz, das Essen! Und dabei meinten sie, das Geld solle nur so herunterschneien; immer geben, geben, dazu wäre der „Voda“, der Kuchler-Anderl, doch da, meinten sie. Aber da kamen sie schön an bei ihm! Noch jetzt lachte er ingrimmig vor sich hin, wenn er daran dachte. Was er ihnen zum Leben daliess, wenn er auf Arbeit fortging, war gerade so viel, dass sie nicht bitteren Hunger zu leiden brauchten. Die Milch war ja von der Kuh da, ein paar Kreuzer für Brot und Polenta dazu, den übrigen Lohn behielt er. Sollten nur zuschauen, wie sie auskämen, sagte er ihnen, wenn sie nicht dienen wollten. Aber das wollten sie nicht, um keinen Preis! Das blieb hartnäckig am Haus hängen, wie die Kletten waren sie. Und dabei ärgerte eins das andre, man musste nur die Moidl und die Kathl kennen! Das Geschrei und Geschelte ging den ganzen Tag nicht aus, er konnte es ja schon von weither hören, wenn er auf das Haus zukam.
Und wie sah’s drinnen aus! Alles voller Unrat, verwahrlost, kein Bett war gemacht, die Kleider und Fetzen lagen zerstreut in den Stuben umher, die Mädeln lungerten herum, die Haare strähnig und schmutzig, Lumpen am Leib, verbissen und tückisch wie die Wildkatzen, die reine Spelunke war’s. Er wusste wohl, dass sie sich bei den Haaren herumzogen und sich braun und blau schlugen, wenn er nicht da war; mochten sie’s, ihm tat’s nicht weh, er nahm so bald als möglich seine Breithacke und ging fort aufs Zimmern. Wochen- und monatelang blieb er fort. Er vergass ganz, dass er eine Heimat, dass er ein Haus und vier Kinder hatte. Nur manchmal packte es ihn, er musste fort, er musste heim. Dann lief er Tag und Nacht über die Berge wie von einer fremden Macht getrieben. Aber sobald er das Haus sah, ging er langsamer und langsamer. –
Und die Kinder erst. Wie die erschraken! „Der Voda! Der Voda!“ Wie ein Schreckensruf ging’s durch das Haus. Aller Streit hatte ein Ende. Da standen sie steif wie die Bildsäulen und schauten in die Ecken. Gleich waren sie einig. Kein Grüss Gott, kein Wort sonst. Nach und nach schlurften sie scheu um ihn herum, aber reden wollte keine. Höchstens, dass es der Ältesten, der Kathl, einmal ein verbissenes Wort herausriss. Wenn er zum Beispiel essen wollte, und sie stellte ihm eine saure Polenta hin, hart und fest, dass man sie kaum mit dem Löffel stechen konnte, und er fing an zu schelten: „Gibt der Voda nur a Geld her, mir ham eh nix anders z’ fressen.“ Oder wenn er sie am Sonntag in die Kirche treiben wollte, schrie sie ihn an: „Schaff der Voda nur a G’wand, an die Stauden wachst koans für uns.“
„Geht’s weiter, schaut’s euch um an Dienst um!“ war wohl seine Gegenrede, aber aus der Spelunke brachte er keine hinaus. So sollten sie eben sterben und verderben auf dem Häusl, er gab keinen Kreuzer mehr her. Ja, wenn sie ihm vielleicht ein „Bitt’ gar schön, Vater“ gegönnt oder das Maul zum Betteln aufgemacht hätten! O nein! Die bissen die Zähne übereinander und schielten nach ihm, ob er nicht bald wieder über die Schwelle ging.
Wie ein Fremder war er in seinem Haus, wie wenn’s gar nicht sein gewesen wäre; sie hingen förmlich an seinen Füssen, ob er sie nicht bald wieder auswärts setze. –
Der Kuchler stand nun auf, langsam, schwer, Schritt vor Schritt stieg er in der Sonne aufwärts.
Das war freilich bei der Marietta ein ander Ding gewesen. Die schrie ja gleich vor Freude, ein eignes Haus zu kriegen! Und war’s noch so klein und eng und schmutzig, es war eine Heimat, und die hatte sie nie gekannt. Ein lediges Kind war sie, von den Verwandten herumgestossen und geschlagen, von einem zum andern geschickt, gescholten und karg gehalten, gezankt, gepufft noch als erwachsene Dirne; da war es für sie ein grosses Glück, eine Heimat zu bekommen, und sie war ihm dankbar und tat ihm alles, was er nur wollte. Es schaute bald anders aus in den Stuben, alles war blank und rein; auch kein Geschrei gab’s mehr im Haus herum, kein Schelten, nur fröhliche Gesichter; Zorn und Groll, das kannte die Marietta nicht. Im Nu harte sie der Kleinen, der Juli, den Kopf verdreht und dem Buben, dem Anderl, auch. Störrisch und verschlagen und faul, wie sie vordem bei den älteren Schwestern gewesen, waren sie nun fleissig und gut und rührig den ganzen Tag, um den Stall und das kleine Feld in Ordnung zu halten, denn davon verstand die Marietta nichts. Die Grossen mussten freilich gehen, und sie gingen, wenn auch mit Geheul und Fluchen.
Einen gleich guten Winter hatte der Anderl nie erlebt. Er sagte es ja dem jungen Weibe nicht, es war nicht seine Art; aber es behagte ihm, auf der Bank zu sitzen und zuzuschauen, wie sie herumhantierte, seine Pfeife zu rauchen und sich neben sie auf die Ofenbank zu setzen, wenn sie spann. Im Kachelofen krachten dann die Scheite, und die Stürme taten wüst draussen, der Schnee fegte gegen die Läden und lag in hohen Wehen vorm Haus. Sonst war ihm der Winter in dem eisigkalten zerrissenen Hochtal ein Greuel gewesen, und er hatte mit Bangen und Grausen darauf gewartet und gewettert und geflucht, wenn ihn Schnee und Eis schon früh abschlossen vom Tal drunten, dass er nicht mehr auf Arbeit gehen konnte.
Er hatte das Winterende nie erwarten können und war brütend im Haus herumgesessen oder hatte mit seinem ersten Weibe gehadert. Nun ging er den ganzen Tag in den Zimmern umher. Alles wollte er der jungen Frau schöner und besser machen, weil sie alles freute, in der Küche und in den Stuben. Und erst als er an die Wiege kam! Die sollte ein Prachtstück werden! War ihm denn je eingefallen, seinen andern Kindern eine neue Wiege zu machen? Da war immer die alte lange gut genug! Aber als die Marietta unter dem alten Gerümpel herumkramte und eifrig an dem staubigen, wackeligen Ding herumputzte, nein, das konnte er nicht sehen. Für ihr Kind sollte sie eine neue, schöne Wiege kriegen. Nicht genug konnte er sich tun, den halben Winter schnitzte er daran herum, und ihre glänzenden Augen freuten ihn noch mehr als das Prachtwerk, das er geliefert hatte. Ja, das wusste er noch alles!
Aber dann – pfui Teufel! – wieder spuckte der Anderl aus und zertrat mit den schweren, nägelbeschlagenen Schuhen die Stelle, pfui Teufel, ja! Auch wenn das ganze Tal nicht gehetzt hätte, er sah’s doch mit eignen Augen, dass das sein Kind nicht war und dass sie ihn belogen und betrogen hatte! Wieder musste er stehen bleiben, sich den Schweiss abtrocknen und verschnaufen.
Er war jetzt hoch über den steilen Abhang heraufgekommen in der Mittagsglut, und vor ihm lag schon sein Häuschen, dicht an der jäh abfallenden Felswand. Drunten gurgelte der Bach, der vom Gletscher kam, zwischen Geröll und niederem Gestrüpp. Dunkel und wild schaute das Tal selbst an diesem sonnensprühenden Tage aus. Die Wände stiegen fast senkrecht in die Höhe, nur mehr mit spärlichem, zerzaustem Wald und mit struppigen Legföhren bewachsen. Drüber schauten die Gletscher, von Zeit zu Zeit von einem schleierartigen Nebel umzogen, der wieder zerflatterte. Über die Steilhänge kletterten Alpenrosen herab, fast bis an sein Haus kamen sie in breiten roten Streifen, und ihr strenger, würziger Harzduft vermischte sich mit dem Geruch des Heues, das, in Schwaden niedergemäht, an den Berglehnen trocknete.
Zerstreut lagen die Höfe im Tal, meist von den Felswänden gegen die Stürme geschützt, sein kleines Haus am höchsten, es hatte nur von einer Seite Schutz. Unter ihm, in der Richtung gegen Jodok zu, standen ein paar Häuser beisammen, weiss und schmuck, mit steinbeschwerten Dächern, Wäsche hing am Zaun und blinkte hell im grellen Sonnenschein. Weiter herauf, auf einem Vorsprung, mitten unter Wiesen, lag der Malseinerhof, das grösste und reichste Gehöft im Tal.
Der Malseiner war eigentlich sein Nachbar, wenn er auch fast dreiviertel Stunden von ihm entfernt war.
Die von Malsein waren fast alle bei der Leiche gewesen, die mochten alle die Marietta gern und waren die einzigen im Tal, die es ihm verdachten, wie er zu ihr gewesen, und die’s ihn auch merken liessen.
Der Malseiner hatte ihn gleich gar nicht angeschaut bei dem Begräbnis, und die Frau kaum. Sie waren noch nicht daheim; als er vorhin an ihrem Hof vorbeiging, hatte er nur den Hansi sitzen sehen, aber auch der schaute nicht auf und schnitzte an einem Holz weiter. Noch setzt konnte er ihn auf der Bank vor dem Haus sehen, und wenn der Wind gerade recht ging, hörte er ihn sogar singen.
Und wie er sang! Wie ein Vogel, voller Freude und Lust. Ja, die hatten gut singen in Malsein! Und noch dazu der Bub, so ein Teufelskerl, wie der war! Überall schon voran mit der Arbeit trotz seiner zwölf Jahre, gross und schlank und kräftig, und was er anpackte, geriet, und der Malseiner schmunzelte nicht umsonst, wenn er von seinem einzigen Kinde sprach.
Wenn sein eigner Bub so gewesen wäre, der Anderl! Wie ein lahmer, verschlagener Hund war er, und jetzt gar, wo die Grossen wieder an ihm herumzuschimpfen und zu stossen hatten!
Die Marietta hatte es noch am ersten verstanden, etwas aus ihm herauszubringen. Ein Kreuz war’s! Jetzt, wo er fünfzehn Jahre alt wurde und recht anpacken sollte, ging’s genau so langsam wie früher. Kaum die Hälfte von dem leistete er, was der Hansi leisten konnte. Dafür hatte der aber auch einen unbändigen Stolz, und der Hochmutsteufel steckte ihm im Blut, er hätte nicht von Malsein herstammen müssen!
Wenn ein paar Buben beisammen waren, auch ältere drunter, hatte der Hansi das grosse Wort. Er gab an, er schaffte an, und gerade wie wenn’s so in der Ordnung wäre, folgten sie ihm alle. Wie ihn das schon gegiftet hatte! Wie oft er den Anderl gehöhnt, angestachelt hatte, sich ihm zu widersetzen! Aber natürlich der Anderl! Der tat blindlings, was der Hansi verlangte! Es hätte ihm auch nur einer widersprechen sollen! Trotzig und wild und ungebärdig war er wie ein junges Ross. Wenn der einmal Bauer wurde! Da musste eine Bäuerin vom Himmel fallen, denn weit und breit war keine gut genug und reich genug und stolz genug! Denn das gehörte dazu, das Stolzsein!
Des Kuchler-Anderls Augen nahmen einen hässlichen, gehässigen Ausdruck an, wie er so hinunter auf das stattliche Gehöft blickte. Der ganze Groll des Kleinhäuslers gegen den Bauern, der ganze Hass des Nichtbesitzenden gegen den Besitzenden sprach daraus.
Jawohl, der Bub wusste schon, dass er einmal die Gulden im Sack konnte klingen lassen, das stieg ihm zu Kopf und machte ihn hoffärtig.
Warum sie nur alle da unten so gut mit der Marietta gewesen? Wohl nur aus Trotz gegen ihn, der sich nie freundlich oder gar untertänig gezeigt hatte, wie’s die Sippschaft haben wollte. Die Marietta dagegen hatte für jeden ein freundliches Gesicht und ein gutes Wort gehabt, und das hatte denen gefallen, natürlich. Der Hansi konnte ja nicht genug Blumenstöcke heraufschleppen, weil sie die Marietta gar so freuten. So lange trug er zu, bis die Fenster beinah so voll standen wie auf Malsein. –
Dicht vor seinem Haus blieb der Anderl nochmals stehen und zog sein blau und weiss kariertes Tuch. Es war, als zögere er einzutreten. Das war eine Hitze! Die Felswand glühte fast, und die paar roten Federnelken, die wie hingespritzte Tropfen das graugelbe Gestein fleckten, hatten die Blätter ordentlich zusammengerollt vor Hitze. Der kleine Garten blühte mit blauem Rittersporn, brennender Liebe und den bunten Kerzen der Levkoien. Der Kuchler lehnte sich an den Zaun und schaute auf die Beete. Salat und Rettich, Lauch und Zwiebel und Schnittlauch, alles noch fein säuberlich in der Reihe, wie sie es gesetzt hatte; aber das Unkraut ging schon überall heimtückisch auf. Sah denn das keine? Wofür waren sie denn zurückgekommen? Lieber lungerten sie auf der Bank vor dem Hause herum oder zupften an den spärlichen Beeren, die der verkrüppelte Johannisbeerstrauch trug.
Und da schau einer her! Die Blumen vor den Fenstern liessen alle die Köpfe hängen, und es war doch eine Pracht, die dicken roten und weissen Geranien, die vielen Nelken und die gelben Büschel der Hirtentaschen zu sehen. Das Gesindel! Nicht einmal danach schauten sie! Mit einem Fluch stiess er gegen die Haustüre – sie gab nicht nach, und in wütender Ungeduld schlug er mit der Faust auf den Drücker, doch niemand kam, ihm zu öffnen. Hatte er nicht der Kathl gesagt, sie müsse dableiben? Die sass jetzt gewiss bei den andern in der kühlen Wirtsstube in Jodok und tat sich gütlich!
Was war denn auch in ihn gefahren, dass er da herauf musste bei der Bärenhitze? Hätte er nicht sitzenbleiben können, bis der Talwind kam, zu essen und zu trinken fand er heute doch nichts zu Hause, und das Viertel Roten, das er getrunken, brannte ihm wie Feuer im nüchternen Magen.
Scheltend ging er ums Haus. Richtig hatten sie auch noch die Stalltüre nicht zugeschlossen. Zu stehlen gab’s freilich nichts beim Kuchler, aber sie wussten es genau, dass er so etwas nicht duldete. Da stand die Kuh vor dem leeren Barren, brüllte kläglich und hatte fort und fort zu tun, sich die Mücken mit dem Schwanz abzuwehren, die in ganzen Schwärmen auf ihr sassen und um sie herumbrummten.
Dazwischen hörte er ein dünnes Stimmchen – Herrgott, das Kind! Hatten sie’s rein mutterseelenallein im Haus gelassen, und zu trinken hatte die Kleine gewiss auch nichts mehr, sie konnte ja gar nimmer weinen! Der Kuchler klinkte die Stubentüre auf, richtig, da stand sie mitten in der Sonne, und ein Schwarm Fliegen sass auf den Händchen und dem Gesicht und hatte sich an die Flasche festgeklebt, die neben ihr in die Kissen hineingefallen war. Freilich, am Morgen, als die Juli die Wiege dorthin stellte, war’s kühl und schattig dort gewesen, und die Kathl – na, wart nur! Komm du nur heim! Dass er sie auch nicht gesehen hatte! Bei der Leiche und beim Leichentrunk war sie sicher nicht gewesen, solange er dort war, das wusste er. Die sollte sich nur freuen, wenn sie ihm zwischen die Finger kam!
Er wehrte zornig mit dem Taschentuch die Fliegen von dem Kinde ab, aber das dünne Stimmchen klagte weiter; dann nahm er die Flasche, wusch sie draussen und steckte sie der Kleinen in den Mund, die gierig zu saugen begann. Jetzt war wenigstens für einen Augenblick Ruhe, das konnte ja kein Christenmensch anhören, das Gewimmer!
Er warf seinen Hut auf den Tisch, holte seine Pfeife aus der Rocktasche, stopfte sie und begann fest zu qualmen, da ging’s gleich wieder an. Er rannte aus der Stube in die Küche und machte sich am Herd zu schaffen, er warf der Kuh Futter vor und blieb im Stall, aber überall sickerte das Gewimmer durch, wie ein dünnes, feines Netz legte es sich auf ihn. Hört es denn nicht endlich auf?
Er stieg ins obere Stockwerk, aber droben war’s nicht zum Aushalten, eine Luft zum Ersticken, eine Bruthitze, kein Fenster offen – das Weibervolk hatte alles zu gelassen, und als er die Fenster öffnete, drang das dünne Stimmchen noch deutlicher zu ihm hinauf. Mit ein paar Sätzen ist er über die Stiege hinunter, den Hals möchte er dem Balg umdrehen, das war ja, wie wenn man immerfort eine Nadel ins Fleisch gestossen kriegte! Er stolpert in die Stube und auf die Wiege los, er reisst das Kind hin und her, schleift die Wiege über die Dielen – wenn er jetzt seine grosse Hand nehmen, den kleinen Kopf in die Kissen drücken würde, so ein paar Vaterunser lang, dann wär alles vorbei, Schande und Zorn und Verdruss. –
Da macht das Kind die Augen gross auf. Er kann nicht hinschauen, er senkt den Kopf. Still setzt er sich auf die Ofenbank und zieht die Wiege nach. Immer noch mit den Augen am Boden, bleibt er eine Weile sitzen, dann stopft er sich die Pfeife wieder. Das war immer sein Platz gewesen, da auf der Ofenbank. Im Sommer, wenn die Fenster weit offen standen, sah er gern, so wie jetzt, übers Tal auf die Schneefelder, während die Marietta ihre Nadeln neben ihm klappern liess oder im Garten arbeitete und dazu sang; im Herbst mochte er gern da sein, wenn die Nebel dick vor den Fenstern lagen und er feucht nach Haus gekommen war im Nebelreissen, und mochte den Rücken an dem breiten Kachelofen wärmen, in dem das erste Feuer brannte. Auch im Winter war’s fein, wenn sie neben ihm sass und spann. –
Er paffte Zug um Zug aus der grünen Porzellanpfeife, und ganz mechanisch, weil die Kleine immer noch wimmerte, fing er an die Wiege mit dem Fuss in Bewegung zu setzen. Es war eine Gewohnheit aus früheren Wintern her, wenn er gerade nicht fort konnte, und wo ihm die Erste ohne viel Federlesens einfach die Wiege zugeschoben und er, paffend, halb im Dusel und vor sich hin sinnierend, weitergewiegt hatte.
Durchs Fenster klang das Gezirpe der Grillen, der schwere Duft des Heus kam mit dem schwachen Luftzug herein, das leise Weinen wurde schwächer. –
Anderl nickte nach und nach ein, im Schlaf immer noch die Wiege im Gange haltend.
Es wurde Abend, und die Sonne stand gross und rot genau über der höchsten Spitze des Ferners, wie wenn man dort eine glühende Riesenscheibe aufgestellt hätte, als Anderl durch Geschrei und Gelächter geweckt wurde. Er konnte sich im Augenblick auf nichts besinnen – wer waren denn die vier? – Was wollten sie denn? –
„Jesses, der Voda!“ schrie die Moidl, „er wiegt gar das weisse Chrischtkindl. Schaugt’s ihn decht an. Gib mir’s her, des fremde Engerl!“, und unter schallendem Gelächter wollten sie und Kathl das Kind aus der Wiege reissen.
Anderl liess seine wilden Augen unter den buschigen Brauen vor über die zwei Dirnen gehen. Die waren ja beide, weiss Gott, betrunken! „Und du! du!“ – die Kathl war im Sonntagsgewand der Marietta zum Begräbnis gegangen! Wie ein Tier stürzte er auf sie zu und packte sie vorne an der Brust: „Was hascht du dir unterstanden? Was hascht du getan? – – Tu’s runter, des G’wand, tu’s runter,“ brüllte er, und da sie ihm nicht schnell genug war, riss er ihr das Kleid herunter, dass es in Fetzen zu Boden fiel. Dann trieb er die Erschrockene mit harten Stössen durch den Gang gegen die Haustüre, riss diese auf und stiess sie hinaus: „Du kimmscht mir nimmer einer, du nimmer; du hättescht dableiben können, du und die Moidl aa, aber jetzt is aus –“
Dann drehte er sich nach der Moidl um, die, blöd und verängstigt, mit stierem Blick noch immer neben der Wiege stand und mit beiden Händen abzuwehren versuchte – denn wenn der ‚Voda‘ so tat, war’s gefehlt! – er packte sie aber unbarmherzig beim Arm und schleifte die Widerstrebende, die sich am Türpfosten halten wollte, hinaus. „Du aa, du aa kimmscht mir nimmer!“ schrie er – ein Ruck, das Haustor flog krachend zu, und der Riegel knirschte.
„Mach die hintere Tür zua,“ schrie er Anderl an, der, schlotternd vor Furcht, sich zwischen Ofen und Wand eingeklemmt hatte. „Will des a Bua sein? Schamst di nit? Glei gehst!“
Mit gebogenem Rücken, in grossen Sätzen wie ein verjagter Kater flog Anderl durch die Stube, dem Stall zu.
Juli war wie angewurzelt an derselben Stelle stehengeblieben, und das Gebetbuch zitterte in ihrer Hand. Sie hatte freilich nichts getan. Der Vater hatte ihr geheissen, mit zur Beerdigung zu gehen, sie hatte nicht zuviel Wein getrunken – die andern hätten ihr schon keinen vergönnt –, hatte auch nicht die Kleider der toten Mutter angezogen, die nun halbzerfetzt am Boden lagen, aber wenn der Vater so war, da mochte man etwas getan haben oder nicht, da war alles eins!
Wenn er sie nun auch weiterschickte, dann kam sie nicht mehr ins Haus herein, das wusste sie. Eine kurze Zeit blieb sie noch verängstigt wie festgenagelt stehen, dann schlich sie, so leis es ihr mit den groben nägelbeschlagenen Schuhen möglich war, am Vater vorbei. Für eine Vierzehnjährige war ihr Körper noch vollständig unentwickelt, und in dem viel zu knappen Kleid sah er noch dürftiger aus, als er war. Die Juli hatte ordentlich Mitleid mit sich, wenn sie dies verschlissene alte Kleid anschaute. Wenn sie die tote Mutter so gesehen hätte! Nie hätte die sie so fortgehen lassen! Nun hatten ihr die Grossen alles genommen, auch den schönen Stoff, von dem ihr die Mutter ein Kleid hatte machen wollen.
„Dass du mir die Zwoa nit ins Haus einerlassescht, sonst geaht’s dir und dem Anderl grad a so!“ schrie ihr der Vater nach, „und jetzt geahscht du kochen!“
In der Küche hatte Anderl schon Feuer gemacht; er hielt den Rücken noch immer gekrümmt wie ein verfolgter Kater, wie wenn er jeden Augenblick Schläge erwarte, und getraute sich kaum zu reden. Aber Milch hatte er gebracht und die Kaffeemühle hergerichtet, denn das Essen vergass er nie. Die Juli hockte sich neben ihn, und so hielten sie sich mäuschenstill, die Juli lauschend, ob das Kleinste, die Nann, sich nicht rühre. Doch die schlief fest. Wie durch ein Wunder hatte sie mitten im wüstesten Geschrei weitergeschlafen. Der Alte sass wieder rauchend auf der Bank, und das grosse Erkerfenster in der Stube funkelte im Schein der Sonne, dass man es weit im Tal sehen musste. Der Rauch von Anderls Feuer, das er endlich nach langem Pusten zustand gebracht hatte, stieg blau über dem kleinen Haus in die Höhe, alles sah friedlich und freundlich aus in der Abendsonne.
In der Streuschupf aber, zuhinterst unter dem Laub, lagen zwei und stiessen Verwünschungen aus gegen dies sonnenüberglänzte Haus, das so friedlich ins Tal hinabschaute und das ihr Vaterhaus war.
2
Nach acht, es war schon dunkel geworden, und die gegenüberliegenden Berge warfen schon lange Schatten, sassen der alte und der junge Anderl und die Juli bei der Suppe. Juli hatte die roten Vorhänge vorgezogen, wie sie es die Mutter hatte tun sehen, das Licht angezündet, die Schüssel auf den Tisch gesetzt und Brot hineingeschnitten. Jetzt löffelten die drei los, die Kinder eng aneinander gedrückt. Der Juli liefen bald die Tränen über die Backen, und sie legte den Löffel weg. Da Anderl stets das tat, was die Juli ihm vormachte, fing auch er zu heulen an und legte den Löffel weg.
„Iss, Bua!“ schrie ihn der Vater an, und gehorsam tauchten die zwei Kinder wieder ein, Juli nur mit Widerwillen die Suppe hinabwürgend.
Da klopfte es draussen an der Türe. Der Vater ass ruhig weiter, die zwei andern hielten inne, den Löffel mit aufgestütztem Arm in die Luft haltend. Und wieder klopfte es.
„Voda, klopfen tut’s,“ sagte Juli, die Resolutere, leis.
„Halt’s Maul, und dass mir koans aussergeht!“
Juli und Anderl sahen sich an, der Bub hielt den Mund offen und lugte starr nach der Türe, wie wenn dort etwas hereinkommen müsste, sie zu erschrecken.
Aber der Vater stopfte sich in aller Umständlichkeit eine neue Pfeife und blies bald solche Wolken von sich, dass das ganze Zimmer grau war; sollte er sich denn da fürchten? Es wurde kühl, und von der Küche, deren Fenster offen standen, wehte der Firnwind herein, hier und da hörte man ein paar Töne des Abendläutens von Jodok herauf.
Da klopfte es so stark an das Fenster, an dem die Juli sass, dass die mit einem Schreckensruf in die Höhe fuhr und Anderl sich unter dem Tisch zu verkriechen suchte.
Der Alte stand auf, nahm den Bergstock aus der Ecke, und bald hörten die zwei den Riegel, dann die Haustüre knarren, ein paar Schreie und flüchtende Schritte an den Fenstern vorbei, hörten alsbald den Vater rings ums Haus gehen, zweimal, sie hielten den Atem an – nichts – dann knarrte weit weg ein Riegel – „die Schupfentür“ wisperte Anderl; nun kam der Vater durch den Stall zurück, und wieder knarrte der Riegel, dann schloss er die Küchenfenster, schloss die Haustüre, lehnte den Bergstock in die Ecke und trieb die Kinder mit einer herrischen Gebärde auf.
„Geht’s ins Bett“, sagte er rauh, „der Bua schlaft da in der Kammer, und du geahscht jetzt aufer mit der Nann, und da oben bleibt sie, ich will sie nie mehr sehen da unten.“
So wurde die kleine Nann von ihrem Vater aus der Stube verbannt und musste ins obere Stockwerk wandern.
Juli trug das Kind, das durch das Aufheben erwacht war, an dem Vater vorbei, wie wenn sie ein Unrecht tue, und es fiel ihr schwer auf die Seele, dass das Kind wieder zu weinen anfing. Als sie das weinende Kind droben aufs Bett gelegt und ihr Stümpfchen Kerze angezündet hatte, kam ihr ihr zukünftiges Leben so schwer vor, dass sie zu heulen und zu beten anfing. Was sollte sie denn mit dem kleinen Kinde anfangen? – Und die Mutter, die doch so gut war, die war jetzt tot, und nur der böse Vater blieb, und niemand half ihr mehr ...
Keiner sagte ihr etwas – –. Sie schaute die Nann an – so blass sah sie aus; wenn sie starb, wer war dann schuld? Die Juli. Wenn sie schrie, wer war dann schuld? Die Juli. Und das Kind wimmerte fort und fort. Sie nahm es auf den Arm und trug es herum, es weinte weiter, sie legte es nieder und nahm’s gleich wieder auf; der Arm wurde ihr lahm, sie musste sich aufs Bett setzen und das Kind in den Schoss nehmen, aber ruhig wurde es auch da nicht. Sie redete der kleinen Nann zu, sie sang ihr leise etwas vor, dann horchte sie wieder, ob sich im Haus etwas rühre, ob der Vater noch auf sei und sie hören könne – es war alles ruhig. Unermüdlich ging sie auf und ab, und unermüdlich weinte das Kind, nichts wollte helfen. Ob’s am Ende gar Hunger hatte? Wie ein Dieb schlich sich die Juli hinunter, mit Herzklopfen, es gab ihr jedesmal einen Stich, wenn die Stufen knarrten; sie tappte sich durch den Gang nach der Küche, da war ja noch warme Milch! Eilig schüttete sie etwas Wasser daran, wie die Mutter immer getan, und tastete sich gegen die Stube, das kleine Stümpfchen Licht vor dem Erlöschen schützend. Sie musste ja auch das ‚Flascherl‘ haben. Beinahe hätte sie Milch und Kerze fallen lassen, denn drinnen in der Stube sass der Vater noch auf, die Ellbogen aufgestützt und das Gesicht mit den Händen verdeckt, und als er sie jäh zurückzog, sah sie, dass er weinte.
In die Erde hätte sie sinken mögen, Angst und Scham schnürten ihr den Hals zu, sie wusste nicht, was sagen oder tun. „’s Flascherl!“ stiess sie endlich heraus, und als sie’s hatte, flog sie wie der Wind über die Treppe.
Sie war so verwirrt, dass sie kaum der Nann die Nahrung reichen konnte. Der Vater weinte. Warum weinte er? – Er hatte doch keine Träne vergossen, solange die Mutter schwer krank war, keine, als sie tot drinnen lag, keine während der Leiche! Er kam ihr sonderbar und fremd vor, und doch stand er ihr wieder näher, er tat ihr leid, und trotzdem scheute sie sich wieder hinunterzugehen zu ihm. –
Die kleine Nann hatte gewaltig an ihrer Flasche geschluckt, nun schlief sie fest. Die Juli aber war noch lange wach, auch nachdem das Licht ausgegangen war, und allerlei Gedanken und Sorgen rumorten in ihrem jungen Kopfe.
Ans Fenster gekauert, sah sie angestrengt auf den hellen Fleck vor dem Hause, der Vater hatte die Lampe immer noch nicht gelöscht. Endlich hörte sie ihn aufstehen, der lichte Fleck verblasste, nun war’s fast ganz dunkel. Undeutlich nur sah man das Gezack der Berge gegen den Himmel stehen, die kleinen weissen Häuser wie Flecke an der Lehne kleben und den Schnee in den Schroffen, da säumten sich plötzlich die Gipfel mit einem hellen Streifen, ein weisser Schein breitete sich über den Himmel aus, und langsam kam der Mond wie hinter einer Riesenmauer vor.
Hatte sie nicht etwas gehört? Leise Tritte? – Sie drückte den Kopf nahe ans Fenster – da schlichen zwei ums Haus, in die Fenster spähend, vorsichtig an den Türen rüttelnd, wie Wölfe, die in der Nacht auf Raub ausgehen; sie kamen, verschwanden im Schatten, kamen wieder – ein heiseres Geflüster, die Steine am Weg krachten, eilige Tritte in der Ferne, dann wurde es still.
Und nun schaute der Mond heraus, eine weiche Helle lag über dem Tal und den Gletschern, in einem fernen Gehöft bellte ein Hund, da kroch die Juli endlich zitternd ins Bett. Es war kühl geworden, und der Wind wehte leichte Nebel an den Zacken der Berge hin. Julis letzter Gedanke war, als sie müde und zerschlagen unter den Laken lag: ‚Morgen gehst du zu der Malseinerin, dass sie dir’s sagt wegen der Nann.‘
Als die Malseiner Knechte am frühen Morgen – kaum graute der Tag, und die Berge sahen noch finster aus gegen den glasigen Himmel – aufs Mähen gehen wollten, fanden sie in dem Schupfen die Kuchlerdirnen, die eine im Unterrock, die andre ohne Leibchen, fest in eine Schürze gewickelt. Sie lagen und schnarchten und schliefen wie die Murmeltiere, selbst das Gelächter der Knechte weckte sie nicht. Erst als sie einer gehörig rüttelte, wachten sie auf. Moidl setzte sich in die Höhe, rieb sich die steifen Arme, – sie hatte ihr Leibchen der Kathl gegeben – und lachte die Männer an. Sie war keineswegs verlegen, – halb verschlafen wie sie war, rüttelte sie sich und konnte sich nicht entschliessen, aus dem warmen Stroh aufzustehen. Kathl dagegen, mürrisch und zornig wie immer, hatte sich zuerst umgedreht und aufs Gesicht gelegt, dann war sie aufgesprungen und hatte versucht, sich mit Ellenbogenstössen Platz zu machen, um durchzukommen. Doch die Knechte standen fest und konnten nicht genug kriegen, sich an dem Aufzug der beiden und an Kathls Wut zu weiden. Selbst als der Bauer unter die Haustüre trat, gingen sie nicht auseinander. Der Malseiner hielt die Hand vor die Augen, denn die ersten feurigen Streifen kamen am Himmel herauf und blendeten ihn. Er war in Hemdärmeln, trotzdem es so kühl war, dass man seinen Atem sah. „Was is?“ rief er hinüber, ohne einen Schritt vorwärts zu machen, „was gibt’s?“ Er war hoch gewachsen, breit in den Schultern, mit einem braunen krausen Vollbart, die kurzgehaltenen Haare seitwärts gescheitelt, während sie im Nacken weit hinuntergewachsen waren. Stattlich und bewusst, mit kräftigen Beinen, stand er vor dem Hause. Die Stimme klang scharf und kurz, aber man sah’s den braunen Augen an, dass sie nicht nur unwillig schauen konnten, wie jetzt.
Michel, der älteste Knecht, ein grober, wüster Kerl, hatte eben die Moidl am Arm gepackt und versuchte sie in die Höhe zu zerren: „Bringsch’n ja nit wach, den Duifl,“ schrie er, „hat no sein’n Rausch von geschtern, scheints!“
Moidl widerstrebte, halb aus Zorn, halb aus Vergnügen an der Sache, die ihr ganz lustig vorkam. So zerrten sie hin und her, die Knechte lachten und schrien, und Moidl schrie und zeterte. Die Dirnen kamen nun auch alle aus dem Haus, laufend und so neugierig, dass sie sich nicht einmal Zeit liessen, sich vollends anzuziehen, sondern noch im Gehen die Röcke und Schürzen einhakten. Sie drängten sich vor die Männer und waren im Spotten und im Geschrei und Gelächter die ärgsten. Keine war dabei, die Kathl oder Moidl beigestanden hätte, umsonst versuchte Kathl bei ihnen durchzukommen. Erst als der Bauer näherkam, weil ihm keiner Antwort gab, und die Dienstboten anrief, erst als die sich nach ihm umdrehten, gelang es ihr, mit einem Puff bei den Dirnen eine Lücke zu stossen und wegzulaufen.
Moidl hockte, noch immer blöd lachend, auf dem Boden und schaute den Bauern hilflos an.
„Ha, die Moidl!“ sagte er, „wo kimmscht denn du her?“ Alle schwiegen; das Gelächter hörte sogar auf, nur die Dirnen wisperten hinter dem Rücken der Knechte. Jetzt, nachdem sich der Malseiner an das Halbdunkel des Schupfens gewöhnt hatte, sah er erst, wie Moidl ausschaute. „Geht’s an die Arbeit!“ herrschte er die Dienstboten an. „No – Marsch, sag’ i!“
Zögernd entfernten sie sich, die Weiber sich dicht beieinander haltend und tuschelnd. Immer wieder drehten sie die Köpfe herum und versuchten noch etwas zu hören.
„Jetzt sag’, Moidl, was ischt mit dir?“
Statt aller Antwort fing sie an zu heulen und liess sich nicht beschwichtigen, sondern heulte immer lauter.
„Hat di der Vater g’jagt?“
„Ja, ja,“ schrie sie, und ganze Tränenbäche rannen über ihr braunes Gesicht.
„Warum denn?“
„I woass nit, i woass nit!“ – sie begann ihre nackten Arme zu reiben, „mi friert a so,“ dabei blieb sie am Boden knien und machte keinen Versuch, aufzustehen.
Dem Malseiner fiel ein, dass er sie gestern beim Leichentrunk hatte schäkern und lachen hören und dass sie mitten unter einer Rotte von jungen Burschen gesessen hatte, die ihr fortwährend einschenkten. Seine Frau hatte noch gesagt: „Na, wenn das Madl koan Rausch kriegt heut, die stellt si schön an beim Leichentrunk!“
Sie war wirklich ausser Rand und Band gewesen. Fortwährend hatte sie den Kopf im Nacken und den Mund weit aufgerissen und lachte ohne Aufhören, wie wenn sie immerfort gekitzelt würde. Das war das erstemal, dass sie länger mit Burschen zusammen war, denn der Vater hatte sie nie fortgelassen, und auf dem Einzelhof, wo sie in der letzten Zeit gedient hatte, kam sie auch nicht unter die Leute.
Der Bauer schaute die zerraufte und heulende Dirne missmutig an.
„Steh auf,“ sagte er kurz, „geh einer, iss was,“ und drehte sich um, aufs Haus zugehend.
Moidl tappte sich an der Mauer in die Höhe und folgte dem Bauern zögernd nach. Ihre Schuhe und Röcke waren voller Staub und Schmutz, die Haare hingen ihr ins Gesicht und klebten voller Tannennadeln, sie zog und zerrte an der Schürze, um sie über die Schultern zu bringen, und drückte sich halb scheu und halb trotzig an den Türpfosten.
In der grossen Stube stand, wie jeden Morgen, eine dampfende Schüssel für Bauer und Bäuerin; eine kleinere für den seltenen Vogel, den sie heute im Schupfen gefunden, hatte die Bäuerin dazugestellt.
Moidl sagte kein Grüss Gott, und die Bäuerin beachtete sie weiter nicht. Vor den Männern hatte sich Moidl nicht gescheut, aber hier in der grossen reinen Stube, die ganz mit dem kalten grauen Frühlichte erfüllt war, vor den forschenden Augen der schlanken, peinlich sauberen Bäuerin begann sie sich ihres Aufzuges zu schämen. Unbeholfen strich sie an sich herum, zog die Schürze fest um sich und fing dann wieder an, sich die Nadeln aus den Haaren zu lesen, immer aber hielt sie die Augen niedergeschlagen.
„Geh di waschen und kampeln,“ sagte die Bäuerin, gab ihr das Schüsselchen mit Milchsuppe und Brot in die Hand und schickte sie in die Kammer.
„Muass ma sie nachher wieder hoamschicken?“ sagte sie.
„Wenn sie dir geht,“ nickte der Bauer.
„Der Kuchler-Anderl muass sie wieder g’halten, des Diandl is zu jung, er kann sie nit aus’m Haus werfen.“
„Du kennst ’n Kuchler schlecht,“ sagt er, „’s Madl fürchtet sich ja z’tot.“
„Nimm du sie! Arbeit ischt gnua!“
„I? – A Kuchlerdirn? Na na, da wird nix draus!“
„Mir reden an andersmal davon,“ sagte die Bäuerin, und da sie stets rasch von Entschluss war und sich alles schnell zurechtlegte, ganz im Gegensatz zu ihm, der in allen wichtigeren Dingen bedächtig vorging, wenn er nicht zornig war, meinte sie: „I geah jetzt glei auffer zum Kuchler, i han a so mit ihm zu reden wegen seiner Arbeit bei uns, und nach der kloa’n Nann und der Juli möcht’ i a schaun, nachher werd’ i ’s schon sehgn. Fressen wird er mi nit glei! ’n Hansi nimm i mit, er will a so schon lang das Poppele sehn.“
Die Sonne war schon hinter den Bergen vorgekommen, als die Malseinerin und Hansi gegen das Kuchlerhäusl aufwärts stiegen. Das Tal war licht und hell, tief unten sah man den grün und roten Kirchturm von St. Jodok wie ein Kinderspielzeug liegen. Die Fenster in all den grossen und kleinen Häusern blinkerten lustig, die Kühe bimmelten weit oben auf den Almen mit ihren Glocken, der Bach schäumte und plätscherte, bis weit hinunter konnte man ihn verfolgen. Auf dem Gras, das zwischen den Steinen im Schatten wuchs, stand noch der Tau, und auf der andern Talseite drüben war’s noch frisch, und leichter Morgendunst lag dort. Den zweien aber wurde es schon heiss im Aufwärtssteigen.
Hansi suchte nach den Knechten und Dirnen, die zum Heuen ausgegangen waren, und entdeckte sie bald da und bald da, hoch oben, und zeigte sie der Mutter. Das lebhafte, bewegliche, mehr zugreifende Temperament der Mutter vereinigte sich bei ihm ganz glücklich mit der nichts überstürzenden, etwas zu bedächtigen Art des Vaters; das Aufbrausende und ganz unerwartet Hervorbrechende hatte er auch vom Vater. Seine ganze kräftige und schon hochgewachsene Gestalt sah nach Leben und Gesundheit aus, und wie er droben neben Anderl stand, schon fast so gross wie der Fünfzehnjährige, und wie sein rotbackiges Gesicht von dem gelbbraunen Anderls abstach, fuhr dem alten Kuchler ein Fluch heraus. „Schamst di nit, Anderl? Is dös aar a Bua? Schau ’n Hausi an.“ Aber Anderl streckte sich nicht etwa oder hielt sich gerader deshalb, er zog den Kopf nur noch mehr ein und schielte von unten vor.
Obwohl die zwei Buben fast tagtäglich denselben Weg zur Schule gegangen waren, war nie ein kameradschaftliches Verhältnis zwischen ihnen gewesen. Hansis stolzem, geradem Sinn widerstrebte das scheue, verschlossene und unterwürfige Wesen Anderls; seine Anschauung hatte er dem Blöden sehr oft durch Püffe oder durch eine Tracht Prügel gezeigt. Was Anderl von allen, vom Vater, vom Lehrer, sogar von der Juli hörte, die sonst ganz gut mit ihm war, das „Scham di!“ oder „Schamst di nit?“ hörte er auch oft genug von Hansi, und er hatte nie eine Freude, den Malseinerbuben zu sehen, wie dieser sich auch sobald als möglich von Anderl losschrauben wollte.
„I will doch ’s Poppele sehn,“ sagte er ungeduldig zu der Mutter, die ihm zu wenig Gehör schenkte.
„Ja, ja,“ nickte die Bäuerin zerstreut.
Anderl sprang voraus, das war auch ihm recht. ‚Das Poppele‘ war auch ihm gegenwärtig das Liebste.
Während die Malseinerin den alten Starrkopf zu bearbeiten suchte, dass er die Moidl wieder aufnähme, sass Hansi bei der Juli in der Kammer auf einem kleinen Schemel und hatte die Nann auf den Knien liegen. Schon lange hatte er sich ein Schwesterchen gewünscht, einen kleinen Spielkameraden, jemand, den er an der Hand über die steilen Wiesenmähder hätte führen können bis hinauf zu den kleinen Stadeln, wo man weit, weit bis ins Dux und gegen das Zillertal zu, nach Navis und über den Brenner sehen konnte, wo alles im Sommer voller Blumen stand, dass man sich nichts Schöneres denken konnte als dort liegen und den blauen Himmel ansehen; jemand, mit dem er über die Steilhänge hätte herabrollen können, der mit ihm schrie und jauchzte vor Lust – einen kleinen Kameraden zum Rodeln im Winter, wo er wie der Sturmwind über die Halden sauste, eine Gefährtin beim Schneeballen, die seine grossen Schneemänner, seine Wälle, seine Schneehäuser bewundert hätte, ein kleines Schwesterchen, dem er seine Schnitzarbeiten zeigen, dem er Spielsachen hätte schnitzen können. Gerade jetzt, wo er nur des Sonntags zur Schule ging und ihn der Vater noch nicht immer zur Arbeit anhielt, ging’s ihm ab, und er hatte oft die Mutter gequält, dass sie ihm ein ‚Poppele‘ bestellen solle, aber ein Schwesterchen musste es sein, von einem Bruder wollte er nichts wissen.
„Wenn sie grad schon grösser wär’“, sagte er nachdenklich und etwas geringschätzig zur Juli und gab ihr die kleine Nann. Nie war ihm in den Sinn gekommen, mit Juli zu spielen, die ihm im Alter doch näher stand als der Anderl. Er war ja oft genug zu der Kuchlerin heraufgekommen, war viel bei ihr im Garten gewesen, aber nie erinnerte er sich, mit der Juli gespielt zu haben. Er hiess sie nur die Zigeunerin und mochte ihr krauses, wirres Haar, das bronzefarbene Gesicht, ihre pechschwarzen, etwas glanzlosen Augen nicht leiden.
Dagegen gefiel ihm die weisse kleine Nann mit den gelben Löckchen sehr.
„Da schau grad’ die feinen Haarlen an und die kloan Fingerlen! I muass sie glei der Muatter zeig’n,“ und eilends nahm er sie wieder Juli ab und stieg hinunter.
„Da schau, Muatter, ’s Poppele, wie nett es ischt.“
Die Mutter nahm’s ihm vom Arm.
„Wie a Engerl, gelt, Kuchler, ma muss es ja gern hab’n, das arme Heiterl!“
Aber der Kuchler stand am Fenster, drehte ihr den Rücken und tat, als höre und sehe er nicht. Erst als Hansi gegangen war, gab er seinen Platz am Fenster wieder auf, und auf seinem Gesicht stand deutlich zu lesen: ‚Was willst du denn noch? Ich brauch’ niemand von Malsein in meinem Haus,‘ und die Sprache war so deutlich, dass die Malseinerin sich gleich zum Gehen anschickte.
„Also, Kuchler“, sagte sie, „es bleibt dabei, du nimmscht die Moidl nit?“
„I nit.“
Die Malseinerin hatte auch ihren Trotz, und jäh, wie sie war, fuhr’s ihr heraus: „Na nimm ich sie.“
Der Kuchler lachte. „G’halt sie nur, i wünsch’ dir Glück dazua!“
Nun musste sie eben sehen, wie sie den Malseiner herumbrachte, auf der Alm war Arbeit genug oben und immer eins zu wenig, da konnte man sie fürs erste schon aus dem Weg räumen.
Die Juli ging noch ein gutes Stück Weges mit und kam dann mit all ihren Sorgen und bat um Rat.
„Sei du nur brav, Juli, es wird schon gehn, i will gern nachschaug’n“, war der Malseinerin letztes Wort. „Du musst es dem armen Hascherl seiner Muatter zulieb tun, wenn der Vater nix von ihm wissen will.“