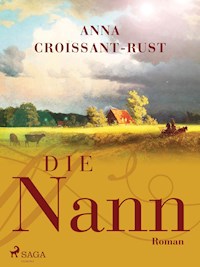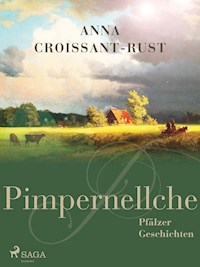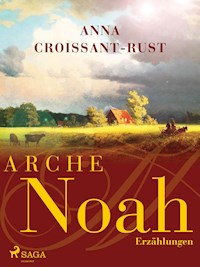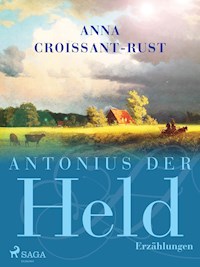
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Buch berichtet von der Freundschaft zwischen dem jungen Toni und der mütterlichen Lene. Von seinen Eltern, der Schwester und den Altersgenossen verachtet, wächst Toni freudlos und ohne Liebe heran. Da ist es ein Glück, dass er in Lene einen Beistand gewinnt, der auf seine weitere Entwicklung einen sehr positiven, heilsamen Einfluss auszuüben vermag. Und schließlich gelingt es Toni, sich auf dramatische Weise vor allen zu bewähren ... Anna Croissant-Rust zeigt in diesem Buch einmal mehr ihre Meisterschaft in der genauen Charakter- und Milieuzeichnung, in der Schilderung des beengenden Dorfmilieus und im souveränen, naturalistischen Umgang mit dem Dialekt, indem sie dem Volk in jeder Hinsicht "aufs Maul schaut". Dadurch entsteht ein realistisch und voller Mitgefühl und Einfühlungsgabe gezeichnetes, anrührendes Lebensbild.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 122
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anna Croissant-Rust
Antonius der Held
Saga
Anna Croissant-Rust
Vom Blickpunkt der erd- und landschaftsverbundenen Dichtung unserer Tage aus betrachtet, erscheint uns die deutsche Heimatkunst um die Jahrhundertwende gewöhnlich als „Tochter des Naturalismus“ und damit mehr oder weniger als Erfüllung aufgestellter Leitsätze. Man spricht sie gern als gewollte, bewusste Heimatkunst an. Doch ist nicht zu übersehen, dass sich unter den damaligen Heimatdichtern auch wurzelechte, bodenständige Gestalten finden, die, frei von gedanklichen Zielsetzungen, offenen Sinnes aus übervollem Herzen schufen. Sie sind ragende Vorposten unserer aus Schollenkräften gewachsenen Dichtung.
Zu diesen Vorposten zählt Anna Croissant-Rust. Mit grosser Unmittelbarkeit schaut diese Dichterin in Leben und Welt. Als ursprüngliche Seele hält sie sich frei von programmatischen Absichten, und selbst dort, wo sie mit den Stilmitteln des Naturalismus gestaltet, wächst sie weit über diesen hinaus. Sie ist auch geschützt gegen Gefahren der Einförmigkeit, denn jedes Werk beginnt sie aus neuem Grund zu heben. Darum auch die leuchtende Farbigkeit und blühende Fülle. Vielen ihrer Werke ist ein dauernder Platz in der deutschen Prosadichtung sicher.
Anna Croissant-Rust wurde am 10. Dezember 1860 in Bad Dürkheim in der Rheinpfalz geboren. Dem Geburtsland und dem pfälzischen Einschlag vieler Werke verdankt sie es, dass die Leser in ihr meist eine Pfälzer Dichterin sehen und ihren Humor dem Weinland zuschreiben. Aber vielleicht ist ihre bäuerliche Herkunft mütterlicherseits aus dem Altbayerischen wichtiger. Gerade diesem Bluteinschlag verdankt sie wohl den oft gerühmten unbestechlichen, ja herben Wirklichkeitssinn mit dem tiefdringenden Blick, dem bodenständigen Naturgefühl und dem tapferen Gemüt. Selbst ihr Humor ist sachlich.
Die Bücher der Croissant gehören zu denen echter Dichtung, wo plastisch etwas gestaltet ist und wo Handlung abrollt. Der Stoffkreis ihrer Werke umspannt immer wieder pfälzisches Dorf- und Kleinstadtleben und Tiroler Bauerndasein. Auf ihrem Hintergrund lässt sie Zustände und Schicksale erwachsen. Es scheint fast, als wollten sich in der stofflichen Zweiheit die beiden Elemente ihres Bluterbes ausdrücken. Wo sie durch die Verhältnisse, etwa einer Kleinstadt, Plottes und Alltägliches gefördert sieht, haftet den Menschen in ihren Augen Schrulliges, Lächerliches, ja vernichtend Komisches an; wo aber ein bäuerlicher Mensch wie Antonius gegen feindliche Gewalten ankämpft, trägt er für sie ein tragisch-heldenhaftes Gesicht. Zwischen beiden Gegensätzen wechseln ihre Werke in lebendigem Rhythmus ab.
Die frühen Arbeiten der Dichterin, Erzählungen und Dramen, beschwören eine düstere Welt. Das herbe Bauerndrama „Der Bua“ (1897) stellte einige Zeit vor Ludwig Thoma die bajuwarische Bauernseele auf die Bühne. Mit den Pfälzer Geschichten „Pimpernellche“ (1901) setzt Humor ein. Er schlägt in der Sammlung „Ausunseres Herrgotts Tiergarten“ (1906) öfters ins Tragische um, wenn sich der Wesenskern von originellen Taugenichtsen in der Maske der Komik enthüllt. Fast ganz den ernsten Ton beherrscht der Volksroman „Die Nann“ (1906). Er erzählt das harte Leben eines Tiroler Mädchens, das durch sieghafte Reinheit alle Fährnisse überwindet. Die meisterhafte Romanerzählung „Winkelquartett“ (1908) ist als Kleinstadtgeschichte wieder ganz auf Humor gestellt. Unvergessliche Sonderlingsgestalten gehen durch das Buch. Als Gegenstück zur „Nann“ gilt die grosse pfälzische Gutsgeschichte „Der Felsenbrunner Hof“ (1910). Ein Mensch kämpft sich durch, mit leidenschaftlichster Anspannung seines Willens. Einen neuen „Tiergarten“ bringt die „Arche Noah“ (1911). Der nächste Roman „Unkebunk“ (1921) ergreift die Lebenswelt einer kleinen Garnisonsstadt. Die beiden Wesensseiten ihrer Dichtung, die komische und heldenhaft-tragische, finden sich in der letzten Sammlung „Kaleidoskop“ (1921) in schönen Geschichten vereinigt.
Das beste Werk darunter ist der hier abgedruckte „Antonius, der Held“. Diese Geschichte, entstanden während des Krieges, ist in ihrem tapferen Gehalt der schönste Beitrag der Dichterin zum vaterländischen Schrifttum. Eine Kindererzählung könnte man sie nennen, da die rührende Freundschaft zwischen dem verkannten Toni und der mütterlichen Lene die seelische Mitte bildet. Das Werk ist mit seiner urtümlichen Kraft und holzschnittartigen Einfalt das süddeutsche Gegenstück zu Storms „Pole Poppenspäler“. Wie ist der Toni dargestellt! Er, der von Eltern, Schwester und Altersgenossen verachtet wird, ohne Liebe aufwächst und in einen Zwiespalt der Seele hineintreibt! Und dabei ist er doch ein stiller Wisser und Herrscher in seinem Reich, der durch die Firmung zu heldenhafter Festigkeit gestärkt wird und sich schliesslich vor allen andern bewährt. Ein Stück deutschen Landes steigt plastisch umrissen auf, scharfkantige Gestalten mit ihren Schwächen und Vorzügen sehen wir ein zeitloses Dasein in Tal und Gebirge dahinleben. Durch die Geschlossenheit und das meisterhafte Steigerungsgefüge ist die Antoniusgeschichte bezeichnend für Anna Croissants Kunst überhaupt. Wie überall beherrscht auch hier den Sprachstil das zieltreffende, anschauliche Wort. Ein feines Empfinden für Tonfall und Eigenwesen der Mundart lebt in der Erzählung. Bei aller Naturtreue der Darstellung schwingt sie in dichterischer Sprache.
Dr. Ferdinand Denk
Antonius der Held
Hoch oben, wo im Mai noch die Frühjahrsheide blüht und der kleine leuchtend blaue Enzian an den sonnigen Hängen gerade anfängt, seine Sterne aufzutun, stand das Haus des Raschötzers. Vom Tal aus konnte man nur das Dach des grossen Futterhauses sehen; man musste dazu den Kopf schon ziemlich tief in den Nacken legen, so hoch und steil war’s da hinauf. Das Haus selbst aber hatte sich hinter den grünen Buckel versteckt, den es dem Berg einfiel, gerade da zu machen, wo der böseste Wind herwehte. Es war aber noch rauh genug, und das Heidekorn, das der Raschötzer baute, musste er zeitig säen und nicht erst nach dem Roggen, wie sie’s weiter unten taten, wollte er seine Plentenknödel noch im gleichen Jahre essen. Eine Kuh konnte man auf Raschötz ernähren, daneben eine Geiss und ein paar Schafe, mehr aber nicht. Das Häusel war klein, mit ganz winzigen Fenstern, des bösen Windes wegen, der von den Bergen herunterfiel; es war altersbraun wie das Futterhaus, das sich hoch über den Rain aufreckte, wie wenn es dem kleinen und geduckten Häuschen den Vorrang streitig machen wollte.
Des Raschötzers Vater war aus dem Krautwelschen drüben eingewandert und hatte das armselige Heimatl um ein Billiges erworben, weil keiner so hoch oben hausen wollte. Er war ein finsterer, schwarzbrauner Mann, der sich um die Leute im Tal nicht scherte, ohne Weib kam und allein mit seinem Sohn hauste. Der Sohn war um ein weniges zutunlicher geraten, obwohl auch in ihm ein Stück von der finsteren Art des Alten steckte. Die Talleute hatten es nie mit dem Krautwelschen da droben gehalten, der ihnen nicht einmal einen Gruss gab: also blieb’s auch beim alten, als der junge Bursche erwachsen war und öfter ins nächste Dorf kam, das tief in der Mulde unten lag, und zu dem er eine Stunde brauchte, wenn er hinuntersprang, oder ins Städtchen, das er erst in drei Stunden erreichte. Die Leute redeten mit ihm — ja, so halb über die Achsel, die Worte fielen ihnen nur gerade aus dem Munde, oder sie warfen sie ihm förmlich hin, besonders die Dirnen, die gleich die Lippen schürzten, wollte er freundlich oder gar zutraulich werden.
So musste er sich nach dem Tod des Alten eine Frau aus dem Krautwelschen holen, und wäre nicht fast jedes Jahr die Amme hinaufgestiegen, um der Raschötzerin einen Buben oder ein Mädel, einmal sogar einen Buben und ein Mädel, in die Welt setzen zu helfen, die Bauern im Dorf und die weit unten im Tal hätten kaum daran gedacht, dass da oben hinter dem Raschötzer Buckel noch Menschen hausten. Leben blieben die vielen Kinder nicht, sie kamen und gingen, und im Dorf sagte man: „Wieder eins vom Raschötzer“, wenn die weise Frau eins in die Kirche trug oder ein kleiner Sarg versenkt wurde. Die Raschötzerin war froh, dass zuletzt nur ihrer zwei mit aus der Schüssel assen, der Toni und die Warwe. Es war schwer genug, die beiden Mäuler zu stopfen, besonders dem Toni seines, das nie genug kriegen konnte. Zur Arbeit war der Toni gerade nicht schlecht zu gebrauchen, so klein er noch war, wenn’s auch recht langsam ging. Aber wenn das Essen auf dem Tisch stand, liefen seine Füsse von selbst ins Haus. Essen war ihm das Wichtigste und Höchste im Leben. Was wusste der Toni sonst vom Leben! Das Haus, das Futterhaus, die graue Kuh, die Schafe, die er liebte, und die Geiss, die er schrecklich fürchtete, weil sein Hosenboden schon ein paarmal eindringlich Bekanntschaft mit ihren Hörnern gemacht hatte, die Hühner, der Hund, Vater und Mutter, die kleine Warwe, das bedeutete für ihn das Leben. Aber eines Tages, der Himmel war blau, und auch oben schien die Frühlingssonne schon so warm, dass die Heide blühte und die Himmelsschlüssel, nahm ihn der Vater mit auf die Waldblösse ober Raschötz, von wo aus man tief, tief hinunter ins Tal schauen konnte, wo die Strasse zog und der Fluss und auf der anderen Talseite drüben Dörfer aufgereiht waren und Weinberge und Burgen und Schlösser, wo unten zwischen Wiesen und Feldern das Dorf lag, dessen spitzer Kirchturm gerade zu ihm heraufschaute. „Do ischt die Stadt“, sagte der Vater und deutete gerade hinunter. „Stadt“, was war das? Da lagen viele Häuser nah beisammen, so nah wie ihre Schafe im Stall nebeneinanderlagen. Von der Stadt hatte er noch nie etwas gehört, vom Dorf unten wohl, denn dahin ging der Vater manchmal. Er hatte es auch schon gesehen, dies Dorf, aber er verband keine angenehmen Vorstellungen damit, denn dort sollte er zur Schule gehen. Das war ihm schon gesagt und angedroht worden, und etwas Gutes konnte das Schulgehen nie und nimmer sein, denn es hiess stets: „Wart ner, wenn du Schuel kimsch!“ Wollte er nicht beten, weil er zu faul oder schläfrig war, schrie ihn die Mutter an: „Kimm du ner Schuel!“ Puffte er die Warwe — gewöhnlich puffte zwar sie ihn —, so drohte sie gleich: „Aber wenn du Schuel kimsch!“ Auf diese Weise bekam er eine heillose Furcht vor der Schule, die gleich nach dem Fegfeuer kam, in dem man elendig verbrennen musste, wenn man der Mutter über die Häfen mit Rahm oder über die gezuckerten Beeren gekommen war. Nein, vom Dorf wollte er nichts wissen, lieber schaute er nach der Stadt, die ihm der Vater noch einmal wies. „Das ischt die Stadt, das ischt Kloschder Gäben, die Stadt Klausen ischt das.“ Jetzt spitzte er die Ohren: Klausen! Klausen giahn! Das war was anderes! Wenn das die Stadt war! Klausen giahn, hiess Zuckerln kriegen und weisses Brot! Wenn nur die Mutter öfter nach Klausen ginge! Im Jahr ein paarmal. Und dann stand er und wartete und lief den Weg ein Stück hinunter und lief ihn wieder zurück vor Angst, er könne nicht mehr heimfinden, und abermals hinunter, der Mutter entgegen. So wartete und wartete er stundenlang, halbe Tage lang und schaute sich die dunkeln Kugelaugen fast heraus, die wie Glasknöpfe aus seinem grossen Kopf standen, immer nach dem Weg hin, den sie kommen musste. Währenddem sprang die Warwe lustig herum, unbekümmert und lachend, wenn sie sich auch einmal sehnsüchtig an seine Seite stellte; die Mutter würde schon kommen, und die Zuckerln waren ihr ja gewiss! Kam sie dann endlich, so flog die Warwe nur so, sie war die Behendere, die Erste bei ihr; sie schwatzte dann und freute sich, man hätte meinen können, sie sei der Mutter den ganzen Nachmittag entgegengelaufen! So machte sie es immer.
Natürlich war sie jetzt auch gleich hinter ihnen her und stellte sich neben den Vater, und ehe er noch fragen konnte, hatte sie schon sechs Fragen getan, und der Vater konnte kaum nachkommen mit Antworten. „Wo ischt die Stadt? Wo ischt Klausen? Han, Vater, wo? Wo ischt die Schuel? I möcht gern Schuel giahn, Vater, i schon. Vater, hörsch? Wo ischt der Eisack? Wo ischt die Bohn? Die Eisenbohn?“ schrie sie. „Schaug, Toni, so schaug decht! Wo fahrt sie hin, die Eisenbohn?“ Aber Tonis runde Augen hingen immer noch am Kloster Säben, das so hochfahrend oben stand und ihm mit seinen vielen blitzenden Fenstern so überaus wohl gefiel. Was war denn das, die Eisenbahn? Bis seine Augen Warwes kleinem Zeigefinger folgten, der hinunter ins Tal zappelte, war die „Bohn“ längst verschwunden, und die Warwe lachte ihn aus „Derf i aa amal Bohn fahrn, Vater“, quälte sie, „gell, wenn i Schuel geh, gell, Vater!“ Und der Vater tröstete: „Ja, ball du Schuel geascht.“
„I geah gern Schuel“, sagte sie und schielte nach dem Toni.
„Hörscht es du, was die Gitsch sagt? Die fürchtet ihr niacht; so schteah do net a so do, red was!“ schrie er ihn plötzlich in ausbrechender Wut an. „Wart ner, wenn du Schuel kimsch, die wer’n dir’s vertreiben! Net oanmal fragscht du; los, was die Gitsch sagt!“
Ja freilich, die Warwe plaudert fort, jetzt erst recht, dass ihm ganz wirblig im Kopf wurde. Zehn Sachen konnte die anschauen, bis er eine sah, und was sie alles sah, und um was sie frug! Doch auf einmal war’s ihr zu langweilig, und mitten drin warf sie den Kopf nach hinten, fing zu singen und zu schreien an und lief davon. Fürchtete sich gar nicht vor dem Vater, wie sie sich nicht vor der Schule, nicht vor der Mutter, nicht einmal vor der Geiss fürchtete. Die hatte ein schönes Leben, die Einsicht war ihm längst gekommen. Toni seufzte schwer. Noch ein paar Monate, dann wurde es richtiger Ernst, dann mussten sie beide zur Schule, da hinunter, wo der spitze Kirchturm heraufschaute. Er jährte sich schlecht, so hatte man ihn über Winter noch zu Hause behalten. Nun durfte er keinen Winter mehr in der warmen Stube auf der Ofenbank liegen neben dem zottigen Hund Lion. War das eine schöne Zeit! Der Toni brauchte nicht neben den Schafen herlaufen, brauchte kein Holz aus dem Wald herbeischleppen und keine Steine von den Wiesen klauben. Konnte nur fort und fort ruhig liegen und zusehen, wie der Schnee runterfiel, und den Vorgenuss des Essens empfinden, das langsam neben ihm im Ofen schmorte, Kraut und Plentenknödel. Und konnte schlafen, so viel und so lange er wollte, wenn ihn nicht gerade die Warwe von der Bank herunterzog, der kleine „sekante Tuifl“.
Vielleicht würde sie doch nicht so sehr jubilieren, wenn sie wirklich in die Schule kam. — Beten konnte sie natürlich schon, während ihn die Mutter immer zankte: „Tuascht gar nicht beten, kann leicht die Warwe mehr.“ Und zum Vater sagte sie oft: „Werd decht no wos aus den Buam wern, wo er lei ans Essen denkt und ans Schlafen un net beten mag.“ Die kleine, magere Mutter hatte alle Hände voll zu tun; sie konnte nicht immer neben dem Toni stehen, ihm die Hände falten oder seine kleinen Daumen packen und ihm ein Kreuz machen lehren über seinen dicken Kopf herunter bis auf die Brust. Man hatte keine Zeit auf Raschötz, sich mit den Kindern abzugeben. Wenn’s Schnee gab, ja, da hatte der Vater Zeit, und es war im letzten Winter gewesen, als er einen Anlauf nahm, den Toni zu erziehen; denn er sollte doch etwas erzogen sein, ehe er zur Schule kam, an welche Notwendigkeit niemand bisher gedacht hatte. Sie lagen alle zwei auf der Ofenbank; der Vater murmelte etwas von Himmel, Hölle und Fegfeuer. Er redete