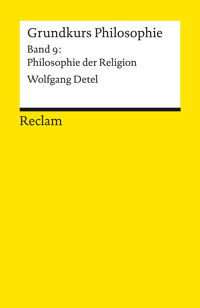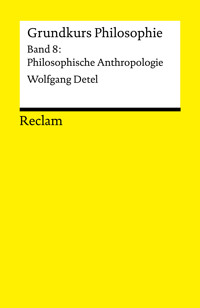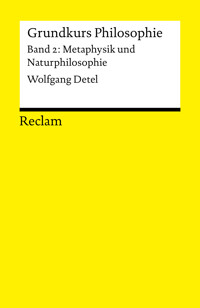6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Reclams Universal-Bibliothek
- Sprache: Deutsch
Aristoteles war der wohl einflussreichste Philosoph für das Mittelalter, prägt aber auch heute noch unser Denken. Seine Überlegungen zu Literatur (»Poetik«), Naturwissenschaft, Politik und Philosophie (»Nikomachische Ethik«, »Metaphysik«) setzen weiterhin Maßstäbe. Um sein gewaltiges und voraussetzungsreiches Werk zu verstehen, ist eine profunde Einführung von großer Hilfe. Wolfgang Detel, anerkannter Spezialist und Aristoteles-Übersetzer, hat sein Standardwerk grundlegend überarbeitet und um die drei neu konzipierten Kapitel »Physik und Theologie«, »Biologie und Psychologie« und »Rhetorik und Poetik« ergänzt. E-Book mit Seitenzählung der gedruckten Ausgabe: Buch und E-Book können parallel benutzt werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 260
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Wolfgang Detel
Aristoteles
Reclam
2005, 2021 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Durchgesehene und erweiterte Ausgabe 2021
Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Made in Germany 2021
RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN978-3-15-961829-6
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-019690-8
www.reclam.de
Inhalt
Aristoteles – Kritiker und Innovator
Dialektik und Analytik
Physik und Theologie
Metaphysik
Biologie und Psychologie
Ethik
Politische Theorie
Rhetorik und Poetik
Neoaristotelismus
Kommentierte Bibliografie
Schlüsselbegriffe
Zeittafel
[7]Aristoteles – Kritiker und Innovator
Es war ungefähr im Jahre 360 v. Chr., als sich eines Tages die führenden Mitglieder der Platonischen Akademie zu einem wichtigen Treffen im großen Vorlesungssaal der Schule einfanden. Unter ihnen befand sich ein junger Thraker von etwa 24 Jahren, der damals bereits rund sieben Jahre in der Platonischen Akademie gelebt, studiert und gearbeitet hatte. Er wusste wie alle anderen Anwesenden auch um die Bedeutung des Ereignisses, das an diesem Tage stattfinden sollte. Platon (um 428–348 v. Chr.), mit seinen fast 70 Jahren immer noch ein kreativer Denker, wollte seinen neuesten Dialog unter dem Namenstitel Parmenides veröffentlichen, d. h. von einem gebildeten Sklaven erstmals vorlesen lassen. Als der Vorleser an jenem Morgen den Vorlesungssaal betrat, herrschte knisternde Spannung. Denn es wurde allgemein erwartet, dass Platon endlich zu den schweren Angriffen gegen seine Formentheorie Stellung nehmen würde, die in den Jahren zuvor seitens einiger führender Akademiemitglieder, z. B. des Mathematikers Eudoxus, formuliert worden waren.
Auch der junge Thraker hatte sich an dieser Kritik beteiligt und wird daher am Tage der Parmenides-Vorlesung besonders gespannt gewesen sein. Und er wird sich, eitel und ehrgeizig, wie er zuweilen sein konnte, nicht wenig geschmeichelt gefühlt haben, als er die Szenerie des neuen platonischen Dialoges kennen lernte: Ein junger, eigenständig denkender Mann mit Namen »Sokrates« formuliert höflich, aber unverblümt die Probleme, die er mit der frühen platonischen Formenlehre verknüpft sieht – unter ihnen auch jene, die der Thraker selbst vorgebracht hatte; [8]und der Gesprächspartner des Sokrates, ein erfahrener philosophischer Meister namens Parmenides, nimmt die Kritik ernst, warnt ihn aber auch vor allzu raschen Antworten und schlägt eine längere und schwierige philosophische Denkübung als Vorbereitung zur Klärung der Probleme vor. Dazu greift er sich als Dialogpartner einen jungen Mann heraus, der Aristoteles heißt (Plat. Parm. 126a–136e, 137b–c).
Für das Auditorium der Parmenides-Lesung stand fest, dass Platon mit dieser Szenerie das kritische philosophische Engagement des jungen Thrakers Aristoteles (um 384–322 v. Chr.) öffentlich anerkennen wollte, ihn aber zugleich zu weiteren philosophischen Überlegungen ermunterte und ihm höchstes philosophisches Niveau zutraute. Die Szenerie des Dialogs Parmenides ist eines von vielen Indizien dafür, dass die Platonische Akademie nicht, wie man lange Zeit angenommen hat, nach Art eines pythagoreischen Ordens organisiert war, in dem nur das Wort des Schulgründers zählte, sondern eine Stätte freier und offener philosophischer Debatten unter gleichberechtigten Mitgliedern war, an denen sogar Frauen teilnehmen durften.1 Das Zusammentreffen zweier der intelligentesten Menschen, die die Geschichte hervorgebracht hat, im anregenden intellektuellen Ambiente einer offenen philosophischen Gemeinschaft führte zu einem einzigartigen theoretischen Innovationsschub. Platon als Wegbereiter neuer Ideen und Aristoteles als Vollender, der den vagen neuen Ideen erst ihre präzise Gestalt gab – dieser Konstellation verdanken wir unsterbliche Erfindungen: Dialektische Argumentationstheorie, formale Logik, analytische Wissenschaftstheorie, essenzialistische Metaphysik, [9]wissenschaftliche Biologie und Psychologie, empirische Theorie des Stadtstaates und Ökonomie, Ethik des guten Lebens, Rhetorik und Poetik – all diese Disziplinen wurden von Aristoteles nicht nur erfunden und entwickelt, sie enthielten auch zentrale Ideen, von denen die Geschichte des westlichen Denkens mehr als zwei Jahrtausende bestimmt werden sollte. Die einzigartige Innovationskraft seines philosophischen Denkens steht daher im Mittelpunkt dieser Einführung.
Die zweite Auflage enthält gegenüber der ersten Auflage eine Reihe von substanziellen Ergänzungen: Die aristotelische Psychologie wird nun ausführlicher dargestellt. Daher wird das ursprüngliche Kapitel über Physik, Theologie und Biologie in zwei eigenständige Kapitel über Physik und Theologie sowie über Biologie und Psychologie transformiert. Auf diese Weise kann der aristotelischen Auffassung, dass die Theologie ein Bestandteil der Physik und die Psychologie ein Bestandteil der Biologie ist, besser Rechnung getragen werden. Das Kapitel über Metaphysik wurde vollständig überarbeitet und erheblich erweitert. Insbesondere werden Inhalt und theoretische Relevanz des VIII. Buches der Metaphysik sowie die systematische Einheit von Buch VII und VIII als Kern der reifen Metaphysik deutlicher herausgearbeitet. Und schließlich werden Rhetorik und Poetik, die in der ersten Auflage nicht näher berücksichtigt wurden, in Gestalt eines neuen Kapitels gewürdigt.
[10]Dialektik und Analytik
Die sokratische Idee, so wie Platon sie gedeutet hat, ist im Kern die Forderung, nicht einfach unter dem Diktat unserer natürlichen urwüchsigen Wünsche und Begierden durchs Leben zu trudeln, sondern zu klären, was ein gutes Leben für uns wäre, welche Art von Mensch wir sein wollen und wie wir unsere Vorstellungen von einem guten Leben realisieren könnten. Dieser Klärungsversuch muss, der sokratischen Idee zufolge, von einer kritischen und argumentativen Prüfung verschiedener Entwürfe von Lebensprojekten begleitet sein. Wir sollten also ein geprüftes Leben führen. Damit treten wir in das Spiel des Gebens und Einforderns von Gründen ein – wir gehen aus dem Reich der Natur unserer gegebenen Präferenzen in den logischen Raum der Gründe über. Dieser Schritt liegt in unserem wohlverstandenen rationalen Eigeninteresse und ist die allgemeinste Form der Bildung (paideia). Die klare Artikulation dieser großen Idee ist ein bedeutendes Verdienst Platons.
In diesem praktischen Kontext wird die Frage wichtig, welche Gründe gute Gründe sind und wie wir zwischen guten und schlechten Begründungen unterscheiden können, und zwar unabhängig von dem Gegenstandsbereich, über den wir reden. Diese spezifische Unterscheidungsfähigkeit nennt Aristoteles »Bildung« – ganz im Geiste Platons, aber präziser als sein großer Lehrer (PA 639a 1–15).
Bemerkenswert ist dabei die klare Unterscheidung zwischen der inhaltlichen und formalen Beurteilung einer Argumentation. Die formale Beurteilung eines Arguments erfordert kein inhaltliches Wissen, sondern nur [11]methodisches Wissen. Damit können wir prüfen, ob die Prämissen eines gegebenen Arguments, wenn sie wahr sind, gute Gründe für die Konklusion des Arguments abgeben, ohne dass geprüft werden müsste, ob die Prämissen wirklich wahr sind. Hier liegt der entscheidende Grund dafür, dass die formalen Disziplinen, die dieses methodische Wissen entfalten, nicht auf einen spezifischen sachlichen Gegenstandsbereich gerichtet sind und allein nicht für einen Zugewinn an sachlichem Wissen ausreichen (Top. I 1, 100a 18–20).
Vor Aristoteles gab es weder eine klare Unterscheidung zwischen der inhaltlichen und formalen Beurteilung einer Argumentation noch auch nur einen Ansatz zu einer Ausarbeitung formaler Disziplinen. Es ist eine der größten innovativen Leistungen des Aristoteles, eine solche Ausarbeitung zum ersten Mal – und bereits auf hohem Niveau – vorgelegt zu haben. Er hat dabei sogar schon zwischen methodischen Standards allgemeiner Gesprächsführung (Dialektik) und strengen Regeln des korrekten Schließens (Syllogistik) unterschieden.
Die Dialektik als formale Technik der Unterredung und Diskussion lehrt, wie wir beliebige Thesen, die von unseren Diskussionspartnern präsentiert werden, auf ihre Begründbarkeit oder Widerlegbarkeit prüfen können. In seiner Schrift Topik hat Aristoteles die formale Technik der Unterredung in außerordentlich differenzierter Form ausgearbeitet. Wir können uns hier nur einige allgemeine Richtlinien und Beispiele vor Augen führen, um einen Eindruck von der aristotelischen Topik zu gewinnen.2
Der Ausdruck »Topik« ist abgeleitet vom griechischen Begriff topos für »Ort« oder »Raum«. Ein dialektisches [12]Gespräch im Sinne der Topik ist eine Unterhaltung zwischen einer Person, die eine These aufstellt und zu begründen versucht (Proponent), und einer Person, die diese These und ihre Begründung zu widerlegen versucht (Opponent). Die Topik soll Richtlinien für Begründungen und Widerlegungen von Thesen entwickeln, Fehler aufzählen, die ein Proponent oder Opponent machen kann, und argumentative Schachzüge vorschlagen, die vor allem der Opponent benutzen kann, um den Proponenten möglichst lange über die Stoßrichtung der Widerlegung im Unklaren zu lassen. Die Arten dieser Richtlinien, Fehler und Schachzüge heißen »Örter« (Topoi), daher der Name »Topik«, Lehre von den Örtern.
Bevor Aristoteles die formalen »Örter« bestimmt, trifft er einige terminologische Bestimmungen über die Technik der Unterredung. Allgemeine Aufgabe der Topik ist es, eine Methode zur Bildung von wahrscheinlichen Schlüssen und zur widerspruchsfreien Diskussion von beliebigen vorgelegten Problemen und Thesen bereitzustellen (Top. I 1). Ein Schluss ist nach Aristoteles eine notwendige Folgerung aus vorausgesetzten Prämissen. Ein demonstrativer Schluss beruht auf wahren Prämissen, ein dialektischer Schluss auf wahrscheinlichen Prämissen (dabei ist wahrscheinlich oder plausibel all das, was alle oder doch die meisten Menschen oder zumindest alle Weisen oder doch die meisten Weisen für wahr halten). Ein eristischer Schluss endlich gründet auf nur scheinbar wahrscheinlichen Prämissen oder stellt eine Folgerung dar, die nur scheinbar ein guter Schluss ist.
Wenn wir plausible dialektische Prämissen finden und angemessene dialektische Schlüsse konstruieren wollen, müssen wir die speziellen logischen »Örter« (Top. II 2, [13]109a) beachten. Dabei sollten wir vor allem die Homonymien und Synonymien berücksichtigen, dürfen also gleichlautende Wörter nicht als bedeutungsgleich und bedeutungsgleiche Wörter nicht als notwendig gleichlautend ansehen. Damit macht Aristoteles klar, dass wir in dialektischen Gesprächen sorgfältige Bedeutungsanalysen voraussetzen müssen, weil für gute Schlüsse semantische Konsistenz unabdingbar ist, wie bereits Sokrates in Platons Dialogen demonstriert hatte.
Nun kann eine dialektische Argumentation (a) von Prämissen ausgehen, denen die jeweiligen konkreten Gesprächspartner zustimmen, oder (b) von Prämissen, die zusätzlich auch von allen oder den meisten Menschen oder doch zumindest von allen oder den meisten Weisen als zutreffend angesehen werden (Top. I 1, 100a–b). Der Fall (b) stellt eine weitaus schärfere Bedingung für die Akzeptanz einer Prämisse dar. Wir können daher von zwei Formen der Dialektik sprechen, einer Dialektik ad hominem (a) und einer allgemeinen Dialektik (b).
Wer die Technik der dialektischen Diskussion lernen will, muss nach Aristoteles auch ein metaphysisches Basiswissen haben, das für die Bestimmung der logischen Örter relevant ist. So bestimmt er beispielsweise (Top. I 4–5):
Jeder prädikative Satz der Form »A ist B« oder, invers formuliert, »Das B kommt dem A zu« hat eine von vier möglichen Formen: (a) B ist Definiens von A; (b) B ist Gattung oder spezifische Differenz von A; (c) B ist Proprium von A; (d) B ist Akzidenz von A. Diese Formen werden genauer bestimmt: B ist Definiens von A, wenn B das A identifiziert (z. B. »vernünftiges Lebewesen« für »Mensch«). B ist Gattung von A, wenn B dem A notwendigerweise [14]zukommt; und A ist spezifische Differenz von B, wenn A der engste Unterbegriff ist, der zusammen mit der Gattung von B das Definiens von B bildet (z. B. »Lebewesen« ist Gattung von »Mensch«, und »vernünftig« ist spezifische Differenz von »Mensch«, wenn »Mensch« sich durch »vernünftiges Lebewesen« definieren lässt). B ist Proprium von A, wenn B zwar nicht essenziell ist für A, wenn aber B stets allen und nur den As zukommt (z. B. »fähig zu lachen« für Menschen). B ist Akzidenz von A, wenn B den As zukommen oder auch nicht zukommen kann, also eine kontingente Eigenschaft der As ist (z. B. »musikalisch« für Menschen).3 Jetzt können wir uns einige Beispiele für logische Örter ansehen4:
(a) Behauptet der Proponent »A ist B« in der Weise, dass B Akzidenz von A ist, dann kann der Opponent versuchen zu zeigen, dass B Proprium oder Gattung oder spezifische Differenz von A ist (und umgekehrt). Das kann unter anderem so geschehen: Ist B Akzidenz von A, so auch C, wenn C Gegensatz von B ist; der Opponent könnte also zu zeigen versuchen, dass ein Gegensatz von B etwa Gattung eines Dinges ist (Top. II 2, 109b–110a).
(b) Behauptet der Proponent »A ist B« in der Weise, dass B Gattung von A ist, so kann der Opponent nachzuweisen suchen, dass es As gibt, die nicht B sind, denn wenn B Gattung von A ist, kommt B allen As zu (Top. II 3, 110a).
(c) Man darf nicht Gattung und Differenz verwechseln. Wer z. B. behauptet, das Staunen sei ein Übermaß an Verwunderung, setzt sich dem Einwand aus, dass [15]Staunen nicht eine Art von Übermaß, sondern eine Art von Verwunderung ist – nämlich eine übermäßige Verwunderung. Man sollte auch nicht Gattung und Materie von Dingen verwechseln. Wer z. B. sagt, Wind sei bewegte Luft, liegt falsch, denn Luft ist nicht Gattung, sondern materieller Träger von Wind – Wind ist eine Bewegung der Luft (Top. IV 1, 121a).
(d) Behauptet der Proponent »A ist B« in der Weise, dass B Proprium von A ist, dann kann der Opponent zu zeigen versuchen, dass es As gibt, die nicht B sind, oder dass es Bs gibt, die nicht A sind (Top. II 4, 111b).
Oft stellen Proponenten oder Opponenten in ihren Diskussionen Definitionen auf. Aristoteles macht daher in der Topik auch einige allgemeine Bemerkungen zu angemessenen Definitionen, die aus Gattung und spezifischer Differenz bestehen (Top. I 8, 103b) und natürlich ebenfalls als logische Örter verwendet werden können; auch diese Bemerkungen setzen Einsichten der frühen essenzialistischen Metaphysik voraus (Top. VI 1–2):
(i) Eine Definition ist angemessen, wenn ihr Definiens (a) deutlich ist, (b) keine überflüssigen Zusätze enthält, (c) Proprium für das Definiendum ist, (d) die Essenz des Definiendums angibt, (e) zur Erkenntnis des Definiendums beiträgt, (f) nicht zirkulär ist, (g) mindestens Gattung und spezifische Differenz angibt.
(ii) In (i) ist (d) – die Angabe der Essenz – im Wesentlichen auf (c), (g) und (e) reduzierbar: Die Essenz eines Dinges anzugeben heißt, Merkmale anzugeben, die insgesamt ein Proprium des Dinges sind, seine Gattung und [16]spezifische Differenz enthalten und explanatorisch fruchtbar für weitere Merkmale des Dinges sind.
Definitionen sind nach der Topik also nicht Explikationen von Wortbedeutungen, sondern wahre universelle Sätze über die Welt, die ein Ding identifizieren und erklären können.
Allgemein wird das methodisch angeleitete dialektische Gespräch nach Aristoteles durch zwei neutrale Bedingungen bestimmt: durch das Konsensprinzip und das Nicht-Widerspruchsprinzip. Der Proponent darf demnach nur fortfahren, wenn der Opponent seinen Thesen zustimmt (Konsens), und er muss einräumen, dass seine These unhaltbar wird, wenn der Opponent ihn zwingen kann, im Rahmen des Begründungsversuchs mindestens einmal einen Satz und dessen Negation zu behaupten (Widerspruch). Wie könnte man die beiden wichtigsten Aspekte einer fairen Diskussion besser charakterisieren?
In der Topik arbeitet Aristoteles, wie wir gesehen haben, unter anderem mit der Unterscheidung zwischen wissenschaftlichen, dialektischen und eristischen Schlüssen. Bei der Kennzeichnung der eristischen Schlüsse deutet er an, dass diese Schlüsse nur scheinbar gültige Schlüsse sind. Was ist genauer ein gültiger Schluss? Diese nahe liegende und zugleich schwierige Frage hat sich Aristoteles offensichtlich in einer Reflexion auf seine Topik gestellt. Das können wir aus den Anfangskapiteln des ersten Buches seiner Ersten Analytik erschließen, die allein ihn schon für immer unsterblich gemacht hätten (APr. I 1–7). Diese Kapitel enthalten nämlich das Herzstück seiner Syllogistik und damit die Erfindung der formalen Logik, die in der späteren [17]Antike und im Mittelalter auf raffinierte Weise weiterentwickelt wurde.
Aristoteles selbst nennt seine Syllogistik »Analytik« (Metaph. VII 12, 1037b 9, NE VI 3, 1139b 27). Hintergrund dieser Bezeichnung ist die Idee, dass befriedigendes Wissen oder eine gute Theorie vor allem die Kenntnis der wichtigsten Elemente des jeweiligen Gegenstandsbereichs umfasst. Die methodische Zerlegung eines komplexen Gegenstandsbereichs in einfachere oder einfachste Bestandteile heißt bei Aristoteles »Analyse« (Metaph. IX 10, AN. III 6; NE III 3, 1112b 20–24), und die Zusammensetzung der einfachsten Bestandteile zum gegebenen komplexen Gegenstandsbereich wurde später »Synthese« genannt. Das analytisch-synthetische Verfahren blieb seit Aristoteles für rund zweitausend Jahre das Leitbild für die Etablierung einer wissenschaftlichen Theorie. Die raffinierte Ausgestaltung dieses Leitbildes in einer wissenschaftlichen Analytik führte bei Aristoteles zu der historisch ersten explizit formulierten formalen Logik und Wissenschaftstheorie.5
Die methodische Analyse, wie Aristoteles sie versteht, kann auf verschiedene Gegenstandsbereiche angewendet werden, etwa auf Mittel-Zweck-Relationen in der Ethik oder auf geometrische Figuren. Wenn wir beispielsweise genauer erklären wollen, warum Sokrates junge Leute einer gezielten Befragung unterzog, damit sie über ihr Leben nachzudenken beginnen, dann könnte eine Antwort sein, dass Sokrates die gezielte Befragung dazu benutzte, um die Auffassungen der jungen Leute einem Konsistenztest zu unterziehen und sie auf Widersprüche in ihren Meinungen aufmerksam zu machen, und dass er dies wiederum als [18]Mittel für eine Hinführung zur Selbstreflexion benutzte. Auf diese Weise können wir die ursprüngliche – latent komplexe – Mittel-Zweck-Relation in zwei einfachere Mittel-Zweck-Relationen auflösen und damit besser durchschauen. Und eine Erklärung der ursprünglichen Mittel-Zweck-Relation bestünde im Wesentlichen darin, sie aus den einfacheren Mittel-Zweck-Relationen wieder zusammenzusetzen (NE III 3). Oder wenn wir auf eine geometrische Figur schauen, etwa auf das Dreieck im Halbkreis, dann brauchen wir nur ein oder zwei geeignete weitere Hilfslinien zu ziehen, die das gegebene Diagramm feiner analysieren, um den Beweis für den Thales-Satz zu erkennen, der behauptet, dass alle Dreiecke im Halbkreis rechtwinklig sind (Metaph. IX 9, 1051a). Allgemein ist das Beweisverfahren der euklidischen Geometrie ein paradigmatischer Fall des analytisch-synthetischen Verfahrens. Denn Kreis und Gerade galten als einfachste Elemente des geometrischen Kontinuums, und deshalb mussten euklidische Beweise mit Zirkel (=Kreis) und Lineal (=Gerade) geführt werden: Was sich mit Zirkel und Lineal effektiv konstruieren ließ und sich damit als aus Kreis und Gerade zusammengesetzt erwies, galt als euklidisch beweisbar und geometrisch existent.
Die Syllogistik ist ein weiterer wichtiger Fall von Analytik, wie sich an ihren wichtigsten Elementen zeigt (APr. I, 1–6):
Ein syllogistischer Satz hat eine der vier folgenden Formen: (i) Das A kommt allen Bs zu (abgekürzt AaB); (ii) das A kommt keinem B zu (abgekürzt AeB); (iii) das A kommt einigen Bs zu (abgekürzt AiB); (iv) das A kommt einigen Bs nicht zu (abgekürzt AoB). Dabei sind A und B Variablen für [19]einstellige universelle Begriffe und a, e, i, o die syllogistischen Relationen, also die entscheidenden logischen Konstanten der Syllogistik.
Ein syllogistischer Schluss ist ein Schluss, der genau zwei syllogistische Sätze als Prämissen und einen syllogistischen Satz als Konklusion enthält, derart dass die beiden Prämissen einen universellen Begriff teilen und der syllogistische Schluss eine der drei folgenden Formen hat:
(1) AxB, BxC ⇒ AxC
(2) BxA, BxC ⇒ AxC
(3) BxA, CxB ⇒ AxC
Dies sind die drei syllogistischen Figuren. Dabei ist B der gemeinsame Begriff oder Mittelbegriff, während A und C Außenbegriffe sind. Der Mittelbegriff ist entweder Subjekt der ersten und Prädikat der zweiten Prämisse (wie in (1)) oder Prädikat beider Prämissen (wie in (2)) oder Subjekt beider Prämissen (wie in (3)).
Wenn wir in den syllogistischen Figuren für die Variable x die vier syllogistischen Relationen (a, e, i, o) in allen möglichen Kombinationen einsetzen, erhalten wir 192 (= 3 × 4 × 4 × 4) syllogistische Schlüsse. Die entscheidende Frage lautet dann: Welche der 192 syllogistischen Schlüsse – auch einfach Syllogismen genannt – sind syllogistisch gültig? Diese Frage zu beantworten ist die Aufgabe der Syllogistik, und die Antwort, die Aristoteles fand, bestand in der Entwicklung der ersten formalen Logik der Weltgeschichte.
Die entscheidende Idee ist zu sagen, dass und warum eine kleine Zahl von syllogistischen Schlüssen perfekt und damit formal gültig ist. Hier sind die vier perfekten [20]Syllogismen (samt ihren mittelalterlichen mnemotechnischen Namen), die Aristoteles angibt (der Pfeil steht für eine gültige Deduktion):
A1 AaB, BaC ⇒ AaC (Barbara)
A2 AeB, BaC ⇒ AeC (Celarent)
A3 AaB, BiC ⇒ AiC (Darii)
A4 AeB, BiC ⇒ AoC (Ferio)
Diese Syllogismen sind perfekt oder gültig aufgrund unseres Verständnisses der a-Relation und der e-Relation. AaB verstehen wir beispielsweise so, dass es kein B-Ding gibt, das nicht auch ein A ist (APr. I 4, 25b 39–40, vgl. 24a 18 und 26a 27). Wenn es nun kein C-Ding gibt, das nicht auch B ist, und kein B-Ding, das nicht auch A ist, dann kann es auch kein C-Ding geben, das nicht auch A ist. Denn angenommen, es gäbe mindestens ein C-Ding, das nicht A ist – nennen wir es C* –, dann folgt, dass wenn C* gemäß der zweiten Prämisse in A1 auch B ist, es mindestens ein B-Ding gibt, das nicht A ist, im Widerspruch zur ersten Prämisse in A1. Somit muss A1 schon aufgrund unseres Verständnisses, und damit aufgrund der Bedeutung der a-Relation, gültig sein. Aristoteles erwähnt übrigens die o-Relation und die i-Relation hier nicht, weil, wie er selbst zeigt, A1 und A2 theoretisch ausreichen: A3 und A4 können mittels A1 und A2 bewiesen werden. (APr. I 7)
Ferner ist aufgrund der Bedeutung der syllogistischen Relationen klar, dass gilt (der Doppelpfeil steht für »wechselseitig logisch gültige Deduktion« und »¬« für »es ist nicht der Fall, dass«):
[21]L1 AeB ⇔ ¬ (AiB)
L2 AaB ⇔ ¬ (AoB)
Und schließlich setzt Aristoteles das Prinzip des indirekten Beweises (das er Prinzip der zum Unmöglichen führenden Deduktionen nennt) voraus, z. B. in der folgenden Form:
PI Seien R, S, T syllogistische Sätze, dann gilt:
Wenn die Deduktion ¬ T, S ⇒ ¬ R gültig ist,
dann auch die Deduktion R, S ⇒ T.
Es gibt in den logischen Schriften keine Rechtfertigung von PI, aber weil PI aus dem Prinzip vom ausgeschlossenen Dritten (»p oder nicht-p« gilt für jeden Satz p) folgt und dieses Prinzip in Buch IV der Metaphysik ausführlich gerechtfertigt wird, können wir auch PI als begründet ansehen.
Die Annahmen A1, A2, L1, L2 und PI sind eine hinreichende Grundlage für die nächste Herausforderung, die von der Syllogistik zu bewältigen ist: syllogistisch zu beweisen, welche weiteren Syllogismen formal gültig sind. Dazu musste Aristoteles zunächst bestimmen, was ein guter syllogistischer Beweis eigentlich ist. Und genau für diese Bestimmung griff er erneut auf die Idee des analytisch-synthetischen Verfahrens zurück.
Die grundlegende Idee ist, dass ein syllogistischer Beweis eines nicht-perfekten Syllogismus R, S ⇒ T darin besteht, ihn in perfekte oder bereits bewiesene gültige Syllogismen zu zergliedern oder zu analysieren. Diese Analyse muss dann konkret darin bestehen, die Kluft zwischen den Prämissen R, S und der Konklusion T mit perfekten oder [22]bewiesenen Syllogismen anzufüllen, so dass wir von R und S allein aufgrund bekannter gültiger Syllogismen zu T gelangen. Das allgemeine Beweisschema der syllogistischen Analyse einer Deduktion D (R, S ⇒ T) ist also die Beweisformel
P R, S: D1 (R, S ⇒ X1) – D2 (X2, X3 ⇒ X4) – … – Dn (X n–1, Xn ⇒ T): T
Dabei sind D1, D2, …, Dn perfekte oder bewiesene Syllogismen. Der erste benutzte Syllogismus D1 beginnt mit den Prämissen des zu beweisenden Syllogismus D, und alle weiteren benutzten gültigen Syllogismen verwenden als Prämissen zwei syllogistische Sätze, die vor ihrem Einsatz in der Reihe R, S, Xi auftauchen, bis T erreicht ist. Auf diese Weise wird in der Tat der zu beweisende Syllogismus D in die gültigen Syllogismen D1 – Dn analysiert und wieder zusammengesetzt.
Die ersten syllogistischen Deduktionen, die Aristoteles auf diese Weise beweist, sind nicht syllogistische Schlüsse im definierten formalen Sinn, sondern einfachere syllogistische Deduktionen mit nur einer Prämisse – die sogenannten Konversionsregeln (APr. I 2, 25a 14–25):
K1 AeB ⇒ BeA; K2 AiB ⇒ BiA; K3 AaB ⇒ BiA.
Nach Aristoteles sind von den 188 nicht perfekten Syllogismen, die es insgesamt gibt, lediglich vierzehn syllogistisch gültig. Zwei typische Beweise lassen sich folgendermaßen notieren:
[23](a) Beweis von BaA, BeC ⇒ AeC (Camestres, zweite Figur): BaA, BeC: K1 (BeC ⇒ CeB) – A2 (CeB, BaA ⇒ CeA) – K1 (CeA ⇒ AeC): AeC
(b) Beweis von AiB, CaB ⇒ AiC (Disamis, dritte Figur):AiB, CaB: K2 (AiB ⇒ BiA) – A3 (CaB, BiA ⇒ CiA) – K2 (CiA ⇒ AiC): AiC
Diese Beweise erfüllen offenbar die Beweisformel P, d. h., sie sind genuine logische Analysen.
Zuweilen muss Aristoteles auf einen indirekten Beweis zurückgreifen: Die Prämissen des zu beweisenden Syllogismus werden positiv gesetzt; aber dann wird angenommen, die Konklusion des Syllogismus sei falsch, und diese Annahme wird dann wieder unter Einsatz gültiger Syllogismen zum Widerspruch geführt. Ein Beispiel ist
(c) Beweis von AaB, BiC ⇒ AiC (Darii, erste Figur):AaB, BiC, ¬ AiC: L1 (¬ AiC ⇒ AeC) – K1 (AeC ⇒ CeA) – A2 (CeA, AaB ⇒ CeB) – K1 (CeB ⇒ BeC) – L1 (BeC ⇒ ¬ BiC), aber ¬ BiC steht im Widerspruch zur zweiten Prämisse BiC.
Mit (c) ist einer der vier perfekten Syllogismen (A3) seinerseits bewiesen.
Wenn wir uns die Grundzüge der Syllogistik vor Augen führen, sehen wir sofort, dass die Syllogistik die zentrale Idee der Logik realisiert, wie sie bis heute anerkannt geblieben ist.
Dieser Idee zufolge ist die Logik eine spezielle Theorie des Argumentierens. Sie betrachtet Formen von [24]Argumenten, nicht konkrete Argumente. Es geht ihr nicht nur darum, wichtige Formen von Argumenten voneinander zu unterscheiden, sondern sie will auch beweisen, was gute und zwingende Formen von Argumenten sind. Insofern Argumente immer Folgerungen oder Schlüsse sind und man zwingende Schlüsse auch gültige Schlüsse nennt, kann man die Logik auch als normative Theorie gültiger Schlüsse bezeichnen. Die Auszeichnung der gültigen Schlüsse erfolgt allein anhand der Semantik der logischen Zeichen: Genau diejenigen Schlüsse sind logisch gültig, die allein aufgrund der Bedeutung der logischen Konstanten, die in ihnen vorkommen, gültig sind; und auch das Beweisverfahren für die Auszeichnung der logisch gültigen Schlüsse basiert auf der Semantik der logischen Zeichen – im Falle der Syllogistik also, wie Aristoteles ausdrücklich bemerkt, letztlich allein auf der Bedeutung der beiden syllogistischen Ausdrücke »x kommt allen y zu« und »x kommt keinem y zu«.
Die Syllogistik setzt Aristoteles in seiner Theorie des Wissens und der Wissenschaft – der »wissenschaftlichen Analytik« – voraus. In einem seiner bedeutsamsten Dialoge, dem Theätet, hat Platon das Wissen als wahre gerechtfertigte Meinung bestimmt (Plat. Theät. 201c–d, vgl. Men. 98a) – eine Definition, die bis heute einflussreich geblieben ist. Aber erst Aristoteles entwickelt Platons Epistemologie weiter zu einer ausgefeilten Wissenschaftstheorie, die er wie die Syllogistik als Analytik kennzeichnet.6 Die von Platon eingeforderte Rechtfertigungsbedingung für Wissen muss nach Aristoteles genauer darin bestehen, dass vorgelegte Thesen für wahr gehalten und mit Verweis auf weitere Fakten erklärt werden können. Eine solche Erklärung nennt er »Demonstration« (APo. I 2).
[25]Zu Beginn der Ersten Analytik, in der unter anderem die Syllogistik präsentiert wird, kündigt er eine Untersuchung der Demonstration an. Eine Demonstration ist als Erklärung mehr als ein gültiger Syllogismus. Aristoteles verwendet den Ausdruck »Syllogismus« in zwei unterschiedlich starken Bedeutungen: zum einen im Sinne einer syllogistisch gültigen Deduktion und zum anderen im Sinne einer syllogistisch gültigen Deduktion mit wahren Prämissen. Den Syllogismus im zweiten, stärkeren Sinne können wir »Beweis« nennen. Eine Demonstration schließlich ist eine wissenschaftliche Erklärung – ein Syllogismus im stärkeren Sinne, dessen wahre Prämissen zusätzlich auf erklärende Ursachen verweisen. Die Demonstration ist daher das entscheidende Thema der Wissenschaftstheorie, die in der Zweiten Analytik entwickelt wird. Aristoteles deutet folglich mit seiner Ankündigung zu Beginn der Ersten Analytik an, dass er Erste und Zweite Analytik, also Syllogistik und Wissenschaftstheorie, als theoretische Einheit betrachtet. In der Tat ist jede Demonstration ein gültiger Syllogismus, während das Umgekehrte nicht gilt.
Nicht nur die Syllogistik, auch die Theorie der wissenschaftlichen Demonstration ist mithin eine Analytik. Die wissenschaftliche Analyse bezieht sich aber nicht auf ganze Syllogismen, sondern auf jeweils einzelne syllogistische Sätze, die universelle Fakten beschreiben – also vornehmlich Fakten, die wir mit generellen Sätzen der Form »Alle Bs sind A« (AaB) bzw. »Kein B ist A« (AeB) beschreiben. Die wissenschaftliche Analyse dieser universellen Sätze und der entsprechenden universellen Fakten bringt die Syllogistik zum Einsatz: Einen als wahr geltenden universellen Satz AaB oder AeB wissenschaftlich zu analysieren heißt, [26]zwei weitere als wahr geltende Sätze zu finden, die Prämissen für einen syllogistisch gültigen Schluss auf den gegebenen universellen Satz sind. Und die Syllogistik gibt uns gerade die Form der gesuchten Prämissen an die Hand (APo. I 32). Nach A1 könnten die gesuchten Prämissen für AaB beispielsweise die Formen AaC und CaB haben, und nach A2 könnten die Prämissen für AeB die Formen AeC und CaB haben (in der Tat behauptet Aristoteles, dass die Wissenschaften primär mit Demonstrationen in der ersten syllogistischen Figur operieren). Diese Analyse und Synthese können wir folgendermaßen notieren (der Buchstabe in Klammern zeigt die syllogistische Relation zwischen A und B an):
(i) A(a): AaC, CaB: B
(ii) A(e): AeC, CaB: B
Syllogistisch formuliert besteht diese Analyse von AaB oder AeB darin, dass wir einen geeigneten Mittelbegriff C finden, der die Aufstellung der beiden Prämissen erlaubt. Es ist möglich, dass wir die inneren syllogistischen Sätze in (i) oder (ii) ihrerseits durch Auffindung anderer Mittelbegriffe weiter analysieren und somit weitere syllogistische Prämissen für sie finden können, etwa für AaC und AeC:
(iii) A(a): AaD, DaC: C
(iv) A(e): AeE, EaC: C
Dann können wir (i) mit (iii) und (ii) mit (iv) zu größeren Analysen verbinden:
[27](v) A(a): AaD, DaC, CaB: B
(vi) A(e): AeE, EaC, CaB: B
Und dieses Spiel können und sollten wir fortsetzen, bis wir zu Prämissen kommen, die wir nicht weiter analysieren können. Das sind dann für den gegebenen Ausgangssatz die ersten oder unvermittelten Prämissen, für die wir keine weiteren Mittelbegriffe finden können. Aristoteles spricht hier anschaulich von einer Verdickungsprozedur, durch die wir die Lücke zwischen den Außenbegriffen des Ausgangssatzes gleichsam mit möglichst vielen Mittelbegriffen anfüllen (APo. I 23). Wenn die Analyse eines universellen syllogistischen Satzes mehr als einen Schritt enthält, können wir übrigens aus den gefundenen Prämissen weitere Sätze neben dem Ausgangssatz logisch ableiten, z. B. aus den in (v) aufgeführten Prämissen den Satz DaB, und aus den in (vi) aufgeführten Prämissen den Satz EaB.
Die weitreichenden wissenschaftstheoretischen Konsequenzen dieses analytischen Verfahrens in den Wissenschaften können wir allerdings erst dann sehen, wenn wir uns klar machen, dass diese Analysen kein logisches Spiel sind, sondern sich auf universelle empirische Fakten in der Welt beziehen. Wenn wir also in unserer Analyse mit einem universellen oder auch partikulären Satz etwa der Form AaB oder AiB starten, so muss es sich um einen Satz handeln, den wir für empirisch wahr halten – z. B. den Satz (a) »Geräusch (A) kommt allen Formen des Donners (B) zu« oder den Satz (b) »Eklipse (A) kommt einigen Mondstellungen (B) zu« (APo. II 8). Und wenn wir in unserer Analyse einen Mittelbegriff C für Prämissen AaC und CaB bzw. AaC und CiB finden müssen, dann muss es sich [28]ebenfalls um Sätze handeln, die wir für wahr halten, von denen wir also glauben, dass sie universelle oder partikuläre Fakten in der empirischen Welt beschreiben – und das zu entscheiden ist Sache empirischer wissenschaftlicher Forschung, nicht formaler logischer Beweise. Es gab, wie Aristoteles berichtet, zu seiner Zeit die Vorschläge, zu Satz (a) den Mittelbegriff C als »Erlöschen des Feuers in den Wolken« und zu Satz (b) als »Dazwischentreten der Sonne zwischen Erde und Mond« zu bestimmen. Damit wurde behauptet, es sei empirisch wahr, dass gilt: (c) Geräusch kommt allem Erlöschen von Feuer in den Wolken zu; (d) Erlöschen von Feuer kommt allen Formen des Donners zu; (e) Eklipse kommt jedem Dazwischentreten der Sonne zwischen Erde und Mond zu, und (f) Dazwischentreten der Sonne zwischen Erde und Mond kommt einigen Mondstellungen zu. Wenn wir die empirischen Sätze (c) bis (f) tatsächlich für wahr halten dürfen, dann haben wir (a) in (c) und (d) sowie (b) in (e) und (f) analysiert, denn (c), (d) ⇒ (a) und (e), (f) ⇒ (b) sind offensichtlich syllogistisch gültige Schlüsse.
Empirische Anwendungen von Analysen dieser Art machen verständlich, warum Aristoteles fordern muss, dass der erste Schritt bei der Etablierung einer angemessenen wissenschaftlichen Theorie darin besteht, universelle empirische Fakten festzustellen. Und wir haben ein empirisches universelles Faktum der Art AaB festgestellt, wenn wir so viele B-Dinge wie möglich empirisch untersucht und herausgefunden haben, dass jedes untersuchte B-Ding die Eigenschaft A hat. Die Aufzählung endlich vieler solcher Beispiele in einer Liste nennt Aristoteles »Anführung«; das ist seine Auffassung von »Induktion«. Eine [29]induktive endliche Liste ohne Gegenbeispiel ist dann natürlich ein exzellenter Grund dafür, den universellen Satz AaB (»Alle B-Dinge sind A« oder »A kommt allen Bs zu«) für wahr zu halten (Aristoteles redet hier allerdings nicht von einem induktiven Schluss). Erst die Fakten, dann die Erklärung – das ist die Devise, die Aristoteles nicht müde wird zu betonen (APo. II 1–2). So hat er auch selbst ein großes biologisches Werk verfasst, das eine reine Faktensammlung beinhaltet und sich aller Analysen und Erklärungen enthält – die Historia Animalium (die Erkundung der Tiere) in zehn Büchern.
Doch welche Rolle spielt die empirische Erfahrung für die Konstatierung empirischer Regularitäten und Prinzipien genauer? Nach Aristoteles entsteht die empirische Erfahrung in vier kognitiven Schritten (APo. II 19):
(1) Wahrnehmung: das Erfassen und Unterscheiden verschiedener Qualia (etwa das Gelbe, Große, Kalte oder Bewegte).
(2) Speicherung und Erinnerung an vergangene Wahrnehmungen der Stufe 1.
(3) Induktion, empirische Erfahrung: Mengen singulärer Fakten der Form »x ist B« (geschrieben B(x)), wobei Träger x und Eigenschaft B auseinandertreten und die verschiedenen Instanzen B(x), B(y), B(z) (oft auch in der komplexen Form B(x) ⇒ A(x), B(y) ⇒ A(y), B(z) ⇒ A(z) …) als ähnlich empfunden werden. Dabei kommt das B und gegebenenfalls das A in der Seele zum Stehen.
(4) Wissen, Einsicht: Vernetzung der empirischen Erfahrung durch logische Analyse.
[30]Diese Stufen folgen genetisch aufeinander, stellen also eine genetische Epistemologie dar. Die Stufen 1 bis 3 sind kognitive Prozesse auf nicht-sprachlicher Ebene, die dem Wahrnehmungsprozess inhärent sind.
Aristoteles ringt an dieser Stelle mit einem ewigen Problem der Wahrnehmungstheorie und des Empirismus: Inwieweit greifen in einen zunächst passiv verstandenen Wahrnehmungsprozess strukturierende Mechanismen ein? Die genetische Epistemologie spiegelt die bedeutende Einsicht, dass empirische Erkenntnis auf der grundlegendsten Ebene nicht auf Prozessen beruht, die sich in Begriffen von Sprache, Logik und Begründung fassen lassen, sondern auf eingespielten und verlässlichen natürlichen Prozessen (die aus heutiger Sicht Strukturerfassung, Merkmalanalyse und Gestaltgesetze umfassen). Damit sind für Aristoteles die tiefsten Grundlagen des Empirismus skizziert.
Wenn nun auf diese Weise für einen bestimmten Gegenstandsbereich möglichst viele Fakten gesammelt und mittels Induktionen