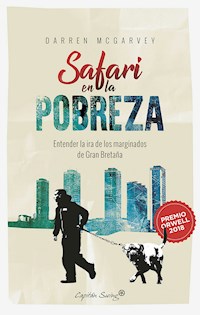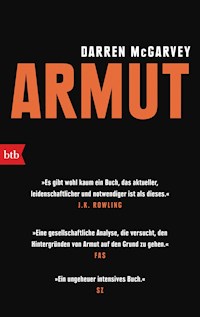
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Arm sein ist keine Schande – oder doch?
Über die »Unterschicht« wird dieser Tage mal wieder viel geredet. »Abgehängt«, »ausgegrenzt«, »chancenlos« sind die Stichworte der Debatte. Aber wie so oft kommen die Betroffenen dabei gar nicht selbst zu Wort. Der Rapper, Aktivist und Autor Darren McGarvey ist selbst in einem der berüchtigten Sozialbunker im Armenviertel von Glasgow aufgewachsen. Für ihn bedeutet Armut in erster Linie: Stress! Er dreht den Spieß um und schreibt sich vom Leib, was seit langem in ihm gärt: Ein wütendes und gleichzeitig erstaunlich hellsichtiges und leidenschaftliches Buch darüber, was es bedeutet, arm zu sein. Ein Buch, das den Blick auf unser Zusammenleben radikal verändert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 383
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über die »Unterschicht« wird dieser Tage mal wieder viel geredet. »Abgehängt«, »ausgegrenzt«, »chancenlos« sind die Stichworte der Debatte. Aber wie so oft kommen die Betroffenen dabei gar nicht selbst zu Wort. Der Rapper, Aktivist und Autor Darren McGarvey ist selbst in einem der berüchtigten Sozialbunker im Armenviertel von Glasgow aufgewachsen. Für ihn bedeutet Armut in erster Linie: Stress! Er dreht den Spieß um und schreibt sich vom Leib, was seit langem in ihm gärt: Ein wütendes und gleichzeitig erstaunlich hellsichtiges und leidenschaftliches Buch darüber, was es bedeutet, arm zu sein. Ein Buch, das den Blick auf unser Zusammenleben radikal verändert.
Darren McGarvey auch bekannt unter seinem Künstlernamen »Loki«, ist Autor, Kolumnist und Rapper. Er wuchs in Pollock am südlichen Rand Glasgows auf. 2015 wurde er »Rapper-in-Residence« in einem Programm der schottischen Polizei zur Gewaltprävention. »Armut« ist sein erstes Buch, war auf Anhieb Sunday Times Top Ten Bestseller und wurde mit dem Orwell Prize 2018 ausgezeichnet.
Darren McGarvey
ARMUT
Aus dem Englischenvon Klaus Berr
btb
Die Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel »Poverty Safari. Understanding the Anger of Britain’s Underclass« zunächst bei Luath Press Limited, Edinburgh, und 2018 bei Picador, London.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2017 by Darren McGarvey
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2019 Luchterhand Literaturverlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
First published 2017 Luath Press Limited, Edinburgh.
First published 2018, in association with Luath Press Limited, by Picador, an imprint of Pan Macmillan, a division of Macmillan Publishers International Limited.
Covergestaltung: semper smile, München
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
JT ∙ Herstellung sc
ISBN 978-3-641-25017-1V001
www.btb-verlag.de
www.facebook.com/btbverlag
Dieses Buch ist meinen wunderschönen und zerbrechlichen Geschwistern Sara Louise, Paul, Lauren und Stephen gewidmet. In verschlüsselter Form ist in diesem Buch alles enthalten, was ich in 33 Jahren über das Leben gelernt habe. Es tut mir leid um die Zeit, die ich nicht bei euch gewesen bin oder ihr euch von mir oder sonst jemandem im Stich gelassen gefühlt habt. Ich liebe euch und freue mich auf den Tag, an dem wir wieder als Familie an einem Tisch sitzen können.
PS: Nehmt keine Drogen.
Beziehungskoordinator
Nachdem der uns gesagt hat
was richtig ist
was falsch und so
über dies und das
und alles
sag ich zu dem Kerl
und was genau ist
dein Job Jimmy
ich bin Beziehungskoordinator
sagt er und nun gut sag ich
ein Beziehungskoordinator
bei all der Arbeitslosigkeit
und der Sauferei
und den Amok laufenden Jungs
und den zerbröselnden Häusern
und den Frauen auf Tranquilizern
haben sie uns wenigstens
einen Beziehungskoordinator geschickt
einen Kerl mit ’nem Diplom
in Scheißwas
kriegt Geld dafür dass er nicht weiß
was er damit anfangen soll
Tom Leonard
Vorwort
Dieses Buch, das zunächst als Nebenprojekt meiner Arbeit als Rapper und Kolumnist entstand, nahm allmählich jeden wachen Moment meines Lebens in Anspruch. Ich musste alle anderen Verpflichtungen herunterfahren oder ganz einstellen, um es fertigzustellen. Letztlich habe ich über zweieinhalb Jahre dafür gebraucht. Am 14. Juni 2017, zwei Tage vor meinem endgültigen Abgabetermin, wachte ich zu der Nachricht eines Feuers auf, das in einem Wohnsilo in Westlondon ausgebrochen war.
Wie alle anderen auch war ich schockiert, entsetzt und bestürzt, als ich die Bilder sah. Im Verlauf des Vormittags drangen immer neue Nachrichten aus der schwelenden Schale des Grenfell Tower. Wir hörten Geschichten von Leuten, die in den oberen Stockwerken gefangen waren und ihre kleinen Kinder aus dem Gebäude warfen, bevor sie selbst von den Flammen verzehrt wurden. Dann gab es Geschichten von Heldentum und Opfern, von Menschen, die, ohne auf ihre eigene Sicherheit zu achten, ins Gebäude rannten, um schlafende Nachbarn zu wecken. Ich dachte an die Handys, die in den Taschen der Toten geklingelt haben mussten.
Später an diesem Tag erfuhren wir von den Abschiedsbotschaften in den sozialen Medien – Botschaften von Leuten, die wussten, dass sie im nächsten Moment sterben würden. Mir kamen die Tränen bei dem Gedanken an eine dermaßen hoffnungslose Situation. Gefangen in der Hülle aus Rauch und Flammen, die ihre Wohnung umschlossen hatten, während sie schliefen, begegneten diese tapferen Seelen ihren letzten Augenblicken mit einer unglaublichen Würde. Ich dachte an meinen Sohn und stellte mir vor, ich hätte nur die Wahl, ihn aus dem Fenster zu werfen – mit der geringen Chance, dass er überleben würde –, oder ihn in den Armen zu halten, bis die Flammen uns verzehrten. Darüber nur nachzudenken ist schon schrecklich genug. Die Bewohner des Grenfell Towers hatten diese Entscheidung tatsächlich treffen müssen.
Der grausame Großbrand, der in einer Wohnung seinen Ausgang nahm und dann auf das gesamte Gebäude übersprang, wurde nicht von jemandem verursacht, der Schaden anrichten wollte. Das Feuer war nicht die Folge eines terroristischen Anschlags. Vielmehr ist es eine vermeidbare Katastrophe gewesen, das Zusammenwirken von menschlichem Versagen und Fahrlässigkeit in industriellem Maßstab.
In den folgenden Tagen stand das Vereinigte Königreich, bereits destabilisiert durch ein Wahlergebnis, das die Zentralregierung stark geschwächt hatte, am Rand von Bürgerunruhen. Die Premierministerin Theresa May, der man in ihrer Reaktion auf das Feuer schlechte Führung vorwarf, wurde hastig in ein Auto geschoben, nachdem sie von den Bewohnern des Grenfell Towers ausgebuht worden war. Die Berichterstattung zeigte eine tief traumatisierte Gesellschaft, die versuchte, sich in einem Führungsvakuum neu zu organisieren. Vor Ort bemühten sich die Behörden, auf die Krise zu reagieren. Es entstand Verwirrung darüber, wie die Opfer an Hilfe gelangen könnten, auch Verwirrung über die Zahl der Toten. Ebenso wenig wie der Zentralregierung gelang es den Kommunalbehörden, ihre grundlegendsten Aufgaben zu erfüllen.
In Abwesenheit konkreter Informationen fing die wütende, trauernde Öffentlichkeit an, die Leere mit Spekulationen und Schuldzuweisungen zu füllen. Als die Menge sich lautstark vor den Gemeindeverwaltungen von Kensington und Chelsea versammelte, zogen sich die Amtsträger still in ihre eigene Verbotene Stadt zurück, wo sie der Öffentlichkeit verborgen blieben. Obwohl es Gerede über Unruhen gab, verhielten sich die Menschen des Grenfell Towers vorbildhaft. Während die Opferzahlen weiterhin stiegen, schliefen eine Woche nach dem Feuer noch immer viele Überlebende in ihren Autos und den öffentlichen Parks.
Das Ausmaß, in dem die Stimmen der Grenfell-Bewohner routinemäßig überhört wurden, spielte eine Schlüsselrolle in der Abfolge der Entscheidungen, die zu dem Feuer führten. Nicht zuletzt waren aus Gründen der Kosteneinsparung brennbare Materialien für die Verkleidung und Dämmung gewählt worden, welche die schnelle Ausbreitung des Feuers im ganzen Gebäude begünstigt hatten.
Die vorgeschlagenen Materialien werden dem Gebäude ein frisches Erscheinungsbild verleihen, das der Gegend und ihren Sichtachsen nicht schaden wird. Wegen seiner Höhe ist der Turm von den angrenzenden Denkmalerhaltungsgebieten Avondale im Süden und Ladbroke im Osten aus zu sehen. Die Veränderungen an dem existierenden Turm werden sein Aussehen verbessern, vor allem von den umgebenden Vierteln aus betrachtet. Deshalb werden Blicke in die und aus den Denkmalerhaltungsgebieten durch die Vorschläge verbessert.
Bauantrag, 2014,
für die Modernisierung des Grenfell Tower.
Ich fühle mich den Menschen des Grenfell Towers stark verbunden. Ich kenne die Hektik, die mit einem Leben im Hochhaus einhergeht, die dunklen und dreckigen Treppenhäuser, die launischen Aufzüge, die nach Urin und feuchten Hundehaaren riechen, den mürrischen Hausmeister, das ungute Gefühl, das man beim Betreten oder Verlassen des Hauses bekommt, vor allem nachts. Ich kenne das Gefühl, abgeschnitten zu sein von der Welt, obwohl man durch ein Fenster im Himmel einen so wunderbaren Blick hinaus hat, das Gefühl der Isolation, obwohl man umgeben ist von Hunderten anderer Menschen, über, unter und neben einem. Vor allem aber verstehe ich das Gefühl, unsichtbar zu sein, trotz der Tatsache, dass das Haus, in dem man lebt, meilenweit sichtbar ist, eines der herausragenden Merkmale der Skyline.
Die Gemeinschaft rund um den Grenfell Tower ist wie viele, die ich kenne: eine Gemeinschaft, die als »sozial benachteiligt« gilt, in der es einen pathologischen Argwohn gegenüber Außenseitern und den Behörden gibt, in der der eingefleischte Glaube herrscht, dass eine Teilhabe am demokratischen Prozess nichts bringt, weil den Mächtigen die Sorgen der »Unterschicht« gleichgültig sind.
Was wirklich einen Nerv traf, war die Nachricht, dass die Ortsansässigen seit Jahren vor den Sicherheitsrisiken im Grenfell Tower gewarnt hatten und das Feuer vermeidbar gewesen wäre. Gegen Mittag am Tag des Brandes entdeckte ich den Blog der Grenfell Action Group, in dem eine Unmenge von detaillierten Artikeln über ein breites Spektrum komplexer gemeinschaftlicher Belange veröffentlicht worden war. Ich erfuhr, dass die Einwohner speziell vor einem Feuerrisiko gewarnt hatten, weil die Sicherheitsvorschriften im Brandfall ungenügend waren. Verstörenderweise hatte der Blog vorausgesehen, dass die Opferzahlen katastrophal sein würden; man hatte dem jedoch keine Beachtung geschenkt.
Im Verlauf der Tage öffnete sich ein Fenster in den Grenfell Tower und damit in das Leben der Unterschicht. Zahllose Zeitungsartikel, Flugblätter und Radiosendungen versuchten einzufangen, wie das Leben im Silo funktionierte. Nachdem man es ignoriert – und abgetan – hatte, interessierte sich plötzlich jeder für das Leben in einer solchen Gemeinschaft. Aber die meisten rauschten, trotz ihrer edlen Absichten, in einer kurzlebigen Expedition einfach nur hindurch.
Eine Art Safari, auf der die einheimische Bevölkerung eine Weile aus sicherer Distanz beobachtet wird, bevor das Fenster in diese Gemeinschaft sich wieder schließt und das Geschehene allmählich in Vergessenheit gerät.
Das ist ein Muster, das ich in meinem eigenen Umfeld wiederholt beobachtet habe, ein Muster, das es gibt, solange ich zurückdenken kann, und deshalb möchte ich mit Armutssafari vor allem Menschen ansprechen, die sich missverstanden und ungehört fühlen. Das Buch soll den Gefühlen und Sorgen dieser Menschen eine Stimme verleihen. Die im Folgenden besprochenen Themen und Probleme sind eindeutig von großer Bedeutung für Gemeinden wie Grenfell, in denen die Menschen von den Entscheidungsträgern routinemäßig ignoriert werden, weil diese glauben zu wissen, was getan werden muss, sich letztendlich aber fatal irren. Was ich hier erkunde, könnte dem Wutausbruch, der auf das Feuer im Grenfell Tower folgte, einen Kontext geben und, was entscheidend ist, die Erkenntnis vermitteln, dass es bei dieser Wut nicht nur um das Feuer und den tragischen Verlust von Menschenleben geht. In Gemeinden in ganz Großbritannien, in denen die Menschen in unterschiedlichem Ausmaß einen Mangel erleben, im Gesundheitswesen, der Wohnsituation und der Bildung, an Orten, wo die Menschen effektiv vom politischen Leben ausgeschlossen werden, ist die Wut spürbar. Und diese Wut ist etwas, woran wir uns gewöhnen müssen, wenn die Dinge sich nicht ändern. In Armutssafari habe ich, in Anlehnung an meine eigenen Erfahrungen und als Ausdruck meiner persönlichen politischen Perspektive, versucht zu skizzieren, wie diese Veränderungen aussehen könnten.
Einleitung
Leute wie ich schreiben keine Bücher – das sagt mir zumindest mein Kopf. »Ein Buch schreiben«, höhnt die Stimme, »du hast nicht genug gelesen, um so was auch nur versuchen zu können.« Das stimmt. Ich bin kein gewohnheitsmäßiger Leser von Büchern, allerdings bin ich ein regelmäßiger Konsument von Wörtern. Seit der Schulzeit interessiert mich sehr, wie Wörter aussehen, klingen und was sie bedeuten. Als Kind wollte ich mich immer an den Erwachsenengesprächen beteiligen, versuchte immer, neue Wörter zu sammeln und meinem Vokabular hinzuzufügen. Man hat mir erzählt, dass ich schon mit fünf Jahren naseweis die furchtbare Grammatik meiner Mutter korrigierte, was sie sehr ärgerte. Mit zehn formulierte ich meine ersten Kurzgeschichten, wobei ich, wie man das in dem Alter so macht, mich ausgiebig bei meinen damaligen Haupteinflüssen bediente: Oma und Batman.
Aber ich kann mich nicht erinnern, irgendwelche Bücher gelesen zu haben. Ich weiß noch, dass ich gelegentlich eins zur Hand nahm und ein wenig darin herumblätterte, oder in einem Buch nach einer spezifischen Information suchte, zum Beispiel nach dem Namen der Hauptstadt der Türkei – der nicht Istanbul lautet. Ich kann mich nicht an den Augenblick erinnern, von dem so viele erzählen, in dem sie das eine Buch verschlangen, das ihr Leben veränderte und ihre Leidenschaft fürs Lesen entfachte. Doch habe ich noch sehr lebhafte Erinnerungen an meinen Kampf mit den Büchern und an die Angst, die mir ihre rein physische Größe und die darin enthaltene Wortmenge einflößten. Allein der Gedanke an ein dickes Buch überwältigte mich.
In der Sekundarschule, in der mein Talent zum Schreiben mich im Englischunterricht zum Klassenbesten machte, verlor ich sofort den Boden unter den Füßen, wenn es um Literatur ging. Man sagte mir, ich hätte das richtige Buch einfach noch nicht gefunden, ich sollte dranbleiben. Immer wieder sagte man mir, dass ich einfach nur mein Gehirn trainieren müsste wie einen Muskel, dann werde das Lesen weniger zur Qual. Insgeheim aber verachtete ich diesen Rat – und diejenigen, die ihn mir gaben. Ich klammerte mich an den Glauben, dass es eine unsichtbare Barriere gäbe, die mich an einer Beschäftigung mit Literatur hinderte. Es war ja nicht so, dass ich an meiner Schule der Einzige gewesen wäre, der mit dem Lesen haderte. Regelmäßige Leser waren die Ausnahme. Lesen wurde nicht als Freizeitaktivität gesehen, eher als notwendiges Übel, etwas, das man durchstehen musste. Was mich von vielen meiner Klassenkameraden unterschied, war, dass ich mich insgeheim danach sehnte, jedes Buch zu lesen, das mir in die Finger kam. Zu meiner Frustration fand ich dann, kaum dass ich es begonnen hatte, immer heraus, dass ich es niemals durchbekommen würde.
Leichtgewichtige Taschenbücher lockten einen oft mit einem interessanten Cover, aber ich stellte auch sie schnell ins Regal zurück, sobald ich bemerkte, dass sie keine Illustrationen enthielten. Diese Bücher waren so vollgestopft mit Wörtern, dass sie in meinen Augen überladen und chaotisch wirkten – und mich mit der Angst erfüllten, die auch ein bevorstehender Umzug weckt, wenn man zu lange darüber nachdenkt. Die winzige Schrift erzeugte, in Kombination mit dem sehr engen Satz, in mir ein Gefühl der Unmöglichkeit, das im Verlauf der Zeit nur noch schlimmer wurde. Nach nur ein paar Seiten von Herr der Ringe war ich demoralisiert. Man erzählte mir immer von Frodos berühmten Abenteuern in Mittelerde. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich mich bereits vor dem Ende von Bilbos Party verdrückt habe.
Hardcover wirkten leichter zu lesen, weil die Schrift größer war, ich fand jedoch ihren Umfang und ihr Gewicht abschreckend. Mein Englischlehrer bestand darauf, dass ich für meinen Englischabschluss John Irvings Owen Meany las und interpretierte. Schön zu wissen, dass er mir eine solche Großtat zutraute (bei einem Roman von weit über 800 Seiten), doch sein großzügiges Vertrauen reichte nicht, um mir meinen heftigen Widerwillen gegen das Projekt zu nehmen. Es war eine Fehleinschätzung meiner Fähigkeiten, ähnlich als würde man einen Säugling auf eine Bergwanderung schicken. Wir einigten uns schließlich auf Tennessee Williams Endstation Sehnsucht, was ich weniger herausfordernd fand, weil es ein Theaterstück war und die Seiten weniger unaufgeräumt wirkten. Ein zusätzlicher Vorteil war die Filmversion, der ich mich zuwenden konnte, wenn meine Ausdauer nachließ.
Für mich kamen mehrbändige Sagen wie Harry Potter einfach nicht in Frage. Wenn ich an Diskussionen über, sagen wir Roald Dahls Der fantastische Mr. Fox oder Anne Fines Das Baby-Projekt teilnehmen musste, konnte ich aus einzelnen Texthäppchen genug Informationen ziehen, um so zu tun, als hätte ich das ganze Buch gelesen.
Ich saugte noch immer Unmengen neuer Wörter auf, inzwischen vor allem aus Zeitungen, aber ich war auch darauf angewiesen, anderen Leuten bei ihren Diskussionen und Debatten zuzuhören, um zu erlauschen, was ich sonst aus einem Buch hätte lernen können. Ich versuchte unterschiedliche Blickwinkel einzunehmen und begann, meine eigenen Überzeugungen und die der Menschen um mich herum zu hinterfragen, manchmal sehr zu deren Verärgerung.
Diskussionen waren fesselnder und machten mehr Spaß, ich mochte die Interaktion mit den anderen. Indem ich redete und mir anhörte, was sie zu sagen hatten, und indem ich darauf achtete, wie sie es sagten, lernte ich mit den unterschiedlichsten Leuten und Charakteren über ein breites Themenspektrum zu reden, woraus man vielleicht sogar schließen konnte, ich wäre ein eifriger Leser. Der Akt des Lesens, und eigentlich alle akademischen Leistungen, wurde von vielen meiner männlichen Altersgenossen entweder als weibisch oder als die Domäne von Snobs oder Sonderlingen abgelehnt. Wäre ich in einer Gegend auf die Sekundarschule gegangen, in der das Klugsein sozial akzeptierter war, wäre ich vielleicht ein besserer Leser geworden.
Lyrik löste bei mir nur Frustration und Verwirrung aus. Es waren nicht nur die unverständlichen Metaphern und die bizarre Zeichensetzung, die mir vor den Kopf stießen, sondern auch der Inhalt selbst. Die Gedichte waren in einer so hohen Sprache abgefasst, dass sie höhnisch auf mich herabzuschauen schienen. Ich betrachtete jeden mit Skepsis, der Gedichte verstehen oder ihre Lektüre genießen konnte. Meine Bemühungen, eine Bedeutung in diesen Zeilen zu finden – oder genauer, meine Bemühungen, die Bedeutung zu finden, die vom Lehrplan vorgeschrieben wurde, und damit den nächsten Test zu bestehen –, brachten mich dazu, Gedichten und Dichtern eine immer größere Feindseligkeit und Skepsis entgegenzubringen, was zu meiner inzwischen aggressiven Haltung gegenüber den Lesern und dem Lesen passte. Unter meinem Störverhalten lag natürlich eine Kränkung, weil ich mich abgelehnt und ausgeschlossen fühlte vom Kreis der Leser – das vernichtende Gefühl persönlichen Versagens. Das Reich des gedruckten Wortes fühlte sich so unerreichbar exklusiv an, dass ich eine Heidenangst vor den Büchern entwickelte, trotz meines Interesses für ihren Hauptbestandteil: Wörter. Irgendwann einmal traf ich die Entscheidung, dass große Bücher nur für ganz bestimmte Leute da seien – für Leute, die schnieke Schulen besuchten, in schnieken Häusern wohnten, einen schnieken Akzent sprachen und schniekes Essen aßen.
Das war ein Irrglauben.
Da ich aber diesen Irrglauben in meine damalige Persönlichkeit integriert hatte, musste ich mir Gründe ausdenken, warum ich recht hatte. Ich konnte nicht einfach akzeptieren, dass das Lesen oder jede Form von Konzentration meine Fähigkeiten überstieg, konnte nicht akzeptieren, dass ich spezielle Hilfe brauchte und sie mir hätte suchen sollen; zumal ich für die schriftlichen Arbeiten, die ich einreichte, ja ganz vernünftige Noten bekam. Ich war gefangen zwischen der hochmütigen Anmaßung, ich sei intelligent, und der demütigenden Wirklichkeit, dass ich kein Buch lesen konnte.
Anstatt mich gedemütigt zu fühlen, fing ich an, mir eine komplizierte, großspurige Legende zu konstruieren, die mein Dilemma erklärte. Meine Unfähigkeit, ein Buch zu Ende zu lesen, war kein Zeichen mangelnder Intelligenz, sondern der Beweis meines unabhängigen Geistes. Ich konnte kein Buch lesen, weil die Bücher, die ich lesen sollte, die man mir als gut empfahl, in Wahrheit großer Mist waren. Ich konnte kein Buch lesen, weil der Lehrplan uns einen überheblichen Oberschichtsblödsinn aufzwang, der nichts über mein persönliches Umfeld und meine Erfahrungen aussagte. Ich gelangte zu der Überzeugung, dass mein Wert als Person lediglich aus der Fähigkeit abgeleitet wurde, mir eine Reihe kultureller Vorgaben und Stichwörter zu merken und zu wiederholen. Stichwörter von Lehrern, die selbst zu Autoritätspersonen aufgestiegen waren, weil sie sich auf diese Vorgaben eingelassen hatten.
Vielleicht lag in diesem Glauben ein Kern Wahrheit. Trotzdem hatte ich keine Ahnung, warum überhaupt ich zu diesem Glauben gekommen war. Es ging nicht, wie ich damals glaubte, um kritisches Denken und einen unabhängigen Geist. Es ging vorwiegend darum, von meinen Defiziten und Unzulänglichkeiten abzulenken. Ich wäre tief gekränkt gewesen, wenn man mir das damals gesagt hätte. In meiner Frustration, dass ich kein Buch lesen konnte, und dem Gefühl des Ausgeschlossenseins, das die Bücher mir noch immer vermittelten, nahm ich eine Weltsicht an, die mich fast gegen jeden Menschen, jeden Ort und jede Sache, die ich kennenlernte, aufbrachte. Das blieb so, bis ich an einem Morgen viele Jahre später betrunken in einer Arrestzelle aufwachte und erkannte, dass mein Leben sich radikal verändern musste.
Ich habe viele Bücher gelesen, oft nicht so, wie man sie eigentlich lesen sollte. Ich befürchte, das spiegelt sich in meiner Art zu denken und zu schreiben wider. Der Gedanke, dass Leute wie ich keine Bücher schreiben dürfen, hallt mir immer noch in den Ohren. Vielleicht habe ich eine Reihe nur lose zusammenhängender Tiraden verfasst, die den Anschein eines Buchs vermitteln, so wie ich den Anschein eines Lesers vermittle. Ich versuche in Armutssafari viele Dinge auszudrücken, nicht zuletzt meine unkonventionellen Lesegewohnheiten. Ich habe versucht, für Leute wie mich zu schreiben, die Schwierigkeiten mit dem Lesen haben; ich möchte sie einladen, ganz nach Belieben in die Texte ein- und wieder daraus aufzutauchen, kleine Stückchen in der falschen Reihenfolge zu lesen oder nach einzelnen, kürzeren Kapiteln zu suchen. Zugleich bin ich mir selbst treu geblieben in der Art, wie ich denke, spreche und schreibe, und habe die ganze Bandbreite meines Vokabulars eingesetzt, die Wörter, die ich im Verlauf meines Lebens gesammelt habe.
Ich weiß, dass über die Armut größere Bücher geschrieben wurden als meins. Ich habe bloß keins davon gelesen.
1 Schuld und Sühne
Die Frauen betreten im Gänsemarsch, in lila Jacken und grauen Jogginghosen das Zentrum für Darstellende Kunst. Man sollte bei der Begrüßung sicher auftreten, den Augenkontakt suchen und die Hand anbieten, bei Zurückweisung aber nicht brüskiert reagieren. Als die Letzte aus einer Gruppe von fünf Frauen den Saal betritt, wird hinter ihr die Tür von genau dem großen, stämmigen Mann in Uniform geschlossen, der sie Augenblicke zuvor herbegleitet hat. Nachdem er sich überzeugt hat, dass der Raum gesichert ist, verschwindet er zu seinem Kollegen in den Kontrollraum auf der Rückseite, und ich bitte die Frauen zu einem Stuhlkreis, der vor einer schwarzen Flipchart aufgestellt ist.
Das Zentrum für Darstellende Kunst, tief im Herzen des Gefängnisses, ist ein Anblick, den man so schnell nicht vergisst. Mit einer voll funktionierenden Theaterbühne, einem Probenraum und einem allgemeinen Veranstaltungssaal kann das Zentrum für Workshops, Seminare und Filmaufführungen genutzt werden. Der Raum ist kühl und dunkel, was einem beim ersten Betreten sofort auffällt, da er damit in starkem Kontrast zum Rest des Komplexes steht, der, je nach Aufenthaltsort, grau oder weiß ist. In einer Ecke wartet eine Auswahl von Musikinstrumenten, wobei die akustische Gitarre das beliebteste ist. Über der kleinen erhöhten Bühne in der Mitte der Stirnseite des Saals hängt eine bescheidene Beleuchtungstraverse über einer Tonanlage mit mehreren Lautsprechern. Die technische Ausstattung ist besser, als ich sie aus den meisten öffentlichen Einrichtungen kenne. Normalerweise müsste man eine Ausrüstung von dieser Qualität mieten, was hier drinnen aus offensichtlichen Gründen aber unpraktisch ist; wenn man das Gefängnis am Haupteingang betritt, hat man das Gefühl, man müsste durch den Zoll. Das Personal, das hier arbeitet, durchläuft diese Sicherheitskontrolle jeden Tag beim Kommen und Gehen. Für Freischaffende wie mich ist allein diese Erfahrung furchteinflößend – vor allem, wenn man schon mal Schwierigkeiten mit der Polizei hatte oder vor einem Gericht stand. Wenn man dann im Zentrum für Darstellende Kunst ankommt, spürt man, wie die Anspannung von einem abfällt, die in dieser bedrückenden und potentiell feindseligen Umgebung herrscht; man muss allerdings auch sagen, dass man nur einige wenige Besuche in schneller Folge braucht, bis man sich eingewöhnt hat und das Procedere als normal empfindet.
Ich vermute, dass sich viele der Frauen nur deshalb für den heutigen Rap-Workshop gemeldet haben, um herkommen zu können. Im Kontext des Gefängnisses ist das Zentrum für Darstellende Kunst fast wie eine Oase, und wenn es der einzige Ort wäre, den man in dieser Einrichtung besucht, würde man wohl bezweifeln, überhaupt in einem Gefängnis gewesen zu sein.
Nach ein wenig Smalltalk, der aus allgemeinen Bemerkungen über die Örtlichkeit besteht, versuche ich, mit dem Workshop zu beginnen, obwohl ich gestehen muss, dass ich nervös bin.
»Was glaubt ihr, warum ich hier bin?«, frage ich. In anderen Situationen ist diese Frage meiner Erfahrung nach eine effektive Eröffnung, denn obwohl sie vage und fast ein wenig einfach wirkt, erfüllt sie mehrere wichtige Aufgaben. Zum Beispiel nimmt die Frage mich sofort aus der Pflicht, weitersprechen zu müssen, was mir angenehm ist, denn ich bin schlecht vorbereitet. Oder genauer gesagt, ich habe unterschätzt, wie unsicher ich bin, sobald ich mich im Fokus eines mir unbekannten Publikums wiederfinde.
Die Frage »Warum bin ich hier?« bringt mir ein paar Minuten, um mich zu orientieren und meine Nerven zu beruhigen. Doch sie dient auch noch einem anderen Zweck, soll nicht allein meine Haut retten. Die Frage »Warum bin ich hier?« wird die Leute beschäftigen und das Potential für weitere Interaktionen schaffen, die mir dabei helfen, die Teilnehmer schneller kennenzulernen. Durch die Beobachtung ihrer Reaktionen werde ich die verschiedenen Persönlichkeitstypen, ihre Begabungen, kommunikativen Fähigkeiten und Lernstrukturen besser einschätzen können und ein Gefühl für die Hierarchie innerhalb der Gruppe bekommen. Ihre Antworten und Reaktionen helfen mir herauszufinden, welche Erwartungen sie an mich haben – wenn überhaupt.
Die Einrichtung ist eine Anstalt für junge Straftäter und ursprünglich für ungefähr 830 männliche Insassen geplant gewesen, auch wenn die tatsächliche Zahl der Insassen höher ist. Die meisten Insassen sind zwischen 16 und 21 Jahren alt. Die Insassen, von Profis auch JS, jugendliche Straffällige, genannt, werden abhängig vom Alter und der Art ihres Verbrechens in Gruppen unterteilt. Ein Teil der Insassen sind Untersuchungsgefangene, was bedeutet, dass sie erst noch vor Gericht erscheinen müssen, um abgeurteilt zu werden, ihre Freilassung auf Kaution jedoch von einem Richter abgelehnt wurde. Diese Gruppe ist gekennzeichnet durch ein andersfarbiges T-Shirt, das normalerweise rot ist. Alle anderen tragen Dunkelblau. Dann gibt es noch die Sexualstraftäter, die, zusammen mit denen in »Schutzhaft«, vom Rest der Insassen abgetrennt sind. Die Schutzhäftlinge sind zu ihrer eigenen Sicherheit in diesem abgesonderten Bereich. Hintergrund ist meist, dass gegen sie eine Drohung ausgesprochen wurde oder sie sich in Gefahr glauben oder sie als »Petzer« gebrandmarkt wurden. Unterschiedliche Leute sind aus verschiedenen Gründen in Schutzhaft, aber weil sie mit den Sexualstraftätern im weiteren Sinne in einen Topf geworfen werden, betrachtet man sie alle als »Triebtäter«, »Pädos« oder »Perverslinge«. Hier drinnen unterscheidet man nicht zwischen Petzen und Sexualstraftätern. Für viele der jungen Männer ist das »Nicht-Petzen« die Grundlage ihres moralischen Kompasses. Für einige ist kein Verbrechen so schändlich wie die Informationsweitergabe an die Polizei.
Das ständige Anwachsen der Gefängnispopulation hat einen Platzmangel zur Folge, der bedeutet, dass viele junge Männer, die nur kurze Strafen wegen geringfügiger Vergehen wie etwa Drogenbesitz oder Ladendiebstahl abzusitzen haben, in denselben Trakten leben wie die schweren Gewaltverbrecher, von denen viele lange Haftstrafen wegen Mordes – oder eines missglückten Mordversuchs – verbüßen. Die Auswirkung dieser Kreuzbestäubung zwischen gewalttätigen und nicht gewalttätigen Verbrechern ist ganz einfach eine Erhöhung des Gewaltpotentials, das in jedem Winkel des Gefängnisses ohnehin beachtlich ist. Komischerweise sind die Sexualstraftäter die am wenigsten aggressive und zudem kooperativste Gruppe; der Kontrast zwischen ihnen und allen anderen ist verblüffend.
In dieser Umgebung kann der geringfügigste Streit schnell eskalieren. Eigentlich gedacht als Ort der Rehabilitation – wie auch der Strafe –, ist das Gefängnis der brutalste Ort in der Gesellschaft. Die Gewalt ist so deutlich zu spüren, dass man an diesem Ort nicht lange wohnen kann, ohne auf die eine oder andere Art verändert oder deformiert zu werden, und das ist der Grund, warum die Leute sich sehr schnell an die Gewalt gewöhnen. Einige gewöhnen sich daran, indem sie selbst aggressiv oder gewalttätig werden, andere indem sie Drogen wie Valium, Heroin oder in jüngster Zeit auch Spice konsumieren. Dabei ist die Allgegenwart der Gewalt für den Gefangenen nicht so erschreckend wie für jene, die nur gelegentlich zu Besuch kommen. Diese beängstigende Pulverfassatmosphäre spiegelt sich in den Familien und Haushalten wider, in denen viele der Gefangenen aufwuchsen und in denen die Gewalttaten so häufig sind, dass man abstumpft und über die entsprechenden Vorfälle eher leichthin spricht, fast so wie über das Wetter.
Vor ein paar Monaten wurden jemandem wegen eines Streits um eine Scheibe Toast das Gesicht aufgeschlitzt. In diesem feindseligen sozialen Klima ist Gewalt nicht nur eine praktische Machtdemonstration, sondern auch eine Form der Kommunikation. Wird jemand dabei ertappt, wie er einer Konfrontation aus dem Weg geht, wird sich derjenige mit weiteren Bedrohungen und Angriffen vonseiten der Personen konfrontiert sehen, die seine Verwundbarkeit spüren. Jemandem wegen einer Scheibe Toast das Gesicht aufzuschlitzen, mag brutal, hirnlos und barbarisch erscheinen, aber in verquerer Weise kann eine solche Tat auch der Versuch sein, das Risiko von Gewalt gegen einen selbst zu reduzieren. Niemand legt sich mit jemandem an, der einen anderen allein wegen einer Scheibe Toast aufschlitzt, und bei dieser Argumentation, die in einem gewalttätigen Umfeld pathologisch ist, geht es sowohl ums Überleben wie um den eigenen Stolz oder Ruf. Im Grunde genommen sind Stolz und Draufgängertum oft nur eine soziale Erweiterung des Überlebensinstinkts. Ungeachtet des Kontexts der Gewalt ist ihre Funktion oft dieselbe: Sie ist nicht nur praktisch, sondern zugleich performativ und dazu gedacht, potentielle Aggressoren abzuwehren und eine direkte Drohung zu eliminieren. Nicht jeder, der hierherkommt, ist gewalttätig, aber es ist schwer, nach der Ankunft nicht in die Kultur der Gewalt hineingezogen zu werden. Oft ist es so, dass Leute das Gefängnis viel gewalttätiger verlassen, als sie es betreten haben. Dies trifft auch auf die Drogenprobleme zu, die oft eskalieren, sobald die Realität des Gefängnislebens sich bemerkbar macht.
Im Allgemeinen sind Frauen weniger gewalttätig. Die Gruppe, mit der ich mich an diesem Vormittag traf, war erst kürzlich herverlegt worden, nach der Schließung von Schottlands einzigem Frauengefängnis, Cornton Vale. Das Gefängnis hatte pro Jahr 12 Millionen Pfund gekostet und etwa 400 weibliche Gefangene und junge Straftäterinnen beherbergt. 2006 hatten 98 Prozent der Insassen in Cornton Vale Suchtprobleme; 80 Prozent litten an psychischen Störungen; 75 Prozent waren Missbrauchsopfer.
Die neue Unterkunft dient nun vorwiegend der Resozialisierung junger Männer, wohingegen diese Frauen jedoch Erwachsene sind. Einige von ihnen haben eigene Kinder, die draußen in Freiheit in der Obhut von Verwandten oder in öffentlichen Einrichtungen leben. Vielleicht denken einige von ihnen an sie, während sie mit leerem Blick ins Nichts starren, verwirrt von meiner ergebnisoffenen Frage.
Zugegeben, ich habe schon stärkere Gesprächseröffnungen hingelegt. Manchmal gleite ich wie auf Flügeln durch diese Anfangsphase, und die Leute fressen mir sofort aus der Hand. Aber an diesem Tag fühle ich mich gehemmt von denselben Selbstzweifeln, die ich auch bei den Frauen feststelle. Ich weise sie darauf hin, dass niemand verpflichtet ist, auf meine Frage nach dem Grund ihres Hierseins zu antworten, aber insgeheim hoffe ich natürlich, dass jemand es tut. Sollte eine der Frauen den Sprung wagen und als Erste antworten, könnte mir das etwas Wesentliches über diese Person und über die Gruppe sagen. Zum Beispiel heben einige die Hand, bevor sie sprechen, und das lässt entweder, je nach Kontext, auf gute Manieren oder auf Unterwürfigkeit gegenüber Autoritäten schließen. Einige gehen dazwischen, bevor man die Frage ganz ausgesprochen hat, und das kann auf Begeisterung, großes Selbstbewusstsein oder ein starkes Abgrenzungsbedürfnis hindeuten. Es ist allerdings sinnvoll, nicht zu viele Vermutungen allein aufgrund des Anfangsverhaltens einer Gruppe anzustellen. Jemand, der gewohnheitsmäßig das Gespräch unterbricht, kann auch Hörprobleme oder Lernschwierigkeiten haben. Ich kann nun nicht alle Hypothesen aus meinem Kopf verbannen, aber ich kann versuchen, mich von meinen Annahmen nicht allzu sehr steuern zu lassen. Diese Annahmen sagen ebenso viel über mich aus wie über die Menschen, die ich beobachte.
Wenn ich in der Gefängnisumgebung eine Diskussion leite, versuche ich, jede verbale Kommunikation zuzulassen, zumindest in der Anfangsphase. Es ist wichtig, nicht zu früh Regeln aufzustellen – solange ich noch keine grundlegenden Informationen darüber habe, mit wem ich spreche. In diesen ersten Augenblicken versuche ich, ein gutes Verhältnis aufzubauen, das auf gegenseitigem Respekt fußt und es mir später leichter macht, Zugang zur Gruppe zu finden.
»Was glaubt ihr, warum ich hier bin?« Die Frage gibt einen kollegialen Ton vor und fungiert als Absichtserklärung. Viele dieser Frauen (und der Gefängnisinsassen im Allgemeinen) sind daran gewöhnt – sogar darauf konditioniert –, von Autoritätspersonen angesprochen zu werden, die Macht über sie haben. Auch wenn das in der Gefängnisumgebung nur recht und billig ist, ist es oft so, dass diese Autoritätspersonen im Lauf der Zeit den Insassen nicht mehr aktiv zuhören, sondern sie als sozial oder beruflich minderwertig betrachten. Eine Kluft öffnet sich zwischen Angestellten und Insassen, und wenn jemand versucht, diese zu überbrücken, kann es zu schweren Missverständnissen kommen. Deshalb neigen die Leute dazu, unter sich zu bleiben und dem jeweiligen Rollenmodell zu entsprechen, das auf ihrer jeweiligen Seite der Trennlinie als üblich gilt.
Indem ich meinen Workshop mit einer Frage eröffne, signalisiere ich der Gruppe, dass diese Dynamik zeitweilig außer Kraft gesetzt wurde. Dass der gewohnte Fluss der Macht unterbrochen wurde. Anstatt so zu tun, als würde ich die Antwort auf grundsätzlich jede Frage kennen, signalisiere ich ihnen, dass ich ohne ihre Hilfe rein gar nichts weiß. Die Frauen können, da ich ihnen eine Frage stelle, davon ausgehen, dass ich den Wert ihrer Erfahrungen und Erkenntnisse achte.
»Du bist der verrückte Rapper«, sagt eine Frau mit Narben an den Armen, die sie sich vermutlich selbst zugefügt hat.
»Wir sind hier, um Songs zu schreiben«, sagt eine andere mit einem langsamen Näseln, das auf den Gebrauch von Methadon oder Beruhigungsmitteln hindeutet.
Mit jeder Antwort vervollständigt sich mein Bild davon, mit wem ich hier zu arbeiten habe.
»Das stimmt«, antworte ich, bevor ich die Frauen nach ihren Namen frage und ihnen ein paar Hintergrundinformationen über mich gebe, was ich, wie immer, mit einem kurzen Rap tue. Das Stück heißt »Jump« und wurde speziell geschrieben, um das Interesse einer Gruppe zu wecken, was wesentlich ist, wenn man mit Leuten arbeitet, die an Konzentrationsstörungen oder geringer Selbstachtung leiden. Je schneller sie den Eindruck bekommen, sie wüssten, worum es geht, desto besser. Je schneller sie das Gefühl haben, mitgestalten zu können, was passiert, desto unwahrscheinlicher wird es, dass sie zu rebellieren beginnen oder in Apathie versinken. Je schneller sie ins Buch hineinkommen, desto schwerer wird es ihnen fallen, es wieder wegzulegen.
Unsicherheit oder Angst in Bezug auf eine Aktivität oder eine Aufgabe zeigen sich oft in einer entweder desinteressierten oder feindseligen Haltung. Im Lauf der Jahre habe ich ein paar Tricks gelernt, wie man die Leute bei der Stange hält. Einer ist, dass man etwas Positives über sie sagt. Jede Interaktion bietet Gelegenheit, dem Teilnehmer eine gewisse Anerkennung oder Bestätigung zukommen zu lassen. Das funktioniert am besten, wenn man etwas anerkennt, das sie gut können; Fähigkeiten oder Persönlichkeitsmerkmale, die sie bereits besitzen und nicht von einem anderen erwerben müssen. Jemanden zu seiner Handschrift, seinem Humor, zu einer interessanten Beobachtung oder Formulierung zu beglückwünschen, kann viel bewirken. Wenn jemand sehr still ist, hat derjenige vielleicht ein interessantes Tattoo oder einen guten Kleidungsstil. Diese Dinge deuten auf Tiefe, Komplexität und eine souveräne Handlungsfähigkeit hin, und das verdient es, anerkannt zu werden. In der Welt des Gefängnisses sind winzige Dinge ungeheuer wichtig, und so wie jemand einen anderen wegen einer Scheibe Toast aufschlitzen kann, kann der Tag eines Menschen von Grund auf umgekehrt werden durch den schlichten Austausch von Freundlichkeiten.
»Du hast eine schöne Handschrift.«
In dem Augenblick, da man etwas Positives sagt, wird der Teilnehmer dies instinktiv abwehren und eine vertrautere Negativzuschreibung bekräftigen.
»Ich? Eine schöne Handschrift? So ein Quatsch. Ich bin blöd. Ich kann nicht schreiben.«
Aber wenn man aufpasst, wird man bemerken, dass die Gesichter aufleuchten und sich Verlegenheit darin spiegelt, kaum dass die Angesprochenen glauben, man schaue nicht mehr hin. An einem guten Tag kann es sogar passieren, dass die Teilnehmer später noch über dieses Kompliment nachdenken oder sich vielleicht eingestehen, es könnte einen Funken Wahrheit enthalten. Diese winzigen Interaktionen helfen einem selbst und den Teilnehmern, einander näherzukommen, eine Chemie zu erzeugen, die nötig ist, um innerhalb der Gruppe Vertrauen und Selbstbewusstsein entstehen zu lassen.
Teilnehmer, die mit Bildungsbarrieren wie schlechter Alphabetisierung oder geringer Selbstachtung zu kämpfen haben, kommen normalerweise – allerdings nicht immer – aus einem familiären Zusammenhang, in dem ihre Fähigkeiten nicht gewürdigt oder gefördert wurden, und das macht es ihnen schwer, Risiken einzugehen. Für diese Gruppe kann allein schon das laute Vorlesen eines Textes oder das Formulieren einer Meinung entmutigend oder einschüchternd sein, was bedeutet, dass man die Bedürfnisse einer Person intuitiv erfassen muss, wenn man sie über ihre Komfortzone hinaus ermutigen will. Für diejenigen, die im Gefängnis landen, ist die Situation oft noch schlimmer; ihre Talente werden unterdrückt, verlacht oder aktiv kleingeredet, sodass sie schließlich zu einer Quelle der Verlegenheit und Scham werden. All jene Aspekte der eigenen Persönlichkeit werden unterdrückt, die auf Verletzlichkeit hindeuten; der Glauben verstärkt sich, dass man dumm ist. Wenn sich eine Stunde oder Lektion anfangs träge dahinschleppt, dann schalten die Leute ab, weil sie annehmen, es läge an ihnen und ihrer mangelnden Intelligenz – auch wenn es eigentlich an einem schlecht vorbereiteten Moderator wie mir liegt. Dieser Kernglaube, dass sie nicht klug genug sind, manifestiert sich oft als konfrontative oder aggressive Haltung. Das herausfordernde Verhalten wird benutzt, um jede Interaktion abzuwehren, die ihre Ängste, ihr Gefühl der Unzulänglichkeit oder ihre Verletzlichkeit enthüllen könnten.
Bei Workshops wie diesen benutze ich als Eisbrecher normalerweise einen Song wie »Jump«. Die erste Zeile geht so:
Growing up, I never knew who to trust, looking at the world through the window of a school bus, gob-stopper in my mouth, I didn’t mind school, it got me out the house.
»Als Kind wusste ich nie, wem ich trauen sollte, wenn ich durchs Schulbusfenster auf die Welt sah, den Lutscher im Mund, gegen die Schule hatte ich nichts, da kam ich aus dem Haus.«
Der Text ist autobiografisch und beschreibt meine Schulzeit sowie den plötzlichen Tod meiner Mutter. Allerdings ist der Song bewusst überladen mit der Sprache und den Bildern der Unterschicht, mit Verweisen auf alkoholische Getränke wie MD 20/20 und Buckfast oder auf Rapper wie Tupac Shakur. Themen wie der Zusammenbruch der Familie, Verlassenheit, Alkoholismus und Verlust, auch die spielerischen Sticheleien gegen die Mittelklasse und die Gesetzeshüter reflektieren nicht nur die eigenen Erfahrungen der Insassen, sondern erkennen eben auch den Wert dieser Erfahrungen an. Der Song, der als derb, anstößig oder schlicht gesehen werden kann, gefällt ihnen, weil er den Reichtum ihrer eigenen Erfahrungen zeigt, die Poesie in dem, was von der breiteren Gesellschaft als die Vulgarität ihres Lebens abgetan wird.
Die Vollstreckung von Strafe ist die Rolle des Staates. Mein Job ist es, diesen Leuten dabei zu helfen, ihre Menschlichkeit in einer Umgebung auszudrücken, in der genau diese Menschlichkeit sie umbringen kann.
Die Teilnehmer, ob in einer Gefängnisumgebung oder jeder anderen Umgebung, die von Menschen unterprivilegierter Herkunft bevölkert wird, beobachten mich oft beim Reden, suchen nach Hinweisen, ob man mir vertrauen kann, ob ich »sauber« bin. Sie achten genau darauf, wie ich rede, welche Wörter ich benutze und in welchem Dialekt sie formuliert sind. Sie versuchen instinktiv, den Unterschied zu ermitteln zwischen dem, der ich wirklich bin, und dem, der ich behaupte zu sein. In dieser Umgebung ist Authentizität der Maßstab, an der alle gemessen werden. Das ist der Grund, warum man selten Menschen von hohem Status findet, die hochsprachliche Sätze formulieren und trotzdem in einem solchen Umfeld arbeiten – außer sie sind umringt von Sicherheitspersonal oder können auf besondere rechtliche Befugnisse zurückgreifen. Wenn Leute hierherkommen, um zu arbeiten, spielen sie oft Rollen, von denen sie glauben, dass sie bei den Teilnehmern ankommen, und sie vergessen dabei, dass die Gefängnisse voll sind mit den emotional intuitivsten und manipulativsten Menschen, die man sich vorstellen kann.
Obwohl Menschen aus den verschiedensten Gründen im Gefängnis landen, besteht ihr gemeinsamer Nenner fast immer darin, dass sie emotionalen, psychologischen, körperlichen oder sexuellen Missbrauch erfahren haben. Misshandlungen oder die Vernachlässigung vonseiten der Eltern und Betreuer scheinen eine bedeutende Rolle bei der Verstärkung der Grundfaktoren zu spielen, die zu kriminellem Verhalten führen: geringe Selbstachtung, niedriger Bildungsgrad, Drogenmissbrauch und gesellschaftliche Ausgrenzung.
Gegen Ende des Workshops erwähnt eine Frau, die bis zu diesem Zeitpunkt still gewesen ist, eher beiläufig, dass ihre Eltern und ihre Schwester kürzlich gestorben seien, nachdem sie auf der Straße gefälschtes Valium gekauft hatten. Dennoch nimmt sie selbst auch im Gefängnis weiter Drogen. Sie ist hier, weil sie die Schuld für etwas auf sich nahm, das ihr Freund getan hatte. Er selbst landete schließlich ebenfalls im Knast, weil er angefangen hatte, Heroin zu nehmen, kurz nach dem Mord an seinem besten Freund, den er in seiner eigenen Wohnung miterlebte. In dem Streit ging es um Drogen. Sie erzählt die Geschichte über ihre toten Eltern mehrmals im Verlauf meiner Arbeit mit ihr, fast so, als würde sie das Erzählte anschließend sofort wieder vergessen. In der vierten Woche vergießt sie eine Träne. Sie sagt mir, dass es die erste Träne sei, die sie im Gefängnis vor anderen geweint hat. Das ist ihre Art, mich wissen zu lassen, dass sie mir vertraut. Als sie anfängt zu schluchzen, trösten die anderen Frauen sie mit all der Fürsorge und Zärtlichkeit einer treusorgenden Familie, etwas, das viele von ihnen vielleicht nie kennengelernt haben.
Viele der Leute in diesem Gefängnis sind Wiederholungstäter. Viele verdienen es, wegen dem, was sie getan haben, hier zu sein. Viele haben Verbrechen gegen unschuldige, rechtstreue Bürger begangen, die nach Strafe verlangen. Wenn man im Gefängnis arbeitet, ist es einfach, die Opfer der Verbrechen zu vergessen. Aber auch wenn deren Berücksichtigung wesentlich ist, trifft es doch zu, dass vieles von dem zerstörerischen und sozial schädlichen Verhalten, das wir bei den Straftätern sehen, einen eindeutigen Ausgangspunkt hat. Egal, wen man sich in diesem Gefängnis aussucht – Psychopathen und kriminelle Geisteskranke einmal ausgeschlossen –, wenn man das Leben dieser Person zurückdreht bis vor die Zeit, zu der sie kriminell wurde, dann wird man wahrscheinlich sehen, dass sie als Kind das Opfer irgendeiner Form von Gewalt war.
2Eine Geschichte der Gewalt
Mit zehn Jahren hatte ich mich daran gewöhnt, dass mir Gewalt angedroht wurde. In gewisser Weise war die Gewalt selbst der Gewaltandrohung vorzuziehen. Wenn man geschlagen – oder gejagt – wird, schaltet sich ein Teil von einem ab. Es kommt zu einer Trennung; man wird körperlich taub, löst sich ab von dem Gewaltakt, der gegen einen begangen wird. Der Körper schaltet in den Selbsterhaltungsmodus, bis die Bedrohung vorüber ist.
Zum Glück verfliegt die Wut eines Angreifers schnell. Deshalb ist der Schlüssel, um eine gewalttätige Episode zu überstehen, normalerweise, sich zu unterwerfen und zu hoffen, dass man keine ernsthaften Schäden davonträgt.
Gewaltakte sind furchteinflößend, aber eine anhaltende Gewaltandrohung ist noch schlimmer. Häusliche Gewalt zum Beispiel spürt man in der Luft. Man passt sich an die Drohung an, indem man hyperwachsam wird. Dieser erweiterte Bewusstseinszustand kann in kurzen, scharfen Episoden der Sensibilität auftreten und ist dann ausgesprochen effektiv. Wenn die Angst vor der Gewalt jedoch zum Dauerzustand wird, dann wird die Hyperwachsamkeit zu einer emotionalen Grundeinstellung, die es einem sehr schwer macht, sich zu entspannen oder im Hier und Jetzt zu leben.
In einem Zuhause, in dem die Gewalt oder die Gewaltandrohung zur Normalität geworden sind, lernt man früh, damit umzugehen. Man wird ein Profi für den Gesichtsausdruck, die Körpersprache und den Tonfall anderer, da man die potentielle Bedrohung ja erkennen und abwehren muss. Man wird zum geschickten emotionalen Manipulator, lernt, die Wut desjenigen in Schach zu halten, der üblicherweise für die Misshandlung zuständig ist, indem man intuitiv dessen Bedürfnisse und den möglichen Auslöser der Wut erspürt und das eigene Verhalten entsprechend anpasst. Für viele Menschen bleiben diese Überlebensstrategien in ihre Persönlichkeit integriert, auch wenn die Gewaltandrohung längst nicht mehr akut ist.
Leider funktioniert die beschriebene Strategie nur eine gewisse Zeit lang, danach versagt sie unausweichlich. Denn wenn man versucht, sich um die Bedürfnisse ausgerechnet der Person herumzuverbiegen, vor der man sich fürchtet, vergrößert man lediglich das Gefühl der Bedrohung, durch das die Hyperwachsamkeit befeuert wird. Bedrohung meint in diesem Kontext die ängstliche Erwartungshaltung, die einer Gewalttat vorausgeht. Es ist ein Dilemma. Einerseits will man nicht, dass es zur Gewalt kommt, andererseits weiß man, sie ist unausweichlich, und man würde ihr am liebsten aus dem Weg gehen.
Ein entscheidender Vorfall in meinem Leben ereignete sich, als ich ungefähr fünf Jahre alt war. Wir waren erst vor Kurzem auf die andere Seite von Pollok gezogen, wo ich aufwuchs. Pollok ist ein sogenanntes Problemviertel im Süden Glasgows, das Anfang der 1990er-Jahre weit oben stand in der europaweiten Rangliste der sozial benachteiligten Stadtgebiete. Unser neues Zuhause war eine Doppelhaushälfte mit drei Schlafzimmern, einem Gärtchen hinten sowie einem Vorgarten. Ich erinnere mich, dass ich an diesem Abend im oberen Stockwerk im Bett lag, aber nicht einschlafen konnte wegen des Lärms, der von unten kam. Meine Mum hatte Leute eingeladen; sie tranken, lachten und hörten Musik. Als Nächstes erinnere ich mich, dass ich vor einer Gruppe von Gästen in der Wohnzimmertür stand. Meine Hoffnung war, dass meine Mutter mich aufbleiben lassen würde, weil sie angetrunken war. Mir war sie lieber, wenn sie etwas getrunken hatte, sie war dann viel entspannter, lustiger und liebevoller. Aber an diesem Abend blieb sie hart und schickte mich wieder nach oben. Es gab ein kleines Hin-und-Her. Ich nehme an, ich wollte vor ihren Gästen ein wenig angeben; ich zog sie wahrscheinlich auf und versuchte, sie in eine besonders schlaue Argumentation zu verwickeln. Dann veränderten sich ihr Tonfall und ihre Haltung, und sie befahl mir ein letztes Mal, nach oben zu gehen. Ich weigerte mich.
Sie starrte mich einen Augenblick an, bevor sie aus ihrem Sessel aufsprang und in die Küche rannte. Sie riss die Besteckschublade auf, griff hinein und zog ein langes, gezahntes Brotmesser heraus. Dann drehte sie sich um. Ich wusste natürlich, dass ihr Verhalten zuweilen unberechenbar war, aber dieser Moment war anders als alles, was ich bis dahin erlebt hatte. Ich rannte aus dem Zimmer und dämlicherweise auf die Treppe zu, als sie, nur Sekunden hinter mir, aus dem Wohnzimmer in den Gang stürmte. Ich hastete die Treppe hinauf, so schnell ich konnte, aber sie kam mir nach. Der Abstand zwischen uns schmolz. Da ich mich nirgendwo verstecken konnte, rannte ich in mein Zimmer und warf die Tür hinter mir zu, was jedoch nichts half. Die Tür prallte von meiner Mutter ab, die mit dem Messer in der Hand hereinstürzte wie das Monster in einem Albtraum.
Wenn ich nur so schlau gewesen wäre, stattdessen zur Haustür hinauszurennen. Noch Sekunden zuvor hatte meine Mutter sich so gut amüsiert, dass es mir sicher erschienen war, sie vor den anderen ein bisschen zu ärgern. Jetzt war ich in meinem Zimmer gefangen, wurde gegen die Wand gedrückt und hatte ein Messer an der Kehle. Ich weiß nicht mehr, was sie zu mir sagte, aber ich erinnere mich noch gut an den Hass in ihren Augen. Ich weiß noch, dass ich dachte, jetzt werde ich gleich aufgeschlitzt, und dann werde ich sterben. In dem Augenblick, als sie das Messer an mein Gesicht hob, wurde sie von meinem Dad nach hinten gerissen und auf die andere Seite des Zimmers geschleudert, wo er sie festhielt, während einer der Gäste mich packte und in sein Auto schaffte.
Ich kann mich nicht erinnern, dass meine Mutter oder sonst jemand danach je etwas über diesen Abend sagte. Um ehrlich zu sein, ich vergaß den Vorfall selbst wieder, bis er mir viele Jahre später plötzlich in einem Flashback vor Augen stand.