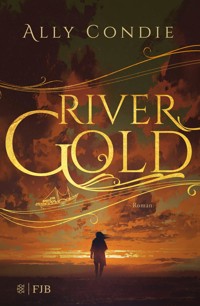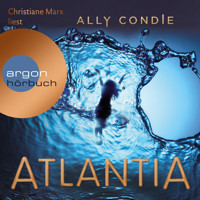
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Argon Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
TAUCHE EIN IN DIE UNGEHEUERLICHE ROMANWELT VON ALLY CONDIE. Zwillinge. Sie waren für ein gemeinsames Leben bestimmt. Doch das Schicksal trennte sie. Bay, du fehlst mir so sehr, flüsterte sie in die Muschel. Aus dem Inneren tönte ein rauschender Gesang und erinnerte an eine Zeit, als Wasser und Land noch zusammengehörten. Wo auch immer an der Landoberfläche ihre Schwester nun war, sie musste sie finden – auch wenn es niemandem erlaubt war, die Stadt unter der Glaskugel zu verlassen. In einer Welt, die in Wasser- und Landbevölkerung aufgeteilt ist, werden die Zwillingsschwestern Rio und Bay durch einen Schicksalsschlag getrennt. Bay tritt ihre Reise zur Oberfläche an. Rio bleibt in Atlantia zurück. Um ihre Schwester wiederzusehen, muss sie herausfinden, warum Wasser und Land getrennt wurden und welche wunderbare und zugleich zerstörerische Gabe die Frauen der Familie verbindet.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Zeit:9 Std. 28 min
Ähnliche
Ally Condie
Atlantia
Roman
Übersetzt von Stefanie Schäfer
FISCHER E-Books
Inhalt
Für Truman, der ein Künstler und ein Macher ist.
Kapitel 1
Meine Zwillingsschwester Bay und ich schreiten unter den braun-türkisfarbenen Bannern hindurch, die von der Decke des Tempels herabhängen. Würdenträger sitzen steif auf ihren Stühlen in der Galerie und überblicken von dort aus das Geschehen. Die Bänke im Mittelschiff sind dicht gefüllt. Götterbilder schmücken Wände und Decke, und es scheint, als würden auch sie uns beobachten. Das größte und schönste Fenster des Tempels, das Rosenfenster, wird von hinten beleuchtet, um die Illusion von einfallendem Sonnenlicht zu erzeugen. Das Glas leuchtet, als spendete es uns Segen – bernsteingelb, grün, blau, rosa, violett. Oben die Farben von Blütenblättern; unten die von Korallenformationen.
Der Priester steht am Altar, der mit einem komplizierten Schnitzmuster von geraden Linien und Wirbeln verziert ist. Wellen, die zu Bäumen werden, sind auf dem kostbaren Holz zu sehen. Zwei Schalen stehen oben auf dem Altar – eine gefüllt mit Salzwasser aus dem Ozean, der unsere Stadt umgibt, eine mit dunkler Erde, die von Oben hinuntergebracht wurde.
Bay und ich warten in einer Reihe mit den anderen gleichaltrigen Jugendlichen. Mir tun die anderen leid, weil sie keine Geschwister haben, die mit ihnen zusammen warten. In Atlantia sind Zwillingsgeburten eher selten.
»Hörst du, wie die Stadt atmet?«, flüstert Bay.
Ich weiß, dass es ihr am liebsten wäre, ich würde zustimmen, aber ich schüttele den Kopf. Was wir hören, ist kein Atem. Es ist das immerwährende Säuseln der Luft, die durch die Wände in die Räume gepumpt wird, damit wir überleben können.
Bay weiß das, aber sie hatte schon immer eine etwas seltsame Beziehung zu Atlantia – wobei sie nicht die Einzige ist, die unsere Unterwasserstadt liebt und sie als lebendig bezeichnet. Und tatsächlich gleicht Atlantia einem riesigen Meereslebewesen, das sich auf dem Grund des Ozeans ausgestreckt hat. Die Straßen und Wege erstrecken sich wie Tentakel ausgehend von den größeren Kuppeln der Wohnviertel und Marktplätze. Natürlich ist alles eingekapselt. Wir leben unter Wasser, sind aber dennoch menschlich; wir brauchen daher sowohl Wände als auch Luft, um uns zu schützen.
Der Priester hebt die Hand, und wir werden still.
Bay presst die Lippen zusammen. Normalerweise ist sie ruhig und ausgeglichen, doch heute wirkt sie angespannt. Hat sie Angst, dass ich mein Versprechen brechen werde? Das werde ich nicht. Ich habe es ihr geschworen.
Wir stehen Seite an Seite, Hand in Hand. Unser braunes Haar ist mit blauen Bändern zu komplizierten Zöpfen geflochten. Wir haben beide blaue Augen. Wir sind hochgewachsen und haben die gleiche Haltung. Doch wir sind zweieiige Zwillinge, nicht identisch, und so kann man uns problemlos auseinanderhalten.
Obwohl Bay und ich nicht das Spiegelbild des anderen sind, sehen wir uns dennoch so ähnlich, wie es bei zwei unterschiedlichen Menschen möglich ist. Wir haben seit jeher eine enge Bindung zueinander gehabt, und seit dem Tod unserer Mutter sind wir noch näher zusammengerückt.
»Das wird schwer heute«, seufzt Bay.
Ich nicke. Es wird schwer heute, denke ich, weil ich nicht das tun werde, was ich immer tun wollte. Doch ich weiß, dass Bay das nicht meinte.
»Weil sie nicht mehr ist«, sage ich.
Bay nickt.
Bevor unsere Mutter vor sechs Monaten starb, war sie die Priesterin des Tempels und leitete die Zeremonie, die zum Jahrestag der Trennung begangen wird. Bay und ich waren jedes Jahr dabei, wenn Mutter die Eröffnungsrede hielt und dann die Jugendlichen, die das Alter der Wahl erreicht hatten, mit Wasser oder Erde segnete, je nachdem, wie ihre Entscheidung ausgefallen war.
»Glaubst du, Maire ist hier?«, fragt Bay.
»Nein«, antworte ich. Bay meint unsere Tante, unsere einzige noch lebende Verwandte. Ich versuche, neutral zu klingen, aber meine Stimme ist scharf. »Sie gehört nicht hierher.« Unsere Mutter gehörte in den Tempel, und sie und ihre Schwester Maire hatten sich vor langer Zeit voneinander entfremdet. Als Mutter jedoch starb …
Nein, ich darf nicht daran denken.
Der Priester beginnt mit dem Ritual, ich schließe die Augen und stelle mir vor, dass an seiner Stelle unsere Mutter die Andacht leitet. In meinen Gedanken steht sie aufrecht und klein hinter dem Altar. Sie trägt ihren braun-blauen Talar und die Priester-Insignien, die Silberkette mit dem Anhänger, der das gleiche Muster wie die Altarschnitzereien hat. Sie breitet die Arme weit aus und ähnelt dabei einem der Rochen, die manchmal durch die Meeresgärten segeln.
»Welche Gaben wurden jenen geschenkt, die Unten leben?«, fragt der neue Priester.
»Langes Leben, Gesundheit, Stärke und Glück.« Ich skandiere die Worte zusammen mit allen anderen, doch für meine Familie hat sich dies nicht erfüllt. Unsere Eltern sind beide jung gestorben – Vater vor Jahren, als Bay und ich noch Babys waren, an einer Krankheit namens Wasserlunge, und Mutter erst vor kurzer Zeit. Natürlich haben sie länger gelebt, als sie es Oben getan hätten, aber dennoch kürzer als die meisten anderen Leute hier Unten in Atlantia.
Doch unsere Familie war ohnehin nie wie die meisten anderen Familien Atlantias. Früher schaute man zu uns hoch, wir wurden zutiefst beneidet, doch in letzter Zeit überwog das Mitleid. Der Neid wurde durch unser Unglück fortgewaschen. Früher respektierte man Bay und mich, wenn wir die Hallen der Tempelschule durchquerten, weil wir die Töchter von Ozeana, der Priesterin, waren. Nun betrachtet man uns als mitleiderregende Geschöpfe, wir sind die Waisenkinder von Eltern, die zu früh gestorben sind.
»Welcher Fluch liegt auf jenen, die Oben leben?«, fragt der Priester.
»Ein kurzes Leben, Krankheit, Schwäche und Elend.«
Bay drückt tröstend meine Hand. Sie weiß, dass ich mein Versprechen halten und mich anders entscheiden werde als geplant.
»Ist das gerecht?«
»Es ist gerecht. Es ist so, wie es die Götter zur Zeit der Trennung beschlossen haben. Manche müssen Oben bleiben, damit die Menschheit Unten überleben kann.«
»Lasset uns danken.«
»Wir danken den Göttern für das Meer, in dem wir leben, für die Luft, die wir atmen, für unser Leben im Unten.«
»Habt Gnade mit uns.«
»Und mit denen, die Oben leben.«
»Dies«, spricht der Priester, »ist der Weg, den die Götter uns vorgezeichnet haben, seitdem die Welt zerstört wurde und die Trennung stattfinden musste. Die Luft war verschmutzt, und die Menschen konnten Oben nicht länger überleben. Um die Menschheit zu retten, bauten sie Atlantia. Doch nicht jeder konnte hinunter. Viele blieben Oben, damit ihre Angehörigen Unten leben konnten.
Wir unter Wasser im Unten haben ein langes, schönes Leben. Wir arbeiten hart, aber nicht annähernd so hart wie diejenigen an Land. Wir haben Zeit für Muße. Wir müssen keine verschmutzte Luft atmen, und der Krebs zerfrisst nicht unsere Lungen.
Die Menschen Oben arbeiten ihr Leben lang, um uns hier Unten zu unterstützen. Ihre Lungen zersetzen sich, und sie leiden furchtbare Schmerzen. Doch sie werden später dafür belohnt werden, im Leben danach.
Die Entscheidung, den Fortbestand der Menschheit auf diese Weise zu retten, wurde von den Göttern und von unseren Ahnen getroffen. Wir akzeptieren sie. Der heutige Tag ist eine Ausnahme, da wir unsere eigene Entscheidung treffen können. Obwohl wir daran glauben, dass uns die Götter aus einem bestimmten Grund nach Unten geschickt haben, dürfen wir auch nach Oben gehen, wenn wir es wünschen, und unser Leben opfern.«
Der Priester hat seine Predigt beendet. Ich öffne die Augen.
Er ist ein hochgewachsener Mann namens Nevio. Ich habe mich immer noch nicht daran gewöhnt, die Priester-Insignien um seinen Hals hängen zu sehen. Mir ist, als gehörten sie unserer Mutter.
»Warum sollte sich irgendjemand dafür entscheiden, nach Oben zu gehen, wo man jung stirbt und schrecklich hart arbeiten muss?«, fragten die Kinder von Unten, als sie kleiner waren. Ich beteiligte mich bei diesen Fragen nie, sondern behielt die lange Liste der Gründe für mich, die dafür sprachen, nach Oben zu gehen: Man kann die Sterne sehen. Man kann die Sonne auf dem Gesicht spüren. Man kann einen Baum berühren, der in richtiger Erde wurzelt. Man kann meilenweit gehen, ohne je an den Rand seiner Welt zu gelangen.
»Tritt vor«, sagt Nevio zu der Ersten in der Reihe.
»Ich akzeptiere mein Schicksal im Unten«, antwortet das Mädchen.
Ein zustimmendes Gemurmel steigt von der Menge auf. Denn trotz all der großen Reden über die Tugenden des Sich-Opferns begrüßen es die Bewohner von Atlantia, wenn die jungen Leute die Wahl ihrer Verwandten, Unten zu bleiben, anerkennen, indem sie sich genauso entscheiden. Nevio, der Priester, nickt und taucht die Finger in die Schale mit Salzwasser und sprenkelt es auf das Mädchen, spritzt ihr Tropfen ins Gesicht, die kleiner sind als Tränen. Ich frage mich, ob es brennt.
Als der erste junge Mann das Oben wählt, nehmen ihn die Friedenswächter in ihre Mitte und führen ihn weg. Es gibt keine Möglichkeit, sich noch von Freunden und Familie zu verabschieden. Nach dem Ende der Zeremonie verfrachten die Friedenswächter alle, die das Oben gewählt haben, für einen Transport an die Oberfläche. Die Endgültigkeit dieser Entscheidung hat mich seit jeher beschäftigt – keine Möglichkeit, noch irgendetwas zu erledigen, nur abrupte Trennung. Ich habe immer gewusst, dass es schwer sein würde, in dem Moment der Entscheidung in das Gesicht meiner Mutter zu blicken, aber sie hätte ja noch Bay gehabt. Sie wäre nicht allein gewesen, ich dagegen – endlich – Oben.
Doch als unsere Mutter starb, veränderte sich alles.
Ein Junge tritt jetzt nach vorn. Ich kenne ihn vom Sehen – Fen Cardiff, hübsch und sympathisch, mit blondem Haar und gefährlich lachenden Augen. In seiner Stimme liegt eine respektlose, ironische Note, als er die heiligen Worte spricht: »Ich wähle das Opfer im Oben.«
Eine Frau schreit laut auf. Sie klingt überrascht und verletzt. Seine Mutter? Hatte er ihr nicht gesagt, wofür er sich entscheiden würde? Er blickt nicht hinauf zur Empore – stattdessen dreht er sich zu uns um, die wir in der Reihe warten. Es wirkt, als suche er nach etwas oder jemandem.
In dem Moment, bevor die Friedenswächter ihn wegführen, begegnen sich unsere Augen – Augen, die bald das Oben sehen werden. Ich bin so neidisch auf ihn, dass ich kaum Luft bekomme. Doch ich habe Bay versprochen, dass ich es nicht tun werde, dass ich hier Unten bei ihr bleibe. Meine Handflächen sind verschwitzt. Ich habe es Bay versprochen.
Sie ist der einzige Mensch, dem ich je erzählt habe, dass ich nach Oben gehen möchte. Dass ich jede Nacht davon träume, dass ich mir beim Anblick des Glasgefäßes mit Erde auf dem Altar im Tempel jedes Mal vorstelle, wie es sich anfühlen würde, sie zu berühren und zu riechen, sie unter meinen Füßen und überall um mich herum zu spüren.
In den Jahren vor dem Tod unserer Mutter versprach mir Bay, dass sie mich gehen lassen würde, wenn die Zeit gekommen wäre. Sie selbst konnte den Gedanken nicht ertragen, Atlantia zu verlassen – sie liebte die Stadt und meine Mutter zu sehr –, doch sie versprach mir, meinen Wunsch für sich zu behalten, damit niemand versuchen würde, mich umzustimmen. Sobald ich meine Entscheidung vor der Gemeinschaft im Tempel verkündet hätte, wäre meiner Mutter keine andere Wahl geblieben, als mich fortgehen zu lassen. Nicht einmal der Priester oder der Rat kann die Entscheidung einer Person anfechten. Ich liebe meine Mutter und meine Schwester, doch solange ich mich erinnern kann, habe ich immer gewusst, dass ich das Oben sehen muss.
Doch jetzt kann ich nicht gehen.
An dem Tag, als unsere Mutter starb, weinte Bay so sehr, dass die Tränen ihre Haare benetzten und mich die Befürchtung durchfuhr, meine Schwester könne sich in eine Meerjungfrau verwandeln, mit Seegrashaaren und Salz auf der Gesichtshaut.
»Versprich mir«, flehte sie, als sie endlich wieder sprechen konnte, »dass du mich nicht hier Unten alleinlassen wirst.«
Ich konnte Bay nicht widersprechen. Ich konnte sie nicht verlassen, jetzt, wo unsere Mutter fort war. »Ich verspreche es«, flüsterte ich zurück.
Bay und ich sind nur zusammen, wenn ich im Unten bleibe. Für das Oben können wir uns nicht gemeinsam entscheiden, weil wir die einzigen beiden Kinder in unserer Familie sind. Und die Regel lautet: Eine Person aus jeder Vererbungslinie muss in Atlantia bleiben.
Nur noch wenige warten vor mir, dann bin ich an der Reihe.
Nevio, der Priester, kennt mich natürlich, doch als ich nach vorne trete, bleibt seine Miene unergründlich und neutral. Meine Mutter wäre genauso gewesen – in ihrem Priester-Talar war sie immer anders, distanziert und förmlich. Doch hätte sie auch ihre Haltung bewahrt, wenn ich gesagt hätte, dass ich nach Oben gehen will?
Ich werde es nie erfahren.
Das Salzwasser ist in einer blauen Schüssel, die Erde in einer braunen. Ich schließe die Augen und zwinge mich, mit der richtigen Stimme zu sprechen – der ausdruckslosen, falschen, die meine Mutter mich immer zu benutzen zwang, weil sie den Fluch und die Gabe meiner richtigen Stimme verbirgt.
»Ich akzeptiere mein Schicksal im Unten«, spreche ich.
Der Priester besprenkelt mein Gesicht mit Salzwasser, segnet mich, und es ist vorbei.
Ich drehe mich um und sehe, wie Bay am Altar vorbeischreitet. Sie ist wenige Momente jünger als ich, sonst wäre sie als Erste gegangen. Meine Schwester in diesem Augenblick zu sehen ist ein wenig, als beobachtete ich mich selbst dabei, wie ich die Entscheidung treffe. Die aufbereitete Luft des Tempels streicht über uns hinweg, als würde Atlantia wahrhaftig atmen.
Bay spricht mit sanfter Stimme, aber ich kann sie deutlich verstehen. »Ich wähle das Opfer im Oben«, sagt sie.
Nein! Bay! Sie hat den falschen Satz gesagt. Sie war nervös und hat einen Fehler gemacht. Ich dränge nach vorn, um ihr zu helfen. Es muss einen Weg geben … »Warte«, schreie ich. »Bay!«
Ich blicke Nevio, den Priester, an, in der Hoffnung, dass er das Ganze aufhalten kann, doch er starrt Bay nur an, und ein Ausdruck der Überraschung huscht über sein Gesicht. Für einen Augenblick treffen sich unsere Blicke, doch das ist schon zu lange. Friedenswächter umringen meine Schwester, wie schon die beiden anderen Freiwilligen vor ihr, die das Oben gewählt haben.
»Warte«, wiederhole ich, doch niemand schenkt mir Beachtung. Das bezweckt ja gerade die Stimme, die ich benutze. »Bay!«, rufe ich noch einmal. Diesmal schleicht sich eine Nuance meiner wahren Stimme in das Wort, und deshalb wendet sie sich zu mir um, beinahe widerwillig.
Ich bin erstaunt über die Trauer in ihren Augen, aber noch mehr über die Entschlossenheit, die ich darin erkenne. Sie hat das geplant. In den Sekunden, die es dauert, das Unmögliche zu erfassen – Das ist kein Fehler, Bay will gehen! –, ist meine Schwester schon fortgeführt worden und aus meinem Blickfeld verschwunden.
Ich dränge mich durch die Menge, schnell und wortlos, es ist ein Versuch, keine Szene zu machen, denn dies würde unterbunden werden. Die Priester kennen mich alle und wissen, dass Bay und ich unzertrennlich sind. Schon kommen einige in meine Richtung, um mir den Weg abzuschneiden.
Warum hat Bay das getan?
Justus, einer der netteren Priester, hat mich fast erreicht und streckt die Hand nach mir aus.
»Nein!«, sage ich, und in dem Moment schlüpfen meine wahre Stimme, mein wahrer Schmerz und meine schneidende Wut aus mir heraus, und Justus lässt den Arm sinken. Sein Gesicht ist – schockiert, entsetzt, als hätte ihn der Ton meiner Stimme getroffen wie eine Ohrfeige.
Ich habe getan, was ich immer versprochen habe, nicht zu tun. Ich habe meine wahre Stimme in der Öffentlichkeit benutzt. Und jetzt geschieht genau das, wovor meine Mutter mich stets gewarnt hat – es gibt keine Möglichkeit, den Vorfall ungeschehen zu machen. Es ist unerträglich, das Entsetzen auf Justus’ Gesicht zu sehen. Justus, der mich schon mein ganzes Leben lang kennt. Ich wage es nicht, zurück in die Menge zu blicken, um festzustellen, wer mich sonst noch gehört hat.
Obwohl ich mit beiden Füßen fest auf dem Boden von Atlantia stehe, löse ich mich auf.
Meine Schwester ist fort.
Sie hat sich entschieden, nach Oben zu gehen.
Sie würde so etwas niemals tun.
Sie hat es getan.
Das Letzte, was sie zu mir gesagt hat, war, dass die Stadt atmet.
Ich höre jetzt meinen eigenen Atem, ein und aus, ein und aus. Ich lebe hier. Ich werde hier sterben. Ich werde niemals fortgehen.
Kapitel 2
Unten im Tiefmarkt preisen die Verkäufer mit lauter Stimme ihre Waren an, drängen den Leuten ihre Karren in den Rücken und in die Seiten, um Aufmerksamkeit zu erwecken.
»Reine Luft!«, ruft einer. »Alle Aromen und Düfte. Zimt, Cayenne, Rose! Zeder, Flieder, Safran!«
»Neue Kleider!«, schreit ein anderer.
Weiter oben, näher an der Oberfläche, rund um den Tempel, gibt es Geschäfte, doch hier unten sind die Waren vielfältiger – ein zusammengewürfeltes Sammelsurium, drunter Kitsch, aber auch Schätze. Die Waren liegen auf Karren und in Buden, anstatt ordentlich hinter Glasschaufenstern ausgestellt zu sein. Die Verkaufsstände sind klapprig, aber zweckdienlich, zusammengestückelt aus Altmetallresten und Plastiklatten.
Bay und ich sind immer überall gemeinsam hingegangen, und nach dem Tod unserer Mutter sind wir im Anschluss an die Zeremonien im Tempel meist über den Tiefmarkt geschlendert. Da ich im Tempel keinerlei Hinweise darauf gefunden habe, warum Bay fortgegangen ist, suche ich hier nach einem Anhaltspunkt. Irgendetwas. Eine Nachricht. Eine Notiz. Irgendeinen Hinweis.
Unsere Schlafgemächer hatte ich bereits inspiziert. Nachdem mich die Friedenswächter an dem Tag freigelassen haben, an dem Bay gegangen ist, bin ich zu dem Raum zurückgekehrt, den wir uns teilen, und habe ihn von oben bis unten durchsucht. Ich musste etwas finden, was ihre Entscheidung erklärte. Ich dachte, ich würde vielleicht einen Brief finden, in ihrer sorgfältigen Handschrift, der alles plausibel machte und ihre Beweggründe erhellte.
Ich drehte die Taschen all ihrer Kleider um. Ich riss das Bettlaken herunter, die Decken und die Bettwäsche, hob die Matratze von den Sprungfedern und schaute darunter nach. Ich ging alle meine Sachen durch, nur um sicher zu sein. Ich überwand mich sogar dazu, die Schachtel im Schrank zu öffnen, in der wir die letzten Habseligkeiten unserer Mutter aufbewahrten, doch alles lag noch genauso darin, wie wir es gepackt hatten. Keine Notiz.
Nichts.
So plötzlich zu gehen, ohne irgendeine Erklärung, war grausam, und Bay war niemals grausam gewesen. Sie konnte ärgerlich und schroff reagieren, wenn sie müde oder angespannt war. Aber diese Eigenschaften waren in ihr nie so ausgeprägt gewesen wie in mir – sie war die sanftere Schwester, fröhlicher und gewiss besser dazu geeignet, in die Fußstapfen unserer Mutter zu treten. Es machte mir nie etwas aus, wenn die Leute darauf hinwiesen, weil ich wusste, dass es stimmte.
In den Tagen nach Bays Fortgang tat ich alles, was mir einfiel, um zu ihr zu gelangen. Ich kämpfte mich durch die Menge im Tempel, bis die Friedenswächter mich zurückzogen und hinter die Absperrung zu einer anderen aufgebrachten Familie drängten. Nachdem sie uns endlich freigelassen hatten, wollte ich wenigstens dem Transport nachblicken, der Bay zur Oberfläche hinaufführte, doch natürlich war er schon lange fort. Ich stand da und versuchte, eine Möglichkeit zu finden, ihr zu folgen, doch der Rat bewacht die Transporter und die Schleusen sehr sorgfältig. Andere Wege, um lebend nach Oben zu gelangen, gibt es nicht. Die meisten Transporte haben keine Druckkammer, so dass Menschen darin nicht überleben können. Sie sind nur für den Transfer von Gütern und Nahrungsmitteln zwischen dem Oben und dem Unten bestimmt.
Und nicht einmal in meinen kühnsten Träumen wage ich mir vorzustellen, dass der Rat mir erlaubt, nach Oben zu meiner Schwester zu gehen. Sie würden es mir niemals gestatten, und eine realistische Fluchtmöglichkeit fällt mir nicht ein.
An einem Stand im Tiefmarkt fallen mir kostbare Brokatstoffe auf, von kundiger Hand bestickt, und beinahe hätte ich den Stoff berührt, wäre stehen geblieben und hätte die Muster betrachtet. Doch ich gehe weiter, überquere den Markt der Länge nach, lasse die eng beieinanderstehenden Buden hinter mir und gelange zu dem Bereich am Rande des Tiefmarktes, wo die Rennen stattfinden.
Trotz der dichten Menschenmenge wird es auf dem Tiefmarkt sehr kalt. Er ist nur spätnachmittags und in den frühen Abendstunden geöffnet und schließt, wenn das Licht gedimmt wird, so dass die Energie für Heizung und Luftversorgung dieses Teils der Stadt verwendet werden kann. Mir läuft es kalt den Rücken herunter: Wir sind hier sehr tief Unten – auch, wenn die Wände von Atlantia noch nie irreparabel gerissen oder gebrochen sind.
Als sich die Menschen vor langer Zeit auf die Teilung vorbereiteten, beteten sie um Inspiration beim Entwurf von Atlantia. Die Legende besagt, dass der Priester damals einen Traum hatte, in dem ihm die Götter befahlen, die Stadt nach dem Grundriss der alten Städte anzulegen. Der Priester sah Atlantia im Traum deutlich vor sich – einen wundervollen Ort mit Tempeln und Kirchen. Er sah lebendige Plätze, farbenfrohe Gebäude mit Geschäften im Erdgeschoss und Wohnungen darüber, Boulevards und Straßen, die miteinander verbunden waren. Alles natürlich unter Wasser.
Atlantia wurde also als eine Vielzahl riesiger, eingekapselter Blasen entworfen, einige höher, andere niedriger, untereinander verbunden durch Kanäle und Wege. Die Ingenieure stellten fest, dass es günstiger war, kleinere Wohneinheiten anzulegen und diese miteinander zu verbinden, als eine große Blase für alles zu konstruieren. Die Halbkugel in der Mitte ist der angenehmste Ort von Atlantia. Sie enthält den Tempel, die Ratsgebäude, den Obermarkt und mehrere Wohnviertel. Andere, kleinere Kuppeln umfassen unbedeutendere Kirchen, Märkte und Wohngegenden. In einigen der tiefsten Blasen befinden sich die Maschinenräume von Atlantia, die Schleusen, durch die die Drohnen für die Reparatur und die Lagerung hereinkommen, sowie der Tiefmarkt.
Das Gesamtkonstrukt bedurfte Jahre der Planung. Einige der Originalzeichnungen sind in einer speziellen Glasvitrine in einem Vorraum des Tempels ausgestellt. Auf den Diagrammen sieht man rostfarbene Flecken und Spritzer. Dem Gerücht nach haben die sterbenden Ingenieure manchmal Blut auf die Papiere gehustet. Bis zum Schluss verfolgten sie hingebungsvoll ihre Aufgabe, sonst wäre die Menschheit ausgestorben. Als ich meiner Mutter gegenüber das Gerücht bezüglich der Blutflecken erwähnte, wies sie es weder von sich, noch behauptete sie, die Flecken stammten von etwas anderem.
Sie sagte nur: »So viele haben sich geopfert, damit wir leben können«, und in ihren Augen lag eine große Traurigkeit.
Die Zerstörung Oben bedeutete, dass nur wenige natürliche Materialien für Unten übrig waren. Unsere Fundamente bestehen größtenteils aus Recyclingmaterial und nur wenige wertvolle Stücke haben den Weg in unsere Stadt gefunden: Der Holzaltar im Tempel zum Beispiel und Steine, mit denen die besten Straßen gepflastert wurden, sind eine Ausnahme. Dennoch ist Atlantia wunderschön. Der größte Stolz seiner Bewohner gilt den Baumimitationen, die aus Stahlstämmen und einzelnen, schimmernden Metallblättern bestehen. Sie können sich in ihrer Schönheit jederzeit mit allem messen, was es je Oben gegeben hat.
So sagt man jedenfalls.
Die Ingenieure imitierten die Transportwege einer der alten Städte – ein romantisches System von Kanälen und Gondeln genannten Booten – als Modell für unser öffentliches Transportsystem hier Unten. Natürlich sind unsere Gondeln moderner – sie haben Motoren und fahren auf Gleisen durch trockene Zementkanäle. Die Leute von Atlantia lieben die Gondeln, obwohl sie ständig gewartet werden müssen. Aber auch wenn die Arbeiter sie jede Nacht nach der Sperrstunde reparieren, ist es nicht ungewöhnlich, tagsüber ein liegengebliebenes Boot zu sehen. Binnen Minuten ist sein Rumpf von Mechanikern umschwärmt wie von Meerjungfrauen auf alten Illustrationen aus der Zeit vor der Teilung.
Meine Mutter fand die Architektur Atlantias faszinierend, und sie liebte die Bäume und die Gondeln fast so sehr wie den Tempel.
»Ein letzter Geniestreich im Angesicht des Todes«, sagte sie zu Bay und mir, wenn wir die Diagramme betrachteten. »Die Ingenieure hinterließen auf jedem Bauwerk Atlantias ihren Fingerabdruck. Sie erschufen die Stadt zweckmäßig und schön zugleich.«
»In gewisser Weise sind sie dadurch zweifach unsterblich geworden«, sinnierte Bay. »Sie leben im Himmel und in Atlantia weiter.«
Meine Mutter blickte Bay versonnen an. Ihrer beider Liebe zur Stadt war so greifbar, dass ich mich ausgeschlossen fühlte. Ich liebte Atlantia, aber nicht im selben Maße wie sie.
Die unteren Regionen sind weniger ansprechend, dafür aber zweckmäßiger gestaltet als die meisten anderen Bereiche Atlantias. Hier sind die Nieten an den Wänden deutlich sichtbar, und der Himmel hängt niedriger. Ganz anders im Tempel, wo sich die Mauern zu riesigen Kuppeln wölben, die das hohe Firmament des falschen Himmels draußen imitieren.
Ich komme an einem der Stände vorbei, an denen Masken verkauft werden. Sie gleichen nicht den Sauerstoffmasken, die wir auf unseren Rücken umhertragen – die wir immer bei uns tragen müssen, falls es je ein Leck in Atlantias Außenhaut geben sollte. Die auf dem Tiefmarkt dargebotenen Masken sind für das Freizeitvergnügen entworfen worden, damit man sich als jemand anders ausgeben kann. Ich heuchle Interesse an ihnen und berühre die Gesichter der atemberaubenden Kreaturen. Es sind Kreaturen, die früher Oben lebten – Löwen, Tiger, Pferde. Ich kenne sie alle nur von Bildern in Büchern. Es gibt auch phantasievollere Masken – eine ganze Palette von Meereshexen, einige mit grünen Gesichtern, andere mit blauen.
Die Kinder erzählen sich gerne Geschichten über die Meereshexen. Wir haben über sie in der Schule geredet, wenn wir draußen auf den Plätzen zusammen spielten. Einmal, als meine Mutter wollte, dass ich sie zu einer späten Messe in den Tempel begleitete und ich nicht mitkommen wollte, versuchte ich, eine der gehörten Geschichten als Vorwand zu benutzen. »Wenn ich in der Dämmerzeit hinausgehe, erwischt mich am Ende eine Meereshexe«, sagte ich zu meiner Mutter. »Oder eine Sirene.«
»Meereshexen gibt es nur im Märchen«, erwiderte meine Mutter.
Die Existenz von Sirenen dagegen leugnete sie nicht –, weil alle wissen, dass es sie wirklich gibt. Für gewöhnlich sind es Frauen, die ihre Stimmen dazu benutzen können, andere zu manipulieren. Sie waren das erste Wunder, das sich nach der Teilung vollzog, und seither haben sie Atlantia immer gedient.
Ich bin eine Sirene.
Dieses Geheimnis versuchte meine Mutter zu verbergen, weil das Leben einer Sirene dem Dienst an Atlantia geweiht ist. Sirenenkinder müssen dem Rat übergeben und von ihm großgezogen werden. Meine Mutter aber wollte mich nicht weggeben.
»Meereshexen gibt es auch«, entgegnete ich meiner Mutter. »Wir kennen sogar ihre Namen.« Vielleicht, dachte ich, gibt es Leute, die wissen, dass sie Meereshexen sind, aber es geheim halten, genauso wie ich verberge, dass ich eine Sirene bin. Bei dem Gedanken lief es mir kalt den Rücken hinunter.
»So, und wie heißen die Meereshexen?«, fragte meine Mutter mit der amüsierten Stimme, die ich so liebte, weil sie mir signalisierte, dass sie auf mein Spiel einging.
»Maire«, antwortete ich, weil ich am Tag zuvor in der Schule eine Geschichte gehört hatte. »Eine von ihnen heißt Maire.«
»Was hast du da gesagt?« Meine Mutter klang schockiert.
»Maire«, wiederholte ich. »Sie ist eine Meereshexe und eine Sirene. Sie kann zaubern, nicht nur mit ihrer Stimme. Sie kann dich manipulieren, wenn sie will, und dann verwandelt sie dich in Meeresgischt, bevor deine Familie auch nur die geringste Chance hat, deine Leiche zu den Flutschleusen zu bringen.«
Eines der Mädchen in der Schule hatte mir erzählt, Maire würde den Meeresschaum trinken, aber ich beschloss, meiner Mutter dieses eklige Detail zu ersparen, weil sie bereits die Hände vor den Mund geschlagen und die Augen weit aufgerissen hatte. Ich war zu weit gegangen. Sie tat nicht nur so, als sei sie entsetzt, sie war tieferschüttert – und meine Mutter war nicht leicht zu erschrecken.
»Erzähl mir nie wieder solche Geschichten«, sagte sie mit zitternder Stimme, und schon bereute ich, was ich getan hatte. Vielleicht hatte ich zu viel von meiner Stimme benutzt, als ich die Geschichte erzählte. Es war nicht meine Absicht gewesen, sie zu erschrecken.
»Nie mehr«, sagte ich. »Versprochen.«
Einige Leute behaupten, Sirenen hätten keine Seele, und daher fragte ich meine Mutter, ob das bei Maire auch so sei.
»Nein«, erwiderte meine Mutter. »Jedes Lebewesen hat eine Seele. Maire hat eine Seele.« Natürlich wusste meine Mutter, worauf meine Frage wirklich abzielte. »Und du hast eine Seele, Rio«, sagte sie zu mir. »Bezweifle das nie.«
Erst viele Jahre später erzählte unsere Mutter uns die Wahrheit – nämlich, dass die Sirene Maire ihre Schwester war. Unsere Tante.
»Aber wir haben keinen Kontakt mehr zueinander«, sagte meine Mutter mit großem Bedauern.
Bay und ich sahen uns erschrocken an. Wie konnten sich Schwestern nur so voneinander entfremden?
»Keine Sorge«, beruhigte uns meine Mutter, als sie unseren Gesichtsausdruck sah. »Euch wird das nicht geschehen. Der Rat hat Maire weggeholt, als bekannt wurde, dass sie eine Sirene ist, und wir wurden nicht gemeinsam großgezogen. Deswegen haben wir uns voneinander entfremdet. Versteht ihr? Das ist einer der Gründe, warum wir Rios Geheimnis bewahren müssen. Wir wollen doch nicht, dass sie von uns getrennt wird. Wir wollen sie nicht verlieren.«
Bay und ich nickten. Das verstanden wir.
Es war ein sehr großes Geheimnis, was meine Mutter da vor dem Rat verbarg. Besonders später, als sie Priesterin wurde. Als erste Frau sowohl der Kirche als auch des Staates von Atlantia erwartete man von ihr, dass sie den anderen Ratsmitgliedern Bericht erstattete und eng mit ihnen zusammenarbeitete. Sie hätte keine Geheimnisse vor ihnen haben dürfen.
Doch sie hatte sie. Mindestens eines und vielleicht noch mehr.
In der Nacht, in der unsere Mutter starb, fand man sie auf Maires Türschwelle. Sie sei dorthin gerannt, berichtete eine Zeugin, die sie hatte vorbeieilen sehen. Dann sei sie auf den Stufen zusammengebrochen. Als Maire die Tür öffnete, war es bereits zu spät.
Ich bin am Rande des Tiefmarktes angelangt, wo sich die Schwimmbahnen befinden – mehrere schwere Zementkanäle, die früher für die Gondeln benutzt wurden. Vor Jahren hat ein Unternehmen die Bahnen hier heruntertransportiert und sie für die Rennen bereitgestellt. Keine Ahnung, wie sie es geschafft haben, etwas so Schweres zu bewegen.
Aldo, der Mann, der die Rennen organisiert, nickt mir zu, als ich mich nähere. »Ich habe gehört, deine Schwester ist nach Oben gegangen«, ruft er. »Das tut mir wirklich leid.« Aldo ist ein paar Jahre älter als Bay und ich. Trotz seiner blauen Augen, dem dunklen, dicken Haar und den ebenmäßigen Gesichtszügen ist er nicht attraktiv.
»Danke.« Mehr als dieses eine Wort bringe ich nicht heraus, wenn mir Leute kondolieren, sonst werde ich von meinem Kummer überwältigt.
Aldos Höflichkeit ist bereits wieder erschöpft. »Ich muss die Wettkampfgruppen für dieses Wochenende umändern, weil sie nicht teilnimmt.«
»Hat sie hier irgendetwas für mich hinterlassen?«, frage ich.
»Was hätte sie denn hinterlassen sollen?«
»Eine Notiz«, sage ich. »Oder irgendetwas anderes. Ich bin mir nicht sicher.«
»Nein«, sagt Aldo. »Sie hat selbst ihre Ausrüstung immer mitgenommen. Wir haben hier unten keinen Platz, um viel unterzubringen. Das weißt du doch.«
Ja, ich weiß das. Die Wettkampfbahnen nehmen fast den ganzen zur Verfügung stehenden Raum ein, und die Zuschauertribünen füllen den übrigen Platz. Aber es gibt eine Reihe von Schließfächern an der Wand, wo Aldo die Pläne aushängt; dort können die Schwimmer Sachen deponieren, während sie im Wasser sind.
»Könnte vielleicht irgendetwas in den Schließfächern sein?«, frage ich.
»Nein«, sagt Aldo. »Ich habe sie letzte Nacht durchgeschaut. Sie waren alle leer.«
Dies sagt er in einem so gleichgültigen Ton, dass ich ihm glaube. Mir sinkt der Mut.
Auch hier hat sie mir also nichts hinterlassen. Aldo dreht sich um und geht weg.
Das Wasser schwappt gegen die Wände der Betonkanäle. Wacklige stählerne Sitzreihen, die an die Galerien im Tempel erinnern, erheben sich auf beiden Seiten. Die Priester wussten, dass Bay nach dem Tod unserer Mutter an den Wettkämpfen teilnahm, doch sie drückten beide Augen zu. Wir brauchten das Geld.
Natürlich versorgt der Tempel all seine Schülerinnen und Schüler mit Essen und Unterkunft, doch unsere Arbeit dort gilt als Heiliger Dienst, und wir erhalten keine Münze dafür. Für die meisten anderen Schüler ist das kein Problem. Sie haben zwei Elternteile, die sie behüten, ihnen Taschengeld geben, die Bücher bezahlen und ihnen neue Kleider kaufen. Die Priesterin oder der Priester erhalten ebenfalls kein Geld, nur Nahrung, Wohnung und Kleidung. Unsere Mutter sorgte für uns, indem sie ihre persönlichen Besitztümer verkaufte, wenn wir etwas Neues brauchten. Doch zum Zeitpunkt ihres Todes besaß sie schon fast nichts mehr.
Daher begann Bay, Geld zu verdienen. Es war erstaunlich, wie genau sie wusste, was zu tun war. Nachdem ich versprochen hatte zu bleiben, trauerte sie zwar noch eine Weile um unsere Mutter, doch in jeder anderen Hinsicht wurde sie wieder die Alte – ruhig, besonnen und klug.
»Auf dem Tiefmarkt gibt es Wettkämpfe«, erzählte sie mir. »Schwimmwettkämpfe. Die Leute wetten auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer.«
Ich wusste von den Wettkämpfen, hatte mich aber nie näher für sie interessiert. Die Priester sahen das Treiben nicht gern. »Die Teilnehmer schwimmen schon seit Jahren«, wandte ich ein.
»Wir könnten das ganz schnell lernen«, erwiderte sie. »Es liegt in unseren Genen.«
Bay und ich gleichen äußerlich meinem Vater – wir sind groß und kräftig, während meine Mutter klein und zart war. Schon mit zwölf überragten wir sie und wuchsen immer weiter; sie lachte darüber, dass sie zu uns beiden aufblicken musste.
Unser Vater war Wettkampfschwimmer, damals, als es noch ein anerkannter Sport war und an den Wochenenden schicke schmale Wettkampfbahnen auf den Plätzen errichtet wurden. Bei einem solchen Wettkampf lernte meine Mutter ihn auch kennen. Sie war bei einem Rennen, und als er am Ende aus dem Wasser stieg und aufblickte, sah er sie. In einer Menge von Menschen, die durcheinanderliefen und -riefen, bot sie einen kleinen Ruhepol. Unsere Mutter war aufgestanden wie alle anderen Zuschauer auch, fuhr aber fort, in dem Buch zu lesen, das sie mitgebracht hatte. Das faszinierte ihn. Was konnte so viel interessanter sein als der Wettkampf? Daher stieg er hinauf auf die Tribüne, fand sie und fragte, ob sie zusammen mit ihm in ein Café gehen würde. Sie war einverstanden und so begann es.
»Aber durch das Wettkampfschwimmen könnte er sich die Wasserlunge zugezogen haben«, protestierte ich.
»Der Zusammenhang wurde nie bewiesen«, entgegnete Bay.
Sie verkaufte eines der letzten persönlichen Besitztümer unserer Mutter – eine Tigerstatue aus Gold – und benutzte die Münze, die sie dafür erhielt, um uns beiden einen Trainingsschwimmanzug und Übungszeit auf den Bahnen zu kaufen.
»Ich fühle mich nackt«, gestand ich Bay an dem Tag, als wir zum ersten Mal unsere Anzüge anprobierten.
»Die Dinger sind fast genauso verhüllend wie unsere Tempelgewänder. Wir sind von oben bis unten bedeckt«, erwiderte sie.
Das brachte mich zum Lachen – was seit dem Tod unserer Mutter so gut wie nie vorgekommen war. Bay grinste. Wir gingen hinaus zu den Bahnen.
Der Lehrer schüttelte den Kopf, als er uns sah. »Aldo hat mir nicht gesagt, dass ihr schon so alt seid«, sträubte er sich. »Es hat keinen Zweck, euch das Schwimmen beizubringen.«
»Wir sind erst fünfzehn«, erwiderte Bay.
»Zu alt«, erwiderte der Mann beharrlich. »Man muss anfangen, wenn man noch jünger ist.«
»Wir haben Sie bezahlt, damit Sie es uns beibringen«, sagte Bay. »Ihnen kann es doch egal sein, wie schnell wir sind, solange Sie Ihre Münze erhalten.«
Als wir beide ziemlich schnell das Schwimmen erlernten, tat er so, als hätte er das von vornherein prophezeit. »Es liegt euch natürlich in den Genen«, erklärte er. »Ihr werdet natürlich nie so gut werden, wie ihr hättet sein können, wenn ihr früher angefangen hättet. Aber ich nehme an, eure Mutter wollte euch im Tempel behalten. Ich muss sagen, ich kann ihr keine Vorwürfe machen.«
»Es spielt keine Rolle, ob ich in den schnellen Gruppen schwimme oder nicht«, sagte Bay leise zu mir. »Ich muss nur gut genug sein, um die Qualifikation zu schaffen und einige der Wettkämpfe zu gewinnen.«
»Augenblick«, sagte ich. Sie hatte ich gesagt, nicht wir. »Und was ist mit mir?«
»Du nicht«, erwiderte Bay. »Es ist zu gefährlich.«
Wegen meiner Stimme. Ich wusste, dass das der Grund war. Sie war immer der Grund gewesen, warum ich etwas nicht durfte. Aber diesmal sah ich nicht ein, warum.
»Es ist immer dasselbe«, erklärte Bay. »Egal, was du in der Öffentlichkeit tust, es ist ein Risiko. Ob du verlierst oder gewinnst, du wirst mit Leuten reden müssen. Glaub mir, es ist besser, wenn du nur zusiehst. Dann kannst du mir sagen, falls jemand versucht zu betrügen. Behalte die Uhr im Auge und prüfe, ob Aldo bei den Ergebnissen schummelt.«
Ich kochte vor Wut. »Wenn ich nicht an den Wettkämpfen teilnehme, warum habe ich dann überhaupt erst schwimmen gelernt?«
»Es ist ein Teil dessen, was wir sind. Unser Vater konnte schwimmen«, antwortete sie. »Und außerdem – findest du es nicht dumm, dass die meisten von uns nicht schwimmen können, obwohl wir unter Wasser leben?«
»Eigentlich nicht«, entgegnete ich. »Sollte jemals die Außenhaut reißen, sterben wir sowieso alle.«
»So darfst du nicht denken«, entgegnete Bay.
Aldo kehrt mit weiteren Blättern zurück, die er an der Wand aufhängt. Das Rascheln des Papiers bringt mich wieder zurück in die Gegenwart.
»Ich könnte an ihrer Stelle schwimmen«, schlage ich vor. An den Wettkämpfen teilzunehmen würde eine Verbindung zu Bay schaffen. Darüber hinaus wäre es eine Möglichkeit, ein wenig von der Ruhelosigkeit loszuwerden, die mich von innen auffrisst.
Aldo zieht die Augenbrauen hoch. Ich sehe ihm an, dass ihm der Vorschlag gefällt. Aldo ist sowohl clever als auch faul, und der Plan erspart ihm einige Arbeit. »Als ihr beide miteinander trainiert habt, warst du immer mit ihr auf einer Höhe.«
»Ja«, sage ich. »Natürlich.«
»Ich hätte kein Problem damit«, sagt er. »Aber die anderen Teilnehmer müssen sich mit dir als Ersatzschwimmerin einverstanden erklären. Und ich muss die Wetter informieren.«
Ich nicke.
»Komm morgen wieder, und ich berichte dir, was sie gesagt haben«, verspricht Aldo und kehrt wieder in das Kabuff zurück, wo er die Wetten annimmt.
Ich bleibe noch einen Moment stehen und blicke auf das glatte türkisfarbene Wasser, das gegen die Seitenwände der Wettkampfstrecke schwappt. Aldo färbt das Wasser künstlich, damit es verlockender aussieht. Zum ersten Mal seit Bays Fortgang fühle ich mich ein winziges bisschen besser. Vielleicht werde ich insgesamt ruhiger, wenn ich meinen Körper ermüde, und sei es nur für die Momente, die ich im Wasser verbringe, auf die Linie unter mir schaue und an nichts anderes denke, als meine eigene Erschöpfung zu durchbrechen.
»Rio«, sagt eine Stimme hinter mir.
In Sekundenschnelle sinkt meine leicht verbesserte Stimmung wieder gegen Null.
Ich kenne diese Stimme, obwohl ich sie seit langem nicht gehört habe, nicht seit der Beerdigung unserer Mutter.
Sie ist hier.
Maire.
Die Schwester meiner Mutter.
Die Sirene, die manche eine Hexe nennen.
Diejenige, die ich verdächtige, meine Mutter getötet zu haben. Denn wie sonst lässt sich ihre zusammengesunkene Gestalt auf Maires Schwelle erklären? Und Maire hat nie etwas gesagt, hat nie ein einziges Wort der Erklärung geboten, warum meine Mutter zu ihr gerannt ist.
»Maire kann sie nicht getötet haben«, erwiderte Bay, als ich ihr von meinem Verdacht erzählte. »Eine Schwester könnte das nicht.«
Ich drehe mich um und blicke zurück auf die Menschenmenge, die den Tiefmarkt bevölkert. Maire kann ich zwischen den Umhängen, Bannern und Gesichtern nicht entdecken. Dennoch spüre ich, dass sie mich beobachtet. Erwartet sie, dass ich ihr antworte?
Maire weiß nichts von meiner Stimme. Meine Mutter hat diesen Teil von mir sorgfältig vor allen verborgen, sogar vor ihrer eigenen Schwester.
»Aber wenn Maire diese Stimme hat, rechnen die Leute dann nicht damit, dass ich auch so eine habe?«, fragte ich einmal, als ich noch klein war.
»Nein«, antwortete meine Mutter. »Es hat noch nie zwei Sirenen in der gleichen Abstammungslinie gegeben. Wir haben immer geglaubt, die Sirenenstimmen seien eine Gabe der Götter und nicht nur eine Frage der Vererbung.«
»Warum behandelst du sie dann nicht wie ein Geschenk?«
Ihre Augen wurden weicher. »Es tut mir leid«, antwortete sie. »Ich wünschte, wir könnten es. Ja, deine Stimme ist tatsächlich eine Gabe, aber du kannst sie noch nicht benutzen.«
»Wann dann?«, fragte ich.
Sie konnte mir darauf keine Antwort geben, also fasste ich einen Plan. Meine Mutter war immer froh darüber, dass ich mich so gut beherrschen konnte. Sie hatte nicht geahnt, woran das lag: daran, dass ich keineswegs vorhatte, für immer zu schweigen. Ich stellte mir vor, dass ich hinaufgehen und dort endlich sprechen würde.
»Maire ist dein bester Schutz«, erklärte meine Mutter. »Da sie eine Sirenenstimme hat, vermutet niemand, dass du sie ebenfalls besitzt.«
»Rio.«
Wieder höre ich meinen Namen, ein einziges klares Wort, das für mich bestimmt ist.
Rasch entferne ich mich von den Verkäufern und den Buden und kehre zurück in die unteren Regionen von Atlantias Wohnvierteln.
Ich habe das Gefühl, dass Maire mir folgt. Es ist fast, als flüstere sie mir etwas zu, Sätze, die ich nicht ganz verstehen kann. Ströme von Wörtern säuseln durch die Luft und die Wände der Stadt. Unwillkürlich frage ich mich, ob ich das auch könnte.
Wenn ich meine Stimme benutze, wird man mich wie Maire behandeln. Ich werde als Sirene gebrandmarkt sein, und die Leute werden mich fürchten.
So wird es sein. Schon jetzt meidet Justus, der Priester, meinen Blick. Obwohl er nur einen Hauch meiner echten Stimme gehört hat, will er sich von mir fernhalten. Das ist auch für mich am sichersten, und ich sollte froh sein. Stattdessen bin ich traurig. Er war der beste Freund unserer Mutter, ein sanfter Priester, von dem Bay und ich hofften, dass die anderen ihn nach dem Tod von Mutter zum Priester ernennen würden.
Doch das taten sie nicht. Sie wählten Nevio.
Eine Gruppe von Teenagern drängt sich an mir vorbei, lachend und schwatzend. Sie werfen mir einen Blick zu und schauen dann weg. Für einen Augenblick gerate ich in Versuchung, sie mit meiner wahren Stimme zu rufen. Ich könnte mit den Jungs spielen und die Mädchen eifersüchtig machen, so dass sie wünschten, sie hätten mich niemals ignoriert.
»Hallo«, sagt eine einschmeichelnde, wunderschöne Stimme.
Für einen Augenblick glaube ich, ich hätte gesprochen. Habe ich aber nicht. Maire ist zurück – sie steht in ihrem schwarzen Umhang und mit wirrem Haar vor mir. Ihr Gesicht ist einerseits zu kantig, um meiner Mutter ähnlich zu sehen, und dennoch zu intelligent, um ihr unähnlich zu sein. Ich habe sie noch nie aus der Nähe gesehen.
»Ich muss mit dir reden«, sagt Maire. »Über deine Mutter. Und über deine Schwester.«
Du musst gar nichts, hätte ich beinah in meiner wahren Stimme gesagt, aber ich habe so lange geschwiegen, dass es mir als Vergeudung erscheint, jetzt zu sprechen. Warum sollte ich das Risiko wegen meiner Tante eingehen, der ich vollkommen gleichgültig bin?
Ich gehe an ihr vorbei. Sie folgt mir. Ich höre ihre Stiefel auf dem Zement. Der dunkle Schmerz meines Verlusts brennt noch von den Worten Mutter und Schwester. So wie sie sie ausgesprochen hat, hallen sie in meinem Kopf wider, kalt wie eine Kathedrale ohne Kerzen.
»Rio?«, sagt Maire. »Ich war im Tempel an dem Tag, als Bay fortgegangen ist, und ich habe dich sprechen gehört.«
Ich halte inne.
Nicht nur Justus hat es bemerkt.
»Ich habe mich schon immer gefragt, ob du auch eine Sirene bist«, ergänzt Maire mit einem glücklichen Unterton, und ich zucke unwillkürlich zusammen.
»Falls es irgendwann einmal irgendetwas gibt, was du möchtest oder brauchst«, sagt Maire, »kann ich dir helfen. Ich habe deiner Mutter geholfen, weißt du. Sogar Ozeana, die Priesterin, brauchte mich.«
Das ist eine Lüge. »Meine Mutter brauchte dich nicht. Sie hatte uns. Ihre Töchter.« Meine Mutter wäre stolz darauf gewesen, wie gleichmäßig und tonlos meine Stimme klingt, obwohl ich am liebsten geschrien hätte.
»Es gibt manches, was man nur einer Schwester erzählen kann«, erwidert Maire, »und manches, worum man nur eine Schwester bitten kann.« Jetzt klingt ihre Stimme weich und traurig, weit entfernt, obwohl sie mir ganz nahe steht. Es ist beunruhigend. »Du hältst mich für die böse Schwester und glaubst, dass deine Mutter die gute war«, sagt sie. »Aber Ozeana brauchte mich wirklich. Und Bay auch.«
Bay brauchte Maire nicht. Bay hatte mich.
»Sie hat dir etwas hinterlassen«, sagt Maire. »Komm mit mir, und ich gebe es dir.«
Ich bin zwischen zwei Wahrheiten gefangen.
Bay wäre nie weggegangen, ohne mir irgendeine Nachricht oder Erklärung zu hinterlassen.
Sie hätte diese Nachricht oder Erklärung niemals Maire anvertraut.
Oder doch?
Maires Stimme bringt alles durcheinander und verwirrt mich.
Eine Gondel bremst hinter uns und gleitet in ihren Zementkanal. Ich will von Maire weg und zurück zum Tempel. Ich renne los.
»Wir müssen reden, du und ich!« Maires Stimme folgt mir. »Ich kann dir helfen zu bekommen, was du willst. Ich kann dir deinen sehnlichsten Wunsch erfüllen.«
Kennt sie denn meinen sehnlichsten Wunsch? Den, nach Oben zu gehen? Ich habe das schreckliche Gefühl, dass das sein könnte. Dass sie mein ganzes Herz und meine Gedanken kennt.
»Ich kann dir helfen, nach Oben zu kommen«, sagt Maire mit verblassender Geisterstimme. »Aber es muss bald sein. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Kannst du hören, wie die Stadt atmet?«
Kapitel 3
Ich setze mich auf eine Bank im Tempel und lasse mich von den vertrauten Gerüchen nach Kerzenwachs, Stein, Weihwasser und muffigem Stoff umhüllen. Ich atme tief ein und warte darauf, dass sich mein rasender Puls beruhigt. Die Begegnung mit Maire hat mir Herzklopfen verursacht.
Die Priester wandern durch das Tempelschiff, und ihre auf dem Boden schleifenden Gewänder rascheln. Ich halte den Kopf gesenkt, um Augenkontakt zu vermeiden, denn ich will kein Mitgefühl wegen der Sache mit Bay.
Im Tempel sollte ich vor meiner Tante sicher sein; Sirenen dürfen ihn nicht betreten. Für sie gibt es einen eigenen Ort für Gottesdienste, irgendwo abgeschottet im Labyrinth der Ratsgebäude. Doch so ist es nicht immer gewesen. Anfangs waren sogar viele Priesterinnen Sirenen. Sie benutzten ihre Stimmen, um vor Überheblichkeit und Sünde zu warnen oder die Gemeinde aufzurufen, Opfer zu bringen. Doch Macht berauscht, und allmählich begannen einige, ihre Stimme einzusetzen, um andere zu verletzen oder zu manipulieren. Von da an nahm der Rat die Sirenenkinder von klein auf in seine Obhut, so dass sie ihre Stimmen nicht zum Bösen, sondern nur zum Nutzen Atlantias verwenden konnten.
Vorne im Schiff zündet eine Frau eine Kerze an. In fast jeder Bankreihe sitzen Leute. Ich frage mich, ob sonst noch jemand einen geliebten Menschen betrauert, der nach Oben gegangen ist. Wie dem auch sei, ich bin sicher nicht die Einzige, die heute Abend hier Trost sucht. Der Tempel schließt nie seine Tore. Er ist der einzige Ort, an dem man sich auch noch zur Sperrstunde aufhalten darf.
Meine Mutter hat manchmal bis spätabends gearbeitet und sich die Gebete und das Flehen jener angehört, die mit Glaubenskrisen, heftigen Zweifeln und ihren gewimmerten oder gebrüllten Sünden zu ihr kamen. Eine ihrer Hauptaufgaben sah sie darin, Menschen zuzuhören. Selbst noch als Hohepriesterin übernahm sie daher die Spätschicht.
Meine Mutter war auch der Meinung, dass Sirenen im Tempel erlaubt sein sollten, doch sie konnte nie genügend andere Priester davon überzeugen, mit ihr zusammen für eine Änderung der Vorschrift zu stimmen. Sie betrachtete den Tempel als ein Haus der Götter und der Menschen, eine Begegnungsstätte, und sie kritisierte, dass manchen Menschen der Einlass versagt wurde. »Sie sagen, die Sirenen seien ein Wunder und daher nicht vergleichbar mit anderen Menschen«, erzählte sie Bay und mir einmal in einem seltenen Moment der Frustration über ihre Arbeit. »Ist es denn zu glauben? Menschen können doch keine Wunder sein!«
Ich blicke hinauf zu den Steinskulpturen über mir, den Säulen und den grimmigen Wasserspeiergöttern, die uns beobachten. Die Götter werden als verschiedene Tiere von Oben dargestellt. Auf der Säule, die mir am nächsten steht, ist der Gott Efram zu sehen, der wegen seines Mutes und seiner Klugheit als Tiger abgebildet wird. Es gibt zahlreiche Tigergötter, aber wenn man weiß, wonach man sucht, kann man sie leicht unterscheiden. Efram besitzt zum Beispiel die größten Augen. Er sieht am meisten.
»Die Götter wissen alles«, tröstete mich meine Mutter, wenn es mir schwerfiel, meine Stimme zu verbergen. »Sie wissen, wie schwer es ist. Und sie sind stolz auf dich, Rio.«
Sind sie stolz, dass ich eine Sirene bin – oder dass ich es verberge?, hätte ich am liebsten gefragt. Doch ich wagte es nicht.
Als ich klein war, erkannte ich, dass ich Bay dazu bringen konnte, alles zu tun, was ich wollte. Bei meiner Mutter hingegen funktionierte meine Stimme nicht. Ich konnte noch so laut schreien oder inständig flehen, sie konnte mir widerstehen. Leicht fiel es ihr wohl nicht. Wenn ich schluchzte, bettelte oder versuchte, sie zu manipulieren, schloss sie die Augen, und ich wusste, dass sie um Stärke betete. Die Götter haben sie ihr immer geschenkt, ein Zeichen ihres Wohlwollens. Hohepriesterinnen können nicht von Sirenen beeinflusst werden. Das ist ein Grund, warum sie gewählt werden – ihre Fähigkeit, Widerstand zu leisten.
Ich erinnere mich noch an damals, als ich fünf Jahre alt war und Bay so schlimm zum Weinen brachte, dass sie kaum noch Luft bekam. Ich tat es absichtlich und genoss es – ich fühlte mich glutvoll und grausam, clever und mächtig zugleich – , doch anschließend brach ich vor Reue zusammen.
Meine Mutter hielt mich fest in den Armen und auch sie weinte. »Du bist ein gutes Mädchen, Rio«, sagte sie. Sie klang erleichtert.
»Ich habe Bay weh getan«, schluchzte ich. »Und zwar absichtlich.«
»Aber hinterher hat es dir leidgetan«, erwiderte meine Mutter, »und du wirst es nicht noch einmal tun.«
Ich nickte. Sie hatte recht.
»Das ist der Unterschied«, erklärte meine Mutter gedankenverloren. »Das ist der Unterschied.« Sie legte die Hände rechts und links an mein Gesicht und sah mich liebevoll an. »Rio«, flüsterte sie, »jeder will irgendwann im Leben einmal einem anderen weh tun. Wir sind nur Menschen. Doch du wurdest mit einer größeren Macht geboren als die meisten anderen. Deswegen musst du deine Stimme unter Kontrolle halten.«
Und natürlich war da noch der andere, der wichtigere Grund. Wir wollten nicht, dass der Rat mich wegholte.
Meine Mutter erkannte sehr früh, dass ich eine Sirene bin, schon als Baby, als ich anfing zu brabbeln. Sie musste sich von ihrer Arbeit beurlauben lassen, weil sie nicht zulassen konnte, dass jemand anderes sich um Bay und mich kümmerte, bis ich alt genug war, um zu lernen, wie ich meine Stimme verbergen konnte. Als Ausrede führte sie an, ich sei kränklich.