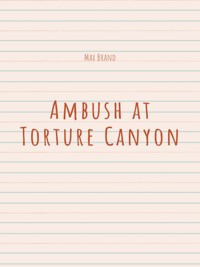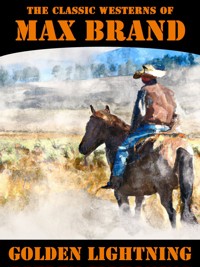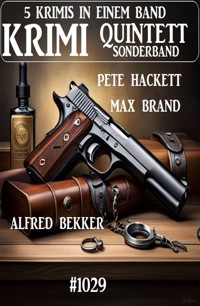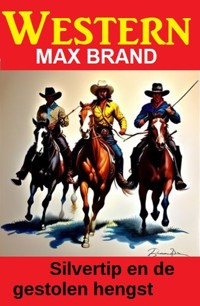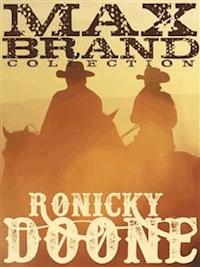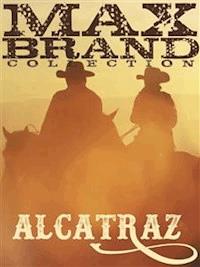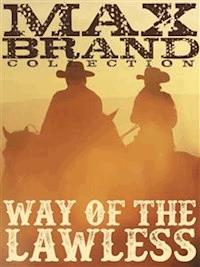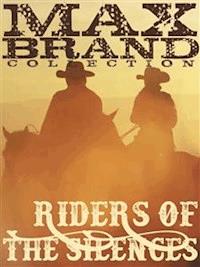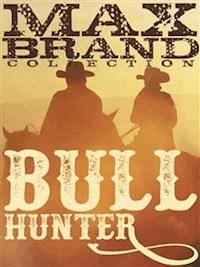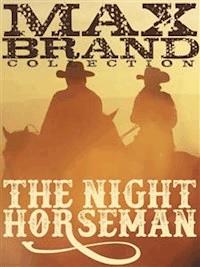6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der kleine Rusty Sabin wird von umherziehenden Cheyenne-Indianern geraubt und aufgezogen. Er lernt das fremde Volk schätzen und sogar lieben, und er wird einer von ihnen: ein weißer Indianer.
Bei einer Mutprobe aber, die ihn zum Krieger machen soll, versagt er, und der Stamm verachtet ihn als Feigling. Nur eine große Tat kann ihm die verlorene Ehre zurückgeben und ihn befähigen, eine Bande auf einen Kriegszug zu führen.
Rusty Savin schwört, eine solche Tat zu vollbringen.
Er will den sagenhaften weißen Hengst fangen und ins Lager bringen, und er will sich mit Wind Walker und den Pawnees anlegen. Taten, vor denen selbst die großen Häuptlinge der Cheyennes bisher zurückschreckten...
Max Brand (eigtl. Frederick Schiller Faust - * 29. Mai 1892 in Seattle Heights, Washington; † 12. Mai 1944 in Latium, Italien) war ein US-amerikanischer Schriftsteller und Drehbuchautor. Der Roman Auf dem Kriegspfad erschien erstmals im Jahre 1934; eine deutsche Erstveröffentlichung erfolgte 1978.
Auf dem Kriegspfd erscheint als durchgesehene Neuausgabe in der Reihe APEX WESTERN.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
MAX BRAND
Auf dem Kriegspfad
Roman
Apex Western, Band 51
Apex-Verlag
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
AUF DEM KRIEGSPFAD
ERSTER TEIL
ZWEITER TEIL
DRITTER TEIL
Das Buch
Der kleine Rusty Sabin wird von umherziehenden Cheyenne-Indianern geraubt und aufgezogen. Er lernt das fremde Volk schätzen und sogar lieben, und er wird einer von ihnen: ein weißer Indianer.
Bei einer Mutprobe aber, die ihn zum Krieger machen soll, versagt er, und der Stamm verachtet ihn als Feigling. Nur eine große Tat kann ihm die verlorene Ehre zurückgeben und ihn befähigen, eine Bande auf einen Kriegszug zu führen.
Rusty Savin schwört, eine solche Tat zu vollbringen.
Er will den sagenhaften weißen Hengst fangen und ins Lager bringen, und er will sich mit Wind Walker und den Pawnees anlegen. Taten, vor denen selbst die großen Häuptlinge der Cheyennes bisher zurückschreckten...
Max Brand (eigtl. Frederick Schiller Faust - * 29. Mai 1892 in Seattle Heights, Washington; † 12. Mai 1944 in Latium, Italien) war ein US-amerikanischer Schriftsteller und Drehbuchautor. Der Roman Auf dem Kriegspfad erschien erstmals im Jahre 1934; eine deutsche Erstveröffentlichung erfolgte 1978.
Joe schlägt zurück erscheint als durchgesehene Neuausgabe in der Reihe APEX WESTERN.
AUF DEM KRIEGSPFAD
ERSTER TEIL
Erstes Kapitel
Bei einem solchen Wetter, wenn die Hitze wie Daumen auf die Schläfen drückt, bestand Marshal Sabin stets darauf, dass seine Frau einen Hut trug. Aber da er heute beim Fischen war, konnte sie seinen Wunsch ignorieren. Sie mochte es nicht, wenn die weiche Krempe des Strohhutes vor ihrem Gesicht auf und ab wippte und ihr die Sicht versperrte.
Er bestand üblicherweise auch darauf, dass sie Mokassins trug, wenn sie das Haus verließ. Aber ihre Füße waren abgehärtet wie die eines Indianers, und deshalb beschloss sie, auch darauf zu verzichten. Aber ein bisschen unbehaglich war ihr doch zumute, denn selbst wenn er weit fort war, hatte sie ständig das Gefühl, seinen ernsten Blick auf sich gerichtet zu sehen.
Das war auch der Grund, weshalb sie ihren Blick über den Horizont schweifen ließ, nachdem sie mit dem Eimer die acht Stufen vom Boden des in die Erde gebauten Hauses hinaufgestiegen war. Sie empfand so etwas wie kindische Furcht und Vergnügen zugleich. Zwischen der Heimstatt und dem Rande der übrigen Welt gab es nur die weite Ebene, über der die Luft in der Hitze flimmerte. Es geschah nicht oft, dass die Frau auf diese Weise bis zum fernen Horizont blickte, denn die unendliche Weite ließ das Stück Acker nur wie eine Handvoll erscheinen. Deshalb wandte die Frau ihren Blick auch rascher wieder dem Maisfeld zu.
Ihr drei Jahre alter Sohn, auf den Namen Lawrence getauft, aber von seinem Vater nur Rusty gerufen, weil der Junge das rote Haar der Mutter geerbt hatte, spielte auf der eingezäunten Weide und freundete sich mit dem Kalb an, während die Kuh klugerweise nicht weiter auf das Kind achtete, sondern zwischen ihrem Sprössling und dem großen Wolfshund, der bei den Stangen saß, Wache hielt. Man hatte den Hund vor etwas mehr als einem Jahr auf genommen, in der Hauptsache als Spielgefährten für Rusty. Sie hatten es ganz lustig gefunden, ihn Dusty zu nennen.
Die Frau lächelte, als sie an diese beiden Namen dachte, aber dieses Lächeln verblasste sofort wieder, als sie daran dachte, welch schwere Arbeit es gewesen war, das Holz für diesen Zaun von weit, weit unten am Fluss heranzuschleppen und die Pfosten in den sommerharten Boden einzugraben. Aber wenn man Ackerland haben wollte, mussten die Tiere durch einen Zaun davon abgehalten werden.
Sie ging über den schmalen Pfad, den hauptsächlich sie mit den Füßen getrampelt hatte, zum Fluss hinab. Am Ufer angekommen, blickte sie seufzend die grob in den Boden gehauenen Stufen hinab, denn bis zum Grund waren es fast zehn Meter, und selbst dort gab es nur so wenig Wasser, dass es kaum einige ~ Tümpel auszufüllen schien. Der harte, ausgedörrte Boden warf die Hitze zurück, und die Frau war froh, als sie endlich knöcheltief im Wasser stand, um den Eimer zu füllen. Sie blieb noch ein kurzes Weilchen hier unten stehen und genoss die schwache Brise, die angenehm kühl von der Schlucht herunterwehte.
Wieder auf der obersten Stufe angekommen, blieb sie erneut einen Moment stehen, ohne jedoch den vollen Eimer abzusetzen. Sie sah, wie Rusty mit dem Hund zum Maisfeld wanderte, dessen Betreten dem Jungen streng verboten war. Rusty trug nur eine Hose und Mokassins. Die Frau lächelte beim Anblick des kleinen, von der Sonne dunkelbraun gebrannten Körpers. Es wäre ihr zwar lieber gewesen, wenn der Junge etwas kräftigeren Körperbau hatte, etwa so wie sein Vater, aber sie freute sich doch, weil der Kleine so ganz und gar ihr Kind war. Der Junge hatte die tiefblauen Augen der Mutter, und eines Tages würden seine von der Sonne gebleichten Brauen sicher genauso dunkel sein wie die der Frau.
Sie ging über den Pfad auf das Haus zu.
»Nicht in den Mais gehen, Rusty!«, rief sie.
Er drehte sich nach ihr um, krallte die rechte Hand ins dichte Fell am Hals des Hundes und beobachtete seine Mutter, bis sie außer Sicht war.
Die Frau lächelte vor sich hin, als sie das Haus betrat, denn sie wusste nur allzu gut, dass der Junge innerhalb der nächsten zwei Minuten in den schmalen Gängen zwischen dem hochgewachsenen Mais verschwunden sein würde. Aber der Hund warnte jedes Mal durch lautes Bellen, wenn Rusty sich einmal über die vorgeschriebenen Grenzen entfernen wollte.
Sie hatte kaum den Wassereimer abgestellt, als sie auch schon Dusty bellen hörte. Beinahe gleichzeitig hörte sie einen gellenden Schrei ihres Jungen. Was war los? Vielleicht eine Schlange? Oder diese andere Gefahr, von der Marshal Sabin nur ein einziges Mal mit ihr zu sprechen gewagt hatte?
Auf dem Tisch lag der schwere Revolver, den ihr Mann geladen hatte, bevor er fortgegangen war. Sie langte hastig nach der Waffe und hetzte die Stufen wieder hinauf... und da sah sie sich dieser zweiten Gefahr gegenüber, die - wie Marshall Sabin ihr eindringlich erklärt hatte - den Tod für sie bedeuten musste.
Hier... und da... und dort... überall brachen die dunkelhäutigen Gestalten aus dem Mais hervor. Die bronzenen Körper schimmerten dunkel im grellen Sonnenlicht. Die Kriegsbemalung hatte ihre Gesichter zu Fratzen verzerrt. Das Geschrei gellte der Frau in den Ohren und drang wie Nadelstiche in ihr Gehirn.
Hinter Rusty sprang ein Feind mit Federkopfputz auf.
Sie konnte das erwartungsvolle Grinsen sehen, als der Indianer mit der linken Hand nach dem Jungen langte und gleichzeitig mit der rechten Hand das Gewehr wie eine Keule hob.
Als Rusty die Mutter sah, schrie er noch lauter und streckte beide Ärmchen nach ihr aus.
Sie war absolut ruhig. Ihre Hand und ihr Verstand waren so ruhig, als handelte es sich um Gestalten aus einem Buch, um Gestalten, die von einem phantasievollen Schriftsteller erfunden worden waren. Während sie den schweren Revolver mit beiden Händen hielt, hörte sie wildes Geschrei. Aber das hatte nichts zu bedeuten. Rusty befand sich direkt in der Schusslinie, aber auch das hatte nichts zu bedeuten. Sie musste ihr Ziel treffen, also traf sie es auch. Kaum hatte sie den Abzug durchgerissen, da sprang die Gestalt hinter Rusty hoch in die Luft und presste eine Hand auf das verletzte Gesicht. Dann ließ sie sich auf ein Knie nieder und richtete das Gewehr auf die Frau.
Der kleine Rusty stolperte im gleichen Moment vorwärts.
Irgendwie bekam die Frau ihren Jungen zu fassen und hob ihn vom Boden auf. Für sie schien er im Moment überhaupt nichts zu wiegen. Sie hätte ihn mit einer Hand am Haar tragen können, während sie mit der anderen Hand ihren Weg erkämpft hätte.
Sie hatte die oberste Treppenstufe erreicht, als sie von der Kugel getroffen wurde. Aber sie wollte einfach nicht zusammenbrechen. Sicher gelangte sie noch nach unten ins Haus, bevor sie in einer Ecke zusammenbrach. Dusty stand über ihr und wollte ihr das Gesicht ablecken. Der Junge begann wieder zu schreien.
»Mommy! Ich bin verletzt! Mommy! Es tut so weh! Da, sieh mal, Mommy! Ich blute, Mommy! Ich blute!«
Sie hörte draußen auf den Stufen zwei schwere Schritte, also streckte sie die rechte Hand mit dem Revolver aus, packte die Waffe ganz fest und richtete sie auf das Büffelfell, das als Tür diente. Als es beiseitegeschoben wurde, feuerte sie auf den nackten, kupferfarbenen Körper des Indianers. Er kam hereingetaumelt und stürzte. Das Gewehr fiel ihm aus der Hand. Er schlug auf den Boden und prallte mit Kopf und Schultern dumpf an die gegenüberliegende Wand. Dort fiel er seitlich aufs Gesicht.
Weitere Indianer versuchten nicht, durch die offene Tür einzudringen, aber die Frau konnte oben auf dem Haus Schritte hören. Das kleine, aber solide aus Lehm gebaute Haus erzitterte unter den schweren Tritten.
Die Frau setzte sich auf, musste aber dreimal Anlauf nehmen, bevor sie es schaffte.
»Armer, kleiner Rusty«, sagte sie leise, als sie sah, dass die Kugel, die ihren Körper durchschlagen hatte, auch noch die Schulter des Jungen gestreift hatte.
Der Hund begann wie ein Wolf zu heulen.
»Mommy! Mommy! Da... sieh nur, sieh nur!«, kreischte Rusty, zeigte mit ausgestrecktem Arm und tanzte vor Entsetzen wie verrückt herum,
Sie blickte aus trüben Augen in die Richtung, in die der Junge zeigte, und sah, wie sich der verwundete Indianer auf ein Knie und auf eine Hand aufrichtete. Am Zittern seiner Muskeln und am Funkeln seiner Augen konnte sie erkennen, dass er seine letzte Kraft darauf verwenden wollte, sein Messer nach ihr zu werfen.
Die Mutter in ihr sah, dass es sich bei dem Indianer nur um einen großen Jungen handelte, der ungewöhnlich kräftig war. Während sie den Revolver auf ihn richtete und zielte, sah sie das blitzende Messer, aber sie konnte einfach nicht abdrücken. Sie konnte nur beobachten, wie das Blut aus der Brustwunde des jungen Indianers sprudelte.
Und dann grub sich das Messer zitternd und leise sirrend in den Boden, als wäre in unendlicher Ferne irgendwo ein Gong angeschlagen worden. Der Indianer-Junge sackte auf dem Boden zusammen. Doch er versuchte noch einmal, nach dem Messer zu langen. Ein Zittern durchlief seinen Körper, dann presste er das Gesicht auf den Boden und lag ganz still.
Dusty setzte sich neben dem toten Burschen hin, richtete die Schnauze zum unsichtbaren Himmel empor und begann zu heulen.
Kate Sabin wollte es scheinen, als wäre alles andere erträglich, nur nicht dieser Aufschrei des Hundes. Sie befand sich in einem Zustand der Benommenheit, und nur das Gefühl einer unerfüllten Pflicht riss sie noch einmal ins Bewusstsein zurück. Mit leerem Blick sah sie sich um. Sie betrachtete den Tisch, den Marshal Sabin so sorgfältig gezimmert hatte; die breiten Hacken, die sie so oft im Maisfeld geschwungen hatte; das kleine Hängebord, auf dem mehrere Bücher standen, darunter die Bibel, Onkel Toms Hütte und Robinson Crusoe. Die Bibel hatte sie kaum einmal aufgeschlagen... bis auf jenen Tag, an dem sie das Geburtsdatum ihres Knaben, den sie ganz allein und ohne jede Hilfe zur Welt gebracht hatte, eingetragen hatte. Sie begriff, dass der gegenwärtige Todesschmerz viel geringer war als diese Qual an jenem Tag.
Es bestand die schwache Hoffnung, dass dieser kleine, von der Sonne so dunkel gebräunte Junge verschont bleiben würde, denn es kam nicht selten vor, dass Indianer weiße Knaben adoptierten. Wenn sie ihn doch bloß noch richtig anziehen könnte! Aber sie wusste, dass ihre Kraft dazu nicht mehr ausreichte. Mit zitternden Fingern nestelte sie die Schnur von ihrem Hals. Daran befestigt war das einzige Schmuckstück, das sie je besessen hatte... eine Art Brosche, wie ein Käfer geformt, aus einem grünlich schimmernden Stein geschnitzt. Ihr Onkel, ein kluger Mann, der auf seinen vielen Reisen weit in der Welt herumgekommen war, hatte ihr diese Anstecknadel einmal aus Ägypten geschickt. Marshal Sabin hatte diesen grünen Stein als Kontrast zu ihrem roten Haar so geliebt, dass Kate das Schmuckstück ständig getragen hatte. Jetzt hängte sie es ihrem kleinen Jungen um den Hals und betete dabei im Stillen, dass die Indianer in diesem kleinen grünen Käfer vielleicht das Zeichen oder Andenken eines großen Häuptlings sehen würden.
Wenn bloß der Hund nicht so heulen würde!
Dann hörte sie von draußen die Stimme eines Mannes, der auf das Haus zu gerannt kam und dabei irgendetwas in der Sprache der Indianer rief oder fragte. Es hörte sich besorgt an. Auch das glaubte Kate Sabin noch zu verstehen, denn im Tipi eines Kriegers gab es nicht viele Söhne... und dort drüben lag der junge tote Bursche.
Das alles sah und nahm sie nur noch so verschwommen wahr, dass sie begriff, wie nahe sie jetzt schon dem Tode war. In der rechten Hand hielt sie immer noch den Revolver, die Mündung unter die linke Brust gedrückt.
»Rusty...«, flüsterte sie und nahm den Kleinen in die Arme. »Sie kommen... viele Indianer. Aber sie werden dir nichts antun, wenn du tapfer bist und ganz gerade dastehst... Darling... küss mich... Hab' mich lieb!«
Er warf die schwachen Ärmchen um ihren Nacken und presste sich mit aller Macht an sie.
Wären das die starken Hände von Marshal Sabin gewesen, so hätte das - wie ihr scheinen wollte - vielleicht doch noch vermocht, das entfliehende Leben in ihr zurückzuhalten. Aber da war nur das Heulen, dieses grässliche Heulen des Hundes... und der Aufschrei des Indianers, der nun draußen auf das Haus zu gerannt kam... und die Stimme ihres eigenen Sohnes, der in ihr Ohr wimmerte: »Mommy... Mommy... geh nicht fort! Lass mich nicht allein!«
Welcher Instinkt mochte dem Kleinen jetzt wohl verraten, dass sie fortgehen würde... für immer? Und da schien sich die Frau nur noch eins zu wünschen. Sie wollte das Gesicht des ersten Indianers sehen, der nun hereinkommen würde, damit sie ihm den Jungen mit einer flehenden Geste als Ersatz anbieten könnte. Aber sie wagte nicht länger zu warten, weil Marshal Sabin ihr gesagt hatte, dass selbst eine Frau kurz vor ihrem Tode vor den Indianern nicht sicher sei. Also presste sie noch einmal das Gesicht fest zwischen Rustys Hals und Schultern, küsste das warme, weiche Fleisch und riss dann den Abzug des Revolvers durch, wie Marshal Sabin es sie gelehrt hatte... mit dem Druck der ganzen Hand.
Zweites Kapitel
Als Rusty Sabin achtzehn Jahre alt war, ritt er hinter Spotted Antelope durch eine Schlucht in den Black Hills. Obwohl es bereits Spätsommer war, strömte das Wasser immer noch mächtig dahin; manchmal rauschte es wie der Wind, mitunter klang das Echo von den Felswänden wider wie menschliche Stimmen. Für Rusty Sabin, der sich selbst nur als Red Hawk kannte, hörten sich diese Stimmen zornig und vorwurfsvoll an, denn er wusste, dass im Herzen des Cheyenne-Indianers, der ihn adoptiert hatte, wilder Zorn loderte. Er hatte es schon seit Jahren gewusst, aber wenn er Bitter Root, seine Pflegemutter, gefragt hatte, was wohl diesen Zorn im Herzen des Kriegers verursachte, war ihm stets nur geantwortet worden: »Ein kluger Mann spricht nur einziges Mal... und nicht zu seinem Kind.«
Aber nun war er dabei, die Schwelle zwischen Kindheit und Mannesalter zu überschreiten, denn schon morgen würde er die Marter ertragen und das Blutopfer bringen müssen. Deshalb wusste er, dass Spotted Antelope endlich sprechen würde. In respektvoller Furcht war der junge Mann stets zehn Schritte hinter dem Indianer geritten.
Als sie eine Stelle erreichten, wo die Schlucht einen Knick machte, stieg Spotted Antelope ab und hobbelte sein Pferd an.
Red Hawk folgte sofort dem Beispiel des Indianers. Es war kurz vor Sonnenuntergang, aber noch war es heiß. So war es nicht viel mehr als eine Geste zeremonieller Würde, als der alte, grauhaarige Indianer sein Gewand aus Büffelfell fest um sich zog. Er deutete mit ausgestrecktem Arm, wo der Strom in einen tiefen Tümpel wirbelte.
»Reinige dich mit Wasser!«, sagte Spotted Antelope. »Und danach werde ich dich mit Rauch reinigen. Mein Sohn, du hast mich unglücklich gemacht, und jetzt werden wir beten, bevor wir das Geheiligte Tal betreten.«
Red Hawk hatte sich zwar innerlich bereits auf allerhand gefasst gemacht, aber als er diesen Namen hörte, hatte er ein hohles Gefühl in der Brust, denn hier, am Zugang zum Geheiligten Tal, war Sweet Medicine, der große Held, der den Cheyennes die Büffel gebracht hatte, zum letzten Mal von Menschen gesehen worden. Der Stamm hatte ihn damals weit fortgetrieben, bevor Sweet Medicine, an dieser Schlucht angekommen, vor ihren Augen groß wie die Wolken geworden war. Sein Gelächter war wie Donnergrollen vom Himmel über die Köpfe seiner Verfolger gehallt, und mit einer einzigen Handbewegung hatte er einen riesigen Pfeiler aus der Felswand gerissen und ihn so schief hingestellt, dass er jeden zu zerschmettern drohte, der sich ihm nähern würde. Jetzt erst hatten die Krieger verstanden, was für ein Mann das gewesen war. Sie hatten ihm flehend die Hände entgegengestreckt und seinen Namen gerufen wie Kinder ihren Vater.
Der junge Bursche war voller Ehrfurcht vor dieser Legende, als er nun seine Mokassins und seinen Lendenschurz ablegte. Jetzt hatte er nur noch eine Lederschnur um den Hals, und an ihr befestigt war ein grüner Käfer. Davon hatte er einen Teil seines Namens bekommen; von diesem Talisman, auf dessen Unterseite neben anderen mysteriösen Figuren auch ein klar umrissener Falke zu sehen war. Die andere Hälfte seines Namens hatte er seinem roten Haar zu verdanken, das nun in langen Zöpfen fest um den Kopf geschlungen war.
Zögernd steckte er einen Fuß ins Wasser, um Temperatur und Strömung zu prüfen. Physisch entsprach er nicht gerade dem sehnigen Cheyenne-Typ. Diese Indianer waren gewissermaßen die Riesen der endlosen Ebenen. Aber er war ungemein flink auf den Beinen und sehr geschickt mit den Händen.
Er beugte sich über das Wasser und betrachtete sein bronzenes Spiegelbild. Beide Arme mit den Handflächen nach unten ausgestreckt, begann er zu beten.
»Oh, Leute unter dem Wasser, seid gut zu mir! Und denkt daran, dass ich euch zwei gute Messer und eine Adlerfeder geopfert habe!«
Dann stieß er sich ab und tauchte kopfüber ins Wasser. Wie Schlangen erfassten die Strudel und Wirbel seinen Körper, seine Hände, seine Knie, seine Füße. Blindlings tastete er mit den ausgestreckten Armen im Wasser herum, bevor seine Hand endlich auf einen Felsen stieß, an dem er sich keuchend und vor Nässe glänzend wieder aus der Strömung ziehen konnte.
Sein Vater hatte inzwischen ein kleines Feuer angefacht.
Red Hawk schüttelte das Wasser vom Körper und blieb dicht neben dem Feuer stehen.
Spotted Antelope warf süß duftendes Gras ins Feuer. Mit beiden Händen erfasste er imaginären Rauch und schüttete ihn langsam über den nackten Körper seines Sohnes, dem der süße Duft in die Nase stieg. Red Hawk fühlte sich jetzt viel wohler, und sein Herz wurde leichter. Er schien alles Böse abzuwerfen und ein echter Cheyenne zu werden, auf dem der Blick des mystischen Sweet Medicine vielleicht mit Wohlgefallen ruhen würde.
Nachdem diese Zeremonie beendet war, setzte Spotted Antelope den Weg sehr langsam fort, denn so sollte ein Mann gehen, wenn er wünschte, dass die Geister sein ganzes Herz bloßgelegt sehen wollten. Dreimal machte der alte Indianer Pause, und beim vierten Mal ließ sich Red Hawk unaufgefordert auf die Knie fallen, denn nun hatten sie die Biegung der Schlucht hinter sich und sahen vor sich den Eingang zum Geheiligten Tal. Red Hawk sah im Geiste eine riesige Gestalt, die bis zum Himmel emporragte und eine Hand auf einen schiefstehenden Felspfeiler gelegt hatte. Laut stöhnend beugte sich Red Hawk nach vorn, bis sein Gesicht den Boden berührte. Danach wagte er sich nicht mehr zu bewegen. Er hatte sich Knie und Ellbogen zerschrammt; das Gestein unter seinem Bauch fühlte sich eiskalt an. Aber er wagte es nur ganz langsam, Seine Augen zu öffnen, und da sah er, dass sein Vater - gepriesen sei sein Name! - ihn an diesem schrecklichen Ort nicht alleingelassen hatte.
Spotted Antelope saß nun mit gekreuzten Beinen auf dem Boden und stopfte mit vier zeremoniellen Daumendrücken Tabak in seine Pfeife. Mit vier Gesten streichelte er den Pfeifenstiel, befestigte ihn am Pfeifenkopf und zündete den Tabak mit einem Stück Glut an, das er vom Feuer der Reinigung mitgebracht hatte. Und deshalb war es geheiligter Rauch, den er nun aus der brennenden Pfeife sog. Er blies den Rauch einmal auf den Boden, dann zum Himmel und schließlich in alle vier Richtungen. Eine letzte Rauchwolke stieß er zum Eingang des Geheiligten Tales hinüber. Dann betete der alte Mann.
»Lauscher unter der Erde, seid lange genug still, um mich zu hören! Lauscher über uns, habt Mitleid mit mir! Sweet Medicine, ich bitte nicht um Pferde oder um Büffel oder um Skalpe, sondern nur um Ehre für meinen Sohn.
Ich habe schlechte, schlimme Dinge getan, und dafür bin ich bereits gestraft worden. Du weißt, dass Short Lance mein Sohn war... und dass eine Frau ihn getötet hat. Aber nachdem sie gestorben war, konnte ich ihr den Skalp nicht nehmen, weil ich einen Knaben sah. Er stand kerzengerade da. Er hatte keine Angst. Da habe ich ihn nach Hause mitgenommen und meiner Squaw gegeben. Ich wusste, dass die Geister mir einen Sohn genommen hatten, um mich zu bestrafen, aber sie hatten mir dafür einen anderen gegeben, weil sie mir das Herz nicht brechen wollten.
Ich begann wieder froh zu werden. Red Hawk war kühn und glücklich. Bald war er der schnellste Läufer unter den Jungen, und im Wasser konnte er sich tummeln wie ein Fisch. Die wildesten Pferde vermochten ihn nicht abzuwerfen.
Aber ich wurde unglücklich, weil er mein Tipi zu oft verließ, um neben dem weißen Mann Lazy Wolf zu sitzen, dem Dolmetscher und Jäger, der ihn die Sprache des weißen Mannes lehrte, bis mein Sohn zwei Sprachen hatte. Und ist es nicht schon schwer genug, mit einer Sprache ehrlich zu reden? Aber von Lazy Wolf hat er auch diese böse Faulheit gelernt, stundenlang dazuliegen und ins Feuer zu starren, als könnte er darin eine Büffelherde während einer Hungersnot sehen.
An unserem Skalptanz und an unseren Scheingefechten fand er kein Vergnügen. Seit drei Sommern ist er der Krieger-Weihe und dem Blutopfer ausgewichen, aber ohne sie kann er niemals ein Mann werden und auf den Kriegspfad gehen,
Hab' Erbarmen mit mir, Sweet Medicine! Ich habe versucht, ein guter Mann zu sein. Ich habe Skalpe erbeutet und einige davon geopfert. Und jetzt, wo ich alt geworden bin, wo meine Pferdeherden zusammenschrumpfen, wo meine Hände schwach werden... lasse Red Hawk Reichtümer und Triumph wieder in mein Tipi zurückbringen!«
Damit beendete der alte Mann sein Gebet, indem er beide Hände auf den Boden drückte, zum Himmel emporstreckte und schließlich dem Zugang des Geheiligten Tales entgegenhielt.
»Steh auf!«, befahl Spotted Antelope plötzlich Red Hawk.
Langsam kam der junge Mann auf die Beine.
»Bete!«, sagte sein Vater.
Red Hawk wollte tun Sieg im Kampf bitten, um viele Skalpe, aber er konnte für sein Gebet nur die Worte finden: »Sweet Medicine, gib mir, was du von ganzem Herzen jedem Cheyenne geben kannst!«
Er hatte kaum ausgesprochen und hielt die Hände immer noch ausgestreckt, als Spotted Antelope einen lauten Schrei ausstieß und sich zu Boden warf.
Und Red Hawk sah, wie sich vor seinen Augen ein Wunder ereignete.
Eine große Nachteule strich am schiefstehenden Felsenpfeiler vorbei!
Der junge Mann warf sich neben seinem Pflegevater flach auf den Boden und hörte über sich das leise Rauschen der Vogelschwingen wie ein geflüstertes, unbekanntes Wort.
Danach, während ihm immer noch eiskalte Schauer des Grauens über den Rücken rieselten, hörte er seinen Vater mit keuchender Stimme murmeln: »Bedanke dich, mein Sohn! Bedanke dich dafür! Dein Gebet ist erhört worden! Oh, Sohn meiner Unterkunft, Sweet Medicine hat dein Gebet gehört und sich vor dir sehen lassen!«
Drittes Kapitel
Die Dunkelheit senkte sich bereits herab, als Vater und Sohn zu ihren Pferden zurückgingen, wobei ihnen noch immer Stimmen aus dem Geheiligten Tal zu folgen schienen. Red Hawk wurde nicht erlaubt, sich wieder anzuziehen. Er musste seine Sachen in einem Bündel mitnehmen, bis sie in der Nähe des Lagers angekommen waren. Der Mond war längst aufgegangen und überschüttete die neuen, weißen Tipis mit silbrigem Licht. Rosiger Feuerschein war durch die Öffnung zu sehen.
Spotted Antelope, bis an die Ohren in sein Gewand gehüllt, ritt voran, während Red Hawk in einigem Abstand folgen musste. Er wusste, dass für seinen Pflegevater die Welt neu geschaffen worden war. Aber er glaubte auch in sich eine neue Kraft am Werke zu spüren, einen neuen Geist, der großen Ruhm in gar nicht ferner Zukunft zu versprechen schien.
Sie gingen nicht zum eigenen Tipi, sondern zur Unterkunft von Running Elk, dem großen Medizinmann. Mysteriöse, süß duftende Rauchschwaden schwebten über dem Feuer im Tipi des Medizinmannes. Running Elk erhob sich vom Boden, um seine Gäste zu begrüßen. Er war ein großer, leicht gebeugter Mann, dessen langes, hageres, vom Alter gezeichnetes Gesicht jetzt zwar lächelte, aber gleichzeitig einen grausamen Ausdruck zeigte. Nachdem er die Geschichte von der geheimnisvollen Erscheinung dieser Eule gehört hatte, forderte er seine Gäste auf, sich hinzusetzen und zur Feier dieses ungewöhnlichen Ereignisses eine Pfeife mit ihm zu rauchen. Der Blick aus seinen von schweren Lidern beschatteten Augen war ständig auf das Gesicht des jungen Mannes gerichtet. Schließlich sprach Running Elk diese Worte: »Es war zweifellos Sweet Medicine.-Wenn er freundlich gesonnen in Erscheinung getreten ist, dann wird Red Hawk so groß werden, dass er den Regen vom Himmel herunterholen kann... und dass er für die Cheyennes die Büffel aus der Erde züchten wird. Sollte Sweet Medicine dagegen zornig gewesen rein, dann wird Red Hawk große Schande über den ganzen Stamm bringen... und jeder Vater wird dankbar sein, keinen solchen Sohn zu haben!«
Danach suchten Vater und Sohn das eigene Tipi auf. Red Hawk war immer noch nackt. Aber niemand sah ihn an, denn alle wussten, dass eine geheiligte Zeremonie stattfand und ein Gelübde abgelegt werden sollte. Die verhüllte Gestalt des Vaters und der nackte Körper des Sohnes verrieten es. Im eigenen Tipi reinigte Spotted Antelope wiederum sich selbst, sein Skalp-Hemd, seinen angemalten Büffelfell-Schild, seine Squaw Bitter Root sowie Person und Kleidung von Red Hawk mit Rauch aus süß duftendem Gras, dann erst gestattete er dem Sohn, sich wieder anzuziehen.
Die Squaw saß mit gekreuzten Beinen da und wandte das alte, runzelige Gesicht abwechselnd vom Vater zum Sohn und zurück. Sie war klug genug, jetzt keine Fragen zu stellen.
Red Hawk ging zu dem großen Topf über dem Feuer und wollte sich etwas vom gekochten Büffelfleisch nehmen, aber der Vater verbot es ihm.
Danach berichtete Spotted Antelope seiner Squaw in kurzen, abgehackten, immer wieder von schweren Atemzügen unterbrochenen Sätzen, was geschehen war und wie es von Running Elk gedeutet worden war. Als die Squaw alles gehört hatte, bedeckte sie ihr Gesicht mit einem Tuch, wie es einer anständigen Frau geziemt, wenn sie von einem Geheimnis erfährt.
Nach einiger Zeit verließ Spotted Antelope das Tipi.
Bitter Root kam zu dem jungen Burschen herüber, der auf dem Boden saß, und legte ihm beide Hände auf den Kopf, während sie betete: »Oh, Lauscher unter der Erde! Oh, Lauscher über uns! Lasst die Skalpe der Pawnees vom Mittelpfahl hängen und über unserem Feuer trocknen!«
Bitter Root dachte nicht an Ruhm oder Reichtum, denn sie war eine praktische Frau. Als auch sie gegangen war, lehnte sich Red Hawk gegen eine mit Federn gepolsterte Rückenstütze und brütete düster vor sich hin. Sein Magen rumorte und verlangte nach dem Essen, das ihm verweigert worden war. Red Hawk dachte daran, sein Lager herzurichten und schlafen zu gehen. Stattdessen aber befand er sich plötzlich unterwegs zum Tipi von Lazy Wolf.
Um diese Jahreszeit unterschied sich Lazy Wolfs Tipi von den anderen. Im Winter pflegte der weiße Mann einen der üblichen Wigwams aus Büffelfellen zu benutzen, aber im Sommer zog er ein Zelt aus leichter, aber kräftiger Leinwand vor. Der Feuerschein leuchtete durch das dünne Gewebe.
Red Hawk blieb vor der Zeltöffnung stehen, aber Lazy Wolf rief ihn sofort in heiterem Tonfall herein. Er saß wie üblich auf einem Haufen Büffelfellen und hatte ein Buch auf dem Bauch liegen. Eine Laterne spendete das Licht zum Lesen.
Blue Bird, die Tochter des weißen Mannes, drehte sich nur um und lächelte den Besucher an. Sie hatte schwarze Haare und Augen, genau wie ihre Cheyenne-Mutter, aber ihr Haar war seidenweich gewellt, und sie hatte dazu einen olivfarbenen Teint. Für Red Hawk war sie das Hauptwunder in Lazy Wolfs Tipi, und weil er Angst vor ihr hatte, scherzte er sehr viel, wenn sie gerade in der Nähe war. Im Moment rührte sie im großen Fleischtopf über dem Feuer herum, das in der Mitte des Zeltes brannte. Der Duft, der von dort herüberwehte, war für Red Hawk noch verlockender als der Geruch im eigenen Tipi. Wenn ihn seine Nase nicht täuschte, dann kochten jetzt dort im Topf einige kleine Vögel. Sein Magen drehte sich um, und ihm drohte vor Hunger beinahe übel zu werden.
»Setz' dich zu mir«, sagte Lazy Wolf. »Und erzähl' mir, was du bei diesem Ritt Neues erlebt hast.« Er drehte sich etwas zur Seite, aber doch nicht weit genug, um seinem dicken Bauch, auf dem das aufgeschlagene Buch mit dem Text nach unten lag, Unbehagen zu bereiten. Er stützte sich auf einen Ellbogen, schob die Nickelbrille auf die Stirn und sah aus feuchtblauen Augen den jungen Mann an. Dann begann er, mit den Fingern seinen Bart zu kraulen. Er rasierte sich niemals vollkommen glatt, sondern schabte nur ab und zu etwas von seinem Bart aus dem Gesicht. Seine Finger waren fast ständig damit beschäftigt, das lange Barthaar zu Locken zu drehen und wieder glattzustreichen. Seinen Beinamen Lazy hatte er zu Recht verdient, denn er war wirklich faul und er rührte sich kaum vom Fleck, es sei denn, dass er ab und zu auf die Jagd gehen musste. An Feierlichkeiten nahm er kaum teil, und er beteiligte sich auch nicht an den Zeremonien. Vor allem aber würde er niemals auf den Kriegspfad gehen.
Die Cheyennes schätzten ihn jedoch aus drei sehr wichtigen Gründen. Erstens war er für sie ein perfekter Dolmetscher und gerissener Händler. Zweitens machte seine Treffsicherheit auf größere Entfernungen sein Gewehr bei Hungerzeiten im Winter wertvoller als alle Waffen des ganzen Stammes zusammen. Und schließlich hatte er bereits zweimal die Pawnees vertrieben, als sie über das Lager während der Abwesenheit der jungen Krieger hatten herfallen wollen. Damals schien sein Gewehr überall zugleich gewesen zu sein. Deshalb hatten ihm die Cheyennes den vollen Namen Lazy Wolf gegeben. Sie respektierten, schätzten, ja verehrten ihn, aber gleichzeitig verachteten sie ihn auch.
Red Hawk setzte sich hin. Er zog ein langes, schweres Messer heraus und warf es so in die Luft, dass es jedes Mal mit der Spitze nach unten fiel. Das schaffte er mit geradezu perfekter Sicherheit. Diesen schwierigen Trick machte ihm so leicht kein anderer Cheyenne nach. Er tat es mit gespielter Gleichgültigkeit, aber wenn sein Blick der blitzenden Klinge folgte, dann huschte er doch jedes Mal zur Seite, und Red Hawk hoffte, in den Augen des jungen Mädchens Staunen oder Bewunderung sehen zu können. Aber Blue Bird war wie üblich enttäuscht; sie schien diesen Messer-Trick nur für eine der vielen Geschicklichkeiten mit der Hand zu halten.
»Für mich gibt's nicht viel zu erzählen, Lazy Wolf«, sagte Red Hawk. »Aber was ist denn inzwischen hier im Lager passiert?«
»Da gibt’s auch für mich nicht viel zu erzählen«, sagte Lazy Wolf und lächelte ein bisschen. »Aber die drei Krieger, die zu den westlichen Bergen gegangen sind, sind immer noch nicht zurückgekommen. Die Leute sagen, dass die drei vielleicht Wind Walker begegnet sind.«
»Könnte Wind Walker denn drei Cheyenne-Krieger töten?«, fragte der junge Bursche und starrte den anderen an.
»Er hat's früher schon getan«, antwortete Lazy Wolf. »Man behauptet von ihm, dass er fünfundzwanzig Skalpe erbeutet haben soll.«
»Du bist ein weißer Mann, Lazy Wolf!«, sagte Red Hawk zornig.
»Du doch auch«, lächelte der andere.
»Aber mein Herz ist durch und durch rot!«, rief der Junge.
»Gut!«, rief Blue Bird, und das Leuchten in ihren Augen konnte jetzt nicht nur vom Feuerschein kommen.
»Außerdem habe ich die Skalpe gesehen«, sagte Lazy Wolf. »Und ich habe mit Wind Walker gesprochen.«
»Ohne dein Gewehr auf sein Herz zu richten?!«, rief der Junge.
»Du musst endlich begreifen, was ich dir ja früher schon erzählt habe«, sagte Lazy Wolf. »Ich bin nur ein Cheyenne, weil ich in ihrem Lager bin... und solange ich in ihrem Lager bin. Aber wenn es dich glücklicher macht, will ich dir sagen, dass Wind Walker mich hasst, weil ich beim Stamm bleibe, und deshalb kann ich ihn natürlich auch nicht sonderlich gut leiden. Um ganz offen zu sein, mein Junge... ich bin nur zu ihm gegangen, weil ich hoffte, herauszubekommen, warum er sein Leben damit verbringt, den Stamm zu hetzen.«
»Und warum?«, fragte der Junge.
»Weil er zufällig eine Frau hatte, die von den Cheyennes ermordet wurde. Das ist der einzige Grund. Manche weißen Männer schätzen Frauen sehr hoch ein. Ihr nicht, aber manche weißen Männer lieben es mehr, mit ihren Frauen und Kindern zu leben, als mit Pferdeherden und Hunderten von Skalpen.« Er lachte und sah das Mädchen an. »Gib Red Hawk was zu essen«, sagte Lazy Wolf zu ihr.
»Mein Vater hat gesagt, dass ich fasten soll«, antwortete der Junge.
»In deines Vaters Tipi sollst du nichts essen. Aber das hier ist ja ein ganz anderes Tipi, und ich sehe doch, dass du schon halb verhungert bist. Blue Bird, gib ihm etwas von dieser Brühe!«
Das Mädchen riss einen Moment Mund und Augen auf, bevor es rief: »Nein! Spotted Antelope hat’s verboten!«
»Nur in seinem eigenen Tipi, aber dieses Tipi hier gehört mir«, sagte Lazy Wolf. »Also, los... gib ihm was zu essen!«