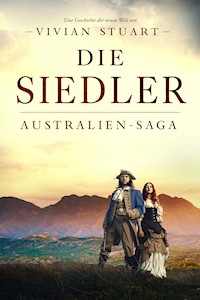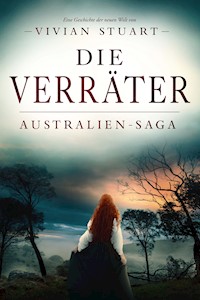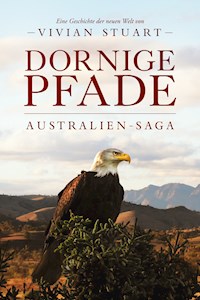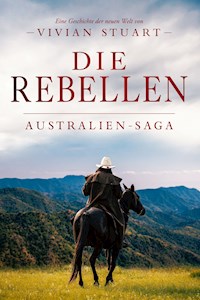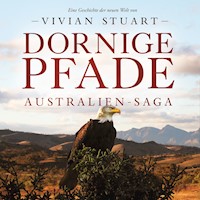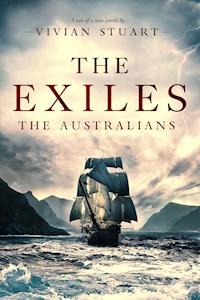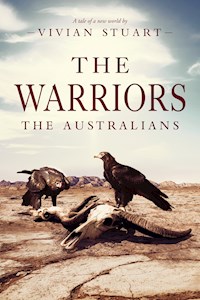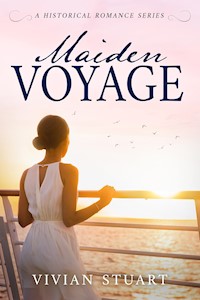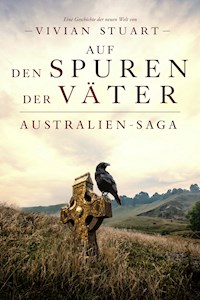
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: Jentas EhfHörbuch-Herausgeber: Skinnbok
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Australien-Saga
- Sprache: Deutsch
Jenny Taggart gehört zu den ersten Siedlern der neuen Kolonie Australien. Sie hat viele harte Jahre auf dem neuen Kontinent erlebt, doch ihr Überlebenswille und ihr Glaube an das Gute im Menschen sind ungebrochen. Nun geht ihr größter Wunsch in Erfüllung: Ihr Sohn Justin findet den Weg durch die Blue Mountains und damit zu neuen, fruchtbaren Weidegründen. Brechen nun goldene Zeiten für die Kolonisten an?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 429
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Auf den Spuren Der Väter
Auf den Spuren Der Väter – Australien-Saga 4
© Vivian Stuart (William Stuart Long) 1982
© Deutsch: Jentas ehf 2022
Serie: Australien-Saga
Titel: Auf den Spuren Der Väter
Teil: 4
Originaltitel: The Explorers
Übersetzung : Jentas ehf
ISBN: 978-9979-64-314-2
Prolog
Heiße und stickige Luft strömte aus dem Wandschrank. Die Seesäcke und andere Gepäckstücke waren schon vor ein paar Tagen auf die im Hafen von Yarmouth vor Anker liegenden Frachter verladen worden.
Jessica India Maclaine hockte in dem Wandschrank und atmete erleichtert auf, als sie Kommandorufe vom Kasernenhof heraufschallen hörte. Der Wandschrank war unter einer Steintreppe eingebaut, die von den Quartieren der verheirateten Offiziere im oberen Stockwerk der Colville Kaserne nach unten führte. Sie hatte sich spät am Vorabend dort versteckt, als ihr Stiefvater seiner Familie mitgeteilt hatte, daß sie am frühen Morgen des nächsten Tages an Bord gehen sollten.
Jessica war sich ganz sicher, daß niemand in dem Wandschrank nach ihr suchen würde. Und sie würde schon bald aus ihrem dunklen Versteck kriechen können, nämlich dann, wenn alle Soldaten auf dem Kasernenhof angetreten wären und sie nach dem Anwesenheitsappell zum Hafen marschieren und sich einschiffen würden. Dann wäre sie frei, so wie ihr Bruder Murdo, und das 73. Infanterieregiment würde mit ihrem Stiefvater für immer aus ihrem Leben verschwinden.
Sie hatte keine Ahnung, was sie dann tun würde. Bis jetzt hatte sie einzig danach getrachtet, der strengen Herrschaft ihres Stiefvaters endlich zu entkommen. Er hatte sie oft brutal geschlagen und unzählige Male jede nur denkbare Weise genutzt, um sie zu erniedrigen und zu kränken. Jessica dachte bitter, daß es nicht schlimmer sein konnte auf der Straße zu betteln, um ihren Hunger zu stillen.
Ihr Bruder Murdo war schon vor drei Monaten durchgebrannt, bevor das Infanterieregiment in Schottland aufgebrochen war.
Keiner der Soldaten war begeistert davon, nach Neusüdwales versetzt zu werden. Es war eine Strafkolonie, und selbst die Tatsache, daß ihr kommandierender Offizier, Colonel Lachlan Macquarie, zum Gouverneur ernannt worden war, konnte die stolzen Schotten nicht trösten.
Jessica seufzte, als sie an all die Gespräche dachte, die sie mit angehört hatte. Selbst die jungen Rekruten hatten sich beschwert und das Gefühl gehabt, daß ihnen durch die Verschickung auf die andere Seite der Welt tiefes Unrecht geschehen sei. Sie selbst hatte ihre Kindheit in Indien verbracht und hatte sich eigentlich auf die lange Schiffsreise gefreut. Sie wäre gern mit ihrer Mutter nach Neusüdwales gefahren ... aber, bei Gott, auf keinen Fall mit dem zweiten Mann ihrer Mutter, Sergeant Major Duncan Campbell.
»Jessie ... Jessie, bist du hier?« Jessica erkannte die Stimme ihrer Mutter, obwohl sie kaum hörbar flüsterte, um sie nicht zu verraten. Sie wußte, daß die Militärangehörigen als letzte an Bord der Schiffe gehen würden, aber ... sie hielt den Atem an. Die Soldaten hatten den Kasernenhof noch nicht verlassen. Sie konnte die entfernten Trommelschläge noch hören, und an den Rufen erkannte sie, daß der Anwesenheitsappell noch nicht beendet war.
»India«, flüsterte ihre Mutter beschwörend und benutzte den Namen, den ihr eigener Vater ihr gegeben hatte und den Duncan Campbell nur in den Mund nahm, wenn er sich über sie lustig machen wollte. »Mach die Tür auf, mein Kind. Er kommt zurück. Er hat mich mit seinem Gürtel geschlagen ... ich mußte ihm ganz einfach sagen, wo du bist.«
In diesem Augenblick war für Jessica der Traum von der lang ersehnten Freiheit ausgeträumt.
»Gut, Mama. Einen Augenblick bitte. Ich mach gleich auf.«
Sie machte ihrer Mutter keine Vorwürfe, weil sie ganz sicher war, daß sie ihr Versteck nicht freiwillig verraten hatte. Als sie aus dem Schrank kroch und sich aufrichtete, war sie froh, daß sie ihrer armen Mutter keine Vorhaltungen gemacht hatte. Elspeth Campbell schaute sie mit kalkweißem Gesicht an und hielt ihr jüngstes Kind, die kleine Flora, auf dem Arm. Ihre Oberlippe war angeschwollen, und ein roter Striemen zog sich über ihr schönes Gesicht.
Und ihre Mutter war geschlagen worden, weil sie, Jessica, sich versteckt hatte. »Tut es sehr weh, Mama?« fragte sie voller Mitleid.
Ihre Mutter preßte die Lippen aufeinander. Dann drängte sie: »Komm schnell, wir mischen uns unter die anderen Frauen und Kinder, und dann wird dir nichts geschehen. Ich habe Janet bei Mrs. Macrae zurückgelassen. Er tut dir nichts, wenn wir alle beisammen sind. Und sowie wir an Bord des Schiffes sind, kannst du ihm aus dem Weg gehn.«
Vielleicht kann ich das, dachte Jessica, aber es würde nicht leicht sein. Das Schiff war bestimmt überfüllt, und die Quartiere für die neunzig Frauen und siebenundachtzig Kinder waren sicher spartanisch und boten kaum ein Versteck.
»Ich kann doch noch mal versuchen, mich hier zu verstecken«, meinte sie kleinlaut. »Oben vielleicht —«
»Hier wird er dich suchen, bis er dich findet, mein Kind«, entgegnete ihre Mutter besorgt. »Du weißt doch wie er ist. Es ist für ihn eine Sache des Stolzes — er will seine Familie Zusammenhalten, damit die Offiziere nicht schlecht von ihm denken. Und da Murdo schon weggelaufen ist, ist er mehr denn je darauf bedacht, daß du das nicht auch noch tust.«
Die vierjährige Flora fing an zu quengeln.
»Ach sei still, Flora!« bat Jessica. Das kleine Mädchen war Duncan Campbeils Lieblingstochter. Er verwöhnte die Kleine noch mehr als seine Erstgeborene, die hübsche zierliche Janet. Jessica wiederholte: »Sei jetzt sofort still!«
Flora hörte nicht auf sie. »Mama«, schluchzte sie, »könnten wir nicht aufs Schiff gehn? Laß Jessica doch hier, wenn sie das will.
»Wir gehn gleich, meine Kleine«, beruhigte sie ihre Mutter. Sie schaute ihre älteste Tochter mitleidig an, sah, wie müde und unglücklich sie war und verstand, daß sie fliehen wollte. Sie wußte genau, daß Duncan Jessie nicht liebte. Er war ein harter Mann, das konnte man beim besten Willen nicht bestreiten, ganz anders als der gutaussehende, lustige junge Soldat, mit dem sie in erster Ehe verheiratet gewesen war, der sie mit nach Indien genommen hatte und mit dem sie fast neun Jahre lang sehr glücklich verheiratet gewesen war.
Aber er war am 4. Mai 1799 in der Schlacht von Seringapatam umgekommen ... Elspeth Campbell fühlte, wie sich ihr Herz schmerzvoll zusammenzog, als sie an ihn dachte.
Sie war als Witwe mit zwei Kindern zurückgeblieben, mit einem fast fünfjährigen Sohn und der hübschen, dunkelhaarigen Tochter, die ihr Mann India genannt hatte. Jessica India ... ein absurder Name, aber er hatte ihn geliebt und hatte sie immer so genannt.
Nach dem Tode ihres Mannes war sie bald in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Die britische Armee in Indien zahlte keine Renten an Witwen aus. Es wurde von ihnen erwartet, daß sie sich wieder verheirateten oder auf andere Weise ihren Lebensunterhalt verdienten. Wenn sie jung waren und gut aussahen, gab es in der Armee keinen Mangel an Verehrern, und sie ... Elspeth seufzte.
Sie war damals erst Mitte Zwanzig gewesen, und die gutaussehende junge Frau war im ganzen Regiment beliebt und geschätzt. Eine Anzahl von Männern hatte ihr den Hof gemacht, und sie hatte den Heiratsantrag von Duncan Campbell angenommen. Er war wie ihr erster Mann Murdo Corporal, war aber viel ehrgeiziger und als ein religiöser, zuverlässiger Mann bekannt. Sie hatten geheiratet, als das Regiment ein paar Monate nach der Schlacht in die Kaserne in Madras zurückkehrte, und —
Dumpfe Trommelschlage verkündeten das Ende des Anwesenheitsappells, und Elspeth zuckte zusammen und sagte: »Um Gottes willen, komm heraus, Mädchen! Du kannst nicht hierbleiben!«
»Aber sie gehen doch an Bord, Mama«, bettelte Jessica. »Und er auch —. Er wird mich jetzt nicht mehr suchen!«
»Er wird von dem Adjutanten die Erlaubnis einholen, noch einmal in die Kaserne zurückzukehren«, antwortete ihre Mutter. »Und zwar dann, wenn er uns nicht am Landungssteg sieht. Uns alle!«
Als Jessica sich gerade aufrichten wollte, kam ihr Stiefvater in den Raum und rief herrisch ihren Namen.
Er war ein hochgewachsener breitschultriger Mann. Er schaute finster drein, und Jessica zitterte vor Angst. Ihre Mutter stellte sich mutig zwischen sie, aber ihr Mann schob sie zur Seite, als sie verzweifelt »Nein, Duncan, nein!« ausrief.
»Das verdammte Mädchen kann doch selbst sprechen, oder?« brüllte er. »Also los, Jessie — was haste zu sagen?«
Sie wich bis zum Schrank zurück, unfähig ein Wort zu ihrer Verteidigung hervorzubringen. Sie sah, daß ihr Stiefvater ein Stöckchen in der rechten Hand hielt, mit dem er sich ungeduldig auf seine nackten Beine unter dem gutsitzenden Schottenrock schlug.
»Nun«, brummte er. »Haste versucht, dich vor uns zu verstecken, oder? Haste gehofft, daß wir ohne dich absegeln? Und was hättste denn ohne uns angestellt? Los — ich will die Wahrheit wissen, Jessie — und ich krieg sie raus, und wenn ich dich verprügeln muß!«
Sie wußte, daß es ihm ernst war mit dem, was er sagte, und flüsterte schließlich unglücklich: »Ja, ich wollte ... ich wollte hierbleiben. Ich will nicht mit euch fahren.«
»Vater«, verbesserte er sie haßerfüllt. »Ich bin dein Vater, das darfste nich vergessen!«
Jessica preßte ihre Lippen aufeinander und schwieg. Es war ihr unmöglich, ihn so zu nennen, und ihre Weigerung machte ihn noch rasender vor Wut.
»Sie will ja gradezu bestraft werden, Frau«, rief er Elspeth zu. »Und, bei Gott, sie kriegt von mir das, was sie verdient!«
Der Stock in Duncan Campbeils Hand sauste durch die Luft. Es kümmerte ihn wenig, wo er das Mädchen traf. Erst als Jessica zu Boden stürzte und ihr Gesicht mit den Händen bedeckte, hörte er auf, auf sie einzuschlagen. Er atmete schwer und ging brummend davon: »War nur das, was sie verdient hat. Und jetzt kommt mit runter auf den Kasernenhof! «
Elspeth legte ein Umhängetuch um ihre ältere Tochter, um die dunkelroten Striemen auf ihren Armen zu verdecken. Sie flüsterte ihr zu: »Wenn wir erst auf dem Schiff sind, leg ich dir linderndes Öl auf, dann tut es gleich weniger weh.«
Jessica, die ihre Bestrafung mit zusammengebissenen Zähnen hingenommen hatte, starrte ins Leere und schaute ihre Mutter dann inständig bittend an. Während sie verprügelt worden war, hatte sie keinen Ton von sich gegeben, aber jetzt strömten ihr die Tränen aus den Augen, und es brach aus ihr heraus: »Ach Mama, muß ich wirklich auf das Schiff? Kann ich mich nicht hier verstecken — er kommt doch bestimmt nicht zurück; er ist doch dafür verantwortlich, daß die Familien an Bord gehen?«
»Ich glaube auch, daß er nicht noch mal hier auftaucht«, meinte Elspeth. »Aber er wird mir die Verantwortung geben, wenn du jetzt noch einmal ausreißt. Und du weißt, was das bedeutet.«
Jessica wußte das aus bitterer Erfahrung. Sie legte sich das Umhängetuch um die Schultern und stand verzweifelt auf. Ihre Mutter legte den Arm um sie, und sie stiegen zusammen die steinerne Treppe hinab.
Die Frauen warteten geduldig am Landungssteg. Elspeth holte ihre Tochter Janet bei Morag Macrae ab. Morag fragte nicht, warum sich ihre Freundin mit den Kindern verspätet hatte, aber als Jessica ihren mitleidigen Blick auf sich ruhen fühlte, war ihr klar, daß die Frau Bescheid wußte. Ihr Mann war ein freundlicher älterer Sergeant, mit dem sie schon über zwölf Jahre lang verheiratet war. Sechs ihrer acht Kinder waren früh gestorben — zwei auf der Rückfahrt von Indien. Sie war auch jetzt wieder schwanger, aber das hielt sie nicht davon ab, mit aller Kraft anderen Menschen zu helfen und sich tatkräftig um ihre beiden Söhne zu kümmern.
»Wir fahren auf der Dromedary«, sagte Elspeth zu ihrer ältesten Tochter. »Das Schiff ist ein Armeetransporter, deshalb ist es auch größer als die Hindostan. Aber es sieht aus, als ob wir noch etwas warten müssen, bevor wir an Bord gehen können ... ist alles in Ordnung, Jessie?«
»Es geht schon, Mama«, sagte Jessica, doch sie konnte sich vor Müdigkeit kaum aufrecht halten. Ihr geschundener Körper schmerzte, aber sie würde um keinen Preis ihre Schwäche zugeben und ihrem gehaßten Stiefvater einen Triumph in die Hand spielen.
Sie schaute sich um und hielt nach ihm Ausschau. Sie entdeckte ihn, wie er aufgeblasen wie ein Pfau am Kai entlangging, bei einer kleinen Gruppe von Offizieren stehenblieb und schneidig salutierte. Einer der Offiziere war Captain Henry Antill, der, wie sie erfahren hatte, zum Adjutanten des neuen Gouverneurs Colonel Macquarie ernannt worden war. Antill galt seit der Schlacht vor Seringapatam als Held des Regiments. Jessica erinnerte sich noch gut daran, wie freundlich er zu ihrer Mutter gewesen war, nachdem ihr Vater in der Schlacht ums Leben gekommen war. Aber seit das Regiment nach Schottland zurückgekehrt war, hatten sie ihn nur noch selten gesehen.
»Captain Antill ist außerdem zum Kompanieführer befördert worden«, sagte ihre Mutter, und ein freundliches Lächeln lag auf ihrem meist ernsten Gesicht. »Und es kann sein, daß er unsere Kompanie anführt, da Major O’Connell nach unserer Landung in Port Jackson den Posten des Regimentskommandeurs übernehmen wird.«
»Dann wird Captain Antill auf unserem Schiff fahren?« fragte Jessica hoffnungsvoll.
»Ja, wahrscheinlich, Jessie«, meinte Elspeth Campbell. »Und der neue Gouverneur mit seiner Frau und seinen Bediensteten auch.« Sie fügte nachdenklich hinzu: »Es sind alles Fremde für uns, Jessie — Colonel Macquarie hat nie in unserem Regiment gedient. Seine Frau —« sie unterbrach sich selbst. »Ach, jetzt sieht es so aus, als ob unser Warten ein Ende hat. Ich muß Flora wecken. Kannst du —« sie schaute ihre älteste Tochter sorgenvoll an. »Glaubst du, daß du unsere beiden Bündel tragen kannst, damit ich die Kleine auf den Arm nehmen kann?«
»Aber natürlich, Mama. Mach dir wegen mir bloß keine Sorgen.« Jessie streckte die Hand aus und verzog keine Miene, als die Mutter ihr das schwere Kleiderbündel reichte. »Es geht mir wieder gut, wirklich.«
Aber trotz all ihrer tapferen Beteuerungen wurde sie während des langsamen Marsches auf dem Landungssteg fast ohnmächtig. Ihre Mutter ging mit ihren zwei jüngeren Schwestern schon auf das Schiff, und als sich Jessica kurz gegen das Geländer der Landungsbrücke lehnte, kam Captain Antill mit einem jungen Fähnrich und ihrem Stiefvater heran.
Er schaute sie einen Augenblick lang an, ohne sie zu erkennen, und rief dann lächelnd aus: »Aber das ist ja Jessica India Maclaine, oder? Und sie hat für ein so junges Mädchen ja viel zu viel zu tragen. Nun, das können wir ändern.« Er winkte einen Soldaten heran, der Jessica die Kleiderbündel abnahm. Sie bedankte sich schüchtern und achtete darauf, daß das Umhängetuch ihre Schultern und ihre Arme bedeckte. Kalte Wut stieg in ihr auf, als sie ihren Stiefvater sagen hörte: »Das Mädchen is meine Stieftochter, Sir. Wo sind denn deine guten Manieren, Jessie — was macht denn ein wohlerzogenes Mädchen?«
Antill entgegnete aufgebracht: »Verdammt noch mal, Sergeant Major, sehen Sie denn nicht, daß das arme Kind völlig erschöpft ist? Ein Windstoß könnte sie umblasen. Komm her, India, hast du vergessen, wie oft ich dich in Madras Huckepack getragen habe?«
Er bückte sich und hob sie hoch, und Jessie hielt sich an seinen Schultern fest, während er sie durch die Breitseitpforte der Dromedary trug und an Bord des Schiffes vorsichtig zu Boden setzte. Er sagte zu dem Soldaten, der die Kleiderbündel trug: »Bringen Sie das Mädchen dorthin, wo die Familien einquartiert sind. Ihre Mutter ist die Frau des Sergeanten Majors, Mistress Campbell. Sagen Sie ihr —« das Umhängetucn war verrutscht, und Jessica sah, daß Captain Antill entsetzt auf ihre blutunterlaufenen Arme blickte. Sie wurde rot und zog das Tuch fester um sich.
»Sagen Sie Mistress Campbell, daß das Mädchen krank ist«, ordnete er an. »Sie weiß, was in diesem Fall zu tun ist, und ob ein Arzt zugezogen werden sollte.« Zu Jessica meinte er freundlich: »Wir sehen uns später, India. Wenn du heute nacht gut schläfst, sieht die Welt morgen schon ganz anders aus.«
Der Raum, in dem die Frauen und Kinder untergebracht waren, war trotz der Größe des Schiffes eng. Viele Mütter mußten sich mit ihren Kindern eine Koje teilen.
Als Frau eines Offiziers waren Elspeth Campbell für sich und ihre drei Kinder drei Kojen zugewiesen worden. Sie waren mit einer Strohmatratze und einer Decke ausgestattet. Ein schmutziger Vorhang schirmte die Kojen vom Hauptraum ab.
Jessica fühlte sich schwach, vor Erschöpfung und Schmerzen. Das Tuch rutschte ihr von den Schultern, und sie sank in der unteren Koje neben Flora, die ungestört von dem Geschrei der anderen Kinder schon wieder fest schlief.
Als Elspeth sah, wie tief sich die Striemen in die Arme ihrer mißhandelten Tochter eingegraben hatten, schickte sie Janet zu Morag Macrae mit der Anweisung, so lange dortzubleiben, bis sie wieder abgeholt würde, und als das Kind verschwunden war, hob sie die schlafende Flora in die obere Koje. Dann reinigte sie mit großer Vorsicht die Wunden und legte ein linderndes Öl auf.
»Er hatte kein Recht, dich so zu behandeln«, rief sie entsetzt aus. »Ich werde ihn anzeigen. Er weiß nicht, was er tut!«
»Das würde er dir niemals verzeihen«, warnte Jessica. »Und es würde auch überhaupt nichts helfen. Er würde einfach sagen, daß ich eine Tracht Prügel verdient hätte und bekäme höchstens eine Rüge erteilt. Du weißt doch wie die Offiziere sind, Mama.« Sie dachte, daß Captain Antill zwar anders war, aber sogar er würde sich nicht in eine Familienangelegenheit einmischen.
Elspeths Finger zitterten, als sie mit einem Lappen das überschüssige Öl abwischte.
»Ich habe alles getan, was ich konnte«, sagte sie. »Aber eigentlich müßte ich den Arzt holen.«
»Nein!« bat Jessica ganz entschieden. »Bitte nicht, Mama. Ich fühle mich schon besser. Ich glaube, es ist das beste, wenn das unter uns bleibt.«
»Gut« gab ihre Mutter nach. Sie stand auf, strich ihrer Tochter zärtlich über das Haar. »Versuch zu schlafen, meine Liebe. Bald sind alle in ihren Kojen untergebracht, und dann wird es hoffentlich etwas ruhiger hier.«
Es war heiß und stickig im Quartier der Soldatenfrauen, und hoffnungslos überfüllt war es außerdem. Die Beschwerden rissen nicht ab. Jessica schlief oder döste die meiste Zeit, bemerkte weder die Hitze noch den Lärm. Nach ein paar Tagen fingen die Striemen an zu heilen.
Am 19. Mai hieß es, daß der neue Gouverneur am Nachmittag an Bord kommen würde. Am Morgen dieses Tages betrat ein Offizier den Raum.
»Bitte schenken Sie mir Ihre Aufmerksamkeit«, bat er höflich. »Ich habe etwas anzukündigen, das Sie alle angeht. Es hat viele Beschwerden gegeben, und wir sind der Sache nachgegangen. Colonel O’Connell hat mir den Auftrag erteilt, Sie davon zu informieren, daß dreißig Frauen mit ihren Kindern auf die Hindostan verlegt werden. Zusätzlich werden vierzig Frauen und Kinder unter der Aufsicht von zwei Offizieren an Land gehen und so lange in Portsmouth wohnen, bis ein Sträflingstransport nach Neusüdwales abfährt und Sie darauf bequemer Platz finden können. Ich werde jetzt die Namen der Frauen verlesen, die mit ihren Männern an Land gehen werden. Sie werden dann in zwei Stunden das Schiff verlassen.«
Der erste Name der Liste war der ihrer Mutter, und Jessica hielt vor Schreck den Atem an, als sie es hörte.
»Elspeth Campbell, Frau von Sergeant Major Duncan Campbell von der vierten Kompanie, und drei Kinder ...« Er las weiter, aber Jessica hörte nicht mehr hin. Sie klammerte sich an die Hand ihrer Mutter und flüsterte: »Ach, Mama! Müssen wir wirklich mit ihm an Land gehen?«
»Ich auf alle Fälle mit den Kleinen ... das weißt du ja. Aber du ...« Elspeth zögerte und überlegte fieberhaft. Dann flüsterte sie leise; »Zuerst werden die Männer an Land gebracht, dein Stiefvater also auch. Das heißt, daß er nicht nach dir suchen kann, Jessie, wenn du lieber an Bord dieses Schiffes bleiben willst.«
»Dann muß ich mich aber doch wieder verstecken, Mama«, flüsterte Jessica unentschlossen. »Und —« Tränen traten ihr in die Augen, als sie die möglichen Folgen bedachte. »Er wird es an dir auslassen, wenn er merkt, daß ich nicht mit an Land gegangen bin. »Er —«
»Davon brauchst du deine Entscheidung nicht abhängig zu machen, Jessie«, antwortete Elspeth. »Bis dahin ist das Schiff schon auf dem Weg — aber überleg dir, ob du den Mut hast, ganz alleine zu fahren. Du kennst Mrs. Macrae gut. Sie paßt auf dich auf, wenn ich sie darum bitte. Und auch die anderen Frauen sind eher Freundinnen als Fremde für dich, Jessie.«
Das ist wahr, dachte Jessica, aber sie klammerte sich weiterhin an die Hand ihrer Mutter, der Abschiedsschmerz drohte sie zu überwältigen.
»Ich möchte nicht von dir fort, Mama«, brachte sie mit erstickter Stimme heraus.
»Aber vergiß nicht, daß du bereit warst, mich zu verlassen, als ich dich in dem Schrank gefunden hab«, erinnerte sie ihre Mutter. »Außerdem ist es ja keine Trennung für immer. Wir kommen nach, sobald das nächste Schiff nach Neusüdwales fährt. Du —« Sie unterbrach sich, als der Sergeant Major die Liste mit den Namen zusammenrollte und drohend sagte: »Beeilen Sie sich, denn eines ist sicher, gewartet wird nicht. Und Ihre Ehemänner sind schon an Land, wenn Sie drankommen.«
»Hast du gehört?« fragte Elspeth.
»Ja, Mama, ich hab es gehört«, meinte Jessica kleinlaut. Ihr Herz schlug wie rasend. Die Fahrt nach Port Jackson würde, wie sie wußte, etwa ein halbes Jahr lang dauern. Und es war eine herrliche Aussicht, ihren Stiefvater ein halbes Jahr lang nicht mehr zu sehen. Sie biß sich auf die zitternde Unterlippe. Dann sagte sie: »Wenn du dafür bist, Mama, dann versuch ich mich zu verstecken. Wenn du —«
»Sei still!« flüsterte ihre Mutter. »Er kommt. Tu so, als ob du deine Sachen zusammenpackst. Ich spreche mit ihm und zerstreue seine Bedenken, falls er welche hat.«
Jessica gehorchte, aber als die große Figur ihres Stiefvaters herankam, geriet sie in Panik und wollte wegrennen ... Irgendwie nahm sie sich zusammen und packte ihre und die Kleider ihrer Mutter in einen hölzernen Koffer. Die kleine Flora schaute ihr von der oberen Koje aus schweigend zu. Sie hatte die Ankunft ihres Vaters noch nicht bemerkt, aber Janet rannte mit ausgestreckten Armen auf ihn zu. Duncan Campbeils strenges Gesicht entspannte sich. Er beugte sich herunter und wiegte sie in seinen Armen, das Abbild eines liebenden Vaters mit seinem Kind.
Jessica fühlte wieder ihre ganze Abneigung bitter in sich hochsteigen, und als er Janet in ihre Koje setzte, schaute sie nicht auf, weil sie Angst hatte, seinem Blick zu begegnen.
»Deine Mutter hat gesagt, daß du deine Lektion gelernt hast, Jessie. Ich hoff, daß das stimmt, oder wir kriegen Schwierigkeiten. Ich muß jetzt mit meinen Männern an Land gehn. Sieh zu, daß du rechtzeitig fertig wirst!«
Sie hielt den Kopf weiter gebeugt und war sich seines Mißtrauens bewußt. Er wagte es nicht, sie vor den anderen Frauen und Kindern zu schlagen, aber er packte sie schmerzhaft an der Schulter.
»Haste verstanden, was ich dir gesagt hab«, herrschte er sie an.
»Ja, natürlich«, murmelte Jessica. Sie faltete gerade ein Kleid ihrer Mutter zusammen und verbarg ihr Gesicht dahinter.
»Ja, Vater. Sag das, du verdammtes Luder!«
Sie stammelte das verhaßte Wort in das Kleid ihrer Mutter hinein, und er war zufrieden. Sie hörte erleichtert, wie sich seine schweren Tritte entfernten, und als sie das Kleid in den Koffer legte, kam ihre Mutter atemlos und mit weißem Gesicht heran.
»Du wirst dich sehr gut verstecken müssen, Jessie«, warnte sie. »Er sagt, daß er einen Mann an der Luke aufstellt, um sicherzugehen, daß du das Schiff verläßt.«
»Ich versteck mich schon gut«, versprach Jessica und fühlte sich entschlossen und mutig. »Ich versteck mich da, wo niemand auch nur im Traum daran denkt, mich zu suchen.«
Als zwei Stunden später der Befehl erfolgte, daß alle sich an der Ausstiegsluke versammeln sollten, verließ Jessica mit den anderen den Raum. Nach dem Anwesenheitsappell erwies sich die Flucht als leichter, als sie sich vorgestellt hatte. Sie drückte ihrer Mutter kurz die Hand und stahl sich dann unbemerkt davon, während die Frauen mit ihren Kindern und ihrem Gepäck aufgeregt die Boote bestiegen.
Niemand hielt sie auf, als sie die Treppe zum höher gelegenen Deck hochstieg. Mit klopfendem Herzen öffnete sie eine Kabinentür nach der anderen. Die ersten vier Kabinen waren offensichtlich belegt.
In der fünften aber lag kein Gepäck. Jessica versicherte sich, daß niemand sie sah, schlüpfte in die Kabine und schloß die Tür hinter sich. Vom Bullauge aus konnte sie zur Ausstiegsluke hinunterschauen. Sie preßte ihr Gesicht gegen das Glas und schaute zu, wie drei Boote mit Frauen und Kindern langsam wegruderten. Die Tränen schossen ihr in die Augen, als sie ihre Mutter erkannte, die die kleine Flora auf den Knien hielt.
Später — sie hatte das Zeitgefühl völlig verloren und wußte nicht, wie lange es gedauert hatte — sah sie zwei der Boote zurückkommen. An den Lederkoffern und den kostbaren, messingbeschlagenen Kisten erkannte Jessica, daß es sich um das Gepäck des neuen Gouverneurs handeln mußte. Kurz darauf konnte sie auch die gedrungene Figur eines Offiziers mit grauen Schläfen ausmachen, der eine mit Goldlitzen verzierte scharlachrote Uniform trug. Das mußte Colonel Macquarie sein, sagte sich Jessica und war weniger beeindruckt, als sie das erwartet hätte. Links und rechts von ihm saßen zwei mit schwarzen Umhängen bekleidete Damen. Die ältere war vielleicht Anfang Vierzig, sie hatte ein rundes gutmütiges Gesicht. Ein paar Strähnen kupferroten Haares lugten unter ihrem Hut hervor, den sie unter dem Kinn festgebunden hatte.
Die jüngere Dame — sie war höchstens ein paar Jahre älter als sie selbst — war schlank und hübsch und trug einen Hut, der im Vergleich zu dem der älteren Frau sehr elegant war. Das Schiff legte an, und Jessica wurde sich plötzlich bewußt, in welch schwieriger Lage sie steckte. Die Kabine, in der sie sich versteckte, war zwar noch nicht belegt, aber das würde nicht mehr lange so bleiben ... Jessicas Herz raste vor plötzlicher Aufregung. Wenn sie gefunden würde, würde die Zeit noch ausreichen, an Land gebracht zu werden, denn das Schiff hatte noch nicht den Anker gelichtet. Sie ging zur Kabinentür und öffnete sie lautlos. Vom Achterdeck ertönten Hochrufe, mit denen das Regiment den neuen Kommandeur empfing. Die Empfangsfeierlichkeiten würden noch eine Zeitlang dauern, aber würde sie es schaffen, unbemerkt in ihr altes Quartier zurückzukommen? Und wenn sie es schaffte, konnte sie sicher sein, daß keine der Frauen ihre Rückkehr melden würde? Es gab ja immer ein oder zwei Frauen, die aus reiner Bösartigkeit andere Leute in Schwierigkeiten zu bringen versuchten ...
Jessica biß sich auf die Lippen, nahm all ihren Mut zusammen und ging los. Aber plötzlich trat ihr ein Offizier entgegen.
Sie blieb mit angstvoll aufgerissenen Augen stehen und schaute in das ernste Gesicht von Captain Antill. Als er sie erkannte, schüttelte er verwundert den Kopf und sagte: »Jessica India! Verdammt noch mal, ich dachte, daß du mit deiner Familie an Land gegangen wärst!«
Sie starrte ihn in sprachloser Verzweiflung an. Dann flüsterte sie: »Ich konnte nicht ... ich konnte nicht mit ihm an Land gehen, Sir ... ich konnte einfach nicht.«
»Ja«, sagte er verständnisvoll. »Vielleicht konntest du das nicht.« Jessica sah ihm an, daß er angestrengt nachdachte. Schließlich öffnete er die Tür der Kabine, neben der er stand und bat sie, einzutreten.
»Das ist meine Kabine, mein liebes Kind. Du kannst hierbleiben, bis wir den Anker gelichtet haben, das wird in weniger als einer Stunde der Fall sein. Kann ich mich darauf verlassen, daß du dann unverzüglich in das Quartier der Frauen zurückgehen wirst?«
Jessica versprach es ihm, bedankte sich und weinte vor Erleichterung.
Der junge Captain schaute sie lächelnd an und sagte: »Ich werde alles für dich tun, was in meiner Macht steht, India. Mrs. Macquarie braucht ein Mädchen — wenn ich dich empfehlen würde, wärst du bereit, in ihre Dienste zu treten?«
»Aber selbstverständlich, Sir«, schluchzte das junge Mädchen. »Wie soll ich Ihnen nur danken?«
Am nächsten Morgen segelten die Dromedary und die Hindostan bei gutem Wind durch den Kanal, und Jessica trat in die Dienste der rothaarigen Dame mit dem etwas auffälligen Hut. Sie konnte ihr Glück kaum fassen.
Nach einer ereignislosen Reise von über zwei Monaten gingen die Schiffe am 6. August 1809 in Rio de Janeiro vor Anker. Mrs. Macquaries Kammerzofe Mary Jones kündigte und wurde an Land gerudert — es wurde gemunkelt, um einen Soldaten des 73. Regimentes zu heiraten, der sich kurz nach der Ankunft von der Dromedary davongemacht hatte.
Jessica wurde gefragt, ob sie den Posten von Mary Jones übernehmen wolle. Sie tat es gern, und ihr wurde ausgerechnet die Kabine zugewiesen, in der sie sich vor zwei Monaten versteckt hatte.
In Rio hörte sie zum erstenmal von dem entmachteten Gouverneur von Neusüdwales und von der Rebellion des Militärs, die dort offenbar stattgefunden hatte. Während sie das glänzende Haar ihrer Herrin bürstete, die auf Einladung eines portugiesischen Prinzen die Oper besuchen wollte, hörte sie Mrs. Macquarie von zwei Besuchern erzählen, die am Nachmittag an Bord gekommen waren, um dem neuen Gouverneur ihren Respekt zu erweisen.
»Der zierliche weißhaarige Mann war Dr. Jamieson, und sein Begleiter war Dr. John Harris. Der zeigte uns Zeichnungen von dem herrlichen Haus, das er in Sydney besitzt. Die beiden haben sich offenbar erfolgreich in Handelsgeschäften engagiert, und nach ihrer eigenen Aussage waren beide an der Rebellion gegen den letzten Gouverneur beteiligt.« Elizabeth Macquarie machte eine Pause und zog ihre feingeschwungenen Augenbrauen nachdenklich zusammen. »Sie berichteten Colonel Macquarie, daß Captain Bligh ein grausamer Tyrann war, der um des Gedeihens der Kolonie willen entmachtet werden mußte. Er hat auch sein Versprechen gebrochen, nach England zurückzukehren, damit die Wahrheit vor einem dortigen Gericht aufgedeckt werden kann. Es scheint, daß Mr. Bligh auf einem Königlichen Schiff, das ihn nach England bringen sollte, nach Tasmanien gesegelt ist! Und seine Tochter, Mrs. Putland, ist ihm treu ergeben.«
Sie lächelte im Spiegel Jessica zu.
»Aber Mrs. Putland muß nach allem, was ich von ihr gehört habe, eine sehr sympathische junge Frau sein. Dr. Harris sagte, daß sie versucht hat, den bewaffneten Truppen den Eingang in das Regierungsgebäude zu verwehren!«
Jessica fühlte Bewunderung für die ihr unbekannte Mrs. Putland in sich aufsteigen.
»Die junge Dame muß ja sehr tapfer sein«, meinte sie.
Elisabeth Macquarie lachte. »Das glauben viele, nicht nur du, Jessica India, Colonel O’Connell scheint von der Beschreibung dieser Frau sehr beeindruckt zu sein ... und Mrs. Putland ist eine Witwe. Ich gebe zu, daß ich mich auf sein erstes Zusammentreffen mit ihr freue und daß auch ich gespannt darauf bin, sie kennenzulernen.«
Die Frau des neuen Gouverneurs stand auf und nahm Jessica die Haarbürste ab. »Ich danke dir, mein Kind, das hast du sehr gut gemacht. Aber jetzt müssen wir uns beeilen. Ich kann doch Seine Exzellenz nicht warten lassen, oder? Hol mein Abendkleid und versuche es so gut zu schnüren, wie Mrs. Jones es immer gemacht hat.«
»Ja, Madame«, antwortete Jessica folgsam. »Ich tu mein Bestes.«
»Davon bin ich überzeugt«, meinte Elisabeth Macquarie freundlich. »Und wer weiß, vielleicht habe ich in dir einen Schatz gefunden, auf den ich nie mehr verzichten will!«
»Das hoffe ich doch, Madame.« Jessica brachte das elegante schwarze Kleid, und ihre Wangen glühten.
Sie fühlte sich so glücklich wie seit ihrer frühen Kindheit nicht mehr, vergegenwärtigte sich genau, wie Mary Jones das Kleid geschnürt hatte, und machte sich eifrig ans Werk.
Es würde noch lange dauern, bis sie am Ziel ihrer Reise in Port Jackson ankämen ... und bis dahin könnte sie noch vieles lernen.
»Das ist jetzt etwas zu eng«, sagte ihre Herrin freundlich. Jessica lockerte die Schnüre und begann von neuem. Sie würde es lernen, mit Gottes Hilfe würde sie alles sehr gut lernen, was von ihr verlangt wurde ...
1
Die Ruder klatschten unregelmäßig in das Wasser des Flusses, und der junge Fähnrich bemerkte, daß die vier Matrosen des Kriegsschiffes Porpoise verschlossen und mürrisch aussahen ... eben wie Männer, denen ihre Arbeit keinerlei Spaß macht.
»Es tut mir leid, Mrs. Putland«, sagte der Fähnrich mit leiser Stimme, weil er sich vorstellen konnte, daß das Verhalten der Mannschaft seinem Passagier nicht gerade angenehm sein würde. Sie war immerhin die verwitwete Tochter des ehemaligen Gouverneurs Bligh. Um ihr sein Mitgefühl und sein Verständnis zu zeigen, legte Richard Tempest seine Hand leicht auf ihre. »Wir sind schon alle zu lang hier, Madam. Es ist schwer, die Moral der Männer aufrechtzuerhalten.«
»Das weiß ich, Mr. Tempest«, meinte Mary Putland. »Sie müssen sich deshalb nicht bei mir entschuldigen.«
Sofort beim Betreten des Bootes hatte sie die schlechte Stimmung der Matrosen bemerkt, und nach acht Monaten frustrierenden Nichtstuns auf dem Schiff, konnte sie die Verstimmung der Leute sehr gut nachempfinden.
Nur die Loyalität für ihren Vater hielt sie noch aufrecht. Aber sie war froh, nach einem wochenlangen Besuch in der Residenz des stellvertretenden Gouverneurs Colonel David Collins jetzt auf das Schiff ihres Vaters zurückkehren zu können, obwohl Hobart wunderschön gelegen war und ein angenehmes Klima hatte.
Aber die Stadt würde sie immer an das Exil erinnern, das sich sehr bald trotz der scheinbaren Freiheit hier als ein Gefängnis herausgestellt hatte. Und Colonel Collins würde mit seiner Geliebten immer ein Feind bleiben, obwohl er sie sehr freundlich empfangen hatte. Er war ganz einfach deshalb ein Feind, da er sich mit den Rebellen in Sydney verbündet hatte, die am 26. Januar 1808 mit dreihundert Soldaten das Regierungsgebäude gestürmt und den Gouverneur entmachtet und unter Arrest gestellt hatten.
Sie hatten ihn zwar nicht umgebracht, ihn aber der quälenden Erniedrigung des Hausarrests ausgesetzt, der langsam seine Selbstwürde und seinen Stolz untergraben hatte. Als Colonel Foveaux ihm nach einem Jahr ein Königliches Schiff angeboten hatte, mit dem er nach England zurückkehren sollte, hatte sich ihr Vater entschieden, stattdessen nach Hobart zu segeln, um dort Hilfe und Unterstützung gegen die Rebellen zu suchen. Als von der heimatlichen Regierung offiziell eingesetzter Gouverneur konnte er diese Hilfe von einem loyalen stellvertretenden Gouverneur nach Recht und Fug erwarten. Aber Mary preßte ihre Lippen ärgerlich aufeinander — Colonel Collins hatte die Stirn gehabt, ihrem Vater glattweg die Hilfe zu verweigern.
»Entschuldigen Sie, Madam ...«, sagte Fähnrich Tempest, und Mary schaute ihn fragend an. Er deutete zum Gipfel des Mount Table hin, der hinter Wolken verschwand. Mary Putland war lange genug hier gewesen, um zu wissen, was das bedeutete, und schon kräuselten die ersten starken Windstöße das bis dahin spiegelglatte Wasser des Flusses. Solche Stürme dauerten niemals lange, aber für ein kleines Ruderboot konnten sie schlimme Folgen haben.
»Erreichen wir noch das Schiff, bevor es losgeht, Rick?« fragte sie angespannt und sprach den jungen Offizier bei seinem Vornamen an. Sie verbesserte sich schnell und fügte hinzu: »Mr. Tempest?«
Richard Tempest schaute mit zusammengekniffenen Augen zu dem Berg hinüber und schüttelte dann den Kopf. Obwohl er sieben Jahre jünger war als sie, hielt ihn ihr Vater — der mit Lob sonst eher geizte — für einen zuverlässigen Offizier.
»Wenn Sie nicht dabei wären, dann würde ich es versuchen — aber Seine Exzellenz würde mich mit Recht sofort aus seinen Diensten entlassen, wenn Ihnen ein Unglück geschehen würde.« Er richtete sich auf und fügte hinzu: »Wir fahren in die Bucht hier und warten ab, bis der Sturm vorüber ist, Madam. Sicher ist sicher. Los Männer, legt euch in die Riemen, rudert mit aller Kraft!«
Diesmal war es nicht nötig, die Matrosen anzufeuern. Und zu Marys Erleichterung legte das Boot bald darauf im Schutz einer Basaltmauer an. Schon zehn Minuten später fuhr der erste eisige Windstoß über sie hinweg, und die beiden Walfänger, die etwas weiter draußen vor Anker lagen, schaukelten kräftig. Mary atmete erleichtert auf. »Sie haben die richtige Entscheidung gefällt, Mr. Tempest«, sagte sie lächelnd. »Obwohl ich in den letzten Jahren viel Zeit auf Schiffen zugebracht habe, gebe ich zu, daß ich sehr wenig davon verstehe. Und diese plötzlich aufkommenden Stürme sind mir richtig unheimlich.«
Fähnrich Tempest erwiderte das Lächeln. Sie war eine der mutigsten Frauen, die er jemals getroffen hatte, und mit ihrem blassen Gesicht und den leuchtenden blauen Augen auch eine der schönsten.
»Dann können Sie sich ja nicht gerade freuen, wieder an Bord der Porpoise zu gehen, Madam?« fragte der Fähnrich.
»Unter den herrschenden Umständen hätte ich keine Minute länger unter Colonel Collins’ Dach bleiben können«, antwortete Mary Putland ernst. »Und ich versichere Ihnen, ich bedauere es nicht im geringsten, Hobart zu verlassen.« Sie fügte leise hinzu: »Sie haben doch sicher gehört, daß Colonel Foveaux in seinem letzten Brief die Arrestierung meines Vaters verlangt hat?«
»Lieutenant Lord hat es mir erzählt, als ich am Landungssteg auf Sie gewartet habe«, sagte Richard. Er rückte näher und sagte so leise, daß niemand außer Mary ihn verstehen konnte: »Ich glaube, daß wir großen Ärger mit Colonel Collins bekommen, wenn er die Sache mit seinem Sohn erfährt, Madam.«
»Mit seinem Sohn?« wiederholte Mary überrascht und dachte im ersten Augenblick an die Bande lauter, unerzogener Kinder, die er mit seiner Geliebten, einer ehemaligen Sträflingsfrau, in die Welt gesetzt hatte. Dann erinnerte sie sich aber an den fünfzehnjährigen Jungen, seinen Sohn aus erster Ehe, den ihr Vater als Fähnrich an Bord der Porpoise aufgenommen hatte.
Das hatte dem stellvertretenden Gouverneur sehr viel bedeutet, denn der Junge war sein Lieblingskind. Als er ihrem Vater mit kühlen Worten mitgeteilt hatte, daß weder er noch seine Mannschaft in Zukunft an Land gehen dürften, hatte er nicht um eine Ausnahmeregelung für seinen Sohn gebeten, aber an sie hatte er gedacht ... Mary seufzte, als sie sich an seine Worte erinnerte.
»Mrs. Putland kann, so lange sie möchte, mein Gast sein, Captain Bligh«, hatte er gesagt. »Als Gegenleistung werden Sie meinen Sohn so wie jeden anderen Offizier behandeln, der Ihnen dient. Ich möchte alles tun, um ihm eine Karriere in der Königlichen Marine zu ermöglichen.«
»Meinen Sie Colonel Collins ältesten Sohn, Mr. Tempest?« fragte Mary. »Der nach ihm genannt ist ... Fähnrich David Collins?«
»Ja, von dem spreche ich, Madam. Aber mehr — er ist degradiert worden und wird morgen früh zu seinem Vater zurückgeschickt, Madam«, antwortete Richard Tempest. »Der dumme junge Kerl hat sich auf einem Frachter voll laufen lassen.«
»Großer Gott!« rief Mary aus. »Wie kann er so was nur tun! War er im Dienst?«
»Natürlich. Sonst wäre es ja nicht so schlimm gewesen. Ich glaube übrigens, daß der junge Mann es darauf angelegt hatte, gefeuert zu werden. Er ist nicht für den Militärdienst geschaffen, und ich nehme an, daß er ganz einfach keine Lust mehr hatte.«
Mary nickte nachdenklich. Aber sie hatte das Gefühl, daß Fähnrich Tempest ihr nicht alles erzählt hatte und fragte: »Ich hoffe doch, daß er nicht den Unmut meines Vaters auf sich gezogen hat?«
»Ich fürchte, genau das hat er getan, Madam«, gab Richard Tempest zögernd zu. »Der Bursche ist während seines Dienstes eingeschlafen. Seine Exzellenz war mit Captain Porteous auf dem Achterdeck, und die beiden Männer wären fast über ihn gestolpert. Und ob Sie es glauben oder nicht, er hatte noch die Stirn, Widerworte zu geben, als er für sein Verhalten gerügt wurde!«
Mary zog die Stirn kraus. Ganz bestimmt hatte der Wunsch ihres Vaters, daß sie auf das Schiff zurückkommen möge, mit dem Verhalten des jungen David Collins zu tun, und —
Richard Tempest unterbrach ihre Gedanken und sagte: »Aber das ist immer noch nicht alles, Mrs. Putland.«
»Immer noch nicht? Um Gottes willen, Mr. Tempest, etwas Schlimmeres, als Sie mir erzählt haben, kann man sich ja kaum vorstellen!«
Er blickte sie bekümmert an. »Collins wurde zu vierundzwanzig Peitschenhieben verurteilt. Die Strafe ist heute morgen vollstreckt worden, und ich bin — ich bin froh, daß ich nicht dabeisein mußte.
»Er wurde ausgepeitscht? « fragte Mary entgeistert und starrte ihn ungläubig an. »Großer Gott!«
Diese Behandlung des Sohnes, auf den er so große Hoffnung gesetzt hatte, würde Colonel Collins niemals vergessen, dachte Mary und zweifelte zum erstenmal an der Klugheit ihres Vaters, den sie so sehr verehrte. Das Verhältnis der beiden Männer war ohnehin schon sehr kühl gewesen, aber jetzt ... sie holte tief Luft und fragte leise: »Mr. Tempest, hat mein Vater diese Bestrafung angeordnet?«
»Aber nein, Madam«, entgegnete Richard Tempest. »Der Kapitän hat ihn zu der Prügelstrafe verurteilt.«
Mary atmete erleichtert auf. Aber Colonel Collins Reaktion war vorhersehbar. Er würde in seiner Wut ihrem Vater die Schuld für das Vorgefallene in die Schuhe schieben. Und er würde alles daransetzen, das lecke, seeuntüchtige Schiff ihres Vaters aus der schützenden Flußmündung zurück ins offene Meer zu treiben ... am besten gleich ganz zurück nach England, wohin die gesamte Schiffsmannschaft sowieso wollte. Die Ausführung der nötigen Arbeiten an der Porpoise war davon abhängig gemacht worden, daß sich Captain Bligh einverstanden erklärte, den Hafen sofort nach erfolgter Überholung seines Schiffes zu verlassen ... Eine Zusicherung, die er aus guten Gründen nicht gegeben hatte.
Mary fühlte, wie ihr die Tränen in die Augen stiegen und wie sie sich auf die Unterlippe biß, um ihre Haltung wiederzugewinnen. Seit der Rebellion des Neusüdwales-Korps hatte es soviel Lug und Trug, soviel Illoyalität gegeben ... aber was konnte man von diesen eigennützigen Schurken auch anderes erwarten?
Der Bootsführer rief erleichtert aus: »Der Sturm ist vorbei, Sir!«
Richard Tempest beschattete seine Augen und schaute in die Bucht. Der Walfischfänger setzte seine Segel und fuhr los. Die Wolken waren von der schneebedeckten Kuppe des Mount Table so schnell verschwunden, wie sie aufgezogen waren.
Er nickte. »Jawohl«, meinte er erleichtert. »Also los, Männer an die Ruder! Setzt zusammen ein. Zieht!«
Mary zog ihren Umhang enger um sich und schloß die Augen. Sie war mit den Gedanken schon auf dem Schiff, das sie in der Ferne auftauchen sah.
2
Der Morgen des 28. Dezembers 1809 war dunkel und stürmisch.
Während der vergangenen Nacht war ein starkes Gewitter mit Hagelschlag niedergegangen und obwohl der Verband der drei Schiffe, die den neuen Gouverneur nach Sydney brachten, schon vom Südkap aus gesichtet worden war, war es denkbar unwahrscheinlich, wie Justin Broome aus eigener Erfahrung wußte, daß die Schiffe in den Hafen einfahren konnten, bevor sich das Wetter besserte.
Er hatte die Kabine seines eigenen kleinen Schiffes, der Flinders, bei Anbruch der Morgendämmerung verlassen und hoffte, daß er in Robert Campbeils Werft die nötigen Reparaturarbeiten innerhalb von vierundzwanzig Stunden beenden würde. Aber Campbells Arbeiter waren nicht erschienen, und sein Schiffszimmermann, Sammy Mason, hatte mit den Schultern gezuckt und auf die bedrohlich niedrig hängenden Wolken gedeutet.
»Bei diesem Wetter findest du niemanden, der dir hilft, Justin«, hatte er entschieden gesagt. »Das beste ist, du gehst an Land und ertränkst deine Sorgen in Rum, wie alle anderen auch.«
Justin fluchte leise, als er den Stumpf des Schiffsmastes sah. Er war in einem Sturm abgebrochen, als die Flinders Siedler, ihr Getreide und ihr Vieh bei einer Überschwemmung am Hawkesbury gerettet hatte.
Trotzdem hatte Justin es geschafft, seine Passagiere nach Sydney zu bringen und war von ihren nicht enden wollenden Dankbarkeitsbezeugungen überwältigt, da er seine Hilfe für etwas ganz Normales hielt. Obwohl die Siedler nach der Flutkatastrophe vor dem Nichts standen, hatten sie Geld für einen neuen Mast gesammelt. Justin würde nur ein paar Pfund aus seiner eigenen Tasche dazulegen müssen, aber ... er hatte gleich nach dem Abflauen des Sturmes an den Hawkesbury zurückfahren wollen, denn die Rettungsarbeiten waren noch lange nicht beendet. Die Flut war ungewöhnlich hoch gewesen, und das Wasser war in einer einzigen Nacht ohne Vorwarnung gestiegen.
Die Farm seiner Mutter Long Wrekin lag zum Glück hoch genug, und es war unwahrscheinlich, daß die Flut mehr als ein paar Schafweiden und ein paar Acker erreicht hätte. Trotzdem wollte er sichergehen und sich persönlich von dem Wohlergehen seiner Familie überzeugen.
Natürlich hatten außer seinem Schiff auch ein paar andere für die Rettungsarbeiten zur Verfügung gestanden. Der Großteil der Ernte hatte gerettet werden können, aber sicher war viel Vieh auf den Weiden ertrunken.
Als Justin seinen Namen rufen hörte, drehte er sich um und sah, wie Sammy Mason durch den strömenden Regen auf ihn zukam.
»Bist du immer noch da, Justin?« fragte der Schiffszimmermann.
»Ja, wie du siehst.« Justin sprang geübt vom Deck seines Schiffes auf den Landungssteg. »Sind die Männer zur Arbeit gekommen.«
»Nein, und es sieht auch nicht so aus. Komm, wir wollen uns unterstellen, damit wir nicht unnötig naß werden ...« Samuel Mason führte Justin zur Schreinerei, streifte seinen triefenden Umhang ab und schüttelte ihn aus. Dann blickte er Justin mit merkwürdigem Gesichtsausdruck an und sagte: »Jemand will deine Flinders chartern, Justin.«
»Mein Gott, Sammy«, rief Justin aus, »du weißt doch ganz genau, daß ich nichts in dieser Richtung unternehmen kann, bis ich einen neuen Mast habe! Und wenn es soweit ist, dann will ich sofort zum Hawkesbury segeln. Verdammt noch mal, ich —«
»Wart einen Augenblick, mein Junge«, unterbrach ihn Mason. »Du weißt ja noch nicht, wer dein Boot haben will, und warum. Es ist möglich, daß du deine Meinung ändern wirst.«
»Also gut, ich bin ganz Ohr«, meinte Justin vorsichtig. »Wenn es sich um eine Fahrt nach Parramatta handelt, dann kann ich das mit der Nottakelage schon schaffen. Aber —«
»Ich nehme an, daß du auch zum Südkap kommst ... und dahin möchte Colonel Foveaux gebracht werden«, unterbrach ihn Mason.
»Colonel Foveaux — der stellvertretende Gouverneur persönlich?« Justin lachte. »Willst du mich hochnehmen, Sammy? Er hat doch seine eigene Barke ... Warum braucht er dann meine Flinders? Ich habe Schafe und Hühner vom Hawkesbury hierher befördert und hatte noch keine Zeit, das Schiff zu reinigen. Im Laderaum riecht es wie in einem Stall, und ich kann mir nicht vorstellen, daß Colonel Foveaux es lustig fände, wenn er sich die Uniform auf meinem Schiff schmutzig machen würde.«
»Es macht ihm nichts aus, Justin, das hat er mir sogar gesagt. Er muß den neuen Gouverneur so bald wie möglich sprechen, dessen Schiff am Südkap vor Anker liegt, weil es wegen des Sturmes nicht in den Hafen einfahren kann. Und sein eigenes Schiff —« Mason lachte schadenfroh auf und fuhr verächtlich fort — »der Idiot von einem Bootsführer hat es gestern abend nicht richtig festgemacht. Es trieb ab und sitzt jetzt halb gesunken auf einem Riff fest.«
»Wirklich? Nimmst du mich nicht hoch?«
»Ganz bestimmt nicht. Und dem Colonel ist auch gar nicht zum Lachen zumute. Er wartet in meinem Büro dringend auf deine Antwort.« Der Schiffszimmermann deutete mit dem Kopf in die Richtung, aus der er gekommen war. »Er scheint es sehr eilig zu haben, denn er sagte, daß er am liebsten sofort aufbrechen will.«
Justin grinste. »In Ordnung, Sammy, richt ihm aus, daß ich ihn zum Südkap fahre, aber auf seine eigene Verantwortung, und es kostet dreißig Schilling. Ich möchte das Geld sehn, sobald ich am Schiff des Gouverneurs anlege ... falls das überhaupt möglich ist! Ich wecke Cookie Barnes auf und wir können ... sagen wir mal in einer halben Stunde losfahren.«
»Gut mein Junge, ich richt es ihm aus.«
Mason warf seinen Umhang um und ging los. Kurz vor seinem Büro setzte er ein liebenswürdiges Lächeln auf, schüttelte den tropfnassen Umhang ab und trat in den kleinen Raum.
Colonel Joseph Foveaux, der unruhig auf und ab gegangen war, blieb stehen. Er war ein hochgewachsener Mann Mitte Vierzig, der etwas zur Korpulenz neigte. Seine dunklen Augen und die braune Haut verliehen ihm trotz seiner eleganten, vorzüglich geschnittenen Uniform das Aussehen eines Zigeuners ... auf alle Fälle sah er nicht wie ein Engländer aus. Samuel Mason hatte gehört, daß seine Mutter eine Französin und sein Vater ein Aristokrat gewesen sei ... vielleicht einer von denen, dachte er, die während der Französischen Revolution ihr Leben unter der Guillotine gelassen hatten ...
»Nun, mein Guter?« fragte der Colonel. »Haben Sie den jungen Broome dazu gebracht, mich zum Südkap zu fahren?«
»Ja, Sir«, antwortete Mason. »Er war zwar nicht wild drauf, das werden Sie verstehen.« Er berichtete von dem gesplitterte Hauptmast der Flinders, aber Colonel Foveaux winkte ab.
»Ja, ja, ich verstehe. Aber Broome ist doch ein guter Seemann, oder etwa nicht, und sein Boot ist abgesehen vom fehlenden Mast in Ordnung?«
»Ja, Sir.«
»Also, dann ist ja alles in Ordnung!« herrschte Foveaux ihn an. »Wann geht die Fahrt los, und was soll es kosten?«
Samuel Mason lächelte den stellvertretenden Gouverneur an, obwohl er seinen arroganten Ton nicht ausstehen konnte. »Sobald er seinen Matrosen geweckt hat, Sir. Spätestens in zwanzig Minuten, und ... die Fahrt kostet vierzig Schilling. Broome will das Geld in bar ausgezahlt haben, wenn er an der Dromedary anlegt.« Er zögerte und hoffte auf eine Belohnung für seine Bemühungen. Aber Colonel Foveaux dachte gar nicht daran, in seine Tasche zu greifen.
Statt dessen blickte er durch die offene Tür in den strömenden Regen hinaus und fragte: »Haben Sie Ölzeug, Mason, das ich leihen kann?«
»Aber selbstverständlich, Sir«, antwortete Samuel Mason dienstfertig. »Für Sie, Sir, stimmt’s? Oder nehmen Sie sonst noch jemanden mit?«
Er wußte die Antwort schon im voraus, zuckte aber zusammen, als Foveaux ihn anschrie: »Nein, verdammt noch mal!«
»Sie haben mich mißverstanden, Euer Ehren. Ich dachte nur, daß ... nun, Sir, daß Sie vielleicht mehr als eine Jacke wollen, und —«
»Zerbrechen Sie sich nicht den Kopf über Angelegenheiten, die Sie einen Dreck angehen, Mr. Mason«, zischte Colonel Foveaux feindselig. »Nun gut — sagen Sie Broome, daß er sich beeilen soll. Ich komme nach, sobald ich das Ölzeug angezogen habe.«
Zehn Minuten später fuhr die Flinders los, und der alte Schiffszimmermann zischte leise fluchend durch die Zähne, als er an die Arroganz des stellvertretenden Gouverneurs dachte ...
Colonel Foveaux zog sich sofort in die kleine Kabine zurück und blieb dort, bis die Flinders nach einer rauhen, aber ereignislosen Fahrt durch Sydneys von Regen und Wind gepeitschtem Hafenbecken sich den Königlichen Schiffen am Südkap näherte.
»Der Flottenverband, Sir!« rief Justin, erhielt aber keine Antwort. Er zuckte mit den Schultern und rief Cookie Barnes zu: »Klar zur Halse!«
Die Mannschaft der Dromedary war damit beschäftigt, ein zerfetztes Sturmsegel einzuholen und niemand merkte, als die Flinders in der Leeseite des Schiffes anlegte. Erst als Colonel Foveaux an Deck kam, wurde eine Strickleiter an der Luke herabgelassen, und ein Matrose lehnte sich heraus, um Foveaux beim Betreten des Schiffes behilflich zu sein. Sowie er an Bord war, wurde die Luke krachend hinter ihm zugeschlagen.
Justin warf einen Blick auf das Geldstück in seiner Hand, lächelte Cookie Barnes bekümmert an und warf es ihm zu. »Das ist dein Anteil, Cookie ... ich bezweifle sehr, daß ich meinen Anteil jemals bekommen werde.« Mit einem Blick auf die geschlossene Luke fügte er hinzu: »Die sind nicht grade sehr gastfreundlich, oder? Aber —« Cookie Barnes stieß einen Schrei aus. Kurz darauf sah Justin, wie ein Körper im aufgewühlten Wasser aufklatschte und versank. Kurz darauf tauchte ein nach Luft schnappender Mann auf.
»Er lebt!« schrie er Cookie Barnes zu. »Achtung, wir drehen bei!«
Justin wußte, daß es in Sydneys Hafen Haie gab, und er suchte das schäumende Wasser um den schwimmenden Mann herum nach Schwanzflossen ab — aber er konnte keine ausmachen. Das hieß noch lange nicht, daß keine Haie da waren, es hieß nur, daß er sich beeilen mußte, um den Schwimmer zu retten, bevor die Haie angriffen ... wie gefährlich das auch für die nur kaum seetüchtige Flinders wäre. Er hatte mit eigenen Augen Menschen gesehen, die von Haien verstümmelt worden waren ... aber der Rumpf seines Schiffes war stabil gebaut. Er war sicher, daß dem Schiff nicht viel passieren konnte, vorausgesetzt, es würde nicht an die Klippen des Südkaps getrieben.
An die nächsten Minuten konnte er sich später nicht mehr erinnern. Er handelte instinktiv, rief Cookie Befehle zu, die der Mann weder verstand noch brauchte, denn auch er wußte genau, was jetzt zu tun sei.
Wie durch ein Wunder erreichten sie den Marsposten der Dromedary als der Mann noch hilflos im Wasser paddelte. Irgendwie schaffte er es, das Seil zu packen, das Cookie ihm zuwarf. Sie zogen den halb ertrunkenen Seemann an Deck und schoben ihn eilig in die Kabine.
Aber dann verließ sie das Glück. Ein plötzlich aufkommender Sturm trieb das Schiff gnadenlos auf die Klippen beim Südkap zu. Justin versuchte mit aller Kraft das Steuer herumzureißen, aber es war vergebens. Wegen des zerfetzten Notsegels war das Boot manövrierunfähig.
Justin erkannte entsetzt, daß er nichts mehr tun konnte, um das drohende Unheil abzuwenden. Wäre der Notmast nur gebrochen! Aber so hatte der Kutter keine richtige Balance mehr, legte sich in der schweren See wie ein harpunierter Wal auf die Seite und war unfähig, sich wieder aufzurichten. Und Wind und Strömung trugen sie langsam, aber unabwendbar in Richtung der tödlichen Klippen ...
Ein heiserer Schrei ertönte. Und Justin sah zu seinem Entsetzen den Mann, den sie gerettet hatten, ein paar Meter abseits des Wracks im schäumenden Wasser paddeln.