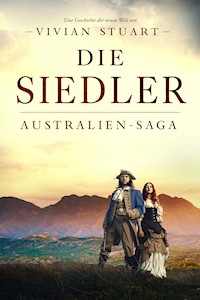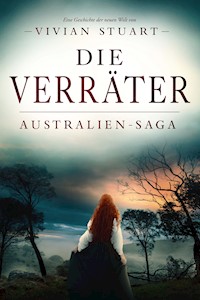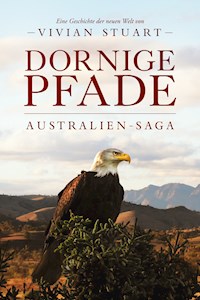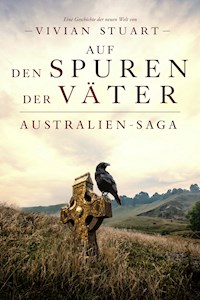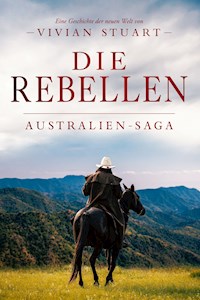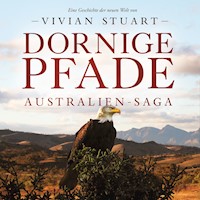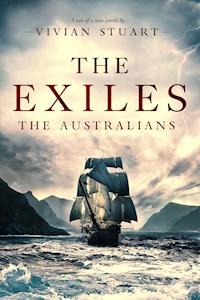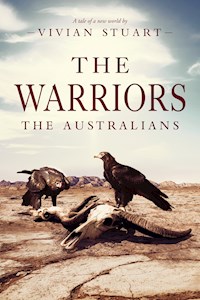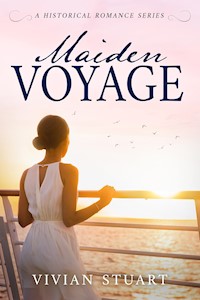Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jentas Ehf
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Australien-Saga
- Sprache: Deutsch
Eine neue Generation von Einwanderern kommt nach Australien: rücksichtslose Abenteurer, die auf der Suche nach Gold sind und das friedliche Zusammenleben in der Kolonie empfindlich stören. Doch die ehemaligen Sträflinge, die inzwischen ehrbare Siedler geworden sind, lassen sich ihren Lebenstraum nicht zerstören: Drei tapfere Männer und eine schöne Frau – Katie O'Malley – nehmen den Kampf auf, um ihre geliebte neue Heimat zu retten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 413
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Abenteurer
Die Abenteurer – Australien-Saga 5
© Vivian Stuart (William Stuart Long) 1983
© Deutsch: Jentas ehf 2022
Serie: Australien-Saga
Titel: Die Abenteurer
Teil: 5
Originaltitel: The Adventurers
Übersetzung : Jentas ehf
ISBN: 978-9979-64-315-9
Prolog
»Murdoch Henry Maclaine, in Anbetracht Ihrer Jugend und der Empfehlung des Hohen Gerichts, in Ihrem Fall Gnade walten zu lassen«, hatte der alte Richter bei der Urteilsverkündung gesagt und den Ernst seiner Worte mit einem knochigen, mahnend erhobenen Zeigefinger unterstrichen, »werden Sie nicht zum Tode verurteilt, sondern statt dessen lebenslänglich in die Strafkolonie von Neusüdwales verbannt. Und«, hatte er mit einem frommen Augenaufschlag hinzugefügt, »ich bitte Gott, daß er Ihnen gnädig sein möge!«
Als er mit den anderen an Armen und Beinen gefesselten Gefangenen in dem schaukelnden Planwagen saß, erinnerte sich Murdoch Maclaine mit großer Bitterkeit an die Urteilsverkündung.
Es stimmte zwar, daß er nicht zum Tode verurteilt worden war. Er war nicht gehängt worden wie der arme alte Sep Todd und wie Dickie Farmer, seine beiden Komplizen bei dem mißglückten Raubüberfall auf die Londoner Postkutsche. Aber ... er zog seine dunklen Augenbrauen zusammen. Zu was für einer Art von Leben war er verurteilt worden? Von ein paar Mitgefangenen hatte er gehört, daß das Leben in Botany Bay für einen Sträfling die Hölle auf Erden sei.
Für seine Mutter, Jessica und die beiden Kleinen war es sicher etwas anderes. Sie waren mit dem 73. Infanterieregiment unter Colonel Lachlan Macquarie, dem Gouverneur der Strafkolonie, vor fünf Jahren dorthin aufgebrochen. Soviel er wußte, lebte seine Familie noch immer in Sydney, zusammen mit seinem brutalen Stiefvater — Sergeant Major Duncan Campbell —, der ihm das Leben so schwer gemacht hatte, daß er von zu Hause durchgebrannt war.
Er hatte vorgehabt, seiner Familie früher oder später zu folgen, aber, bei Gott, nicht als ein zu lebenslänglicher Verbannung verurteilter Sträfling in Ketten! Diese Schande würde seiner Mutter das Herz brechen. Sie war immer eine stolze Frau und bemüht gewesen, ihn und seine Schwester Jessica zu ehrlichen, gottesfürchtigen Menschen zu erziehen. Es würde für sie einen großen Schock bedeuten, wenn sie erführe, daß ihr einziger Sohn als Straßenräuber vor Gericht gestellt und abgeurteilt worden war.
Die Zusammenarbeit mit der Bande von Nick Vincent hatte Murdo viel Geld eingebracht, und er bedauerte eigentlich nicht, daß er sich darauf eingelassen hatte. Nick war immer freundlich zu ihm gewesen, hatte ihm eine Wohnung und Arbeit verschafft — am Anfang hatte er für fünf Schilling in der Woche als Pferdeknecht bei ihm gearbeitet. Und damals, als er als knapp fünfzehnjähriger Junge mitten im kalten Winter von zu Hause ausgerissen war, war diese Anstellung ein großes Glück für ihn gewesen.
Anfangs hatte er auf den Straßen Glasgows gebettelt, und vor einer Kneipe hatte er Nick Vincent kennengelernt, der mit dem halberfrorenen und halbverhungerten jungen Mann Mitleid empfand und ihm Arbeit anbot.
»Ich kann jemand brauchen, der mit Pferden umgehen kann«, hatte er gesagt und dann lächelnd hinzugefügt: »Allerdings nur, wenn er nicht zu viele Fragen stellt und den Mund halten kann. Bist du dazu bereit, mein Junge?«
Er hatte ohne zu zögern zugestimmt, nach nichts gefragt und nichts ausgeplaudert. Selbst als er nach kurzer Zeit begriff, welchen Tätigkeiten sein Dienstherr nachging, hatte er weiter für ihn gearbeitet, und ein Jahr später — als er fast siebzehn war — wurde er von Nick als vollgültiges Mitglied in seine Räuberbande aufgenommen.
Die Bande war gut organisiert, die Raubüberfälle wurden genau geplant und professionell durchgeführt. Aber in der Nacht bevor er mit Todd und Farmer die Londoner Postkutsche außerhalb von Winchester ausraubte, war Todd unvorsichtig gewesen. Er hatte beim Abendessen in einer Wirtschaft zuviel geredet. Ein Informant hatte alles ausgeplaudert, und deshalb waren sie auf frischer Tat geschnappt worden ... Todd und Farmer waren inzwischen längst tot.
Während er ... Murdo seufzte unglücklich auf. Er war gefesselt wie ein wildes Tier, wurde nach Portsmouth oder Southampton verfrachtet, und es stand ihm eine sechs Monate lange Schiffsreise ins Ungewisse bevor. Zwar besaß er einen beachtlichen Notgroschen, den Nick für ihn verwahrte und der ihm zukommen sollte, bevor der Sträflingstransport den Anker lichtete.
Er hoffte, daß Nick sein Versprechen halten würde. Nick Vincent hatte bisher immer sein Wort gehalten, seine Männer immer fair behandelt und dafür gesorgt, daß ihre Witwen und Familien eine ausreichende Unterstützung erhielten, wenn jemand von ihnen erwischt und hingerichtet worden war.
Bei einem kurzen Besuch im Gefängnis von Winchester hatte Nick angedeutet, daß er den Planwagen mit den Sträflingen aufhalten wollte, wenn er sicher sein könne, daß Murdo sich darin befände. Der kleine Halunke von Wärter war damit einverstanden gewesen, das genaue Abfahrtsdatum weiterzugeben, aber es konnte auch sein, daß er das Bestechungsgeld nur eingesäckelt und sonst nichts unternommen hatte. Aber —
Murdo beugte sich vor, als er Pferde herangaloppieren hörte und schöpfte neue Hoffnung.
Ein Pistolenschuß krachte, und sein Herz schlug schneller, als er Nicks lauten Befehl hörte: »Stehenbleiben und Hände hoch! Wir sind an Ihrer Ladung interessiert. Keine Bewegung, oder Sie sind ein toter Mann!«
Der Wagen blieb knirschend stehen. Der Kutscher saß mit zwei Wärtern ungeschützt auf dem Kutschbock. Seine Stimme zitterte, als er rief: »Um Gottes willen, nicht schießen, Mister! Wir sind unbewaffnet und machen Ihnen bestimmt keinen Ärger!«
»Dann runter vom Bock«, befahl Nick. »Und zwar alle — und Hände hoch! Und Joss, durchsuch sie auf alle Fälle nach Waffen.«
»Die ham nich mal ’n Messer«, meldete ein Mann. An der tiefen Stimme erkannte Murdo, daß es Joss Gifford sein mußte, Nicks rechte Hand. Murdo versuchte aus dem kleinen Fenster zu schauen, aber er konnte sich in seinen Ketten kaum rühren, und der Mann neben ihm hielt ihm den Mund zu.
»Sei still, du Idiot«, zischte er. »Halts Maul, bis wir wissen, was die überhaupt wollen!«
»He, du!« rief Nick und sprach offenbar einen der Wärter an.
»Rein in den Wagen mit dir und laß sie alle raus, so schnell wie möglich! Wie viele Männer sind drin?«
»Vierundzwanzig, Sir. Aber sie ...«
Nick unterbrach ihn. »Etwas plötzlich«, befahl er. »Ich will, daß alle aussteigen und sich hier vor mir aufstellen, verstanden? Aber die Fesseln bleiben dran, bis ich was anderes sag.«
Einen Augenblick später knirschte der Schlüssel im Schloß, und die vergitterte Wagentür sprang auf. Murdos Mitgefangene, die bisher völlig überrascht geschwiegen hatten, begriffen plötzlich, daß sie unerwartet die Freiheit wiedergewinnen sollten, und fingen wie wild zu johlen an.
Nick schrie sie an: »Ruhe, ihr verdammten Idioten! Ruhe, hab ich gesagt! Ihr seid frei, wenn ihr das tut, was ich euch sage. Raus jetzt, so schnell ihr könnt, ich will alle sehen. Murdo, mein Junge ...« Sein schroffer Ton veränderte sich. »Bist du da?«
»Ja, hier bin ich!« rief Murdo aufgeregt. Der Mann neben ihm stand schon, und Murdo sprang auf die Tür zu, so schnell es seine Beinketten ihm erlaubten.
Der Hüne Joss Giffort stand in einiger Entfernung bereit. Hinter ihm saßen drei maskierte Männer mit gezückten Pistolen auf ihren Pferden. Murdo erkannte sie trotz ihrer Masken und strahlte Nick glücklich an.
»Gott vergelt’s dir! Das vergess ich dir nie, Nick, solange ich leb.«
»Is schon gut, mein Junge«, wehrte Nick ab. Dann deutete er auf Murdo und sagte ungeduldig zu einem der beiden Wärter: »Den hier wollen wir haben. Nimm ihm die Ketten ab, und zwar ein bißchen plötzlich!«
Murdo streckte seine gefesselten Hände aus, und der Wärter befreite ihn vor Angst zitternd von seinen Handschellen. Joss grinste hinter seiner Maske, zog einen zusammengelegten Umhang aus seiner Satteltasche und warf ihn Murdo zu.
»Leg den um, mein Junge«, sagte er. »Und dann steig aufs Pferd. Nick hat Kleider für dich, aber wir wollen uns nich länger hier aufhalten, als es unbedingt nötig ist. Wenn wir erst mal ’n Stückchen weiter weg sind, kannst du deine Gefängniskleidung ausziehen.«
Als auch die anderen Gefangenen frei waren, riet Nick ihnen, den Kutscher und die beiden Wärter zu fesseln, ihnen aber sonst kein Leid anzutun, und er fügte hinzu: »Das rat ich euch in eurem eigenen Interesse, denn sonst kommt ihr bestimmt nicht mit dem Leben davon, falls ihr geschnappt werdet.« Ohne ein weiteres Wort wandte er sich ab und galoppierte, von seinen Männer gefolgt, davon.
Nach einer Straßenbiegung bog Nick von der Straße ab, ritt im Schritt an einem Feldrain entlang und zügelte sein Pferd hinter einer Gebüschgruppe. Hier konnten die Reiter von der Straße aus nicht gesehen werden, und Nick sagte kurz: »So, jetzt zieh die Gefängniskleidung aus, Murdo, und zieh das hier an.«
Murdo ließ sich das nicht zweimal sagen. Kurze Zeit später erinnerte nur noch sein geschorener Kopf daran, daß er ein geflohener Sträfling war. Er drückte sich den Dreispitz auf den Kopf, den Nick ebenfalls besorgt hatte, und sprang wieder aufs Pferd. »Wohin geht’s, Nick?« fragte er, als der Anführer weiter querfeldein ritt.
»Nach Bucks Oak«, antwortete Nick kurz. »Und nach Alton Arms, wo ich für dich was organisiert hab, damit du für ’ne Zeitlang untertauchen kannst.«
Dann schwieg er mit verschlossenem Gesichtsausdruck, und Murdo begriff, daß er nichts weiter sagen wollte.
»Murdo!« rief ihm Joss Giffort von hinten zu und bedeutete ihm, sein Pferd zu zügeln. Als beide Seite an Seite am Ende der kleinen Reitergruppe dahinritten, sagte der ältere Mann leise: »Wir reiten nach Hinton Marsh, mein Sohn, und ich nehm an, daß Nick die ganze Nacht durchreiten wird. Er hat sich was für dich ausgedacht, aber ich glaub kaum, daß es dir gefallen wird. Aber ich find, du schuldest ihm blinden Gehorsam, Murdo. Er hat dich davor bewahrt, als Verbannter nach Botany Bay geschickt zu werden, deshalb steilste in seiner Schuld, oder?«
»Ja, das stimmt«, entgegnete Murdo überzeugt. Aber er fühlte sich nicht mehr ganz wohl in seiner Haut und blickte Joss an. »Weißt du, was er mit mir vorhat?«
»Ja, mein Junge. Aber ich werd’s dir nich erzählen — das geht mich ja nix an. Ich wollt dich nur ’n bißchen vorwarnen.«
»Danke«, meinte Murdo. Vielleicht hatte Nick vor, ihn in den Norden zu schicken, bis Gras über die Sache gewachsen war.
Aber was immer Nick auch geplant hatte, er würde ihm natürlich gehorchen; auf alle Fälle hatte er ja seinen Notpfennig und seine Freiheit. Und wenn Nick mit seiner Bande in den Norden ziehen würde, dann könnte er ja wieder zu ihm stoßen.
Aber es nützte nichts, sich jetzt Gedanken zu machen. Nick würde ihm schon sagen, was er mit ihm vorhatte, wenn der richtige Zeitpunkt dafür gekommen war. Um ihn zu befreien, hatte er den Gefangenentransport überfallen und damit ein großes Risiko auf sich genommen. Murdo lächelte Joss an.
»Ich tu, was immer Nick von mir verlangt, Joss.«
»Bist ’n guter Junge«, meinte Joss anerkennend. »Ich hab mir schon gedacht, daß du so reagieren wirst.« Er nickte, gab seinem Pferd die Sporen und ritt nach vorne zu Nick.
Wie er vorhergesagt hatte, ritten sie die ganze Nacht hindurch, und stiegen nur einmal an einer abgelegenen Wirtschaft ab, um den Pferden Wasser zu geben und selbst etwas zu essen. Nick mied die großen Straßen, Dörfer und Städte. Der Trupp kam erst am Mittag des nächsten Tages in Bucks Oak an. Im Stall der Wirtschaft versorgte Murdo zusammen mit Liam O’Driscoll die erschöpften Pferde und wartete darauf, daß Nick ihn zu sich rufen würde. Knapp eine Stunde nach ihrer Ankunft war es soweit. Als er die Wirtsstube betrat, wohin Nick ihn gebeten hatte, blieb er überrascht stehen, als er Nick mit zwei uniformierten Fremden am Tisch sitzen sah.
Es waren Königliche Rotröcke, Sergeants mit goldenen Rangabzeichen an ihren Uniformjacken — Rekrutenanwerber. Murdo wußte sofort, was da gespielt wurde. Nick stand auf, legte ihm einen Arm um die Schulter und führte ihn in die andere Ecke des Zimmers.
»Du willst, daß ich Soldat werde?« flüsterte er mit zitternder Stimme.
Nick nickte. »Ja, mein Junge, so kann man’s ausdrücken. Verstehste, du bist jetzt ’n Risiko für uns, und in ’n paar Stunden wirste überall gesucht. Die fangen ’n paar von den anderen Gefangenen ein, und diese Idioten werden aus Schiß alles über dich erzählen, was sie wissen. Du mußt irgendwo sicher untertauchen, Murdo.«
»Aber die Armee«, sagte Murdo bitter.
»Da wird niemand nach dir suchen. Ich schwör’s dir, daß es der einzige Ort ist, wo sie dich nicht vermuten!« Dann fuhr er fort: »Du weißt ja, wie gern ich dich hab — du bist wie mein eigener Sohn, und es fällt mir sehr schwer, mich von dir zu trennen. Aber ’s is ja nich für immer, und der Krieg is vorbei. Das is jetzt ’n ganz bequemes Leben bei der Armee — da kannst du ’ne wirklich ruhige Kugel schieben.«
»Bei der Armee wird nie ’ne ruhige Kugel geschoben«, protestierte Murdo. Als Kind eines Soldaten hatte er seine Jugend in Kasernen verbracht und wußte nur zu gut, was für eine harte Disziplin dort herrschte. War er nicht deshalb von zu Hause geflohen, weil sein Stiefvater Duncan Campbell ihn so behandelte, wie man gemeine Soldaten behandeln würde? Er versuchte es zu erklären, aber Nick unterbrach ihn ungeduldig.
»Auf alle Fälle ist es besser als Botany Bay. Und du brauchst nicht zu kämpfen.«
»Das stimmt vielleicht. Aber trotzdem würd ich alles lieber tun, als Soldat zu werden. Nick, ich ...«
»Murdo, Murdo!« sagte Nick unglücklich. »Wo ist deine Loyalität geblieben, deine Dankbarkeit? Willst du uns alle in Gefahr bringen? Joss und mich, uns alle ... Deine Freunde, oder ... ? Wir sind ’n großes Risiko eingegangen, um dich zu befrei’n, denk daran, mein Junge!«
»Das tu ich doch«, meinte Murdo kleinlaut. Er schaute zu den beiden Sergeants hinüber, die schweigend vor ihren Bierkrügen saßen und sich nicht für das zu interessieren schienen, was Nick und er miteinander zu bereden hatten.
»Es wird auch nich für lang sein«, meinte Nick. »Sechs Monate, vielleicht sogar weniger, dann interessiert sich kein Mensch mehr für dich. Dann kannste dich rauskaufen und zu uns zurückkommen. Schau, hier ich hab deinen Anteil ausgerechnet, den du noch zu kriegen hast. Is ’n ganz schönes Sümmchen, und ich fänd’s idiotisch von dir, wenn du’s mit zum Militär nimmst. Aber wenn du willst, hinterleg ich’s für dich bei Charley Finn, dem Gastwirt. Er hebt’s dir auf, bis du’s brauchst, oder ich heb’s für dich auf, wie du willst. Du vertraust mir doch, oder?«
»Aber natürlich, Nick. Trotzdem, ich würde ...« Murdo versuchte zum letzten Mal Nick umzustimmen. »Könnt ich nicht in den Norden gehn und mich dort verstecken? In Glasgow kann man doch unbemerkt untertauchen. Ich wäre allein und ...«
»Ohne Freunde würdest du nich bis zur Grenze kommen«, erwiderte Nick so entschieden, daß Murdo sich in sein Schicksal fügte. Der Bandenführer zog ungeduldig seine Stirn kraus und deutete auf die Standuhr. »Wir haben jetzt genug Zeit verloren. Wie steht’s, Murdo? Tust du das, worum ich dich bitte? Denn wenn du’s nicht tust ...« Er sprach die Drohung zwar nicht aus, aber Murdo verstand, was er meinte. Nicks Drohungen durfte man nicht leichtnehmen. Er wußte, daß er nie auch nur einen Pfennig Geld sehen würde, wenn er sich jetzt Nicks Wünschen widersetzte. Der alte Joss hatte recht gehabt, daß er nicht gerade begeistert von Nicks Plänen sein würde. Aber die Armee war tatsächlich besser als eine Strafkolonie in Neusüdwales.
»Nun?« drängte Nick. »Läßt du dich anwerben?«
»Ja«, antwortete Murdo und schluckte.
Nick lachte, packte den jungen Mann am Arm und führte ihn zu den beiden Sergeants. »Hier ist der junge Mann, meine Herren«, verkündete er. »Er ist frei und bereit, in der Armee des Königs zu dienen!«
»Wie heißt du, mein Junge«, fragte der eine und schaute ihn freundlich an.
»Smith, Sergeant«, antwortete Nick. Er warf Murdo einen warnenden Blick zu. »Er heißt Murdoch Smith.«
Der Sergeant schaute Murdoch prüfend an, lächelte dann und zog ihm den schlechtsitzenden Dreispitz vom Kopf. »Er hat ja schon ’nen Armeeschnitt«, meinte er amüsiert und zwinkerte Murdo zu. »Nun, wir fragen nich danach, was gestern war. In welches Regiment willste denn, eh? Kannst dir’s selbst auswählen. Das Zweiundneunzigste in Brüssel kommt in Frage, dann das Zweiundvierzigste und das Einundsiebzigste, dann kannste ins Dreiundsiebzigste gehn oder ins Neunundsiebzigste ...«
Er zählte weiter die in Frage kommenden Regimenter auf, aber Murdo hörte nicht hin. Er könnte ins 73. Regiment eintreten, ins Regiment seines verstorbenen Vaters! Wenn er schon zum Militär mußte, dann wenigstens in dieses Regiment ...
Er richtete sich auf, unterbrach den Sergeant und sagte: »Ich bin bereit, mich vereidigen zu lassen, und ich will ins dreiundsiebzigste Regiment. Und außerdem heiß ich Maclaine, nicht Smith.«
Nick zuckte mit den Schultern und schüttelte den Kopf.
»Geliebte Gemeinde, wir haben uns hier im Namen Gottes versammelt, um die Vermählung dieses Mannes mit dieser Frau zu feiern ...«
Der Priester sprach weiter, aber George De Lancey, der an seines Bruders Seite stand, bemerkte, daß seine Gedanken abschweiften. Es war typisches Aprilwetter. Obwohl ein Regenschauer die Gemeinde eben auf dem Weg zur Kirche durchnäßt hatte, schien jetzt ein Sonnenstrahl durchs bunte Glasfenster hinter dem Altar. Dadurch lag ein leuchtend bunter Lichterteppich auf dem Steinboden vor der Braut, und sie lächelte unter ihrem Schleier, als sie es sah.
Magdalen Hall war eine wunderschöne junge Frau, dachte George de Lancey, und sein Bruder konnte sich glücklich schätzen, ihre Zuneigung errungen zu haben. Er neidete ihm dieses Glück nicht. Sein älterer Bruder war noch immer — wie schon von frühester Jugend an — sein großes Vorbild.
Aber in seinen kühnsten Träumen hatte er sich niemals vorgestellt, es jemals so weit wie William bringen zu können oder sogar noch erfolgreicher zu sein als er. So standen die beiden Brüder vor der Gemeinde, die sich an den gutaussehenden Offizieren und der schönen Braut nicht satt sehen konnte.
Ihre militärische Karriere hätte jedem britischen Offizier in ihrem Alter zur Ehre gereicht, war aber um so bemerkenswerter, als die Brüder gebürtige Amerikaner waren. Sie waren in New York als Nachfahren einer Hugenottenfamilie geboren worden, die nach dem Verdikt von Nantes in die neue Welt geflohen war ...
»William Howe, willst du Magdalen zur Frau nehmen, willst du sie lieben, ehren, und ihr in guten und bösen Tagen zur Seite stehen, bis daß der Tod euch scheidet?«
William bejahte die Frage mit ernster Stimme. Magdalen blickte schüchtern zu Boden, als ihr dieselbe Frage gestellt wurde, dann schaute sie zu ihrem hochgewachsenen Bräutigam auf, eine zarte Röte überzog ihr schönes Gesicht, und sie antwortete leise mit Ja.
Ihr Vater, der grauhaarige Sir James Hall of Dunglass, sprach mit großem Ernst die wenigen Worte, die während der Trauzeremonie von ihm erwartet wurden, und ging dann zur Familienbank zurück, während das junge Paar ernst die Treueschwüre wiederholte, die der Pfarrer ihm vorsprach.
Seltsam bewegt, tastete George in der Tasche seiner gutsitzenden Uniform nach dem Ring. Seine Hand zitterte leicht, als er ihn in das Gebetbuch des Pfarrers legte, und er stellte sich einen Augenblick lang vor, daß seine Jugendliebe Katie O’Malley dort im weißen Hochzeitskleid stünde und ihm gerade ihr Jawort fürs Leben gegeben hätte. Aber Katies Augen waren blau, ihr Haar sah aus wie gesponnenes Gold, und Magdalen, die jetzt die Frau seines Bruders war, hatte braune Augen und glänzendes, dunkles Haar ... die beiden sahen sich wirklich nicht ähnlich. Er war für ein paar Sekunden einem Wunschtraum erlegen.
Er trat zurück, wie der Vater der Braut es getan hatte. William und seine Braut knieten vor dem Altar nieder, und während der alte Pfarrer ein Gebet sprach, dachte er wieder an die Vergangenheit. Während des französisch-englischen Krieges war der tapfere General Le Marchant neben ihm gefallen. Drei Wochen später war er mit Wellingtons Regiment in Madrid eingeritten, unter den begeisterten Vivat-Rufen der spanischen Bevölkerung.
Dann hatte es zwar Rückschläge gegeben, aber er hatte daraus gelernt. Ihm war klargeworden, weshalb lange Gewaltmärsche nötig waren, und ihm hatten die Gründe für sofortige Rückzüge nach Siegen, die ihm bis dahin unverständlich waren, eingeleuchtet.
Während der Predigt schaute George zur Kanzel auf, schloß aber dann seine Augen, weil die alten Erinnerungen sich seiner bemächtigten.
Ja, es hatte während des Krieges Frauen in seinem Leben gegeben — ein paar Spanierinnen, ein französisches Bauernmädchen, die Witwe eines irischen Soldaten, die ihm eine Wunde verbunden und ihn liebevoll gesund gepflegt hatte. Aber die Gesichter der Frauen verschwammen in der Erinnerung, selbst Katies Gesicht sah er nicht mehr klar vor sich. Deutlicher konnte er sich die Gesichter der gefallenen Soldaten vergegenwärtigen — manche waren Freunde gewesen, die meisten aber Fremde — Briten, Deutsche, Portugiesen, die trotz ihrer entsetzlichen Wunden scheinbar friedlich dalagen. An die vielen Schwerverwundeten, die sich bis zum letzten Augenblick noch ans Leben geklammert hatten, wagte er gar nicht zu denken. George atmete schwer.
Der Krieg war vorüber, sagte er sich ... Für William und seine schöne junge Frau ebenso wie für ihn. Napoleon Bonaparte mochte zwar aus Elba geflohen sein, aber die Engländer hatten nichts von den Franzosen zu befürchten, die kriegsmüde waren — genauso kriegsmüde wie er selbst, dachte George.
Sein Einsatz war mit einem Offizierspatent im 2. Dragonerregiment belohnt worden, das sich zur Zeit in Belgien aufhielt, aber er konnte, wenn er das wünschte, wieder Zivilist werden. Er konnte sein Offizierspatent verkaufen, so wie es sein Bruder William jetzt nach seiner Verheiratung beabsichtigte. Da sie gegen Amerikaner gekämpft hatten, konnten sie natürlich nicht nach Amerika zurückkehren, aber England stand ihm ja offen, oder er konnte sein Glück in einer der Kolonien machen. Während er einmal in Lincoln’s Inn zu Mittag aß, hatte er zufällig von einem Tischnachbarn erfahren, daß in der Strafkolonie in Neusüdwales dringend Rechtsanwälte gebraucht würden.
Zwei Brüder, beide Mitglieder des Lincoln Inn, waren als Richter dorthin ausgewandert, bezogen ein ansehnliches Gehalt, der Jüngere der beiden war erst vor kurzem seinem Bruder dorthin gefolgt.
»Jeffrey Bent arbeitete im selben Richterzimmer wie ich«, hatte der Rechtsanwalt erzählt. »Und er hielt mir als Anwaltsgehilfe die armen Teufel vom Leib. Dann wurde sein älterer Bruder zum Militärstaatsanwalt von Neusüdwales berufen, mit einem Einkommen von zwölfhundert Pfund pro Jahr. Und der junge Jeffrey ist inzwischen als Zivilrichter dort tätig, immerhin verdient er achthundert Pfund ... verdammt noch mal, ich wüßte, wo ich hinginge, wenn ich Geld bräuchte. Ob’s nun eine Strafkolonie ist oder nicht, ich würde nach Botany Bay aus wandern!«
George öffnete die Augen und sah, daß die Gemeinde sich inzwischen erhoben hatte und das neuvermählte Ehepaar schon auf dem Weg war, um die Unterschrift im Kirchenbuch zu leisten. Er erhob sich und eilte hinter ihnen her.
William schaute ihn vorwurfsvoll an, aber Magdalen strahlte vor Glück, als sie ihn als den Trauzeugen umarmte.
»Lieber George«, flüsterte sie, als er sie zärtlich in seinen Armen hielt, »es ist einfach wunderbar, daß du jetzt mein Schwager bist.«
Als die Zeremonie beendet war, fuhren sie in der Kutsche von der Kirche zum Schloß Dunglass, wo es ein wunderbares Hochzeitsessen gab und eine Rede der anderen folgte. Als George später seinem Bruder beim Umkleiden half, dankte er ihm sehr.
»Du warst mir eine große Hilfe, lieber George«, meinte William strahlend. »Mach bitte so weiter. In den nächsten drei Wochen wirst ausschließlich du etwas von mir hören, und ich vertraue darauf, daß du dafür sorgst, daß ich nur in den dringendsten Notfällen gestört werde. Das verstehst du doch, oder? Ein Mann heiratet schließlich nicht jeden Tag, und ich habe, weiß Gott, lange genug darauf gewartet, meine süße Magdalen zu meiner Frau machen zu dürfen.«
»Das verstehe ich vollkommen«, versicherte ihm George. »Du wirst nicht gestört werden, das verspreche ich dir.«
Er nahm an, daß das nicht schwierig sein würde, aber schon weniger als zwei Stunden nach der Abfahrt des frisch vermählten Paares rief ihn ein Diener aus dem Ballsaal des Schlosses heraus, wo sich die Gäste inzwischen zum Tanz versammelt hatten.
»Ein Offizier möchte Sir William sprechen, Sir. Ich sagte ihm, daß William und Miss Magdalen — ich meine Lady De Lancey — schon weggefahren sind, und er bat darum, Sie sprechen zu können, Sir. Er sagte, es sei sehr wichtig. Und ...« Der Mann schaute ihn sehr ernst an. »Er sagte, daß er vom Duke von Wellington käme, Sir.«
George fühlte, wie er blaß wurde. Eine Botschaft vom Duke konnte nur eines bedeuten, das wußte er, und der Bote — Lieutenant Henry White vom 32. Infanterieregiment — bestätigte seine schlimmsten Befürchtungen.
»General Ney hat uns betrogen, George — er ist mit seinem gesamten Regiment zu Bonaparte übergelaufen! Der König ist geflohen. Bonaparte zog in Paris ein und wurde von der Bevölkerung mit begeisterten ›Vive l’Empereur!‹ empfangen. Und er hat keine Zeit verloren, um eine neue Armee zu mobilisieren — alle Soldaten, die letztes Jahr nach seiner Abdankung desertiert sind, sind begierig darauf, in einem nächsten Krieg für ihren Helden wieder den Kopf hinhalten zu können. Das behaupten jedenfalls unsere Spione. Ich fürchte, es ist verdammt ernst, Sir.«
Er berichtete weitere Einzelheiten, und George hörte entsetzt und ungläubig zu.
Er war ein Narr gewesen anzunehmen, daß der Krieg vorüber sei, dachte er unglücklich. Und ein noch größerer Narr, zu glauben, daß das stolze französische Volk den Frieden wolle ...
Henry White fügte mit großem Ernst hinzu: »Es geht wieder ganz von vorne los, lieber George. Und Wellington möchte, daß dein Bruder so bald wie möglich in Brüssel antritt. Wenn irgendmöglich schon in einer Woche. Er hat mich gebeten, die Botschaft persönlich auszurichten und alle nötigen Reisevorbereitungen für ihn zu treffen.«
»Er hat heute geheiratet«, sagte George leise.
»Ja, das habe ich gehört. Aber es ist doch sicher möglich, Verbindung mit ihm aufzunehmen, um ihn von den traurigen Neuigkeiten zu informieren?«
George nickte zögernd, und White klopfte ihm freundschaftlich auf die Schulter. »Höre ich Tanzmusik?« fragte er. »Ist der Hochzeitsball schon im Gang?«
»Ja, aber ...«
»Dann sollten wir daran teilnehmen! Wir können den Colonel heute nacht bestimmt nicht mehr erreichen. Also los, mein Lieber!« Henry White lächelte. »Laß uns essen, trinken und fröhlich sein, denn morgen«, er unterbrach sich, und seine Augen glänzten — »morgen müssen wir uns wieder auf den Weg machen und nach militärischen Lorbeeren streben. Aber vielleicht leihst du mir ein sauberes Hemd und Tanzschuhe? Nach dem Ritt von Edinburgh hierher kann ich mich in meiner Kleidung schwerlich den Damen von Dunglass präsentieren.«
»Ich leihe dir mit Vergnügen alles, was du brauchst«, antwortete George unglücklich.
Sir James Halls Dudelsackpfeifer spielte einen fröhlichen Tanz auf, als die beiden jungen Männer den Ballsaal betraten.
»Ich sehe ein paar wahre Schönheiten«, sagte White fröhlich.
»Entschuldige mich, George.«
Und George De Lancey schaute zu, wie der Offizier den Ballsaal durchquerte und auf eine Gruppe von jungen Damen zuging, die sich mit ihren Seidenfächern Kühlung zufächelten. Es waren sehr hübsche Mädchen darunter, dachte George, obwohl kein einziges seiner geliebten Katie O’Malley das Wasser reichen konnte.
Aber er war Gast hier und mußte seine Pflicht tun. Er folgte Whites Beispiel und forderte eine der jungen Damen zum Tanz auf.
1
Nach neun Tagen Sturm mit haushohen Wellen ebbte der Wind ab und drehte nach West. Als der Erste Offizier des Königlichen Kriegsschiffes Kangaroo frühmorgens an Deck kam, um den Ersten Maat in der Wache abzulösen, fühlte er sich sehr erleichtert, als er um sich blickte.
Zwar sahen die dicken grauen Wolken nach Schnee aus, und das Schiff stampfte mühsam durch eine schwere Dünung. Aber es hatte den Sturm gut überstanden, und die wenigen nötigen Reparaturen konnten an Bord ausgeführt werden.
Das Schiff war viele Meilen vom Kurs abgetrieben worden — es war bisher noch nicht möglich gewesen festzustellen, wie weit — aber nach der ungewöhnlichen Kälte und den Eiszapfen in der Takelage zu urteilen, waren es bestimmt zweihundert Meilen.
Rick Tempest schlang sich seinen dicken Wollschal um den Hals. Die Männer der Morgenwache stolperten an ihm vorbei und freuten sich auf die Wärme unter Deck. Seine eigene Wache stellte sich zum Appell auf.
»Das Barometer steigt«, sagte der Navigator Silas Crabbe. Sein knochiges Gesicht war blau vor Kälte, seine Augen rot gerändert. Er sah krank aus, dachte Rick besorgt, obwohl das eigentlich kein Wunder war, wenn man daran dachte, was alles hinter ihnen lag. Nächte, in denen sie praktisch kein Auge zugetan hatten, lange Tage, an denen sie sich am Mast hatten festbinden müssen, um nicht von den tosenden Wellen über Bord geschwemmt zu werden.
Er und Silas Crabbe hatten es am schwersten gehabt, hatten oft stundenlang an Deck ausgeharrt, während der Kommandant der Kangaroo, Captain John Jeffrey, mit seiner Frau kaum jemals seine Kabine verlassen, alle Befehle von dort aus gegeben hatte, und nur selten kurz auf dem Achterdeck erschienen war, um mit einem Blick die Ausführung seiner Befehle zu überprüfen.
Silas Crabbe stampfte mit seinen eiskalten Füßen auf und schickte sich an, unter Deck zu gehen. Er sagte: »In ungefähr ’ner Stunde versuch ich, ’ne Positionsbestimmung zu machen, Mr. Tempest. Wenn der Wind so bleibt wie jetzt, kann’s ja sein, daß die Sonne durchkommt. Aber wahrscheinlicher is, daß es zu schneien anfängt. Aber, was das Wetter uns auch bringt, wir müssen nach Nordosten, damit ...«
Er wurde durch einen Ruf vom Wachposten im Mastkorb unterbrochen. »Backbord kleines Segelboot in Sicht, Sir. Etwa ’ne Meile entfernt. Sieht wie ’n Rettungsboot aus, Sir.«
Ein Rettungsboot in diesen einsamen, wilden Gewässern konnte nur eines bedeuten, dachte Rick. Er griff nach seinem Fernglas und wünschte, daß die Sicht besser wäre. Aber wenigstens schneite es noch nicht.
»Es sind Männer an Bord, Sir«, rief der Wachposten ihm zu.
»Ich seh keine Bewegung an Bord, kann aber erkennen, daß Menschen im Boot liegen. Schwer zu sagen, wie viele! Vielleicht sechs, vielleicht mehr. Aber von ’nem Schiff is weit und breit nix zu sehn.«
Rick suchte mit seinem Fernglas den Horizont ab und konnte die Worte des Wachpostens nur bestätigen. Er seufzte und stellte sein Fernglas auf das Rettungsboot ein, das schräg im Wasser lag. Nichts rührte sich. Vielleicht kam alle Hilfe zu spät. Kurz bevor er das Fernrohr zusammenschieben wollte, entdeckte er plötzlich eine Hand, die sich kurz hob und dann wieder unbeweglich dalag. Also waren doch nicht alle der unglücklichen Leute tot! Er rief dem Steuermann zu, den Kurs zu ändern und auf das Boot zuzuhalten.
»Einer lebt«, sagte er zu Silas Crabbe. »Wir fahren so nah wie möglich heran, ich stelle eine freiwillige Mannschaft für das Achterboot zusammen, und dann holen wir sie an Bord. Und Sie lösen mich hier ab, ja? Und, Mr. Harris ...« Der junge Offiziersanwärter war gleich neben ihm.
»Sir?«
»Gehen Sie zum Captain. Melden Sie ihm, daß wir ein Boot mit Schiffbrüchigen gesichtet haben und daß ich das Achterboot zu Wasser lasse, um sie zu retten. Und dann bringen Sie mir so viele Decken, wie Sie nur auftreiben können.«
Der junge Offiziersanwärter machte sich daran, den Befehl auszuführen, und kam bald darauf mit beiden Armen voll Decken zurück. Er reichte Rick eine Flasche Brandy, auf der die Initialen des Kapitäns zu lesen waren und die, wie er unschuldig meinte, gerade von einem Steward nachgefüllt worden war. »Ich dachte, das könnten Sie gut brauchen, Sir.«
Der Kapitän kam gleich hinterher und vermochte nicht, seinen Ärger zu verbergen. Er war ein kleiner Mann, der zum Dickwerden neigte, und sah viel älter aus, als er war, nämlich erst vierzig Jahre.
Seine leicht aufbrausende, arrogante Art hatte ihn bei den Marineoffizieren und den Matrosen der Kangaroo nicht gerade beliebt gemacht, doch das schien ihm gar nichts auszumachen. Er nahm die Mahlzeiten gemeinsam mit seiner Frau ein, und er hatte noch kein einziges Mal einen Offizier zum Essen eingeladen — eine Nachlässigkeit, die unter den Offizieren natürlich nicht unbemerkt geblieben war.
»Gerechter Himmel, Mr. Tempest!« rief der Kapitän verärgert aus. »Was ist denn das schon wieder für eine Geschichte? Wegen einem Rettungsboot mit Schiffbrüchigen werde ich an Deck geholt! Sie sind doch der Erste Offizier, oder? Können Sie nicht selbst anordnen, was in diesem Fall getan werden muß?«
»Das kann ich schon, Sir«, versicherte ihm Rick. »Und ich hab Sie auch nicht rufen lassen. Mr. Harris sollte Sie nur davon informieren, daß ich beidrehe und ein Rettungsboot ins Wasser lassen würde, um die Überlebenden zu retten. Und ich ...«
Captain Jeffrey unterbrach ihn ungeduldig.
»Sehr gut, sehr gut. Das müssen wir wohl aus reiner Menschlichkeit tun. Aber wir haben keinen Schiffsarzt an Bord, das wissen Sie so gut wie ich. Und ich wage daran zu zweifeln, daß einer von diesen armen Teufeln die Erfrierungen ohne ärztliche Hilfe überleben wird.«
»Das kann schon sein, Sir. Aber wenn auch nur die geringste Chance besteht«, begann Rick, »dann werde ich ...«
»Um Gottes willen, machen Sie nur, Mr. Tempest«, entgegnete der Kapitän kühl. »Ich nehme an, daß Sie das Achterboot kommandieren werden? In Ordnung — ich gehe unter Deck. Erstatten Sie mir Bericht, wenn Sie wieder an Bord sind. Und passen Sie gut auf meine Flasche auf — es ist Silber.«
»In Ordnung, Sir«, sagte Rick mit ausdrucksloser Stimme.
Als das Achterboot zu Wasser gelassen worden war, bemerkte Rick, daß der Seegang stärker war, als er angenommen hatte.
Aber da die sechs Matrosen, die sich freiwillig für das Rettungsmanöver gemeldet hatten, mit aller Kraft ruderten, waren sie schon ein paar Minuten später bei dem Unglücksboot.
»Möchten Sie, daß ich an Bord gehe, Sir?« fragte der Steuermann.
Rick schüttelte den Kopf. »Nein, das mach ich schon, danke.«
Er wartete ab, bis die beiden Boote sich gleichmäßig im Wellengang hoben, sprang dann ins Heck des Rettungsbootes und landete notgedrungenermaßen auf dem Haufen eng zusammengerückter Menschen. Als er unabsichtlich mit der Schulter die Ruderpinne streifte, sah er entsetzt, daß sich eine Hand daran festklammerte. Sie war an der Ruderpinne festgefroren, und als er den Steuermann mühsam auf die Seite drehte, starrten ihn die blicklosen Augen eines höchstens fünfzehn- oder sechzehnjährigen jungen Mannes an.
Sein Körper war eiskalt, und die Totenstarre war schon eingetreten. Rick kroch weiter und fühlte sich vor Mitleid krank. Hinter dem jungen Steuermann lagen fünf weitere Menschen, und er erkannte auf einen Blick, daß alle tot waren. Er dachte bitter, daß Captain Jeffrey recht gehabt hatte ... Man konnte nichts mehr für sie tun, als für sie zu beten und sie wieder der See zu überlassen, die sie getötet hatte.
Aber er erinnerte sich an die erhobene Hand, die er deutlich gesehen hatte. Er hatte es sich bestimmt nicht eingebildet. Und das war erst weniger als eine halbe Stunde lang her — da mußte noch einer am Leben gewesen sein und fähig, das Herannahen der Kangaroo zu bemerken.
Sein Blick blieb an einem Kleiderhaufen hängen, der halb bedeckt von Ölzeug im Bug des Rettungsbootes lag. Mit neuer Hoffnung zog er das Ölzeug zur Seite. Darunter lag, von Mänteln und Hosen bedeckt, jemand, der bestimmt noch lebte. Und als er sich über ihn beugte, hob er eine weiße Hand, als ob er ihn grüßen wollte. Als Rick in das weiße Gesicht des jungen Mannes blickte, dachte er, daß er noch jünger war als der arme Teufel, dessen Hand an der Ruderpinne festgefroren war.
Er hielt ihm die Feldflasche gegen die blauen, zitternden Lippen. »Da, mein Junge«, meinte er ermutigend. »Du bist jetzt in Sicherheit, und bald bist du in einer warmen Kajüte.« Als er zurück im andern Boot war, sagte er erschüttert: »Ein Überlebender, und sechs Menschen sind tot. Wir schleppen ihr Boot zu unserem Schiff, damit sie ein christliches Begräbnis erhalten.« Er deutete auf die Decken. »Zieh dem jungen Mann die nassen Kleider aus, Simmonds, und hüll ihn in die trockenen Kleider ein. Vielleicht können wir ihn noch retten.«
Kurz darauf rief Simmonds erschrocken aus: »Sir! Das is kein Schiffsjunge, das is ’ne Frau — ’ne junge Frau, Sir!« Rick starrte ihn verblüfft an.
»Eine ... Frau, Simmonds?«
»Ja, Sir, ganz bestimmt. Sie hat ’n Nachthemd an. Und sie is ohnmächtig. Ich schaff’s nich, ihr Brandy einzuflößen, Sir. Sie is ja kaum mehr am Leben!«
»Dann müssen wir so schnell wie möglich zurück zum Schiff«, entschied Rick. »An die Ruder! Und zwar mit aller Kraft!«
Als das Boot an der Kangaroo anlegte, beantwortete Rick Silas Crabbes Frage damit, daß er verzagt den Kopf schüttelte. Dann rief er: »Nur noch einer lebt — eine Frau. Wir bringen sie gleich ins Schiff hoch, Mr. Crabbe. Im Rettungsboot waren sechs Tote, melden Sie das dem Captain!«
Als er an Deck stand, fügte er leise hinzu: »Die Providence war ein amerikanisches Handelsschiff aus Boston, das nach Sydney segeln sollte. Das Schiff ging in einem Sturm vor zwei Tagen unter. Ich habe das Logbuch bei mir. Es lag im Rettungsboot.«
Der Zweite Offizier John Meredith und zwei Fähnriche waren an Deck gekommen, um beim Abschluß der erfolgreichen Rettungsarbeit dabeizusein.
»Und es ist wirklich nur noch ein Mensch am Leben?« rief Meredith aus. »Eine Frau?«
»Ja«, bestätigte Rick kurz. »Eine junge Frau. Ich weiß nicht, wer sie ist.« Er blickte Silas Crabbe an. »Haben Sie den Captain informiert?«
»Äh — ich hab ihn informiert, Sir«, rief der Offiziersanwärter Harris mit schriller Stimme. »Er sagt, er würde kommen, und ...«, der Junge unterbrach sich und fügte unnötigerweise hinzu: »Da ist er schon, Sir!« Und während Captain Jeffrey sich von der hinteren Ladeluke her näherte, verdrückte er sich so schnell wie möglich. Die anderen Offiziere verneigten sich vor ihm, aber er ignorierte sie.
»Nun, Mr. Tempest?« fragte er.
Rick richtete sich auf. Mit ausdrucksloser Stimme wiederholte er das, was er Silas Crabbe gesagt hatte.
Jeffrey fluchte. »Großer Gott! Ein amerikanisches Handelsschiff auf der Fahrt nach Neusüdwales — einer britischen Kronkolonie! Verdammt noch mal, da weiß doch jeder, daß die nichts anderes als Alkohol an Bord hatten, oder? Billigen, schlechten Brandy, der mit einem Riesengewinn an die Sträflinge verkauft werden sollte!«
Rick holte tief Luft und sagte: »Entschuldigen Sie, Sir, aber ich möchte die junge Frau so schnell wie möglich unter Deck bringen. Und vielleicht könnte Mrs. Jeffrey ...« Der Captain unterbrach ihn: »Natürlich, lassen Sie die Frau hinuntertragen, Mr. Tempest ... aber in Ihre Kabine, nicht in meine. Meine Frau wird natürlich alles tun, um der Ärmsten so gut wie möglich zu helfen. Aber sie hat keine Erfahrung in Krankenpflege, und ...« Er unterbrach sich und schaute auf die eingemummelte Gestalt der einzigen Überlebenden der Providence, die von Ellis und dem Bootsmann vorsichtig vorbeigetragen wurde. Die Decke über ihrem Kopf rutschte zur Seite. Ein schneeweißes kleines Gesicht kam zum Vorschein, und der Captain rief voller Mitleid aus: »Großer Gott, wie jung sie ist! Fast noch ein Kind!«
»Ja, Sir«, stimmte Rick zu. Er wandte sich an den Steuermann. »Bringen Sie sie in meine Kabine!« Er erinnerte sich daran, daß der Koch über medizinische Kenntnisse verfügte. Er war ein älterer Mann, der während der bisherigen Fahrt sehr erfolgreich die alltäglichen Verletzungen der Matrosen behandelt hatte. »Fragen Sie den alten Bill Onslow, was er für sie tun kann. Ich komme so bald wie möglich selbst hinunter. « Rick griff in die Tasche und reichte dem Captain seine Brandyflasche zurück. »Vielen Dank, Sir. Und hier ist das Logbuch, falls Sie ...«
Jeffrey schien ihn nicht gehört zu haben. Er schaute mit merkwürdig nachdenklichem Gesichtsausdruck zu, wie die sechs erfrorenen Männer an Deck gebracht und dort in einer Reihe niedergelegt wurden.
»Man muß sie nach Ausweispapieren durchsuchen«, sagte er mit gerunzelter Stirn. »Heute nachmittag um fünf halte ich einen Gottesdienst für sie ab, Mr. Tempest ...« Er gab genaue Anordnungen und fügte dann zu Ricks Erleichterung in freundlicherem Ton hinzu: »Mr. Meredith kann Ihre Wache übernehmen, Mr. Tempest. Sie kümmern sich jetzt besser um die unglückliche junge Frau, und — ach ja, ich werde Mrs. Jeffrey bitten, Ihnen bei der Krankenpflege behilflich zu sein. Sie leiht ihr bestimmt Kleider und eine Wärmflasche ... falls das arme junge Mädchen überhaupt noch lebt. Sie wissen nicht, wie sie heißt?«
»Nein, Sir. Die Providence stammt aus Boston. Mehr weiß ich auch nicht.«
Der Captain sagte: »Dann ist sie sehr wahrscheinlich eine Amerikanerin und ganz bestimmt die einzige Überlebende. Nun gut, Mr. Tempest. Welchen Kurs haben Sie steuern lassen?«
»Wir segeln schon seit einer Stunde nach Nordosten, Sir. Sind Sie damit einverstanden, daß ich mehr Segel setzen lasse, bevor ich unter Deck gehe, Sir?«
Captain Jeffrey zögerte, schaute in die Takelage auf und nickte schließlich mit dem Kopf. »Ja, wenn Sie es für richtig halten. Ich berichte jetzt meiner Frau von dem amerikanischen Mädchen.«
Schon nach ein paar Minuten, nachdem Rick mit dem Koch in seiner Kabine war, erschien Mrs. Jeffrey mit Kleidern und einer Wärmflasche. Sie bat den Koch, die Wärmflasche mit heißem Wasser zu füllen und einen Haferbrei zu kochen.
Zu Rick sagte sie: »Ich muß sie ausziehn, Mr. Tempest — ihr Nachthemd ist völlig durchnäßt —, und ich brauche Ihre Hilfe, um sie hochzuheben. Aber bitte schauen Sie weg, während ich sie umziehe.«
Rick gehorchte ihr schweigend. Selina Jeffrey war eine dunkelhaarige, stattliche Frau. Normalerweise hielt sie sich abseits und richtete nie das Wort an ihn, aber die traurige Verfassung des verunglückten jungen Mädchens nahm sie so mit, daß sie ganz gesprächig wurde.
»Ach, das arme, unglückliche Kind!« rief sie aus und rieb dem Mädchen die schmalen, schneeweißen Hände, um die Blutzirkulation wieder in Gang zu bringen. »Es ist ohnmächtig, oder? Wird es sterben, oder besteht eine Chance, daß es sich wieder erholt, Mr. Tempest?«
Der alte Koch kam zurück, schob die Wärmflasche unter die Füße des Mädchens und sagte ernst: »Das kann man noch nicht sagen, Madam. Ich hab schon ein paar Männer — große, starke Matrosen — in demselben Zustand gesehn. Wenn man es nicht schafft, sie zu wecken, sterben sie ohne jeden Todeskampf. Es ist die Kälte, verstehn Sie? Wir müssen versuchen, sie aufzuwecken, Madam, wir müssen sie irgendwie aufwärmen. Versuchen Sie, ihr was von der Fleischbrühe einzuflößen.« Er stellte den kleinen Kochtopf auf den Boden und schaute Rick fragend an. »Wollen Sie ihr auf die Backen klopfen, Sir, oder soll ich’s machen?«
Rick nahm sich zusammen, biß die Zähne aufeinander und tat, worum Onslow ihn gebeten hatte. Es ging ihm gegen den Strich, eine Frau zu schlagen, und diesmal war es ihm fast unmöglich, da das Mädchen so zart und verletzlich wirkte. Das Klopfen hatte keinerlei Wirkung, außer daß Mrs. Jeffrey protestierte und ihm befahl, sofort damit aufzuhören.
»Das ist doch die reinste Brutalität, Mr. Tempest«, rief sie aus. Sie versuchte, dem jungen Mädchen etwas von der heißen Suppe in den Mund zu löffeln, aber das meiste davon lief aufs Kissen, und Onslow schüttelte seinen grauhaarigen Kopf.
»Wir müssen sie aufwecken, Madam. Sie kann ja nicht schlucken, wenn sie ohnmächtig ist.«
Mrs. Jeffrey hörte nicht auf ihn. Sie versuchte verzweifelt weiter, das Mädchen zu füttern, bis ihr Mann die Kabine betrat. Mit bedauerndem Gesichtsausdruck ließ sie sich von ihm überreden, sich zurückzuziehen, um sich nicht unnötig zu erschöpfen.
»Ich kann tatsächlich nicht mehr tun, als ich versucht habe.
Ich fürchte, sie schläft ihren Todesschlaf, und du solltest im Beerdigungsgottesdienst auch darum bitten, daß Gott ihre Seele gnädig aufnehmen möge, John.«
Captain Jeffrey zuckte resigniert mit den Schultern. »Wir müssen alle sterben«, erklärte er salbungsvoll. »Ich bitte dich, reg dich nicht zu sehr auf, meine Liebe. Komm ... Du solltest dich etwas hinlegen.« Er bot ihr seinen Arm, und während sie die Kabine verließen, fügte er leise hinzu: »Wir haben zwei der Toten identifizieren können, Mr. Tempest. Es waren zwei Offiziere. Die anderen scheinen einfache Matrosen gewesen zu sein.«
Nachdem sich der Segeltuchvorhang, der als Tür diente, hinter dem Captain und seiner Frau geschlossen hatte, nahm der Koch den Suppentopf hoch und legte den Deckel darauf.
»Ich muß das Abendessen zubereiten, Sir«, sagte er entschuldigend. »Ich hoffe, daß Sie mich eine Stunde lang entbehren können.«
»Ja, natürlich, Billy«, meinte Rick. Er schaute mit großem Mitleid die reglos daliegende Gestalt in seinem Bett an und seufzte tief. »Ich zweifle, ob irgend jemand etwas für dieses arme Mädchen tun kann. Es bricht mir schier das Herz, aber — verdammt noch mal, was können wir schon tun?«
»Es gibt noch eine Möglichkeit«, sagte der alte Billy plötzlich. »Es hat bei Matrosen geholfen, die halb erfroren aus dem Meer gefischt worden sind.« Er wurde rot im Gesicht. »Nun, wenigstens bei einem jungen Mann hat’s geholfen, und Sie können glauben, was Sie wollen ...«
Rick unterbrach ihn ungeduldig. »Ich glaube überhaupt nichts. Sagen Sie mir, um Gottes willen, was ich tun kann!«
Der Koch blickte zu Boden. Dann sagte er: »Ein Matrose legte sich die ganze Nacht lang zu dem halb erfrorenen Mann in die Hängematte und wärmte ihn mit seinem Körper. Am nächsten Tag war er wieder so lebendig wie Sie und ich, und heute kommandiert er ein Schiff.« Der Koch schaute Rick an. »Die Wärme des menschlichen Körpers, Sir, verstehn Sie? Is viel besser als jede Wärmflasche und jede Decke, das schwör ich Ihnen!«
»Großer Gott!« rief Rick aus. »Sie schlagen mir doch nicht vor, daß ich ... der Captain würde mich umbringen, und das wissen Sie, Onslow!«
Der alte Billy Onslow ging eilig zur Tür der Kabine. »Ich muß jetzt das Essen servieren, Mr. Tempest.« Er verschwand ohne ein weiteres Wort und ließ Rick verwirrt zurück.
Der Totengottesdienst sollte in zwei Stunden stattfinden. Als Erster Offizier müßte er natürlich anwesend sein, aber bis dahin würde er mit großer Wahrscheinlichkeit nicht gestört werden. Rick zögerte und suchte verzweifelt nach einer Lösung. Er dachte kurz daran, Mrs. Jeffrey um Hilfe zu bitten, aber dann ließ er den Gedanken fallen. Sie würde sich bestimmt weigern und ihren eigenen schlechten Gesundheitszustand vor schieben ... und das junge Mädchen müßte sterben.
Endlich stand Ricks Entschluß fest. Er würde alles versuchen, diesem armen Wesen das Leben zu retten. Er seufzte tief und fing an, sich auszuziehen. Nur mit einer Hose bekleidet kletterte er dann in die Koje und nahm den zierlichen, eiskalten Körper des ohnmächtigen Mädchens in seine Arme. Sie rührte sich nicht, und er lag lange Zeit da und drückte es an sich. Nach kurzer Zeit fing er an zu schwitzen, da er nicht daran gewöhnt war, unter so vielen Decken zu liegen. Und bald schlief er vor Hitze und Erschöpfung tief ein.
Er erwachte erst, als eine schrille Stimme ihn vom Gang her beim Namen rief.
»Mr. Meredith läßt ausrichten, daß die Schiffsbesatzung zum Appell antritt!«
Rick brauchte ein paar Sekunden, bis er wieder wußte, was geschehen war, und er hörte erleichtert, wie sich die Schritte im Gang wieder entfernten. Er schlüpfte aus der Koje und zog die Decken über dem jungen Mädchen glatt. Dann kleidete er sich in großer Eile an.
Erst nachdem er seine Uniformjacke zugeknöpft hatte, wagte er es, einen Blick in die Koje zu werfen. Er hielt vor Überraschung den Atem an, als er sah, daß das Mädchen mit weit geöffneten Augen dalag.
»Das Schiff ... ist untergegangen.« Es flüsterte mit kaum hörbarer Stimme: »Die Providence ... das Schiff meines Vaters. Wir mußten in die ... Rettungsboote, aber ich ...« In ihren blauen Augen schimmerten Tränen. »Es war so kalt, und mein Vater ...«
»Sie sind in Sicherheit.« Er kniete neben der Koje nieder und versuchte, das junge Mädchen zu beruhigen. »Der Sturm ist vorbei. Sprechen Sie nur, wenn Sie wirklich wollen — es ist besser, wenn Sie sich ausruhen.«
»Ich will aber sprechen, ich ... Ihr Schiff hat uns gerettet? Ich — ich kann mich an nichts mehr erinnern, was passiert ist. Ich dachte, daß wir ... daß wir alle verloren wären, daß wir ertrinken müßten.« Ihre Stimme klang jetzt etwas kräftiger, aber sie war immer noch verwirrt.
»Wir haben das Rettungsboot im Wasser treiben sehen und Sie an Bord geholt«, sagte Rick leise. Er überlegte fieberhaft, ob sie wahrgenommen hatte, daß er sie in seinen Armen gehalten hatte, wagte es aber nicht, sie zu fragen. Auf alle Fälle hatte ihr kleiner, eiskalter Körper keinerlei Begierden in ihm geweckt, vielleicht auch, weil er selbst durchgefroren und zu lange ohne Schlaf gewesen war. Aber sie hätte es dennoch mißverstehen können oder ... Er stand auf. »Sie waren halb erfroren, und Sie waren ohnmächtig — mehrere Stunden lang.«
Zum Teufel mit dem alten Billy Onslow, dachte er. Das Essen mußte doch längst vorüber sein, er hätte schon zurück sein müssen. Er entschuldigte sich, trat auf den Gang hinaus und bat einen Steward, den Koch zu holen. »Sagen Sie ihm, daß er heiße Suppe mitbringen soll, und zwar so schnell wie möglich!«
Als er wieder zurück in seine Kabine trat, schaute ihn das junge Mädchen prüfend an.
»Sind Sie ... ein englischer Offizier? Ist das hier ein englisches Schiff, ein Kriegsschiff?«
»Ja. Es ist das Königliche Kriegsschiff Kangaroo. Und ich bin Richard Tempest, der Erste Offizier.«
»Ich bin Amerikanerin, aus Boston«, sagte das Mädchen. Es fügte mit großer Bitterkeit hinzu: »Wir in Boston haben nicht viel für die Engländer übrig, Mr. Tempest.«
»Das ist verständlich«, meinte Rick. »Ich muß jetzt an Deck. Aber ich habe den Koch rufen lassen, der ein zuverlässiger Mann ist. Er wird Ihnen heiße Suppe bringen. Und die Frau des Captains, Mrs. Jeffrey, wird Ihnen bestimmt helfen, wo sie nur kann — Sie können Onslow bitten, sie holen zu lassen.« Er zwang sich zu einem Lächeln. »Sie wissen doch, daß unsere Länder nicht mehr im Krieg miteinander liegen, oder?«
Die junge Frau schaute ihn ernst an, und Rick zögerte und war nicht sicher, ob sie verstanden hatte, was er ihr gesagt hatte. »Versuchen Sie, etwas von der Suppe zu essen. Sie haben lange Zeit nichts mehr zu sich genommen. Bis vor ein paar Minuten waren Sie ohnmächtig, und Sie sind immer noch sehr schwach.«
»Ja, ich verstehe«, sagte das Mädchen leise. »Ich glaube, deshalb erinnere ich mich auch nur an so wenig.« Aber während es das sagte, fiel ihm plötzlich alles wieder ein, und es setzte sich in der Koje auf.
»Unser Schiff, das war die Providence. Es sollte nach Sydney in Neusüdwales fahren. Aber ... vielleicht wissen Sie das schon?«
»Ja«, bestätigte Rick. »Wir haben das Logbuch gefunden.«
Das Mädchen zog die Augenbrauen fragend hoch und fuhr dann fort: »Unser Rettungsboot war das letzte — die anderen sind gesunken. Mein Vater sagte, daß die Matrosen in den anderen Booten keine Überlebenschancen hätten ... ist er ... ist mein Vater in Sicherheit, Mr. Tempest?« Als Rick nicht sofort antwortete, fügte es mit großem Stolz hinzu: »Er ist der Captain Phineas O’Malley, der Besitzer der Providence. Während des Krieges diente er in der Marine und kommandierte ein Kriegsschiff namens Liberty.