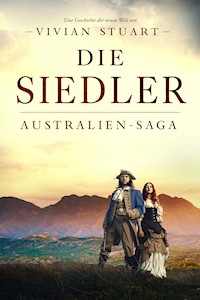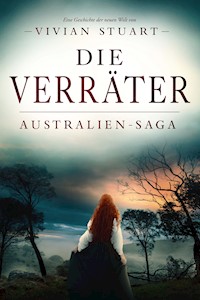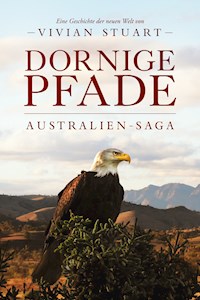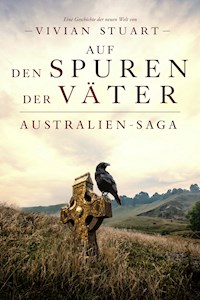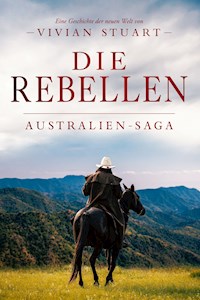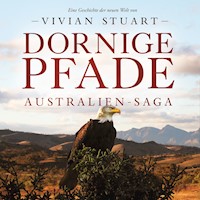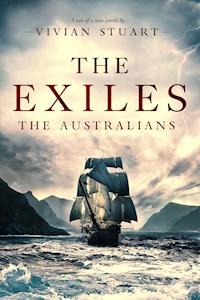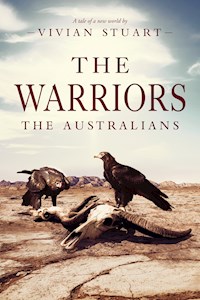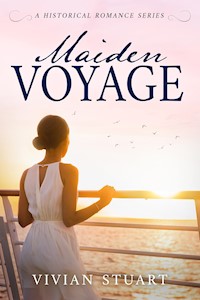Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: Jentas EhfHörbuch-Herausgeber: Skinnbok
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Australien-Saga
- Sprache: Deutsch
Sie haben den riesigen australischen Kontinent besiedelt. Sie haben Not und Entbehrung besiegt und die harten Anfangsjahre hinter sich gelassen. Nun machen sich einige von ihnen auf zu neuen Ufern: Das unbekannte, exotische Neuseeland ist das Ziel. Sie erleben große Gefahr und beweisen noch größeren Mut. Ein dramatischer Kampf um eine neue Welt beginnt, in den Freunde, Feinde und Liebende verstrickt werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 911
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Gründerväter
Die Gründerväter – Australien-Saga 9
© Vivian Stuart (William Stuart Long) 1987
© Deutsch: Jentas ehf 2022
Serie: Australien-Saga
Titel: Die Gründerväter
Teil: 9
Originaltitel: The Empire Builders
Übersetzung : Jentas ehf
ISBN: 978-9979-64-319-7
Prolog
Am Neujahrstag des Jahres 1859 lief die Königliche Dampffregatte Kestrel in Port Jackson ein, um das dort stationierte Kriegsschiff, die Galah, abzulösen. Laut fluchend beobachtete der Kommandant der Galah, der für seine Dienste bei dem Sepoy-Aufstand in Indien ausgezeichnete Fregattenkapitän Red Broome, wie das soeben eingelaufene Schiff in der Watson Bay vor Anker ging. Immerhin traf es zwei Wochen früher als erwartet an seinem neuen Standort ein.
Die Instandsetzung seines eigenen Schiffes — den Schaden hatten sie auf der Überfahrt von Kalkutta erlitten — war erst vor zehn Tagen abgeschlossen worden. Er war sich dessen schmerzlich bewusst, dass er die Galah nach England zurückbringen musste, sobald er dem Kommandanten der Kestrel die Verantwortung für den Stützpunkt übergeben hatte.
Allerdings wäre es höchst ungastlich, wenn er seinen Nachfolger nicht gebührend willkommen hieße. Eine Einladung zum Dinner für einen der nächsten Abende in seinem Haus, nachdem alle Formalitäten erledigt waren, würde voll und ganz genügen, beschloss Red. Seine Frau Magdalen war eine ausgezeichnete Gastgeberin. Sie wäre zwar wegen der unerwartet frühen Ankunft der Kestrel ebenso bestürzt wie er, aber er könnte sich dennoch darauf verlassen, dass sie ihnen ein Abendessen vorsetzen würde, das bei allen Gästen noch lange in Erinnerung bliebe. Schließlich war es sein Abschiedsessen und gleichzeitig das Begrüßungsmahl für seine Ablösung in der Kolonie.
In den folgenden Tagen, in denen Red sich auf seine Abreise vorbereitete, sollte er seine spontane Einladung jedoch bereuen. Es stellte sich heraus, dass der Kapitän der Kestrel, Commander Rupert Harland — klein von Gestalt und geltungssüchtig — etliche Jahre älter war als Red und auf wesentlich mehr Dienstjahre zurückblicken konnte. Er war nur deshalb nicht weiter befördert worden, weil ein Untersuchungsgericht ihm die Verantwortung für den Tod eines Fähnrichs gab, der unter seinem Kommando auf den Westindischen Inseln gedient hatte.
Bei diesem Jungen handelte es sich um den jüngsten Sohn des Zweiten Seelords. Wie Harland innerhalb der ersten halben Stunde ihres Zusammentreffens Red verbittert anvertraute, habe seine Lordschaft ihn aus diesem Grunde in den vergangenen fünf Jahren auf halbem Sold gehalten. Das Kommando über die Kestrel sei ihm erst nach dem Tod des rachsüchtigen alten Admirals anvertraut worden. Und den Standort, an den er beordert worden war, hätte er sich selbst als allerletzten ausgewählt.
»Eine verfluchte Strafkolonie«, erklärte er streitlustig. »Und das zwei volle Jahre lang. Möge Gott ihnen vergeben, denn ich vermag es nicht.«
Mit deutlichem Missfallen betrachtete er Reds braun gebranntes, gutaussehendes Gesicht. Er überlegte sich, wie viele Jahre sie wohl voneinander trennen mochten, und sah in ihrem Rangunterschied Grund genug zu Ressentiments, die er keineswegs zu verbergen versuchte.
»Verdammt, ich stand bereits im Rang eines Lieutenants, als Sie gerade mal Fähnrich waren! Sie haben unter dem ehemaligen Admiral Sterling gedient, stimmt’s?«
»Ja, die Success war mein erstes Schiff. Aber ...«
»Und wie ich gehört habe, sind Sie hier draußen geboren?« Harlands Ton klang wie eine Anschuldigung, und Red verspannte sich.
»Ja, das stimmt. Ich ...«
»Dann wird Ihnen der Abschied sicher schwerfallen. Zum Teufel, ich würde alles darum geben, wenn ich mit Ihnen tauschen könnte, Captain Broome. Ich habe Frau und Kinder in Dorset, und da ich fünf Jahre lang mit halbem Sold knausern musste, konnte ich es mir nicht leisten, sie mitzubringen.«
Ich würde für diesen Tausch noch viel mehr geben, wenn es nur die geringste Möglichkeit dazu gäbe, dachte Red und hörte Harlands Wortschwall mit großer Beherrschung zu.
Zwei Tage, nachdem er seinen Nachfolger kennengelernt hatte, verstärkte sich Reds instinktive Abneigung ihm gegenüber noch. Claus Van Buren, inzwischen einer von Sydneys angesehensten Kaufleuten, steuerte seinen auffallend schönen, auf einer amerikanischen Werft gebauten Klipper Dolphin in den Hafen, als Red sich gerade mit Harland im Amtssitz des Kommodore aufhielt, von wo aus man das gesamte Hafengelände überblicken konnte. Harland hatte den Schoner, der zusätzlich Dampfantrieb besaß, mit bewundernden Blicken betrachtet. Sein Herz schlug für Segelschiffe, was durchaus für ihn sprach. Als er sein Interesse an dem hervorragend konstruierten Schiff bekundete, erbot sich Red, der Dolphin gemeinsam mit ihm einen Besuch abzustatten, damit Harland sie besichtigen konnte.
Da er Claus seit seiner Kindheit kannte, kam es Red nicht in den Sinn, die Herkunft des Schiffseigners zu erwähnen. Sydneys feine Gesellschaft hatte den Mischling längst akzeptiert, und bei jedem großen Ereignis zeugte Claus’ dunkle Hautfarbe von seinem javanischen Blut, während sein holländischer Name Zeugnis für seine aristokratische Abstammung ablegte.
Zunächt verlief der Besuch auf der Dolphin reibungslos, denn Rupert Harlands Interesse war durchaus echt. Er kannte sich mit dem Bau von Klippern erstaunlich gut aus, und sein Verhalten gegenüber Claus war, wenn auch ein wenig herablassend, doch immerhin höflich. An Bord befanden sich auch Claus’ hübsche amerikanische Frau Mercy und ihre beiden Söhne. Als die ausgiebige Besichtigung endlich abgeschlossen war, kam Mercy an Deck und lud die Besucher zu einer Erfrischung in die große Kajüte ein.
Commander Harland betrat die Kajüte und sah die schöne Vertäfelung sowie die luxuriöse Ausstattung, den mit Schnitzereien verzierten Esstisch mit Stühlen, das Silber, die geschliffenen Kristallgläser und das feine Porzellan auf dem Sideboard. Er schien sichtlich beeindruckt, gab seine herablassende Haltung auf und besann sich auf bessere Manieren. Ehrerbietig beugte er sich über Mercys Hand und bedankte sich für die angebotene Tasse chinesischen Tee. Nachdem sie den Tee eingegossen hatte, setzte er das mit Claus begonnene Gespräch über die Takelage und die Ladekapazität fort.
»Es überrascht mich, dass Sie Ihr Schiff nicht mit Rahsegel getakelt haben. Wenn es Ihnen um Geschwindigkeit geht — da Sie im Wollhandel tätig sind, gehe ich doch davon aus —, dann hätte ich gedacht, dass Sie ...« Entsetzt unterbrach er sich und bekam vor Verblüffung den Mund nicht mehr zu. »Wer um alles in der Welt ...«
Der Vorhang zum Korridor war zur Seite geschoben worden, und der junge Maori-Häuptling Te Tamihana betrat die Kajüte. Er bewegte sich so ungezwungen, als sei er mit allen an Bord bestens vertraut. Von Mercy Van Buren nahm er eine Tasse Tee entgegen und setzte sich an den Tisch.
Red wusste von der Freundschaft des Häuptlings mit Claus, und da der junge Maori ihm bereits vorgestellt worden war, grüßte er ihn mit Namen. Harland aber starrte ihn dermaßen entgeistert an, als sei er eine Erscheinung aus einer anderen Welt. Verständlicherweise musste das plötzliche Auftauchen Te Tamihanas mit seinem stark tätowierten Gesicht und seinem geschmeidigen, kupferfarbenen und bis auf einen kurzen Rock aus geflochtenem Flachs völlig nackten Körper auf einen Neuankömmling aus England befremdlich wirken. Noch dazu, da der Maori völlig ernst an seinem Tee nippte. Trotz alledem war Red auf die Reaktion seines Offizierskollegen nicht vorbereitet.
Harland sprang auf, ließ seine Teetasse fallen und rief wütend: »Bei Gott, Broome, aus Ihnen ist ja vielleicht schon ein Eingeborener geworden, aus mir aber nicht! Was Captain Van Buren angeht, war ich bereit, fünf gerade sein zu lassen. Aber man kann doch nicht von mir erwarten, dass ich mich mit einem dieser wilden Ureinwohner an einen Tisch setze. Das ist verdammt noch mal zu viel verlangt, Sir!«
Te Tamihana blickte ihn leicht überrascht an, stellte vorsichtig seine Tasse ab und bemerkte in fehlerfreiem Englisch: »Wenn du erlaubst, Claus, gehe ich mit den Jungen an Deck. Wie es so geht, waren wir mitten in einem spannenden Spiel, und die beiden haben mich hart bedrängt. Entschuldigen Sie mich bitte, Mrs Van Buren.«
Niemand sagte ein Wort, bis der Vorhang sich nicht mehr bewegte. Dann schüttelte Claus warnend den Kopf in Reds Richtung und sagte mit kalter Stimme: »Bei dem jungen Mann, den Sie soeben beleidigt haben, Commander Harland, handelt es sich nicht um einen australischen Ureinwohner. Er ist ein Maori, einer der einflussreichsten Häuptlinge von Neuseelands Bay of Islands, und außerdem einer meiner geschätzten Freunde, der ebenso wie Sie als Gast auf meinem Schiff weilt. Er ...« Harland versuchte, ihn zu unterbrechen, doch Claus ließ das nicht zu. »Lassen Sie mich ausreden, Commander. Ich verbringe einen Großteil meiner Zeit in Neuseeland, wo ich ausgedehnte Handelsbeziehungen unterhalte, weit bedeutendere als meine derzeitigen Interessen im Wollhandel. Und sie gründen sich auf das freundschaftliche Verhältnis zu den Maori-Stämmen, das ich über viele Jahre hinweg aufgebaut habe. Ich betrachte die Maori als gleichwertige Partner, und ich respektiere ihre Kultur, ihre Wertmaßstäbe und ihre Ehrbarkeit. Dieselbe Haltung nehmen sie auch mir gegenüber ein, Sir.«
Rupert Harland gelang es, sich wieder zu fassen. Mit hochrotem Gesicht und in spöttischem Ton entgegnete er: »Für jemanden Ihrer Hautfarbe mag das durchaus verständlich sein, Captain Van Buren. Gleich und gleich gesellt sich gern, nicht? Ich glaube, im Gegensatz zu uns neigen die Holländer dazu, mit den einheimischen Bewohnern der von ihnen unterworfenen Länder Mischehen einzugehen. Und bei Ihnen wird deutlich ...«
Verärgert versuchte Red, ihm Einhalt zu gebieten, aber Claus schüttelte erneut den Kopf.
»Gestatte mir bitte, Red, dass ich diesem Gentleman die aktuelle Lage in Neuseeland erkläre. Wenn er in der australischen Kolonie deine Stelle einnehmen soll, ist es äußerst wichtig, dass er die Zusammenhänge kennt.«
»Also gut, fahr fort«, willigte Red ein und presste die Lippen zusammen.
»Gern.« Claus wandte sich wieder an Harland. Der Blick seiner dunklen Augen war kalt, aber ohne jeden Zorn. Er wartete, bis Mercy, der sein Blick nicht entgangen war, sich entschuldigt und zurückgezogen hatte, und bemerkte dann mit ruhiger Stimme: »Ich muss Ihnen sagen, Sir, dass in Neuseeland vermutlich in unmittelbarer Zukunft ein Krieg ausbrechen wird, viel gefährlicher als der von vor zwölf Jahren. Die Besiedlungdichte hat um das Zehnfache zugenommen, und auf der Nordinsel geht sie mit alarmierender Geschwindigkeit vor sich. Und wenn ich alarmierend sage, dann meine ich das auch, denn die Schwierigkeiten werden von den Siedlern verursacht. Zu viele von ihnen sind geldgierig und unehrenhaft, und sie schenken den Rechten der Maori und ihren Klagen kaum Beachtung. Sie enteignen sie und betrügen sie um ihr angestammtes Land, halten sie mit falschen Versprechungen hin und geben ihnen nicht einmal eine faire Entschädigung für die Ländereien, die sie ihnen abgenommen haben.«
»Neuseeland ist eine britische Kolonie«, polterte Harland los. »Laut den Verträgen mit den Maori-Häuptlingen steht den Siedlern das Land zu.«
»Richtig«, räumte Claus ein und warf Red wieder einen warnenden Blick zu. »Doch die Maori waren schon da, lange bevor der erste Weiße seinen Fuß auf den Boden von NeuSeeland gesetzt hat. Außerdem, Sir, kann man mit den Maori nicht einfach so verfahren wie mit den Ureinwohnern von Tasmanien. Man kann sie nicht einfach auf eine karge Insel vertreiben und sie dort verwahrlost und krank dem sicheren Tod überlassen. Dafür sind sie zu zahlreich. Sie sind ein starkes, stolzes und kriegerisches Volk, und sie werden verteidigen, was ihnen gehört. Zudem, Sir, sind die Siedler gar nicht in der Lage, den Kampf mit ihnen aufzunehmen, denn es sind hauptsächlich Farmer und Kaufleute, so wie ich, oder Missionare. Sollten die Maori wirklich in den Krieg getrieben werden und sollten sich die Stämme unter einem gemeinsam gewählten König vereinigen, wie es im Moment den Anschein hat, werden viele Schiffe der Königlichen Marine und zahlreiche Regimenter Ihrer Majestät notwendig sein, um ein Blutbad zu vermeiden. Ich bitte Sie, das zu bedenken, Commander Harland.«
Claus sah wieder zu Red hinüber und fügte bedauernd hinzu: »Ich habe mit Bestürzung gehört, dass du nach England beordert worden bist, Red. Ich hatte gehofft — und es ist mir ein Bedürfnis, das zu sagen —, dass du die Erlaubnis bekommen würdest, mit der Galah zu bleiben und die Gemüter zu beruhigen.«
Seine Stimme hatte durchweg versöhnlich geklungen, doch Rupert Harland war alles andere als in versöhnlicher Stimmung. Er nahm seine Mütze, setzte sie wütend auf den Kopf und schickte sich an zu gehen. Dabei blickte er Red an, der jedoch sitzen blieb und keinerlei Anstalten machte, ihm zu folgen.
»Aus meiner Sicht«, sagte der Kommandant der Kestrel gehässig, »ist Gewalt das richtige Mittel, um mit aufsässigen Eingeborenen fertigzuwerden. Das ist das Einzige, was die meisten von ihnen verstehen. Und wenn es nach mir geht, Van Buren, werden meine Schiffskanonen sprechen, falls Ihre Maori-Freunde sich verschwören und rebellieren. Vielleicht kommt es tatsächlich zu einem Blutbad, wie Sie Vorhersagen, aber das vergossene Blut wird kein britisches, sondern das Blut der Maori sein. Ich wünsche einen guten Tag, Sir.«
Er stürmte aus der Kajüte, und Red sagte entschuldigend: »Soll der Kerl doch zur Hölle fahren! Tut mir leid, Claus, tut mir wirklich leid, dass ich ihn an Bord gebracht habe.«
»Lass ihn ruhig gehen«, antwortete Claus, »und bleib du zum Dinner, Red. Du konntest ja nicht wissen, wie er reagieren würde. Außerdem«, fügte er lächelnd hinzu, »wenn du bleibst, kannst du wenigstens Te Tamihanas Gemüt ein wenig besänftigen. Glaub mir, mein Freund, das ist dringend notwendig. Der junge Häuptling hat erwogen, die King Movement — die Bewegung der Maori zur Wahl eines gemeinsamen Königs — tatkräftig zu unterstützen, und wer könnte ihm das verdenken?«
Red zog die Stirn kraus. »Du glaubst also, dass diese Bewegung eine ernste Gefahr für den Frieden dar stellt?«
»Na ja«, Claus zögerte. »Das wäre wohl so, wenn der große Hongi Hika noch lebte. Bestimmt hat dein Vater dir von ihm erzählt. Ich glaube, er ist ihm einmal begegnet.«
»Ja, das stimmt, als er Erster Offizier auf der Kangaroo war.« Reds Züge entspannten sich. »So wie mein Vater sie geschildert hat, muss das eine beeindruckende Begegnung gewesen sein. Er bewunderte Hongi sehr.«
»Die Maori ebenfalls. Hongi machte das Recht des Eroberers geltend, und kein Stamm wagte sich ihm zu widersetzen. Seine Krieger waren bereits mit Musketen ausgestattet, als die übrigen nur Speere und Kriegsbeile hatten. Nach seiner Rückkehr von einem Besuch am englischen Hof erschien er in einer Rüstung, die der König persönlich ihm geschenkt hatte. Hongi besaß großes Ansehen.«
»Gibt es derzeit keinen Häuptling von Hongis Format?«, fragte Red.
Claus schüttelte den Kopf. »Nein. Die beiden großen Stämme — die Ngapuhi in der Gegend nördlich von Auckland und die Waikato im Süden — liegen seit jeher in Fehde miteinander, weil ständig irgendein altes Unrecht gesühnt werden muss. Keiner von ihnen würde sich einem von der Gegenseite gewählten König beugen«, sagte Claus nachdenklich. »Die Ngapuhi erklärten sich vor einiger Zeit bereit, eine Abordnung der Waikato zu treffen, bestätigten dann aber ihre Loyalität gegenüber der Königin von England — vermutlich vor allem aus Respekt vor dem früheren Gouverneur, Sir George Grey. Die Maori haben ihm immer vertraut und glaubten, er stünde mehr auf ihrer Seite als auf Seiten der Siedler. Bei seinem Nachfolger, Sir Thomas Gore-Browne, sind sie sich da nicht so sicher.« Claus zuckte mit den breiten Schultern. »Jedenfalls verschlechtert sich die Lage zusehends, was zu einem Blutvergießen führen könnte. Und die südlichen Stämme haben bereits ihren eigenen König gewählt.«
»Ach ja? Ist das eine gute oder eine schlechte Nachricht?«
»Offen gestanden weiß ich es nicht, Red«, gab Claus zu. »Der von ihnen Gewählte — Potatau heißt er — ist ein berühmter alter Krieger und wird allgemein geschätzt. Aber er ist nun mal alt, und seine großen Kämpfe sind vorüber. Deshalb bezweifle ich, dass er tatsächlich die Macht hat, alle Maori gegen uns zu vereinen, wenn er das überhaupt will. Sein Sohn Tawhiao wird vermutlich sein Nachfolger. Doch der ist leider ein junger Hitzkopf, der Ärger machen könnte, wenn er Gelegenheit dazu bekommt.«
Eine Weile hing Claus schweigend seinen Gedanken nach, und plötzlich hellte sich seine Miene auf.
»Du hast bestimmt davon gehört, dass dein Schwager, der tapfere Colonel De Lancey, entschieden hat, sich in Neuseeland anzusiedeln?«
»Ja«, bestätigte Red. »Er hat mir davon erzählt.«
Ursprünglich war Will De Lancey auf der Suche nach einem geeigneten Stück Land südlich von Sydney ins Illawarra-Gebiet gegangen. Nach seinen schrecklichen Erfahrungen beim Sepoy-Aufstand in Indien hatte er sich dazu entschlossen, das Schwert gegen die Pflugschar zu tauschen, wie er es zynisch ausdrückte. Während seiner Abwesenheit starb jedoch sein Freund Henry Osborne, der Besitzer des Mount-Marshall-Anwesens, und der Preis für ein gutes Stück Land in dem fruchtbaren Illawarra-Gebiet war inzwischen unverschämt hoch.
»Ich bin zu spät gekommen, um noch Land zu erwerben wie die Schafzüchter«, hatte William bedauernd gesagt. »Henry hätte mir sicher ein Stück Land zu einem vernünftigen Preis überlassen, aber leider weilt er ja nicht mehr unter uns. Von meinem Sold könnte ich mir die derzeit verlangten Preise wohl kaum leisten. Außerdem ist Mount Marshall mit zu vielen Erinnerungen an meine liebste Jenny behaftet. Du weißt ja, wir haben dort einen Teil unserer Flitterwochen verbracht. Und als ich dorthin zurückkehrte, musste ich feststellen, dass ich diese Erinnerungen nicht mehr loswurde. Neuseeland bietet bessere Möglichkeiten, und nun ja, wir sollten lieber noch einmal ganz von vorn anfangen, der Junge und ich.«
Als könnte Claus Reds Gedanken lesen, sagte er mit einem Lächeln: »Als wir vor Anker gingen, Red, traf ich den Colonel zufällig in der Stadt, und er bezahlte mir die Überfahrt nach Auckland für sich und den jungen Mann, den er bei sich hatte — wie heißt er doch gleich?«
»Andrew Melgund«, antwortete Red. »Der Sepoy-Aufstand machte ihn zum Waisen; seine Eltern wurden in Kanpur niedergemetzelt. Und Jenny, meine arme kleine Schwester Jenny, die ebenfalls dort starb, rettete dem Jungen das Leben.«
»Der Junge machte auf mich einen guten Eindruck«, bemerkte Claus.
»Das ist wahr«, stimmte Red zu. »Ich glaube, nur wegen ihm ist Will nicht wahnsinnig geworden.« Nüchtern fügte er hinzu: »Schon allein um seinetwillen hoffe ich, dass in Neuseeland der Frieden bewahrt wird, Claus. Nach dem Krimkrieg und dem Sepoy-Aufstand hat Will genug mit Krieg zu tun gehabt. Wann segelst du los?«
»In etwa zehn Tagen. Für die kurze Zeit wollen wir nicht extra unser Haus beziehen und wohnen lieber an Bord. Mercy und meine Jungen kommen wie immer mit.« Seine Stimme klang warm. »Ich kann mich wirklich glücklich schätzen, Red. Ich führe das Leben, das ich liebe, und meine Frau und Kinder können dieses Leben auf See mit mir teilen. In der Hinsicht bin ich wesentlich besser dran als du. Auch wenn du eine noch so hohe Position in der Königlichen Marine hast, ist dir nicht gestattet, Magdalen und deine kleine Tochter mitzunehmen, wenn du nach England fährst, oder?«
»Leider nicht«, antwortete Red. »Dieses Privileg wurde uns von den Lords der Admiralität entzogen. Die Meinen werden die Überfahrt auf einem Handelsschiff machen müssen.«
»Ich habe einen Woll-Klipper, die Dragonfly, die nächsten Monat in See sticht«, sagte Claus. »Es ist ein Siebenhunderttonner, und ich könnte ihnen eine Fahrkarte anbieten. Aber vielleicht zieht Magdalen die Reise auf einem Dampfschiff vor. Ich kann ihr jedenfalls versprechen, dass meine Dragonflyeine schnelle Überfahrt haben wird. Und«, fügte er mit breitem Lächeln hinzu, »ich mache dir einen Vorzugspreis.«
»Ich werde das mit Magdalen besprechen. Ganz sicher ist sie von deinem Angebot begeistert.« Red erwiderte das Lächeln seines Freundes, und die unerfreuliche Begegnung mit Commander Harland war vergessen. »Herzlichen Dank, Claus. Du bist ein echter Freund.«
Als zwei Tage darauf in Justin Broomes Haus in der Elizabeth Bay das Dinner zur Begrüßung des neuen Kommandanten der Kestrel an seinem Stützpunkt Sydney und zur Verabschiedung seines Vorgängers stattfand, war die Atmosphäre äußerst gespannt, wie Red gleich bei seiner Ankunft entsetzt feststellte. Wie erwartet war Rupert Harland die Ursache des Konflikts.
Obwohl dem Kommandanten der Kestrel bewusst sein musste, dass er in einer Art großen Familientreffens der einzige Fremde war, unternahm er nicht den geringsten Versuch, auf das allseits freundliche Entgegenkommen einzugehen. Sein Verhalten war dermaßen reserviert, dass es fast an Grobheit grenzte. Es schien, als wollte er partout seine Überlegenheit gegenüber der feinen Gesellschaft einer Kolonie herausstellen, deren Mitglieder, wie er zweifellos annahm, nur von schändlichen Sträflingen abstammten und daher kein Anrecht auf seine sonst übliche Höflichkeit hätten.
Magdalen hatte im Haus an der Elizabeth Bay in aller Frühe die Leitung der Küche übernommen und sich bereits vorher viele Gedanken um die einzelnen Gerichte gemacht. Nun war sie zuerst besorgt und schließlich brüskiert, weil der neu eingetroffene Kommandant das ausgezeichnete Essen in keiner Weise würdigte. Während ein Gang dem anderen folgte und Rupert Harland geringschätzig auf seinem Teller herumstocherte, bemerkte Red die wachsende Verlegenheit seiner Frau und wurde immer wütender.
Zur Hölle mit diesem ungehobelten Klotz, dachte er aufgebracht.
Er konnte sich kaum mehr zurückhalten und bedauerte zutiefst, dass er seinen Nachfolger bei ihrer ersten Begegnung spontan eingeladen hatte. Das war ein grober Verstoß gegen seine Gastfreundschaft. Er fing den Blick seines Vaters auf und bemerkte zu seinem Erstaunen, dass Justin Broome sich von Harlands Benehmen eher amüsiert als beleidigt fühlte.
Als die Ladys sich in den Salon zurückzogen, um dort ihren Kaffee zu trinken, hielt sein Vater ihnen die Tür auf und blieb danach kurz neben Red stehen.
»Keine Sorge, Red«, sagte er leise. »Mit solchen Leuten habe ich schon früher zu tun gehabt. Einmal habe ich sogar unter einem Mann von seinem Schlag gedient, unter Captain John Jeffrey auf der Kangaroo. Vielleicht erinnerst du dich? Das war der Kapitän, der vor einigen Jahren den Zusammenstoß mit dem berühmten Hongi Hika in Neuseeland hatte. Ich habe dir bestimmt davon erzählt.« Er lächelte. »Wir werden diesem Mr Harland Benehmen beibringen, da kannst du sicher sein.« Damit nahm Justin Broome wieder seinen Platz am Kopfende des Tisches ein und erhob seine Stimme: »Magdalen hat uns heute ein Dinner beschert, Red, an das wir noch lange zurückdenken werden. Setz dich, mein lieber Junge, und wir trinken ein Glas Portwein auf deine gesunde Ankunft an der Küste Englands!«
Der Toast wurde gebührend aufgenommen, und alle tranken auf Reds Wohl. Als dann die Zigarren und Pfeifen angezündet wurden und die Karaffe mit dem Portwein die Runde machte, entstand eine kurze Stille, und Red hörte seinen Vater sagen: »Ach, Commander Harland, mir kam da gerade etwas in den Sinn. Ich glaube, ich habe schon einmal mit einem Ihrer Verwandten Bekanntschaft gemacht. Das ist zwar schon eine Weile her, über zwanzig Jahre. Kurz nachdem die ersten Siedler aus Holdfast Bay in die Gegend von Südaustralien zogen, wo heute die Stadt Adelaide liegt. Sie selbst waren vorher noch nie hier, stimmt’s?«
Rupert Harlands feistes Gesicht war plötzlich von Zornesröte übergossen. Einen Augenblick lang hatte es den Anschein, er erstickte an seiner Empörung. Er fasste sich jedoch wieder und sagte mit heiserer Stimme: »Nein ... nein, Sir, absolut nicht. Ich, äh, ich kann mir nicht vorstellen, auf wen Sie da anspielen.«
»Ach nein?« Wie Red bemerkte, ließ sein Vater sich nicht aus der Ruhe bringen.
Im Plauderton erläuterte er kurz die Schwierigkeiten, denen sich die ersten Siedler in Adelaide ausgesetzt sahen, da sie auf die zu erwartenden Lebensbedingungen nur schlecht vorbereitet waren: mangelnde Arbeitskräfte und weder angemessene Unterkunft noch ausreichende Nahrung. Hinzu kamen die anhaltenden Auseinandersetzungen zwischen dem Gouverneur, Captain Hindmarsh, und dem Bauinspektor, Colonel Light, über die endgültige Lage der Stadt.
»Diese unglücklichen Menschen waren kurz vor dem Verhungern«, fuhr Justin Broome fort, nickte weise mit seinem weißen Haupt und vermied Harlands plötzlich geradezu flehenden Blick.
»Geld hatten sie, die meisten jedenfalls, aber mit Geld konnten sie sich das, was sie so dringend brauchten, nicht beschaffen. Bis ...«, fuhr er mit veränderter Stimme fort, und Red beobachtete, wie sein Vater den geschlagenen Kommandanten der Kestrel mit seinen blauen Augen aufmerksam ansah. »Bis zur Ankunft eines der Königlichen Kriegsschiffe, der Ringdove, falls mein Gedächtnis mich nicht im Stich lässt. Der Proviantmeister der Schaluppe versorgte die Leute großzügig mit den Schiffsvorräten. Und wie es hieß, erzielte er persönlich einen beträchtlichen Gewinn — allerdings wohl kaum mit Billigung Seiner Lordschaft.« Erneut machte er eine Pause, und aus Harlands Gesicht wich sämtliche Farbe. »Ich erinnere mich deshalb so gut daran ...« Sein Vater hatte jetzt die Aufmerksamkeit aller am Tisch, bemerkte Red. Alles schwieg, als er fortfuhr: » ... weil ich in dem Untersuchungsausschuss war, der anschließend in Sydney zusammentrat. Wenn ich mich recht entsinne, trug dieser Proviantmeister denselben Namen wie Sie, Commander Harland.«
»Mein Name ist nicht gerade ungewöhnlich, Sir.« Harland war aufgesprungen und stammelte: »Von dieser Angelegenheit weiß ich nichts, ich ... wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden, Sir, würde ich mich gern verabschieden. Ich, äh, ich meine, vielen Dank für Ihre Gastfreundschaft, Captain Broome.«
»Ach, sei doch bitte so nett und bring den Commander zur Tür, John«, bat Justin.
Red bemerkte den zufriedenen Blick seines Vaters, während sein jüngerer Bruder sich erhob, um der freundlich vorgebrachten Bitte nachzukommen.
Justin Broome wartete, bis Johnny zurückgekehrt war, und beantwortete dann mit einem breiten Grinsen Richter De Lanceys Ausruf: »Großer Gott, was war denn das soeben, Justin?«
»Eine Taktik, die der Kommodore und ich uns ausgedacht haben, George, weil auch er Harlands Arroganz nicht länger ertragen konnte.« Justin setzte sich wieder. »Um ehrlich zu sein, hatte ich diese Ringdove-Affäre völlig vergessen. Dem Kommodore fiel jedoch zufällig ein, dass er ebenfalls Mitglied des Untersuchungsausschusses war. Er war zu der Zeit Erster Offizier auf der alten Buffalo. Und der Proviantmeister war tatsächlich der Vater von unserem Harland. Wir haben die Akten überprüft; deshalb kann er leugnen, so viel er will. Der Beweis liegt vor. Ich brauche wohl nicht ausdrücklich zu betonen, dass Harland senior den Dienst quittieren musste und ihm keine Pension zuerkannt wurde.«
Richter De Lancey amüsierte sich köstlich und lachte.
»Ich verstehe. Doch was hat dich dazu veranlasst, die Angelegenheit heute Abend zur Sprache zu bringen?«
Justin zündete sich erst eine neue Zigarre an.
»Oh, ich hatte ursprünglich gar nicht die Absicht«, gestand er. »Eigentlich hatten wir vor, das Thema im kleinen Kreis im Büro des Kommodore anzusprechen — sozusagen als Warnung, damit der Kerl sich bessere Manieren zulegt. Aber heute Abend ist Reds Abschiedsfest, zu dessen Gelingen jeder von uns beigetragen hat. Und als Harland darauf aus war, uns unsere gute Laune zu verderben ... tja, da habe ich mir gedacht, das wäre wohl der richtige Moment. Ich kann doch davon ausgehen, dass ihr mit mir einer Meinung seid?«
Ein zustimmendes Gemurmel machte sich breit, und Red sagte ernst: »Danke, Vater. Nicht nur der Kommodore meint, dass Harlands Benehmen unerträglich ist.«
Sein Vater deutete auf die Karaffe mit dem Portwein.
»Füllt eure Gläser, meine Freunde«, lud er sie ein, »und bevor wir zu den Ladys gehen, möchte ich gern noch einen Toast ausbringen.« Nachdem sich jeder bedient hatte, hob Justin Broome sein Glas. »Auf meinen Schwiegersohn Will De Lancey, auf meinen Sohn John und seine Frau, die uns bald verlassen werden, um nach Neuseeland aufzubrechen. John wird für seine Zeitung einen Artikel über das dortige Problem der Landansprüche schreiben. Möge Gott ihnen eine rasche Überfahrt schenken und sie in seiner Gnade eines Tages alle wohlbehalten zurück zu uns nach Hause bringen!«
Darauf tranken sie. Die Nachricht vom bevorstehenden Aufbruch seines Bruders war für Red eine Überraschung, und als sie gemeinsam den Tisch verließen, sagte Johnny entschuldigend: »Das hat sich gerade erst entschieden, Red, genau genommen, erst heute Nachmittag. Wir fahren mit Will und dem Jungen auf der Dolphin.« Er errötete und fügte mit Blick auf seine Frau mit leiser Stimme hinzu: »Kit ist hier nicht glücklich, deshalb dachte ich ... nein, verdammt noch mal, ich hoffe, dass ein Tapetenwechsel ihr und unserer Ehe gut tun könnte. Im Gegensatz zu dir scheint mit mir als Ehemann nicht allzu viel los zu sein, leider!«
Red schaute ihn betroffen an, doch Johnny klopfte ihm auf die Schulter und brachte ein schiefes Lächeln zustande.
»Mach dir deswegen keine Sorgen, Bruder. Das wird schon wieder, ganz bestimmt. Nur leider bricht unsere Familie ziemlich auseinander, stimmt’s? Das finde ich schade.«
Da konnte er ihm nur beipflichten, dachte Red bedrückt. Aber so war das Leben nun einmal; nichts dauerte ewig, und Trennungen waren unvermeidlich. Zielbewusst steuerte er auf seine Frau zu, setzte sich auf die Armlehne ihres Sessels und legte ihr locker den Arm um die schlanke Taille.
»Commander Harland ist ziemlich überstürzt aufgebrochen, Red«, bemerkte sie besorgt.
»Ja, meine Liebste«, stimmte Red zu. »Dank meines Vaters wird er sich in Zukunft wohl etwas weniger unbeliebt machen.« Er nahm sie fester in den Arm. »Magdalen, ich liebe dich! Und es bricht mir das Herz, dass ich dich verlassen muss. Das weißt du doch, nicht?«
»Ja«, antwortete sie mit sanfter Stimme. »Das weiß ich, Red. Aber ich komme ja nach. Ich möchte immer mit dir zusammen sein, bis ans Ende meiner Tage, Liebster.«
Wie in einem stillen Übereinkommen sahen beide zu Johnny hinüber, der allein dastand und grimmig dreinschaute. Offenbar hatte Kitty Broome ihren Mann noch gar nicht bemerkt und unterhielt sich angeregt mit Richter De Lancey.
Magdalen flüsterte leise: »Wir können uns glücklich schätzen, Red. Vergiss das nie, hörst du?«
Red beugte sich zu ihr hinab und gab ihr einen zärtlichen Kuss. »Nein«, sagte er. »Das vergesse ich nicht.«
1
Nach ihrer neunundsechzigtägigen Überfahrt, die weitgehend ohne besondere Zwischenfälle verlaufen war, ging die Galah in Spithead vor Anker. Nachdem die Mannschaft abgemustert und Red Broome sich mit Bedauern von ihr verabschiedet hatte, wurde er als Richter in einem Militärgerichtsverfahren berufen. Es sollte an Bord des Kampfschiffes Copenhagen stattfinden, dem Flaggschiff des Vizeadmirals der Kanalflotte.
Damit hatte Red nicht gerechnet. Doch auf diese Weise würde der unangenehme Moment wenigstens noch etwas hinausgezögert, von dem an er bei halbem Sold auf unbestimmte Zeit — und bis zu Magdalens Ankunft einsam und allein — auf ein neues Kommando warten müsste.
Red nahm die Berufung zum Richter gleichmütig an. In dem Verfahren sollte über den Verlust eines Kriegsschiffes, einer kleinen Schaluppe, die vor der irischen Küste gesunken war, verhandelt und ein Urteil gefällt werden. Also ging er davon aus, dass die Angelegenheit eine reine Formalität und damit rasch erledigt wäre. Bei Verlust eines Schiffes der Königlichen Marine — sei es in Kriegs- oder Friedenszeiten — musste der Kommandant sich in jedem Fall vor Gericht verantworten. Doch falls ihm nicht gerade Feigheit oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden konnte, lautete das Urteil in der Regel auf Freispruch. Im schlimmsten Fall kam es zu einem Verweis und zu einer Degradierung.
Als Red sich an Bord der Copenhagen meldete, erfuhr er jedoch, dass dieser Fall ernstere Konsequenzen haben würde. Die Lancer, eine Sechzehn-Kanonen-Schaluppe, war in einem heftigen Sturm mit gesetzten Segeln an die Küste getrieben worden, während unter Deck ein Feuer wütete. Bei ihrem Untergang hatten der Kapitän und, bis auf fünf Mann, die gesamte Besatzung ihr Leben gelassen. Vor Gericht stand nun der Erste Offizier. Wie Red mit Bestürzung feststelle, war sein Name Adam Colpoys Vincent. Der Ehrenwerte Adam Vincent, einer der jüngeren Söhne des Earl of Cheviot — des General Major Earl of Cheviot, der in Waterloo zum Stab des Duke of Wellington gehörte. Red runzelte die Stirn, als er sich an den jungen Vincent erinnerte. Er war Lieutenant in der Shwnnow-Marinebrigade gewesen, die während der Meuterei vor knapp zwei Jahren Sir Colin Campbell in Lucknow unterstützt und ungemein tapfer gekämpft hatte. Er selbst hatte dieser Brigade angehört, und er hatte Adam Vincent als freundlichen und mutigen jungen Offizier in Erinnerung. Bereits als Fähnrich war Vincent mit dem Viktoriakreuz ausgezeichnet worden, als er unter Captain William Peel, dem Kommandanten der Shannon, im Krimkrieg gedient hatte.
Das Viktoriakreuz hatte er gemeinsam mit Edward Daniels verliehen bekommen, und ... Immer tiefere Furchen gruben sich in Reds Stirn. Er dachte zurück an das bewegende Zeremoniell. Captain Marten, Peels Nachfolger, hatte den beiden jungen Männern in Anwesenheit der in Galauniform angetretenen Brigade der Shannon auf dem Rückweg nach Kalkutta verspätet die kleinen Bonzekreuze überreicht — die höchste Auszeichnung für Tapferkeit, die die dankbare Nation ihren Kriegshelden verleihen kann.
Und nun stand einer dieser jungen Helden wegen drei schwerer Anschuldigungen vor Gericht. Zusammen mit den übrigen elf Mitgliedern des Militärgerichts wurde Red vereidigt. Als er seinen Platz zur Rechten des Vorsitzenden eingenommen hatte, verlas der Militärstaatsanwalt die Anklageschrift. Je mehr Red deren Tragweite bewusst wurde, desto weniger konnte er den Vorwürfen Glauben schenken.
Auch wenn er mit den juristischen Formulierungen nicht sonderlich vertraut war, verstand er doch, dass das Verhalten des jungen Offiziers durch die vorgetragenen Anklagepunkte in Grund und Boden verdammt wurde. Adam Vincent wurde beschuldigt, in stark angetrunkenem Zustand gewesen zu sein, als ihm in einem schweren Sturm vor der Südwestküste Irlands, nahe der Bantry Bay und des Leuchtturms von Dursey Head, das Kommando über die Schaluppe übertragen wurde, weil der Kapitän der Lancer krank im Bett lag.
Offenbar war die Schaluppe durch starke Sturmböen auf einen leeseitigen Küstenabschnitt getrieben worden. Wie der Militärstaatsanwalt ausführte, sollten aber vor Gericht eindeutige Zeugenaussagen beweisen, dass Vincent es verabsäumt habe, rechtzeitig die Segel zu reffen, um das Unglück zu verhindern. Noch vernichtender war die Anschuldigung, Lieutenant Vincent habe, als ihm das unter Deck ausgebrochene Feuer gemeldet wurde, anscheinend nicht schnell genug auf diese zusätzliche Gefahr reagiert. Stattdessen habe er übereilt den Befehl zum Verlassen des Schiffs gegeben. Auf Grund des verfrühten Befehls seien die Boote, in denen die Mannschaft das Ufer erreichen wollte, von den Wellen überspült worden und gekentert. Dies habe einhundertelf Menschen das Leben gekostet. Unter ihnen befand sich auch der erkrankte Kapitän der Lancer, Kommandant John Omerod.
Der letzte, wenngleich weniger schwere Anklagepunkt, versetzte Red besonders in Erstaunen. Denn er stand in krassem Widerspruch zu dem Eindruck, den er selbst bei ihrem gemeinsamen Einsatz in der Marinebrigade in Indien von Adam Vincents Charakter gewonnen hatte. Red hatte Vincent als einen verlässlichen, kompetenten Offizier in Erinnerung, der die Disziplin in der Marine hochhielt. Der ehemalige Captain Peel, der den jungen Lieutenant länger kannte als sonst irgendjemand, hatte ihn außerordentlich geschätzt. In einem seiner letzten Berichte, die der Kapitän der Shannon vor seinem tragischen Tod an die Admiralität abgeschickt hatte, war Vincent zusammen mit einigen anderen für eine wohlverdiente Beförderung vorgeschlagen worden.
»Wäre der junge Vincent nicht bereits mit dem Viktoriakreuz ausgezeichnet worden«, hatte William Peel damals gesagt, »wäre sein Name auf jeden Fall unter denen gewesen, die ich für eine Auszeichnung empfohlen habe. Er kennt keine Angst, und am Shah Nujeef hat er sich die Ehrung doppelt verdient.«
Ein so hohes Lob, und jetzt ... Red lauschte bestürzt, wie der Militärstaatsanwalt mit eintöniger, teilnahmsloser Stimme von dem Papier in seiner Hand ablas.
»Ferner sind Sie angeklagt, sich am zehnten März dieses Jahres von fünf Uhr nachmittags bis Mitternacht aus den Ihnen zugewiesenen Räumlichkeiten an Bord dieses Schiffes entfernt und sich der Aufsicht des zu Ihrer Eskorte bestimmten Offiziers, Lieutenant Fleming, entzogen zu haben. Und das, obwohl Sie wegen des zu erwartenden Verfahrens bereits unter Arrest standen.«
Der Militärstaatsanwalt machte eine Pause. Unter der ausladenden Perücke, die die Würde seines Amtes unterstrich, zog er die Stirn in ernste Falten. Dann ließ er den Blick durch den gesamten Gerichtssaal schweifen bis hin zu dem Stuhl des angeklagten Offiziers und forderte ihn auf, sich schuldig oder nicht schuldig zu bekennen.
Adam Vincent erhob sich. Red hatte ihn bisher noch nicht richtig sehen können und erschrak bei seinem Anblick regelrecht. Neben seinem Anwalt, einem beleibten Mann mit Perücke und Robe, wirkte der junge Lieutenant unruhig und nervös. Sein gut geschnittenes Gesicht war totenbleich, und sein blonder Schopf gesenkt. Red fühlte Bestürzung über die Veränderung, denn er hatte ihn als einen unbeschwerten, athletischen jungen Riesen im Gedächtnis, der sich kaum je von etwas abschrecken ließ.
Vincents Antwort auf die formelle Frage des Militärstaatsanwalts war nicht zu hören. Aber bevor er aufgefordert werden konnte, seine Antwort zu wiederholen, sagte der Anwalt mit der Perücke an seiner Seite in festem Ton: »Die Antwort lautet: Nicht schuldig, Sir.«
Vincent aber konnte sich ihm gegenüber behaupten. Es gelang ihm, seine Fassung wenigstens teilweise wiederzuerlangen, und er richtete sich zu seiner vollen Größe auf.
»Ich bitte das Gericht um Nachsicht, Sir«, bat er mit lauterer Stimme. »Wenn Sie erlauben, würde ich mich gern selbst verteidigen, Sir.«
Der Vorsitzende, der Kapitän der Copenhagen, sah ihn mit hochgezogenen Brauen an.
»Der Rat eines Anwalts steht Ihnen zu, Mr Vincent«, wies er ihn auf seine Rechte hin. »Wie ich weiß, ist ein erfahrener Rechtsanwalt in Person von Sir David Murchison beauftragt worden, Sie zu vertreten. Ich muss gestehen, dass ich den Grund für Ihre Bitte nicht verstehe. Wünschen Sie etwa, nicht auf Sir David Murchisons Dienste zurückzugreifen?«
Adam Vincent senkte den Kopf. »Genau, Sir. Ich benötige keinen Rechtsbeistand, Sir. Ich habe nicht darum gebeten.«
Der Vorsitzende zog die Brauen noch weiter hoch. »Sie wären gut beraten, Mr Vincent, wenn Sie sich das durch den Kopf gehen ließen«, erklärte er geduldig. »Gegen Sie sind sehr schwere Anschuldigungen erhoben worden, und ich wage zu bezweifeln, dass Sie im Hinblick auf die Anklagepunkte mit dem Gesetz vertraut sind. Sie werden juristischen Rat benötigen, damit Ihre Verteidigung ordnungsgemäß durchgeführt und Ihnen ein fairer Prozess gemacht werden kann.«
»Bitte verzeihen Sie, Sir«, warf Vincent mit gepresster Stimme ein, »aber Sir David Murchison — ich meine, der Rechtsanwalt, Sir — wir stimmen in der Vorgehensweise meiner Verteidigung nicht überein. Wenn es Ihnen recht ist, Sir, möchte ich meinen Fall lieber selbst übernehmen und die ... die Zeugen befragen zu Dingen, mit denen ich vertraut bin.«
Mit gerunzelter Stirn blickte der Vorsitzende nun zum Militärstaatsanwalt, der keineswegs unfreundlich reagierte: »Meinen Sie, dass Sie persönlich die Zeugenbefragungen durchführen möchten, Mr Vincent? Falls ja, kann ich Ihnen mitteilen, dass Sie nach Anhörung der jeweiligen Zeugen durch das Gericht durchaus die Möglichkeit dazu haben. Sie können aber auch, falls Sie keinen erfahrenen Rechtsanwalt wünschen, einen von Ihnen gewählten Offizier damit beauftragen, die Zeugenbefragung in Ihrem Namen durchzuführen. Wie der Herr Vorsitzende schon sagte, sind die Anschuldigungen gegen Sie jedoch außerordentlich schwerwiegend. Daher wäre es in Ihrem eigenen Interesse, wenn Sie Sir David Murchisons sachkundigen Rat annehmen würden.«
»Danke, Sir«, erwiderte Adam Vincent. »Aber bei allem Respekt, Sir, bitte ich das Gericht um die Erlaubnis, meine Verteidigung selbst übernehmen zu dürfen, da ... da ich es für angebracht halte, Sir.«
Der Vorsitzende stieß einen ungeduldigen Seufzer aus. Der beleibte Anwalt, Sir David Murchison, sagte mit deutlicher Schärfe: »Gentlemen, dann werde ich mich aus diesem Fall zurückziehen.« Er machte vor dem Richterpult eine steife Verbeugung und ging zu den zwei Stuhlreihen, die für das allgemeine Publikum reserviert waren.
Red sah, dass kaum die Hälfte der Stühle mit den geraden Lehnen besetzt war. Und nach den Notizblöcken auf ihrem Schoß zu urteilen, waren die meisten der Zuschauer Journalisten, vermutlich Vertreter der Lokalpresse. Ganz am Ende der letzten Reihe jedoch erregte ein gut gekleideter, vornehm aussehender Gentleman in unverkennbar militärischer Haltung Reds Aufmerksamkeit. Er hatte weißes Haar und war wohl Mitte bis Ende fünfzig. Als der abgewiesene Anwalt neben ihm stehenblieb und sich zu einem kurzen, geflüsterten Meinungsaustausch verpflichtet sah, ging Red davon aus, dass es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um Adam Vincents Vater, den Earl of Cheviot, handeln müsse.
Offenbar hatte der Earl, ohne vorher das Einverständnis seines Sohnes einzuholen, einen berühmten Anwalt Ihrer Majestät mit seiner Verteidigung beauftragt, dachte Red.
Der verärgerte Gesichtsausdruck des Patriarchen schien Reds Vermutung zu bestätigen. Zwei oder drei der Journalisten drehten sich um, als hätten auch sie ihn bemerkt, und ihre Stifte bewegten sich eifrig über das Papier. Mit einer weiteren steifen Verbeugung raffte Sir David Murchison seine Robe und verließ den Gerichtssaal, während der Wachposten die Tür hinter ihm schloss und wieder Haltung annahm.
Red ließ seinen Blick über die Anwesenden schweifen und bemerkte unter den Reportern in der ersten Reihe einen weiteren Gentleman von militärischem Aussehen. Er mochte einige Jahre jünger sein als Lord Cheviot, war ebenfalls gut gekleidet, hatte sich aber weniger gut gehalten. Tiefe Falten durchzogen seine leicht gebräunte Gesichtshaut. Das Haar und der breite Kavallerie-Schnurrbart waren weiß gesprenkelt. Red kam es so vor, als habe er sich erst kürzlich von einer schweren Krankheit erholt. Gleichzeitig fragte er sich, in welcher Beziehung dieser Mann wohl zu dem jungen Vincent stand. Vielleicht war er ein Freund oder ein Offizier der Armee, den er in Indien kennengelernt hatte.
Der Mangel an Reportern ließ vermuten, dass der Fall für die überregionale Presse nicht von Interesse war. Wenn jedoch die Anwesenheit des Earl of Cheviot bekannt würde, könnte es durchaus sein, dass die Londoner Tageblätter einen Skandal witterten und ihre besten Leute eilends nach Portsmouth schickten, um so viel wie möglich über den Prozess zu berichten.
Der Vorsitzende hatte sich mit dem Militärstaatsanwalt kurz besprochen, und die Richter — für Red alles Fremde — tuschelten miteinander. Sobald der Militärstaatsanwalt wieder an seinen Platz trat, herrschte jedoch Stille. Der Vorsitzende verkündete mit lauter Stimme, dass der Bitte des angeklagten Offiziers stattgegeben wurde.
»Sie können Ihre Verteidigung selbst übernehmen, Mr Vincent«, sagte er kühl. »Obwohl ich Sie noch einmal darauf hinweisen muss, dass es nicht in Ihrem eigenen Interesse ist.« Da Vincent hartnäckig schwieg, zuckte der Kapitän der Copenhagen die epaulettengeschmückten Schultern, wandte sich an den Offizier, der die Anklage vertrat, und bat ihn zu beginnen.
Der Anklagevertreter war ein Kommandant mit einem sorgfältig gestutzten Bart, wie er inzwischen in der Königlichen Marine erlaubt war. Nach einer an das Gericht gewandten kurzen Einleitung rief er seinen ersten Zeugen auf.
Der Zeuge wurde vereidigt und gab seinen Namen mit Amos Cantwell an, Dritter Offizier des unseligen Kriegsschiffs, der Schaluppe Lancer.
Er war sichtlich nervös. Während er mit leiser, gepresster Stimme die Fragen des Anklagevertreters beantwortete, blickte er immer wieder wie in einer stummen Bitte um Vergebung zu dem Offizier hinüber, gegen den er aussagen sollte. Vincent antwortete mit einem außerordentlich warmen Lächeln und einem Nicken. Deutlich ermutigt, wurde Cantwell allmählich selbstsicherer, und seine meist einsilbigen Antworten kamen weniger zögernd.
Geschickt entlockte der bärtige Anklagevertreter ihm die Bestätigung der Ereignisse, auf die in den beiden ersten Anklagepunkten Bezug genommen wurde. Der Wind war den ganzen Tag über immer stärker geworden, hatte gegen Abend auf Südwest gedreht und war zu einem gewaltigen Sturm angewachsen. Cantwell machte genaue Angaben zur Position der Lancer. Er berichtete, wie sie mit starker Neigung leewärts gegen die haushohen Wellen angekämpft hatte. Captain Omerod war ganz plötzlich erkrankt, bezeugte der Lieutenant. Er selbst hatte die Abendwache übernommen, und beim Glasenschlag der Schiffsglocke um halb sieben hatte Lieutenant Vincent ihn über die Unpässlichkeit des Kapitäns informiert. Seiner Ansicht nach hatte das Schiff unter den herrschenden Wetterverhältnissen zu viele Segel gesetzt. Er berichtete weitere Einzelheiten. Red lauschte ihm ebenso bestürzt wie alle übrigen Mitglieder des Militärgerichts.
Denn allen war klar, dass der Befehl, die Segel zu reffen, notwendig und klug gewesen wäre.
»Sie haben einen solchen Befehl also nicht erhalten, Mr Cantwell?«, fragte der Anklagevertreter.
Cantwell schüttelte den Kopf. In Beantwortung einer Reihe von Fragen gab er zögernd zu, dass sowohl er als auch der Zweite Offizier der Lancer, den er am Ende der Nachmittagswache abgelöst hatte, um Erlaubnis ersucht hatten, die Segel einzuholen.
»Der Erste Offizier sagte, der Captain habe die Erlaubnis verweigert, Sir. Nachdem ich meine Bitte vorgetragen hatte, Sir, ging er hinunter, um nochmals mit Captain Omerod zu sprechen. Als er wieder an Deck kam, Sir, unterrichtete er mich, dass der Kapitän erkrankt sei und er das Kommando übernommen habe. Gleich darauf gab er den Befehl, die Segel einzuholen.«
»Lieutenant Vincent gab den Befehl?«
»Ja, Sir.« Amos Cantwell zögerte und warf Vincent wieder einen verstohlenen Blick zu. Nach erneutem Nicken fuhr er fort. »Die Toppsgasten hatten, nun ja, sie hatten Angst, Sir. Wir hatten eine Menge unerfahrener Matrosen an Bord, und bei so starkem Wind in die Takelage zu klettern, war nicht ganz ungefährlich. Mr Vincent fluchte, Sir, und sagte, er würde ihnen zeigen, wie man das macht.«
»Und hat er es getan?«
»O ja, Sir. Er schleuderte seine Stiefel von den Füßen, und er und der verantwortliche Bootsmann Kay kletterten gemeinsam hinauf. Die anderen Männer folgten ihnen.« Als Cantwell erst einmal im Redefluss war, berichtete er eifrig über die Geschehnisse und brachte Vincents Verhalten große Bewunderung entgegen.
Der bärtige Anklagevertreter aber holte ihn jäh auf den Boden der Tatsachen zurück. »Mr Cantwell, war der Erste Offizier zu diesem Zeitpunkt vollkommen nüchtern?«
»Nüchtern, Sir?«
»Ja, nüchtern, Mr Cantwell. Sie haben zu Protokoll gegeben, dass er zu schwanken schien und dass sein Atem nach Alkohol roch. Sie glaubten, er hätte beim Captain etwas getrunken. Ist das richtig?«
»Nun ja, Sir«, räumte Cantwell unglücklich ein. »Die Nacht war sehr kalt und stürmisch und ... also ich hätte schon etwas getrunken, Sir, wenn mir jemand etwas angeboten hätte. Mr Vincent gestand den Toppsgasten eine Ration Rum zu, als sie wieder an Deck waren. Er sagte, sie hätten es verdient, Sir. Und er selbst nahm auch einen Schluck. Nass bis auf die Haut war er, Sir, und eiskalt. Sie alle. Einer der neu angeheuerten Männer, Leichtmatrose Bowman, einer der Zeugen, Sir ... er rutschte von den Wanten des Großmastes ab, als er sich etwa acht Fuß über dem Deck befand. Zum Glück landete er auf einem Haufen Segeltuch, Sir, und wurde nur leicht verletzt. Seine Schulter war ausgerenkt, und der Erste Offizier genehmigte ihm eine doppelte Ration Rum und renkte sie ihm wieder ein, seine Schulter, meine ich, und ...«
Der Anklagevertreter schnitt ihm das Wort ab. »Ja, schon gut, wir werden zu gegebener Zeit die Aussage von Leichtmatrosen Bowman hören. Was ich festzustellen versuche und was das Gericht wissen möchte, ist der Zustand, in dem Lieutenant Vincent an Deck kam, nachdem er Captain Omerod in seiner Kajüte aufgesucht hatte. War er betrunken, Mr Cantwell?«
»Das kann ich nicht sagen, Sir.« Cantwell errötete.
»Sie müssen sich dazu äußern. Sie stehen unter Eid, Mr Cantwell.«
Wieder sah der junge Offizier unsicher zu Vincent hinüber, und wieder erhielt er ein beruhigendes Nicken.
»Sir, ich nehme an, dass er beim Captain etwas getrunken hat. Aber betrunken war er nicht, Sir. Er wusste genau, was er tat. Und das Schiff stampfte so heftig, dass sich keiner von uns an Deck mehr gerade halten konnte, Sir.«
»Also gut, Mr Cantwell«, räumte der Anklagevertreter ein. »Ich werde dem Gericht diese Entscheidung überlassen. Kommen wir nun zu den Umständen, unter denen Ihr Schiff verlassen wurde.«
»Das war erst viel später, Sir«, erklärte Cantwell, dem die Erleichterung, dass er keine Fragen zu Vincents Nüchternheitszustand mehr beantworten musste, deutlich anzumerken war. »Erst nach dem Feuer, Sir.«
Ohne zu stocken berichtete er nun, wie er nach Beendigung seiner Wache unter Deck gegangen sei, während Vincent als Wachoffizier der ersten Nachtwache an Deck zurückblieb. Dann sei er durch Warnrufe und die Bootsmannspfeife, die die Wachen unter Deck nach oben rief, aus dem Schlaf gerissen worden.
»Wir fanden uns alle ein, Sir. Es war sechs Glasenschläge der Hundswache, der zweiten Nachtwache, und Mr Rayburn war der Wachoffizier an Deck, aber der Erste Offizier befand sich auch dort. Er sagte, unter Deck sei Feuer ausgebrochen. Zwar sagte er nicht wo, Sir, aber Mr Rayburn teilte mir mit, dass es in der Kapitänskajüte sei. Mr Vincent rief, die Schläuche sollten ausgezogen werden, und er lief mit einem Brandtrupp nach unten. Ich blieb an Deck, Sir, und sah, dass wir der Küste gefährlich nahe kamen. Der Leuchtturm von Dursey Head war deutlich zu sehen.«
Anschaulich schilderte Amos Cantwell die verzweifelten Anstrengungen der Mannschaft, die Lancer von der Felsküste fernzuhalten.
»Mr Vincent hatte befohlen, das Focksegel zu setzen, aber Wind und Tide waren zu stark, Sir. Zwei kräftige Männer standen an der Ruderpinne, und ich half auch mit, aber das Schiff gehorchte dem Ruder nicht. Mr Rayburn sagte mir, sie hätten die halbe Nacht vergeblich gekämpft, und das Feuer hätte gerade noch gefehlt. Dann kam der Erste Offizier wieder an Deck, Sir. Er sagte, er wolle versuchen, das Schiff zu wenden und an Dursey Head vorbeizukommen ...«
Cantwell redete in einem fort, man brauchte ihn nicht extra dazu auffordern. Red versuchte, sich in eine ähnlich missliche Lage zu versetzen. Er war sich sicher, dass er unter den gegebenen Umständen ganz genauso gehandelt hätte wie der unglückselige Erste Offizier der Lancer.
»Wir steuerten den Bug herum, Sir, oder zumindest dachte ich das«, sagte Cantwell mit rauer Stimme. »Doch dann schwappten eine oder zwei Tonnen Wasser herein, und das Schiff bekam starke Schlagseite. Eine halbe Ewigkeit hing die Lancer völlig schräg, Sir, und plötzlich richtete sie sich auf. Und dann ...«Er brach ab, und aus seinem jugendlichen Gesicht wich sämtliche Farbe. »Mr Vincent schickte mich nach unten, um das Kommando über den Brandbekämpfungstrupp zu übernehmen. Ich sah, wie der Captain an Deck kam. Mr Lee und ein Matrose halfen ihm. Er sah sehr schlecht aus, Sir, und konnte sich kaum auf den Beinen halten. Ich hatte gerade den Trupp gefunden, als Befehl gegeben wurde, das Schiff zu ... zu verlassen.«
»Wer gab den Befehl, Mr Cantwell?«, fragte der Vorsitzende in scharfem Ton.
Cantwell wandte ihm den Blick zu.
»Das weiß ich nicht, Sir.«
»Was meinen Sie damit, Sie wissen es nicht?«
»Ich habe nur gehört, wie der Befehl wiederholt wurde, Sir. Ich befahl den Leuten vom Brandbekämpfungstrupp, ihn zu befolgen, und sie haben keine Zeit verloren. Sie liefen sofort an Deck, Sir.«
»Und Sie nicht?«, hakte der Vorsitzende nach, nachdem er ein Bündel Papiere durchgeblättert hatte, das vor ihm auf dem Tisch lag. »Warum nicht, Mr Cantwell?«
Cantwell verspannte sich. »Ich blieb unten, um sicherzustellen, dass niemand unter Deck geblieben war, Sir. Der Koch hatte sich kurz vorher schwer verbrüht, und ich wusste, dass er im Schiffslazarett lag. Außerdem war da noch der Leichtmatrose Bowman. Er war nach seinem Sturz aus den Wanten dort hingeschickt worden, und man hatte ihm eine Dosis Laudanum gegeben. Ich dachte, die beiden hätten den Befehl vielleicht gar nicht gehört, Sir.«
»Und hatten sie?«, fragte der Vorsitzende stirnrunzelnd.
»Nein, Sir«, erwiderte Cantwell. »Und unser Passagier auch nicht, Lieutenant Lane von der Königlichen Marine, Sir. Ich fand ihn in seiner Kajüte. Er sagte, er hätte während des ganzen Sturms geschlafen, Sir. Und im Lazarett traf ich auf den Ersten Offizier. Er hatte dasselbe vorgehabt wie ich, Sir.«
»Verstehe.« Der Vorsitzende nickte dem Anklagevertreter zu. Dieser fuhr mit seiner Befragung fort, indem er den Zeugen aufforderte, das weitere Geschehen zu berichten.
Plötzlich sah Cantwells jugendliches Gesicht um Jahre gealtert aus.
»Ich half Mr Vincent, die beiden Männer aus dem Lazarett an Deck zu bringen, Sir. Lieutenant Lane war uns schon vorausgeeilt, und er ... Sir, ich hörte ihn ausrufen: ›Sie sind untergegangen, so gut wie alle! Die Boote sind gesunken!‹ Und als ich an Deck kam, sah ich, dass er recht hatte. Es war schwierig, bei dem Wellengang überhaupt etwas zu erkennen. Aber ich sah, wie das Walfängerboot umkippte und seine Insassen ins Meer schleuderte. Einige Köpfe tauchten mehrmals auf, aber nicht lange. Und wir konnten ihnen überhaupt nicht helfen, Sir. Nur ein einziges Boot war noch an Bord des Schiffes — die Gig, Sir, aber die See hatte ihr ein großes Leck geschlagen. Wir mussten hilflos zusehen, wie sie alle ertranken.«
»Sie haben unser Mitgefühl, Mr Cantwell«, sagte der Vorsitzende mit schroffer Freundlichkeit. »Das muss ein schrecklicher Anblick gewesen sein.«
»Ja, Sir, das war es«, bestätigte Amos Cantwell düster. Er zitterte, und nach einem weiteren Blick zu Lieutenant Vincent fügte er flüsternd hinzu: »Ich wünschte, ich könnte es vergessen, Sir.« Dann nahm er sich zusammen, da er begriff, dass diese Tortur bald vorüber wäre, und sprach mit lauter Stimme: »Das Schiff wurde ungefähr ... oh, ungefähr zwei Stunden später an die Küste getrieben, Sir. Die Leute im Leuchtturm hatten unsere Notlage gesehen, und sie halfen uns, an Land zu schwimmen. Trotzdem, Sir, wurde ich beinahe weggespült. Der Erste Offizier, Mr Vincent, rettete mir das Leben. Er hielt mich fest, und dann schwamm er zurück zu Bowman, weil der nicht schwimmen konnte. Mr Vincent sollte nicht vor Gericht stehen, Sir. Er ...«
»Das«, unterbrach ihn der Vorsitzende streng, »haben nicht Sie zu beurteilen, Lieutenant Cantwell.« Er seufzte hörbar und richtete sich an den angeklagten Offizier. »Möchten Sie diesen Zeugen ins Kreuzverhör nehmen, Mr Vincent?«
Vincent erhob sich.
»Nein, Sir, vielen Dank. Mr Cantwell hat seine Aussage bewundernswert präzise gemacht. Ich habe keine weiteren Fragen, Sir.«
Der Vorsitzende sah sich fragend zu beiden Seiten um.
»Gentlemen? Haben Sie irgendwelche Fragen, die Sie Mr Cantwell stellen möchten?«
Nur ein einziges Mitglied des Militärgerichts machte von dieser Aufforderung Gebrauch. Fast zehn Minuten lang versuchte er in aggressivem Ton, Amos Cantwell einzuschüchtern, er solle zugeben, dass der Erste Offizier betrunken gewesen sei. Doch seine Bemühungen blieben erfolglos. Als der Kommandant endlich von seiner Befragung abließ und sich damit einverstanden erklärte, dass der Zeuge entlassen würde, war Vincents Gesicht rot vor Wut.
Der nächste Zeuge entlockte dem Kommandanten ein Lächeln voll unverhohlener Zufriedenheit. Es war ein kleiner, stämmiger Bursche in Marineuniform mit stahlgrauem Haar und dem leichten Anflug eines Cockney-Akzents.
Ein altgedienter Soldat, vermutete Red, dessen Karriere unter seiner mangelnden Bildung gelitten hatte.
Er gab seinen Namen mit Thomas Arthur Lane an und seinen Rang als den eines Lieutenants. Im Wesentlichen bestätigte er die Aussage des jungen Cantwell. Allerdings gab er zu, dass er während der schlimmsten Phase des Sturms geschlafen hatte.
»Weil ich nun mal Passagier war, Sir, und keine besonderen Pflichten zu erfüllen hatte, und weil todsicher ’ne stürmische Nacht auf uns zukommen würde, hab ich mich in meiner Kajüte aufs Ohr gelegt. Die Kajüte von Captain Omerod war aber nicht weit weg — sozusagen in Hörweite, wenn nur laut genug gesprochen wurde. Und das wurde es, Sir. Er und der Erste Offizier haben sich gestritten, dass die Fetzen flogen — jawoll, alle beide.«
»Wollen Sie damit sagen, Sir«, fragte der anklagende Offizier, »dass Sie gehört haben, wie der Kapitän und der Erste Offizier so etwas wie eine heftige Auseinandersetzung hatten?«
»Das war mehr als ’ne Auseinandersetzung, Sir, mehr als’n bloßer Streit«, behauptete der Marineoffizier überzeugt. »Was sie genau gesagt haben, konnt ich nicht verstehen. War aber auch nicht nötig. Ich hab auch so gewusst, dass sie sich ganz und gar nicht einig waren. Angebrüllt hat der Captain Lieutenant Vincent, hat ihn wer weiß was genannt, wenn ich das richtig mitgekriegt hab. So ein, zwei Worte hab ich ja aufgeschnappt. Aber nicht genug, dass ich sagen könnt, worum es eigentlich ging.«
Als Lane sich der gespannten Aufmerksamkeit der gesamten Zuhörerschaft im Gerichtssaal bewusst wurde, machte er eine kurze Pause und verzog die schmalen Lippen zu einem freudlosen Lächeln.
»Ich hab gehört, wie Mr Vincent sagte, das Schiff geriete in Bedrängnis, wenn man nicht die Segel reffen würde. Aber der Captain schickte ihn bloß zum Teufel. ›Ich werde die Segel einholen lassen, wenn ich das für nötig halte‹, hat er gesagt.«
»Haben Sie außerdem noch etwas gehört?«, fragte der Anklagevertreter rasch.
Lane schüttelte den Kopf. »Nein, Sir, weil sie dann aufgehört haben. Ich hab gehört, wie der Erste Offizier die Kapitänskajüte verlassen hat. Ich wollt mich ihm in den Weg stellen und fragen, was denn los ist. Aber er rannte an mir vorbei und gab keine Antwort.«
»Konnten Sie, überlegen Sie genau, Mr Lane, konnten Sie sich ein Bild davon machen, ob Mr Vincent getrunken hatte?«
»Er war betrunken, Sir«, erwiderte der Marineoffizier ohne zu zögern. »Er wankte und torkelte, und er roch nach Alkohol. Und außerdem sprach er ganz undeutlich.«
Der Vorsitzende griff ein.
»Ich dachte, Sie sagten, Mr Vincent hätte nicht mit Ihnen gesprochen, als Sie versucht haben, ihn aufzuhalten?«
Lane fuhr sich mit der Zunge über die Lippen und lächelte wieder. »Ich hab gesagt, dass er mir keine Antwort gegeben hat, Sir. Und das stimmt. Jedenfalls nicht auf meine Frage. Aber gesprochen hat er schon. ›Der Captain ist krank geworden‹, hat er gesagt. ›Ich übernehme das Kommando. Dann ging er an Deck. Er torkelte, wie ich schon gesagt hab. Und ich bin zurück in meine Kajüte und hab mich schlafen gelegt.«
»Sie haben sich schlafen gelegt, Mr Lane?«, rief der Vorsitzende. »Sie haben sich tatsächlich zum Schlafen in Ihre Koje gelegt?«
»Ja, Sir. Und ich hab geschlafen, bis der junge Offizier, Lieutenant Cantwell, mich geweckt hat. Er hat gesagt, ich soll an Deck gehen, weil Befehl gegeben worden war, das Schiff zu verlassen.«
Red bemerkte die erstaunte Miene des Vorsitzenden.
»Sie waren in der Lage zu schlafen, obwohl Sie wussten, dass Mr Vincent, der Ihrer Beobachtung nach betrunken war, das Kommando über das Schiff übernommen hatte? Waren Sie nicht beunruhigt?«
»Wozu sollte ich denn beunruhigt sein, Sir?«, rechtfertigte sich Lane gekränkt. »Ich bin doch kein Deckoffizier. Ich hätte sowieso nichts tun können. Und außerdem hab ich die Bootsmannspfeife gehört und den Befehl an die Matrosen, in die Takelage zu klettern und die Segel zu reffen. Ich dachte, wir würden schon mit den Schwierigkeiten fertig werden und ... na ja, ich war müde, Sir. Also hab ich mich aufs Ohr gelegt. Dann weiß ich erst wieder, dass Lieutenant Cantwell gerufen hat, ich soll an Deck gehen.«
Was Lieutenant Lane sonst noch aussagte, erhärtete die Angaben von Amos Cantwell. Wenn er auch den Bericht von ihrer Rettung etwas mürrisch vorbrachte und Vincents Anteil daran nicht besonders hervorhob. Auf die Frage nach dem Zustand des Angeklagten zu jenem Zeitpunkt räumte er, immer noch leicht mürrisch, ein: »Da war er schon nüchtern genug. Hat ja auch genug Zeit gehabt, nicht?«
Als Vincent wie zuvor angeboten wurde, den Zeugen ins Kreuzverhör zu nehmen, lehnte er zu Reds Überraschung wiederum höflich ab. Von den Mitgliedern des Militärgerichts unternahm nur der schmalgesichtige, ältere Kommandant mit Namen Sigsworth, wie Reds unmittelbarer Nachbar ihm mitteilte, den Versuch, die Ursache der Auseinandersetzung zwischen dem Kapitän der Lancer und seinem Ersten Offizier zu ergründen. So lange er aber auch auf Lane einreden mochte, konnte dieser nur seine persönliche Meinung dazu äußern, die der Militärstaatsanwalt allerdings für unzulässig hielt.
»Sie sind sich aber völlig sicher, Mr Lane«, beharrte Commander Sigsworth, »dass Lieutenant Vincent alles andere als nüchtern war, als Sie ihn vor der Kapitänskajüte ansprachen?«
»Da bin ich mir meiner Sache ganz sicher, Sir«, behauptete Lane. »Lieutenant Vincent war betrunken. Nicht gerade volltrunken, aber ihm fiel es schon schwer, sich auf den Beinen zu halten, Sir. Und wie schon gesagt, sprach er undeutlich. Ich konnt ihn kaum verstehen. Und er roch so stark nach Alkohol, als ob er sich mit dem Zeug begossen hätte.«
Er durfte den Zeugenstand verlassen, und die Sitzung wurde bis nach dem Mittagessen unterbrochen. Da der Admiral abwesend war, wurde es in der geräumigen Tageskajüte serviert. Bei Tisch wurde Red von dem Vorsitzenden des Militärgerichts, dem Kommandanten des Flaggschiffs — dessen Name, wie er erfuhr, Duckworth war —, offiziell willkommen geheißen.
»Captain Broome ist soeben aus unserer australischen Kolonie zurückgekehrt, Gentlemen«, verkündete Duckworth. »Erst gestern hat auf seiner Fregatte, der Galab, die Mannschaft abgemustert. Deshalb mag er sich zu Recht darüber wundern, dass sein wohlverdienter Landurlaub aufgeschoben werden musste. Der Grund für Ihre Mitwirkung an diesem Verfahren, mein lieber Freund, ist folgender: Die halbe Flotte befindet sich mit dem Konteradmiral auf See, um unseren Alliierten, den Portugiesen, einen Freundschaftsbesuch abzustatten. Daher sind ranghohe Kapitäne derzeit knapp.«
Da er erfahren hatte, dass Red die übrigen Richter bei diesem Verfahren nicht kannte, stellte er sie ihm mit einem freundlichen Lächeln namentlich vor.
»Wie es den Anschein hat, waren Sie lange fort.«
»Beinahe vier Jahre, Sir«, entgegnete Red.
»Gehörten Sie nicht kürzlich bei dem Aufstand in Bengalen zu der Shannon -Marinebrigade?«, fragte einer seiner Kapitänskollegen.
»Ich gehörte zum Verbund der Brigade, ja, Sir«, erwiderte Red. Er bediente sich von den Speisen, die ein Steward in schmucker Uniform ihm anbot, und hoffte, nicht nach seiner früheren Bekanntschaft mit Adam Vincent befragt zu werden. Die unvermeidliche Frage kam aber doch wie vorauszusehen von Commander Sigsworth, und Red nickte zustimmend.
»Während des Einsatzes habe ich zusammen mit Lieutenant Vincent gedient, Commander, und sein Verhalten war vorbildlich. Diese Meinung wird übrigens nicht nur von mir vertreten. Ich möchte hinzufügen, dass der verstorbene Captain Peel ihn für eine Beförderung wärmstens empfohlen hat. Ich, nun, ich war überrascht und gleichzeitig bestürzt, ihn hier vor Gericht zu finden. Das muss ich zugeben. Vor allem wegen so schwerwiegender Anschuldigungen.«
Gern hätte er noch mehr gesagt, besann sich aber eines Besseren. Womöglich würde sonst seine Unparteilichkeit angezweifelt.
Captain Duckworth bemerkte seine Verlegenheit und warf rasch ein: »Wir alle sind bestürzt, Captain Broome, dass wir über einen Offizier zu Gericht sitzen müssen, der allem Anschein nach eine hervorragende militärische Karriere vor sich hatte. Und noch dazu jemand, der für seine Tapferkeit im Krimkrieg mit dem Viktoriakreuz ausgezeichnet wurde. Aber ...« Resigniert zuckte er die Schultern und antwortete auf eine Bemerkung von Sigsworth, die Red nicht gehört hatte.
Mit dem Einverständnis aller wandte sich die Unterhaltung anderen Themen zu, und erst als das Essen vorüber war und die Offiziere sich auf ihre Rückkehr in den Gerichtssaal vorbereiteten, hielt Commander Sigsworth Red am Ellbogen fest.
»Sie waren außer Landes, Captain Broome«, sagte der ältere Mann mit gesenkter Stimme, »deshalb haben Sie von dem Skandal, in den Lieutenant Vincent verwickelt ist, wohl nichts mitbekommen. Das Gerücht geht um, Sir, dass Vincent mit der Frau seines früheren Kommandanten, John Omerod, ein Techtelmechtel hatte. Sie ist eine sehr schöne Frau, Caroline Omerod.«