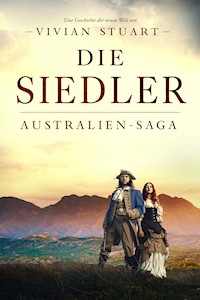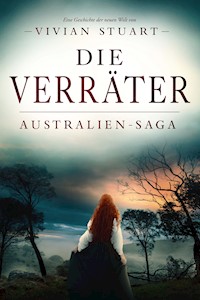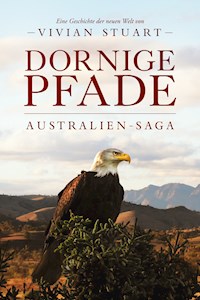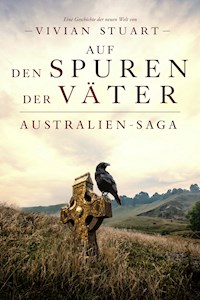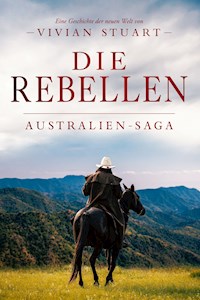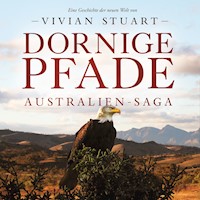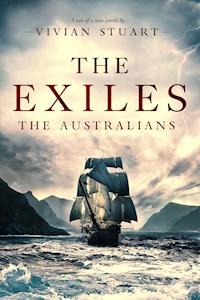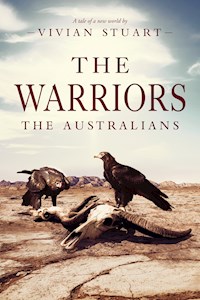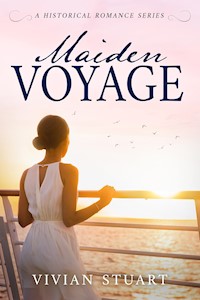Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: Jentas EhfHörbuch-Herausgeber: Skinnbok
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Australien-Saga
- Sprache: Deutsch
Ein neues Jahrhundert ist angebrochen. Neue, große Hoffnungen prägen das Leben der jungen Australier in ihrem eigenen Land. Einige- wie der junge Tolo Mason - ziehen auf der Suche nach Gold und Ruhm ins menschenleere Outback. Andere - wie die Nachkommen der Broomes - finden ihre Erfüllung in der Politik und ergreifen die Macht im Land. Und einige ziehen nordwärts nach Neu-Guinea, um neues Land zu erobern.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 851
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Machtbesessenen
Die Machtbesessenen – Australien-Saga 12
© Vivian Stuart (William Stuart Long) 1990
© Deutsch: Jentas ehf 2022
Serie: Australien-Saga
Titel: Die Machtbesessenen
Teil: 12
Originaltitel: The Imperialists
Übersetzung : Jentas ehf
ISBN: 978-9979-64-322-7
–––
Was ist Australien? Eine große, hungrige und durstige Wildnis mit ein, zwei Städten zum Nutzen ausländischer Spekulanten, hauptsächlich bevölkert von gekreuzten Schafen und teilweise von Narren.
Henry Lawson, australischer Dichter und Erzähler
Jemand, der dieses Land zum Vergnügen bereist, würde auch zum Zeitvertreib in die Hölle gehen.
R. T Maurice, australischer Geograph
Die australische Geschichte liest sich nicht wie eine historische Darstellung, sondern wie ein wunderschönes Lügenmärchen. Sie ist voller Überraschungen und Abenteuer und Ungereimtheiten und Widersprüche und Unglaublichem; doch all das ist passiert.
Mark Twain, amerikanischer Tourist
Prolog
Wenn Sie mich fragen, Sir«, sagte Lieutenant James Camber, »würde ich den Einheimischen gewisse Gebiete britischen Empires am liebsten schnell wieder zurückgeben.«
Kapitän Andrew Broome von der Royal Navy wandte sich seinem jungen Offizier zu und lachte in sich hinein. »Ich finde, Sie haben es sehr treffend formuliert, James. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass es das Kolonialministerium oder das britische Volk ebenso sieht.«
An die Reling seines Schiffes gelehnt, betrachtete Kapitän Broome die ungewöhnliche Szenerie, die sich seinem Auge bot. Das Schiff, die HMS Durable, lag in Port William Inlet auf der Östlichen Falklandinsel vor Anker. Oberhalb des Hafens, direkt an der Küste in der Stadt Stanley, standen einige Holzhäuser mit so farbenfroh gestrichenen Dächern, als wollten sie sich von der tristen, frostigen Landschaft dieses Außenpostens des britischen Empires besonders abheben. Seit die Durable in das Gebiet der Falklandinseln vorgedrungen war, schien zum ersten Mal die Sonne. Und der Kapitän stellte mit Überraschung fest, dass diese Inseln im Südatlantik ja doch etwas Farbe zu bieten hatten.
Der in Australien geborene Kapitän Broome war zwar auf den Namen Andrew getauft worden, doch sein auffälligstes Attribut, das von seinem Vater geerbte rostrote Haar, hatte ihm den von allen Verwandten und Bekannten benutzten Spitznamen Rufus oder Rufe eingebracht.
Er konnte sich nicht erinnern, wann ihn jemand das letzte Mal Andrew genannt hätte. Sein richtiger Name war vermutlich nicht einmal all seinen Offizierskollegen und Besatzungsmitgliedern bekannt.
Groß und kräftig, wie er war, machte er in seiner tadellos sitzenden winterblauen Uniform und der Kaltwetterausrüstung an Deck eine richtig gute Figur. Er hatte seinen Mantelkragen hochgeschlagen, die Hände in den Taschen vergraben und den Schirm seiner Kapitänsmütze tief in die Augen gezogen. Ab dem 50. Grad südlicher Breite konnte es sogar mitten im Sommer empfindlich kalt werden.
»Nur ein Seemann kann die Ausmaße des britischen Empires wirklich ermessen, stimmt’s, James?«, bemerkte Rufe.
»Das ist wohl wahr, Sir«, entgegnete der Lieutenant.
»Was mich angeht«, fuhr Rufe fort, »ich bin froh, wenn diese Reise zu Ende ist und wir unseren Heimathafen in Sydney erreichen. Wissen Sie, dass ich in den über dreißig Jahren meiner Marinezugehörigkeit kaum einmal einen Fuß in meine Heimat gesetzt habe? Meine Familie lebt zum größten Teil in Sydney, und ich habe sie in all den Jahren höchstens ein halbes Dutzend Mal gesehen. Ich freue mich schon auf meine Rückkehr.«
»Kann ich mir gut vorstellen, Sir«, erwiderte der Lieutenant. Dann bemerkte er eine kleine Bewegung an der Kohlenstation am Kai von Stanley und sah durch sein Fernglas. »Da war das Zeichen, Sir. Sie sind so weit, dass wir kommen können.«
»Sehr gut«, sagte Rufe. »Treffen Sie die erforderlichen Vorbereitungen, Lieutenant.«
Die Durable war ein Torpedoboot-Zerstörer, obwohl die meisten Marinesoldaten sie und die übrigen Schiffe dieses Typs einfach als Zerstörer bezeichneten. Sie war knapp fünfundfünfzig Meter lang, hatte eine Wasserverdrängung von dreihundertzwanzig Tonnen und war zusätzlich zu ihren drei Achtzehn-Zoll-Torpedorohren mit drei Sechspfündern und einem Zwölfpfünder bestückt. Sie diente sowohl zur Verteidigung gegenüber feindlichen Torpedobooten als auch zum Angriff auf größere Schiffe. Weshalb man in diese kalten und weitgehend leeren südatlantischen Gewässer ein Kriegsschiff beordert hatte, blieb dem Kapitän und seiner Mannschaft ein Rätsel. Die einzige Erklärung wäre, dass die Royal Navy bis in die am weitesten entlegenen Gebiete des britischen Empires präsent sein sollte.
Die Tatsache, dass das britische Empire sich bis zu den Falklandinseln erstreckte, war durch den auf der Kohlenstation von Stanley flatternden Union Jack deutlich ersichtlich. Allerdings dehnte das britische Empire sich noch weiter nach Süden aus: durch die Drake Passage bis zu den Südlichen Shetlandinseln unmittelbar oberhalb des Südlichen Polarkreises und darüber hinaus — zumindest hatte man Anspruch darauf erhoben — bis zur Antarktis, den sturmumtosten Schneemassen und dem ewigen Eis dieses südlichsten Kontinents.
Nachdem die Durable eine volle Ladung Kohle aufgenommen hatte, war sie über und über mit Ruß bedeckt. Murrend, wie es unter Seeleuten üblich ist, machte die Besatzung sich daran, das Schiff zu säubern. Und sie hörte erst dann damit auf, als alles wieder wie geleckt aussah und selbst das kleinste Kohlenstäubchen in der letzten, unzugänglichsten Ecke an Bord entfernt war.
Der Himmel zog sich zusammen, und der Nebel wurde so dicht, dass von den freundlich gestrichenen Dächern Stanleys nichts mehr zu sehen war. Sobald die Sichtverhältnisse es erlaubten, brachte Rufe die Durable hinaus aufs offene Meer. Der antarktische Sommer stand vor der Tür, und Rufe hatte den Befehl, die fast nicht endende Helligkeit der Tage zu nutzen, um die Gewässer rund um den eisbedeckten Kontinent zu erforschen. Rufe setzte Kurs auf die Südlichen Orkneyinseln und sichtete an einem trüben Tag, der Sturm verhieß, die Coronation Insel. Nachdem sie die Orkneyinseln hinter sich gelassen hatten, gab er Befehl, Kurs nach Süden zu nehmen und in den als Weddellmeer bekannten Teil der antarktischen Gewässer einzudringen.
Die Durable war nicht für die Bequemlichkeit der auf ihr lebenden Männer konzipiert worden. Der Wind, der den klaren Geruch von ewigem Eis mit sich brachte, blies durch die offene Brücke, und die Unterkünfte sowohl der Offiziere als auch der Mannschaft waren nur unzureichend beheizt. Während die Wellen sich immer höher auftürmten und das Schiff winzig klein erscheinen ließen, rollte und stampfte es durch die eisigen Wassermassen. Wenn es ganz unten in einem Wellental angelangt war, befand sich selbst der Schornstein unterhalb des Wellenkamms. Es herrschte Windstärke sieben. An Land konnte ein solcher Sturm große Bäume biegen; auf See und ganz besonders in diesen Breiten war das jedoch etwas völlig Normales.
Als die eisige Dünung ständig höher wurde und sich zu knapp zwanzig Meter hohen Wellen auftürmte, glich die Reise immer stärker einer Fahrt in der Berg- und Talbahn auf dem Jahrmarkt. Die Durable kämpfte gegen die hohe Dünung und führte dabei alle Bewegungen aus, die ein auf der Wasseroberfläche treibender Gegenstand überhaupt nur ausführen kann: Sie stieg auf, drehte sich, drehte sich erneut, hielt sich einen Augenblick in der Schwebe, tauchte dann ab, drehte sich und donnerte in ein Wellental hinab, während die eiskalte Gischt an den vorderen Geschütztürmen entlang über das gesamte Deck spritzte.
»Ziemlich spektakulärer Auftritt«, bemerkte Rufe Broome. Niemand in der gesamten Marine konnte sich mit Rufe Broome messen, der seit seinem vierzehnten Lebensjahr zur See gefahren war. Trotzdem hatte er ein ungezwungenes Verhältnis zu seinen jungen Offizieren, solange diese seine Freundlichkeit nicht auszunutzen versuchten.
»Ich bin mir ziemlich sicher, Sir, dass da ein Missverständnis vorliegt«, erwiderte James Camber. Es war seine Wache, doch der Kapitän stand gemeinsam mit ihm auf der Brücke. Beide Offiziere hatten sich dick in ihre Kaltwetterausrüstung eingepackt. »Sind Sie sicher, dass unser Befehl nicht lautet, auf schnellstem Weg in die Korallensee zu fahren?«
Rufe lachte. »Zu schade, dass Sie nicht der ranghöhere Offizier sind. Sonst würde ich mich einfach dumm stellen und zulassen, dass Sie unsere Befehle genau in diese Richtung interpretieren.« Nichts hätte Rufe lieber getan, als direkten Kurs auf diese ruhigen Gewässer vor der australischen Nordostküste zu nehmen.
Aufgabe der Durable war es, im eisigen Weddellmeer Wetterbeobachtungen vorzunehmen und die Bedingungen des Packeises zu untersuchen. Anschließend sollte sie in Richtung Westen durch die Drake Passage fahren und sich so nah an der antarktischen Küste halten, wie die Witterungsbedingungen es nur zuließen, bis sie das Rossmeer und das Ross Schelfeis erreichte — eine Eismasse fast so groß wie Frankreich.
Hier, am unteren Ende der Welt, brachte eine verhältnismäßig kurze Reise ein Schiff rasch über viele Längengrade. Folglich würde die Fahrt vom Weddellmeer zum Rossmeer die Durable von einem Punkt südlich von Südafrika zu einem entsprechenden Punkt südöstlich von Australien und Neuseeland bringen. Nach dem schwierigen Abdrehen an der antarktischen Küste würde Rufe sich zumindest damit trösten können, sich näher an seiner Heimat zu befinden.
Die Erforschung hoher Breitengrade hatte in Marinekreisen äußerste Priorität. Auch andere Schiffe waren mit dieser Aufgabe betraut. Die Tatsache, dass die Durable nicht zu dem Zweck gebaut worden war, sich durch das Packeis vorzuarbeiten, hatte die Admiralität offenbar nicht weiter gestört. Zum Glück waren Rufes Befehle mit vorsichtigen Formulierungen versehen, wie beispielsweise >falls möglich<. Und er würde nicht zögern, im Notfall von dieser Befreiungsklausel Gebrauch zu machen. Sobald das Eis allzu bedrohlich wurde, würde er umkehren. Denn falls die Durable erst einmal im Packeis festsäße, könnten ihre Metallwände viel leichter zusammengedrückt werden als die der Holzschiffe, die speziell für die Erforschung der Arktis und der Antarktis konstruiert worden waren.
Die Männer, die die Wetterbeobachtungen vornehmen sollten, führten ihre Aufgabe mit großer Sorgfalt aus. Wenn später die Wissenschaftler die von der Durable im Weddellmeer vorgenommenen Aufzeichnungen mit denen im Rossmeer oder auch mit den von anderen Schiffen notierten Beobachtungen verglichen, ließe sich genauer sagen, welche Klimabedingungen an den verschiedenen Stellen des eisbedeckten Kontinents herrschten.
Innerhalb der nächsten halben Stunde drehte der Wind um neunzig Grad. Er erreichte Windstärke zehn und wurde somit zu einem richtigen Sturm. Eine riesige Dünung mit weißen Schaumkronen und immer dichter werdenden Wellentälern und -kämmen türmte sich zischend und brodelnd um das Schiff herum auf. Die Durable bockte und drehte sich, tauchte ab und wurde mit eiskalter salziger Gischt besprüht, die über das gesamte Deck bis hin zum Heck ablief. Während der Sturm weiter wütete, wurden das Deck, die Takelage und die Aufbauten mehr und mehr von einer dünnen Eisschicht überzogen. Rufe gab Befehl, das Heck in den Wind zu drehen und auf nordöstlichen Kurs zu gehen. Zwar wäre es bequemer gewesen, den Sturm mit dem Bug abzureiten, aber in dieser Richtung lagen die Palmer Halbinsel und das küstennahe Packeis.
Die Sicht war nicht beeinträchtigt, denn es stand keine einzige Wolke am Himmel. Der Sturm rührte von einem kräftigen polaren Unwetter her, und bis zum Morgen war das Schiff stark vereist und wurde von dieser tonnenschweren Last immer tiefer ins Wasser gedrückt. Rufe schickte die Besatzung mit Äxten hinaus, um die zunehmend gefährliche Last abzusplittern.
Der Sturm hielt unvermindert an. An Land wären bei dieser Sturmstärke Bäume entwurzelt worden. Die Wellen hoben das Heck der Durable an, fegten unter ihr hindurch und ließen sie rückwärts von den Wellenkämmen in die Tiefe fallen. Die Matrosen, die das Eis abhackten, mussten sich rasch abwechseln, damit sie keine Frostbeulen bekamen. Der Boden unter ihren Füßen war glatt und rutschig durch das Eis, sodass die Männer sich nur unter schwierigsten Bedingungen und unter größten Mühen fortbewegen konnten. Sie lehnten sich gegen den Wind, und große Stücke von den Äxten abgeschlagenes Eis flogen dicht an ihnen vorbei.
Dass das Unglück nicht schon früher passierte, war eigentlich ein Wunder. Plötzlich rutschte eine der Äxte am Eis ab und glitt einem Seemann mit voller Wucht ins Knie. Sofort schoss das Blut aus der offenen Arterie. Der Mann stürzte, stöhnte verzweifelt auf und hielt sich mit beiden Händen das Bein.
James Camber konnte den Unfall von der Brücke aus beobachten und rannte sofort an Deck. Einige Seeleute versuchten, die starke Blutung zu stillen. Genau in dem Moment, als Camber bei dem Verletzten eintraf und die Matrosen zur Seite scheuchte, war auch der Schiffssanitäter zur Stelle. Dieser brachte auf der Kleidung des Verletzten eine Aderpresse an und befahl einigen Männern, ihn ins Schiffslazarett zu bringen. Camber folgte ihnen.
Im Schiffslazarett angekommen, musste Camber stark schlucken, um nicht sein Frühstück abzugeben, als der Schiffssanitäter das Bein freilegte. Die Axt hatte die Kniescheibe und die Knorpel des Matrosen durchtrennt, sodass der Unterschenkel nur noch an einem dünnen Streifen Fleisch sowie an den starken Bändern in der Kniekehle hing.
»Das ist ein Fall für den Chirurgen«, sagte der Sanitäter.
»Das meinen Sie doch nicht im Ernst«, erwidere Camber.
Der verletzte Matrose war bewusstlos.
»Wenn das Bein nicht abgenommen und die Blutung gestillt wird, gibt der Mann bald den Geist auf«, fuhr der Sanitäter fort. »In der Walfangstation auf Südgeorgien gibt es einen Arzt.«
»Ich werde das mit dem Captain besprechen«, sagte Camber.
Sobald Rufe Broome sich den Bericht angehört hatte, sah er in die Karten und stellte einige Berechnungen an. Die Durable befand sich mehr als eintausendfünfhundert Meilen von Südgeorgien entfernt inmitten eines antarktischen Sturms. Rufe überließ das Kommando auf der Brücke seinem Stellvertreter, Lieutenant Camber, und begab sich unter Deck.
Der Verletzte war zwar bei Bewusstsein, aufgrund des verabreichten Morphiums aber halb betäubt. »Wie geht es Ihnen, mein Sohn?«, fragte Rufe ihn.
»Der Doc sagt, ich werde mein Bein verlieren«, antwortete der Matrose mit schwacher Stimme.
»Das steht fest«, sagte Rufe. »Aber da ist noch etwas. Sind Sie Manns genug, um sich einer unangenehmen Wahrheit zu stellen?«
»Mir bleibt wohl keine Wahl, Sir, oder?«
»Zumindest keine große«, bestätigte Rufe. »Der nächste Bauchaufschneider befindet sich auf Südgeorgien. Eine Möglichkeit wäre, nach Norden abzudrehen und Kurs auf Südgeorgien zu nehmen, wobei wir den ganzen Weg von einem Wellental ins andere schlingern müssten. Und bis wir dort ankämen, wären Sie wahrscheinlich längst verblutet.«
Der Mann schüttelte abwehrend den Kopf.
»Die andere Möglichkeit wäre, dass der Doc und ich das Wenige, was noch von Ihrem Bein übrig ist, durchschneiden und die Arterien abbinden. Gleichzeitig könnten wir versuchen, den Sturm auf offener See abzuwettern und danach sofort nach Südgeorgien zu fahren, damit der dortige Arzt unser Werk zu einem hübschen, ordentlichen Abschluss bringen kann.« Er legte dem jungen Burschen die Hand auf die Schulter. »Ich denke, Ihnen ist klar, was wir tun müssen.«
Der Matrose nickte mit grimmiger Miene.
Nervös suchte der Sanitäter die erforderlichen Instrumente zusammen und stellte den Äther bereit. Rufe, der sich seine Hände und Arme sorgfältig geschrubbt und einen Arztkittel übergezogen hatte, untersuchte das verletzte Bein, während der Sanitäter dem Patienten den Äther verabreichte.
Die Sehnen am Bein des jungen Burschen waren überraschend fest, und Rufe musste sich tüchtig anstrengen, bis er sie endlich durchtrennt hatte. Gemeinsam mit dem Sanitäter machte er die Hauptarterie ausfindig und band sie ab. Durch den Druck ließ auch die Blutung aus den übrigen Adern nach. Als schließlich nur noch eine kleine Menge Blut in den Verband sickerte, wickelte Rufe den amputierten Unterschenkel in ein Laken, wusch sich die Hände und ging zurück auf die Brücke.
Während der kommenden Stunden ließ der Sturm etwas nach, und das Schiff kam allmählich weiter nach Norden, musste aber nach wie vor gegen hohe Wellen ankämpfen. Das Bein des Matrosen erhielt eine Seebestattung, allerdings ohne jegliches Zeremoniell.
Die südgeorgische Walfangstation war ein rauer, unwirtlicher Ort. Das Auslassen von Walfett und das Auskippen der Abfälle in die Bucht, wo Tausende von Seevögeln sich um die besten Bissen zankten, verbreiteten einen unerträglichen Gestank. Der ortsansässige Arzt roch stark nach Rum. Als er den Stumpf des jungen Seemanns untersuchte, blieben seine Hände jedoch ruhig.
»Ich würde hier nicht gerade von einer ordentlichen Arbeit sprechen«, sagte der Arzt.
Er sah Rufe offen an und lächelte. »Aber Sie haben dem Burschen ganz offensichtlich das Leben gerettet, Captain. Außerdem habe ich von zugelassenen Ärzten schon Schlimmeres gesehen.«
Mithilfe des Sanitäters gab er dem Matrosen erneut eine Narkose und stutzte den Stumpf zurecht, zog die Haut vom Oberschenkel teilweise bis über das rohe Fleisch und nähte sie dort an. Der junge Seemann wurde im Lazarett der Walfanggesellschaft auf Südgeorgien zurückgelassen, damit der Arzt sich weiter um ihn kümmern konnte. Die Durable fuhr in Richtung Südwest davon.
Durch den Umweg zu der Südgeorgia-Insel war einiges an Zeit für die Erforschung der antarktischen Gewässer verloren gegangen. Statt ins Weddellmeer zurückzukehren, fuhr die Durable direkt durch die Drake Passage in Richtung Rossmeer, überquerte die unsichtbare Linie, die den Südlichen Polarkreis markierte, bog am 150. westlichen Längengrad ins Rossmeer ein und umschiffte damit einen großen Teil der Erdkugel.
Bei strahlendem Wetter erreichte die Durable das Rossmeer. Der Himmel war so tiefblau, wie Rufe es noch nirgendwo auf dieser Erde gesehen hatte. In der Ferne glitzerte ein hochfliegender Seevogel wie ein weißes Juwel in der Sonne, und die Wellen, die sich leicht unter dem Schiff durchschoben, waren so farblos wie ein Eisklumpen aus Süßwasser. Die Durable bahnte sich vorsichtig ihren Weg durch Treibeis. Riesige Tafeleisberge, so hoch wie eine Kathedrale, glitten an ihr vorbei. Die Luft war kalt und von einer geradezu berauschenden Reinheit.
Am Horizont sah man schneebedecktes Eis funkeln, doch allmählich verwandelte das Meer sich in Schneematsch, und Eisschollen von zerbrochenem Packeis erforderten häufige Kursänderungen. Ein Schwarm Pinguine schwamm in Reih und Glied an der Durable vorbei. Die schmucken kleinen Schwimmer tauchten ins Wasser, kamen wieder an die Oberfläche und hielten auf das ferne weiße Funkeln zu. Ein Stück Treibeis krachte an Backbord voraus mit solcher Wucht auf die Durable, dass Rufe lieber Vorsicht walten ließ.
»Tja, Lieutenant«, sagte er zu Camber, »mir scheint, wir sind so weit, wie das Eisaufkommen es zulässt.«
»Zu dieser Schlussfolgerung war ich bereits gestern gekommen, Sir«, entgegnete Camber.
»Ist schon irgendwie enttäuschend«, meinte Rufe. »Wo wir jetzt so nah sind, würde ich doch gern den Eissockel sehen. Und sei es nur, um später sagen zu können, dass ich so nah an den weißen Kontinent herangekommen bin.«
»Wir geben einfach vor, wir wären nah genug gewesen, um den Eissockel zu sehen. Ich schwöre, ich werde es keiner Menschenseele erzählen, wenn Sie die Wahrheit ein wenig hinbiegen, Sir.«
Rufe seufzte. Er gab Befehl, die Durable zu wenden. Wie zur Bestätigung, dass seine Entscheidung, nicht weiter in das dem Eisschelf vorgelagerte Packeis einzudringen, richtig war, verdunkelte sich der Himmel mit erschreckender Geschwindigkeit und machte den antarktischen Tag plötzlich zur Nacht. Riesige Wellen türmten sich auf, und eisiger Regen überzog das Schiff mit einer feinen Eisschicht. Der Schneematsch, durch den die Durable sich vorgeschoben hatte, gefror nach und nach zu einer dünnen, harten Eiskruste. Rufe befahl halbe Kraft voraus. Die Durable kämpfte gegen die hohen Wellen an und schmetterte ihnen herausfordernd ihren Bug entgegen, bis sie zwei Tage später aus der Dunkelheit des Sturms auftauchte und sich in einer ruhiger gewordenen See wiederfand, wo die Dünung nur noch gut fünfzehn Meter hoch war und glatte Wellenkämme hatte.
Rufe brachte die Durable westlich an der Macquarie-Insel im Südwesten von Neuseeland vorbei und fuhr östlich an Tasmanien entlang. In einem Klima, das ihm weit angenehmer war, fuhr er mit seinem Schiff langsam in den neuen Hafen von Sydney ein, den Sydney Harbour. Er war nach Hause gekommen
Teil 1
1
Westaustralien
Im Land der »riesigen Schlange, so groß wie ein umherwandernder Berg« herrschte drei Jahre lang ununterbrochen die Dürre mit ihrem glutroten Taumel aus Hitze, Hunger und Durst. Eine Gruppe vom Stamme der Baadu aus Warrdarrgana hatte sich auf ihren Wanderungen weit entfernt von ihrem Zuhause, das ihren Vorfahren in der lange zurückliegenden Traumzeit gegeben worden war. Die Leute litten große Not und Entbehrung, und ohne Ganba wären sie längst verhungert.
Doch ebenso, wie die Baadu ihr Stammesmitglied Ganba respektierten, war er unter ihnen auch gefürchtet und verhasst.
Ganba hatte grobe, ausdrucksstarke Gesichtszüge. Über seiner vorspringenden fleischigen Nase und seinen buschigen Augenbrauen erhob sich eine flache, fliehende Stirn, die in einen dick eingefetteten dichten, auf dem Hinterkopf spitz zulaufenden Haarschopf überging. Für einen Baadu war Ganba ein sehr behaarter Mann. Er hatte eine starke, dunkle Gesichtsbehaarung, und seine breite Brust war von zahlreichen zeremoniellen Narben übersät.
Die Alten sagten, Ganba sei so groß und stark, weil man ihn als Kind während einer ähnlichen Dürreperiode und Hungersnot nach und nach mit dem Fleisch seiner jüngeren Schwestern gefüttert und seine Haut als Schutz gegen die sengende Sonne mit ihrem Fett eingerieben hatte. Daher war Ganba schneller gewachsen als die gleichaltrigen Jungen, und die Initiationsriten waren gemeinsam mit älteren Jungen an ihm vorgenommen worden, die sich trotz ihrer Jahre nicht an Kraft und Körpergröße mit ihm messen konnten.
Der Leib seiner kleinen Schwestern aber hatte ihn nicht nur breit und fett gemacht, sondern ihn auch mit einem unstillbaren Hunger auf menschliches Fleisch versehen.
In seinem Stamm wusste niemand genau, was Ganbas Einstellung zu seinen Mitmenschen geprägt hatte. Es hieß, dass ihm in seinem ganzen Leben noch nie ein Mann, eine Frau oder ein Kind begegnet seien, die er leiden mochte. Sogar seine leibliche Mutter hatte er gehasst, ebenso wie seine verschiedenen Stammesmütter und seine älteren Geschwister. Am liebsten hätte er sie alle aufgegessen. Doch da sie älter oder stärker waren als er, hatte er keine Chance gegen sie gehabt. Kaum aber war er kräftig genug, machte er es sich zur Gewohnheit, seine Mutter und jede andere Frau zu verprügeln, die es wagte, sich seinen Wünschen und Bedürfnissen zu widersetzen. Einmal warf Ganba einem jungen Mädchen Sand in die Augen, sodass sie erblindete. Offenbar war er noch stolz auf diese Tat.
Aus all diesen Gründen ließen die Männer ihn bei den Initiationsriten während des Wawarning, bei dem sie ihn in die Luft warfen, mehrmals auf den Boden fallen, statt ihn aufzufangen. Und die Schläge, die sie ihm verabreichten, waren nicht wie bei den übrigen Jungen nur zeremonieller Art. Ganba reagierte wütend, doch als es ans Bluttrinken ging, vergaß er rasch seinen Zorn. Die Baadu tranken allesamt Blut, doch nur wenige von ihnen entwickelten eine solche Vorliebe für menschliches Blut wie Ganba.
Nachdem Ganba die Initiationsriten überlebt hatte und zum Mann herangewachsen war, wurde er zum Träger der »Tötungssandalen« — zeremonieller Fußspangen ohne Sohlen. Nur derjenige durfte sie tragen, der von seinem Stamm dazu auserwählt worden war, Hinrichtungen vorzunehmen. Auf diese Weise machte Ganba nun Jagd auf menschliches Wild. In Zeiten des grässlichsten Hungers wurde er allerdings auch zum Hauptnahrungslieferanten für die umherwandernde Gruppe vom Stamme der Baadu.
Als die Sonne weiterhin gnadenlos vom Himmel brannte und sich auch im dritten Jahr keinerlei Wolken zeigten, die eine Unterbrechung der Dürreperiode prophezeit hätten, traf Ganba zwei wichtige Entscheidungen. Zum einen würde er das Land der »riesigen Schlange, so groß wie ein umherwandernder Berg« verlassen, und zum anderen würde er nicht allein gehen. Er suchte sich ein junges, dralles, hart arbeitendes Mädchen und teilte ihrer Familie mit, dass er sie zur Frau nehmen würde. Zu bitten hatte er nicht nötig. Als Brautpreis bot er an, der Familie Nahrung zu beschaffen.
Bildana, das junge Mädchen, wurde von blankem Entsetzen ergriffen. Sie war sich nicht sicher, ob Ganba sie als Bettgenossin oder als Mahlzeit haben wollte. Am liebsten wäre sie weggelaufen. Nur die noch größere Angst vor den unsichtbaren Dingen im Busch, vor den Ungeheuern und Geistern, die noch schrecklicher waren als die Möglichkeit, dass sie wie mehrere frühere Frauen Ganbas auf seiner Feuerstelle braten würde, hielt sie davon ab.
Da Bildana nicht fliehen konnte, bat sie ihren Kommuru, den Bruder ihrer Mutter, um Hilfe. »Das Töten der Ehefrauen muss aufhören«, sagte sie. »Ich weiß, dass Frauen, die sich freiwillig einem Mann hingeben, nach unserer Sitte in Zeiten der Hungersnot gegessen werden. Ganbas Ehefrauen aber waren unberührt, und indem er sie tötete, hat er das Stammesrecht verletzt.«
Der Kommuru nickte.
Seit der Traumzeit, als die Menschen noch in Gestalt von Kängurus, Barramundis und Bergkängurus über die Erde gingen, waren Zeremonien ein wichtiger Bestandteil im Leben der Baadu. In diesem Jahr unerbittlicher Dürre bereiteten sich gemeinsam mit Ganba vier weitere junge Männer auf ihre Hochzeit vor. Bildanas Kommuru wollte versuchen, Ganba während einer bestimmten Phase des sich in die Länge ziehenden Festes zu töten.
Die fünf heiratswilligen Männer standen den Kommurus ihrer künftigen Ehefrauen in einer Reihe gegenüber. Unter ihnen befand sich auch Bildanas Kommuru. Ein jeder der älteren Männer hielt die Leber eines Unglückseligen von einem anderen Stamm in der Hand, der von den Baadu-Jägern erlegt worden und somit zu einem Bestandteil der Festlichkeiten geworden war. Die Kommurus warfen Stücke der rohen Leber in die Luft. Die jungen Männer, die sich auf ihre Hochzeit vorbereiteten, mussten sie mit dem Mund auffangen. Dabei war es ihnen streng verboten, die glitschigen Fleischbrocken mit den Händen oder mit den Zähnen zu berühren. Bei diesem Zeremoniell handelte es sich um eine todernste Angelegenheit. Falls einer der künftigen Ehemänner die Leber mit den Händen berührte oder dabei beobachtet wurde, wie er seine Zähne benutzte, oder falls er die rohen, blutigen Stücke erbrach, musste auch er sterben und bereicherte danach den Hochzeitsschmaus.
Bildanas Kommuru schnitt nach und nach immer größere Stücke ab und warf sie in den weit geöffneten Mund des Mannes, der seine Lieblingsnichte zur Frau haben wollte. Fieberhaft versuchte er, Ganba dazu zu zwingen, das ihm zugeworfene Leberstück zu verfehlen, es mit den Händen oder Zähnen zu berühren, an den immer dicker werdenden Stücken zu ersticken oder sich zu erbrechen.
Zu Ganbas Linker ertönte ein unterdrücktes Stöhnen. Ein junger Mann, durch Krankheit und die lange Dürre geschwächt, krümmte sich und würgte blutige Leberstücke aus. Aus dem Dunkel hinter den lodernden Flammen schrie ein junges Mädchen vor Kummer laut auf, als einer der Stammesältesten den in den Überlieferungen vorgesehenen Schlag ausführte.
Der schwächliche junge Mann würde nie das Vergnügen erfahren, eine Frau zu besitzen.
Ganba lachte nur und öffnete den großen Mund, um ein noch dickeres Stück Leber aufzufangen, das Bildanas Kommuru ihm zuwarf. Er ließ das glitschige Fleisch über seine Zunge gleiten, ohne es mit den Zähnen zu berühren, und schluckte krampfhaft. Mit dem frischen Blut der Leber löschte er gleichzeitig seinen Durst.
»Du hast versagt, alter Mann«, spottete Ganba. Wütend warf der Kommuru ein letztes Stück Leber in die Luft, und Ganba schluckte es gierig, rülpste zufrieden und warf der sich windenden Bildana einen lüsternen Seitenblick zu. »Der da« — er schob seinen staubigen Fuß unter die Leiche des jungen Mannes neben sich und hob sie ein wenig an — »wird für eine Mahlzeit nicht viel hergeben,«
Bildanas Hochzeitsnacht war schmerzlich, aber zum Glück sehr kurz. Ganba nahm sie schnell und brutal und schob sie danach verächtlich mit dem Fuß zur Seite. Sie hockte sich, so nah es ging, an die andere Seite des Feuers und zitterte in der kalten Nachtluft.
In der Totenstille der frühen Morgenstunden rollte sie sich nackt in die noch warme Asche und schlief.
Als Bildana von den Absichten ihres Ehemannes erfuhr, wäre es ihr fast lieber gewesen, er hätte sie sofort aufgegessen. Ganba plante eine lange Wanderung nach Westen, immer der aufgedunsenen, glühend heißen Sonne entgegen. Einen so endlos langen Marsch ins Ungewisse an der Seite eines Mannes wie Ganba sah Bildana als unerträgliches Schicksal an. Weinend und stöhnend, beladen mit sonnengetrocknetem Menschenfleisch, folgte sie ihrem Herrn und Gebieter in das ausgedörrte Never Never Land.
Im letzten Moment entschlossen sich einige der Baadu, Ganba auf seinem Weg zu begleiten. Ganba grinste sie höhnisch an, machte sich über sie lustig und fragte sie, wie sie den Marsch durch die Wüste wohl überleben wollten. Er hätte jedenfalls nur gerade genug Nahrung für sich und seine Frau bei sich.
»Wenn die alle mitkommen wollen«, vertraute er Bildana an, »werden wir genug zu essen haben, ohne dass wir noch mehr mitschleppen oder unterwegs jagen müssen!« Seine Lippen verzogen sich zu einem breiten, selbstzufriedenen Grinsen und entblößten seine faulenden Backenzähne.
Bildana schauderte. Zu gern hätte sie die Narren gewarnt, die ihren Ehemann freiwillig begleiteten, dass sie nichts weiter als ein Festmahl auf zwei Beinen für ihn waren. Doch sie fürchtete Ganbas Zorn zu sehr, um ihn zu hintergehen.
Die Nahrung, die Bildana bei sich trug, war bald verzehrt. Bildana hatte Hunger und Angst, sie könnte die Erste sein, die Ganbas Appetit zum Opfer fiel. Deshalb war sie insgeheim froh über den Unfall einer der Frauen aus ihrer Gruppe. Diese war in einen Felsspalt gestürzt und lag nun laut stöhnend auf dem Boden. Frisches rotes Blut schoss an den Stellen, an denen die scharfen Kanten ihrer gebrochenen Knochen sich durch die Haut schoben, aus beiden Beinen. Ganba kletterte in den Felsspalt hinab, machte dem Schreien der Frau ein rasches Ende und zerlegte sie sogleich an Ort und Stelle. Ihren Körper im Ganzen aus dem tiefen Spalt zu befördern, wäre zu schwierig geworden. Deshalb reichte Ganba die einzelnen Fleischstücke zu den anderen hinauf.
Der Ehemann der getöteten Frau erhob keinerlei Einwände, denn er sah die Notwendigkeit von Ganbas Handeln vollkommen ein. Im Grunde handelte es sich um einen Akt der Gnade. Hätte Ganbas Axt dem Leiden der Verletzten nicht ein rasches Ende bereitet, hätte sie einen langsamen, qualvollen Tod erlitten. Nun würde sie den Geistern der Traumzeit zumindest mit dem Verdienst gegenübertreten können, einigen ihrer Stammesmitglieder in Notzeiten mehrere Tage lang als Nahrung gedient und ihnen somit beim Überleben geholfen zu haben.
Ganbas kleine Gruppe erreichte die Anhöhen unweit des Meeres und eine Stadt der Weißen, die an einem Fluss erbaut worden war. Außer der einen Frau war niemand aus ihrer kleinen Schar verloren gegangen oder getötet worden. Denn als sie näher zur Küste kamen, hatten sich Ganbas Speer genug Ziele in Form von Kängurus geboten.
Nun stand Ganba auf einer der Anhöhen und sah zu der Stadt hinunter, die die Weißen Perth nannten. In den Straßen herrschte reges Treiben, und soeben fuhr ein kleines Schiff aus dem Hafen ins offene Meer hinaus und zog eine dunkle Rauchwolke hinter sich her.
»Diese Weißen, sind die wild und gefährlich?«, fragte Bildana.
Ganba antwortete nur mit einem Knurren. Als junger Mann war er im Outback hin und wieder auf Gruppen von Weißen gestoßen. Er hatte gesehen, wie sie ihre Fleischnahrung mit Feuerwaffen erlegt hatten. Magischer Rauch war aus den Mündungen ihrer langen schwarzen Stöcke gedrungen und hatte die Kängurus über eine Entfernung zu Fall gebracht, die der Speerwurf des stärksten Mannes nie hätte erreichen können. Schon damals hatte er die Weißen gehasst, denn er wusste, dass sie Eindringlinge in seinem Land waren. Ihre Waffen jedoch hätte er gerne besessen.
Bei anderer Gelegenheit hatte er gesehen, wie ein Weißer einem anderen im Austausch gegen kleine runde Metallscheiben einen Schießstock gegeben hatte. Einer der Ältesten seines Stammes hatte ihm den Gebrauch des Geldes der Weißen erklärt, und wieder war Ganba von Gier erfüllt gewesen.
Beim Anblick der Stadt Perth empfand er großes Selbstvertrauen. »Der weiße Mann wird uns nichts tun«, sagte er zu Bildana. »Wir gehen da hinunter und werden unter unseresgleichen sein.« Er zeigte auf einen Außenbezirk mit verfallenen Behausungen, den sogenannten Humpies, armseligen Hütten, die die Aborigines aus allen möglichen von den Weißen ausrangierten Materialien errichtet hatten.
Als Ganba seine Gefährten in die Barackensiedlung führte, erkannte er sofort, dass die dort lebenden Menschen Vertreter unterschiedlicher Stammesgruppierungen waren. Die verschiedensten Dialekte wurden hier gesprochen und außerdem eine Art gebrochenes Englisch als eine von sämtlichen Stammesmitgliedern akzeptierte Möglichkeit, um sich untereinander zu verständigen.
Ganba wusste nicht noch hätte es ihn gestört, dass die ursprünglich an dieser Küste lebenden Aborigines schon vor langer Zeit den Waffen und Krankheiten der Weißen zum Opfer gefallen und die derzeitigen Bewohner der Humpy-Toum so wie auch er Außenseiter waren, die es aus dem trockenen Landesinneren an die Küste verschlagen hatte. Ebenso wenig wusste er, dass Westaustralien — wie die Weißen Ganbas Heimat nannten — inzwischen Teil einer vereinten Nation war, die sich über den gesamten Kontinent erstreckte: der Australische Staatenbund. Ganba wusste nur zweierlei. Er wollte bestimmte Dinge, über die die Weißen verfügten, in seinen Besitz bringen. Und dazu müsste er das Geld der Weißen entweder verdienen oder stehlen. Letzteres entsprach zwar eher Ganbas Talenten, doch kannte er auch Mittel und Wege, sich das Geld zu verdienen.
Zunächst einmal vertrieb Ganba einen schwächeren Mann mitsamt seiner Familie aus dessen ärmlich gebauter Hütte. Durch das Zusammenspiel von Einschüchterung, Betrügereien und Diebstahl gelang es ihm, genug Nahrung zu beschaffen, um seine Gruppe am Leben zu erhalten und dafür zu sorgen, dass Bildanas Hinterteil rund und attraktiv blieb. Dies war mehr als wünschenswert, denn er hatte mit ihr bestimmte Pläne.
Ganba ging regelmäßig hinunter zum Hafen und beobachtete die ankommenden und auslaufenden Schiffe, bis ein japanischer Perlenfischer am Kai anlegte und schnatternde kleine Männer an Land eilten. Diese braunhäutigen Männer wurden von einem grimmig dreinblickenden, grauhaarigen, gefährlich aussehenden Aborigine mit einem breithüftigen Mädchen an der Seite erwartet — einem Mädchen, das man, wie sie bald erfuhren, mieten konnte.
Solange das japanische Schiff im Hafen vor Anker lag, fehlte es Ganba an nichts. Doch schließlich fuhren die Japaner ab, und die folgenden Schiffe brachten nur Weiße an Land, von denen die meisten keinen Gefallen an einem Aborigine-Mädchen fanden. Hin und wieder wurde Ganba von weißen Costables wegen Diebstahls gefasst und bestraft. Und wenn er wieder aus dem Gefängnis der Weißen entlassen wurde, gab es in seiner Humpy nichts zu essen. Er sehnte sich nach einer ausgiebigen Mahlzeit von halb durchgebratenem Menschenfleisch. Doch Perth wurde vom Gesetz der Weißen beherrscht, und er wagte es nicht, auf eine solche Jagd zu gehen.
An diesem Punkt seines Lebens, als er beinahe bereit war, aufzugeben und ins Never Never Land zurückzukehren, hörte er von dem jungen Weißen, der einen Führer ins Landesinnere suchte.
2
Misa Masons Stellvertreter in Perth, der ihre Interessen bei den weit gestreuten Geschäftsbeteiligungen des Mason-Unternehmens vertrat, war Robert Endicott, Rechtsanwalt, Geschäftsmann und Familienvater. Endicott hasste Australien und insbesondere Westaustralien mit großer Leidenschaft. Und er schwor sich, solange der Herrgott ihm seine Empfindungsfähigkeit erhielt, würde sich daran auch nie etwas ändern. Er war ein gut gebauter Mann mittleren Alters und trug mit Stolz einen ordentlich gestutzten Spitzbart, der durch ein Stückchen fast unnatürlich blasse englische Haut von seinem Backenbart getrennt war. Wenn er durch die Straßen ging, kleidete er sich — zumindest behaupteten das die waschechten australischen Urtypen — wie ein Londoner Zuhälter.
Endicott war beunruhigt.
Als der Sohn der Frau, die das Jon-Mason-Geschäftsimperium geerbt hatte, plötzlich gemeinsam mit seiner jungen Frau in seinem Vorzimmer auftauchte, fühlte der Handelsvertreter sich etwas überrumpelt. Die Mason-Geschäftsinteressen in Perth beschränkten sich größtenteils auf reine Routine-Verschiffungen. Alltägliche Gebrauchsgegenstände kamen herein, und Rohstoffe sowie Nahrungsmittel gingen hinaus. Dieser Güterverkehr machte nur einen kleinen Anteil des Mason-Handelsunternehmens aus. Jon Masons Witwe hatte sich den Ruf erworben, eine schonungslose, überaus tüchtige Geschäftsfrau zu sein. Gleich nach Übernahme des Unternehmens ihres verstorbenen Gatten hatte Misa Mason es von korrupten Angestellten gesäubert und auch einige der unabhängigen Vertreter entlassen. Endicott hatte sich in seinem Geschäftsgebaren nicht das Geringste vorzuwerfen. Da seine Anwaltstätigkeit in Perth nicht gerade lukrativ war, machten die hohen Gebühren, die er für die Abfertigung der Mason-Schiffe berechnete, einen beträchtlichen Teil seines Einkommens aus. Mrs Mason, die in sicherer Entfernung an der gegenüberliegenden Seite des Kontinents in Sydney lebte, hatte diese Gebühren nie infrage gestellt. Vielleicht würde sich das jedoch bald ändern.
Endicott betrachtete nervös Thomas Mason, der bei ihm zur Tür hereinkam. Er war von dem auffälligsten Merkmal des jungen Mannes, dessen Größe, zutiefst beeindruckt. Der junge Mason hatte seine imposante Statur von den samoanischen Vorfahren seiner Mutter geerbt und überragte Endicott bei Weitem. Trotz seines gut sitzenden, teuren Straßenanzugs hatte es den Anschein, als wollten seine breiten Schultern den Stoff jeden Moment zum Platzen bringen. Auf Endicott, mit seinen ein Meter dreiundsiebzig und knapp siebzig Kilo ein normaler Durchschnittsmann seiner Generation, wirkte diese geballte Kraft beinahe bedrohlich.
Endicott taxierte den jungen Mann. Thomas Mason hatte dichtes pechschwarzes Haar und ein wohlgeformtes Gesicht. Seine Haut war nur unwesentlich dunkler als die eines Weißen, der die meiste Zeit seines Lebens im Busch verbracht hatte. Seine Nase war schmal — typisch englisch wie die seines Vaters — und die Augen dunkelbraun. Der junge Mann hatte eine natürliche, gelassene Haltung und ein sicheres Auftreten.
Erst nach einer halben Minute richtete Endicott seine Aufmerksamkeit auch auf das junge Mädchen, das sich bei Thomas eingehängt hatte und ihm nur knapp bis zur Schulter reichte. Endicott war beeindruckt von ihrer strählenden Schönheit. Er räusperte sich verlegen, bevor er das Paar stammelnd begrüßte.
Die rothaarige Java Gordon Mason war erst achtzehn, besaß aber die Ausstrahlung und Würde einer seit Jahren glücklich verheirateten Frau. Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen war ihr Gesicht durch die kürzliche Reise von Sydney durch halb Australien sonnengebräunt, was ihr ausgezeichnet stand. Sie trug ein schlichtes, dunkelblaues Reisekleid. Ihr Arm, mit dem sie sich bei ihrem Mann untergehakt hatte, war zart, ihre Hände schmal mit langen Fingern und sorgsam manikürten Nägeln.
Sie hielt den Blick auf Endicott gerichtet, als wollte sie sich ein Bild von seiner Größe machen. Dann schaute sie zufrieden zu ihrem Ehemann auf, den sie mit Tolo ansprach. Bei ihrem Augenausdruck fühlte der ältere Mann sich peinlich berührt. Er hatte das schon bei anderen jungen Paaren erlebt: Manche von ihnen strahlten eine so deutlich spürbare sexuelle Energie aus, eine so beunruhigende Leidenschaft, dass sie bei jüngeren Männern Neid und Begehrlichkeit auslösen mochten. In Endicotts Fall aber verursachten sie nur ein einfühlsames Lächeln, gefolgt von einem Anflug von Traurigkeit. Diese jugendliche Flamme, dachte er, würde sich nur allzu rasch verzehren.
»Ah, Mr Mason«, sagte Endicott, ging um seinen Schreibtisch herum und schüttelte dem jungen Mann die Hand. »Es ist mir eine Ehre und ein großes Vergnügen, dass Sie uns besuchen.« Erneut räusperte er sich. »Erst vergangenen Monat erhielt ich eine offizielle Mitteilung Ihrer Mutter.« Er holte tief Luft. »Oder ist es schon zwei Monate her?«
»Wir sind nicht wegen der Mason-Geschäfte hier«, erwiderte Tolo.
Als Endicott hörte, dass der junge Mason nicht in seinen Geschäftsbüchern herumschnüffeln würde, stieß er einen erleichterten Seufzer aus. Doch dann sah er ihn verdutzt an. Perth hatte nicht gerade den Ruf eines Badekur- oder Urlaubsortes. »Wie kann ich Ihnen helfen?«, fragte er schließlich.
»Wir haben die Absicht, ins Landesinnere zu reisen«, erklärte Tolo schlicht und einfach. »Ich möchte Studien über die Aborigines betreiben.«
»Ach du lieber Himmel«, entgegnete Endicott. »Das kann doch nicht Ihr Ernst sein!«
»Das ist uns sogar sehr ernst«, bestätigte Java.
»Könnte sein, dass ich für den Kauf der Ausrüstung auf Reserven Ihrer Konten zurückgreifen muss«, fügte Tolo hinzu.
Endicott nickte bloß. Er nahm an, dass der Sohn dieser außergewöhnlichen Frau, die die Mason-Geschäftsangelegenheiten regelte, nicht das Geringste über den mörderischen Busch wusste, der Perth ans Meer drängte. Doch schließlich war es nicht seine Aufgabe, dem jungen Mann Instruktionen zu erteilen. »Sie werden einen Führer benötigen«, sagte er.
»Haben Sie jemand Bestimmten im Sinn?«, fragte Tolo.
»Ja, allerdings«, antwortete Endicott. »Sein Name ist Terry Forrest. Ich schätze, er weiß mehr übers Outback als sonst ein Sterblicher.« Er errötete. Die Sprache aufs Überleben zu bringen, kam ihm beinahe taktlos vor. Doch falls Thomas Mason auf dieser Reise ins Landesinnere bestand, würde er Endicotts Ansicht nach ungeachtet seiner Körpergröße sterben müssen. Eine Schande, dachte er, wenn der junge Narr seine hübsche Frau mitnähme und sie in der sengenden Hitze verschrumpeln, verhungern und verdursten würde. Aber er war nun einmal der Mason-Vertreter in Perth, und der Sohn der Eigentümerin hatte ihn um seine Dienste gebeten. Also sollte er sie haben.
Tolo und Java waren erst am Tag zuvor in Perth eingetroffen. Das Schiff war in den frühen Morgenstunden eines sonnigen Maitages in Fremantles großem Hafen eingelaufen, sodass sie genug Zeit hatten, in Ruhe an Bord einer Barkasse die zwölf Meilen den Swan River hinaufzufahren bis nach Perth Water, der breiten Bucht vor der Stadt.
Jetzt, da das Abenteuer seinen Lauf nahm, kamen Tolo immer wieder Zweifel. Nach den langen, ruhigen, glücklichen Monaten, die er und Java auf der Mason-Viehfarm verbracht hatten, wo er Java mit niemandem teilen musste, ärgerte er sich beinahe über die Anwesenheit anderer Leute. Java jedoch blühte regelrecht auf. Sie hatte die Reise entlang der australischen Südküste sehr genossen. Sie kannte den Namen und die Lebensgeschichte sämtlicher Offiziere sowie der meisten Besatzungsmitglieder an Bord der Mason-Schifffahrtslinie. Ihr hatte es gefallen, neue Leute kennenzulernen, und sie hatte sich auf ihre Ankunft in Perth gefreut. Mehr noch als Tolo hatte sie auf das Verlassen der heimatlichen Viehfarm hingewirkt, denn sie war begierig darauf, die Expedition nach Westaustralien fortzuführen.
Tatsächlich war es nicht ihr erster Besuch in Perth. Vor fast zwei Jahren, als Java noch nicht ganz siebzehn Lenze zählte, waren die beiden von zu Hause durchgebrannt und hatten in Sydney bei Javas Eltern, Sam und Jessica Gordon, für eine Familienkrise gesorgt. Die Flucht der jungen Leute war zwar völlig impulsiv und überstürzt vonstatten gegangen, aber trotzdem hatte Tolo alles sorgsam durchdacht. Er hatte seine Braut zunächst nach Perth gebracht, wo für den Fall, dass die Gordons versuchen sollten, die Ehe ihrer noch minderjährigen Tochter annullieren zu lassen, der Arm des Gesetzes von Neusüdwales sie nicht erreichen konnte.
Tolo hatte überlegt, seine Braut direkt auf die alte Mason-Viehfarm außerhalb von Melbourne zu bringen. Auch dort wären sie vor eventuellen gesetzlichen Maßnahmen der Gordons sicher gewesen. Doch falls es Sam in den Sinn gekommen wäre, hätte er dem Paar auf die Viehfarm folgen und seine Tochter zurückholen können. Nein, hatte Tolo sich überlegt, es wäre besser, Java so weit wie möglich fortzubringen an einen unbekannten Ort.
Sam und Jessica aber unternahmen keinerlei Schritte, um Java nachzureisen oder die Ehe für ungültig erklären zu lassen. Stattdessen hatte Sam seiner Frau, die völlig von Sinnen zu sein schien, ernsthaft geraten, sich mit der Heirat ihrer Tochter abzufinden. Schließlich war Tolo kein schlechter Bursche. Eher ein Erfolgstyp. Immerhin hatte er sich bereits als erfolgreicher Grundstückskäufer erwiesen und würde sich höchstwahrscheinlich auch zu einem treusorgenden, liebevollen Ehemann entwickeln.
Diese Empfindungen wurden deutlich aus einem Brief, den Sam über die Mason-Schifffahrtsgesellschaft an Java versandt hatte, da er keine Adresse von ihr besaß. Der Brief erreichte sie schließlich in Perth. Beruhigt durch seinen Inhalt entschlossen sich Java und Tolo, auf die Mason-Farm unweit von Melbourne zurückzukehren — in Tolos Zuhause, wo er als Kind zum ersten Mal die wundersamen Geschichten über die Traumzeit der Aborigines gehört hatte.
In den kommenden Monaten lernte Java die Viehfarm fast ebenso lieben wie ihr junger Ehemann. Weitere Briefe wurden nach Sydney gesandt und immer nur von Sam beantwortet. Die Antwortschreiben drückten seine große Liebe zu Java aus — und auch Jessicas, obwohl Jessica selbst nie schrieb. Das war Java nicht entgangen, und es schmerzte sie. Java sehnte sich danach, ihre Mutter zu sehen und natürlich auch ihren Vater. Sie glaubte, sie könnte erst dann wirklich Frieden mit ihnen schließen, wenn sie sich Aug in Aug gegenüberstanden. Und sie sehnte sich auch danach, ihre Großmutter wiederzusehen, Jessicas Mutter Magdalen, deren Briefe zwar weniger häufig kamen, aber sehr liebevoll waren und vernünftige Ratschläge zum Eheleben enthielten. Doch die Monate verstrichen wie im Flug, und das junge Paar ging völlig auf in seinem Glück und der täglichen Routine auf der geschäftigen Viehfarm. Tolo erwies sich als fähiger junger Verwalter. Nie war er zu stolz, eine Lehre anzunehmen von einem der alten Hasen, die seiner Familie schon seit vielen Jahren gedient hatten und wussten, wie man einen so großen Besitz effizient am Laufen hielt.
Tolo schrieb an seine Mutter, Misa Mason, die inzwischen ständig in Sydney lebte. Zuerst war sie über das Durchbrennen der beiden jungen Leute entsetzt gewesen, doch dann hatte sie sich für ihren Sohn gefreut und gebetet, sein Lebensweg möge durch seine überstürzte Entscheidung nicht beeinträchtigt werden. Als gebürtige Samoanerin hatte sie unter den weißen Australiern genug Vorurteile erfahren, und ihrer Ansicht nach sollten Rassenüberlegungen bei Herzensangelegenheiten keine Rolle spielen — ebenso wenig wie bei allen anderen Dingen. Mit ihrer liberalen Ansicht fand sie volle Unterstützung bei ihrer Freundin und Geschäftspartnerin Bina Tyrell. Gemeinsam brachten sie bei einem feierlichen Abendessen in Binas elegantem Restaurant in Abwesenheit des jungen Paares einen Toast auf die beiden aus. Misa berichtete Tolo in einem ihrer Briefe von diesem Ereignis und fügte hinzu, sie hoffe, dasselbe mit ihm und seiner jungen Frau wiederholen zu können, wann immer sie nach Sydney zurückkehren wollten.
Nach einigen Monaten voller Glückseligkeit in Tolos altem Zuhause wurde Java allmählich unruhig. Sie wollte zu gern das Land bereisen. Außerdem war sie der Ansicht, dass Tolo seinen lange gehegten Wunsch, die Aborigines zu erforschen, nicht noch länger aufschieben sollte. Die Viehfarm war bei den erfahrenen Mitarbeitern und ihrem Aufseher in den besten Händen, und es würde auch während Tolos Abwesenheit alles gut laufen. Also war bei der zweiten Reise nach Westaustralien letztlich Java die treibende Kraft.
In Perth angekommen, ließ die Unterbringung immer noch genauso zu wünschen übrig wie auf ihrer Hochzeitsreise. Tolo hätte es sich durchaus leisten können, sich und seine Frau ein wenig zu verwöhnen. Doch wo es keinen Luxus gab, konnte man ihn sich auch nicht erkaufen. In ihrem Hotel mangelte es an vielem. Das Zimmer jedoch war sauber, und es hatte ein wundervoll weiches Doppelbett, von dem Tolo und Java ausgiebig Gebrauch machten.
Nachdem sie Robert Endicott aufgesucht hatten, mussten sie einige Tage warten, bis ihr in Aussicht stehender Führer ausfindig gemacht und ein Treffen arrangiert worden war. Tolo und Java nutzten die Zeit, um in Perth eine Reihe von Sehenswürdigkeiten zu besichtigen, die sie im Glückstaumel ihrer Hochzeitsreise kaum wahrgenommen hatten. Tolo hatte sämtliche verfügbaren Bücher zu Perths Geschichte verschlungen und musste feststellen, dass seine Frau ihm mit ihrer Leselust in nichts nachstand. Also kannten sich nun beide mit dem Thema bestens aus. Sie schlenderten durch die Straßen, sahen sich die drei Stockwerke hohe Einfahrt im Tudorstil an, die zum Hauptquartier der Enrolled Pensioner Forces führte, den Soldaten-Siedlern, die Perth gegründet hatten. Der von Sträflingen erbaute Torweg sowie der Uhrenturm des Rathauses waren glänzende Beispiele für das filigrane flämische Verbundmauerwerk. Gleich neben der Stadt erstreckte sich der Kings Park: ein Gebiet, in dem man den natürlichen Busch in seiner ursprünglichen Form belassenen hatte, damit auch in tausend Jahren die Kinder noch eine Vorstellung davon haben würden, wie der Busch ausgesehen hatte, als die ersten Siedler hier eingetroffen waren.
Dieser Park und die Stadt selbst lagen an den unteren Abschnitten des Swan River. In Perth Water, wo der Swan River über eine halbe Meile breit wurde, konnten Java und Tolo unzählige kleine Segelschiffe und Barkassen beobachten sowie die Dampfschiffe, die die Passagiere zum Hafen von Fremantle brachten.
Perth schien ein recht netter Ort zu sein. Bei durchaus angenehmen Temperaturen schlenderten Java und Tolo durch die häufig ziemlich engen Straßen und beobachteten die Passanten — eine Mischung aus Leuten in grober Arbeitskleidung und Geschäftsmännern mit Schlips und Kragen. Als sie aber eines Morgens zu den Außenbezirken der Stadt spazierten, trafen sie auf eine völlig andere Szenerie. Wie angewurzelt blieben sie stehen und schauten einen kleinen Hügel hinab auf einen Dschungel von behelfsmäßigen Hütten: auf die den Aborigine-Einwohnern von Perths gehörenden Humpies.
Die windschiefen Bauten folgten keiner erkennbaren Anordnung. Die meisten bestanden lediglich aus Segeltuchfetzen, die über ein Gerüst aus Buschholz gespannt waren. Nur wenige der stabileren Behausungen waren mit Wellblechdächern versehen. Tolo nahm an, dass die Böden aus nichts anderem als festgestampftem Lehm bestanden.
Den Blicken der Betrachter bot sich ein Chaos unvorstellbarer Armut. Zwischen diesen Elendsquartieren bewegten sich ausschließlich Aborigines, oder sie lungerten halbnackt an jedem noch so kleinen schattigen Fleckchen herum. Splitternackte Kinder mit aufgeblähten Bäuchen spielten mitten im Dreck zwischen zersplitterten Knochen, aus denen das Mark herausgesaugt worden war, verfaultem Abfall und den Exkrementen von Mensch und Tier.
Lange sprachen Tolo und Java kein Wort. Dann nahm Tolo seine Frau am Arm und führte sie so weit fort zwischen die gepflegten Häuser der weißen australischen Herren des Landes, bis die Humpy-Town ihren Blicken entzogen war. Schließlich brach Tolo das Schweigen.
»Diese Menschen kommen in die Städte, weil sie von den Errungenschaften unserer sogenannten Zivilisation gekostet haben: vor allem Alkohol und Tabak. Aber sie sind auch hinter anderen materiellen Gütern her, die wir besitzen. Nur verfügen sie weder über das Wissen noch über die Fähigkeiten, um das Geld zu verdienen, mit dem sie sich diese Dinge kaufen können. Deshalb bleibt ihnen nichts anderes übrig, als die Reste aus unseren Abfalltonnen zu essen und unsere weggeworfene Kleidung zu tragen. Und sie sterben an so harmlosen Krankheiten wie den Masern.«
Java musste zugeben, dass sie kein so brennendes Interesse an den Ureinwohnern ihres Kontinents hatte wie ihr Ehemann. Natürlich bedauerte sie die Leute und hätte gern versucht, ihr Elend zu mildern, doch konnte sie nicht die gleiche Faszination für sie aufbringen wie Tolo. Was machte es für den Mann, den sie liebte, nur so ungeheuer wichtig, genauere Kenntnis über diese unglückselige Rasse zu erlangen?
Schon lange, bevor sie die Humpy-Town am Stadtrand von Perth gesehen hatte, war sie zu dem Schluss gekommen, es könne nur daran liegen, dass er selbst ein Mischling war. Er hatte ihr gesagt, es störe ihn nicht mehr, wenn er beleidigende Äußerungen gegenüber Leuten mit brauner oder schwarzer Haut höre. Aber sie hatte es bereits miterlebt, dass er in Wut geriet. Und Gott stehe demjenigen bei, der in Tolos Gegenwart eine verunglimpfende Bemerkung über Samoaner machte, besonders wenn sie gegen seine Mutter, eine reinrassige Samoanerin, gerichtet war.
Javas Liebe zu Tolo wär aus ihrem ursprünglichen Mitgefühl für ihn erwachsen. Das wusste sie sehr wohl, denn sie war reif genug, um ihre eigenen Schwächen zu erkennen. Von Beginn an hatte sein Kampf gegen die Ausgrenzung von Farbigen sie tief beeindruckt. Java war in einem Haus aufgewachsen, in dem offene Diskussionen zu jedem Thema die Regel waren, und sie hatte sich mit den gegensätzlichen Einstellungen zum Rassenproblem beschäftigt. Sie hatte dem Schriftsteller Henry Lawson zugehört, einem der deutlichsten Verfechter eines weißen Australiens, der die Aborigines für eine aussterbende Rasse hielt und meinte, dies sei auch das Beste für sie. Und sie hatte einige religiöse Wortführer gehört, die oft mit fieberhaftem Eifer ihre Argumente für die Gleichheit der Menschen vorgetragen hatten. Ihre persönliche Einstellung zur Rassenfrage betrachtete Java als liberal. Schließlich verdankte sie ihr Leben einem alten Mann mit brauner Hautfarbe, einem sogenannten Wilden, der in einer Hütte im javanischen Hochland wohnte. Der Mann hatte ihre Mutter gerettet, als diese hochschwanger bei dem Krakatau-Ausbruch und der nachfolgenden Flutwelle beinahe ums Leben gekommen wäre. Mithilfe der Frauen seines Dorfes hatte der Alte Jessica wieder gesundgepflegt und sich darum gekümmert, dass ihr Baby unbeschadet auf die Welt kam.
Java war sehr wohl an den Überlieferungen der Aborigines interessiert. Das hieß aber nicht, dass sie — bräuchte sie diese Entscheidung nur für sich allein zu treffen — dermaßen große Anstrengungen unternommen hätte, um die Geschichten der Traumzeit aus dem Munde eines Nachfahren der ersten Einwohner Australiens zu hören. Zugegeben, einige der Mythen fand sie in ihrer Naivität und Einfachheit rührend amüsant, andere Geschichten wiederum kamen ihr wie einfallslose ständige Wiederholungen vor.
Trotz alledem würde sie Tolo in das weit entlegene Never-Never folgen aus dem einfachen Grunde, weil er ihr Ehemann war, der Mann, den sie liebte. Und sie würde ihn bei seiner selbst gewählten Mission nach Kräften unterstützen. Sie zweifeite nicht einen Augenblick daran, dass er sein erklärtes Ziel, gründliche Studien zum Leben der Aborigines zu betreiben und seine Erkenntnisse in einem Buch zu veröffentlichen, auch erreichen würde. Da Java Ende des neunzehnten Jahrhunderts an Australiens intellektueller Erweckung teilgenommen hatte, war ihr das Wissen um seiner selbst willen zu einem Wert geworden, den sie nicht hinterfragte. Auch wenn sie ihre Schwierigkeiten damit hatte, den Begriff Kultur auf die Lebensweise der Aborigines anzuwenden, hielt sie Tolos Wunsch, deren Mythen und Legenden schriftlich festzuhalten, für durchaus löblich. Seine Forschungen würden ein Geschenk für künftige Generationen darstellen. Wenn die Ureinwohner Australiens erst einmal ausgestorben wären, könnten spätere Wissenschaftler sich an Tolos Buch orientieren, um die eigentümlichen Gewohnheiten und Glaubensvorstellungen einer erloschenen Rasse zu untersuchen. Und dass es diese Rasse schon bald nicht mehr geben würde, stand für Java fest. Ein Blick auf die Humpy-Town hatte sie davon überzeugt, dass die Aborigines in der modernen Welt nicht überleben konnten. Darwins Theorien schienen sich wieder einmal zu bestätigen: Die am besten an das moderne Leben Angepassten, die Weißen, würden überleben, während die Blackfellows allmählich von der Erde verschwinden würden.
Als sie in ihr Hotel zurückkehrten, wo sie sich mit dem von Endicott empfohlenen Führer treffen wollten, befand Java sich in getrübter Stimmung. In der Hotelhalle blieben sie kurz stehen. Tolo holte seine Uhr aus der Tasche und zog sie auf, während er nachsah, wie spät es war. »Wie wäre es mit einer Tasse Tee, bevor dieser Forrest auftaucht?«
»Das wäre wunderbar«, willigte Java ein. Die Vorstellung von etwas so Zivilisiertem wie Tee erschien ihr nach ihrem Abstecher zu den Humpies geradezu himmlisch.
Im Speisesaal waren noch genug Plätze frei. Am frühen Nachmittag hielten sich hier fast nur männliche Gäste auf, und alle Blicke richteten sich auf Java, die durch ihren festen Schritt und ihre stolze Haltung ebenso viel Aufmerksamkeit auf sich zog wie durch ihr hübsches Gesicht und ihre auffällige Haarfarbe. Einigen der Anwesenden war auch das bronzefarbene Gesicht ihres hochgewachsenen Begleiters nicht entgangen. Einer der Männer beugte sich vor und flüsterte seinem Gegenüber etwas zu. Doch als Tolo ihm direkt ins Gesicht sah, wandte er seinen Blick sofort wieder von ihm ab.
Noch bevor sie ihre erste Tasse Tee ausgetrunken hatten, traf Terry Forrest ein. Von dem Augenblick an, als er den großen Raum betrat, wusste Java, dass er der Mann war, mit dem sie sich verabredet hatten. Er war groß und hatte sonnengebräunte Haut. Am Eingang machte er Halt und sprach kurz mit dem Oberkellner. Dann durchquerte er leichtfüßig den Raum, während er seinen breitkrempigen Buschhut abnahm und sein lockiges, kurz geschnittenes Haar zum Vorschein kam. Seine Augenbrauen wirkten ausgeblichen durch die unablässig scheinende Wüstensonne, und seine Augen unter den blonden Wimpern waren von jenem Eisblau des Wassers, das Tolo und sie in der Bass Straße durchquert hatten.
»Tag, Kumpel«, sagte Forrest, als er den Tisch erreichte. Tolo stand auf und schüttelte ihm die Hand, woraufhin Forrest ihm ein breites Lächeln schenkte. »Ohmannomann, das nenne ich einen Zuchthengst. Kommt nicht so oft vor, dass ich aufschauen muss, um einem Mann in die Augen zu sehen.«
»Freut mich, Sie kennenzulernen, Mr Forrest«, erwiderte Tolo. »Nehmen Sie doch Platz.«
»Mit Vergnügen«, sagte Forrest, machte aber erst noch eine Verbeugung vor Java. »Und das ist Mrs Mason?«
»Meine Frau«, bestätigte Tolo.
Tolo wartete, bis Forrest sich gesetzt und seinen Hut nachlässig auf den vierten, unbenutzten Stuhl am Tisch geworfen hatte. Dann nahm auch er Platz. Forrest taxierte Java völlig unverblümt, und sein breites Grinsen verriet deutlich, dass ihm sein Gegenüber sehr gut gefiel.
»Sie wollen also durch das Land der Dürre und Enttäuschung wandern«, begann Forrest. »Zumindest hat Endicott mir das gesagt.«
»Ja, das stimmt«, erwiderte Tolo. »Ich habe vor, mich draußen in der Wildnis mit den Aborigines zu befassen, die noch als Nomaden leben.«
Forrest blickte zur Decke und schwieg.
»Mr Endicott behauptet, Sie würden die Wüsten besser kennen als irgendjemand sonst«, sagte Tolo.
»Jedenfalls besser als jeder andere Whitefellow«, bestätigte Forrest, »und gut genug, um einen großen Bogen darum zu machen.«
»Ich würde Sie gut bezahlen, Mr Forrest, wenn Sie bereit wären, uns in die Nullarbor zu bringen.«
»Wenn Sie hinter Aborigines her sind, ist das bestimmt der letzte Platz, wo Sie hin wollen«, erwiderte Forrest. »Außer Salzbusch und Blaubusch gibt es da absolut nichts. Höchstens die Jeedarra.«
»Die Jeedarra«, sagte Tolo, »die mächtige, magische Schlange, die Menschen frisst.«
Forrest kniff die Augen zusammen und betrachtete Tolo etwas genauer. »Stimmt, Kumpel. Die Blackfellows verfolgen ab und an ein Känguru über wenige Meilen in die Nullarbor, aber sie sehen auf jeden Fall zu, dass sie sich noch vor Sonnenuntergang wieder hinausbewegen. Denn wenn sie sich nach Einbruch der Dunkelheit noch dort aufhalten, werden sie von der Jeedarra erwischt oder durch ein Zugloch gesaugt.«
Als Java zum ersten Mal das Wort ergriff, hing Forrest wie gebannt an ihren Lippen, und seinen Mund umspielte ein träumerisches Lächeln. »Die mächtige, magische Schlange ist mir vertraut«, sagte sie, »aber von ... wie haben Sie es noch gleich genannt . . . von Zuglöchern habe ich noch nie etwas gehört.«
»Man findet sie meilenweit von der Küste entfernt«, antwortete Forrest. »Die gesamte Nullarbor-Ebene ist von Höhlen und unterirdischen Gängen durchzogen. Bei einigen von ihnen besteht eine direkte Verbindung zu den Unterwasser-Höhlen an der Küste. Wenn das Wasser sich bewegt, kann es passieren, dass über eine große Entfernung hinweg mitten in der Nullarbor aus einem der Löcher plötzlich ein starker Wind bläst und die heiße Luft der Ebene in ein anderes Loch gesaugt wird. Bei manchen hört es sich an wie Donner.«
»Wo kann man denn noch eingeborene Nomaden finden, wenn nicht in der Nullarbor?«, fragte Tolo.
Forrest seufzte und fuhr sich mit der sonnengebräunten Hand durch sein lockiges rotblondes Haar. »Auf dem Weg hierher hatte ich angenommen, ich hätte es mal wieder mit einem Weichei aus Sydney zu tun, das in diese Gegend kommt, um ein aufregendes Abenteuer im ach so wilden Outback zu erleben. Vielleicht sogar mit einem Aborigine-Jäger. Von dieser Sorte tauchen immer wieder mal welche hier auf. Sie halten die Blackfellows für ein Relikt aus grauer Vorzeit, für ein Hindernis, das auf dem Weg des weißen Fortschritts beseitigt werden muss, verstehen Sie?«
»Sie wollen doch wohl nicht behaupten, dass Sie sie . . . jagen?«, fragte Java mit erregter Stimme.
»O nein. Das verstößt gegen das Gesetz unseres vereinigten Australiens, Missy. Klar, von einigen von uns weiß man, dass sie hin und wieder ein paar Aborigines dazu verholfen haben, sich zu verbessern.«
»Sich zu verbessern?«, fragte Java mit schwankender Stimme.
»Indem sie sie von der Erdoberfläche woandershin befördert haben«, erklärte Forrest. »Abgeschossen. Wir sind eben ein bisschen, ähm, altmodisch hier draußen. Wir richten uns immer noch nach dem alten Motto der ersten Siedler: Wenn es sich bewegt, erschieß es. Wenn es sich nicht bewegt, schneid es ab.«
»Tolo«, sagte Java, die vor Schreck errötete, »ich habe das Gefühl, Mr Forrest ist nicht unser Mann.«
Doch Tolo drückte nur ihre Hand unterm Tisch.
»Wie ich schon sagte«, fuhr Forrest fort. »Sie sind ganz anders, als ich Sie mir vorgestellt habe. Sie wollen keine Aborigines jagen. Und Sie suchen auch nicht nach Gold?«
»Nein«, sagte Tolo. »Wir wollen uns den umherwandernden Aborigines anschließen, um ihre Lebensweise, ihre Mythen und Gewohnheiten zu erforschen.«
»Ich fürchte, Kumpel, das werden Sie ohne mich tun müssen.« Forrest nahm seinen Hut. »Hören Sie, es geht mich zwar nichts an, aber ich an Ihrer Stelle würde mit ein paar von diesen zahmen Blackfellows in der Humpy-Town reden. Für eine Flasche Fusel oder ein paar Münzen finden Sie rasch ein Dutzend Aborigines, die mit Fug und Recht von sich behaupten können, von hohem Rang zu sein. So bezeichnen sie ihre weisen Männer. Mit ihrem Singsang blasen die Ihnen die Ohren voll.«
»Danke für den Vorschlag«, sagte Tolo. »Aber diese Leute haben wir schon zu Gesicht bekommen. Wir hätten zweifellos mehr davon, wenn wir unsere Informationen von Ureinwohnern beziehen könnten, die noch nicht dem verderblichen Einfluss der Weißen erlegen sind.«
Forrest sah Java tief in die Augen. »Und Sie wollen mitgehen?« »Selbstverständlich«, sagte sie sofort.
Forrest schüttelte den Kopf.
»Die werden Sie auffressen«, sagte er, beugte sich zu ihr und senkte die Stimme. »Die werden Sie nicht vergewaltigen. Das ist nicht ihr Stil. Ihr Hauptanliegen ist es, in einer der menschenfeindlichsten Gegenden dieser Erde am Leben zu bleiben. Die werden nicht einen Augenblick zögern, sich über ihr Fleisch herzumachen. Ja, wirklich, die schlachten Sie ab, als wären Sie ein Schwein. Mit dem ausgelassenen Fett aus Ihren Nieren reiben sie sich die Haut ein — wegen des Geruchs und damit sie nicht verbrennen in der Sonne.«
»Das reicht, Mr Forrest!«, mischte Tolo sich ein.
»Ja, das finde ich auch«, sagte Forrest und erhob sich. »Aber meine menschenfreundliche Ader zwingt mich, Ihnen noch das Eine mit auf den Weg zu geben, Mr Mason. Sie sind ein verdammter Narr, wenn Sie in die Wüste rausgehen und anfangen, nach wilden Schwarzen zu suchen. Und wenn Sie diese reizende Kleine mitnehmen, sind Sie ein doppelter Narr. Sollten die Schwarzen Sie nicht verspeisen, wird die Wüste Sie umbringen. Die hat schon bessere Männer getötet, auch wenn sie nicht so groß waren wie Sie.« Tolo machte Anstalten, sich von seinem Platz zu erheben, doch Forrest streckte abwehrend die Hand aus, als wollte er ein Friedensangebot machen.
»Schönen Dank, Mr Forrest«, sagte Tolo mit erhobener Stimme.
»Noch ein letztes Wort.«
»Davon haben Sie offensichtlich einen unerschöpflichen Vorrat«, konterte Tolo.
»Wenn Sie unbedingt nach wilden Aborigines Ausschau halten müssen, wäre die Gibson der richtige Ort für Ihre Zwecke. Am besten können Sie von Carnarvon aus aufbrechen.«
»Das sind fünfhundert Meilen die Küste hinauf«, sagte Tolo, dessen Interesse trotz seiner Verärgerung geweckt war.
»Erspart Ihnen weite Strecken zu Fuß«, erwiderte Forrest und wandte sich zum Gehen.
»Mr Forrest«, rief Java. Er drehte sich um. »Möchten Sie sich das Angebot meines Mannes, Sie als Führer anzustellen, nicht doch noch einmal überlegen?«