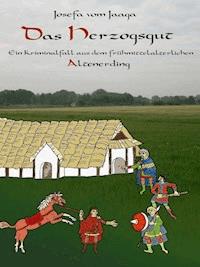Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Solingen, Januar 1796. Luise Berg, Tochter eines verstorbenen wohlhabenden Kaufmanns, ist vierundzwanzig Jahre alt und sie weiß: Für sie wird es höchste Zeit zu heiraten. Dummerweise zögert ihr Verehrer, ein vor der Revolution geflüchteter vornehmer Franzose, ihr endlich den ersehnten Antrag zu machen. Zu allem Überfluss wird, kaum ist ein Waffenstillstand geschlossen, ein General der feindlichen französischen Revolutionsarmee bei Luises Mutter Wilhelmine einquartiert. Ein Beziehungsdreieck der besonderen Art, zwischen Kriegsgetrommel, Solinger Klingen und Burger Brezeln.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 331
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Auf der Treppe
Auf der TreppeKapitel 1Kapitel 2Kapitel 3Kapitel 4Kapitel 5Kapitel 6Kapitel 7Kapitel 8Kapitel 9Kapitel 10Kapitel 11Kapitel 12Kapitel 13Kapitel 14Kapitel 15Kapitel 16Kapitel 17Kapitel 18Kapitel 19Kapitel 20Kapitel 21Epilog: Paris 1802NachwortZeittafelÜbersetzungen und BegriffserklärungenWeitere Romane aus der Zeit der Revolution und der napoleonischen EpocheImpressumAuf der Treppe
Eine sachliche Romanze
von
Josefa vom Jaaga
Kapitel 1
Verehrter Herr Bürgermeister Schmitz,
bitte gestatten Sie, dass eine schutzlose Witwe sich in diesen finsteren Tagen mit der Bitte um Hilfe an Sie wendet.
In der Stadt kursieren seit Tagen die widersprüchlichsten Gerüchte, seitdem die Neuigkeit eines Waffenstillstands zwischen der französischen und unserer Armee wiederholt die Runde machte. Da es immer mehr so aussieht, als sei diese Neuigkeit wahr, befürchte ich, auch die unerfreulichen Gerüchte könnten auf Tatsachen beruhen, und die Vorhut der Franzosen werde tatsächlich ihre Winterquartiere in der Gegend von Solingen beziehen.
Sollte dem so sein, und sollte tatsächlich, wie man auf der Straße zu wissen glaubt, ein höherer Offizier mit einem Teil seiner Männer in der Stadt kantoniert werden, so muss ich bereits jetzt entschieden dagegen protestieren, dass der Stadtrat etwaige Ansprüche auf meine Räumlichkeiten erhebt. Ich lebe, wie Sie wissen, seit dem Tod meines Gemahls allein und ohne männlichen Schutz in meinem Haus; meine Tochter ist jung und unverheiratet. Es wäre mit den guten Sitten völlig unvereinbar, fremde Soldaten hier zu beherbergen, die nicht nur unseren Ruf, sondern, da die Angehörigen der revolutionären Heerhaufen jung und zügellos zu sein pflegen, tatsächlich unsere Habe, unsere Ehre und womöglich gar Leib und Leben gefährden würden.
Ich kann Sie nur dringend ersuchen, Herr Bürgermeister, dem Stadtrat diese meine Position zu übermitteln, sollte sich die Frage der Einquartierung tatsächlich stellen.
Darüber hinaus verbleibe ich, lieber Schmitz, Ihre Ihnen allzeit verbundene und ergebene
Wilhelmine Berg, Kaufmannswitwe
~
Die dunkle Vertäfelung der guten Stube im Ratskeller zu Solingen reichte bis hinauf zum Ansatz der weiten, mehlig-grauen Kreuzbögen des Gewölbes. Auch das Holz der Bänke, Tische und Stühle war dunkel, fast schwarz geworden von jahrzehntelangem Gebrauch und dem Ruß der Kerzenflammen, die gegen das Zwielicht des Raums ankämpften. Ungezählte Bürgermeister, Ratsherren sowie ihre Freunde und Geschäftspartner hatten hier die Besprechungen der Stadtgeschäfte bei einem Glas Rheinwein ausklingen lassen. Von manchen gab es noch Erinnerungsstücke hier, von wechselnden Wirtsfamilien verwahrt über Jahrhunderte in Truhen, die schwer waren, deren Scharniere knarrten und über deren Inhalt niemand mehr den rechten Überblick besaß: geschmiedete eiserne Namensplaketten, die einst vielleicht einen Kirchenstuhl geschmückt hatten, eine ausrangierte Amtskette, oder sogar nur einen vergessenen dreieckigen Hut mit einem Namenszeichen.
Vielleicht würden manche der Anwesenden ähnliche Spuren hinterlassen, vielleicht auch nicht.
Es war ohne Bedeutung. Irgendwann würde das Haus vielleicht eingerissen werden oder – Gott verhüte es – einem Brand zum Opfer fallen, wie er vor einigen Jahrzehnten die halbe Stadt verwüstet hatte. Man würde die gute Stube anderswohin verlegen, oder sogar die ganze Gaststätte würde andere Räumlichkeiten beziehen. Das Holz der Vertäfelung würde erneuert werden müssen, die alten Stühle und Bänke würden zu wackeln beginnen unter dem Gewicht wohlgenährter Hinterteile und ersetzt werden müssen. Aber auch dieses junge Holz würde nachdunkeln, auch über den neu angeschafften schmiedeeisernen Wandleuchtern würden sich die vertrauten Schmierflecken aus Ruß und Wachs bilden und auf den Tischplatten, den polierenden Lappen der Schankmädchen zum Trotz, die Ränder verschütteten Weins. Auch die renovierte Stube würde bald denselben unverkennbaren Duft atmen, dieselbe Mischung aus Holzfeuer vom offenen Kamin, von gebratenem Fleisch, Wein, dem dichten Qualm langstieliger Tabakspfeifen und vielen Körpern auf engem Raum, unter deren Besitzern längst noch nicht alle die kürzlich aufgekommene Mode mitmachten, sich täglich mit Wasser zu waschen.
So würde es sein, so war es stets gewesen, vermutlich schon, seitdem irgendwann im Mittelalter jemand der Stadt Solingen die Stadtrechte verliehen hatte und damit den vornehmsten und wohlhabendsten Familien die Möglichkeit, sich selbst zu verwalten. Nur Kleidermoden, Frisuren und Gesichter hatten seitdem gewechselt. Und natürlich das Gemälde des jeweiligen Landesherrn, dem die Ratsherren großzügig gestatteten, von der Wand aus an ihrer Unterhaltung teilzuhaben, wo es hinter dem Stuhl des Bürgermeisters am Kopfende des Tisches vor sich hin staubte, bis eine mitleidige Dienstmagd Ehre und Renommee des Landesvaters (im Moment hieß er Karl Theodor) mit dem Staubwedel wiederherstellte.
Schon die Familiennamen der Ratsherren blieben meist gleich, und die Szenerie veränderte sich nie. Die hier mit am Tisch saßen und um Einfluss und Aufträge buhlten, gehörten zu den Herren der Stadt, zu den wohlhabenden Kaufmannsfamilien, die mit dem Handel von Scheren, Messern, Sensen, Sicheln, Säbeln und Degen reich geworden waren. Diesen Herren und ihren Handelshäusern arbeiteten ganze Hundertschaften von kleinen Handwerksbetrieben zu, Schmiede, Scherenschleifer und Werkzeugmacher, die in kleinen Fachwerkhäusern an den Bachläufen ihrem Gewerbe nachgingen. Gemeinsam sorgten sie dafür, dass die Stadt Solingen gedieh und seine Einwohner wohlhabend blieben.
So war es gewesen, so musste es sein. Die Ereignisse der Welt umspülten die Stadt, liefen darüber hinweg und wälzten wohl auch hin und wieder etwas davon um. Am Ende war alles stets wieder, wie es war.
Gute Klingen brauchte man immer.
An diesem Abend, einem Januarabend im Jahr 1796, hatte man die ersten Runden bereits ausgegeben, und die zeremonielle Steifheit war vertrauter Geselligkeit gewichen. Zwar wären die würdigen Herren nie so weit gegangen, den Kamisol abzulegen und über die Stuhllehne zu hängen, wie das die Bauern und Handwerker draußen in der allgemeinen Wirtsstube taten (oder wenn, so wären dafür noch einige weitere geleerte Gläser vonnöten gewesen). Doch sie hatten sich nach der anstrengenden Sitzung zum Wohle der Stadt immerhin mit Kapaun oder Sauerbraten gestärkt und fühlten sich inzwischen in der Lage, die Pfeifen herauszuholen, deren Qualm die Tafel in dichte Wolken hüllte, und jene Probleme, die man kurz zuvor noch in offizieller Funktion als Vertreter der Ortsgewalt besprochen hatte, auch auf persönlicher Ebene anzugehen.
Mit etwas kläglichem Lächeln neigte Bürgermeister Schmitz sich von seinem Platz am Kopfende der Tafel zu dem Herrn rechts von ihm hinüber und schob ihm über die Tischplatte ein gefaltetes Papier zu.
»Weil wir gerade so schön beieinander sitzen, mein lieber Knecht: Da wäre noch etwas, das ich Ihnen zeigen wollte.«
Johann Abraham Knecht, ein stämmiger Herr Mitte fünfzig mit schütterem Haar, dessen letzte Reste sich nur noch mühsam zum obligatorischen Zopf im Nacken flechten ließen und der deshalb Zuflucht zu einer Perücke nehmen musste, griff gut gelaunt nach dem Schreiben, entfaltete es und las. Er lachte, schüttelte sanft den Kopf, während er es wieder zusammenlegte, und reichte es Schmitz zurück.
»Das ist so charakteristisch für meine Schwägerin! Noch ist die Kantonierung nicht einmal endgültig beschlossen, und sie sorgt sich bereits, ihr könnten dadurch Nachteile entstehen. Soll ich Ihnen Abbitte tun für meine Verwandtschaft, mein Lieber?«
»Selbstverständlich nicht, Herr Knecht! Als ob ich es Ihnen deswegen gezeigt hätte!« Schmitz steckte das Briefchen zurück in die Tasche seines Rocks.
»Sie haben natürlich gesehen, dass unsere werte Wilhelmine den Bogen Papier halbiert und bis an den Rand beschrieben hat«, spöttelte Knecht und prostete dem Bürgermeister zu, ehe er einen großen Schluck Riesling nahm. Er setzte das Glas heftig wieder ab; was er gelesen hatte, schien ihn zu ärgern, auch wenn er seine lächelnde Miene beibehielt. »Wir können davon ausgehen, dass die andere Hälfte noch einmal halbiert und ebenfalls äußerst sparsam verwendet werden wird. Meiner Frau darf ich gar nichts davon erzählen; sie regt sich seit dem Tod ihres Bruders ohnehin ständig darüber auf, wie geizig Wilhelmine geworden ist. Unter uns gesagt, dass mein Neffe Carl gemeinsam mit meinem Sohn in meinem Haus erzogen wird, war ihre Idee. Sie sorgte sich sehr, der Junge könnte durch die übertriebene Sparsamkeit seiner Mutter fürs Leben leiden müssen. Er ist ohnehin nicht sehr kräftig.«
Bürgermeister Schmitz stellte sein Glas auf den Tisch und strich sich nachdenklich über den Backenbart. »Dann halten Sie die Besorgnis Ihrer Schwägerin also für vorgeschoben? Genau das war, was ich von Ihnen wissen wollte.«
»Natürlich ist es ein Vorwand. Eine Einquartierung bedeutet Kosten, und die scheut sie.«
»Dennoch kann man ihr Argument verstehen. Sie und ihre Tochter leben allein, mit nur wenigen Dienstboten, von denen wohl auch die meisten weiblich sind. Es erscheint fragwürdig, von schutzlosen Frauen zu verlangen, vielleicht mit einer Gruppe zügelloser Grenadiere unter einem Dach zu leben.«
»Ich bitte Sie, Schmitz! Sie kennen doch Wilhelmine! Wenn ich in diesem Fall um jemanden Angst hätte, dann um die Grenadiere!«
»Knecht! Nun seien Sie doch einmal ernst!«
»Es ist mein voller Ernst, Bürgermeister.« Johann Abraham Knecht leerte sein Glas und zog den schweren Krug über die Tischplatte zu sich heran, um es neu zu füllen. »Natürlich muss man darüber nachdenken, dieses Haus zu belegen, wenn es Einquartierungen gibt. Es steht mindestens zur Hälfte leer, seitdem mein Schwager verstorben ist. Wilhelmines zwei ältere Töchter sind verheiratet, der Sohn lebt bei uns. Man wird den Solinger Bürgern schwer erklären können, weshalb sie Soldaten in ihren ohnehin schon engen Häusern aufnehmen sollen, während in diesem herrschaftlichen Gebäude so viele Räume ungenutzt verstauben.«
»Genau deswegen wende ich mich ja an Sie, Knecht. Können Sie Ihrer Schwägerin nicht ins Gewissen reden? Ich würde die Witwe eines meiner Amtsvorgänger ungern durch Zwang verpflichten.«
»Anders werden Sie bei Ihr allerdings nichts erreichen, Herr Schmitz. Sie wird zur Furie, wenn es ums Geld geht. Wenn Sie meinen Rat hören wollen: Stellen Sie sie vor vollendete Tatsachen. – In der Sitzung eben hörten Sie sich sehr bestimmt an, dass die Franzosen kommen werden. Wie sicher ist es denn überhaupt?«
»Der Waffenstillstand ist von der Regierung in Paris bestätigt«, sagte Schmitz. »Mehr weiß ich auch noch nicht. Es hat lange genug gedauert, bis eine Antwort auf das Angebot der Österreicher kam. Aber offenbar planten sie schon zuvor, die gesamte Vorhut ihrer hiesigen Armee über den Rhein zu bringen und auf unserer Uferseite ins Winterlager gehen zu lassen. Sie werden sich kaum umbesinnen.«
»Wer befehligt die Vorhut?«
»Meines Wissens noch immer Lefebvre.«
»Das ist dieser Elsässer, nicht wahr? Ich habe von ihm gehört. Wird er selbst nach Solingen kommen?«
»Möglich, aber unwahrscheinlich. Vermutlich wird man nur eine Division in unsere Gegend verlegen, während der Chef den Rheinübergang in Düsseldorf bewacht. Aber was heißt da nur.« Schmitz rieb sich nachdenklich die Nase. »Bis zu einem gewissen Grad teile ich die Besorgnis Ihrer Schwägerin, mein Lieber. Es wird für Solingen nicht billig werden.«
»Ein offener Konflikt in unserer Gegend samt Kampfhandlungen und womöglich Plünderungen wäre noch teurer«, hielt Knecht dagegen. »Wir sollten dankbar sein für unsere Neutralität. Und Wilhelmine wird es besser verschmerzen können als manch anderer Stadtbürger. Ich darf Ihnen versichern, Schmitz, es ist aus der Hinterlassenschaft meines Schwagers ein ansehnliches Vermögen vorhanden. Auch wenn Wilhelmine tut, als müsse sie am Hungertuch nagen.«
»Es ist mir auch um die Tochter zu tun«, sagt Schmitz. Knecht lehnte sich vor und sah dem Bürgermeister gerade ins Gesicht.
»Bürgermeister! Lassen Sie sich von Wilhelmine keinen Sand in die Augen streuen! Es geht ihr nicht darum, dass jemand Luises Tugend zu nahe treten könnte – es geht darum, dass das ganze Haus bewohnbar gemacht und beheizt werden muss in diesem Winter, wenn man Soldaten bei ihr einquartiert. Was dem Haus übrigens nur gut tun kann; ich befürchte, die Sparsamkeit meiner verehrten Schwägerin wird sonst früher oder später die Feuchtigkeit in die Mauern ziehen. Was Luise angeht … nun, Sie wissen selbst, was für ein Mädchen sie ist.«
»Wie alt ist Ihre Nichte denn inzwischen eigentlich?«
»Sie wird in diesem Jahr fünfundzwanzig werden.«
Schmitz machte ein bedenkliches Gesicht. »Nicht mehr zu jung, um zu heiraten, möchte man meinen.«
Knecht lachte hart. »Wem sagen Sie das! Aber das Mädchen hat Ambitionen.« Er zwinkerte. »Zu allem Überfluss berechtigte. Wäre sie als Junge zur Welt gekommen, würde sie inzwischen sicher längst das Geschäft eigenständig führen. Sie ist nicht dumm, die Luise, aber leider zu stolz, es zu verstecken. Eine Schönheit ist sie auch nicht gerade, das macht es nicht leichter. Welcher von unseren jungen Leuten nimmt so eine, wenn er auch eine einfältige, brave, anschmiegsame haben kann?
»Mein Neffe war interessiert«, gab Schmitz zu, ohne genauer zu definieren, welchen jungen Mann aus seiner ausgedehnten Verwandtschaft er meinte. »Schließlich hat Luise eine ansehnliche Mitgift zu erwarten. Inzwischen ist er aber anderweitig gebunden.«
»Gratuliere, lieber Schmitz«, sagte Knecht lächelnd, offenbar ohne Bedauern.
»Sie machen sich um Ihre Nichte gar keine Sorgen?«, fragte der Bürgermeister. »In der Stadt wird seit zwei Wochen viel geredet.«
»Über Luise und diesen Monsieur Duffieux, meinen Sie?«
»Sie wissen davon?«
»Die beiden haben sich in meinem Haus kennengelernt.«
Schmitz sah seinen Freund entsetzt an. »Nun muss ich mich aber wundern, lieber Knecht. Sagen Sie nicht, Sie selbst haben sie mit diesem Franzosen verkuppelt?«
»Kuppelei war dafür gewiss nicht notwendig. Duffieux war geschäftlich bei mir, wegen des Ankaufs von Säbelklingen für ein berittenes englisches Regiment. Wir sprachen damals davon, wenn Sie sich erinnern. Bisher ist übrigens nichts daraus geworden.«
»Wir sind uns wohl einig, dass Monsieurs angebliche Einkäufe nur den wahren Zweck seiner Anwesenheit verschleiern sollen.«
»Das sind wir, aber damals wusste ich das noch nicht. Er war ein wenig überspannt, wie viele Franzosen, aber höflich und umgänglich; ich lud ihn zum Kaffee ein und stellte ihn meiner Frau vor. Luise schaute an diesem Tag zu einem Besuch bei ihrer Tante vorbei, wie sie das häufiger tut. Sie wissen, dass Luise nicht schüchtern ist. Und Duffieux war gleich interessiert an ihr, sobald er hörte, es handle sich um die Tochter einer wohlhabenden Witwe. Er ist im Exil; die Gesetze der revolutionären französischen Regierung haben ihn geächtet. Er hat also keinen Zugriff auf sein Vermögen und dürfte auf eine lukrative Heirat angewiesen sein. Wie auch immer. Er und Luise kamen ins Reden, und bald darauf sprach er bei Wilhelmine vor. Ich schätze ihn als jemanden ein, der günstige Gelegenheiten wittert.«
»Wann war das?«
»Es müsste Anfang Dezember gewesen sein.«
»Hat er bereits um Luises Hand angehalten?«
Knecht hob ein wenig die Schultern. »Nicht, dass ich wüsste.«
Schmitz schüttelte den Kopf. »Dass Sie das so ruhig mitansehen können, Knecht! Denken Sie an den Klatsch! Es geht doch um den Ruf der Familie.«
»Ruhig bin ich durchaus nicht«, gestand Knecht. »Es tut nie gut, wenn einer jungen Dame so lange der Hof gemacht wird. Sobald der Gedanke an Heirat einmal im Raum steht, und das tat er bei diesen beiden sozusagen von Beginn an, sollte es keine vierzehn Tage mehr dauern, bis das Verhältnis entweder aufgelöst oder in ordentliche Bahnen gelenkt wird. Sie müssen ja nicht sofort heiraten, aber die Verlobung sollte doch verkündet werden.«
»Da bin ich ganz Ihrer Meinung! Ist Luise denn gar nicht verliebt in den jungen Mann?«
»Luise?« Knecht kratzte sich im Nacken und machte ein spöttisches Gesicht. »Luise ist kein Mädchen, das sich leicht verliebt, Bürgermeister. Sie hat zu viel Geist, als dass sie dem erstbesten gallischen Geck nachlaufen würde, nur weil er ihr schöne Augen macht. Aber sie weiß, dass ihr in ihrem Alter, und nachdem sie den jungen Herren von Solingen so lange die kalte Schulter gezeigt hat, nicht mehr viele Möglichkeiten bleiben.« Er lachte. »Wären wir katholisch, könnte sie wenigstens in ein Kloster gehen. Wie es ist, weiß sie, dass sie heiraten muss. Es ist der Franzose, der sich ziert. Und ich gebe zu, ich bin Duffieux deswegen allmählich gram. Vielleicht spielt man in seiner Heimat derart mit den Hoffnungen von jungen Mädchen. Bei uns in Solingen nicht.«
Schmitz schüttelte sorgenvoll den Kopf. »Hoffentlich nimmt das nicht ein böses Ende für Sie und Ihre Familie. Es sollte mir sehr leid tun. Mir scheint, Luises Ruf würde sich nicht mehr erholen, sollte aus der Hochzeit mit Monsieur Duffieux nichts werden. Wenn ich fragen darf, was sagt denn der Herr Prediger Neinhaus dazu?«
»Der wird sich ebenso wenig in die Angelegenheiten von Wilhelmine und Luise zu mengen wagen wie ich«, sagte Knecht trocken. »Wilhelmine will die letzte ihrer Töchter möglichst zügig verheiraten. In diesem Punkt will sie sich nichts nachsagen lassen. Die ersten beiden hat sie ja gut unter die Haube gebracht. Die Diergardts in Langenberg und die Keuchens in Barmen sind respektable und wohlhabende Familien. Aber bei Luise stehen die Anwärter nicht gerade Schlange. Lieber diesen Franzosen als gar keinen, sagt sie sich wohl. Luise selbst kann durchaus heikel sein; ihr wird auch nicht jeder zur Nase stehen.«
»Aber dieser Franzose tut es?« Der Bürgermeister machte ein sorgenvolles Gesicht. »Ich hatte sie mir immer als Gattin eines Professors oder Predigers vorgestellt. Da ihr seliger Vater doch solche Mühen auf sich genommen hat mit ihrer Erziehung, mit dem Sprachunterricht und den Musikstunden …«
»Zu brav und bieder für Luise«, winkte Knecht ab. »Madame Duffieux de la Grange-Merlin zu sein, das würde ihr wohl besser gefallen als ein Leben an der Seite eines Predigers oder Schulmeisters oder gar eines unserer Kaufmannssöhne. Ihr Vater hat sie ein wenig verzogen, fürchte ich. Luise war sein Nesthäkchen, nachdem ihm drei Kinder gestorben waren und bevor Carl geboren wurde.« Knecht lächelte mild. »Mein Schwager war selbst schon nicht mehr der Jüngste. Luise konnte ihn immer um den Finger wickeln. Sehen Sie es ihm nach. Vor allem machen Sie sich keine Sorgen, weder um Wilhelmine noch um Luise. Beide sind sehr wohl in der Lage, sich zur Wehr zu setzen.«
»Dennoch ist mir nicht gut dabei. Mir scheint, ich werde mir Vorwürfe machen müssen, egal, was ich tue. Quartiere ich keine Soldaten bei den Frauen ein, wird man mir vorwerfen, übertriebene Rücksicht auf Freunde und Standesgenossen genommen und die Lasten auf die kleinen Leute abgewälzt zu haben. Tue ich es doch, bin ich verantwortlich, sollte etwas geschehen. Es wäre mir unlieb, sollte dabei eine Feindschaft entstehen, oder sollten Dritte mir Hartherzigkeit vorwerfen. Stellen Sie sich nur vor, den beiden Frauen stößt wirklich etwas zu!«
»Dann rate ich Ihnen Folgendes: Quartieren Sie den höchsten kommandierenden Offizier, der nach Solingen verlegt wird, bei Wilhelmine ein.« Knecht lehnte sich auf seinem Stuhl zurück und zog seine Tabaksdose aus der Tasche. »Offiziere pflegen disziplinierter zu sein als Mannschaften. Übergriffe können Sie sich nicht leisten, weil es ihrer Karriere schädlich wäre. Und wenn der Kommandant der hiesigen Truppen in einem Haus lebt, sollte das für die Bewohnerinnen dieses Hauses die beste Schutzwache sein.«
»Sie sind boshaft, Knecht«, stellte Schmitz fest. »Es wäre auch eine sehr teure Schutzwache. Offiziere haben Ansprüche.«
»Wilhelmine kann es sich leisten, eine großzügige Gastgeberin zu sein.« Knecht nahm ungerührt eine kräftige Prise aus seiner Dose. »Zwingen Sie sie zu ihrem Glück, Bürgermeister.«
Kapitel 2
»Wo willst du denn hin, Luise? Gehst du etwa schon wieder?«, fragte die Stimme ihrer Tante. Sie kam durch die nur halb zugezogene Tür, an der Luise soeben vorbeizuhuschen versucht hatte, aus der Stube. Einer Stube, die freilich im Haus von Onkel Knecht, ebenso wie in Luises Vaterhaus, »Salon« hieß, weil das vornehmer klang.
Natürlich blieb es eine Stube, auch wenn man die massigen Bauernmöbel aus Eiche durch ein Sofa mit verspielt geschwungener Lehne und Armsessel ersetzt hatte, die ähnliches Mobiliar aus Frankreich nachahmten, auch wenn Gemälde aus Italien und den Niederlanden an der Wand hingen und die Uhr auf dem Kaminsims angeblich aus einer Werkstätte in Paris stammte. Die Stube war in jedem Haus ein Ort, der immer ein wenig nach Essig und Lavendelöl roch, weil hier täglich aufs Peinlichste genau geputzt wurde, der Ort, an dem jedes Ding seinen unverrückbaren Platz hatte, von der Porzellanfigur auf dem Beistelltisch (»Eine Biskuit-Miniatur«, pflegte die Tante betont beiläufig zu sagen, »aus Meißen. Das Geschenk eines zufriedenen Kunden, wissen Sie.«) bis hin zu den Bewohnern. In der Stube thronte, in einem separaten Andachtswinkel, die in Leder gebundene, altehrwürdige Familienbibel auf ihrem eigenen Tischchen in der Ecke, und davor stand die schwere Wachskerze von einer halben Elle Umfang. In der Stube empfing man Besuch, saß nach dem Abendessen noch auf eine Stunde zur Unterhaltung beisammen und bat, wenn man es sich leisten konnte, am Nachmittag zur Kaffeetafel; das galt im Haus des reichen Kaufmanns Knecht nicht anders als in dem seiner Schwägerin Wilhelmine Berg oder im letzten Fachwerk-Kotten eines Reidermeisters, auch wenn bei Knechts vielleicht belgische Waffeln mit Sahne vorgesetzt wurden und andernorts Graubrot mit Marmelade.
»Ich will nur kurz nachsehen, ob draußen alles in Ordnung ist, Tante«, gab Luise zurück. »Man weiß doch nie, was den Dienstboten einfällt bei solchem Trubel.«
»Aber bleib nicht zu lange, ich bitte dich. Gerade heute, wo all dieses fremde Volk unterwegs ist. Man kommt so leicht ins Gerede.«
»Ich bin gleich wieder zurück.« Luise setzte sich mit raschen Griffen ihre Haube auf und legte sich den Mantel um die Schultern. Sie gab ihr Versprechen obenhin, ohne die Absicht, sich daran zu halten, und nahm an, dass ihre Tante das ahnte. Luise hatte sich gewiss nicht an diesem kühlen Januarmorgen in aller Herrgottsfrühe zu einem Botengang zu ihrer Tante bereiterklärt, um nun das Hauptereignis zu verpassen. Immerhin waren die Trommeln von der Straße schon bis herauf in den Salon zu hören gewesen!
Am besten hätte man den Einzug der Franzosen natürlich vom Fenster dieses Salons beobachten können. Das Haus der Knechts lag an der Cölner Straße, auf der die Franzosen vorbeimarschieren mussten. Aber Tante Maria Luisa hätte der Nichte nie gestattet, in ihrer Gegenwart so offensichtlich und in ungehöriger Weise ihrer Neugierde zu frönen.
Sie selbst schien ohnehin nicht neugierig zu sein.
Ganz Solingen nicht. Unter den Besuchern, die in den letzten Tagen auf eine Tasse Kaffee und ein Stück Rührkuchen zu Luises Mutter gekommen waren, hatte das Thema nur insofern eine Rolle gespielt, als man allgemein hoffte, diese Prüfung des Herrn werde möglichst rasch vorübergehen und man werde den Kontakt mit den fremden Besatzern so gering wie möglich halten können. Dabei hatten die Besucher wie stets in den Tassen gerührt, sich ein wenig geziert, ehe sie sich das obligatorische Stück Kuchen auf den Teller legen ließen, und anschließend wanderte das Gespräch weiter zu den wirklich wichtigen Ereignissen von Solingen, zur Schwangerschaft einer entfernten Kusine, der Krankheit eines ältlichen Gevatters und dem grellgelben Baumwolltuch, das eine Nachbarin am letzten Sonntag beim Kirchgang getragen hatte und das allgemein als schamlos auffällig empfunden wurde.
Luise begriff es nicht.
Streng genommen waren es nicht wirklich Besatzer, die da kamen, sondern Soldaten, die für die nächsten Tage in den Häusern von Solinger Bürgern einquartiert wurden, und die sich für die Dauer ihrer Anwesenheit streng neutral zu verhalten hatten. Aber es waren Soldaten des revolutionären Frankreichs, Angehörige jenes aufrührerischen Volks, das vor wenigen Jahren seinen König und seine Königin auf der Guillotine enthauptet hatte. Zwar hatte das Herzogtum Berg keinen direkten Anteil an den Kämpfen, doch sein Herzog Karl Theodor gehörte in seiner Eigenschaft als Kurfürst der Pfalz und von Bayern zu den entschiedensten Gegnern der Revolution und unterstützte den deutschen Kaiser und die Allianz der Fürsten, die dieses Geschwür auf der Landkarte Europas nun schon seit Jahren auszubrennen versuchten.
Die Solinger konnten also mit Fug und Recht behaupten, sie empfingen heute den Feind in ihren Mauern! War das nicht aufregend? War es wirklich kein Grund, hinaus auf die Straße zu gehen und sich dieses fremde Volk anzusehen und dabei jenen leisen Schauder zu empfinden, wie Luise ihn schon verspürte, während sie die Treppe zum Eingang hinabstieg?
Nun, ganz stimmte es nicht, dass die Solinger nicht neugierig waren. Die Cölner Straße quirlte zwar an Wochentagen stets vor Leben, heute war es aber besonders schlimm. Sicher hätten die meisten Leute, die heute hier unterwegs waren, nicht einmal vor sich selbst zugegeben, weshalb sie gerade an diesem Mittwochvormittag eine Besorgung auf dem Alten Markt zu machen hatten oder beim Pastor vorbeischauen wollten. Gewiss war es reiner Zufall.
Die Trommeln waren inzwischen unüberhörbar. Die Leute, die zu ihrem Rhythmus marschierten, mussten bereits ganz nah in der Stadt sein, irgendwo verborgen im Dunst. Der Morgen dieses zwanzigsten Januar hatte mit Nebel begonnen, nicht anders als die vorigen. Die eisigen Nächte wichen tagsüber einer ungewöhnlich kräftigen Sonne, unter der aus den zahlreichen Bachläufen der Gegend trübe Schwaden stiegen, die sich oft bis in den Vormittag hinein zwischen den Hausmauern hielten.
Da stapften sie heran. Männer in blauen Uniformröcken mit roten Aufschlägen und weißen Hosen tauchten aus dem Dunst auf, das Gewehr über der Schulter, den Tornister auf dem Rücken, den Blick stur geradeaus gerichtet. Sie marschierten in Doppelreihen, Trommler, oft noch halbe Kinder, gaben den Marschtritt vor; hin und wieder ging oder ritt ein Offizier seitlich davon; mehr Raum gaben die schmalen Straßen Solingens nicht her. Passanten, Karren und die zwei oder drei Kutschen, die man in Solingen auf der Straße sah, wichen zur Seite, um den Soldaten einen Pfad freizugeben; nur die Kinder, die der neuen Gäste wegen wohl die Schule schwänzten, strömten eifrig dazu und umringten die Marschierenden mit großen Augen, bis ein Erwachsener ihnen eine Backpfeife gab und sie fortschickte. Um ihre Verlegenheit zu überspielen, schoben die Männer die Hände in die Taschen ihrer langen Überröcke. Die Frauen bargen sie in ihren Schürzen oder unter den schweren wollenen Umschlagtüchern. Alle beäugten sie diese Fremdlinge misstrauisch und verschämt, als wagten sie nicht zu genau hinzusehen, als könne man sich eine Augenkrankheit dabei einhandeln. Der blau-weiß-rote Zug marschierte zum Klang der Trommeln zwischen den Solingern hindurch.
Luise hatte nicht vor, sich unter die Schaulustigen zu mischen. So viel wollte sie sich von ihrer Würde nun doch nicht vergeben; immerhin war sie die Tochter eines der vornehmsten Bürger der Stadt. Eine Luise Berg stand nicht gaffend zwischen den Mägden, Handwerkern und Bauern am Straßenrand.
Stattdessen verharrte sie unmittelbar hinter der Eingangstür, auf der obersten der Stufen, die zum Haus ihres Onkels empor führten. Aus dem Augenwinkel bemerkte sie eine Bewegung und sah, dass im Erdgeschoss, am Fenster des Kontors, in dem ihr Onkel arbeitete, der Vorhang zurückgeschoben worden war. Das runde Gesicht und die weiß gepuderte Perücke von Onkel Knecht wurden sichtbar. Als er Luise auf dem Treppenabsatz stehen sah, lachte er und hob in scherzhaftem Tadel den Zeigefinger. Luise lächelte zurück und fühlte sich ein wenig besser mit dem Wissen, einen Verbündeten in ihrer Neugierde zu besitzen.
Ihr Aussichtspunkt war großartig, denn Onkel Knechts Hauseingang lag ein gutes Stück höher als die Straße. Nicht weniger als sieben Stufen führten vom holprigen, mit Schneeresten getupften Straßenpflaster hinauf zur Türschwelle. Was hatten die Solinger getratscht, als einer der Ihren, Knechts Vater nämlich, sich beim Bau seiner neuen Residenz diese Extravaganz leistete! Sieben Stufen! Wirklich und wahrhaftig sieben Stück, jede einzelne mit größter Sorgfalt von den Mitbürgern gezählt, begutachtet und zur überflüssigen Verschwendung erklärt, die zweifellos den Ruin der Handelsfamilie Knecht begründen werde.
Bis jetzt hielt die Familie sich noch hervorragend, soweit Luise das beurteilen konnte. Onkel Knecht konnte sich sogar leisten, zu den Nichten und Neffen seiner Frau besonders freundlich und großzügig zu sein, lud sie regelmäßig ein und hatte vor zwei Jahren darauf bestanden, Luises jüngeren Bruder Carl in sein Haus aufzunehmen, wo er gemeinsam mit seinem Vetter erzogen werden konnte. Lediglich das Haus, das inzwischen auch schon wieder mehrere Jahrzehnte alt war, hatte seinen Spitznamen weg. Es war in Solingen schlicht und ergreifend »das Haus auf der Treppe«.
Von der obersten Stufe dieser Treppe aus beobachtete Luise, wie die Franzosen in Richtung Rathaus marschierten. Da die Straße so schmal war, dauerte es sehr lange, und Luise fand den Anblick rasch ermüdend. In den vergangenen Monaten waren immer wieder Soldaten in der Stadt gewesen, meist Kuriere oder österreichische Offiziere, die mit ihren Eskorten an der Poststation hielten, um die Pferde zu wechseln. Schneidige Kerle waren das gewesen, in sauberen weißen Uniformen, mit ordentlich frisiertem und gepudertem Zopf und blank polierten Stiefeln. Selbst der langweilige sonntägliche Nachmittagskaffee hatte sich interessanter gestaltet, wenn diese hübschen Gäste zur Sprache gekommen waren.
Was da vor Luise vorbei defilierte, waren erschöpfte, abgerissene Herumtreiber, viele von ihnen so dürr, dass man sich wunderte, wie sie Gewehr und Tornister noch schleppen konnten. Die Uniformen dreckig und geflickt, die Gesichter hager, unrasiert und trotzig unter langen, zotteligen Haaren. Manche Männer humpelten mehr, als sie gingen, andere schienen nicht einmal Gewehre zu haben. Halb abgerissene Schuhsohlen wurden notdürftig mit Schnüren und Stoffstreifen daran gehindert, sich ganz zu lösen. Rockschöße hingen in Fetzen.
Wenn das der gefährliche Feind war, mit dem die Truppen des Reichs es zu tun haben würden, brauchte man sich über den Fortgang des Kriegs wohl keine Sorgen zu machen. Eher musste man befürchten, dieses Heer schmutziger Landstreicher werde alle möglichen Krankheiten nach Solingen einschleppen. Unwillkürlich fragte Luise sich, ob Duffieux wohl im Moment ebenso wie sie selbst irgendwo am Straßenrand stand und sich diese fremden Landsleute ansah. Was mochte er dabei empfinden? Luise selbst war nahe daran, Mitleid zu haben.
Die Offiziere sahen ein wenig besser aus als die Mannschaften, aber nicht viel. Immerhin waren sie rasiert; sich auch zu frisieren, schien in Frankreich nicht mehr üblich zu sein. Luise ließ die kleine Gruppe mit dem Kommandanten der Truppe, die man in erster Linie daran erkannte, dass alle beritten waren, noch an sich vorüber, ehe sie wieder hinauf zu Tante Maria Luisa ging. Aber sie blickte schon kaum noch hin. Ihre Neugierde war fürs Erste gestillt und hatte einer gewissen Enttäuschung Platz gemacht. Zeit, Bericht zu erstatten. Man durfte davon ausgehen, die Tante werde, trotz ihrer persönlichen Zurückhaltung, einige Fragen an die wissbegierige Nichte haben.
Womöglich wäre der Einmarsch dieser halbwilden Herren ja doch ein Sujet für den nächsten Sonntagskaffee.
~
Verehrte Frau Berg,
liebe Wilhelmine,
verzeihen Sie, wenn ich Sie mit dieser Nachricht behelligen muss. Leider war es mir nicht möglich, Sie vollkommen von jeder Einquartierung zu befreien. Ganz Solingen ist mit französischen Truppen belegt; wir müssen alle unser Scherflein beitragen.
Ihr »Gast«, um es positiv auszudrücken, ist ein général de brigade namens Soult, der seinen Kammerdiener, einen Burschen und zwei Adjutanten mitbringen wird. Er gehört zu den engen Vertrauten des Divisionsgenerals Lefebvre, der ihn uns in seinem Begleitschreiben als höflich und von ruhiger Gemütsart ankündigt. Als Offizier dürfte er jedoch nicht ohne Ansprüche sein. Ich hätte nie gewagt, ihm ein weniger distinguiertes Haus anzubieten als das Ihre, wo ich weiß, mit welcher Hingabe man ihn umsorgen wird.
In jedem Fall sollte seine Anwesenheit Sie vor allen Übergriffen übermütiger Soldaten schützen. So viel glaubte ich der Witwe eines meiner Amtsvorgänger schuldig zu sein.
In untertänigster Verehrung, Ihr Ihnen stets gewogener
Peter Johann Abraham Schmitz, Bürgermeister
Post Scriptum: Es wäre zweifellos günstig, würde Monsieur Duffieux de la Grange-Merlin seine Besuche in Ihrem Haus eine Weile einstellen. Ein General der Revolutionsarmee könnte die Anwesenheit eines Émigré trotz des Waffenstillstands als Provokation empfinden.
~
Wilhelmine ließ das Schreiben sinken, das soeben von einem Botenjungen für sie abgegeben worden war, und widerstand mühsam dem Drang, das Papier mit dem offiziellen Briefkopf der Stadt zwischen den Fingern zu zerknüllen.
Aus dem Spiegel über dem kalten Kamin blickte sie, eingerahmt in die weißen Rüschen von Kragen und Haube, ihr eigenes Gesicht an. Es wirkte blass und hart im trüben Licht dieses Januarmorgens, dessen Sonne noch zu müde und ausgelaugt schien, um weit genug in die Höhe zu steigen und ihre Strahlen bis herauf ins obere Stockwerk des Hauses zu senden. Unwillkürlich fröstelte Wilhelmine. Im Untergeschoss waren die Mädchen noch beim Lüften; durch die offenen Fenster herein flogen von der Cölner Straße her die Fetzen aufgeregter Rufe und das Echo einer Militärkapelle. Anscheinend hatte der Einmarsch der französischen Revolutionsarmee in Solingen bereits begonnen.
Es war zu spät, noch einmal Protest gegen die Kantonierung einzulegen. Wenn sie es nicht besser gewusst hätte, hätte Wilhelmine angenommen, der Bürgermeister habe sie mit Absicht erst jetzt informiert. Konnte es sein, dass die Einquartierung dieses Generals tatsächlich so kurzfristig vorgenommen worden war?
In jedem Fall war die namentliche Erwähnung von Luises Verehrer eine unterschwellige Beleidigung, sagte sie sich.
Man konnte wohl von Glück sagen, dass es sich bei der Ankunft der Franzosen wenigstens um einen friedlichen Einzug handelte. Noch bis vor wenigen Tagen hatte Krieg geherrscht, auch wenn die Erschöpfung und der Winter beide streitenden Parteien faktisch längst daran gehindert hatten, sich gegenseitig umzubringen. Zwischen den Truppen der Republik Frankreich und denen des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation war schließlich ein Waffenstillstand geschlossen worden, der dem Bergischen Land freilich wenig half: Zur neutralen Zone erklärt und zwischen den verfeindeten Heeren gelegen, würde es nun die gefräßigen Armeen beider Seiten den Winter über zu versorgen haben.
Ob man die Truppen der Republik Frankreich, wenn sie erst einmal faktisch Besitz von einer Stadt ergriffen hatten, jemals wieder daraus würde verscheuchen können, das stand auch in den Sternen.
Sie sah noch einmal in den Spiegel und runzelte die Stirn. Es half nichts, derart bleich und verhärmt konnte man einem fremden Herrn nicht gegenübertreten. Wilhelmine würde, bevor der General eintraf, sehr gegen ihre Neigung etwas Rouge auflegen und an einem Mittwoch den Sonntagsstaat anlegen müssen.
Sie beschloss, diese Notwendigkeit dem unerwünschten Gast bereits als erste Verfehlung anzurechnen. Zweifellos würden zahllose weitere folgen.
Aber mit einer wehrlosen Frau konnten sie es ja machen.
Die Trommeln wollten nicht verstummen. Wilhelmine würde das Hausmädchen anweisen, wenigstens die Fenster fest zu schließen. Was für eine unangenehme Unterbrechung des Tagesablaufs die Ankunft dieser fremden Menschen darstellte! Hoffentlich würde es möglich sein, jeden Kontakt mit den unerwünschten Gästen auf das Nötigste zu beschränken. Vorerst galt es wichtigere Fragen zu klären. Wilhelmines Blick schweifte weiter durch den Salon, über die goldene Uhr auf dem Kaminsims, die silbernen Leuchter daneben, die Gemälde an den Wänden bis zu der Porzellanschale mit Früchten auf dem Beistelltisch.
Sie ließ die Wirtschafterin rufen. Therese Bartlau, eine stämmige kleine Frau Ende vierzig, erschien prompt, das Kopftuch im Nacken verknotet, die Schürze von jenem strahlenden Weiß, das ihre Trägerin als jemanden auswies, der sich nicht mehr selbst die Kleider schmutzig zu machen brauchte. Wie ihre Herrin war auch sie Witwe, wenn auch deutlich länger als Wilhelmine und aus deutlich weniger vornehmen Verhältnissen. Dennoch gab es viele Punkte, in denen die beiden Frauen, die diesen Haushalt gemeinsam leiteten, sich einander verbunden wussten.
»Es ist wie befürchtet, Bartlau«, sagte Wilhelmine knapp. »Wir haben Einquartierung. Franzosen.« Therese Bartlau nickte und verzog den Mund zu einem grimmigen Lächeln. Wilhelmine hatte ihr gegenüber kein Geheimnis daraus gemacht, dass sie beim Bürgermeister interveniert hatte, bevor die Frage der Kantonierung überhaupt offiziell geworden war. Die Wirtschafterin war stets skeptisch gewesen, nun sah es aus, als werde ihr Misstrauen sich bewahrheiten. Dass Bürgermeister Schmitz vor den Franzosen kuschte, hatte man abwarten können. Abgesehen davon versprach er sich sicher mehr davon, die Häuser seiner Freunde aus dem Stadtrat von solch gefräßigen Gästen frei zu halten, als das einer alleinstehenden Witwe, die ihm voraussichtlich in der Zukunft weniger nützlich sein konnte.
Nun würde Wilhelmine Berg sich eben selbst helfen müssen, und die Bartlau würde ihr dabei zur Seite stehen wie immer in den Jahren seit dem Tod ihres Gemahls. Wilhelmine war froh um diese resolute Herrscherin über ihre Dienstboten. Sie wusste, alle Anweisungen würden präzise ausgeführt werden.
»Da wir seit Wochen an jedem Sonntag für den Waffenstillstand gebetet haben, dürfen wir uns jetzt wohl nicht über die Folgen beklagen«, fügte sie hinzu. »Unser Anliegen kann im Moment nur sein, uns so gut wie möglich auf die Ankunft dieser fremden Herren vorzubereiten. Haben wir irgendwelche Dienstboten, die in der Lage sind, sich auf Französisch verständlich zu machen?«
»Ich fürchte, nein, gnädige Frau.«
Wie ärgerlich. Wilhelmine selbst beherrschte nur ein paar Brocken der Sprache, auch wenn sie mehr verstand.
»Mit Verlaub, gnädige Frau – das Fräulein Luise?« Die Bartlau zog ein fragendes Gesicht, und Wilhelmine winkte energisch ab.
»Meine Tochter hat zwar Französisch gelernt, wird aber nicht in Kontakt mit unseren Gästen treten, sofern es sich nicht als unumgänglich notwendig erweist. Es wäre kaum statthaft.«
Mit ein bisschen Glück würde dieser Waffenstillstand bald enden, und die Franzosen wären in einigen Tagen verschwunden. Das Wetter war überraschend gut für Januar; gewiss konnten die Herren bei solch strahlendem Sonnenschein wie heute bald damit fortfahren, einander zu erschießen? Oder war Sonnenschein nicht gut für die Kriegsführung? Wäre Frost besser gewesen? Sie würde sich erkundigen und ihre Gebete um gutes Wetter entsprechend danach ausrichten.
»Ich sollte vielleicht an meinen Bruder in Barmen schreiben«, überlegte sie laut. »Luise könnte für eine Weile zu ihm ziehen, sollte der Aufenthalt unserer Gäste tatsächlich länger dauern. Es würde die unangenehme Enge im Haus etwas vermindern. In jedem Fall möchte ich allen unnötigen Umgang mit diesen Menschen weitestgehend vermeiden.« Aus Wilhelmines Sicht war jeder Umgang unnötig; das musste sie nicht eigens betonen. Die Bartlau nickte grimmig, und Wilhelmine zählte auf, was zu tun war.
»Bitte sorgen Sie dafür, dass Räumlichkeiten bereitgestellt werden, damit die Herren bei ihrer Ankunft ohne Verzögerung auf ihre Zimmer geführt werden können. Ein General, zwei Adjutanten samt Dienstboten. Für die Domestiken werden Kammern unterm Dach genügen; geben Sie entsprechende Anweisungen für unsere Dienstmädchen, zusammenzurücken. Die Küchenhilfen schlafen in den Wirtschaftskammern. Dem General werden wir die Räumlichkeiten des seligen Herrn anbieten müssen. Machen Sie Zimmer für die übrigen Herren im selben Trakt frei, lassen Sie die Kamine säubern und befeuern, geben Sie der Köchin Bescheid und sorgen Sie für ausreichende Bevorratung, insbesondere was Holz, Weißbrot, Wein und Fleisch angeht. Die Preise für alle diese Dinge werden gewiss bald ins Unermessliche steigen. Unseren Gästen steht auch der Speisesaal zur uneingeschränkten Verfügung; meine Tochter und ich werden bis auf weiteres hier im Salon essen. Auf diese Art werden wir die Herren am wenigsten stören.«
Und ihnen am seltensten begegnen. Wieder das entschlossene Nicken der Bartlau.
»Warnen Sie die Mädchen, dass Sie mit einem gewissen Maß an Zudringlichkeit zu rechnen haben werden. Kleinigkeiten haben sie zu leiden; ernsthafte Übergriffe sind Ihnen oder mir zu melden, damit ich den General ermahnen kann, auf seine Leute einzuwirken. Jedes Mädchen, das einen der Franzosen zu unsittlichem Benehmen ermuntert, wird unverzüglich entlassen. Haben Sie gehört?«
»Jawohl, gnädige Frau. Wäre auch noch schöner.«
»Gut, dann zu Wichtigerem. Lassen Sie die Schatulle, die auf der Kommode in meinem Boudoir steht, in den hinteren Keller schaffen, ebenso die besten Schmuckstücke meiner Tochter, insbesondere die Rubinohrringe und die Kette mit dem silbernen Kreuz und den blauen Steinen. Dazu alle wertvollen Uhren, die Leuchter, die teuersten Tabakspfeifen und die Münzsammlung des seligen Herrn. Vom Tafelsilber und Porzellan ebenfalls alles Entbehrliche. Versperren Sie den Keller und sehen Sie zu, dass die Tür wie zufällig von etwas verdeckt wird, von Weinfässern oder dergleichen; den Schlüssel bringen Sie mir. Lassen Sie aber die billigeren Wertsachen liegen, auch Schnaps, Tabak, Manschettenknöpfe, versilberte Schuhschnallen und ähnliche Dinge; es wäre unklug und auffällig, würden unsere Gäste gar nichts zum Plündern finden.«
»Jawohl. Wenn ich fragen darf, was ist mit den Gemälden?«
Wilhelmine warf einen bedauernden Blick über die Schulter. Ihr verstorbener Gemahl hatte nur hin und wieder Bilder eingekauft, dabei jedoch guten Geschmack bewiesen.
Sie schickte in Gedanken einige kräftige Verwünschungen in Richtung Bürgermeister Schmitz.
»Ihr Fehlen würde auffallen; es ist keine Zeit mehr, sie durch schlechtere zu ersetzen.« Sie schaute die Wirtschafterin wieder an. »Bitte lassen Sie meiner Tochter, sobald sie von dem Besuch bei ihrem Onkel zurückgekehrt ist, ausrichten, sie möge in den nächsten Tagen so weit wie möglich auf ihrem Zimmer bleiben und sich auf keinen Fall im Wohntrakt des seligen Herrn blicken lassen. Monsieur Duffieux mag sie Nachricht von den Ereignissen geben; gewiss wird er von selbst so einsichtig sein, uns eine Weile nicht mehr aufzusuchen.«
Die Bartlau machte ein Gesicht, als wollte sie ausspucken. »Da wär' man wohl froh darüber. So ein französischer Habenichts. Ich verstehe gar nicht, was das Fräulein an so einem findet.«
Wilhelmine ihrerseits verstand es nur zu gut. Luise war immerhin bereits vierundzwanzig und wahrhaft keine Schönheit. Es wäre nicht weiter schlimm gewesen, unter anderen Umständen. Auch Wilhelmine selbst hatte als junge Dame nicht von sich behaupten können, mit den Reizen einer Pompadour oder Dubarry wetteifern zu können. Aber Wilhelmine hatte eine jener Ehen geschlossen, wie sie sich in Solingen und Umgebung fast von selbst ergaben unter den Familien der führenden Kaufmanns- und Fabrikantenfamilien. Das Äußere spielte dabei eine untergeordnete Rolle, wenn sich nur die geschäftlichen Interessen der Familien begegneten und ein wenig Sympathie vorhanden war.
Doch Luise schien das ja nicht zu genügen. Das halsstarrige Kind, von seinem Vater – Gott hab ihn selig! – nach Strich und Faden verwöhnt und verzogen, verlangte nach mehr, ohne dass Wilhelmine auch nur eine Vorstellung davon hätte gewinnen können, was konkret das sein sollte. Solingen schien Luise zu klein, zu gewöhnlich zu sein, und die jungen (oder auch gern schon etwas älteren) Herren der Stadt, die auch nur die leisesten Anstalten machten, sich für sie zu interessieren, fanden sich rasch entmutigt.
Andere junge Mädchen pflegten dieser Tage einen Hang zur Romantik, wünschten von einem verliebten Verehrer im Kahn gerudert zu werden oder Hand in Hand mit ihm durch die Natur zu promenieren. Wilhelmine hielt an sich nichts von solchen Albernheiten, wäre im Fall ihrer jüngsten Tochter jedoch froh darum gewesen. Als Mutter zweier weiterer Töchter, die beide glänzend verheiratet waren, wusste sie, wie leicht bei solchen Gelegenheiten einige schmeichelnde Bemerkungen das schwärmerische Gemüt einer jungen Dame beeindrucken und die Schritte beider jungen Leute fast von selbst auf den Pfad zum Traualtar lenken konnten.
Luise war dafür leider zu klug und ihr Blick in den Spiegel stets zu unbestechlich gewesen. Sie konnte zu genau einschätzen, jeder mögliche Verehrer werde sich in erster Linie für ihre Mitgift und allenfalls in zweiter Linie für die Person interessieren, die damit verbunden war. Grundsätzlich schien sie das zu akzeptieren, hatte aber im Gegenzug beschlossen, für sich das Beste herauszuholen. Die Solinger Bürger in ihren knielangen Röcken und steifen Kastorhüten fielen offenbar nicht unter diesen Begriff.
Inzwischen war Luise allerdings fast fünfundzwanzig und noch immer unverheiratet. Allmählich schien ihr zu dämmern, dass ihre Zeit ablief.
Unter solchen Vorzeichen war es, wenigstens nach Wilhelmines Ansicht, geraten, die eigenen Ansprüche herunter zu schrauben und zu nehmen, was man bekommen konnte. Selbst wenn es ein Franzose war wie Monsieur Duffieux de la Grange-Merlin, den die Revolution aus seinem Vaterland vertrieben hatte und der, wie die Bartlau und im Stillen auch Wilhelmine argwöhnten, vermutlich nicht viel mehr sein Eigen nannte als die Kleider auf dem Leib. Der junge Mann – nun ja, wenn man Anfang bis Mitte dreißig jung nennen wollte – hatte Luise bereits mehrfach seine Aufwartung gemacht, sich so angeregt, wie es angesichts von Wilhelmines Sprachkenntnissen möglich war, im Salon mit Mutter und Tochter unterhalten und jedes Mal brav für beide Damen Blumen mitgebracht.
Nur einen Antrag oder auch nur ein Liebesgeständnis hatte er Luise noch immer nicht gemacht.
Wilhelmine konnte nicht einschätzen, wie gefährlich die Lage möglicherweise für Duffieux werden würde, nun, da seine feindlichen Landsleute in Solingen waren. Die Anhänger der Revolution pflegten mit jenen Franzosen, die noch der Sache des ermordeten Königs anhingen, kurzen Prozess zu machen. Doch da Duffieux sich mit dem Segen des Stadtrats hier aufhielt und die einmarschierten Truppen hier nur Quartier nehmen, aber keinerlei Befehlsgewalt haben würden, wäre Duffieux hoffentlich nicht gezwungen, der Gegend den Rücken zu kehren.
Mit ihm würde sich womöglich Luises letzte Hoffnung auf eine Heirat verflüchtigen.
»Immerhin ist Monsieur Duffieux von vornehmer Abkunft«, versetzte sie würdevoll. Die Bartlau ließ sich wenig davon beeindrucken.
»Behauptet er zumindest. Kann heutzutage ja jeder sagen, wo man in Frankreich nichts mehr überprüfen kann. Ein wichtiger Mann kann er nicht gewesen sein, sonst hätten die anderen Franzosen, die Rebellen, ihn ja nicht aus dem Land gelassen, sondern geköpft. Und jetzt läuft er herum, der arrogante Tunichtgut, und lockt uns die jungen Männer mit englischem Geld zu den Waffen, damit sie solche wie ihn wieder nach Paris bringen. Wenn er gegen die Revolution kämpfen will, dann wünsche ich ihm alles Glück der Welt, aber er soll's gefälligst selber tun und nicht unsere unschuldigen Jungen dazu bringen, dass sie sich für ihn erschießen lassen.«
Wilhelmine hätte wenigstens der Form halber gern widersprochen, aber sie konnte nicht wirklich ein Argument dagegen finden.