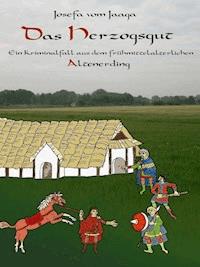Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als Louise de Guéhéneuc Ende 1799 in Begleitung ihrer Eltern nach Paris kommt, weiß sie genau, was der Grund dieser Reise ist: Sie soll heiraten. Bevorzugt einen Herrn aus dem Umfeld des Generals Napoleon Bonaparte, der sich soeben in Frankreich an die Macht geputscht hat und zum Ersten Konsul aufgestiegen ist. Aber wie Louise bald feststellt: Nicht alle Heiratskandidaten, die im Kreis der neuen Machthaber zur Auswahl stehen, verfügen über die besten Manieren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 533
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ein General und Schandmaul
TitelseiteKapitel 1Kapitel 2Kapitel 3Kapitel 4Kapitel 5Kapitel 6Kapitel 7Kapitel 8Kapitel 9Kapitel 10Kapitel 11Kapitel 12Kapitel 13Kapitel 14Zwischenspiel: MarengoKapitel 15Kapitel 16Kapitel 17Kapitel 18Kapitel 19Kapitel 20Kapitel 21Kapitel 22Kapitel 23Kapitel 24NachwortAnhang I: Der Französische RevolutionskalenderAnhang II: Übersetzungen und BegriffsklärungenAnhang III: Was wurde aus ...Anhang IV: ZeittafelWeitere BücherImpressumJosefa vom Jaaga
Ein General und Schandmaul
Kapitel 1
»Wenn man es genau betrachtet«, sagte Monsieur de Guéhéneuc, »so hat das Unheil wohl begonnen ab dem Zeitpunkt, als wir Männer euch Frauen gestatteten, lesen zu lernen.«
Die Kutsche fuhr durch ein weiteres Schlagloch und rüttelte ihre Insassen durch. Es war in diesem Jahr bereits ungewöhnlich kalt für Mitte Frimaire1 (oder Anfang Dezember, wie man in glücklicheren Tagen gesagt hätte); die Landschaft vor dem Kutschfenster versank in eisigen Nebeln. Der Grund blieb bis Mittag gefroren, und die Straße, von den Herbstregen ausgewaschen, wand sich als knochenhartes, von tiefen Furchen und Gräben durchsetztes Band der Hauptstadt entgegen. Louise nahm an, sie werde am ganzen Körper blaue Flecken haben, wenn sie erst in Paris bei Tante und Onkel anlangten. Falls sie nicht vorher allesamt erfroren wären.
»Ich würde dir vehement widersprechen, lieber François«, lächelte Louise' Mutter, nachdem sie sich wieder in den Kissen zurecht gesetzt hatte, »würde ich dich nicht schmunzeln sehen und wüsste ich nicht, dass du selbst der erste warst, der darauf drang, dass unsere Tochter eine ordentliche Bildung erwerben sollte.«
»O ja«, spöttelte Louise' Vater. Er musste lauter sprechen als üblich, um das Rattern der Räder zu übertönen, und er beugte sich vor dabei, um eigenhändig die ins Rutschen geratene wollene Decke wieder über den Knien seiner Damen zurecht zu rücken. »Natürlich habe ich das. Weil ich ein Dummkopf bin wie alle Väter und wie alle Väter von Grund auf verliebt in meine Tochter. Wenn es nach mir ginge, sollte sie alles haben, was sie sich wünscht. Und was wünscht sie sich? Romane voller strahlender Helden natürlich, nach deren Lektüre sie notwendigerweise über die Gewöhnlichkeit der wirklichen Verhältnisse die Nase rümpft und sich für keinen Ehemann mehr begeistern kann.«
»Oh, François!«, lachte Madame de Guéhéneuc, und Louise setzte eine würdevolle Miene auf.
»Nun gut, lieber Papa. Um Ihnen zu beweisen, wie wenig hochmütig mich die Lektüre gemacht hat, will ich Ihnen gestehen, dass ich mir meinen Ehemann bereits gewählt habe: Ich denke, ich werde den hinkenden Gustave heiraten.«
»Den früheren Knecht von Monsieur Forger?« Louise' Eltern taten ihrer Tochter den Gefallen, sich händeringend über den Einfall zu entsetzen. »Mach uns nicht unglücklich, teures Kind!«
»Aber wieso denn?« Louise vergrub die Hände tiefer in ihrem Muff und sah unschuldig von ihrem Vater auf die Mutter und zurück. »Gustave hat sich von seiner Frau scheiden lassen und sie samt Kind vor die Tür gesetzt, sowie seine neuen Freunde es ihm möglich machten, hat dann seine Arbeit hingeworfen und sich ganz der Politik und dem nationalen Wohl gewidmet. Ist das nicht selbstlos und zeugt von edelmütigem Charakter? Er hat keinen Zahn mehr im Mund und zumindest dem Anschein nach keinen Besitz außer seinem Schnupftuch und den Kleidern, die er am Leib trägt – für seinen Lebensunterhalt sorgt er, indem er wohlhabende Bürger beim Jakobinerclub denunziert. Er kann weder lesen noch schreiben, verbringt den Tag damit, der Arbeit aus dem Weg zu gehen und auf die Besitzenden zu schimpfen, und flucht, spuckt und rotzt auch sonst, dass es eine Lust ist. Mit anderen Worten, er ist das Idealbild eines Helden unserer glorreichen Revolution, und ich denke, ich könnte nicht besser wählen als ihn.«
Madame de Guéhéneuc wendete sich zur Seite und verbarg ihre Heiterkeit hinter ihrem breiten Hutschleier, aber Louise' Vater, obwohl auch er lachte, seufzte ein wenig.
»Tu deinem alten Vater einen Gefallen, Kind, und lass solche Worte niemanden hören, wenn wir erst in Paris sind!«
Louise wurde sofort ernst. Sie neigte, außerhalb der vertrauten Umgebung ihrer Familie, wenig zum Übermut und musste deshalb nicht wirklich daran erinnert werden, auf ihre Worte zu achten – auch nicht daran, wie wichtig diese Reise für die ganze Familie war.
Seit achteinhalb Jahren war Louise nicht mehr in Paris gewesen – seit jenem verhängnisvollen Tag im Juni 1791, als die königliche Familie versucht hatte, aus dem revolutionären Frankreich zu fliehen. Sobald François de Guéhéneuc, seines Zeichens Kammerdiener Ludwigs XVI. und damit Inhaber eines höfischen Amts, das ihm unmittelbaren Zugang zur Familie des Herrschers gewährte, vom Verschwinden seines Herrn erfuhr, kannte er nur noch ein Ziel: seine eigene kleine Familie vor dem Unheil in Sicherheit zu bringen, das er unaufhaltsam herannahen sah. Louise war damals neun Jahre alt gewesen, und sie erinnerte sich noch an ein kleines, weiß vertäfeltes Zimmer, in dem sie und ihr jüngerer Bruder Charles-Louis oft gespielt hatten und von dem sie annahm, es müsse zum königlichen Palast gehört haben. Louise' Vater hatte zunächst die Kinder aus den Tuilerien fortbringen lassen, dann Louise' Mutter, und schließlich war auch er selbst … ja, man musste es wohl so nennen: geflohen, fort aus der Nähe zum Königshof, fort aus der Hauptstadt ins verschlafene Dornes, wo einem Freund der Familie ein kleines Landhaus gehörte, in dem sie für die nächsten Jahre Zuflucht fanden.
Wenn Louise ehrlich war, so war es der Familie dort nie wirklich schlecht ergangen. Monsieur de Guéhéneuc besaß ein gutes Gespür für die Chancen, die sich inmitten des revolutionären Chaos boten, und auch wenn er nie so weit ging, sich den Jakobinerclubs anzudienen, die mit blutigen Parolen und noch blutigeren Taten schon bald die Macht an sich rissen, so gelang es ihm doch, bei den häufigen Versteigerungen eingezogener Güter das eine oder andere lohnende Geschäft zu machen. Jene ersparten goldenen Louisdors, die Madame de Guéhéneuc eingenäht in ihre Unterröcke und in die Kleider der Kinder aus den Tuilerien geschmuggelt hatte, stiegen in ihrem Wert ins Unermessliche, als Frankreichs Wirtschaft zwischen Kriegschaos und rasender Geldentwertung in sich zusammenbrach. Armeen wurden aufgestellt und zogen an die Grenze; die Soldaten benötigten Kleidung, Schuhe und Ausrüstung. Monsieur de Guéhéneuc besaß aus besseren Tage noch manche Kontakte, manche Freunde, die in ähnlicher Lage waren wie er. Er veräußerte sein Haus in Paris, wusste sich im Ausland mit Goldreserven und mit Waren zu versehen und sie in Frankreich unter der Hand oder offen an den Mann zu bringen. Die alten Freunde aus besseren Tagen taten sich zusammen, verschafften einander Verträge und Empfehlungen, griffen sich gegenseitig unter die Arme. Die meiste Zeit fehlte es Louise und ihrer Familie an nichts. Sie hörten von den Gräueln der Revolution, sie ängstigten sich deswegen, doch sie blieben unbehelligt. Louise' Vater hatte, während rundum alle Ordnung zusammenzubrechen schien, ein regelrechtes Vermögen erwirtschaftet. Für das Landhaus in Dornes mit seinem schönen Park inmitten von Weinbergen konnte Monsieur de Guéhéneuc dem Freund, der die Familie einst so großzügig aufgenommen hatte, inzwischen längst einen ordentlichen Mietzins bezahlen. Für Louise und ihren Bruder Charles war es ein wirkliches Zuhause geworden.
Dennoch. Mochte die Familie noch so wohlhabend geworden sein inmitten des Aufruhrs, mochte die Terrorherrschaft der Guillotine auch vorüber sein, Louise würde der Revolution den Mord an König und Königin nie verzeihen. Denn natürlich hatte man in jenem traurigen Juni, als Louise sich aus der Stadt aufs Land geschafft sah, die flüchtende Königsfamilie wieder eingefangen, hatte sie im Triumph zurück in die Hauptstadt geschleppt, sie erst in ihrem Palast, dann im Kerker gefangengesetzt und schließlich auf der Guillotine ermordet. Louise erinnerte sich noch an das aschgraue Gesicht ihres Vaters an jenem Morgen, als er die Zeitung las.
»Er war in vielem ein Narr«, hatte sie ihn murmeln gehört. »Aber das … nein, nicht das.« –
Louise schüttelte leicht den Kopf, als könne sie mit dieser Bewegung die düsteren Erinnerungen verscheuchen. Die Kutsche ratterte weiter über die unebene Straße.
»Bitte verzeihen Sie, Papa«, sagte sie nüchtern in den Lärm der Räder. »Ich wollte Sie nicht beunruhigen.«
Zu viel stand auf dem Spiel für ihren Vater bei dieser Reise, wusste Louise. In Paris hatte es wieder einmal einen Putsch gegeben – war es nun der zweite, dritte oder vierte seit der Revolution? Soweit Louise es verfolgt hatte, geschah dies immer auf ähnliche Weise: Diejenigen innerhalb der Gruppe der Machthaber, die fanden, sie kämen ein wenig zu kurz für ihren Geschmack, suchten sich einen willigen General mit bekanntem Namen und setzten mithilfe von dessen Truppen die alte Regierung ab, um eine neue zu bilden. Aber diesmal schien etwas anders zu sein. Dieser letzte General schien nicht gewillt, nach dem Putsch wieder in der Versenkung zu verschwinden, wie man das von den Militärs erwartete.
Und nach der Ansicht von Louise' Onkel Frédéric, dem Bruder ihrer Mutter, war das sogar eine gute Sache.
»Zum ersten Mal«, hatte er an Monsieur de Guéhéneuc geschrieben, »zum ersten Mal seit neun Jahren, lieber Schwager, sieht es aus, als erhielten wir wieder Ruhe, um zu atmen, seit Bonaparte an der Macht ist. Die Leute sind des Streits müde.«
Und deshalb war Louise' Vater nun mit seiner Gemahlin und seiner Tochter auf dem Weg nach Paris. Um sich der neuen Administration, die sich »Konsulat« nannte, vorzustellen und sich in Erinnerung zu bringen. Die neue Regierung hatte Ämter zu vergeben, und man munkelte, laut genug, damit Onkel Frédéric es für wahr hielt, Opfer der Revolution und ehemalige Vertraute vom königlichen Hof könnten mit bevorzugter Behandlung rechnen.
Hoffentlich hatte Onkel Frédéric sich nicht geirrt.
Ganz mochte auch Louise' Vater der neuen Lage noch nicht trauen.
»Eine neue Regierung wird zunächst einmal ihr eigenes Scherflein ins Trockene bringen wollen«, hatte Monsieur de Guéhéneuc den Brief seines Schwagers nüchtern kommentiert. »Bei einem Putsch von solchen Ausmaßen haben viele Männer mitgeholfen oder zumindest weggesehen. Beides, Hilfe wie Wegschauen, wird bezahlt werden müssen – und wo wird das Geld dafür herkommen wenn nicht von denen, die gestürzt wurden?« Er deutete wehmütig auf sich selbst. »Ich habe mehrere Geschäfte mit engen Vertrauten der alten Regierung getätigt – wer sagt, dass die neue mir das nicht nachteilig auslegen wird? Wer sagt, dass unter diesen Soldaten, die die Macht übernommen haben, nicht immer noch Jakobiner vom alten Schlag sind, bereit, jeden Geschäftsmann schon allein deshalb auf die Guillotine zu schicken, weil er mehr Geld in der Tasche hat als sie?«
Dennoch war er sofort entschlossen, Onkel Frédérics Einladung nach Paris anzunehmen – oder vielleicht sogar deswegen. Möglichst rasch Freundschaft zu schließen mit der Horde von Generälen, die sich da in der Hauptstadt plötzlich als Politiker gaben, war das Gebot der Stunde, sagte sich Louise. Für den Fall, dass es schief ging, mochte Monsieur de Guéhéneuc seine Vorsichtsmaßnahmen ebenfalls bereits getroffen haben. Zumindest hatte er Charles-Louis, Louise' Bruder, bei seinem Erzieher in Dornes gelassen. Er war erst sechzehn, fast zwei Jahre jünger als seine Schwester.
Louise selbst dagegen war von Onkel und Tante ganz ausdrücklich mit eingeladen worden, weshalb sie nun, eingehüllt in Pelisse, Wolldecken, Schals, Haube und Muff, neben Madame de Guéhéneuc auf dem bequemeren Rücksitz saß und mit ihren Eltern um die Wette fröstelte. Niemand hatte den Grund für diese Einladung an Louise ausgesprochen, und es war auch nicht notwendig. In Dornes würde sich für die Tochter eines ehemaligen königlichen Kammerdieners kaum ein standesgemäßer Ehemann finden – in den wieder zum Leben erwachten Räumen der Tuilerien, die der neuen Regierung als Amtssitz dienten, dagegen sehr wohl.
Und Louise wusste, dass nichts so geeignet war, um ein lukratives Amt zu erhalten, wie die Verwandtschaft zu bedeutenden Persönlichkeiten. Ihre Versicherung an Monsieur de Guéhéneuc, sie wolle ihn nicht beunruhigen, erhielt somit noch eine zweite Bedeutung.
Louise kannte ihre Pflicht. Sie sah ihr nicht unbedingt mit Begeisterung entgegen, aber sie wusste, es würde ihre Aufgabe sein, sich gut zu verheiraten, die Familie dadurch finanziell zu entlasten und die Zukunft ihrer kleinen Familie ein Stück weit mit zu sichern.
Onkel Frédéric begrüßte die Verwandten in aufrichtiger Freude, Tante Henriette deutlich zurückhaltender. Möglicherweise erinnerte sie sich noch zu gut an die Spannungen, die zwischen ihr und Louise' Mutter geherrscht hatten, als Onkel Frédéric sie samt den Kindern während der dunkelsten Monate der Terrorherrschaft zu den Guéhéneucs nach Dornes geschickt hatte. Auch Louise' Vater mochte daran denken, denn er überbot Onkel Frédéric noch an Freundlichkeit und bedankte sich mehrmals und überschwänglich bei ihm und Tante Henriette für die angebotene Gastfreundschaft.
»Wir werden deine Güte nicht zu lange in Anspruch nehmen, lieber Freund«, beteuerte er nochmals, als die gesamte Familie sich im kleinen und reichlich düsteren Salon von Tante Henriette auf eine Tasse Tee versammelt hatte. »Bei erster Gelegenheit suche ich nach einem Haus, das wir für einige Wochen mieten können. Denn ich nehme an, so lange wird es wohl dauern, mit unseren neuen Konsuln ins Gespräch zu kommen.«
»Vielleicht nicht einmal, Schwager, vielleicht nicht einmal.« Onkel Frédéric rührte in seiner Tasse. Er saß in einem Fauteuil, dessen Armlehnen unter breiten, ungeschickt bestickten Schonern verschwanden – gewiss das Werk einer von Louise' halbwüchsigen Kusinen, die soeben, nachdem man sich reihum begrüßt und umarmt hatte, von Tante Henriette rigoros auf ihr Zimmer geschickt worden waren, um den nach der Reise erschöpften Verwandten etwas Ruhe zu gönnen. »Bonaparte war als General, wie man hört, ein Mann schneller Entschlüsse. Das wird sich nicht geändert haben.«
»Und du denkst noch immer, er steht Unsereins wohlwollend gegenüber? Und er wird sich halten können?«
»Bisher sieht alles danach aus«, antwortete der Onkel. »Er hat sich mit Feuereifer in die Arbeit gestürzt, und man scheint es zu würdigen. Vor allem aber hat er die richtigen Leute hinter sich – die Bankiers und Kaufleute. Die haben ihn nach oben gebracht und drängen ihn in die richtige Richtung. Frankreich hat genug von Erklärungen und Verfassungen und immer neuen garantierten Rechten, die man auf der Straße mit Füßen tritt. Die Leute haben Hunger, die Leute wollen Geld verdienen und sich von ihrer Hände Arbeit ernähren, und dafür, dass sie es wieder können, will Bonaparte sorgen.«
Louise ließ den Blick durch den Raum schweifen, über die Landschaftsbilder in ihren splitternden Goldrähmchen, die verblichenen Vorhänge, die durchgesessenen Sofas, auf denen die Familie sich gruppiert hatte. Von allem, was die Revolution gebracht hatte, waren die Worte, oder die Gedanken dahinter, ihr das Liebste gewesen.
»Und er ist zugänglich?«, erkundigte sich Monsieur de Guéhéneuc weiter und meinte den Ersten Konsul damit. Onkel Frédéric wiegte das Haupt hin und her.
»Nur bedingt«, gab er zu. »Ehrlich gesagt, er ist ein seltsamer Kauz. Eine Witzfigur, unter anderen Umständen. Du wirst ihn erleben. Lach nur nicht, wenn er anfängt, unsere Zeiten mit Cäsar und Augustus, Alexander dem Großen und Hannibal zu vergleichen – drunter tut er's nicht. Aber was rede ich, du wirst nicht lachen – niemand würde das. Dazu ist es ihm zu ernst. Und wenn du ihn hörst und dich nicht sehr in Acht nimmst, fängst du fast selbst an, daran zu glauben. In jedem Fall«, fügte er hinzu und ließ den Blick von Louise zu ihrer Mutter gleiten und zurück, »war es eine gute Idee, deine Damen mitzubringen. Für jemanden, der dem alten Hof nahestand, führt der einfachste Weg zu Konsul Bonaparte über die Konsulin Madame Bonaparte.« Er musste lachen. »Und die ist zugänglich, das kann ich dir versichern. Sie wird begeistert sein, euch beide zu empfangen, da habe ich keinen Zweifel.« Er beugte sich vor und kniff seine Nichte neckisch in die Wange. »Vor allem Louise wird dort bestimmt großen Erfolg haben.«
Beim Abendessen platzte das Speisezimmer aus allen Nähten. Man musste Onkel Frédérics guten Willen loben, aber es war unübersehbar, dass sein Haus keine zwei Familien beherbergen konnte. Bevor Tante Henriette endlich den ersehnten Stammhalter zur Welt gebracht hatte (der nicht zu Hause wohnte, sondern ein Internat in der Stadt besuchte), hatte sie nicht weniger als fünf Töchter geboren, von denen vier noch lebten. Die älteste, Madeleine, war vierzehn, ihre Schwester Claire, mit der Louise sich am besten verstand, dreizehn, die beiden jüngsten elf und zehn. Somit scharten sich selbst ohne die häufigen Gäste jeden Abend mindestens neun Personen um Onkel Frédérics Tafel und in Tante Henriettes Salon.
Am ersten Abend gestattete die Etikette den Neuankömmlingen, sich nach der anstrengenden Reise bald zu entschuldigen, das Haus wieder seinen eigentlichen Bewohnern zu überlassen und sich in ihre Schlafkammern zurückzuziehen. Für Louise bedeutete das, hinter einer übel gelaunten Magd, die mit dem Licht vorausging, eine knarrende, enge Stiege hinauf zu klettern und in ein Zimmer zu ziehen, das eigentlich ihrer Kusine Madeleine gehörte.
Es war eisig kalt in der Stube, so kalt, dass Louise unwillkürlich zögerte, sich für die Nacht zu entkleiden. Stattdessen trat sie an das einzelne Fenster der kleinen Kammer. Es ging auf einen gepflasterten Innenhof hinaus; hinter einem vorspringenden, in der Mitte eingesunkenen Dach konnte Louise die kahlen Zweige eines Obstbaums erkennen. Faulendes Laub lag zu Füßen der Mauer. An den braunen Streifen, die die Hauswände entlang liefen, konnte man erkennen, wo die Schlafzimmer lagen, aus deren Fenstern man morgens die Nachttöpfe entleerte. Ein Hund, vermutlich ein Streuner, verschwand soeben ums Eck.
Kein angenehmer erster Eindruck von Paris, dachte Louise. War dies wirklich die Stadt, von der die Dichter behaupteten, nur hier könne eine Frau wahrhaft Frau sein? Man konnte nur hoffen, die potentiellen Ehemänner, die sich unverheirateten jungen Damen in diesen Mauern präsentierten, würden ein wenig ansehnlicher sein als die Mauern selbst.
***
Vgl.
Anhang I: Der Französische Revolutionskalender
Kapitel 2
Monsieur de Guéhéneuc sprach bereits am nächsten Tag in den Tuilerien vor und gab bei den zuständigen Behörden ein schriftliches Gesuch ab, in dem er sich und seine Situation schilderte, sein besonderes Verhältnis zum ehemaligen Königshof darlegte und um Ersatz für jene Stellung bat, die die Revolution ihm zerstört hatte. Rascheren Erfolg versprach aber auch er sich von dem zweiten Schreiben, das Madame de Guéhéneuc am Nachmittag in Tante Henriettes Salon auf sein Diktat hin verfasste und bei der Reinschrift durch jene weiblich weitschweifigen Formulierungen aufwertete, angesichts derer ihr Ehemann in gutmütigem Spott die Augen rollte. Es war gerichtet an Madame Josephine Bonaparte, die Gemahlin des Ersten Konsuls.
Ein wenig wunderte Louise sich darüber. Was hatte die Ehefrau eines Staatsbeamten mit Angelegenheiten der Politik zu tun?
Während die Guéhéneucs auf Antwort warteten und während Louise' Vater sich vornahm, sich regelmäßig in die Tuilerien zu begeben, um nicht in Vergessenheit zu geraten, begann man mit der Suche nach einer geeigneten Wohnung. Mochten die wohlerzogenen Kusinen auch noch so treuherzig versichern, es mache ihnen nichts aus, sich in einem gemeinsamen Zimmer zusammenzudrängen, und mochten Madame de Guéhéneuc und Tante Henriette noch so entschieden versuchen, Streitereien zwischen den eigenen und fremden Dienstboten zu verhüten, auf lange Sicht war es für den Familienfrieden unabdingbar, dass der Besuch aus der Provinz sich nach einer eigenen Bleibe umsah.
Louise fühlte sich auch nach Ablauf einiger Tage noch immer nicht wohler. Sie war mit ihrer Mutter einige Male ausgefahren, um ein paar enge Bekannte zu besuchen – in einer Droschke, was Madame de Guéhéneuc sehr beschämte, obwohl es angesichts der neuen Verhältnisse kaum noch jemanden gab, der sich leisten konnte, auf solche Dinge zu achten. Selbst wohlhabende Geschäftsleute zogen es dieser Tage vor, Mietkutschen zu nehmen, statt einen eigenen Wagen zu halten, wenn nicht aus finanziellen Gründen, dann aus ideellen. Wer wollte schon dastehen als einer, der sich über seine ärmeren Mitbürger zu erheben versuchte? Oder richtiger: Wer wagte es bereits wieder?
Großes Vergnügen hatte Louise in jedem Fall auch an diesen Ausfahrten nicht gefunden; alles, was sie vom Fenster des Wagens aus sehen konnte, waren bröckelnde Fassaden und frierende Menschen. Die Besuche bei den Freunden verliefen eintönig, mit den immer gleichen Gesprächen über entfernte Verwandte und geflüsterten Anspielungen auf jene Freunde, die sich vor der Revolution ins Ausland geflüchtet hatten.
Was Louise bei Onkel Frédéric besonders zu schaffen machte, war der fehlende Garten. Ihr Zimmer zu Hause in Dornes wies mit seinem Balkon hinaus ins Grün, in jenen leicht verwilderten kleinen Park, in dessen Mitte das Haus lag, und Louise, obwohl sie es im allgemeinen vorzog, sich in den Räumen zu beschäftigen, hatte die Möglichkeit zu täglichen Spaziergängen doch gern genutzt. Den Küchenhof, über den morgens die Gemüse- und Fleischhändler ihre Handkarren zogen, und die wenigen Fußbreit Rasen, die sich hinter dem Haus von Onkel Frédéric bis zum Küchenbeet und dem verwilderten Birnbaum erstreckten, konnte man jedoch beim besten Willen nicht wirklich als Garten bezeichnen.
Selbst Louise' Mutter, die sehr streng auf Etikette hielt und es eigentlich ungehörig fand, als Dame zu Fuß durch die Stadt zu gehen, hielt es letztlich in den engen Räumlichkeiten nicht mehr aus. Glücklicherweise lag das Haus von Onkel Frédéric in einer sicheren Straße, in der man nicht um Ehre oder Hab und Gut fürchten musste, und Madame de Guéhéneuc rechtfertigte ihren eigenen Verstoß gegen die guten Sitten schließlich damit, die Revolution habe ohnehin alle gesellschaftlichen Regeln davon gefegt. Unter dem Vorwand, Besorgungen machen zu müssen, und meist begleitet von einer der jungen Kusinen sowie einem Dienstmädchen, das die leidvolle Ehre hatte, die Einkäufe nach Hause tragen zu dürfen, machten Madame de Guéhéneuc und Louise sich von da an täglich auf zu langen Fußmärschen über Gassen und Plätze und durch Boutiquen und Kramläden.
Es war keine völlig aus der Luft gegriffene Ausrede. Denn auch wenn Madame de Guéhéneuc in den letzten Jahren hin und wieder ein Damenjournal aus der Hauptstadt in die Finger bekommen hatte, so war man in Dornes doch weit von all jenen rasch wechselnden modischen Entwicklungen entfernt, die die Damen von Paris in Atem und die Portemonnaies ihrer Väter und Ehemänner schmal hielten. Die Verkäufer in Stoff- und Putzgeschäften überboten sich darin, die Neuzugänge aus dem Süden über die letzten Neuerungen aufzuklären. Louise, die schlichte Gewänder bevorzugte und wenig Sinn für die tiefere Philosophie des Bekleidungswesens aufbrachte, lauschte halb amüsiert, halb geistesabwesend, während ihre Mutter mit den Kusinen und Ladeninhabern darüber diskutierte, ob eine bestimmte Art von Spitzen an Ärmelabschlüssen und Säumen in diesem Jahr tragbar war oder nicht und welche Farben von Federn und Bändern um Gottes willen nicht in Kombination auf Hut oder Haube aufscheinen durften. Versehen mit vielen guten Ratschlägen und bepackt mit Hutschachteln und in Packpapier gewickelten Stoffproben machte die Gruppe sich danach auf den Weg nach Haus – sehr zum Vergnügen von Tante Henriette, die durchaus schätzte, wenn ihre Nachbarinnen von Fenster aus beobachten konnten, wie die offenbar wohlhabenden Gäste Tag für Tag neue Einkäufe in ihr Haus trugen.
Die Gassen, durch die ihr Weg führte, lagen beim Aufbruch vormittags meist noch in winterlich-frostiger Ruhe. Das Viertel, in dem Onkel Frédérics Haus lag, war wahrlich kein schlechtes, mit gepflasterten Wegen und ansehnlichen Fassaden, aber es hatte doch bessere Zeiten gesehen. Manch Eigentümer mochte sich aufs Land zurückgezogen haben, um von dort abzuwarten, wie die neu angetretene Regierung sich geben würde. Viele Vorhänge hinter den Fenstern waren zugezogen, Putz bröckelte an den Mauern herab. Ein Blick in die Seitengassen zeigte, dass zumindest in manchen Wohnungen Dienstboten bei der Arbeit waren; an Hintereingängen wurde mit Lieferanten um Brot und Gemüse gefeilscht, und aus oberen Stockwerken ergoss sich der Inhalt von Nachttöpfen hinunter in den Rinnstein. Durch die kahlen Zweige der Hecken huschten Spatzen auf der Flucht vor verwilderten Katzen.
Traten Madame de Guéhéneuc und ihre Begleiterinnen den Heimweg an, so hatten sich die Straßen längst belebt; man musste jetzt darauf achten, keiner Chaise vor die Pferde zu laufen und nicht mit den dünnen Sohlen von Damenstiefeln in die Hinterlassenschaften der Kutschgäule zu treten. Händler mit Bauchläden oder Handkarren riefen mit heiserer Stimme ihre Angebote in die Luft, Dienstmädchen auf Besorgungsgängen kuschelten sich enger in ihre Schultertücher, Tagelöhner klopften an Hintertüren und bliesen auf ihre Finger, um sie zu wärmen. Über allem lag ein unmerklicher Schleier von Grau, wie eine nicht abzuwaschende Schmutzschicht, oder als seien unter den Jahrhunderten, die über die Stadt gezogen waren, ihre Farben allmählich verblasst.
Louise dachte wehmütig an ihr Zimmer in Dornes. Auch dort wären die Gärten jetzt kahl. Aber dennoch, so schien ihr, hatte der Blick von ihrem Balkon ihr selbst im tiefsten Winter nie ein Bild derartiger Tristesse gezeigt, wie es das graue, in Frost erstarrte Paris tat.
Eines Tags, als die Damen mit ihren Einkäufen wieder vor dem Tor in der alten Mauer anlangten, die den Vordereingang von Onkel Frédérics Haus ein wenig von der Straße abschirmte, belebten zwei unerwartete Farbtupfer das trübe Bild. Die Uniform des einen Offiziers war grün mit roten Aufschlägen und Hosen, die des anderen blau, seine Hosen weiß. Beide Herren schienen noch recht jung, sie konnten kaum dreißig Jahre zählen. Beider Uniformröcke und -hosen waren in ähnlichem Maß übersät mit Goldstickereien, Tressen, goldenen Schnüren an der Schulter und sonstigen Abzeichen, die Louise sich nicht deuten konnte. Die Herren waren so vertieft in ihr lautstarkes Gespräch, dass sie die gemächlich heran rückende Damenschar, der sie den Weg versperrten, glatt übersahen.
Beide sprachen – oder schrien – tiefsten gascognischen Patois. Und vermuteten rein deshalb wohl bereits, sich in ihrer Unterhaltung keinerlei Zwang antun zu müssen. Wer in der Hauptstadt sprach schon diesen alten Dialekt?
Nun, Louise zum Beispiel. Was direkt mit der Köchin des Landhauses in Dornes zusammenhing, die aus der Gascogne stammte, die zwei kleinen Kinder der neu eingezogenen Familie, die sie gern in der Küche besuchten, sofort ins Herz schloss und sich, lange ehe die Guéhéneucs gekommen waren, bereits unter den vorherigen Bewohnern seit einem Jahrzehnt standhaft geweigert hatte, ordentliches Französisch zu lernen – eine Widerborstigkeit, die sie auch unter der neuen Herrschaft nicht ablegte. Es hatte einiger amüsanter Missverständnisse zwischen Madame de Guéhéneuc und der Herrin über Herd und Kochtöpfe bedurft, ehe Louise' Mutter vor den Verhältnissen kapitulierte und sich das notwendige Vokabular aneignete, um mit ihrer Köchin kommunizieren zu können.
Bei Louise und ihrem Bruder Charles war es, inspiriert durch jede Menge Naschereien, schneller gegangen und hatte größere Erfolge gezeigt. Zwar verstand Louise jetzt bei weitem nicht alles von dem Gespräch zwischen den zwei Offizieren – vor allem einige der heftiger gebrüllten Ausdrücke entgingen ihr – aber doch genug, um sich den Verlauf des Streits in etwa zusammenreimen zu können. Sie tat das schon aus etlicher Entfernung, denn die Herren bewiesen beide, dass sie über beachtliches Stimmvolumen verfügten.
»Verdammt, du hattest es versprochen!«
»Ich hatte gesagt, ich versuche es, Jean. Ich konnte sie nun einmal nicht umstimmen.«
Der zweite Sprecher machte Anstalten, sich abzuwenden, sah sich aber grob an der Schulter festgehalten, und Louise konnte sehen, wie sein Kopf herum ruckte und seine Augen sich zornig weiteten. Ein weiß gepuderter Flechtzopf baumelte ihm unter dem Zweispitz hervor auf den Rücken; an den Seiten fielen ebenso gepuderte Strähnen offen um sein Gesicht. Der Offizier schüttelte die Hand ab, die auf seiner Schulter lag, was ihm, da er deutlich größer war als sein Kamerad, nicht sonderlich schwer fallen konnte.
»Vergiss es endlich, Jean!«
»Du verfluchter Feigling!« Die Wut malte auf die Wangen des anderen Offiziers Flecken, deren Tönung fast dieselbe Farbe hatte wie die Ärmelaufschläge seines Kameraden. Seine Stimme war heiser. »Spuck's wenigstens aus, dass du nicht willst! Meinst du, ich merke nicht, wie du dich seit gestern schon vor mir verkriechst? Du hattest nie vor, mir helfen, oder?«
»Ich würde, wenn ich könnte!«, zischte der Offizier mit dem Zopf. »Mich hier abzupassen, wenn ich für Bonaparte auf Botengang bin, wird jedenfalls zu nichts führen!«
Nun horchte selbst Louise' Mutter auf. Sie hatte von dem Gespräch bisher sicher weniger verstanden als ihre Tochter – und vor allem hatte sie, wohlerzogene Dame, die sie war, sicher darauf verzichtet, für die unverständlichen Kraftausdrücke des Patois eine französische Entsprechung zu suchen. Aber der Name des Ersten Konsuls war einfach genug herauszuhören.
»Versteck dich nur hinter Bonaparte!«, höhnte der Kleinere. »Der General ist auf meiner Seite, dass du es weißt, du Scheißkerl!«
Was die Bedeutung des letzten Worts anging, war Louise sich nicht sicher. Aber eine Freundlichkeit war es gewiss nicht gewesen. Der Offizier in der grünen Uniform fuhr wutentbrannt wieder zu seinem Gegner herum und erblickte dabei die kleine Gruppe der Damen, die mittlerweile unmittelbar vor den zerstrittenen Herren angehalten hatte. Verlegen, ja, beinahe erschrocken tat er einen Schritt zur Seite.
»Verzeihen Sie, meine Damen«, sagte er, jetzt in einwandfreiem Französisch. »General, ich glaube, wir versperren den Damen den Weg.«
Der Herr in Blau, der Louise' Einschätzung nach allerhöchstens dreißig Jahre alt sein und so trefflich auf gascognisch fluchen konnte, war also sogar General?
Louise hätte es zwar nicht zu sagen gewusst, aber sie nahm an, sowohl die Manieren des Offizierskorps wie das Eintrittsalter für manche Dienstgrade seien zu Zeiten der Königsherrschaft noch andere gewesen.
Der Angeredete warf einen Blick über die Schulter, musterte die Damenschar vom Kopf bis zu den Füßen und wendete sich, ohne auch nur zu grüßen, wieder seinem Kameraden zu. »Erst versteckst du dich hinter Bonaparte, dann hinter den Röcken irgendwelcher aufgetakelten Schnepfen, um dich um eine Antwort zu drücken? Du bist der größte Feigling, den ich kenne, Bessières!«
Die Hand des anderen fuhr in Richtung seines Degens.
»Wenn du nicht mein Freund wärst, Jean, müsste ich dich dafür vor die Klinge fordern!«
»Sicher!«, lautete die höhnische Antwort. »Was für ein Glück für dich, dass Bonaparte Duelle verboten hat. Wie stünde sein vorbildhafter Liebling Bessières denn da, würde er dagegen verstoßen? Und was würde erst das brave Bübchen von dir denken? Rutsch mir den Buckel 'runter, Jean-Baptiste! Ich hab' dich gut verstanden. Du hältst zu Murat. Hätte ich mir denken können; für euch Kavalleristen ist doch niemand ein ganzer Mensch, wenn er nicht auf einem Gaul sitzt!« Er sagte noch etwas in seiner Mundart, das Louise beim besten Willen nicht verstand und bei dem selbst Bessières der Mund offen stehen blieb.
»Jean, hier sind Damen!«, rief er entsetzt.
Ein weiterer Blick aus funkelnden dunklen Augen glitt über die Schulter, von Madame de Guéhéneuc zu Louise und weiter zu den Kusinen, die sich ängstlich im Hintergrund hielten. Er hätte kaum verächtlicher sein können. »Damen! Denken kann ich's mir, von welcher Sorte! Und ich sag's dir, ich hab' es nicht nötig, mich bei den hohen Herrschaften einzuschmeicheln, die jetzt wieder aus allen Ecken hervor kriechen und sich zu gut sind für Unsereins! Ich nicht! Aber mach du dich ruhig zum Affen, mach einen schönen Bückling, verleugne deinen Vater und tu, als wärst du nicht der Sohn eines Baders aus Cahors! Ich werde dich nicht hindern, anderen den Arsch zu küssen, Jean-Baptiste!«
Der letzten Satz gab er, wie um sicherzugehen, auch ja von allem Zuhörern verstanden zu werden, in seinem vermutlich besten Französisch von sich, wendete sich dann ab und stampfte, beide Hände zu Fäusten geballt, über die Straße. Der Kutscher eines heran ratternden Wagens zügelte erschrocken seine Pferde.
Der in Grün gewandete Offizier blieb zurück und musterte betreten Louise' Mutter, sichtlich in höchster Verlegenheit, wie er sich verhalten sollte. Schließlich nahm er den Hut ab und verneigte sich demütig.
»Bitte, verzeihen Sie meinem Kameraden seine Worte, meine Damen. Er sprach in höchster Erregtheit und äußerst unbedacht. Ich kann mich Ihnen nur zu Füßen legen und Sie vielmals in seinem Namen und in dem der konsularen Garde um Vergebung anflehen.«
Man musste zugeben, verglichen mit dem zweiten Offizier sprach dieser Mensch in durchaus gefälligem Ton. Als er sich wieder aufrichtete und Madame de Guéhéneuc anzublicken wagte, klemmte er den Hut nach höfischer Sitte unter den Arm. Louise konnte das unmerkliche, beifällige Nicken, mit dem ihre Mutter diese Geste wahrnahm, beinahe sehen. Dennoch blieb ihr Tonfall kühl.
»Sie dienen demnach bei der Garde, Bürger?«
Wieder verbeugte sich der Offizier. »Jean-Baptiste Bessières«, stellte er sich vor, »chef-de-brigade der berittenen Garde der Konsuln. Ich bedauere zutiefst, dass mein Kamerad und ich Sie auf Ihrem Weg aufgehalten zu haben, meine Damen. Auch wenn dieses unangenehme Vorkommnis mir die Freude dieser Begegnung verschafft hat.«
Das war in der Tat gefällig, und es sprudelte so zügig zwischen den schmalen Lippen des Sprechers hervor, als habe er diese Sätze wirklich ausgiebig einstudiert. Seine momentane Verlegenheit schien bereits wieder verflogen oder hatte sich zumindest hinter einen Schirm vorsichtiger Zurückhaltung begeben, hinter dem hervor Bessières die Damen (insbesondere Louise und ihre Kusinen) verstohlen, aber interessiert und fachkundig musterte. In diesem Blick lag etwas eigentümlich Verwirrendes, aber es dauerte lange, ehe Louise die Ursache begriff: Der Offizier schielte kaum merklich auf einem Auge. Ansonsten jedoch schien er zumindest in Haltung und Kleidung durchaus dem Muster eines Offiziers zu entsprechen.
Madame de Guéhéneuc allerdings war nicht leicht zu beeindrucken.
»Und Ihr Freund gehört ebenfalls dieser Truppe an?«, erkundigte sie sich ungnädig. Bessières nahm den Tonfall zum Anlass, erneut eine zerknirschte Miene aufzusetzen.
»Divisionsgeneral Jean Lannes gehört zur regulären Infanterie«, sagte er, in einem Ton, als müsse das als Erklärung und Entschuldigung ausreichen. »Er ist, seiner Art ungeachtet, einer unserer fähigsten und begabtesten Generäle.«
»Ein General?« Louise' Mutter hatte eine unnachahmliche Art, kaum merklich die Brauen in die Höhe zu ziehen und eine Art Verwunderung in ihre Stimme zu legen, die den armen Bessières, der Louise allmählich wirklich leidtat, zu einer dritten unterwürfigen Verbeugung zwang.
»Ich kann Sie nur noch einmal bitten, Madame, Gnade vor Recht ergehen zu lassen. Mein Kamerad hat eine große Enttäuschung erlitten, wie ich fürchte. Er wusste in seinem Schmerz gewiss nicht, was er sagte. Ich darf Ihnen versichern, Madame, General Lannes ist, trotz seiner manchmal rauen Umgangsformen, ein großartiger Soldat und in der Armee ebenso wie im Stab des Ersten Konsuls ausgesprochen beliebt. Deswegen hatte ich auch nicht vor, diesen Vorfall offiziell zu melden, doch falls Madame darauf besteht, würde ich es selbstverständlich tun. Andernfalls stehe ich Ihnen für jede Satisfaktion, die Sie verlangen, zur Verfügung, um diesen Flecken auf der Ehre der Armee fortzuwaschen.«
Madame de Guéhéneuc tat, als müsse sie darüber nachdenken, dann nickte sie. »Ich danke Ihnen. Sie sind sehr höflich. Es ist nicht unsere Absicht, Ihren Freund etwa in Schwierigkeiten zu bringen. Betrachten wir die Worte des Herrn als nicht gesprochen. Adieu, Monsieur.«
Bessières trat einen Schritt zur Seite, um sie passieren zu lassen, doch als er sah, wie Madame de Guéhéneuc abbog und sich zum Haus von Onkel Frédéric wendete, eilte er ihr hastig hinterher.
»Verzeihen Sie, wenn ich noch einmal wage, mich an Sie zu wenden, aber hatte ich etwa die Ehre, mit Madame de Guéhéneuc zu sprechen?«
»Ich bin Madame de Guéhéneuc«, gab Louise' Mutter in sanftem Erstaunen zurück.
»So muss ich General Lannes, trotz der gewaltigen Verlegenheit, in die er mich brachte, von Herzen dankbar sein. Dadurch, dass er mich vor Ihrem Haus aufhielt, versetzt er mich nunin die Lage, jene Botschaft, die zu überbringen man mich beauftragt hat, persönlich auszurichten, nachdem ich bereits die Ehre hatte, sie einstweilen Ihrem Gemahl zu übermitteln.«
»Sie haben eine Botschaft? Für mich?«
»Eine Einladung«, präzisierte Bessières. »Von Madame Bonaparte für den kommenden Decadi1, in ihr Landhaus Malmaison. Ich habe mir erlaubt, das Schreiben Madame Bonapartes einstweilen ebenfalls Monsieur de Guéhéneuc auszuhändigen; die Einladung erstreckt sich selbstverständlich auch auf ihn.«
»Madame Bonaparte erweist uns eine große Ehre«, sagte Louise' Mutter, nun deutlich freundlicher.
»Im Gegenteil, Madame, sie betrachtet es als hohe Ehre. Sie lässt Ihnen durch mich ausrichten, sie habe Ihr Schreiben mit Interesse gelesen und nehme großen Anteil am Schicksal Ihrer Familie. Sie wäre entzückt, könnten Sie es möglich machen, zu kommen, und bittet Sie, den unverbindlichen Rahmen, in dem diese Begegnung stattfindet, nicht für mangelnden Respekt zu halten. Sie müssen wissen«, fügte er hinzu, »das Landhaus von Malmaison, das eine Wegstrecke außerhalb von Paris liegt, beim Dorf Rueil, ist der private Rückzugsort der Familie des Ersten Konsuls. Madame Bonaparte und ihre Tochter verbringen zuweilen eine ganze Dekade dort, doch der Konsul selbst meist nur die Wochenenden. Die Empfänge, die Madame Bonaparte dort gibt, sind ausgesprochen charmant und eine gute Gelegenheit, neue Bekanntschaften zu knüpfen und alte zu pflegen. Möglicherweise eine bessere Gelegenheit als die offiziellen Empfänge in den Tuilerien.«
»Ich verstehe«, nickte Louise' Mutter. »Bitte überbringen Sie Madame Bonaparte meinen aufrichtigen Dank für die freundliche Einladung. Es wird uns eine hohe Ehre sein, ihr Folge zu leisten.«
»Madame Bonaparte wird überglücklich sein«, wiederholte der Offizier, »wenn ihr Vergnügen auch kaum so groß sein kann wie das meine darüber, dass ich so bald die Ehre haben werde, die Damen wiederzusehen. Ich hoffe, Sie werden mir in Malmaison Gelegenheit geben, für die Unhöflichkeit, die Ihnen widerfuhr, Buße zu tun und Ihnen zu beweisen, dass nicht alle Offiziere über derart ruppige Manieren verfügen wie unser unglücklicher General Lannes.«
Offenbar gehörte Monsieur Bessières demnach ebenfalls zu den Gästen dieser »unverbindlichen« Wochenend-Empfänge. Das beantwortete zumindest teilweise eine Frage, die Louise sich heimlich bereits gestellt hatte, weshalb nämlich ein Offizier der Garde, der doch zu den Gefolgsleuten von Monsieur Bonaparte zählen sollte, dem Anschein nach Dienstbotengänge übernahm im Auftrag von Madame. Es sah nicht aus, als fühle sich der Offizier der Garde dadurch in seinem Selbstgefühl gekränkt. Entweder war er ein sehr umgänglicher Charakter, oder solche Aufträge kamen häufiger vor.
Madame de Guéhéneuc sah sich verpflichtet, sich von dem Offizier sehr viel freundlicher zu verabschieden, als sie ihn empfangen hatte. Bessières erwiderte die Abschiedsgrüße in gut gespielter Demut und musterte, während er die Damen nun endlich an sich vorüber flanieren ließ ins Haus, noch einmal interessiert vor allem Louise sowie Madeleine und Claire, die beiden ältesten ihrer Kusinen.
Das nicht eingeplante Gespräch vor der Eingangstür beraubte leider Louise' Vater der Freude, seine Damen mit der Einladung überraschen zu können.
»Bemüh dich nicht, lieber François«, wehrte Madame de Guéhéneuc ab, als ihr Gemahl händereibend und mit strahlendem Gesicht im Salon auf sie zu kam. »Wir sind bereits ins Bild gesetzt. Wir hatten praktisch auf den Stufen zum Haus noch das zweifelhafte Vergnügen, deinen Besucher kennenzulernen.« Sie nickte Onkel Frédéric zu, der es sich auf dem Sofa bequem gemacht hatte und seine Töchter unwillig aus dem Zimmer winkte, ehe sie ihn mit ihren Einkäufen traktieren konnten.
»Grundgütiger!« Louise' Vater legte, wenn auch deutlich spöttisch, mit einer Geste des Erschreckens die Hand auf die Brust. »Meine Liebe, hatte dieser arme Offizier etwa das Unglück, vor deinen Augen keine Gnade zu finden?« Onkel Frédéric, in Erwartung einer launigen Erzählung, lachte leise in sich hinein und schlug ein Bein über das andere.
Madame de Guéhéneuc dankte der Bediensteten, die ihr Hut und Muff abnahm, und ließ sich auf den Sessel sinken, den ihr Mann ihr dienstfertig zurecht rückte. Auch ihr Seufzen hatte eine komische Klangfärbung. »Nun, man muss zugeben, er hat sich zweifellos bemüht. Es hätte schlimmer sein können.«
»Von einem Baderssohn aus Cahors«, konnte Louise sich nicht enthalten hinzuzufügen. Es trug ihr einen strafenden Blick ihrer Mutter ein, den sie mit einem gehorsamen Senken des Kopfs als gerechtfertigt akzeptierte. Die Bemerkung war ohne Zweifel vorlaut gewesen. Und als wirkliche Dame hätte Louise natürlich vorgeben müssen, sie hätte das gascognische Streitgespräch der beiden Offiziere nicht verstanden. Aber dafür hatte sie sich, so gerne sie sonst ihrer Mutter gehorchte, zu gut dabei amüsiert.
»Was man leider nicht von dem zweiten Offizier behaupten kann, dem wir draußen begegneten«, fuhr Madame de Guéhéneuc fort. »Und euren verständnislosen Mienen entnehme ich, dass dieser General Lannes nicht gemeinsam mit seinem Kameraden hier war. Glaub' mir, lieber François, wäre er es gewesen, würdest du dich daran erinnern.«
»Ihr Ärmsten!« Louise' Vater lehnte sich mit dem Ellenbogen aufs Fenstersims und musterte seine Gemahlin amüsiert. »Bei uns war nur ein gewisser Bessières, um eine Einladung Madame Bonapartes zu überbringen. Welche Schandtat hat dieser unbekannte General denn begangen?«
Madame de Guéhéneuc gab eine kurze, äußerst launige Zusammenfassung des Streitgesprächs, dessen Zeuginnen die Damen geworden waren, und Louise half gelegentlich bei einigen Passagen des Gascognischen, die sich dem Verständnis ihrer Mutter entzogen hatten. Die Herren lauschten mit regem Interesse, und Monsieur de Guéhéneuc kommentierte mit einem Augenzwinkern, an seinen Schwager gewendet:
»Du siehst, mein lieber Frédéric, wie notwendig es ist, in gesellschaftlichen Fragen stets die Meinung von Damen einzuholen. Ohne den Rat deiner Schwester wäre ich womöglich auf den Gedanken verfallen, diesen Bessières für einen überraschend angenehmen Zeitgenossen zu halten und mich darüber zu freuen, wie höflich doch der Umgangston in unserer glorreichen Revolutionsarmee geworden ist!«
»Ich gestehe ihm zu, er hat sich für seinen General ausgiebig entschuldigt«, sagte Louise' Mutter gnädig. »Er schien sich ernsthaft um einen höflichen Tonfall zu bemühen. Wie völlig unpassend es war, eine Dame quasi auf der Türschwelle mit diesem Versuch zu überfallen, das scheint er freilich nicht bemerkt zu haben.«
»Sieh es ihm nach, meine Liebe«, lächelte ihr Mann. »Er war auch uns gegenüber sehr höflich. Nicht wahr, Frédéric? Er war sogar so galant, vorzugeben, er würde sich an meinen Namen erinnern, obwohl das schwer vorstellbar ist. Offenbar«, fügte er lächelnd hinzu, »diente unser junger Freund aus Cahors eine Weile in der Garde constitutionelle des Königs.«
»Die den König schlecht genug beschützt hat«, sagte Madame de Guéhéneuc.
»Das war ihr auch schwer möglich, da die Revolutionsregierung sie nach kaum ein paar Monaten wieder auflöste.«
Louise' Mutter winkte ab. »Sei dem, wie es sei. Der heutige Tag dürfte uns das gesamte Spektrum der Charaktere vor Augen geführt haben, mit denen wie es von nun an zu tun haben werden.«
»Zweifellos zwei interessante Bekanntschaften«, lachte auch Onkel Frédéric. »Ich bin jetzt schon gespannt, was für Neuigkeiten ihr aus Malmaison mitbringen werdet. Sicher werdet ihr bald dort ein und aus gehen und könnt euren armen Verwandten ebenfalls Zutritt dort verschaffen. Ich zähle auf euch. Immerhin werde auch ich in absehbarer Zeit etliche Töchter zu verheiraten haben. Ein ansehnlicher junger Offizier mit guten Beziehungen zum Ersten Konsul käme mir als Schwiegersohn nicht ungelegen.« Er musterte Louise und schmunzelte. »Und, junge Dame? Welchen Eindruck hat der junge Monsieur Bessières auf dich gemacht?«
»Denselben wie auf Mama«, sagte Louise sittsam. »Er sprach angenehm und hat große Anstrengungen unternommen, eine ordentliche Erziehung nachzuweisen.«
»Wenn sie nur nicht auf den Boden spucken und ihre schlammigen Stiefel auf die Polster legen«, sagte Monsieur de Guéhéneuc, »so will ich bei Soldaten schon zufrieden sein. Und gemeine Soldaten sind es nun einmal, auch wenn sie nun ins Offizierskorps aufsteigen durften. Dieser junge Mann schien immerhin begriffen zu haben, dass der Rang eines Offiziers auch zu einem gewissen Benehmen verpflichtet.«
»Und das ist mehr, als man von anderen seines Stands sagen kann«, ergänzte Madame de Guéhéneuc.
der letzte Tag der Zehn-Tage-Woche im Revolutionskalender
Kapitel 3
Der ersehnte Tag der Fahrt nach Rueil rückte mit erschreckender Geschwindigkeit näher, und mit ihr die wichtigste aller Fragen: Was sollte man anziehen? Da das Thema der korrekten Bekleidung, seitdem der Offizier Bonapartes das Haus Onkel Frédérics verlassen hatte, fortan zum Entsetzen der Herren vom Frühstück bis zum Abendessen sämtliche Gespräche bestimmte, sah selbst Louise sich gezwungen, ihm mehr Aufmerksamkeit zu widmen, als sie selbst für notwendig erachtet hätte.
Ganz offensichtlich war die Frage, welches Kleid sich für den Antrittsbesuch bei der ersten Dame von Frankreich eignete, noch weit komplizierter, als es selbst die diensteifrigen Angestellten der Stoff- und Putzgeschäfte darstellen konnten. Louise selbst besaß, wie ihre Mutter manchmal seufzend vermerkte, nur wenig von jenem typisch weiblichen Eifer, der Stunden darauf verwenden konnte, jene einzelne, sanft gelockte Strähne, die sich unweigerlich aus aufgesteckten Frisuren zu lösen und malerisch den Nacken zu umschmeicheln hatte, in perfekte Korrelation zu Dekolleté, Haarschmuck, aufgelegtem Rouge und gewähltem Parfum zu setzen. Louise' Ansprüche an das Kleid, das sie am Decadi tragen wollte, waren entsprechend gering. Es sollte angesichts der Temperaturen eines Dezembertags nicht zu viel von Schultern, Brust und Oberarmen enthüllen, aus hochwertigem Stoff sein, der das Portemonnaie ihres Vaters trotzdem nicht ruinierte, und den zudringlichen Blicken, denen man in einem Milieu von ungehobelten Soldaten als junge Dame möglicherweise ausgesetzt wäre, nicht gar zu viel zu entdecken geben.
Louise war auf der Suche nach einem Ehemann, nicht nach dem Vater für ein lediges Kind. Angesichts der gewagten Vorschläge, die man ihr in einigen Läden machte (»Aber die Citoyenne hat eine so wunderbare Figur – nein, unmöglich, Bürgerin, Sie können sich doch nicht unter so viel Tuch verstecken – sehen Sie nur diesen Stoff! Hauchdünn, leicht wie eine Feder – umschmeichelt jede Kontur, während doch alle Schönheit vor dem Auge des Bewunderers offenliegt…«), war Louise beinahe versucht, diese unhöfliche Antwort sogar laut zu geben.
Am Ende stand ein Kompromiss, der gleichermaßen das Modebewusstsein der Pariser Gewandschneider wie das Schamgefühl ihrer Kundin befriedigte. Versehen mit überschwänglichen Komplimenten für ihren exzellenten Geschmack und ihre stille Eleganz sah Louise sich wieder in die Welt und, als das Ende der revolutionären Zehntageswoche herangerückt war, in Gesellschaft ihres Vaters und ihrer Mutter nach Rueil entlassen. Nach einem frühen Mittagsimbiss brachen sie auf; Monsieur de Guéhéneuc hatte, sobald er den Anlass des Ausflugs erwähnte, ohne Schwierigkeiten bei einem Wagenverleih eine besonders schöne Kutsche und ein hübsches Gespann aus zwei Füchsen auftreiben können, das brav durch die Vorstädte hinaus in den sonnigen, aber eisig-kalten Dezembertag trabte.
Für eine Fahrt zum Ersten Konsul, erklärte der Vermieter, sei in jedem Fall das Beste gerade gut genug.
Das Dorf Rueil wäre wenig eindrucksvoll gewesen (einige Bauernhöfe, die sich einst sicher im Kreis um eine düstere gotische Kirche geschart hatten) ohne die vielen romantischen Wochenendhäuser, die vermögende Pariser Bürger in dieser angenehmen Entfernung von der Stadt hatten anlegen lassen. Allerdings fehlte dem Ort, vielleicht aufgrund dieses Einflusses, nach Louise' Ansicht ein wenig der rustikale Charme, der den Reiz eines in größerer Unabhängigkeit gewachsenen Landstädtchens ausmachte. In besseren Tagen hatte der berühmte Kardinal Richelieu dem Kirchenbau des Orts eine prunkvolle Fassade verabreichen lassen, in deren Fensternischen nun lebensgroße Marmorengel auf die Besucher herabschauten, als wollten sie sicherstellen, dass die schmutzigen Bauern und Schafhirten, die einst das Dorf bevölkert haben mochten, nicht wiederkehrten. Man hatte die Wege verbreitert, um Platz für die Equipagen der Wochenendgäste zu machen, hatte Plätze gepflastert und kunstvolle Blumengebinde an die Kurbeln von Dorfbrunnen gewunden. Brunnen, aus denen vermutlich seit einem Jahrhundert niemand mehr Wasser geschöpft hatte. Schweinekoben waren abgerissen worden und hatten Ställen für Kutschpferde Platz gemacht, und was an Misthaufen noch zu existieren wagte, verbarg sich schamhaft hinter Hecken und Gesträuch und machte in der kalten Dezemberluft allenfalls durch aufsteigenden Dampf samt zugehörigen Gerüchen auf sich aufmerksam. Alle größeren Fenster und Hauseingänge schienen Richtung Paris zu blicken; es war, als lehne das ganze Dorf sich erwartungsvoll nach Osten.
Das Anwesen des Konsuls Bonaparte, das den traurigen Namen »Malmaison«, schlechtes Haus, trug, lag außerhalb des Orts, beinahe schon an der Seine, hinter deren Biegung sich der Ort Croissy ausbreitete. Louise konnte, als sie steifgefroren vor dem Eingangsportal von Malmaison aus der Kutsche kletterte, die Rauchsäulen dieses Nachbarorts in der Luft hängen sehen. Das Haus war nicht groß, kaum größer als das der Guéhéneucs in Dornes. Es roch nach dem Rauch, der aus den Kaminen quoll, nach Schnee, der in der Nacht wohl fallen würde, und nach dem Harz der Bäume, die man bei Einbruch des Winters im Forst gefällt hatte. Unter den Strahlen einer blassen Wintersonne, deren Schein sich silbern auf sichtbar neu gedeckte Dächer und frisch gestrichene Hauswände legte und selbst den Kies in der Auffahrt glitzern machte wie ein Bett aus Perlen, schien der Name des Anwesens schwer verständlich. Einzig eine seltsame Stille, die über dem Park und der Auffahrt lag und in der das Schnauben der Pferde und das Knirschen der Räder im Kies ebenso hallend verklang wie die Kommandos des Kutschers, fiel Louise auf und erweckte den Eindruck, das Haus sinniere über die Schatten einer bewegten Vergangenheit – oder vielleicht über die Nebelstreifen einer ungewissen Zukunft.
Der Eindruck verflog sofort, als Louise und ihre Eltern sich dem Haus näherten. Ein Bediensteter trat aus der Tür, noch ehe sie sie erreicht hatten, und fragte nach ihrem Begehr. Er trug weder Livree noch Perücke, verneigte sich jedoch so anmutig und stellte seine Erkundigungen mit so selbstverständlicher Unterwürfigkeit, dass Louise in ihm ohne Schwierigkeiten jemanden erkennen konnte, der sein Metier noch nach den strikten Regeln des Ancien Regime erlernt hatte. Angesichts der vielen billigen Kräfte, die man in diesen Tagen für kleines Geld anheuern konnte, fiel ein solch wohlerzogener Diener doppelt auf. Durch die nur angelehnte Tür flogen aus dem Inneren des Hauses Harfenklänge und leises Frauenlachen heran.
Monsieur de Guéhéneuc nannte seinen Namen und bat um die Ehre, zu Madame Bonaparte geführt zu werden. Der Diener wusste offenbar Bescheid, oder er erkannte in dem Besucher sofort einen Mann, der ebenso aus besseren Tagen übrig geblieben war wie er selbst. Jedenfalls verbeugte er sich erneut, sogar noch deutlich tiefer als beim ersten Mal, und bat die Gäste ohne Umstände herein in ein geräumiges Vestibül. Vier Säulen aus poliertem grauem Marmor trugen die weiß gestrichene Decke; die Wände waren mit demselben Material verkleidet. Aus zwei bogenförmigen Nischen fühlte Louise sich von den starren Augen lebensgroßer Statuen gemustert. Links und rechts gingen je zwei Türen ab; die gegenüberliegende Wand bestand beinahe nur aus mannshohen, bogenförmigen Fenstern, an deren Außenseite Eisblumen empor kletterten. Winterlich kahle, mit Schnee überzuckerte Gärten erstreckten sich über den gefrorenen Grund bis hinab an die Seine und verloren sich irgendwann im dichten Forst. Die Wärme von Kaminfeuern quoll gemeinsam mit der Harfenmusik kurz heraus in die Eingangshalle, als der Diener in einem Nebenraum verschwand, um die Gäste anzumelden.
Sie brauchten nicht lange zu warten. Mit einer weiteren wohlerzogenen Verbeugung kehrte der Bedienstete zurück und geleitete die Besucher durch eine Tür rechts in einen Raum, dessen beinahe einzige Möblierung ein Billardtisch war und in dem eine Bedienstete höflich und tief vor den Gästen knickste, sowie weiter in einen Salon, dessen prächtige Ausstattung Louise beinahe den Atem nahm.
Nur aus ihren frühesten Kindheitserinnerungen, wenn sie ihren Vater in Versailles hatte besuchen dürfen, kannte sie Ähnliches. Aber dies alles war neu, die Wände frisch getäfelt, das Gold der Zierleisten ohne Kratzer und Schrammen, die Gobelin-Bespannung des Mobiliars weder abgewetzt noch verblichen, die Verkleidung des Kamins noch ohne den leisesten Schatten von Ruß. Selbst die Gemälde an den Wänden schienen eigens für ihren bestimmten Platz gemalt und auf die Farbe der Tapete und die Form der Rahmen abgestimmt. Durch zwei wandhohe Fenster, die in den Hof hinaus wiesen, fielen, kaum gedämpft durch die hauchdünnen weißen Vorhänge, die Strahlen der Wintersonne und brachten all die Farben, die Frische, das Neue, in einer Weise zum Glänzen, die Louise beinahe in den Augen schmerzte.
Durch die offenstehenden Flügel der gegenüberliegenden Tür traten im selben Moment mehrere Damen, alle gleichermaßen schlank und elegant, alle mit ähnlichem Haarschmuck und in ähnlichen Gewändern aus hellen, fließenden Stoffen, sodass Louise' Vater, als er sich aus seiner ersten Verbeugung wieder aufrichtete, für einen Augenblick kaum zu wissen schien, an wen er sich für die Begrüßung wenden sollte.
Die Hausherrin nahm ihm die Wahl ab. »Monsieur de Guéhéneuc!«, sagte sie, langsam und mit ungewöhnlich dunkler, rauchiger Stimme, die jede Silbe zu dehnen und auszukosten schien. »Wie freut es mich, dass Sie meiner Einladung folgen konnten!« Sie sprach mit einem seltsam fragenden Unterton, als sei sie sich nie sicher, die richtigen Wörter zu verwenden, und richtete ihr Lächeln gleichermaßen auf Louise' Vater und Louise' Mutter, nachdem sie eine Winzigkeit davon, gemeinsam mit einem routinierten, taxierenden Blick, Louise zugeworfen hatte.
Man musste genau hinsehen, um zu erkennen, dass Madame Josephine Bonaparte in der Tat um einige Jahre älter war als ihre Begleiterinnen. Um wie viele, konnte Louise beim besten Willen nicht einschätzen – die Maske aus exzellent aufgetragener und abgepuderter Schminke, auf den Wangen von Rouge überhaucht, war undurchdringlich. Madame Bonaparte hatte kastanienfarbenes Haar, das nach der Mode der Revolution im Nacken kurz gestutzt und an Stirn und Schläfen zu malerischen Locken gedreht war, die in der Tat nicht bezaubernder hätten fallen können. Gegen die fast weiße Haut stachen die Augen dunkler und exotischer ab, als sie waren; hinter den langen, schwarz getuschten Wimpern verbargen sich Pupillen von sanftem Braun.
Louise' Vater dankte verbindlich für die Einladung und stellte Frau und Tochter vor. Er achtete sehr darauf, die revolutionären Anreden »Citoyen« und »Citoyenne«, also »Bürger« und »Bürgerin« zu verwenden, aber die Gattin des neuen Oberhaupts der Republik ging darüber mit ihrem sanften Lächeln hinweg, als habe sie es nicht gehört.
»Madame de Guéhéneuc! Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie ergriffen ich war, als ich Ihren Brief las. Er hat mich zu Tränen gerührt! Bitte glauben Sie mir, dass ich Ihren Kummer ohne Einschränkung teile und alles für Sie und Ihre Lieben tun werde, was in meiner Macht steht. Und Mademoiselle!« Die Reihe war an Louise. »Nein, wie entzückend Sie sind! Herzallerliebst! Madame, Sie müssen sehr stolz auf dieses Kind sein. Ich bin bezaubert, Sie hier zu haben! Bitte, erlauben Sie mir, Ihnen meine Tochter, meine Schwägerinnen und ihre Freundinnen vorzustellen ...«
Die restliche Schar hell gekleideter Figuren, die bisher auf der Schwelle unruhig von einem Bein aufs andere getreten waren, flutete in den Salon. Es waren nicht weniger als sechs junge Damen unterschiedlichen Alters, die Madame Bonaparte vorzustellen hatte, und so ähnlich sie auf den ersten Blick wirkten, so wenig hatten sie in Ausdruck und Benehmen gemeinsam.
»Meine Tochter Hortense.« Ein dunkelblondes, sehr schlankes Mädchen, dem Anschein nach ein wenig jünger als Louise, vielleicht siebzehn, versank stumm in einen anmutigen Knicks – leichtfüßiger und anmutiger, als Louise je einen gesehen hatte. Natürlich hatten die Guéhéneucs sich vor dem Besuch über die Familie des Ersten Konsuls informiert, und so wusste Louise, dass der Familienname dieser jungen Dame »de Beauharnais« lautete und ihr Vater, der erste Gemahl der jetzigen Madame Bonaparte, ein Vicomte des Ancien Régime gewesen war, den man, obwohl er die Revolution unterstützte, auf der Guillotine hingerichtet hatte.
Hortense hatte eine ähnliche Frisur wie ihre Mutter, die jedoch an ihrem schmalen, langen Gesicht ganz anders wirkte. Sonderlich schön war sie nicht, befand Louise; Kinn und Stirn waren fliehend und zu schmal, verglichen mit den breiten Wangen. In Summe hatte ihr Gesicht ein wenig von dem eines Pferdes. An äußeren Vorzügen besaß sie allerdings die gleichen vollen Wimpern und schön geschwungenen Augen wie ihre Mutter – nur waren die ihren von einem ins Grüne spielenden Blau – und eine Figur, um die manche der Nymphen auf den Gemälden ringsum sie sicher beneideten. Ihre Bewegungen waren weich und fließend wie die einer Tänzerin. Sie sagte mit anmutig gesenktem Blick und höflichem Ton einige Begrüßungsworte.
»Meine Schwägerinnen, Madame Pauline Leclerc und Mademoiselle Caroline Bonaparte.«
Zwei weitere junge Damen knicksten, allerdings mit deutlich weniger Anmut. Wobei auch Louise sich gegenüber der gazellenartigen Hortense wie ein Tollpatsch fühlte. Die ältere der beiden, Madame Leclerc, warf der Tochter des Hauses denn auch einen Blick voll mühsam unterdrückter Gehässigkeit zu. Sie hätte Neid kaum nötig gehabt; von allen anwesenden jungen Damen war sie zweifellos die schönste. Mit ihrem ebenmäßigen Gesicht, dunklen Locken und festen Brüsten, leuchtenden Katzenaugen und einem Lächeln strahlend weißer Zähne, das gelegentlich aus ihrem Schmollmündchen aufblitzte, hätte sie für jedes Gemälde einer Venus posieren können. Leider schien sie sich ihrer Wirkung zu bewusst zu sein, dem verführerischen Augenaufschlag nach zu urteilen, den sie, ohne bestimmte Absicht, geradezu im Reflex, Monsieur de Guéhéneuc widmete. Madame Pauline Leclerc trug ihre Schönheit vor sich her wie ein Banner.
Und gütiger Himmel! Bei der Tiefe dieses Dekolletees hätte Louise an der Stelle von Madame Leclerc nicht mehr zu atmen gewagt aus Angst, mehr von sich preiszugeben, als unter zivilisierten Menschen üblich war. Allerdings war, bei genauerem Hinsehen, der Stoff des Gewands so dünn, dass sich ohnehin alles darunter abzeichnete, was Herren an bestimmten Stellen interessant finden mochten – halb versteckt, halb noch betont durch die enganliegende Umhüllung aus hautfarbenem Tricot-Stoff. Ganz offensichtlich teilte Madame Leclerc nicht Louise' Abneigung gegen durchsichtigen Musselin.
Ihre Schwester Caroline war ebenso dunkelhaarig wie Pauline, aber deutlich jünger, fast noch ein Kind, wenn auch von sehr fraulichen Formen. Louise schätzte sie auf siebzehn oder achtzehn. Gesicht und Figur waren rundlicher als bei ihrer Schwester, ihre Blicke aufgeweckter und forscher. Sie musterte die Besucher der Reihe nach, besonders Louise, als überlege sie, was sich mit diesen neuen Spielzeugen wohl anstellen ließe.
Die letzten drei jungen Damen waren ebenfalls Gäste in Malmaison, erläuterte Madame Bonaparte, und zwar Schulkameradinnen von Hortense und Caroline, die alle zusammen das weithin gerühmte Mädchenpensionat von Madame Campan besuchten. Zwei von ihnen, die Desmoiselles Aglaé und Adélaide Auguié, waren Nichten von Madame Campan. Bei der dritten, Aimée Leclerc, handelte es sich um die jüngere Schwester von Paulines Ehemann, einem Divisionsgeneral im Dienst Napoleon Bonapartes, die ihren Bruder und ihre Schwägerin heute nach Malmaison begleitet hatte.
Nach diesen Vorstellungen durfte man sich endlich setzen, und es entstand ein kleines Gerangel um die wenigen Stühle, die rund um den vergoldeten Intarsientisch gruppiert waren. Den Gästen und der Hausherrin musste man höflicherweise Plätze überlassen, die schöne Pauline sicherte sich ebenfalls einen, und die übrigen jungen Damen verzichteten darauf, sich auf einem der zusätzlichen Stühle niederzulassen, die man an der Wand entlang aufgestellt hatte, sondern begaben sich an eins der Fenster und bemühten sich, im winterlichen Licht möglichst hübsche Silhouetten abzugeben.
Louise ihrerseits wagte kaum, sich auf den feinen Gobelins niederzulassen, mit denen die Stühle bezogen waren. Die Stickereien mussten ein Vermögen gekostet haben.
Nachdem die üblichen einleitenden Floskeln über beschwerliche Straßen und eisiges Wetter gewechselt waren, ließ Madame Bonaparte ein leises Seufzen hören.
»Völlig unabhängig von der Freude, die Sie mir in jedem Fall mit Ihrem Kommen gemacht hätten, bin ich gerade heute sehr erleichtert, dass Sie sich bereitfinden, mir ein wenig über meine Einsamkeit hinweg zu helfen.« Offenbar empfand die Dame des Hauses ihren Salon nicht als überfüllt genug, wenn sie sich inmitten ihrer Gäste noch einsam fühlen konnte. »Wie Sie sehen, hat mein guter Bonaparte noch nicht zu uns gefunden. Um genau zu sein, er hat sich mit einigen Herren in den anderen Flügel des Hauses zurückgezogen, um zu arbeiten, und uns Unglückliche hat man hier im Salon abgesetzt, wo wir, wie das die Pflicht der Frauen ist, auf das Erscheinen unserer glorreichen Helden warten müssen. Ich hoffe, Monsieur de Guéhéneuc, Sie werden sich in einer rein weiblichen Gesellschaft nicht zu sehr langweilen. Spätestens zum Tee werde ich Bonaparte rufen lassen. Ich tue das sonst nie, doch ich möchte auf keinen Fall, dass er es versäumt, solch interessante Bekanntschaften zu machen.« Noch weniger wollte sie gewiss, dass unbemerkt bliebe, wie sehr sie sich für ihre Besucher einsetzte. Sie winkte einer Bediensteten, die wortlos knickste und verschwand, sicher, um Erfrischungen zu bringen.
Louise' Vater erklärte, er könne sich nichts Schöneres vorstellen, als einen Nachmittag umgeben von so viel Freundlichkeit und Anmut zu verbringen, und Madame Bonaparte lächelte Louise' Mutter an. Sie öffnete die Lippen dabei nicht, und auch beim Sprechen nicht mehr als notwendig. Schlechte Zähne, vermutete Louise und war sicher, dass ihre Mutter gerade dasselbe dachte.
»Ihr Gatte ist so gütig, Madame. Aber dennoch, für einen Herrn muss es sehr ermüdend sein, wenn Damen sich über neue Moden und alte Zeiten unterhalten. Dabei fällt mir ein … sagen Sie, Pauline, wo steckt denn Ihr Bruder Jérôme?«
»Na hier«, kam es aus dem Nebenzimmer, ehe die schöne Pauline nachdenklich die Stirn runzeln und etwas darauf erwidern hätte können. Ein schmaler, dunkellockiger Junge in Uniform stolzierte zwischen den noch immer offenstehenden Flügeltüren hindurch über die Schwelle. Er genoss seinen Auftritt sichtlich. »Schämen Sie sich, liebe Schwägerin«, tadelte er lachend Madame Bonaparte, mit einer Stimme, die merklich mitten im Stimmbruch steckte. »Ich wollte nur einmal sehen, ob Sie mich vergessen würden, wenn ich Ihnen für den Moment aus den Augen käme. Und schon haben Sie mich vergessen!«
»Das haben wir nicht, Sie Schlingel!« Madame Bonaparte schüttelte liebevoll den Kopf und wendete sich wieder ihren Gästen zu. »Dieser Schelm hier ist der jüngste Bruder meines Gemahls, Jérôme Bonaparte, Leutnant der konsularen Garde. Der charmanteste von allen Brüdern Bonaparte, und das weiß er leider sehr genau. – Wirklich, Jérôme, es war wenig galant von Ihnen, sich im Musikzimmer zu verstecken, während wir Gäste haben. Der arme Monsieur de Guéhéneuc sitzt als einziger Herr unter lauter Damen.«
»Ist das nicht eher beneidenswert?«, entgegnete der Junge prompt, während er sich lässig einen Stuhl an den Tisch zog, und Louise' Vater beeilte sich, ihm zuzustimmen. Darüber entspann sich ein scherzhaftes Geplänkel, in dessen Verlauf die Bedienstete eine Schale mit kandierten Früchten und zu kleinen Figuren geformtem Marzipan herein brachte.
»Oh, Sie sind ein Engel!«, bedankte Madame Josephine sich überschwänglich bei der Dienerin, als hätte sie die Leckereien nicht selbst in Auftrag gegeben. Jérôme stibitzte derweil bereits das erste Stück Marzipan, ehe die Schale ganz auf dem Tisch stand.
Im selben Moment entstand bei den jungen Damen am Fenster merkliche Unruhe; sie schoben die Gardinen zurück, drängten sich kichernd gegen die Scheiben und blickten hinaus.
»Zwei Reiter sind in den Hof geritten«, meldete Caroline aufgeregt, und Hortense, die sogar kurz hinaus gewinkt hatte, fügte hinzu:
»Es sind Eugène und Bessières!«
»Endlich!«, nickte Aimée Leclerc, wenn auch mit leisem Spott. »Das sollten zwei Herren sein, die ihre Pflicht kennen und sich auch um uns Damen kümmern.«
»He!«, protestierte der junge Jérôme kauend. »Bin ich etwa niemand? Habe ich euch etwa nicht den ganzen Tag Gesellschaft geleistet?«
»Du bist mein Bruder«, entgegnete Caroline knapp. »Was will ich denn mit dir? Und meinen Murat hat Napoleon ja mit sich geschleift ins Beratungszimmer, wo er sich bestimmt einen dummen Vortrag nach dem anderen anhören muss. Ich wette, er wäre tausendmal lieber hier mit uns zusammen.«
»Das ist allerdings wahrscheinlich«, sagte Aimée Leclerc wieder, und wieder klang es spöttisch. Louise hatte dieser jungen Dame bisher kaum Beachtung geschenkt, zu beschäftigt damit, die vielen neuen Gesichter auseinanderzuhalten. Jetzt, bei genauerer Betrachtung, schien Aimée ihr beinahe die interessanteste von allen zu sein. Sie war weder sonderlich schön noch sonderlich hässlich und stand wohl im selben Alter wie Louise selbst. Ihr Hals war zu dick, wie sie überhaupt zur Fülle zu neigen schien, aber ihre Haut außerordentlich fein, und ihr dunkelblondes Haar dicht und glänzend. Sie wirkte zurückhaltend, aber auf eine Art, die eher Überlegenheit als Schüchternheit verriet. Ihre dunklen Augen unter dichten und zu breiten Brauen hatten einen klugen, forschenden Ausdruck, wie ihn Männer an Frauen meist wenig schätzten. Sie taxierte ihre Freundinnen gelegentlich mit sehr kühlen Blicken, wie ein Forscher ein Studienobjekt unter dem Vergrößerungsglas. Namentlich gegenüber ihrer Schwägerin Pauline benahm sie sich auffallend wortkarg.
Längere Überlegungen waren Louise nicht vergönnt, denn nun öffnete sich hinter ihr die Doppeltür zum Billardraum, und herein watschelte schwerfällig, ohne dass jemand ihn angekündigt hätte, lachend, mit ausgebreiteten Armen, als wolle er dem Nächstbesten oder der ganzen Welt um den Hals fallen, ein weiterer Junge in Uniform. »Maman!«, rief er schon von der Türschwelle, sah dann die unbekannten Gesichter in der Runde, ließ die Arme sinken und verneigte sich mit überraschender Eleganz und ohne jede Verlegenheit wegen seines stürmischen Auftritts. »Wir haben Gäste?«, erkundigte er sich, hörbar erfreut, mit der unverstellten Neugier eines Kinds.
Hinter ihm schob sich, lautlos und schmunzelnd, der hochgewachsene Schatten Bessières ins Zimmer und verneigte sich tief.
Madame Bonaparte streckte lächelnd die Hand aus, und der junge Mann, der wohl älter war, als er auf den ersten Blick wirkte, in Louise' Alter oder sogar etwas darüber, stapfte mit schaukelnden Schritten zu ihr und legte die seine hinein. Auch auf seinem grünen Uniformrock prangten Abzeichen, die darauf hindeuteten, dass er bereits einige Sprossen auf der militärischen Rangleiter erklommen hatte.
Louise fragte sich unwillkürlich, in welchem Alter man heutzutage eine Offizierslaufbahn begann. Der Neuankömmling konnte höchstens achtzehn oder neunzehn, Leutnant Jérôme Bonaparte dagegen kaum fünfzehn sein.
»Mein Sohn«, sagte Madame Bonaparte in unverkennbar mütterlichem Stolz. »Leutnant Eugène de Beauharnais. Chef-de-brigade Bessières kennen Sie ja bereits.«
Der Junge verneigte sich wirklich deutlich eleganter, als er ging. Er sah seiner Schwester Hortense wenig ähnlich, fand Louise, bis auf die lang bewimperten Augen. Sein Haar war von einem dunkleren Blond, dünn und kurzgeschnitten. Die schlechten Zähne schien er von der Mutter geerbt zu haben, allerdings machte er keinerlei Anstalten, sie zu verstecken, sondern begrüßte die Runde der Gäste mit breitem Lachen, so freudig, offen und ungekünstelt, dass man gewillt war, ihm alle schief sitzenden Zähne und bräunlichen Zahnstümpfe zu vergeben, die er dabei offenbarte. Vor Louise machte er eine extra tiefe Verbeugung.
»Schäm dich, Bessières!«, rief er dem älteren Offizier zu. »Du hast kein Wort gesagt, dass wir heute eine so bezaubernde junge Dame hier haben würden! Sonst hätte ich dich doch viel früher zum Aufbruch gedrängt.«
Bessières war auch heute frisiert und gekleidet wie bei ihrer ersten Begegnung, in einen grünen Uniformrock von sehr ähnlicher Form, aber prächtigerer Ausstattung wie der, den der junge Leutnant de Beauharnais trug. Er schien antworten zu wollen, kam aber nicht dazu, weil die jüngere der beiden Auguié-Schwestern, die etwa in Louise' Alter war, einen Schmollmund zog und eilig einwarf:
»Wie hässlich von Ihnen, Leutnant! So deutlich lassen Sie uns also wissen, dass wir Ihnen als Grund für einen Besuch nicht dringend genug erscheinen? Pfui!«
»Sehr unhöflich«, stimmte Hortense unverzüglich ein, und ihr Bruder lachte wieder, nickte Louise noch einmal zu und trat zum Fenster, wo er eine wortreiche, von viel Gelächter und weiblichem Gekicher unterbrochene Entschuldigung darüber begann, die Damen vernachlässigt zu haben. Bessières nutzte die Gelegenheit, näher an den Tisch zu treten, die Gäste in aller Form zu begrüßen und, an Madame Bonaparte gewendet, leise hinzuzufügen:
»Womöglich werden Sie bald die Genugtuung haben, Eugène mit einem neuen Dienstgrad vorzustellen, Madame. Ich habe seinen Namen gestern zur Beförderung eingereicht und bin sehr zuversichtlich, diese bewilligt zu sehen.«
Madame Bonaparte legte eine Hand auf ihr Herz und lächelte in die Runde, als seien die Guéhéneucs für diese freudige Nachricht verantwortlich.
»Haben Sie gehört? Oh, Sie müssen unbedingt öfter nach Malmaison kommen, wenn Ihr Besuch Vorzeichen für solch glückliche Ereignisse bedeutet! Ich danke Ihnen für die Nachricht, lieber Bessières. Weiß Eugène es schon?«
»Natürlich nicht«, schmunzelte Bessières. »Der gesamte Stab freut sich bereits darauf, wie ungläubig er strahlen wird, wenn der Erste Konsul ihn zum ersten Mal beiläufig als Capitaine Beauharnais anspricht.«
»Capitaine Beauharnais«, wiederholte Madame andächtig. »Und das mit neunzehn! Sein Vater wäre ja so stolz auf ihn!«
»Und der Erste Konsul ist es auch«, fügte Bessières hinzu. Währenddessen hatten Madame Pauline Leclerc und ihr jüngerer Bruder Jérôme einander Blicke zugeworfen.
»Wann werde ich befördert?«, nörgelte der Junge prompt.
»Aber Jérôme«, lächelte Madame Bonaparte. Jérôme trommelte ungeduldig mit den Fingern auf der Armlehne seines Sessels herum.
»Nein, ich will es wissen! Ich bin auch Leutnant, wieso wird Eugène befördert und ich nicht?«
»Sie sind doch erst vor einigen Wochen in die Garde eingetreten, Leutnant«, sagte Bessières – ein wenig kühl, schien Louise. »Eugène hat bereits den gesamten Ägyptenfeldzug mitgemacht und Ihnen drei Jahre Diensterfahrung voraus.«
»Na und?«, beschwerte sich Pauline. »Jérôme ist der Bruder des besten Generals von ganz Frankreich! Ein Bonaparte! Uns liegt der Kampf im Blut!«
Bessières deutete eine Verbeugung an. »Weswegen ich ganz sicher bin, dass Ihr Bruder eine glänzende Karriere vor sich hat, Madame Leclerc.«