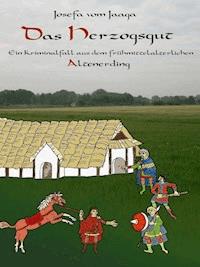Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Herbst 1805: Die französische Armee unter Führung Kaiser Napoleons befreit Bayern von österreichischer Besetzung und eilt dem Sieg von Austerlitz entgegen. Kurfürst Max Joseph und Kurfürstin Karoline können nach München zurückkehren und ihr Land zum Königreich ausrufen. Alles wäre wunderbar - würde Napoleon nicht darauf bestehen, Max Josephs Tochter Auguste mit Eugène Beauharnais, dem Sohn von Kaiserin Josephine, zu verheiraten. Die Fortsetzung der Geschichte über eine Wittelsbacher-Prinzessin, die inmitten politischer Zwänge und Intrigen aus Versehen glücklich wurde.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 524
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Covergestaltung: P. Grill unter Verwendung von Bildern folgender Fotografen/Grafiker:
Murloc Cra4ler
Clker-Free-Vector-Images
Buntysmum (diese 3 Bilder veröffentlicht unter Lizenz CC0 via Pixabay)
Marie-Lan Nguyen, veröffentlicht unter Lizenz CC BY 2.5 (nachzulesen unter:
https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/legalcode) auf Wikimedia Commons
(Anmerkung: Das Bild wurde nach eigenem Ermessen bearbeitet. Das Original der Fotografie ist einzusehen unter:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bicorne_hat_Ecole_Polytechnique.jpg)
Vielen Dank an alle Künstler!
Kapitelübersicht
Im ersten Band
Verbindlich verbündet
Max träumt von Straßburg
Damen unter sich
Pläne einer Prinzessin
Briefwechsel
Wenn man sich nicht um alles selbst kümmert …
Opferzeremonien
Vereiste Pfade
Tête-à-tête
Gesang und tote Hasen
Familienverhältnisse
Spätes Verlöbnis
Impressionen einer Hochzeit
Kontratanz
Wie Seine Majestät befiehlt
Statt eines Epilogs
Ausblick und Nachlese
Anhang
Im ersten Band …
… hatte sich der bayerische Kurfürst Max Joseph nach langem Zaudern entschlossen, ein Bündnis mit Frankreichs neuem Kaiser Napoleon Bonaparte einzugehen. Sehr zum Leidwesen seiner Gattin, Kurfürstin Karoline, und seiner Schwiegermutter, der Markgräfin Amalie von Baden. Beide Damen zürnten Napoleon wegen der Entführung und Erschießung des Herzogs von Enghien und hätten sehr viel lieber ein Bündnis mit Österreich gegen Frankreich gesehen – zumal eine weitere Tochter Amalies, eine Schwester Karolines, als Gemahlin des russischen Zaren auf der Seite der Kriegsgegner stand.
Dem Anschein nach hatte Max Joseph sich richtig entschieden. Bei Kriegsausbruch hatte er sich mit seinem Hof nach Würzburg abgesetzt. Napoleon gewann die ersten Auseinandersetzungen beinahe im Handstreich. Das von österreichischen Truppen besetzte Bayern wurde befreit; die Franzosen marschierten auf Wien. Aber abgesehen von den ehelichen Verstimmungen im kurfürstlichen Haus gab es noch eine weitere Komponente, die Max Joseph Sorgen machte: Napoleon Bonaparte bemühte sich seit geraumer Zeit, eine Ehe zwischen einem seiner Verwandten und einem der alten Fürstenhäuser Europas zustande zu bringen. Und er hatte dabei auch ein Auge auf Auguste geworfen, Max Josephs siebzehnjährige Tochter aus erster Ehe.
Auguste hatte sich mit Karl von Baden, dem jüngeren Bruder ihrer Stiefmutter Karoline verlobt, um einer solchen Ehe mit einem Gefolgsmann Napoleons zu entgehen, einer Ehe, die sie ebenso wie ihre gesamte Familie als Schande empfunden hätte, da der Bräutigam keinem alten Fürstenhaus entstammte und ihr somit in jedem Fall nicht ebenbürtig war.
So also war die Lage im Oktober 1805, als Napoleon mit seiner Garde sich München näherte.
1. Verbindlich verbündet
»Iatz geh' weida, Oide, d'Franzosen keman. Schick di hoid a bissl, da Nabolion kimmt! Und vergiß ned auf d'Trikolor'!«
»Wos vergiß i ned?«
»Den blau-rot-weißen Hadern, den wo's d' ma gestern g'naht hosd. Dass ma was zum Winga hab'n.«
»Du, Vater, i woaß fei ned, ob des a so recht is'. I hätt g'moant, des Weiße g'hört in d'Mitt 'nei und des Rote unt' hi …«
»Ah! So genau wead scho koaner schaug'n. Iatz geh weida, sunst is da 'Pole scho auf'm Stodtplatz und mia san oiwei no dahoam. - Wief Lampara! Wief Lampara!«
»Was schrein's denn da alle?«
»A so hoid. Des g'hört sie a so, wann a Kaiser kimmt!«
»Wead scho wieder so was Lateinisch' sei!«
»Iatz dua mid, Oide, der Nabolion kimmt ned oi Tag! Wief Lampara!«
Es waren Dialoge wie diese, die sich am Rand der Straßen entspannen, während die Garde des französischen Kaisers am sechsundzwanzigsten Oktober 1805 feierlich unter jubelnden Ausrufen von »Vive l'empéreur!« durch das Karlstor in München einmarschierte. Kaiser Napoleon selbst war schon am vierundzwanzigsten im Stadtgebiet angelangt. Er quartierte sich im selben Schloss Nymphenburg ein, das der bayerische Kurfürst Max Joseph mit seiner Familie einige Wochen zuvor so überstürzt verlassen hatte, und wartete. Als auch am sechsundzwanzigsten noch kein Kurfürst eingetroffen war, der kalte Herbstregen aber erstmals seit Wochen ein wenig nachließ, die kaiserlichen Strümpfe getrocknet waren und die Sonne hervorblitzte, nutzte Napoleon eilig die Gelegenheit, befahl seinem Großstallmeister Caulaincourt, den Sechsspänner vorfahren zu lassen, und hielt um halb acht Uhr abends inmitten seiner Truppen feierlichen Einzug in die Stadt. Die Münchner säumten die Straßen, winkten mit ihren selbstgenähten Trikoloren und schrien sich vor Begeisterung die Kehlen heiser. Es war bereits dunkel genug, damit die Hausbesitzer ihre Fassaden mit all jenen aus bunten Laternen zusammengesetzten Sinnbildern und lateinischen Sprüchen verzieren konnten, mit denen Herrscher sich überall von der Bevölkerung traktieren lassen müssen, wohin sie kommen. Napoleon hatte freilich nicht allzu viel Zeit, sie zu studieren; auf ihn wartete in diesem Krieg noch die Schlacht von Austerlitz. Zuvor musste er allerdings erst seinen Kavalleriegeneral wieder einfangen; Marschall Prinz Joachim Murat hatte sich bereits auf eigene Faust Richtung Wien aufgemacht, wohin sein kaiserlicher Schwager ihn noch gar nicht hatte schicken wollen.
Max Joseph befand sich zur selben Zeit samt Gemahlin und Kindern noch immer in Würzburg. Er ließ sich viel Zeit, seinen überreizten Magen auszukurieren, vielleicht in der Hoffnung, die Kurfürstin werde sich doch noch überzeugen lassen, gemeinsam mit ihm nach München zurückzukehren. Aber auch wenn Karoline sich inzwischen bereit fand, bei öffentlichen Auftritten zu erscheinen und dabei wenigstens insofern den Anschein zu wahren, als sie die Anwesenheit ihres Gemahls nicht mehr demonstrativ ignorierte – mehr an Zugeständnissen konnte Max Joseph ihr nicht abringen. Karoline schien tatsächlich nicht gewillt, ihrem Gemahl das Bündnis mit Napoleon jemals zu vergeben.
Der Kurfürst musste allein nach München fahren. Er reiste am sechsundzwanzigsten ab. Es war ein Samstagabend; die Glocken der Würzburger Bischofskirchen läuteten von fern den Sonntag ein.
»Nun ist es geschehen, mein lieber Montgelas«, sagte Max Joseph traurig zu seinem Außenminister, als er neben ihm am Tor der alten Bischofsresidenz auf das Vorfahren der Reisekutsche wartete. »Ich habe mein persönliches Glück geopfert für das meines Landes. Bayern ist gerettet, aber meine Ehe ist zerstört.« Er warf einen sehnsuchtsvollen Blick über die Schulter zurück zur Eingangstreppe, auf der jedoch keine Kurfürstin erschien, um ihn zu verabschieden.
Karoline stand am Fenster ihres Boudoirs, um die Herren beim Einsteigen zu beobachten. Sie ließ rasch den Vorhang fallen, als ihr Gemahl, während er den Fuß aufs Trittbrett setzte, einen Blick zu ihrem Fenster hinauf warf. »Wir werden in jedem Fall noch einige Zeit hier verbringen«, sagte sie über die Schulter zur Freifrau von Wurmb, Augustes alter Gouvernante, die sich mit im Zimmer befand. »Bitte unterrichten Sie die Kinder entsprechend, Machère. Man muss sicher sein, dass die Straßen frei sind vom Feind, ehe man die Kleinen möglichen Gefahren aussetzt.«
Vor allem wollte Karoline sicher sein, keinen französischen Kaiser in ihrem Haus vorzufinden, wenn sie nach München käme.
Die kurfürstliche Kutsche ratterte inzwischen auf Straßen, die durch Regen und marschierende Soldatenstiefel in Morast verwandelt waren, der bayerischen Hauptstadt entgegen. Maximilian Josephs Laune besserte sich mit jeder Meile, die zwischen ihm und seiner zürnenden Ehefrau lag; seine natürliche Zuversicht ergriff, nun, da die Gefahr vorüber war, wieder ganz von ihm Besitz.
»Wenn wir uns beeilen«, sagte er am zweiten Reisetag zu Montgelas, »dann erwischen wir den Kaiser vielleicht noch in München. Was meinen Sie, wie neugierig ich auf diesen Mann bin, mein Lieber! Er soll es nicht bereuen, mir aus der Patsche geholfen zu haben; wenn es etwas gibt, womit ich mich ihm dankbar erweisen kann, dann will ich es ihm mit Freuden geben.«
»Wenn ich darum bitten dürfte, Durchlaucht, das um Gottes willen nicht Monsieur Otto hören zu lassen?«, entgegnete der Minister trocken. »Sie wissen gut, was er verlangen würde.«
»Also, natürlich nicht meine Tochter«, empörte Max Joseph sich sofort, »das wäre ja noch schöner.« Er verfiel in stummes Grübeln, dann fügte er hinzu: »Obwohl es ja vielleicht auch da eine Möglichkeit gäbe. Wie wäre es denn mit Charlotte? Die Kleine wird, mit ihren Narben im Gesicht, ohnehin nicht leicht zu verheiraten sein. Man könnte sie doch als Braut für den Prinzen Beauharnais anbieten, statt der Auguste.«
Montgelas schürzte die Lippen. »Im Grunde kein schlechter Gedanke. Allerdings muss man berücksichtigen, dass Charlotte noch keine vierzehn und Kaiser Napoleon nicht als geduldig bekannt ist.«
»Das denke ich auch«, nickte Max Joseph und zwinkerte. »Aber wenn die Franzosen ablehnen, weil Charlotte ihnen zu jung oder zu hässlich ist, dann haben wir zumindest unsere Dankbarkeit und unseren guten Willen bewiesen, und Auguste kann seelenruhig ihren Prinzen Karl heiraten, wenn schon ihr Herz so an dem Burschen hängt. Und dann«, sagte er, und urplötzlich kehrte die Müdigkeit in seine Züge zurück, »wird vielleicht auch die Kurfürstin mit mir zufrieden sein.«
Leider kamen Kurfürst und Außenminister einen Tag zu spät in München an; Kaiser Napoleon war bereits am achtundzwanzigsten abgereist, und bei den spontanen Entscheidungen des Franzosenkaisers ließ sich kaum sagen, wo und wann er das nächste Mal Halt machen würde. Max Joseph blieb nichts übrig, als ihm einen Kurier mit einem Dankschreiben hinterher zu senden und untertänig anfragen zu lassen, ob der bayerische Kurfürst seinem Retter bei Gelegenheit seine Aufwartung machen dürfe.
Der Kurfürst hatte Gesellschaft, während er auf Antwort wartete: Der Freiherr von Gravenreuth hatte Kurprinz Ludwig aus dem schweizerischen Lausanne nach Hause geschafft.
Wo Ludwig nun mit der Miene eines schmollenden Kleinkinds in der Residenz saß und seinem Vater grollte.
Gravenreuth hatte unterwegs alles getan, um dem Kurprinzen die veränderte Lage zu erklären. Ludwig hatte, in ein gepolstertes Eck der Reisekutsche gelehnt, mit vor der Brust verschränkten Armen und vorgeschobenem Kinn zugehört. Ja, ja, man müsse vielleicht zugeben, Kaiser Franz habe sich nicht besonders geschickt benommen und ganz sicher nicht sehr höflich. Man nahm keinen Kurfürsten in seinem eigenen Schloss gefangen; man war doch nicht unter Wilden! Aber hätte man nicht trotzdem eine andere Lösung finden können? »Jetzt sind wir mit den Franzosen verbündet, Gravenreuth! Mit den Franzosen! Gegen alle anderen deutschen Staaten!«
»Nicht wirklich, Durchlaucht. Die meisten unserer süddeutschen Nachbarn, selbst wenn sie Neutralität halten, stehen dem französischen Kaiser wohlwollend gegenüber. Bedenken Sie die gewaltigen Vorteile, die sich für Bayern aus diesem Bündnis ergeben werden. Kaiser Napoleon will Bayern vergrößern. Man spricht von Tirol, vom Innviertel, von Passau und Eichstätt.«
»Nun, das sind natürlich schöne Zugewinne, aber dennoch …«
»Die Unabhängigkeit vom Kaiserreich! Volle Souveränität! Eine Königskrone für Ihren erlauchten Herrn Vater, Durchlaucht! Eine Krone, die, wie ich erwähnen möchte, einst auf Ihr Haupt übergehen wird.«
Ludwig runzelte die Stirn. »Das klingt alles erbaulich, mein Lieber. Aber glauben Sie, der Kerl wird Wort halten? Er ist Franzose, und noch nicht einmal ein richtiger. Diese Leute sind alle falsch und verlogen! Bonaparte ist ein Kriegstreiber, ein Tyrann, ein Schlächter und ein Mörder; er hat den Herzog von Enghien auf dem Gewissen … angeblich soll er in Ägypten seine eigenen Soldaten im Lazarett vergiftet haben!«
»Bösartige Schauergeschichten aus englischer Feder, Durchlaucht.«
»Da bin ich nicht so sicher wie Sie.«
»Ihre Skrupel ehren Sie, Durchlaucht, und zeugen von Ihrem noblen Charakter. Letztlich sind, wie ich befürchte, aber alle moralischen Überlegungen zwecklos im Angesicht der Tatsachen. Ihr erlauchter Herr Vater stand vor der Wahl, entweder eine Königskrone aus den Händen des französischen Kaisers anzunehmen, oder seine totale Vernichtung.«
Ein Schlagloch erschütterte den Wagen; Ludwig setzte sich im Fond der Kutsche zurecht. »Natürlich kann ich es meinem Vater nicht verübeln, wenn er sich von Bonaparte eine Krone schenken lässt. Ich würde es ihm im Gegenteil schwer verübelt haben, hätte er diese Gelegenheit ungenutzt verstreichen lassen. Aber gleich ein Bündnis! Unser guter Ruf, der uralte Name des Hauses Wittelsbach! Vergessen Sie nicht meine Schwester!«
Der Freiherr von Gravenreuth bemühte sich um eine mitleidige Miene. »Ich fürchte, Durchlaucht, das ist nun einmal das Schicksal der Prinzessinnen fürstlicher Häuser.«
»Nein«, sagte Ludwig entschieden. »Niemals. Ich verbiete es. Keine Ehe mit einem Franzosen, mit einem dieser Räuber und Mörder, die uns so viel angetan haben! – Wissen Sie eigentlich, Gravenreuth, weshalb mein Gehör so schlecht ist?«
»Durchlaucht haben mir bereits ein- oder zweimal die Ehre erwiesen, mich darüber aufzuklären.«
»Weil wir damals, als ich noch ein Knabe war, unter dem Krachen von Gewehr- und Kanonenfeuer vor den Franzosen fliehen mussten! Eine Kanonenkugel schlug fast unmittelbar in unserer Nähe ein. Der Donner französischer Kanonen hat mich taub gemacht – und es ist mir gleichgültig, was die Ärzte dazu sagen! Ich weiß, was ich weiß! Ich werde mich gegen diese Ehe stemmen mit allen Kräften. Ich hoffe sehr, meine Stiefmutter wird es auch tun. Eine Krone, die befleckt ist, mag man im Laufe der Geschichte abwischen und durch ehrenvolle Handlungen in gebührendem Glanz erstrahlen lassen können. Besonders, wenn sie einer Familie wie der meinen angetragen wird, der diese Krone längst zugestanden hätte. Aber nie werde ich zulassen, dass das Blut unserer Familie mit dem des französischen Straßenpöbels vermischt wird! Ich liebe meine Schwester über alles; ich würde es nie überleben, würde ihr solche Schande zugefügt!«
Gravenreuth zog ein ernstes Gesicht. »Ich kann Durchlaucht nur bitten, sich diesen Entschluss genau zu überlegen. Auch wenn diesbezüglich nichts schriftlich festgehalten wurde: alle Zusagen, die der Kaiser der Franzosen dem Kurfürsten gemacht hat, erfolgten gewiss unter der Prämisse dieser Eheschließung.«
»Sie meinen, Bonaparte gibt uns den Königstitel nur, wenn meine Schwester diesen … Vizekönig heiratet?«
»Und das Gleiche gilt vermutlich für Tirol und alle übrigen Gebietszusagen.«
»Erpressung«, stieß Ludwig mühsam hervor. »Nötigung und Machtmissbrauch! Bonaparte ist ein Verbrecher!« Er erging sich eine Weile in ähnlichen Ausdrücken, und der Freiherr von Gravenreuth lauschte, machte eine angemessen betroffene Miene dazu und wartete, bis der Prinz sich beruhigt hatte, ehe er meinte:
»Nun, da Durchlaucht der einzige sind, der den Prinzen Beauharnais bereits kennengelernt hat, werden Sie am besten beurteilen können, wie schwer die erlauchte Prinzessin voraussichtlich an Ihrer Ehe zu leiden hätte. Ich bin sicher, auch Ihr Vater wird diesbezüglich Ihren Rat einholen wollen.«
»Meinen Rat?« Der Gedanke war so neu für Ludwig, dass er etwas Faszinierendes hatte. »Ja, das wird er zweifellos. Aber was soll ich ihm sagen? Der Kerl war freilich nett genug. Graf Reuß wird es bestätigen; fragen Sie ihn. Höflich, sogar liebenswürdig, und er machte nicht einmal den Eindruck, als stecke Berechnung dahinter. Wahrscheinlich ist er von diesen ganzen Franzosen sogar noch der beste. Aber wen kümmert das? Franzose ist und bleibt er! – Kann man von mir erwarten, mich zu entscheiden zwischen einem französischen Schwager und einer Königskrone? – Natürlich haben Sie nicht unrecht, andererseits. Eine politisch günstige Ehe zu schließen ist das Los einer Prinzessin. Und meine Schwester ist ein braves Mädchen. Anspruchslos, gehorsam, gar nicht sehr stolz. Man könnte sie wahrscheinlich mit jedem Mann verheiraten, und wenn sie erst einmal Kinder hätte und vielleicht einen kleinen Kreis von Freunden um sich, würde sie zumindest nicht ganz unglücklich sein. Denken Sie nicht?«
Der Freiherr von Gravenreuth beeilte sich, dieser Einschätzung zuzustimmen. »Zweifellos gehören die Fügsamkeit und die Demut, mit der Frauen ihr Geschick auf sich nehmen, zu ihren größten Tugenden. Die Prinzessin von Bayern gilt auch in dieser Hinsicht als Zierde ihres Geschlechts!«
»Aber gerade deswegen! Sie ist viel zu gut für so einen! – Denken Sie, der Papst würde so eine erzwungene Ehe später für nichtig erklären, wenn man gut mit ihm verhandelt? Ah, aber wir stehen seit der Säkularisation zu schlecht mit Rom! – Steht schon fest, was uns Bonaparte geben würde, abgesehen vom Königstitel? Tirol wäre freilich wertvoll, vor allem das südliche. Und die strategische Bedeutung! Wir würden die Alpenpässe kontrollieren, wie einst zu Zeiten Tassilos … Man müsste versuchen, möglichst viel von den Franzosen herauszuschinden, wenn wir schon unsere Würde und das Lebensglück meiner Schwester dafür opfern … Aber nein, es geht ja nicht. Vollkommen unmöglich. Sie ist Karl von Baden versprochen.« Der Kurprinz schien, als ihm dieses Verlöbnis einfiel, selbst nicht zu wissen, ob er enttäuscht oder erleichtert sein sollte, sich vor einer Entscheidung zwischen Politik und Moral bewahrt zu sehen. Ihm gegenüber schüttelte Gravenreuth betrübt den Kopf.
»Es sieht alles danach aus, als habe man in Baden kein Interesse an dieser Verbindung. Von einer öffentlichen Bekanntmachung des Verlöbnisses oder wenigstens einer heimlichen Zustimmung des Markgrafen nach wie vor kein Wort. Ihr erlauchter Herr Vater ist sehr gekränkt deswegen.«
»Meine Schwester auch, unter uns gesagt«, gestand Ludwig. »Sie hat mir Briefe geschrieben in den letzten Wochen, gerade über Karl …« Er grinste unsicher und schüttelte die Hand, als habe er sie sich verbrannt. »Sie wissen ja, wie empfindlich meine Schwester ist. Sollte Karl tatsächlich noch immer vorhaben, sie zu heiraten, hat er es zumindest nicht klug angefangen. Das Ganze war sowieso eine Schnapsidee, ausgeheckt von meiner Stiefmutter und dieser alten Hexe in Baden. Aber eine Sache weiß ich gewiss: ehe meine Schwester freiwillig einem simplen Beauharnais in die Ehe folgt, wird sie jeden anderen deutschen Prinzen vorziehen. So viel Stolz muss sie als Tochter des Hauses Wittelsbach aufbringen!«
Während der folgenden Tage in München, in denen Vater und Sohn in der weitgehend verwaisten Residenz saßen und auf Nachrichten aus dem Osten warteten, sprachen sie tatsächlich miteinander über das Schicksal Bayerns und der Familie: Max Joseph in halben Sätzen, unterbrochen von Seufzern und Rechtfertigungen, und Ludwig stotternd vor Aufregung, klagend und schimpfend, das Schlimmste von den hinterhältigen Franzosen befürchtend. Was Augustes Schicksal anging, versuchte der Kurfürst seinen Erben zumindest zu beruhigen; er habe Ludwigs Schwester in die Hand hinein versprochen, sie werde sich frei entscheiden dürfen, und er wolle dieses Versprechen auch ganz gewiss halten.
»Solange die Badener das Verlöbnis nicht offiziell aufkündigen, betrachte ich Auguste und Karl als einander versprochen«, sagte Maximilian Joseph und nickte sich selbst und seinem Sohn entschlossen zu.
Es war wirklich nicht so, dass der Kurprinz an dieser Entschlossenheit zweifelte. Natürlich nicht. Er hatte die Entschlüsse seines Vaters nur schon zu oft fallen gesehen, um sich allein darauf zu verlassen. So war es wohl zu erklären, dass Ludwig, als er an einem der nächsten Nachmittage das Billett eines jungen Herrn erhielt, von dem er sich undeutlich erinnerte, ihm bei einem Empfang im vergangenen Herbst einmal vorgestellt worden zu sein, das Papier nicht sofort ins Kaminfeuer warf, sondern sich mit dem Schreiber tatsächlich zu einem heimlichen Stelldichein im Englischen Garten verabredete. Der Graf Croy hatte in seinem Briefchen nicht viele Worte gemacht, aber wenn es darum ging, die »schönste Blüte Bayerns in Sicherheit zu wissen«, hätte sich auch ein weniger poetisch veranlagter Kurprinz als Ludwig ausrechnen können, um wen es ging.
Als Ludwig am nächsten Nachmittag im Englischen Garten anlangte, regnete es in Strömen, und die beiden jungen Männer, die als einzige Besucher des Parks unter ihren Regenschirmen über die schlammigen Wege spazierten, hätten für einen etwaigen Spion kein auffälligeres Bild abgeben können.
»Ich höre, Sie haben mir einen Vorschlag zu machen, Graf?«, fragte Ludwig. Der Regen trommelte auf den Schirm und durchweichte seine Schuhsohlen.
»Zu Befehl, Durchlaucht.« Der junge Graf Croy konnte kaum älter als Ludwig sein; er bemühte sich, Haltung anzunehmen, musste aber darauf achten, dass ihm der Wind nicht unter den Schirm fuhr. »Durchlaucht müssen wissen, dass in München seit der Durchreise des französischen Kaisers die wildesten Gerüchte umgehen.«
»Sie sind der Ansicht, dieses Geschwätz sei für mich von Interesse?«
»Wenn Durchlaucht mir versichern, es handle sich bei den infamen Behauptungen, unsere verehrte Prinzessin Auguste müsse den Prinzen Beauharnais heiraten, um Altweibergeschwätz, so machen Sie mich damit zum glücklichsten aller Menschen, und ich will unverzüglich schweigen und mich vollkommen beruhigt zurückziehen.« Graf Croy sah den Kurprinzen an, als hinge an dessen Antwort sein ganzes Wohl und Wehe.
Ludwig verzog das Gesicht. »Es liegt mir fern, irgendwelchen Stadttratsch zu bestätigen oder zu widerlegen. Sagen Sie einfach, was Sie mir zu sagen haben.«
»Durchlaucht«, rief der junge Mann schwärmerisch, »ich hatte die Ehre, der erlauchten Prinzessin Auguste im vergangenen Sommer vorgestellt zu werden. Die Prinzessin zu erblicken, war, als hätte ich einen Blick in den Himmel getan. Meine Seele schreit in Agonie bei dem Gedanken, das herrlichste, bezauberndste Wesen, den schönsten Diamanten Bayerns in den Händen der Franzosen zu sehen! Ich schmeichle mir, Durchlaucht, dass Sie dieses Gefühl teilen.«
Ludwig stieß spöttisch den Atem aus. »Das dürfen Sie allerdings laut sagen.«
»So hören Sie mich an. Ich werde eine Kutsche besorgen, einen gewöhnlichen Reisewagen, unauffällig, jedoch so komfortabel wie irgend möglich. Wir werden niemanden einweihen; ich selbst will mich als Kutscher zur Verfügung stellen und die Prinzessin heimlich an jeden Ort schaffen, den Durchlaucht mir als Zufluchtsort für die Prinzessin bezeichnen.«
Der jugendliche Graf meinte es offenbar vollkommen ernst. Er wusste bereits, wo er Wagen und Pferde auftreiben wollte, er hatte sich falsche Namen ausgedacht und eine Verkleidung besorgt; für Pässe und sonstige Papiere werde er mit Ludwigs Hilfe sorgen können; als Reiseziel schwebte ihm Sachsen vor oder sogar Preußen. Ludwig entließ ihn mit der vagen Bitte, sich für den Notfall bereit zu halten, und verbrachte die nächsten Stunden grübelnd in seinem Zimmer. So romantisch der Plan war – um die Schwester vor dem zu bewahren, was ihr drohte, mochte es tatsächlich die einzige Chance sein.
Aber würde es nicht bedeuten, in die Politik einzugreifen? Wenn Bonaparte die Erhebung Bayerns zum Königtum von dieser verwünschten Hochzeit abhängig machte, stellte sich Ludwig damit nicht der Zukunft seines Landes in den Weg? Wie sollte er sich vor seinem Vater, vor sich selbst, seinen ungeborenen Kindern und nicht zuletzt seinen Vorfahren rechtfertigen, vor all jenen Wittelsbachern, die seit dem Mittelalter nach einer Königskrone gelechzt hatten, wenn er diese Krone aufgrund persönlicher Präferenzen beiseite fegte?
Es war nur vernünftig, diesem schwärmerischen Grafen keine weitere Beachtung zu schenken, sagte sich der Kurprinz. Dass der Graf Croy bis über beide Ohren in Ludwigs Schwester verliebt war, stritt er ja nicht einmal ab. Der Himmel mochte wissen, wohin der Kerl Auguste bringen würde und in welchem Zustand sie dort ankäme. Um eine Sache klarzustellen: als Schwager war ein simpler Graf Croy ebenso untragbar wie ein Beauharnais. In dieser Hinsicht machte Ludwig keine nationalen Unterschiede.
Kurfürstin Karoline war mit den Kindern noch immer in Würzburg, fühlte sich dort aber mit jedem Tag unzufriedener. Es war ja nicht so, dass sie ihren Gemahl vermisste. Wie hätte sie das auch, da er sie derart beleidigt hatte? Aber ohne ihn geschah in Würzburg nicht mehr viel. Die Gesandten reisten nach und nach ebenfalls ab. An der Abendtafel, an der sonst Max Joseph in seiner leutseligen Art Anekdoten erzählt oder von seinen Ausflügen in die Stadt berichtet hatte, herrschte nun gelangweiltes Schweigen. Elisa und Amalia, die älteren Zwillinge, fragten jeden Tag mit großen Augen nach ihrem Papa; sie mochten instinktiv spüren, dass etwas nicht stimmte.
Max Josephs erster Brief aus München brauchte so lange, dass Karoline schon begonnen hatte, sich Sorgen zu machen. Schließlich herrschte noch immer Krieg im Land – was, wenn Max Joseph und Montgelas einem Trupp versprengter Österreicher in die Hände gefallen waren? Sie war wider Willen erleichtert, als sie das Schreiben in Max Josephs kleiner, gekritzelter Handschrift entfaltete, und die Kinder atmeten sichtbar auf, als Karoline ihnen aus dem Brief vorlas.
Obwohl manches darin durchaus Anlass zur Besorgnis gab.
»Die Franzosen waren in Nymphenburg?«, fragte Karl Theodor erschrocken. »Die werden uns doch nicht unsere Tiere erschossen haben!« Prompt begannen Amalia und Elisa um ihre zahmen Rehkitze zu weinen, und Karoline sah sich genötigt, ihren Stiefsohn wegen seines Dazwischenrufens zu rügen, ehe sie fortfuhr:
»Der Papa schreibt, es gehe ihm sehr gut. Die Münchner hätten ihn empfangen wie den Retter des Vaterlandes, und auch der Kaiser Napoleon habe ausrichten lassen, er sei sehr glücklich gewesen über das herzliche Willkommen. Napoleon ist schon wieder fort und führt weiter Krieg, der Papa will ihm hinterher reisen, sobald es geht.«
»Aber nicht in den Krieg«, brabbelte Elisa unglücklich, und Karoline strich ihr über den Kopf.
»Nein, Liebling, nicht in den Krieg. Der Papa war Soldat, als er jung war und die Franzosen noch einen König hatten. Heute muss er nicht mehr kämpfen.«
Zumindest hoffte sie das.
Max Josephs Brief war nicht der einzige, der eintraf, und da es sonst wenig zu tun gab, stürzte Karoline sich eifrig auf diese Korrespondenz und legte die Feder kaum noch aus der Hand. Karolines Mutter Amalie schrieb aus Baden und fragte besorgt nach Augustes Lage. Was sollte Karoline antworten?
»Auguste wünscht täglich mehr, dass ihr Schicksal endlich entschieden werde, und ich wage zu versichern, dass ihr Vater von dem gleichen Wunsch beseelt ist. All das genügt aber nicht, wenn mein Großvater und Karl keinerlei Schritte tun.«
Wirklich versicherte Max Joseph aus München noch einmal brieflich, er werde einer Ehe, wie Napoleon sie wünsche, also mit seinem Stiefsohn, dem Prinzen Beauharnais, niemals zustimmen. Er habe fest vor, Auguste mit Karl zu verheiraten – wenn nur aus Karlsruhe endlich das leiseste Zeichen käme, dass man dieses Verlöbnis dort wünsche. Karoline antwortete knapp und gemessen, sie sei froh zu hören, dass Max Joseph immerhin vom Schicksal seiner Tochter nicht völlig unberührt bleibe.
Weitere Briefe trösteten Karoline über ihren Kummer hinweg. Marie schrieb aus Braunschweig und Wilhelmine aus Darmstadt; beide waren von Amalie ins Bild gesetzt worden und taten ihr Bestes, Karoline Mut zuzusprechen. Sie dürfe in ihren Bemühungen nicht nachlassen; Max Joseph sei kein schlechter Mensch, nur zu schwach und wankelmütig, zu sehr bestrebt, mit aller Welt in Frieden zu leben. Gewiss werde er sich mit ein wenig Geduld und Strenge wieder auf den rechten Weg führen lassen. Vor allem jedoch müsse Karoline an den kleinen Bruder Karl und an Auguste denken und deren Glück sichern.
Selbst die Zarin Jelisaweta, Karolines Schwester Luise also, hatte durch alle Kriegswirren hindurch auf dem Umweg über Baden einen Brief geschickt. Sie tadelte Maximilian Joseph darin so schwer, dass Karoline sich gegen ihren Willen genötigt sah, ihren Mann zu verteidigen. Der Kurfürst handle außerordentlich unklug, schrieb Luise in hochtrabendem Ton, und werde schwer an den Folgen seines Tuns zu tragen haben; die russische Armee stehe, unter persönlicher Leitung von Luises Gemahl, dem Zaren Alexander, bereits in Böhmen und werde sich bei erster Gelegenheit mit der österreichischen vereinigen, um dann, zahlenmäßig weit überlegen, Bonaparte und seine Franzosen zu vernichten. Wie Max Joseph so dumm habe sein können, sich mit einem Zigeuner wie Bonaparte zu verbünden?
›Freilich‹, dachte Karoline bitter, ›so kann man leicht reden, wenn man im fernen Sankt Petersburg sitzt und Kaviar verzehrt, während anderswo die Kanonen auffahren.‹
Für Karoline und ihren Schützling Auguste, fuhr Luise in ihren Belehrungen fort, komme alles darauf an, Zeit zu gewinnen. Gewiss werde Max nicht so dumm sein, vor Abschluss des Friedens einer Hochzeit mit einem Franzosen zuzustimmen? Dann sei noch nichts verloren; ein Sieg der Verbündeten werde alles ändern. Habe das russische Heer Bonaparte erst in Schimpf und Schande zurückgejagt nach Paris, werde dem Verlöbnis zwischen Karl und Auguste nichts im Wege stehen. Sie selbst wolle sich bei Alexander dafür verwenden und ihren erlauchten Gemahl um Verständnis bitten für Maximilians Handlungsweise, wobei sie jedoch nicht verhehlen könne, wie aufgebracht der Zar darüber sei, dass Bayern sich auf die Seite des Antichristen geschlagen habe. Das Beste, das Karoline für sich und ihren Seelenfrieden tun könne, sei nun, nicht mehr zu viele Hoffnungen auf ihre Ehe zu setzen und keinerlei Gefühle darauf zu verschwenden; sie, Luise, habe stets befürchtet, die ältere Schwester sei viel zu romantisch veranlagt und hege daher in dieser Hinsicht zu große Erwartungen.
Karoline knüllte das Schreiben zusammen und warf es zur Seite. Erst da bemerkte sie, dass ihr eine Träne über die Wange lief.
›Im Gegensatz zu deinem Mann‹, antwortete sie ihrer Schwester in Gedanken, ›hat der meine seine Frau einmal geliebt!‹
Die einzigen Akteure dieses Dramas, die nicht schrieben, waren der Markgraf von Baden – und Karolines Bruder Karl.
2. Max träumt von Straßburg
In München rüsteten Kurfürst und Kurprinz sich zum Aufbruch. Inzwischen hatte bereits der November begonnen, in der Nacht gab es Frost, die ersten Schneefälle standen zu erwarten. Kuriere Napoleons waren eingetroffen; der französische Kaiser befinde sich auf dem Weg nach Linz, und bis dorthin sei der Feind bereits zurückgewichen. Einer Reise des Kurfürsten stand somit nichts mehr im Wege als die schlechten Straßen, und mit denen würde man leben müssen. Die Abreise von Kurfürst, Kurprinz und dem Freiherrn von Gravenreuth, der als Sondergesandter bei Napoleon bleiben sollte, war für den Dienstag geplant. Max Joseph schlief kaum und verbrachte vor Aufregung die halbe Nacht von Montag auf Dienstag auf dem Leibstuhl. Als Ludwig beim Einsteigen das bleiche Gesicht seines Vaters bemerkte und die hektischen roten Flecke auf den Wangen, da befürchtete er für die Reise das Schlimmste.
Wider Erwarten besserte sich der Zustand Max Josephs mit jeder neuen Reisestation, die sie passierten; Ludwig traute seinen Augen kaum. Vor Mühldorf wurde ihre Kutsche zum ersten Mal von französischen Soldaten angehalten, die dort eine Straßensperre errichtet hatten. Jemand rief vernehmlich »Qui vive?«, und über Max Josephs Gesicht breitete sich unvermittelt ein Strahlen. Er öffnete den Schlag und lehnte sich halb nach draußen.
»Weißt du, mein Junge«, rief er dem französischen Posten zu, der die Parole gefordert hatte, »zu meiner Zeit hätte man darauf etwas geantwortet, das ihr heutzutage wohl nicht mehr gerne hört, nämlich ›Vive le roi!‹. Was sagt man heute? ›Vive l'empéreur‹? Ich will dir diese Antwort gern geben, zu deinem Kaiser sind wir nämlich unterwegs.«
Der Lauf einer Muskete tauchte auf der anderen Seite der Wagentür auf, und für einen Moment war Ludwig sicher, man würde sie gleich an die Wand stellen und füsilieren. Aber irgendetwas, vielleicht das perfekte Französisch dieses großgewachsenen Fremden oder seine unverkennbar ehrliche Freude über den Anblick französischer Uniformen, schien den Posten davon zu überzeugen, dass der Mann trotz seiner royalistischen Reden harmlos war. Er blickte ins Wageninnere und dort misstrauisch von einem Gesicht zum nächsten.
»Na, was ist, Junge«, fragte Max Joseph in exakt jenem halb jovialen, halb ärgerlichen Tonfall, den ein höherer Offizier gegenüber einem nachlässigen Untergebenen üblicherweise anschlug, »hat die französische Armee etwa seit der Revolution das anständige Grüßen verlernt?«
Der junge Soldat in seinem blauen Rock nahm unverzüglich Haltung an. »Ich bitte um Verzeihung, Monsieur. Wir müssen alle Wagen kontrollieren, die diese Straße passieren. Befehl vom Kaiser.«
»Na, dann kontrolliert mal. Komm, Louis, kommen Sie, Gravenreuth, wir steigen so lange aus, damit die Burschen ihre Arbeit tun können. - Seid ihr hier stationiert, mein Junge?«, wendete er sich sofort wieder an den Posten. »Wer kommandiert euch denn? Bist du schon lange bei der Armee? Und wo bist du daheim?«
Max Joseph wartete kaum, bis der verdutzte Franzose eine Frage beantwortet hatte, ehe er die nächste abfeuerte. Als die Reisenden weiterfuhren, winkten die Soldaten der Kutsche freundlich hinterher.
In Mühldorf wurden die Pferde gewechselt, und während Ludwig sich bemühte, in einer abgelegenen Ecke der Poststation etwas zu essen zu bekommen, verbrachte Max Joseph die Zeit mit einem schnurrbärtigen Grenadier, mit dem er irgendwelche Geschichten austauschte, in denen es offenbar um das Ausheben von Lagergräben und Latrinen oder ähnlich unerfreuliche Dinge ging. In Altötting unterhielt Ludwigs Vater sich beinahe eine Viertelstunde mit dem dortigen Kommandanten, der die gesamte Zeit hochachtungsvoll vor dem ehemaligen Regiments-Obersten Max Joseph von Zweibrücken die Hand an die Stirn legte.
»Mon dieu!«, rief Max Joseph aus, als er sich endlich von dem Franzosen hatte losreißen können. »Ich fühle mich, als wäre ich zwanzig Jahre jünger! Ich habe es mir ja gleich gedacht, man hat schrecklich übertrieben. Im Grunde ist es kaum anders als damals, als ich noch mein Regiment ›Royal Alsace‹ in Straßburg kommandiert habe.«
»Aber Papa!«, stotterte Ludwig. »Wie können Sie so etwas sagen! Diese Leute haben Ihren Freund und Gönner Ludwig XVI. aufs Schafott geführt!«
»Ja, natürlich«, sagte Max Joseph friedfertig. »Da hast du schon recht. Aber sonst ist alles fast wie damals.«
Als Max Joseph in Braunau aus der Kutsche stieg, wo man übernachten wollte, erkannte Ludwig seinen Vater kaum wieder. Max Joseph, der in München nach dem Aufbruch in den Polstern der Kutsche zusammengesunken war wie ein nur halb gefüllter Mehlsack, hielt sich gerade wie ein Laternenpfahl, seine Schultern schienen breiter und sein Bauch kleiner, sein Schritt hatte einen unverkennbaren Marschrhythmus angenommen, und beim Abendessen sprach er mit dem französischen Ortskommandanten ausführlich über irgendwelche Details des Militärreglements, von denen Ludwig sein Leben lang noch nie gehört hatte. Ludwig war froh und erhob sich hastig, als Gravenreuth zum Schlafengehen mahnte mit dem Argument, es liege noch eine weitere anstrengende Tagesreise vor ihnen.
Ludwig gab es nicht gern zu, aber sein eigener Vater fing an, ihm unheimlich zu werden. Da Ludwig und Max Joseph sich das Zimmer teilten, blieb dem Kurfürsten nichts übrig, als seinem Sohn nach oben zu folgen.
In der Nacht wurde Ludwig durch Trommelwirbel und gellende Trompetensignale aus dem Schlaf gerissen – und sie mussten wirklich sehr laut sein, um durch seine Schwerhörigkeit und seine bleierne Müdigkeit zu dringen. Er rieb sich die Augen und entzündete eine weitere Kerze am brennenden Nachtlicht.
Ihm gegenüber rollte sich die rundliche Figur seines Vaters, noch halb schlafend, eilig aus der Bettstatt. Kurfürst Max Joseph griff mechanisch nach seinen Kleidern, fuhr mit den zielstrebigen Bewegungen eines Schlafwandlers in Hemd und Hose und schien erst wirklich wach zu werden, als er den Arm in den Rockärmel gesteckt hatte. Verwundert hielt er den Ärmel näher ans Licht der Kerze und betrachtete die Farbe des Stoffs.
Sein Blick glitt zu Ludwig.
»Das ist nicht mein Uniformrock«, sagte er. Ludwig bestätigte diese Erkenntnis schüchtern, und sein Vater nickte. Ein wehmütiger Ausdruck legte sich über sein müdes, rundes Gesicht, während er, jetzt aber langsam und gemessen, fortfuhr, sich anzuziehen. »Die Uniform von ›Royal Alsace‹ war blau, weißt du. Mit roten Aufschlägen. Und das Signal gerade, das war Generalalarm.« Er schloss den letzten Knopf, trat vor die Tür und erkundigte sich bei einem vorüber eilenden Posten nach dem Grund des nächtlichen Weckrufs. »In den Mannschaftsquartieren ist ein kleines Feuer ausgebrochen«, erklärte er, als er wieder herein kam. »Man hat es aber schon unter Kontrolle.« Es klang beinahe traurig. Ebenso selbstvergessen wie zuvor zog er sich aus, legte seine Kleider säuberlich gefaltet am Kopfende des Betts ab, wünschte seinem Sohn eine gute Nacht und fiel wieder in Schlaf.
Ludwig tat die restliche Nacht kein Auge mehr zu.
Das Schlimmste freilich stand dem Kurprinzen erst bevor. Der französische Kaiser hatte verlauten lassen, er erwarte den Kurfürsten in Linz. Er hatte sich im dortigen Landhaus einquartiert, einem frisch renovierten Gebäudekomplex mit einem von Arkaden gesäumten Innenhof, der Ludwig wehmütig an den Süden denken ließ. Überall wäre er jetzt lieber gewesen als hier.
Die Räume, die der Korse seinen bayerischen Gästen zugewiesen hatte, lagen im selben Trakt wie seine eigenen, nur eine Treppe tiefer. Bevor sie sich zur offiziellen Audienz aufmachten, kam Max Joseph herüber in Ludwigs Zimmer.
»Nicht wahr, Louis, du wirst mir keine Schande machen? Ich weiß, wie schwer dir das hier fällt, aber bitte, du darfst dir deine Abneigung gegen den Kaiser nicht anmerken lassen. Versprich es mir, Louis! Nicht nur die Zukunft deines Vaters, die deines ganzen Landes hängt davon ab. Du wirst vernünftig sein, nicht wahr?«
Ludwig versprach es. Versprach, sich zusammen zu nehmen, seinen gerechten Zorn zu zügeln, und die Kanaille, das Monster, den korsischen Schlächter mit ausgesuchter Höflichkeit zu behandeln.
Mit fest zusammengebissenen Zähnen und geballten Fäusten betrat er neben seinem Vater die Höhle des Ungeheuers. Im Vorzimmer empfing sie ein Adjutant oder General oder was auch immer, jedenfalls ein Franzose in ziemlich prunkvoller Uniform, dessen Augen ungewöhnlich hoch über der Nasenwurzel saßen, was ihn einem Kraken ähnlich sehen ließ. Sein Tonfall war kühl, sein Benehmen zurückhaltend, und seine Miene und Gestik wirkten kalt und kontrolliert. Außerdem, wie sich das für den Wächter vor dem Wohnsitz des Teufels gehörte, hinkte er leicht. (Ludwig schnupperte unauffällig; nach Schwefel roch er nicht.) Er führte sie in ein Vorzimmer, in dem ein braungebrannter Wilder mit Turban, Pluderhosen und Krummsäbel eine Tür bewachte.
Durch eben diese Tür trat er. Die Kanaille, das Monster, der korsische Schlächter, der Teufel in Menschengestalt. Er sah aus wie ein untersetzter, mittelgroßer Mann Anfang vierzig, dem die Haare über der Stirn auszugehen begannen, und er strahlte übers ganze Gesicht, als er Ludwigs Vater die Hand schüttelte. »Endlich lerne ich Sie kennen, Durchlaucht. Wissen Sie, dass mir schon Ihr alter Lehrer, der Chevalier Keralio, von Ihnen berichtet hat? Er war einer der Inspektoren an meiner Militärschule. Ich verdanke diesem Mann alles; wer weiß, ob je etwas aus mir geworden wäre ohne ihn!«
Und Ludwig sah mit Entsetzen, wie sein Vater die ganze sorgsam einstudierte Dankesrede vergaß, wie er stattdessen von seinem lang verstorbenen Erzieher zu plaudern begann, von seiner Jugend, von seinem Militärdienst in Straßburg, bereits vollkommen gewonnen, vollkommen glücklich. Kaiser Napoleon schüttelte auch dem Kurprinzen die Hand, ganz bürgerlich, und Ludwig glaubte, dabei ein leises Zwinkern in den schmalen, tiefliegenden Augen wahrzunehmen.
»So, so. Sie sind das. Mein Junge hat mir schon von Ihnen berichtet.« Und als er Ludwigs Verwirrung bemerkte: »Der Vizekönig, der Prinz Beauharnais, den Sie in Mailand besucht haben. Eugène hat mir geschrieben, Sie seien ein lebhafter und kluger junger Mann, um einiges flotter als die übrigen deutschen Prinzen, und Sie hätten sich auf Ihrer Italienreise ungemein gebildet. Sie haben ihn schwer beeindruckt, mein Lieber.« Hatte er das?
Dann führte der Unsägliche den Vater in sein privates Gemach, dessen Tür sich hinter den beiden rundlichen Gestalten schloss. Der hinkende General (Duroc hieß er wohl) bat Ludwig, sich zu setzen und sich Wein und Erfrischungen bringen zu lassen nach Belieben, entschuldigte sich dann und ließ ihn mit dem schweigenden Mameluken allein, der sich, breitbeinig und mit verschränkten Armen, vor der Tür aufbaute. Der Kurprinz hatte somit viel Zeit, auf die verschlossene Tür zu starren und sich das Zwiegespräch zwischen dem bayerischen Kurfürsten und dem französischen Kaiser in allen Einzelheiten auszumalen.
Zuerst würde Bonaparte gewiss all seine Versprechungen wiederholen. Innviertel, Tirol, und wer konnte sagen, was sonst noch alles. »Ich werde Bayern so groß machen, dass es sich nie wieder vor Österreich zu fürchten braucht.«
Der Vater würde begeistert nicken, seinem Retter aus ehrlichem Herzen danken, und Bonaparte würde eins drauf setzen und ihm erneut die Königskrone versprechen. Und dann käme der Pferdefuß. »Ach ja: wegen der Hochzeit, zwischen Ihrer Tochter und meinem Jungen, dabei bleibt es doch, nicht wahr?«
Der Vater würde verlegen mit den Füßen scharren. »Soweit es mich angeht, spricht gar nichts dagegen, Sire. Wenn meine Tochter einverstanden ist.«
»Natürlich, natürlich.« Vor dem Altar ja sagen müsse das Mädchen selbstverständlich. Aber dafür – und Bonaparte würde dem Kurfürsten an dieser Stelle jovial auf die Schulter klopfen – dafür werde der Vater gewiss zu sorgen wissen, nicht wahr? Dieser würde sich ein kameradschaftliches Lachen abringen und das Thema wechseln und versuchen, möglichst aus dem Gespräch zu entwischen, ohne sich festlegen zu müssen.
Etwa an dieser Stelle der imaginären Unterhaltung öffnete sich die Tür, und der französische Kaiser führte den Kurfürsten wieder heraus und begleitete ihn und den Prinzen bis zur Türschwelle, wo er sie mit einer Herzlichkeit verabschiedete, die Ludwig zutiefst verstimmte.
Konnten diese Franzosen sich nicht ein bisschen mehr wie die Monster benehmen, die sie waren?
Ludwig sollte im Verlauf der nächsten Stunden noch genug Gelegenheit haben, sich über den Franzosenkaiser zu ärgern: Napoleon war trotz seiner rundlichen Gestalt unheimlich flink und in ständiger Bewegung, stapfte auf und ab, sprach zu viel, zu schnell und zu leise, und wenn er gut gelaunt war, schlug er fremden Leuten auf Schultern, Hinterköpfe und Schenkel, klemmte ihre Nasen zwischen zwei Finger oder zupfte sie mit einer Vehemenz am Ohr, als wolle er es ihnen abreißen. Der bayerische Kurprinz war mehrmals das Ziel solcher Attacken, sah sich aber beruhigt, als er den hinkenden General, der offenbar das Amt eines Großhofmarschalls ausübte, und verschiedene andere Audienzsuchende denselben Zärtlichkeiten ausgesetzt fand. Denn Zärtlichkeiten sollten es offenbar sein.
Was der Kaiser der Franzosen niemals war: absichtlich unhöflich oder arrogant zu seinen bayerischen Gästen; er sprach mit großer Wärme von seinem Einzug in München und der Dankbarkeit, die er dabei von den Bayern erfahren habe.
»Dass man uns mit Neugierde bestaunt, das kennen wir, auch dass man uns schmeichelt, um uns gnädig zu stimmen. Dass wir einmal sein dürfen, was wir als unsere Bestimmung sehen, Befreier eines unterdrückten Volkes, dass wir das Joch einer fremden Besatzung lüften und den Leuten einen geliebten Fürsten zurückgeben dürfen, erfüllt uns mit tiefer Befriedigung.« Er sprach nicht im Pluralis Majestatis – er redete von sich und seinen Soldaten.
Zu Ludwigs gewaltiger Erleichterung hatte der französische Kaiser nicht viel Verwendung für seine bayerischen Gäste; sein Kriegszug ging natürlich vor, und Max Joseph und Ludwig, die am Mittwochabend angekommen waren, durften sich bereits Sonntag früh wieder auf den Heimweg machen und langten am Montag wieder in München an. Die Fahrt kam Ludwig vor wie ein Alptraum; der Mann, der ihm in der Kutsche gegenüber saß und aussah wie sein Vater, schien ihm völlig fremd.
Der Kurprinz kehrte also mit ausgesprochen gemischten Gefühlen, der Kurfürst voller Erleichterung nach München zurück. Max Joseph sah sich gefeiert mit einer Begeisterung, wie er sie seit seinem Amtsantritt nicht mehr erfahren hatte. Er hatte die richtige Entscheidung getroffen, hatte die österreichische Bedrohung abgewehrt und sein Land gerettet. Sogar der Kurprinz war mit dem französischen Kaiser im selben Raum gewesen, ohne zu versuchen, ihm an die Kehle zu gehen. Alles war gut gegangen. Es wog all die Bauchkrämpfe und schlaflosen Nächte beinahe auf.
Allerdings ließ die nächste Bedrohung nicht auf sich warten. Kaiser Napoleon selbst hatte Maximilian Joseph beim Abschied schonend darauf vorbereitet.
»Es macht Ihnen doch nichts aus, meine Frau auf einige Tage zu beherbergen? Sie hasst es, so weit von mir entfernt zu sein. Die Kuriere mit meinen Briefen brauchen dann so lange, sagt sie. Nicht, dass sie meine Briefe je beantworten würde, wohlgemerkt. Aber sie ist schrecklich eifersüchtig, und vermutlich glaubt sie, sie könne mir besser auf die Finger sehen, wenn sie sich nur hundert statt zweihundert Meilen weit weg befindet. Machen Sie sich wegen meiner Frau aber bloß keine Umstände! Sie ist ein reizendes Geschöpf und wird sie gar nicht belästigen. Sie bringt ihre eigenen Köche mit und eigene Zofen und ihre Schneiderin und wahrscheinlich auch noch ihren eigenen Kräutergarten, falls sie den in ihrem Koffer unterbringen konnte. Setzen Sie sie einfach irgendwo in Ihrer Residenz ab, lassen Sie sie die Hochzeit organisieren, geben Sie ein paar Bälle oder bieten Sie ihr sonst eine Gelegenheit, ihre Kleider und ihren Schmuck vorzuführen, und sie wird wunschlos glücklich sein. Außerdem verehrt sie die alten Adelsfamilien glühend und hat vermutlich bereits den ganzen Stammbaum Ihres Hauses auswendig gelernt. Sie brennt darauf, die Kurfürstin kennenzulernen.«
Diese Vorfreude war ausgesprochen einseitig. Karoline befand sich Mitte November noch immer in Würzburg. Von der drohenden Ankunft der französischen Kaiserin Josephine erfuhr sie bereits von ihrer Mutter aus Karlsruhe, noch ehe der entsprechende Brief Max Josephs aus München eintraf. Amalie befand sich in einer ähnlichen Verlegenheit wie ihre Tochter, und was sie schrieb, klang nicht verheißungsvoll. Bei ihr habe sich die Kaiserin für den achtundzwanzigsten November angekündigt. »Schrecklich vornehm, wenn man berücksichtigt, dass sie nicht mehr als eine gekrönte Kokotte ist.« Dass sie nach München reise und dort zu bleiben gedenke, sei in jedem Fall als schlechtes Omen zu werten für die Sache von Karl und Auguste. Was sonst konnte der Zweck von Josephines Aufenthalts in Bayern sein, als der, die Hochzeit ihres Sprösslings, dieses italienischen Vizekönigs, vorzubereiten?
»Ja, was«, murmelte Karoline. Sie dachte voll Mitleid an Auguste. Gestern hatte Karoline einen Brief von ihrem Bruder Karl erhalten, in dem Karl tatsächlich auf eine baldige Heirat mit Auguste angespielt hatte. Auguste war vor Freude durch den Raum getanzt, und Karoline, die auch den begleitenden Brief Amalies gelesen hatte und wusste, welche Mühe es Amalie gekostet hatte, ihrem missmutigen Sprössling diese Zeilen in die Feder zu diktieren, hatte wehmütig dazu gelächelt.
Was nützten alle Bemühungen, wenn kein Wille dahinter stand?
Aus irgendeinem Grund fiel ihr bei diesem Gedanken ihr Ehemann ein. Sie seufzte leise, ließ ihre Zofe kommen und bat sie, mit dem Packen zu beginnen. Für Karoline wurde es Zeit, nach München zu fahren.
Kaiserin Josephine reiste in gemächlichen Etappen. Sie blieb drei volle Tage in Karlsruhe, Tage, deren Stunden Markgräfin Amalie zählte. Man hatte der Kreolin einen eigenen Pavillon errichtet, und Amalie verfolgte angewidert, wie ihr Schwiegervater wegen der Gespielin eines korsischen Mörders und Entführers sein gesamtes Schloss auf Hochglanz polieren ließ.
»Seien Sie versichert, meine Liebe«, erklärte Markgraf Karl Friedrich sogar einige Tage vor der Ankunft des Gasts, »Sie werden die Kaiserin ebenso lieben, wie alle Welt sie liebt. Sie hat eine bezaubernde Art. Nicht wahr, Karl?«
»Oh ja«, sagte sein Enkel mit einer Bereitwilligkeit, die Amalie sonst meist schmerzlich vermisste, »eine sehr freundliche Dame. Und gar nicht stolz.«
»Stolz?« Dieses Wort war der Tropfen, der für Amalie das Fass zum Überlaufen brachte. »Worauf sollte das Weibsbild wohl stolz sein? Auf eine Abstammung, bei der man nicht weiß, wie viele karibische Negersklaven beteiligt waren? Oder darauf, dass man sie zu Zeiten der Revolution als Mätresse von einem zum anderen weitergereicht hat?«
Der alte Markgraf starrte sie an mit offenem, nahezu zahnlosem Mund. »Aber meine Teuerste!«
»Nein, Durchlaucht! Sie werden mich nicht dazu zwingen, mich vor dieser Kokotte zu demütigen, indem ich diese Farce mitspiele. Ich reise ab nach Mannheim.«
»Abreisen?« Markgraf Karl Friedrich warf einen hilfesuchenden Blick auf seinen Enkel, der aber nur dastand mit hängenden Armen und verständnislosem Gesicht. »Meine Liebe, Sie können doch jetzt nicht abreisen. Sie sind die Markgräfin; Sie müssen die Kaiserin empfangen …«
»Ich kenne keine französische Kaiserin, ich kenne nur die Witwe Beauharnais, deren Mann den Verbrechertod auf der Guillotine gestorben ist und deren widerwärtiger Sohn gerade versucht, Ihrem Enkel die Braut zu stehlen!«
»Aber Mama«, sagte Karl, schockiert über die Wortwahl seiner Mutter, »der Prinz Beauharnais und sein Freund, der Marschall Bessières, waren sehr nett zu uns in Paris. Sie haben uns die ganze Stadt gezeigt.«
Amalie sah ihren Sohn so vorwurfsvoll an, dass er prompt verstummte. Markgraf Karl Friedrich dagegen war unbeugsam.
»Sie können nicht abreisen, Madame. Ich verweigere Ihnen meine Erlaubnis.«
Amalie glaubte nicht recht zu hören. »Was unterstehen Sie sich?«
»Sie sind mein Untertan, meine Liebe. Bitte zwingen Sie mich nicht, Ihnen Befehle zu erteilen. Ich ersuche Sie nochmals in aller Form, die französische Kaiserin ehrenvoll zu begrüßen. So verstehen Sie mich doch«, setzte er hastig hinzu, als Amalies Augen wütend aufflammten, »es geht um das Wohl Badens, um das Erbe Ihres Enkels. Wollen Sie den Ärger Napoleons riskieren, wenn er hört, die Markgräfin von Baden habe seine Kaiserin mit Nichtachtung gestraft? Der französische Kaiser hat die Österreicher beinahe im Handstreich geschlagen, er ist mächtiger denn je. Wir können uns nicht gegen ihn stellen!«
Amalie rang lange mit sich. Als sie endlich antwortete, hatte sie das Gefühl, als schmecke sie Galle im Mund.
»Nun gut. Ich bleibe. Ich werde die … Kaiserin willkommen heißen.« Sie streckte dem Markgrafen einen Zeigefinger unter die Nase. »Aber ich werde nicht am Eingang auf sie warten. Ich begrüße sie an der Treppe.« Um keinen Widerspruch zuzulassen, drehte sie sich um. »Am oberen Absatz der Treppe!«
Ihr Schwiegervater und ihr Sohn blieben mit betretenen Mienen zurück.
»Der Prinz Eugène hat sogar sehr hübsch gesungen«, sagte Karl verdrossen.
Amalie feilschte bis unmittelbar vor Ankunft des Gasts mit ihrem Schwiegervater um jeden Schritt und jede Treppenstufe, die sie diesem liederlichen Weibsbild zur Begrüßung entgegengehen musste. Danach, nachdem sie vor der kleinen, in Samt und Seide gewickelten und mit Juwelen behangenen Person in einen angedeuteten Knicks verfallen war, zog sie sich unter dem Vorwand einer Krankheit zurück und versuchte, jeden weiteren Kontakt mit dem Gast zu vermeiden. Sie ließ sich jedoch in allen Einzelheiten darüber unterrichten, was in ihrer Abwesenheit gesprochen wurde. Ihren Hofdamen, eifrigen Berichterstatterinnen, entging keine Feder am kaiserlichen Hut und keine mit Schminke noch so gut überdeckte Runzel. Es hieß, die Kaiserin habe sich eingehend und in überaus reizendem Ton mit dem alten Markgrafen und beinahe ebenso lange mit dem Prinzen Karl unterhalten.
Vermutlich hatte sie Vergleiche angestellt zwischen Amalies Sohn und ihrem eigenen, mutmaßte Amalie empört; vermutlich entwarf sie nun die Strategie, mit der letzterer den ersteren bei der bayerischen Prinzessin Auguste ausstechen sollte.
Dieser perfide Plan sollte bald Makulatur sein, darauf baute Amalie fest. Sie erhielt noch immer Briefe von ihrer Tochter Luise aus Sankt Petersburg, und aus ihnen schöpfte sie Hoffnung. Das Heer ihres russischen Schwiegersohns, des Zaren Alexander, würde den Österreichern zu Hilfe eilen, Bonaparte samt seinem selbstgezimmerten Kaisertum, samt Kaiserinnen, Brüdern, Schwestern, Schwägern und Stiefsöhnen aus der Weltgeschichte tilgen, und Auguste und Karl, das glücklich liebende Paar, wären endlich vereint.
Die ersten dichten Schneefälle Ende November sahen Karoline wieder in München. Als ihre Kutsche durch das Schwabinger Tor fuhr, hörte Karoline vom Straßenrand die Leute jubeln und applaudieren, hörte ihren Namen rufen und den Max Josephs. Es berührte sie ungemein warm.
Die alten Mauern der Wittelsbacher-Residenz tauchten vor ihr auf, und zum ersten Mal bei einer Rückkehr hatte sie wirklich das Gefühl, sie komme nach Hause.
Als Karoline ihre Räume betrat, war sie sprachlos. Ihr Salon, ihr Empfangsraum, ihr Boudoir – alles war neu und exakt nach ihrem Geschmack eingerichtet; selbst das Grün der Samtvorhänge im Salon hatte ganz genau die Farbe, die sie sich vorgestellt hatte. Es gab einen zierlichen Schreibtisch aus rotbraunem Holz mit goldenen Scharnieren, es gab gepolsterte Stühle und Sessel, die farblich exakt auf die Tapeten abgestimmt waren, es gab eine Ecke für Karolines Bilder und Zeichen-Utensilien und vor allem gab es viel Platz für die Kinder. Karoline stand, noch in Hut und Mantel, inmitten all der Pracht, hatte die Hände vor dem Mund gefaltet und drehte sich ungläubig um sich selbst.
»Das hatte ich noch in Auftrag gegeben, ehe wir im Frühjahr nach Nymphenburg abreisten«, sagte die Stimme Max Josephs verlegen von der Türschwelle. »Es sollte ein Geburtstagsgeschenk sein, aber natürlich wurden die Handwerker nicht rechtzeitig fertig, wie immer. Gefällt es Ihnen?«
Karoline richtete sich auf und straffte die Schultern. »Sie haben sich zweifellos in große Unkosten gestürzt.«
»Liebste Karoline, Sie wissen genau, dass mir für Sie nichts zu teuer …« Er wollte eintreten, aber der wütende Blick, den seine Gemahlin ihm zuwarf, hielt ihn davon ab. Verlegen scharrte er mit den Füßen.
»Wie geht es den Kindern?«, fragte er.
»Sie kommen bald nach. Die Wege sind noch nicht völlig sicher; wir haben noch Österreicher unterwegs getroffen. Glücklicherweise höfliche Leute.« Karoline nahm ihren Hut ab und ließ ihn auf einen Beistelltisch sinken. »Sie wissen, dass Auguste in heller Angst lebt.«
»Das muss sie nicht«, rief er sofort. »Sie braucht diesen Menschen nicht zu heiraten, wenn sie nicht will. Das habe ich dem Kaiser auch gesagt. Es hängt alles ganz allein von ihr ab; sie soll sich frei entscheiden.«
»Ach, Max«, sagte Karoline nur.
Er runzelte die Stirn und hob das Kinn; das Licht der Lampen fing sich an den goldenen Ringen in seinen Ohren und machte sie blitzen. Max Joseph schien gewachsen seit Würzburg, dachte Karoline verwundert, oder er hielt sich aufrechter.
»Ich weiß, dass ich Sie gekränkt habe, Madame«, sagte er. »Aber gestehen Sie mir zu, dass ich Gründe dafür hatte, die ich nicht missachten durfte. Ihre Meinung von mir und Ihre Gefühle sind mir das Wichtigste auf der Welt, solange ich allein als Mann und Gatte handeln darf. Aber das Wohl meines Landes, das Leben Hunderttausender muss Vorrang haben für den Kurfürsten. Ich werde Sie nicht wegen meiner Handlungsweise um Verzeihung bitten, Karoline. Ich habe mich richtig entschieden. Wo, glauben Sie, stünden wir jetzt, hätten wir die Unklugheit besessen, uns gegen den Kaiser Napoleon zu stellen?« Er drehte sich um und verschwand im Flur; die Tür schloss sich lautlos.
Karoline starrte eine Weile blicklos auf die Gemälde ihrer Kinder, mit denen die Wände geschmückt waren. Dann ging sie, wie einem inneren Zwang folgend, zu ihren alten Zeichnungen, öffnete eine bestimmte Mappe und zog die Porträts des Herzogs von Enghien heraus. Sie musterte sie eine Weile kritisch, dann runzelte sie die Stirn, stopfte sie unsanft zurück und steckte die Mappe fast angewidert ganz nach hinten in den Stapel.
»Wieso?«, hörte er die Stimme der Frau, mit der er verheiratet war, von der Schwelle seines Kabinetts. »Wieso muss ich immer allein gehen, Louis? Ich bin das Gespött des ganzen Hofs!«
Prinz Louis Bonaparte, jüngerer Bruder des Kaisers der Franzosen, blickte von den Papieren auf, die er studierte. »Napoleon hat mich mit Arbeit überhäuft, ich habe zu viel zu tun. Mein rechter Arm schmerzt mich zu sehr. Ich habe keine Lust, mir auf dem Empfang meiner Schwester Caroline stundenlang sinnloses Geschwätz anzuhören und schon gar nicht endlose Lobeshymnen auf den glorreichen Joachim Murat. Suchen Sie sich einen Grund aus, Hortense, sie sind alle gleichermaßen richtig.« Er wendete sich wieder seiner Arbeit zu, aber die blonde Frau in der hellen Abendrobe ging nicht.
»Sie sind rücksichtslos«, beklagte sie sich. Die Prinzessin Hortense besaß, wie ihr Ehemann behauptete, dasselbe Talent wie ihre Mutter, die Kaiserin Josephine, zu allen passenden Gelegenheiten in Tränen auszubrechen. Leider tat sie es weniger kontrolliert und sah deswegen dabei nicht so gut aus wie die Kaiserin; ihre Nase und ihre Augen röteten sich und schwollen an.
»Natürlich«, polterte Louis. »Ich bin rücksichtslos. Ich habe Ihnen von Anfang an gesagt, ich würde Sie nicht auf Carolines Fest begleiten. Was Sie nicht gehindert hat, mir täglich damit auf die Nerven zu gehen. Seit heute Morgen um neun Uhr geht es treppab, treppauf in diesem Haus, rennen Dienstmägde und Kammerzofen nach Schals und Schuhen und Handschuhen und Haarkämmen. Und jetzt, da Sie aufbrechen wollen und hier endlich wieder ein bisschen Ruhe einkehrt, jetzt soll ich mein Haus verlassen? Ich denke ja gar nicht daran.«
Hortense biss sich auf die Lippen und wendete sich halb ab; ihre langen, schlanken Finger, die Finger einer Pianistin, dachte Louis, krampften sich in ein Spitzentaschentuch. »Sie könnten wenigstens so höflich sein und etwas über mein Kleid sagen.«
»Es dürfte dem Anlass angemessen sein.« Louis verbarg die Hände unter der Schreibtischplatte und massierte mit der linken seinen rechten Arm. Was würde er nicht dafür geben, Pianoforte spielen zu können – oder wenigstens auf längere Zeit eine Feder halten, ohne dass sein Arm verkrampfte.
Hortense verlegte sich auf Schmeichelei. »Bedenken Sie, wie enttäuscht Ihre Schwester sein wird, Sie nicht zu sehen. Und welches Vergnügen Ihnen entgeht! Sie gönnen sich viel zu selten Zerstreuung.«
»Ja«, spottete er, »ich muss gestehen, es ist ein gewaltiges Vergnügen, auf wackligen Beinen am Rand der Tanzfläche zu stehen und meiner Frau dabei zuzusehen, wie sie sich von einem Don Juan nach dem anderen hofieren lässt!«
»Ich lasse mich nicht hofieren!«, rief sie, in dem schrillen Ton, den Louis am wenigstens ertragen konnte. »Ich tanze, Louis, ich bin fröhlich und vergnügt und freue mich meines Lebens!«
»Tun Sie das, Madame, aber tun Sie es bitte ohne mein Beisein und außerhalb dieses Hauses!«
Hortense wirbelte wortlos herum, und die kostbaren Steine in ihrer Frisur funkelten einmal kurz auf, bevor die Tür hallend hinter ihr zuschlug.
Louis lehnte sich aufatmend zurück in seinen Sessel. Sein Blick fiel auf ein Bild an der gegenüberliegenden Wand, das der Prinz Eugène Beauharnais seiner Schwester Hortense vor einer Weile aus Italien geschickt hatte. Es zeigte Eugène im Ornat des Vizekönigs, angetan mit einer goldenen Amtskette und einem schweren blauen Samtmantel, in dem er entsetzlich jung und verloren aussah.
»Schwager«, sagte Louis in Richtung der Leinwand, »sollten die Gerüchte stimmen und Napoleon dich tatsächlich verheiraten wollen, dann hast du schon jetzt mein herzliches Beileid.«
Die Prinzessin Hortense hatte unterdessen die wartende Kutsche bestiegen und war, wie üblich, allein zu einer der zahlreichen Festivitäten aufgebrochen, mit denen Paris die Siege der Grande Armée feierte. Das Palais der Murats war schon von weitem zu erkennen an dem hellen Lichtschein und der Unmenge an Wagen, die vor dem Eingang vorfuhren. Da die Kaiserin sich nicht in der Stadt befand, wetteiferten die Schwestern des Kaisers darum, auf ihren Festen die größte Pracht zu entfalten und sich als die einfallsreichste Gastgeberin zu erweisen.
Prinzessin Caroline Murat, Gemahlin von Marschall Joachim Murat, der, wie die Armeebulletins vermeldeten, sich auf dem Feldzug täglich mit Ruhm bedeckt hatte, machte die Honneurs am Eingang und umarmte ihre ehemalige Schulkameradin Hortense voll Rührung.
»Liebste Hortense, ich bin entzückt, dass Sie kommen konnten!« Caroline musste sich fast auf die Zehenspitzen stellen, um Hortense auf die Wange zu küssen. Die Schuhe an ihren zierlichen Füßen funkelten von Rubinen, und ihr Kleid spannte deutlich über dem Busen. Sie war immer schon etwas rundlich gewesen, und bei irgendeinem ihrer vier Kinder hatte sie begonnen, in die Breite zu gehen. Neidisch musterte sie ihre Schwägerin, die selbst während ihrer Schwangerschaften noch ausgesehen hatte wie eine Nymphe.
»Meine liebe Caroline«, antwortete Hortense mechanisch, »wie hätte ich fort bleiben und Sie nicht beglückwünschen können? Ganz Paris spricht von den Heldentaten, die Prinz Murat auf diesem Feldzug für den Kaiser begangen hat. Sind nicht die Einnahme der Donaubrücken und überhaupt von ganz Wien nur seiner Klugheit und seiner Gewitztheit zu verdanken?«
Caroline lächelte geziert. »Sie schmeicheln mir, liebste Freundin, aber welche Ehefrau hört nicht gern das Lob ihres Gefährten aus solch hohem Mund? Es hat etwas Erhebendes, zu wissen, dass mein Joachim sich dem Kaiser nützlich erweisen kann. Wobei ich sicher bin, auch unser lieber Louis tut das, auf seine eigene Weise. Wo ist er denn heute?«
»Er fühlte sich nicht wohl«, sagte Hortense. Sie erhielt ein weiteres wie gemaltes Lächeln zur Antwort.
»Der Arme. Mein Bruder sollte sich mehr schonen. Geben Sie es nur zu, Hortense, Sie sind als Ehefrau zu fordernd.« Sie lachte meckernd über ihren eigenen Witz. »Aber wir werden es uns auch ohne ihn gemütlich zu machen wissen.« Ohne auf die übrigen Gäste zu achten, die hinter Hortense die Treppe herauf kamen, hängte sie sich bei ihrer Schwägerin ein und führte sie davon in den hell erleuchteten Saal, hinein in Musik, funkelnde Juwelen und Gelächter.
Für einen winzigen Moment konnte Hortense ihrem Ehemann nachfühlen, weshalb er sich geweigert hatte, zu kommen.
»Meine liebste Freundin«, sagte die Prinzessin Caroline Murat schwärmerisch, »Sie können sich wohl vorstellen, weshalb ich auf Ihre Ankunft gelauert habe. Abgesehen davon natürlich, dass wir alle hoffen, Sie heute tanzen zu sehen, was stets ein gewaltiges Vergnügen ist.« Seit Caroline auf Bälle ging, bemühte sie sich, Hortense auf der Tanzfläche auszustechen. Es gelang ihr nie. »Aber vor allen Dingen müssen Sie meine Neugierde befriedigen! Haben Sie Nachricht von Ihrem Bruder?«
»In seinem letzten Brief schrieb Eugène, es gehe ihm sehr gut, aber er wünsche dringend, zur Armee gerufen zu werden.«
Spöttisch, und noch immer mit ihrem aufgemalten Lächeln um die Lippen, schlug Caroline ihrer Schwägerin mit dem Fächer auf den Arm. »Oh, nun spielen Sie nicht die Unschuld, meine Liebe, Sie wissen genau, was ich meine. Dass der Vizekönig sich danach sehnt, an einem so glorreichen Feldzug teilzunehmen, ist ja verständlich, aber er muss sich dem Willen unseres Kaisers fügen wie wir alle. Und zu sorgen braucht er sich nicht, Napoleon hat ja meinen lieben Joachim an der Seite. Es muss auch friedliche Naturen wie Ihren Bruder geben, die einen Schreibtisch leiten statt eines Regiments, und die das verwalten, was unsere siegreiche Armee mit ihren Generälen erobert.« Sie beugte sich ein wenig vor und flüsterte so vernehmlich, dass man es wohl noch im Nebenzimmer verstand: »Nein, ich möchte wissen, wann wir Ihnen gratulieren dürfen, oder vielmehr Ihrem lieben Bruder. Tun Sie nicht so, als seien Sie die einzige in ganz Paris, die nichts von den Gerüchten rund um diese bayerische Prinzessin weiß. Geben Sie sich einen Ruck, meine Teuerste, erlösen Sie mich von meiner Neugier. Gewiss wissen Sie alles und spannen uns auf die Folter, Sie ungehöriges Ding!«
Hortense rang sich ein Lächeln ab. »Ich wünschte, ich könnte es Ihnen sagen. Aber ich bin so klug wie Sie. Meine Mutter hat mir zuletzt aus Straßburg geschrieben, und sie behauptet in diesem Brief, von Heiratsplänen für Eugène nichts zu wissen.«
»Wirklich?« Caroline Murat riss unschuldig die Augen auf. »Sollte ich womöglich sogar mehr wissen als Sie? Hätten Sie tatsächlich noch nicht erfahren, dass die Kaiserin auf dem Weg nach München ist?« Sie hob bedeutungsvoll die Brauen. »Nach München, liebe Hortense. Ich wollte Sie eigentlich fragen, wann Sie dorthin abreisen.«
»Meine Mutter … meine Mutter ist in München?«, wiederholte Hortense verwirrt. Nicht zum ersten Mal beklagte sie in Gedanken die Schreibfaulheit der Kaiserin. Josephine hasste es, die Feder zur Hand zu nehmen, vielleicht weil Hortense' Vater, der Vicomte de Beauharnais, sie in ihrer ersten Ehe so oft für ihre stilistischen Mängel gerügt hatte.
»Aber ja«, beteuerte Caroline Murat inzwischen. »Warten Sie auf den morgigen ›Moniteur‹, wenn Sie mir nicht glauben. Da wird es drin stehen.«
»Ist Eugène auch dort?« Hortense hasste es, ihre Schwägerin fragen zu müssen, aber sie konnte auch nicht ohne Antworten bleiben. Warum schrieb nicht wenigstens Eugène?
»Das wollte ich ja eben von Ihnen wissen«, lächelte die Prinzessin Murat. »Da Sie mir aber offenbar auch keine Auskunft geben wollen …«