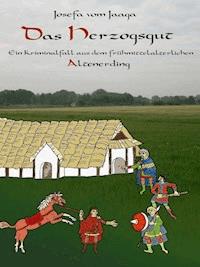
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im Jahr 788 AD wird der letzte bairische Agilolfingerherzog Tassilo III auf dem Reichstag zu Ingelsheim durch Karl den Großen abgesetzt. Zeitgleich machen sich von verschiedenen Orten kleine Trupps fränkischer Soldaten auf den Weg, um die Besitzungen des Herzogs für ihren König zu sichern. Bei einem dieser Trupps befindet sich der achtzehnjährige Fulcko, zusammen mit seiner Schwester und seinem Onkel. Doch ihre Ankunft in dem kleinen Ort Ardeoingas, in den es sie verschlagen hat, gestaltet sich anders als geplant: Ein untreuer Beamter hat sich mit der Kasse abgesetzt. Ein vornehmer fränkischer Herr scheint spurlos verschwunden. Die Einheimischen sind störrisch und plagen sich mit ihren eigenen Sorgen und Kümmernissen. Und wer ist dieser zwielichtige Richter, der als einziger herzoglicher Beamter noch in der Gegend geblieben ist - und der das Pferd des verschwundenen Franken reitet?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 359
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Herzogsgut
Das HerzogsgutKapitel 1Kapitel 2Kapitel 3Kapitel 4Kapitel 5Kapitel 6Kapitel 7Kapitel 8Kapitel 9Kapitel 10Kapitel 11Kapitel 12GlossarOrtsregisterZeittafelWeitere Bücher dieses AutorsImpressumDas Herzogsgut
Josefa vom Jaaga
Kapitel 1
Es war so eine Sache, wenn man vom bairischen Bischofssitz Frigisinga nach Ardeoingas reisen wollte, zumal in diesem Frühjahr, im Jahre des Herrn 788.
Nicht, dass viele Leute gewusst hätten, dass man das Jahr 788 schrieb. Im Gegenteil. Den allermeisten, sofern sie nicht gerade vorhatten, Bischof zu werden, war die Frage, welches Jahr der Kalender der heiligen Stadt Rom vorgab, vermutlich herzlich gleichgültig. Man zählte die Herrschaftsjahre von Königen und Herzögen, wenn man schon unbedingt zählen wollte, aber selbst dafür gab es selten Anlass. Letztlich war ja doch ein Jahr soviel wert wie das andere, solange es nur genügend Regen, genügend Sonne und vor allem genügend Korn in die Speicher bringen würde. Und von der hochtrabenden Jahreszählung »Anno Domini Nostri Iesu Christi», die am Stuhl Petri neueste Mode in offiziellen Dokumenten war, hatten vermutlich noch nicht einmal alle Bischöfe gehört.
Ardeoingas jedenfalls lag nur wenige Meilen südöstlich von Frigisinga, und ein Reisender hatte mehrere Möglichkeiten, um dorthin zu gelangen. Er konnte, wenn er es ganz bequem haben wollte, dem Lauf der Isara flussabwärts nach Nordosten bis zur Klostersiedlung von Mosabyrga folgen, von wo ihn eine alte, noch nicht ganz verfallene Römerstraße nach Süden bis nach Ardeoingas bringen würde. Oder er konnte ebenso gut die entgegengesetzte Richtung einschlagen, denselben Fluss ein Stück aufwärts reiten und irgendwann, wenn der Boden ihm fest und das Gelände günstig erschien, nach Osten einbiegen, um sich entlang eines Weges, der über Einödhöfe, kleine Siedlungen und herzogliche Hofgüter durch die Wälder führte, zur selben Römerstraße durchzuschlagen, der er dann nur noch nach Norden zu folgen brauchte.
Natürlich konnte er auch auf geradem Weg durch die sumpfige Ebene reiten, die die beiden Nachbarsiedlungen voneinander trennte. Vor allem, wenn er ein Ortsfremder war, der unbedingt seinen Willen haben und um keinen Preis auf die Ratschläge der Einheimischen hören wollte, die es doch schließlich nur gut meinten und am besten wissen mussten.
So wie es die kleine Gruppe von Reitern vorhatte, die sich an diesem Morgen im Hof der bischöflichen Behausung versammelte. Das Unternehmen stand schon jetzt unter keinem guten Stern, denn der erwachende Tag blinzelte ziemlich unwirsch auf die allzu frühe Geschäftigkeit hinunter. Trübes Zwielicht kämpfte einen aussichtslosen Kampf gegen die grauen Wolkenschleier, die ein feuchter Westwind vor sich her über den Himmel trieb, und außer den Hühnern, die den ohnehin schon nervösen Pferden zwischen den Hufen herum trippelten, und der Schar aufgeregter Nonnen, die noch vor Laudes und Prim aus dem benachbarten Kloster herübergekommen waren, um sich von Hiltrud zu verabschieden, schien noch kaum jemand wirklich munter. Die Knechte, die die letzten Tiere aus dem Stall zogen und aufsattelten, gähnten jedenfalls so herzhaft, dass man es in ihren Kiefern knacken hören konnte.
Immerhin, der Anführer des kleinen Trupps, ein graubärtiger fränkischer Recke, der auf den Namen Rodoin von Worms hörte, saß bereits im Sattel und blickte mit einer Miene, die an eine aufziehende Gewitterfront gemahnte, auf die Tonsur des dicken, rundgesichtigen Mönchs hinunter, der das Zaumzeug seines Pferdes gepackt hatte und unter heftigem Schnaufen in seinem gutturalen bajuwarischen Dialekt auf ihn einredete.
»Also dann macht doch, was Ihr wollt. Aber wehe, Ihr sagt hinterher, man hätte Euch nicht gewarnt. Eine gewaltige Dummheit ist es, eine gewaltige, dass der Herr mir vergebe, und dann noch bei diesem Wetter! Durchweichen wird es Euch bis auf die Knochen, wenn Euch der Wind nicht vorher aus dem Sattel bläst!« Die Backen des Mönchs blähten sich vor Empörung derart, als wolle er persönlich an dem Versuch mitwirken. »Und das alles noch mit dem Kind dabei!«
Eine Hand mit runden Stummelfingern deutete auf die zweite Person, die bereits im Sattel ihrer Falbstute saß, und Fulcko, der selbst eben erst den Fuß in den hölzernen Steigbügel gestellt hatte, folgte der Geste mit den Augen und musterte seine vierzehnjährige Schwester halb kritisch, halb besorgt.
Falls Hiltrud diese Besorgnis teilte, ließ sie es sich zumindest nicht anmerken. Sie hatte sich die Palla, an der der Wind zerrte, fest ums Kinn geschlungen, lächelte mit strahlenden Augen in den heranziehenden Regen und ließ sich, während sie auf den Aufbruch wartete, geduldig von den Nonnen die Hände zum Abschied drücken und die Satteltaschen mit allerlei Krimskrams und wahrscheinlich jeder Menge Naschwerk vollstopfen. Die frommen Frauen schluchzten den Abschiedsschmerz ergriffen in ihre Schleier.
Als die fränkischen Reiter sich vor einigen Wochen in der Residenz des Bischofs Atto einquartierten, hatte Herr Rodoin seine Nichte, wie sich das gehörte, im Gästehaus des kleinen Frauenklosters von Frigisinga untergebracht. Hiltrud war dort rasch zum uneingeschränkten Liebling der Bewohnerinnen aufgestiegen. Jeden Tag hatten mehr von diesen sittsamen Bräuten Christi das Mädchen auf dessen Spaziergängen hinüber zum Hofgut des Bischofs begleitet, und dabei war, soweit Fulcko das hatte verfolgen können, jeder einzelne der männlichen Anwesenden vom Kopf bis zu den Zehenspitzen begutachtet, bezüglich seiner Herkunft, Beziehungen und Reichtümer abgeschätzt und ausführlich als potentieller Heiratskandidat diskutiert worden.
An männlichen Gästen herrschte ja auch bis gestern in Frigisinga wahrlich kein Mangel. Auch wenn der Bischof selbst abwesend war (er befand sich natürlich, wie alle Großen des Reiches, beim königlichen Hoftag in Ingoldsheim), so gab es doch, abgesehen von Herrn Rodoin und seinen Leuten, noch etliche weitere Gruppen fränkischer Milites 1, die so lange die Gastfreundschaft des Bischofs genossen, bis der Befehl vom Hof des Königs sie erreichen würde. Dieser Befehl freilich ließ auf sich warten - die Wege waren weit, der zu verhandelnde Fall kompliziert und doch ein wenig heikel. Die fränkischen Recken (es waren ihrer mehrere Dutzend) wurden über der Warterei zusehends rastlos, und Fulcko nahm an, dass der Bischof bei seiner Rückkehr seine Weinkeller weit weniger gut gefüllt und einige seiner eher fröhlichen Nonnen weit weniger jungfräulich antreffen würde als bei seiner Abreise.
Zum Osterfest, das sie alle in Frigisinga verbrachten, fanden sich auch etliche der bairischen Adligen der Umgebung ein, und Hiltrud musste ihren Rang als Augapfel des Klosters für eine Weile mit anderen unverheirateten Damen teilen, besonders mit Reinhild, einem Mädchen aus der in dieser Gegend recht mächtigen Adelsfamilie der Fagana. Die beiden gleichaltrigen Mädchen freundeten sich trotz des Standesunterschieds sofort an, kicherten und glucksten miteinander um die Wette und trieben mit den verheißungsvollen Blicken, die sie unter langen Wimpern hervor großzügig in die Runde ihrer Verehrer warfen, nicht nur Fulcko, sondern auch den sonst stoisch gelassenen Rodoin von Worms zur Verzweiflung.
Fulcko selbst hatte, wenn er ehrlich war, jede Gelegenheit beim Schopf ergriffen, seinen Oheim mit der leidigen Aufgabe zu betrauen, über Hiltruds Tugendhaftigkeit zu wachen, und sich stattdessen den diversen Gruppen junger Adliger angeschlossen, die die Wälder nach jagdbarem Wild und die Schankhäuser nach Wein und willigen Frauenzimmern durchstöberten. Manche der Franken und sogar einige Baiern kannte er schon flüchtig aus Heeresversammlungen und Königspfalzen - auch wenn die meisten der höhergestellten Herren erst einmal Wert darauf legten, einen namen- und mittellosen Jungspund wie diesen achtzehnjährigen Blondschopf auf Abstand zu halten. Aber nach zwei Jahren am Hofe König Karls war Fulcko diese Behandlung gewohnt, und erfahrungsgemäß genügten die Aufregung einer Eberjagd oder der erste danach geleerte Humpen Bier, um alle Standesunterschiede für eine Welle davonzuspülen.
Von seinen früh verstorbenen Eltern hatte Fulcko nicht nur dieselbe hochgewachsene Gestalt und dasselbe blond schimmernde Haar geerbt wie seine Schwester, sondern auch denselben aufgeweckten Verstand und dasselbe unverwüstlich fröhliche Lachen - zwei Dinge, die sich nach Ansicht seines Onkels nicht mit Gold aufwiegen ließen. Dummerweise waren sie auch schon das einzige, was die Geschwister geerbt hatten, und damit glich die Vorsehung das Geschenk, das sie mit der einen Hand gemacht hatte, mit der anderen auch gleich wieder aus.
Fulckos Eltern waren kurz nach Hiltruds Geburt an einem Fieber gestorben, das seinerzeit in der Gegend grassierte. Um ihr kleines Gut an der Grenze zu Neustrien hatte es einen langwierigen Erbstreit gegeben, den schließlich irgendein Verwandter mit größerem Geldbeutel und besseren Beziehungen zur örtlichen Obrigkeit für sich entschieden hatte. Herr Rodoin hatte schon lange den zweifelhaften Luxus der Freiheit zugunsten eines Vasallendienstes beim König aufgegeben - und natürlich zugunsten eines kleinen Hofes, das er zum Lohn dafür als Lehen erhielt. Ohne Zögern hatte er die beiden Kinder seines älteren Bruders zu sich genommen, ungeachtet der Tatsache, dass er bald selbst zwei Söhne und eine Tochter durchfüttern musste. Kaum verwunderlich also, dass der Haferbrei, den die Hausfrau auf Rodoins Hof der Familie vorsetzte, nicht selten ziemlich wässrig ausfiel.
Glücklicherweise wurde Worms schon bald zu einer bevorzugten Winterresidenz des neuen fränkischen Königs Karl, was Herrn Rodoin, dessen Gut ganz in der Nähe der Stadt lag, den willkommenen Vorwand bot, bei allen Gelegenheiten als braver Vasall am königlichen Hof zu erscheinen und sich an der Tafel des Herrschers zu verpflegen statt am heimischen Herd. So wie fast die gesamte restliche Gegend, und zwar ohne das geringste schlechte Gewissen. Schließlich wurde ein Großteil der Abgaben, die von den Gütern erhoben wurden, nur für die Versorgung des königlichen Hofes verwendet, eines unersättlichen Drachens, dessen Erscheinen jedes Mal, wenn der gewaltige Tross sich von einer Pfalz zur nächsten wälzte, bei den Einheimischen mindestens ebenso viel Entsetzen auslöste wie Ehrfurcht.
Oder, wie sich ein Knecht auf Rodoins Hof ausdrückte: »Der Herr geht fort und frisst auf Kosten des Königs, der auf unsere Kosten frisst.«
Seit zwei Jahren hatte Fulcko seinen Oheim an den Hof begleitet, auf einem noch recht tauglichen Klepper und angetan mit einer nur ganz wenig verschrammten Brünne, die Herr Rodoin billig bei einem italienischen Händler erstand, der sie wiederum unter nicht ganz geklärten Umständen einem Rompilger abgenommen hatte und offenbar dringend loswerden wollte. Fulcko waren die Umstände des Kaufs egal; die Rüstung ihm nach ein paar kleineren Änderungen ganz hervorragend, und sie machte ihn, zumindest in seinen eigenen Augen, zu einem echten Königsvasallen - einem jener zahl- und mittellosen Franken also, die sich zu Füßen von Karls Thron einfanden und dem Herrscher von Pfalz zu Pfalz folgten in der Hoffnung, eines Tages werde dabei einmal ein beneficium, ein kleines Lehen für sie herausschauen.
Und nun, da man Fulckos Onkel mit einem kleinen Kommando betraut hatte, sah es zum ersten Mal so aus, als könnte etwas daraus werden.
Natürlich erklärte das alles noch lange nicht Hiltruds Anwesenheit. Und eigentlich war Fulcko fast überzeugt, dass seine unschuldige, engelsgleich lächelnde Schwester sie, was das anging, alle an der Nase herumgeführt hatte. Jedenfalls war sie eines schönen Tages im letzten Herbst unangekündigt, begleitet nur von einer Magd Rodoins, in der Pfalz aufgetaucht und hatte ihrem verdutzten Bruder und Onkel verkündet, sie habe sich entschlossen, den Schleier zu nehmen und sei auf dem Weg zu ihrem Kloster (irgendeinem obskuren Nonnenorden ein Stück weiter östlich, von dem Fulcko noch nie zuvor gehört hatte). Sie bitte lediglich darum, in der Pfalz unter dem Schutz ihres Oheims auf eine passende Reisegesellschaft warten zu dürfen, der sie sich anschließen könne.
Und diese passende Reisegesellschaft war dann irgendwie nie aufgetaucht, auch nicht, als der König mit dem ganzen Hof für das bevorstehende Weihnachtsfest nach Ingoldsheim umzog, oder wenn eine aufgetaucht wäre, so war Hiltrud zu dieser Zeit mit Sicherheit gerade erkältet und bettlägerig, oder hatte plötzliche Zweifel an ihrer Berufung, oder befand die Begleitung einfach nicht für vertrauenswürdig genug. Jedenfalls hielt sich das Mädchen auch zu Beginn des Frühjahrs noch immer in der königlichen Pfalz auf und schäkerte dort in einer Art und Weise mit den Herren aus dem königlichen Gefolge, dass wohl nicht nur Fulcko am baldigen Noviziat seiner Schwester zweifelte.
Schließlich kam der Befehl, der Fulcko und Rodoin nach Osten sandte, und es gab nur drei Möglichkeiten: Hiltrud auf eigene Faust zurückzuschicken auf Rodoins Gut, sie in der Obhut des Pfalzgrafen am königlichen Hof zurückzulassen - oder sie mitzunehmen.
Natürlich schien die erste die naheliegendste Lösung zu sein. Wenn da nicht sowohl an Fulcko wie seinem Oheim die Befürchtung genagt hätte, dass Hiltrud früher oder später einen Weg zurück an den Hof des Frankenherrschers finden würde. Und das Mädchen ohne männliche Aufsicht im königlichen Gefolge zu lassen, war für Fulcko gleichbedeutend mit der Aussicht auf eine kleine Nichte oder einen kleinen Neffen, wenn auch nicht unbedingt automatisch auch auf einen Schwager.
Nicht, dass er Hiltrud Vorwürfe machte. Nun ja. Nicht allzu laute zumindest. Das Mädchen war in mancher Hinsicht verständiger und abgeklärter als der ältere Bruder. Sie wusste genau, dass sie außer ihren äußerlichen Reizen nichts in die Waagschale zu werfen hatte, um sich einen Ehemann zu angeln, und deshalb wucherte sie nach Kräften mit jenen Talenten, die die Natur ihr geschenkt hatte. Ein paar Jahre, und ihr würde wirklich kein anderer Weg mehr offenstehen als der hinter die Mauern eines Klosters.
Hiltrud besaß, das hatte sie Fulcko voraus, einen ziemlichen Dickschädel, und sie schien fest entschlossen, diesem drohenden Schicksal ein Schnippchen zu schlagen.
Aber Dickschädel hin oder her: dass das Mädchen den kleinen Trupp begleitete, so manchem der fränkischen Streiter nicht. Allen voran Hartger von Molenheim tat seinen Unmut darüber bei jeder Gelegenheit kund - zumindest, seitdem Hiltrud ihm zu verstehen gegeben hatte, dass ein mittelloser fränkischer Krieger, den man ihrem Onkel unterstellt hatte und dem schon die Hälfte der Zähne aus dem Mund gefault war, nicht wirklich das war, was sie sich für ihre Zukunft vorstellte. Ganz egal, wie düster diese Zukunft auch werden mochte.
»Der Dicke hat so unrecht nicht«, tönte der Molenheimer denn auch in diesem Moment. »Ihr solltet Eure Nichte besser hier im Kloster lassen, Rodoin, damit sie uns nicht aufhält. Sie kann ja später nachkommen, wenn das Wetter besser ist.« Er bemerkte den wütenden Blick, mit dem Fulcko ihn streifte, und ergänzte genüsslich: »Ihr Bruder sollte bei ihr bleiben und auf sie achten. Dann ist der uns auch nicht im Weg.«
Fulckos rechte Hand krallte sich um das Lederzeug am Sattel, bis er Gefahr lief, den Gurt abzureißen. Die beiden anderen fränkischen Milites, die zu Herrn Rodoins Gruppe gehörten, der rothaarige, immer ein wenig verhungert aussehende Wulfbert und der schweigsame Hunold von Mainz, sahen sich kurz an und zogen dann wie auf Kommando die Köpfe ein. Der letzte Streit zwischen dem dunkelhaarigen Molenheimer und seinem blonden Widerpart war allen noch gut in Erinnerung.
Damals war es um Hiltrud gegangen, aber wäre sie nicht gewesen, hätten die beiden gewiss einen anderen Vorwand gefunden, um sich an die Kehle zu gehen. Es gab nichts an Hartger, das Fulcko auch nur tolerabel gefunden hätte. Der Molenheimer war faul, angeberisch, aufgeblasen und auf unerträgliche Art von sich selbst überzeugt. Leider war er aber auch ein unleugbar zäher Brocken und guter Kämpfer, der in den zahlreichen Wirtshausschlägereien, die es angeblich dieser Tage in Frigisinga gegeben hatte, kräftig auszuteilen wusste. Wenn er mit stolzgeschwellter Brust von den Heldentaten berichtete, die er auf den Feldzügen mit Karl begangen haben wollte, konnte man den Eindruck gewinnen, das Frankenreich habe seine gesamte Existenz allein Hartger von Molenheim zu verdanken.
Einen Achtzehnjährigen wie Fulcko nahm er natürlich nicht für voll. »Vielleicht schlage ich mich mit dir, Jungchen«, hatte er seinen Gegner verächtlich beschieden, »sobald dir ein ordentlicher Bart gewachsen ist.«
Und das empfand Fulcko wirklich als Hieb unter die Gürtellinie. Denn ob der Molenheimer es nun wusste oder nicht: der kümmerliche, fast durchscheinend blonde Flaum, der zögerlich über Fulckos Oberlippe keimte und so gar keine Anstalten machte, sich zu einem mannhaften fränkischen Schnurrbart auszuwachsen, war heimlich Fulckos größte Sorge. Er hatte alle möglichen Ratschläge ausprobiert, die Wangen mit Salz und Wein und Schweinefett eingerieben, dreimal auf das Rasiermesser gespuckt, ehe er den dünnen Haarwuchs damit abschabte, und sich auf Anraten seiner Schwester eine Paste aus Talg, geheimnisvollen Kräutern, zerriebenen Pelzhaaren und kleingestoßenen Pilzen unter die Nase geschmiert. Außer einem ordentlichen Ausschlag war nichts dabei herausgekommen. Das machte ihn anfällig für die Sticheleien Hartgers, und seitdem der Molenheimer das wusste, ließ er besonders häufig eine entsprechende Bemerkung fallen. Dabei strich er sich dann betont zufrieden über seinen eigenen Schnurrbart, der so dicht, schwarz und üppig unter der knollenförmigen Nase wucherte, dass Fulcko es als himmelschreiende Ungerechtigkeit empfand.
Kurz und gut, es brauchte nicht viel, damit Hartger und Fulcko aneinander gerieten.
Im Moment allerdings spürte Fulcko den bohrenden Blick seines Onkels im Rücken, biss sich auf die Lippen, würgte an der Antwort, die er für Hartger schon auf der Zunge gehabt hätte, und versuchte, stolz auf sich zu sein, als es ihm gelang, sie hinunter zu schlucken.
Dazu schmeckte sie allerdings zu bitter.
Herr Rodoin versüßte ihm die Angelegenheit beträchtlich, indem er nachlässig anmerkte: »Ich danke Euch für Eure Besorgnis, Hartger, aber meine Nichte ist keine verweichlichte Neustrierin. Sie wird uns nicht behindern. Im übrigen hätten wir weit weniger Zeit verloren, hättet Ihr Euch nicht vorgestern im Schankhaus so sinnlos betrunken, dass Ihr einen vollen Tag Euren Rausch ausschlafen musstet.«
Fulcko grinste hämisch in Richtung seines Widersachers und schwang sich auf seinen Gaul. Er gönnte Hartger die Abfuhr von Herzen - zumal Herr Rodoin es unterlassen hatte, zu erwähnen, dass man Fulcko in kaum besserem Zustand gefunden hatte. Aber im Gegensatz zu Hartger war er immerhin noch in der Lage gewesen zu stehen, und wenn ihn nur jemand in den Sattel gehoben hätte, dann hätte er auch reiten können, ob nun in diese Ardeo-Siedlung oder sonst wohin!
Hartgers (und, ja, vielleicht auch Fulckos) Unpässlichkeit war denn auch der Grund, warum Rodoins Trupp einen Tag später von Frigisinga aufbrach als alle anderen. Die übrigen fränkischen Kriegsleute hatten sich schon gestern in alle vier Winde zerstreut, während Rodoin innerlich fluchend darauf warten musste, dass die Hälfte seiner kleinen Streitmacht wieder aus dem Vollrausch erwachte. Um den Zeitverlust wettzumachen, würde man nun eben jeden noch so angenehmen Umweg vermeiden und den Weg durch das Moor einschlagen.
Zum Glück hatten sie ohnehin eine der kürzesten Strecken zurückzulegen. Auf halber Strecke gab es zudem ein herzogliches Zinsgut namens Deoinga, das ihr erstes Zwischenziel war und in dem man zur Not Rast machen konnte, sollte sich der Ritt tatsächlich aus irgendeinem Grund in die Länge ziehen.
Auch Wulfbert und Hunold waren inzwischen aufgesessen. Sie wirkten halb erleichtert und halb enttäuscht darüber, dass eine neuerliche Auseinandersetzung zwischen Fulcko und Hartger auszufallen schien. Damit war die Gruppe beinahe vollständig Aufbruchszeit, bis auf...
»Wo steckt denn dieser Odalrich?«, rief Rodoin. Er winkte ungeduldig in Richtung des gesattelten Maultieres, das ein Knecht am Zügel hielt. Der dicke Mönch, noch immer eine Hand um den Riemen am Kopfgeschirr von Rodoins Pferd gekrallt, machte eine abfällige Geste.
»Der Herr Bischof hat nicht gesagt, dass irgendeiner von uns Brüdern sein Leben aufs Spiel setzen muss wegen dieser Angelegenheit.«
»Bischof Atto hat uns den Mönch Odalrich als Führer, Schreiber und als Dolmetscher beigesellt«, schnarrte der Franke. »Odalrich wird wohl kaum so dumm sein, einen Befehl seines Herrn zu missachten - oder gar einen von König Karl.«
»Das braucht er gar nicht«, beschied ihn der Dicke. »Der Odalrich ist nämlich krank, jawohl. Er hat das Gliederreißen, das hat er immer bei diesem Wetter. Und der Pater Prior lässt Euch sagen, dass Ihr ja statt seiner den Virgilius mitnehmen könnt. Lesen und schreiben kann der sogar schöner als der Odalrich.«
Hoffentlich auch reiten, dachte Fulcko besorgt, als der Genannte mit wehender Kutte und nur halb geschnürten Sandalen aus dem Inneren des Gebäudes stolperte. Die frommen Brüder mussten sich den jüngsten und schüchternsten aus ihren Reihen herausgepickt haben, um ihn den abziehenden Franken aufzuhalsen. Der Schreiber, der auf den Stufen noch hastig Schreibtafel und Griffel in einem Leinensack verstaute, erinnerte Fulcko an eine schief gewachsene Uferweide, mit Gliedmaßen, die alle irgendwie zu lang und zu dünn aussahen. Seine Schultern sackten schlaff abwärts, das schüttere blonde Haar um seine Tonsur stand nach allen Seiten ab, und nachdem er mit der Hilfe zweier Knechte in den Sattel des Maultiers geklettert war, saß er da in einer Haltung, die es geraten erscheinen ließ, ihn irgendwie anzubinden und festzuschnallen.
Aber Herr Rodoin nahm auch diesen Schicksalsschlag hin in einer äußerlichen Ruhe, für die sein Neffe ihn heimlich bewunderte. Mit einem Handzeichen gab er seinem Trupp den Befehl zum Aufbruch. Hühner und Nonnen stoben auseinander.
Einige Stunden später wünschte Fulcko sich nur noch zurück an ein warmes Herdfeuer. Er war nass bis auf die Haut; sein Wollmantel, der sich nach langem Widerstand inzwischen doch mit Wasser vollgesogen hatte, klebte an ihm und drückte schwer wie mit steinernen Gewichten auf seine Schultern. Der kalte Wind machte die Finger klamm, bis sie die Zügel kaum noch halten konnten.
Rund um ihn rauschte noch immer Regen nieder, in einem dichten grauen Perlvorhang, der die Welt auf einen Kreis von guten hundert Schritt Durchmesser reduzierte. Wenn ein Windstoß den Schleier kurz lüftete, zeigte er nichts als überschwemmtes, leeres Land. Schilf, Moos und fauliges Gestrüpp vom Vorjahr bestimmten die Gegend, die eben war wie ein Brett, und wenn schon einmal etwas daraus in die Höhe ragte, waren es bestenfalls schwächliche Birken und Pappeln. Sogar echte Bäume schienen sich zu gut für diese Gegend zu sein. Die tiefschwarze Erde war auch bei trockenem Wetter schon vollgesogen mit Feuchtigkeit und konnte die Regenmassen unmöglich aufnehmen. Stattdessen sammelte das Wasser sich in breiten, nur eine Handbreit tiefen Seen, in die die unaufhörlich fallenden Tropfen bizarre Ringmuster malten. Selbst der scheinbar feste Boden war trügerisch und tückisch; Wasserpflanzen bildeten mancherorts so dichte Teppiche, dass sie den sumpfigen Boden darunter völlig verbargen. Die Reiter ließen ihre Pferde langsam gehen und gaben ihnen Gelegenheit, sich jeden Schritt zu ertasten. Niemand hatte Lust, den Tag als Moorleiche zu beenden.
Der Weg war ohnehin schwierig genug. Die Tiere sanken bis über die Hufe in den feuchten Grund ein, jeden Schritt begleitete ein herzhaftes Schmatzen, als freue sich das Erdreich unter ihnen schon auf ein leckeres Mahl. Einzelne Grasbüschel ragten immer wieder aus den Wasserflächen und machten die Pferde stolpern. Sie hatten Virgilius schon zweimal aus dem Dreck aufsammeln und wieder in den Sattel verfrachten müssen, als sein Maultier gestrauchelt war. Auch Wulfbert und Fulcko wären beinahe schon gestürzt, und Fulckos armer alter Klepper zitterte inzwischen am ganzen Körper und schnaubte ängstliche weiße Atemwolken in die kalte Luft.
Gegen Mittag machten sie Rast, auf einer kleinen Anhöhe unter einer Gruppe Pappeln, dem trockensten Punkt, den sie finden konnten. Hiltrud sah bleich und überanstrengt aus, Virgilius, der ansonsten den ganzen Tag noch nichts gesprochen hatte, mühte sich, den Schlamm von seiner Kutte zu kratzen, und murmelte dabei halblaut irgendwelche Psalmen vor sich hin. Oder vielleicht waren es auch lateinische Verwünschungen; es war ja nicht so, dass Fulcko ihn verstanden hätte. Wulfbert kaute an einem Stück Fladenbrot und schimpfte von Zeit zu Zeit auf das Wetter, den Landstrich und das gesamte Unternehmen, Rodoin inspizierte nacheinander die Pferde, und Hartger war im wesentlichen damit beschäftigt, so auszusehen, als ob ihm alles nichts ausmachte.
Fulcko stand inzwischen am Rand der Anhöhe, hielt sich mit der linken Hand an einigen tiefhängenden Zweigen fest und starrte in das schlammige Grau-Grün des Moores, aus dem sich hier und dort die bleichen Skelette der Birken erhoben. Hier, stellte er sich vor, hatten wohl vor einigen hundert Jahren die Alten noch Opfer für ihre heidnischen Götter dargebracht. Das Moor hatte alles verschlungen, ein gewaltiges Maul, in das ängstliche Menschlein hineinwarfen, was sie nur hatten, um die unberechenbaren Mächte, die im Inneren der Erde hausten, zufriedenzustellen: Gold und Silber, Waffen, Tiere - vielleicht sogar Menschen. Bei dem letzten Gedanken schlug Fulcko hastig das Kreuzzeichen.
Der einzige, der sich einen Rest Optimismus bewahrt zu haben schien, war ausgerechnet Hunold. »Hört bald auf«, brummte er ungefragt und nickte in den fallenden Regen dabei. Woher er das wissen wollte, fragte ihn niemand, aber er sagte es mit großer Bestimmtheit. Da er sonst so selten sprach, glaubten seine Gefährten ihm die Behauptung aufs Wort. Wenn Hunold etwas sagte, pflegte er sich seiner Sache sicher zu sein.
Prompt dünnte der Regen im Laufe des Nachmittags zu einem leichten Nieseln aus und endete schließlich ganz. Auch der Wind drehte sich, er wehte ihnen jetzt entgegen, und zwar noch kälter als am Morgen, kam es Fulcko vor. Die Reiter, durchnässt bis auf die Haut, fröstelten in den Sätteln. Von dem herzoglichen Zinsgut Deoinga, das ja angeblich auf halber Strecke liegen sollte, war weit und breit nichts zu sehen, und wo auch immer dieses Ardeoingas sein mochte, erreichen würden sie es heute gewiss nicht mehr. Dazu war ihr Fortkommen den ganzen Tag über zu langsam gewesen. Die Aussicht darauf, in dem kaltfeuchten Morast übernachten zu müssen, hob die Stimmung nur bedingt.
Rodoin suchte den Ort für das Nachtlager zeitig aus; alle waren inzwischen erschöpft, vor allem die Tiere, und es machte wenig Sinn, heute noch weiterzureiten. Als Fulcko nach dem Absatteln sein Pferd mit einem Büschel braunen Schilfrohrs abrieb, schaute es ihn so vorwurfsvoll an, dass er sich richtiggehend schuldig fühlte. Die Beine des alten Tiers waren bis zum Bauch mit schwarzem Schlamm bespritzt. Zelte hatten die Franken keine mitgebracht, um sich nicht unnötig mit Gepäck zu belasten, zumal sie ja auch nicht damit gerechnet hatten, länger als bis zum Abend unterwegs zu sein. Es galt also ein Nachtlager unter freiem Himmel. Sie suchten sich einen halbwegs trockenen Flecken, entzündeten mit nicht wenig Mühe ein Feuer und deckten den durchweichten Boden so gut es ging mit Birkenreisern ab, die sie von den Bäumen schlugen, ehe sie ihre Decken darauf entrollten.
Hiltrud schlief danach schon fast im Sitzen ein. Virgilius sah aus, als sei er den Tränen nahe, und murmelte etwas vom »schlimmsten Tag meines Lebens«. Gesprochen wurde ansonsten fast nichts.
Das Beste war, dass weiterer Regen ausblieb.
Dafür kam der Nebel.
Fulcko sah es erst, als Hunold ihn gegen Morgen zur Wache weckte. Da hatten die dicken weißlichen Schwaden, die in Fetzen über den Boden schwebten, ihren Ring um das Nachtlager bereits geschlossen.
»Scheußlich«, knurrte der alte Kämpe bestätigend, als er Fulckos erschrockenes Gesicht sah, und setzte nach kurzem Zögern hinzu: »Bet' ein paar Paternoster, Junge. Schaden kann's nicht.« Dann wickelte er sich in seine Decke und war offenbar wenige Herzschläge später problemlos eingeschlummert.
Fulcko fragte sich, wie alt man werden musste, um so eine Seelenruhe zu entwickeln.
Er packte einen der Äste, die sie am Vorabend als Feuerholz gesammelt hatten, und stocherte damit in der Glut, bis rote Funken aufstoben. Rund um ihn tanzten Nebelgespenster ihren Reigen durchs Dunkel, fuhren rauschend durchs mannshohe Schilfrohr und kicherten und glucksten mit Bächen und nächtlichen Moorbewohnern um die Wette. Das ging so lange, bis irgendwo ein blässliches rosa Schimmern in der Ferne andeutete, dass die Sonne aufgehen wollte. Zu diesem Zeitpunkt hatte Fulcko, auch wenn er es später nicht zugeben sollte, bereits sehr viel mehr als nur ein paar Paternoster gebetet.
Sein Onkel war beim Aufstehen ähnlich begeistert über den Nebel, der sich auch nach dem kurzen Frühstück noch nicht verzogen hatte. Aber was sollten sie tun? Sie mussten grob nach Südosten, und diese Richtung versuchten sie einzuhalten, indem sie sich am Stand der Sonne orientierten. Das Gelände hätte darüber hinaus wohl auch dann wenig Merkmale geboten, wenn sie mehr davon hätten sehen können.
Die Pferde staksten und stolperten durch den Morast. Sie waren müde, und ihre Reiter ließen sie noch vorsichtiger und gemächlicher gehen als am Vortag. Immerhin ersparte ihnen das für mehrere Stunden weitere Unfälle, selbst mit Virgilius und seinem Maultier.
Und dann, irgendwann am Vormittag, trat urplötzlich vor ihnen die Frau aus dem Nebel. Hartger fluchte erschrocken und langte nach dem Schwertgriff, Fulcko zügelte sein Tier so abrupt, dass der alte Gaul fast mit den Hinterhufen vom Weg gerutscht wäre. Selbst Rodoin fuhr zusammen, fing sich aber schnell und winkte Virgilius, zu ihm nach vorn zu kommen. Der Mönch gehorchte merklich zögernd, aber bei genauerer Betrachtung gab es zu übertriebener Furcht keinen Grund: Die Frau, die noch nicht einmal alt war, wenn sie auch etwas heruntergekommen wirkte, war eindeutig aus Fleisch und Blut, und sie sah harmlos genug aus. Sogar ihr Fränkisch war weit verständlicher als das, was Fulcko teilweise in Frigisinga gehört hatte.
Sie sei auf der Suche nach Moos, erklärte sie auf Rodoins Frage, was sie alleine hier draußen tue, und hob zur Bestätigung den breiten, flachen Weidenkorb, den sie unter dem Arm trug. Das Moos aus dem Sumpfland sei das beste zum Abdichten von Ritzen in hölzernen Wänden. Deoinga? Nein, nein, da seien die Herren schon lange vorbei, wohl im Nebel daran vorüber geritten. Den Ort Ardeoingas mit dem Herzogsgut kenne sie freilich auch, aber wenn die Herren dorthin wollten, so seien sie ein wenig zu weit nach Südosten abgekommen. Wenn sie freilich die eingeschlagene Richtung beibehielten, so würden sie schon bald nach Itzilinga gelangen, einem Dorf, das schon ganz in der Nähe von Ardeoingas liege und von wo es einen viel begangenen Pfad nach dem größeren Ort gebe.
Rodoin besprach sich kurz mit Hartger und Hunold und entschied dann, dem Vorschlag der Frau zu folgen und den Weiler aufzusuchen. Vom Moor hatten vorerst alle genug, auch wenn Hartger standhaft versicherte, dass für einen wie ihn so ein Ritt doch eine Lächerlichkeit sei.
Das Dorf, auf einer Anhöhe am Rand der Moorebene gelegen, kam ihnen nach der Nacht im Freien vor wie der Himmel auf Erden, mochten die meisten Häuser auch noch so schmal und gedrungen sein. Das Herrenhaus mit der kleinen Kirche daneben nahm sich ohnehin prächtig genug aus, die Kapelle hatte sogar ein gemauertes Fundament. Arm war die Gegend ganz offensichtlich nicht. Ein paar Unfreie oder Pächter waren dabei gewesen, das Dach einer Scheune mit neuem Ried auszubessern, das man im Winter geerntet hatte. Sie ließen ihre Schilfbündel aber bereitwillig fallen und kamen den schlammverkrusteten Neuankömmlingen bis ans Tor der Einfassung entgegen, anscheinend eher neugierig und amüsiert als verwundert. Ja, ja, das hätten sie hier immer wieder, erklärte ein alter Graubart, dessen Leibesumfang für einen Unfreien fast schon beschämend war. »Gibt immer ein paar, die meinen, sie wissen es besser.«
Der Herr des Anwesens, ein gewisser Rasso, Sohn des Izzilo, war seinerseits zu höflich, den verdreckten Zustand seiner Gäste auch nur zu erwähnen. Er hieß sie mit großer Geste willkommen, zeigte sich begeistert darüber, Vasallen des mächtigen Frankenherrschers Karl beherbergen zu dürfen, und wies seine Frau und Töchter wichtigtuerisch an, sich sofort um Hiltrud zu kümmern, das Mädchen sei sicher vollkommen erschöpft. Dann rief er seinen Priester, der in dem Kirchlein nebenan Dienst tat, und reichte in ähnlich herrischer Manier den Mönch Virgilius an ihn weiter.
Die übrigen Männer wurden in der Halle des Haupthauses unverzüglich und mit aller Großzügigkeit bewirtet. Vor so weitgereisten Gästen wollte Rasso sich anscheinend nicht lumpen lassen. Fulcko wusste es zu schätzen, er merkte tatsächlich erst beim Essen, wie hungrig er gewesen war. Nachdem sie ausgiebig getafelt hatten (ohne dass dabei viel gesprochen wurde - eine längere Unterhaltung war ohne Virgilius als Dolmetscher doch recht schwierig), führte Rasso seinen Hof vor - offiziell unter dem Vorwand, Rodoin werde doch sicher nach Hiltrud und dem Mönch aus Frigisinga schauen wollen. Das gab ihm die Gelegenheit, die Gäste in seine kleine Eigenkirche zu geleiten, wo sie die Grabplatte der in Tuffstein gehauenen Ruhestätte seines Ahnen Izzo gebührend zu würdigen hatten. Der Priester, ein kleiner Kahlkopf mit flinken Äuglein, war wohl nur einer jener Unfreien, die von ihren Grundherren irgendwann zum Priester erklärt worden waren, aber er schien seine Gebete immerhin zu beherrschen, soweit Fulcko das beurteilen konnte. Er steckte, als der Hausherr die Gäste herein führte, bereits in eifrigem Tratsch mit dem Mönch, auch wenn die zwei sofort schuldbewusst verstummten. Wahrscheinlich hatte Virgilius dem Priester gerade alle Widernisse der gestrigen Reise vorgejammert.
Nachdem sie, jetzt in Begleitung von Mönch und Priester, auch noch die Stallungen besichtigt und Pferde und Vieh ausgiebig gelobt hatten, redete niemand mehr davon, den Weg heute noch fortzusetzen. Obwohl, wie Rasso sich ausdrückte, der Ort Ardeoingas kaum einmal einen guten Steinwurf entfernt liege. »Wenn ihr diesem Pfad weiter folgt, kommt ihr schon bald zu einer kleinen Siedlung, die am Fuß eines sehr steilen Hügels liegt. Man nennt sie 'Uffos Häuser'. Sie gehört Graf Hatto von den Fagana, der auch ein befestigtes Anwesen dort hat, ganz oben auf der Spitze des Hügels.«
»Graf Hatto«, wiederholte Fulcko. »Hat er einen Sohn namens Wettilo, und eine Tochter namens Reinhild?«
»Freilich. Der junge Herr Wettilo ist der zweite Sohn, gibt aber zur Zeit hier die Befehle, weil der Graf nämlich mit dem älteren Sohn in Ingoldsheim ist, beim Hoftag. Kennt Ihr ihn denn, also, den Wettilo, meine ich? Der müsste so in etwa Euer Alter haben.«
»Wir haben uns in Frigisinga getroffen, als er mit seiner Schwester zu Ostern dorthin kam«, erklärte Fulcko, halb an seinen Onkel gewendet, der zufrieden nickte. In der Gegend bereits Bekannte zu haben, konnte ihrer Sache nur dienlich sein. Zumal, wenn sie zur einflussreichen Fagana-Familie gehörten.
»Ihr braucht aber gar nicht bis dorthin zu reiten«, erzählte Rasso weiter, »sondern könnt schon früher nach Norden einbiegen. Ihr werdet Ardeoingas ohnehin schon von der Kuppe aus am Fluss liegen sehen können.« Er klatschte in die Hände. »Aber das solltet Ihr wirklich erst morgen tun. Lasst Eure Pferde noch ein Weilchen verschnaufen und Eure Nichte noch ein wenig ausruhen, Herr Rodoin. Ob Ihr nun heute Abend oder morgen früh eintrefft, wird doch wohl keinen Unterschied machen?«
Vermutlich nicht, da waren sich alle einig. Im Nachhinein betrachtet war es vielleicht nicht die beste Entscheidung, aber an diesem Nachmittag konnten sie das noch nicht wissen. Im Gegenteil, sie waren alle froh und glücklich darüber, sich für die Nacht in der behaglich warmen Halle des Langhauses zum Schlafen ausstrecken zu können.
Irgendwann später in der Nacht wurde Fulcko kurz wach. Er wunderte sich noch, was ihn geweckt haben konnte, denn in der stickigen Luft, in der der schwere Geruch des Holzfeuers vom Herd hing, hatte er zuvor geschlafen wie betäubt. Dann hörte er durch das regelmäßige Schnarchen der Schläfer (außer den fränkischen Gästen hatten auch noch einige Knechte Rassos ihr Lager in der Halle, allerdings in den zugigeren Ecken näher am Eingang) das aufgeregte Wispern zweier Männer. Es musste gerade die Heimlichtuerei sein, mit der die zwei versuchten, ihr Zischeln zu unterdrücken, die ihn hatte wach werden lassen.
»Fort?«, hörte er Rasso flüstern. Es klang entsetzt. »Nach all dem, und... einfach fort?«
Der Andere war schwerer zu verstehen, zum einen, weil er seine Stimme noch mehr dämpfte, aber vor allem, weil sein bairischer Dialekt viel ausgeprägter war als der Rassos. Es mochte einer seiner Unfreien sein. Nach der langen Wartezeit in Frigisinga, in der er mit etlichen Bajuwaren zu tun gehabt hatte, verstand Fulcko die ungewohnte Sprache meistens ganz gut. Diesmal hörte er aber nur etwas von »an sich selbst zuerst« und »hat er aber da gelassen«. Oder so ähnlich.
Rasso beantwortete die geflüsterte Erklärung mit einem missbilligenden Schnauben. »Woher hast du das?«
»Von einem aus Singoldinga, und dem hat es einer von Otkers Leuten selbst erzählt«, verstand Fulcko diesmal deutlich. Es blieb einen Moment ruhig, dann bestimmte der Hausherr:
»Mag alles sein, geht uns aber nichts an. Um fremder Leute Angelegenheiten brauchen wir uns nicht zu scheren. Schau zu, dass du nach Hause kommst, und schlaf.«
Genau diesen weisen Rat befolgte auch Fulcko unverzüglich wieder. Er hatte die Augen kaum geschlossen, als er das mitternächtliche Zwiegespräch bereits wieder vergessen hatte.
1 lat.: »Soldat, Krieger«
Kapitel 2
Sie verließen Rassos Hof am frühen Morgen. Der Hausherr war anscheinend noch früher aufgestanden und zu diesem Zeitpunkt bereits irgendwo auf seinem Grund unterwegs. Er ließ sich also entschuldigen, hatte für die Gäste allerdings einen ordentlichen Reiseproviant einpacken lassen (den sie jetzt, ein paar Meilen vor dem Ziel, kaum noch benötigen würden), und gab ihnen einen Knecht mit, der sie noch ein Stück weit die Straße entlang führte, bis er ihnen riet, nach Nordosten einzuschwenken. Die Sonne lachte bald nach dem Aufbruch so heiter vom Himmel, als wolle sie sich über die Franken und die Reise der letzten zwei Tage lustig machen. Der Unfreie kehrte irgendwann um, und wenig später zügelten die Reiter auf einem flachen Hügel ihre Pferde und sahen ihr Ziel vor sich.
»Oh, wie schön!«, rief Hiltrud unwillkürlich. Hartger drehte sich halb im Sattel um und warf ihr einen herablassenden Blick zu. Allerdings blieb er stumm, und auch die anderen Männer ließen sich nicht herab, den begeisterten Ausruf, der ja wohl wieder einmal typisch weiblich war, zu kommentieren.
Vielleicht taten sie es auch deswegen nicht, weil man dem Mädchen nur schwer widersprechen konnte - selbst als fränkischer Kriegsmann, der eine Landschaft eher nach strategischen als nach ästhetischen Gesichtspunkten zu beurteilen hatte. Sogar Fulcko musste zugeben, die Gegend mache heute, ohne Regen und Nebel, einen weit besseren Eindruck als die beiden Tage zuvor. Der Blick von der Hügelkuppe, auf der sie hielten, hinunter in das breite Tal des kleinen Flüsschens Semida bot an diesem Morgen ein Bild wie gemalt.
Sanft geschwungene Hügel, die sich grob von Süd nach Norden zogen, rahmten das Tal zu beiden Seiten ein. Der dichte Mischwald, der darauf wuchs, wurde, je weiter er abwärts klettern musste, immer dünner und endete schließlich in einer fast völlig ebenen Talsohle, die von Menschenhand beinahe vollständig gerodet worden war. Für das schmale Flüsschen, das sich irgendwo in ihrer Mitte dahin schlängelte, war das Tal fast lächerlich weit. So hatte das Gewässer Gelegenheit, sich mit einer Vielzahl von Gräben, Schnörkeln, toten Seitenarmen und dichten Schilfwäldern nach beiden Seiten auszubreiten. Der tiefschwarze Grund in Ufernähe war sicher ebenso sumpfig wie das Gebiet, das sie gestern durchquert hatten, aber im strahlenden Sonnenschein dieses Tages wirkte er nicht bedrohlich, sondern im Gegenteil fast anheimelnd. Die Birken, Weiden und niedrigen Sträucher, die in kleinen Gruppen Teiche, Gräben und Flusslauf säumten, trieben gerade erst ihr frisches Frühjahrsgrün; ihre runden Kronen bauschten sich hell, locker und weich. Auf der weiten, sonst leeren Ebene der Talsohle sahen sie aus wie Wolken, wie Spiegelbilder der flockigen weißen Gebilde, die weiter oben gemächlich ihren Weg über den heute heiteren kobaltblauen Himmel zogen.
Aber ja. Sie waren ja nicht hier, um die Landschaft zu bewundern, rief Fulcko sich ins Gedächtnis. Vor allen Dingen barg dieses Tal eine erstaunliche Anzahl menschlicher Siedlungen, die sich zu beiden Seiten des Flüsschens aufreihten. Die erste lag gleich rechts von dem Punkt, an dem sie hielten, am südlichen Rand des Tals, halb verdeckt von einigen Bäumen. Das musste die Besitzung der Fagana sein, von der Rasso gesprochen hatte. Herr Rodoin machte seine Leute durch ein Handzeichen auf die Kuppe dieses südlich gelegenen Hügels aufmerksam. Während die übrigen Hänge sich recht sanft vom Tal in die Höhe schwangen, war dieser Anstieg fast schon halsbrecherisch steil, und die Fagana hatten sich das zunutze gemacht: Am höchsten Punkt der Kuppe war der sonst dichte Bewuchs ausgelichtet worden. Was dort oben, in diesem Falkenhorst am Eingang zum Tal, angelegt worden war, konnte nur eine regelrechte Burgbefestigung sein.
Zwischen den Häusern der eigentlichen Ortschaft glitzerten Wassergräben in der Morgensonne. Vermutlich war es eine Siedlung unfreier Handwerker, Gerber vielleicht oder Eisenschmiede. Aber es war bei weitem nicht das einzige Dorf, das die Franken ausmachen konnten. Beinahe aus allen Richtungen stiegen Rauchfahnen empor. Zwischen den einzelnen Ortschaften lag wohl kaum eine Stunde Fußmarsch. Irgendwo blinzelten auch ein paar geborstene Säulen und von Unkraut überwucherte Ruinen unter den Bäumen hervor - offenbar die Reste eines alten römischen Gutshofes. Vielleicht beherbergten einige Dörfer noch die Nachkommen der Leute, die es früher bewirtschaftet hatten.
Eine Siedlung stach deutlich aus den übrigen heraus. Der Ort Ardeoingas, dessen Schilfdächer und kalkgetünchte Lehmmauern linker Hand zwischen den Bäumen am Ufer hervorblitzten, war als einzige so groß, dass sie sich auf beiden Flussufern ausgebreitet hatte. Fulcko kam es später so vor, als teile die Semida den Ort nicht ganz zufällig in zwei Hälften: auf der den Franken zugewandten Seite lag das große herzogliche Gut mit den Pächterhöfen und den Behausungen der Unfreien, auf der jenseitigen die Kirche und eine Reihe kleinerer Höfe freier Bauern. Noch freilich ließen sich solche Details kaum erahnen. Soweit Fulcko es aus der Entfernung anhand der aufsteigenden Rauchsäulen abschätzen konnte, musste die Zahl der Häuser allerdings recht beachtlich sein. Die Semida floss an dieser Stelle scheinbar besonders gemächlich und träge, teilte sich sogar kurzfristig in zwei Arme auf und hatte sich eine Windung ausgesucht, um allen Schlick und Morast, den sie als Ballast mit sich führte, am Ufer abzuladen. Der Grund war hier deshalb bis ans Wasser hin recht fest und bot ein sicheres Fundament, um ein Gebäude darauf zu errichten. Die Siedler, die einst von Norden her gekommen waren, hatten, was an Baumbestand vorhanden war, eine gehörige Strecke nach beiden Seiten hin gerodet, ihren Ort mit einem Palisadenverhau befestigt und Felder und Gemüsebeete angelegt. Wenn Fulcko die Augen zusammenkniff, konnte er dort kleine Punkte erkennen, die sich bewegten. Offenbar waren die Leute schon bei der Arbeit.
Eine Weile musterten sie die Gegend, dann winkte Rodoin, und sie machten sich ans letzte Stück des Weges. Schon bald konnten sie auf einen schmalen Fußpfad einschwenken, der vom Ort herauf kam und wohl hinüber zur Fagana-Siedlung führte. Etwa zu diesem Zeitpunkt zügelte der voran reitende Rodoin sein Tier abrupt und deutete nach Osten, hinüber zur jenseitigen Hügelkette.
Fulcko musste erneut die Augen zusammenkneifen, denn die Sonne stand zu dieser Jahreszeit noch nicht besonders hoch und blendete. Aber dennoch konnte er einen einzelnen Punkt erkennen, der sich ziemlich rasch bewegte: ein Reiter. Und kein schlechter offenbar, denn er preschte im versammelten Galopp zwischen den Bäumen hervor, die auch auf den Hügeln gegenüber immer lockerer standen, je weiter abwärts es ging. Bei genauerem Hinsehen gab es offenbar hinter einer dünnen Reihe Bäume sogar einen Weg, der auf der anderen Talseite auf der Hügelkuppe entlang führte.
»Ist das da oben eine alte Straße der Römer?«, fragte Wulfbert prompt.
»Es muss wohl die sein, die nach Mosabyrga geht«, gab Rodoin Bescheid. Aber Fulcko sah, dass er mit den Gedanken woanders und mit den Augen noch immer bei dem einzelnen Reiter war, der inzwischen den Fuß des Hügels erreicht hatte, sein Tier leicht und elegant auf der Hinterhand wendete und den Hügel mit beinahe derselben Geschwindigkeit wieder hinauf preschte. Fulckos Onkel war mit den Jahren schon etwas weitsichtig geworden. Möglicherweise konnte er einfach etwas mehr erkennen als sein Neffe. Seltsam war das Verhalten dieses Reiters jedenfalls. Aber vielleicht wollte er auch nur das Pferd ein wenig bewegen.
Während sie langsam weiter auf die Palisaden von Ardeoingas zu ritten, tauchte auf der anderen Seite der Reiter wieder zwischen den Bäumen auf, an derselben Stelle wie vorher, aber diesmal etwas langsamer. Dort lief anscheinend ein Fußpfad von der Römerstraße weg quer über den Hang hinunter zur Ortschaft. Fulcko glaubte fast, das ungeduldige Tänzeln des Pferdes sehen zu können, als sein Herr es diesmal so hart am Zügel nahm. Und jetzt konnte er auch erkennen, was Herr Rodoin wohl schon vorher bemerkt hatte: Der Reiter war nicht allein. Neben und hinter ihm stapfte eine kleine Gruppe von Leuten zu Fuß, die er vorher, bei dem übermütigen Galopp den Hang hinunter und wieder hinauf, hinter sich zurückgelassen hatte. Die Gruppe war ganz offensichtlich ebenfalls nach dem Ort unterwegs, nur eben von Osten, während die Franken selbst von Südwesten her kamen. Für eine Weile verloren sie den anderen Trupp aus den Augen, als er den Fuß des Hügels erreicht hatte und hinter einer Baumgruppe verschwand.
Je näher die Franken dem Ort kamen, desto mehr wurden die Neuankömmlinge zum Gegenstand allgemeinen Interesses. Als erste kamen die Hunde, braun- und schwarzscheckige, zottige Kläffer, die die Reiter mit lautem Gebell umrundeten, bald schwanzwedelnd, bald knurrend, als könnten sie sich noch nicht recht entscheiden, inwieweit man diese Fremden als Freunde oder Feinde behandeln solle. Auf den Gemüsebeeten vor dem Palisadenzaun richteten sich Männer und Frauen in braunen Arbeitskitteln über ihren kleinen Feldhacken auf und musterten die fränkischen Reiter ähnlich misstrauisch von weitem. Kinder, die auf den Grasflächen in Ufernähe Kühe und in den Gehölzen braun gefleckte Schweine hüteten, sprangen von ihren Posten auf und liefen den Reitern auf bloßen Füßen entgegen, bis sie von ihren Eltern in barschem Tonfall wieder an die Arbeit geschickt wurden. Der Geruch der Holzfeuer, der von den Feuerstellen aus den Häusern herüberwehte, mischte sich mit dem der Mistgruben. Es gab zwar ein zweiflügeliges Tor in den Palisaden, aber es war unbewacht und stand weit offen.
Das herzogliche Gut, das gleich hinter dem Tor begann, hatte noch einmal seinen eigenen Palisadenzaun innerhalb der Verschanzung. Auch hier schien es allerdings nirgendwo Wachmannschaften zu geben. Die Hütten in der Nähe blickten mit dem Eingang fast alle nach dem First des großen Herrenhauses hin. Wahrscheinlich waren es die Behausungen der Unfreien, bis auf ein ziemlich großes Gebäude ganz in der Nähe des Tores, das Fulcko mit Kennerblick sofort als Taverne einstufte. Am herzoglichen Gut vorbei und zwischen den Hütten hindurch führte ein Trampelpfad zu einem Hain aus alten Eichen, der die Zeit möglicherweise noch aus heidnischen Tagen überdauert hatte, und weiter zu einem Steg, den man aus fest verzurrten Holzbohlen über den Fluss errichtet hatte.
Auf einer kleinen Anhöhe am jenseitigen Ufer lag die Kirche. Sie war nicht viel größer als die Eigenkirche Rassos in Itzilinga, verfügte aber sogar über den Luxus eines turmartigen Aufsatzes auf dem Reetdach, in dem eine kleine Glocke baumelte. Später sollte Fulcko sehen, dass es in der Nähe der Kirche sogar noch ein zweites Schankhaus gab. Das war schon alleine insofern wichtig, als es bedeutete, dass Fulcko und Hartger einander beim Trinken aus dem Weg gehen konnten.
Auch im Inneren der Palisaden stockte alle Bewegung, als man die Franken bemerkte. Ein Schmied ließ den Hammer neben die Feuerstelle sinken, eine Frau mit unter dem Kopftuch zusammengebundenen Haaren, die auf einer Bank im Freien ihr Kind stillte, ging hastig ins Innere ihrer Behausung und kam mit einem bärtigen Mann zurück, der den Trupp argwöhnisch beäugte. Gelegentlich rief jemand den Reitern einen zögernden Gruß zu, den Rodoin aber nicht beachtete. Er ritt auf geradem Weg zum Tor des Herzogsgutes, ohne nach links und rechts zu sehen. Die Torflügel standen bereits offen, und es war nicht schwer zu erraten, für wen man sie geöffnet hatte: Die Gruppe mit dem einzelnen Reiter, die die Franken unterwegs beobachtet hatten, hatte den Hof offenbar ganz knapp vor ihnen erreicht. Rodoin zügelte sein Pferd unmittelbar hinter dem Tor, so dass er und seine Leute den Ausgang versperrten, und die beiden Gruppen beäugten einander stumm.
Fünf Männer standen im Innenhof vor dem Eingang des großen Herrenhauses, gegenüber dem Stallgebäude. Auch der Reiter war anscheinend bereits abgestiegen. Wahrscheinlich war es derselbe, der das Pferd, einen temperamentvollen Fuchshengst mit zwei weißen Stiefeln und breiter Blesse, kostbar gesattelt und aufgezäumt, noch immer am Zügel hielt. Fulcko beachtete den Mann freilich anfangs nicht weiter, denn einer seiner Gefährten stellte ihn, was die äußere Erscheinung anging, ziemlich in den Schatten. Es war einer von denen, die den Weg zu Fuß gegangen waren, seinen schlammbedeckten Schuhen nach, ein noch ganz junger Bursche, kaum viel älter als Fulcko und auch nicht viel kleiner. Eine so sauber gearbeitete Tunika aus so leuchtend blauem Wollstoff, verziert mit so teuren Webborten, und Gürtelbeschläge von einer Qualität wie die, die dieser Kerl trug, hätte Fulcko sich freilich nicht einmal im Traum leisten können. Bewaffnet war der Baier nicht, wenn man das abgegriffene Arbeitsmesser an seinem Gürtel (dessen Griff aber tatsächlich mit Silber tauschiert war - Fulcko musste zweimal hinsehen, bevor er es glaubte) nicht als Waffe zählen wollte.





























