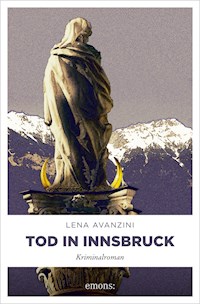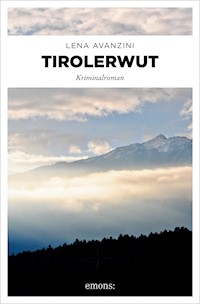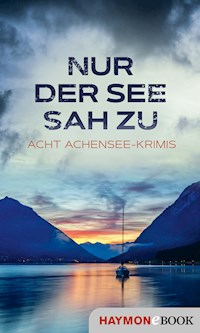Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Carla-Bukowski-Krimi
- Sprache: Deutsch
MORDALARM IN DER REHA-KLINIK Unglaublich, aber wahr: Das Verbrechen macht Pause und Carla Bukowski ist verliebt! Nach der Aufklärung eines Gattenmordes herrscht im LKA Wien Flaute. Zeit also für Bukowski, sich um den Sohn ihres Fast-Verlobten Leon Ritter zu kümmern. Leon, ein Journalist mit Spürsinn für die ganz großen Geschichten, kuriert nämlich seinen Bandscheibenvorfall in der Reha-Klinik am Walderberg aus. Doch das Glück ist ein Vogerl ... Leon wittert einen Betrugsskandal in der Reha-Einrichtung und verschafft sich Zugang zu den Büroräumen. Nicht ganz legal, natürlich, und leider auch nicht unbeobachtet. Am nächsten Morgen ist er tot. VON LIEBE, BETRUG UND MENSCHLICHEN ABGRÜNDEN Hängt Leons Tod mit dem vermeintlichen Selbstmord einer Reha-Patientin zusammen, den er für Mord hielt? Was hat es mit der "weißen Frau" auf sich, die lautlos durch die Gänge schleicht und dabei Shakespeare zitiert? Und welche Rolle spielt der ärztliche Leiter, der zu seinen Patientinnen mehr als ein professionelles Verhältnis pflegt? Ohne Rücksicht auf Verluste stürzt sich Bukowski in die Ermittlungen und gerät dabei selbst ins Visier des Mörders ... Lena Avanzini liefert einmal mehr einen elektrisierenden Kriminalroman und entlarvt Seite für Seite, wozu eine gekränkte Seele fähig ist. "Ich liebe Lena Avanzinis Krimis: Weil sie ausgezeichnet schreiben kann und es ihr gelingt, die Spannung auf jeder Seite zu steigern." "Lena Avanzini lässt in ihren Krimis auf mitreißende Weise in menschliche Abgründe blicken." "Ein hervorragend aufgebauter Krimi. Und ein Motiv, das sich erst auf den letzten Seiten herauskristallisiert." ********************************************** Bisher ermittelte Carla Bukowski in: Nie wieder sollst du lügen
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 407
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lena Avanzini
Auf sanften Schwingen kommt der Tod
Carla Bukowskis zweiter Fall
Komm, großer schwarzer Vogel,
Jetzt wär’s grad günstig!
Die anderen da im Zimmer schlafen fest
Und wenn wir ganz leise sind,
Hört uns die Schwester nicht?
Ludwig Hirsch
1
31. März
„Sie haben also …“ Die Silben wurden von den nackten Wänden zurückgeworfen und hallten unheimlich nach. Bukowski zuckte zusammen. Es gab keinen Grund mehr, zu schreien. Das Gewitter war weitergezogen. Wie auf Knopfdruck hatte der Regen sein Geprassel eingestellt, bis auf letzte Tropfen, die in unregelmäßigen Abständen an die Fensterscheiben klopften. Sanft. Beinahe versöhnlich.
„Sie haben also nichts gehört?“, fragte sie leiser.
Die Fian schüttelte den Kopf – eine Bewegung, die lediglich in einer leichten Erschütterung ihres Doppelkinns sichtbar wurde. Im Übrigen schwieg die Gute. Stille senkte sich über den Befragungsraum, wurde nur durch ein Knistern unterbrochen, wenn Manni mit der Hand über sein unrasiertes Kinn rieb.
Sehnsüchtig schielte Bukowski in ihren Kaffeebecher. Leer. Mit einer knappen Geste signalisierte sie ihrem Kollegen, dass er Nachschub organisieren sollte, fügte mit einem Augenaufschlag ein „Bitte“ hinzu. Aber Revierinspektor Manfred Pribil begriff nicht oder wollte nicht begreifen.
Sie wischte sich mit dem Ärmel über die Stirn. Die Schwüle der vergangenen Tage staute sich in den vier Wänden, deren Fenster sich nicht öffnen ließen. Die Klimaanlage funktionierte nicht, es war stickig. Bukowski sehnte sich nach kühler, vom ersten Frühlingsgewitter gereinigter Luft. Und nach einer Zigarette, mit der sie diese Luft verpesten konnte. Seit fast drei Stunden versuchte sie nun schon, Marianne Fian ein Geständnis zu entlocken. Erfolglos. Die Sechsundvierzigjährige erwies sich als tougher als gedacht. Zuckte nicht mit den Wimpern. Schwitzte nicht. Begehrte weder zu essen noch zu trinken, wollte niemanden anrufen, verlangte keinen juristischen Beistand. Unbeweglich saß sie am Tisch wie eine Kugel – eine kleine, schwarze Kugel – und ruhte in sich. Mit einer Selbstsicherheit, die an Abgebrühtheit grenzte. Oder war sie nur über die Maßen gleichgültig?
Bukowski musterte das kreisrunde Gesicht ihres Gegenübers. Hohe Stirn, kurzer Pony, regelmäßige Gesichtszüge, auffallende Blässe. Eine Blässe, die nicht das Ergebnis eines Schocks war, sondern sich einem hellen Make-up verdankte. Einem perfekten Make-up, das neben Hautunebenheiten, Pigmentflecken und roten Äderchen auch Emotionen aller Art kaschierte.
Bukowski griff nach ihrem Tablet und schaute sich die Tatortfotos an. Herbert Fian, ein Mittfünfziger mit sportlicher Figur und markanten Gesichtszügen, war ein attraktiver Mann, wenn man von der Blutlache absah, die sich unter seinem Leichnam ausgebreitet hatte. Sie vergrößerte die zerschnittene Hand des Toten und zeigte Marianne Fian den Ausschnitt.
„Sehen Sie die Abwehrverletzungen? Es hat einen Kampf gegeben. Geschirr ist zu Bruch gegangen. Vermutlich hat Ihr Mann geschrien.“ Dreizehn Messerstiche. Keiner hatte ein lebenswichtiges Organ getroffen. Herbert Fian konnte sich noch von der Küche ins Wohnzimmer schleppen. Bis zum Couchtisch, auf dem sein Handy lag. Es gelang ihm, einen Notruf abzusetzen. Bevor der Notarzt eintraf, war er jedoch verblutet. „Und Sie wollen nichts gehört haben? Obwohl Sie nebenan im Schlafzimmer waren, nur durch eine dünne Wand getrennt?“ Lächerlich. Die herbeigerufene Polizeistreife hatte die Fian in ihrem Bett angetroffen. Fertig gekleidet und geschminkt. Perfekt geschminkt! Bukowski fragte sich, wann sie dafür Zeit gefunden hatte. Zwischen Notruf und dem Eintreffen der Kollegen? Oder bevor sie zugestochen hatte?
„Ich habe geschlafen“, sagte die Fian, den Blick starr auf das Foto gerichtet.
Bukowski konnte keine Regung in den Rosinenaugen erkennen. Nur die Lüge, die sich hinter die dunklen Sprenkel der Iris duckte. Ich muss eine härtere Gangart anschlagen, dachte sie. Der Nachmittag zerrann ihr unter den Fingern. Dass Marianne Fian ihren Mann erstochen hatte, war klar wie der Enzianschnaps, den Bukowskis Oma früher selbst gebrannt hatte. Nur die Beweise fehlten. Bis jetzt hatten sie nichts, was einen Richter dazu veranlassen würde, die Untersuchungshaft zu verhängen. Womöglich mussten sie die Fian ziehen lassen, dringender Tatverdacht hin oder her. Ein Geständnis würde alles erleichtern. Außerdem würde es Bukowski einen frühen Feierabend bescheren. Die Zeit für ein ausgiebiges Telefonat mit Leon. Seine Entlassung aus dem Krankenhaus stand bevor und schon übermorgen würde sie ihn sehen. Zum ersten Mal nach seiner Bandscheibenoperation. Bevor sie es verhindern konnte, huschte ein Lächeln über ihre Lippen.
Marianne Fian bezog es auf sich und lächelte zurück. „Ohropax“, sagte sie und strich sich eine Strähne ihres rabenschwarzen Bobs hinters Ohr.
„Wie bitte?“
„Ich schlafe immer mit diesen Wachsdingern. Weil Herbert so schnarcht.“ Wieder das Lächeln. Die vollen Lippen teilten sich, gaben zwei Reihen perlenförmiger Zähne frei, die im überschießenden Zahnfleisch fast versanken. An Marianne Fian war alles üppig, sogar die Innenausstattung ihres Mundes. Ihr Fleisch quoll aus der Form wie Hefeteig. Zwei eingesunkene Rosinen die Augen, eine goldene Einschnürung der Ehering, eingebackener Hagelzucker die Zähne. Noch während Bukowski an Hagelzucker dachte, bröckelte das Lächeln der Fian, die Lippen schlossen sich. „Geschnarcht hat“, korrigierte sie sich, als wäre ihr gerade erst aufgefallen, dass ihr Mann keine störenden Geräusche mehr machen würde. Nie mehr.
„Ohropax also“, sagte Bukowski. Sie erkannte, dass sie so nicht weiterkam und beschloss, auf Zeit zu spielen. Eine tickende Uhr in Kombination mit nagelkauender Ungewissheit war immer noch die effektivste Zermürbungsmethode. Effektiver als ein Fragemarathon, die Guter-Bulle-böser-Bulle-Taktik, falsche Versprechungen oder gar Drohungen. Und absolut legal. Tatverdächtige mussten zwar „ohne unnötigen Aufschub“ einem Richter vorgeführt werden, so stand es in der Strafprozessordnung – spätestens achtundvierzig Stunden nach der Festnahme. Aber achtundvierzig Stunden konnten verdammt lang sein.
„Pause“, sagte Bukowski und rauschte hinaus. Manni folgte ihr auf dem Fuß, Dankbarkeit im Blick. Er bot an, Pizza zu organisieren. Sie setzte sich währenddessen auf den Mauervorsprung im Hof und rauchte, bis Manni mit dem verspäteten Mittagessen zurückkam.
In ihrem gemeinsamen Büro gingen sie noch einmal alles durch, was Kollegin Amalie Franz seit dem Morgen an Fakten zusammengetragen hatte.
„Wusstest du, dass die Fian eine angesagte Fotografin ist?“, fragte Bukowski.
Manni zuckte mit den Schultern. Seine Aufmerksamkeit galt den Peperoni, die er von seiner Pizza genascht hatte und deren Schärfe ihm Schweißtropfen auf die Stirn trieb.
„Hat sich vor gut zwei Jahren selbständig gemacht, mit großem Erfolg. Was glaubst du, auf welche Art von Fotos sie sich spezialisiert hat?“
„Erotikshootings?“
Die Akne auf Mannis Wangen erblühte wie die Königin der Rosen. Aber das kann natürlich auch an der Pizza Diavolo liegen, dachte Bukowski und grinste. „Ganz falsch. Scheidungsfotos, stell dir vor!“
Während die meisten Fotostudios das übliche Repertoire von Pass-, Bewerbungs-, Hochzeits-, Babybauch- bis Familienbildern anboten, setzte Marianne Fian auf eine Sparte, von der Bukowski noch nie zuvor gehört hatte. Die aber in der Luft liegen musste, wenn man die steile Erfolgskurve der Jungunternehmerin richtig interpretierte. In vielen Menschen, vor allem in Frauen – neunzig Prozent von Fians Kunden waren Kundinnen – schlummerte offenbar das Bedürfnis, das Ende eines Lebensabschnitts zu dokumentieren. Sich von ihren Partnern zu trennen, zum Friseur zu gehen und den Beginn des neuen Single-Daseins fotografisch festhalten zu lassen: ernst, trotzig oder lächelnd, mit neuem Haarstyling, einem Glas Prosecco, einer verwelkten Rose oder einem zerrissenen Porträt des Ex in der Hand. Aber auf alle Fälle selbstbewusst.
So selbstbewusst wie die Frau hinter der Kamera, dachte Bukowski. Was als Gag begonnen hatte, bescherte der Fian inzwischen saftige Einnahmen, es hatte ihr den Preis „Innovativste Unternehmerin 2014“ eingetragen und eine Nominierung zur „Frau des Jahres 2015“ der Zeitschrift Hip in Wien.
„Weil Marianne Fian der Scheidung den Nimbus des Prekären nimmt“, zitierte Bukowski aus der Onlineausgabe des Lifestyle-Magazins, „und weil die Geschiedenen in Fians Porträts ihre Verletzlichkeit nicht verstecken, sondern wie ein Banner vor sich hertragen, stolz und unerbittlich. Gerade dadurch wirken sie stärker denn je – gleichsam fröhlich-verspielte Amazonen des 21. Jahrhunderts.“
„Na hawidere“, murmelte Manni und Bukowski war sich nicht sicher, ob die Missbilligung in seiner Stimme Marianne Fian galt, den kameraaffinen Geschiedenen oder der Ausdrucksweise der Artikelschreiberin. „Deine Pizza wird übrigens kalt, Jadis. Rucola mit Schafskäse ist doch deine Lieblingssorte, oder?“
„Köstlich“, sagte Bukowski. Aber obwohl sie hungriger war als sämtliche bösen Hexen von Narnia zusammen, schaffte sie nicht mehr als zwei Bissen. Vielleicht weil sie heute Morgen das Frühstück erbrochen hatte. Oder weil ihr die stagnierende Vernehmung auf den Magen schlug. „Glaubst du, Marianne Fian sieht sich selbst auch als Amazone? Hat sie es deshalb vorgezogen, ihren Ehemann zu erstechen, anstatt die Scheidung einzureichen wie Susi Musterfrau?“
„Vielleicht hatte sie einfach alles satt. Apropos satt … Wenn du nichts mehr … ich meine …“ Manni schielte auf Bukowskis Pizzakarton.
Sie schob den Karton über den Tisch. „Klar, hau rein! Was soll die Fian sattgehabt haben?“
„Die ewigen Streitereien. Die Eifersuchtsanfälle ihres Mannes, die Schreiduelle.“ Manni befreite Bukowskis angebissenes Pizzastück vom Grünzeug, rollte es zusammen und verschlang es in Rekordzeit.
„Woher weißt du das?“
„Von Oschkar.“ Er schluckte und wischte sich mit dem Ärmel über den Mund. „Er hat die Nachbarn befragt. Und alle behaupten, Herbert Fian sei ein rechthaberisches, besitzergreifendes Arschloch gewesen. Außerdem rasend eifersüchtig. Mit Marianne soll er fast täglich gestritten haben, aber auch mit seinem Sohn und mit dem jungen Arbeitslosen, der über den Fians wohnt. Ein gewisser Willi Hinterholzer.“
„Aber sowohl der Sohn als auch der Hinterholzer haben ein Alibi, richtig?“, riet Bukowski.
„Du hast es erfasst. Der Sohn lebt seit einem halben Jahr mit seiner Freundin in Floridsdorf. Zur Tatzeit hat er Kaffee gekocht, was die Freundin bestätigt. Der Hinterholzer ist mit zwei Kumpels unterwegs gewesen. Auch sein Alibi hat Oskar überprüft.“
Bukowski legte den Finger in das Grübchen an ihrer Nase, das ihr immer beim Nachdenken half. „Ich frage mich, ob Herbert Fian einen Grund hatte, so eifersüchtig zu sein. Hat Oskar diesbezüglich schon was herausgefunden? Wo steckt er eigentlich?“
„Ist nach Sankt Blödsinn gefahren, um irgendwas zu checken“, sagte Manni und wischte sich einen Spritzer Tomatenmark vom Kinn. „Kommt sicher bald.“
Und tatsächlich. Keine halbe Stunde später trudelte Chefinspektor Oskar Travnitschek ein und brachte interessante Neuigkeiten aus der niederösterreichischen Landeshauptstadt mit. Die Fian habe im Januar einen Praktikanten engagiert, erzählte er. Einen gewissen Dominik Baldauf. Und nicht nur beruflich habe sie sich seiner angenommen. „Stellt euch vor, die vögelt mit dem! Keine zwanzig ist der Bursche und nicht einmal halb so schwer wie sie!“ Schnaubend riss sich Oskar die Mütze vom Kopf, zog einen Kamm aus der Hosentasche und fuhr damit ein paarmal durchs Haar.
„Ja und?“
„Was heißt ja und? Ihr Sohn ist älter als dieser Baldauf! Das ist doch …“
Bukowski, die den Kollegen trotz ihrer flachen Schuhe um einen Kopf überragte, musste in die Knie gehen, um ihm in die Augen zu sehen. „Weißt du, was ich mich frage?“ Sie musterte Oskar wie ein soeben entdecktes Insekt, von dem man nicht wusste, wie es zu klassifizieren war: Schädling? Harmlos? Sammlungswürdig oder ein Fall für die Fliegenklatsche? „Ob du dich genauso aufregen würdest, wenn Marianne Fian ein Mann wäre. Stell dir vor, der übergewichtige Besitzer eines Fotostudios treibt es mit seiner dreißig Jahre jüngeren, gertenschlanken Angestellten. Würde dann auch Ekel in deiner Stimme mitschwingen? Oder womöglich Bewunderung? Bewunderung mit einem Schuss Neid?“
Oskar sah sie ratlos an. „Wie jetzt … was jetzt?“ Es dauerte, bis der Groschen fiel. „Spinnst du, Carla? Willst du damit sagen, dass ich ein Macho bin?“
Bukowski tätschelte seinen Rücken. „Aber nein, das würde mir nicht im Traum einfallen. Du doch nicht, Ossi! Obwohl … dein Rollenverständnis … hm, also das könnte vielleicht ein klitzekleines Update vertragen. Meinst du nicht?“ Sie lächelte ihn an. „Aber zurück zu diesem milchjungen Praktikanten. Hältst du es für möglich, dass Dominik Baldauf …“
„… unser Mörder ist? Ausgeschlossen. Er war zur Tatzeit in St. Pölten. Ein Familienfest – seine Oma ist siebzig geworden. Nach der Feier haben er und seine zwei Cousins im Wohnzimmer der alten Dame übernachtet. Da wäre er nicht unbemerkt weggekommen.“
„Gut“, sagte Bukowski. „Dann wissen wir das. Danke, mein Lieber.“
Bevor Oskar hinausging, warf er ihr einen vorwurfsvollen Blick zu, spuckte das Wort „Rollenverständnis“ aus, als wäre es Gift, und zog sich die Mütze bis über die Brauen.
Manni kicherte. Dann tranken sie miteinander Kaffee. Zwei Espressolängen später hielt Manni es nicht mehr aus. „Wie lange willst du unsere Verdächtige eigentlich noch schmoren lassen?“
In diesem Moment kam der Anruf von Kriminaltechniker Peter Gruber, genannt Gruber eins. Was er zu berichten hatte, war zwar nur ein Detail, aber ein hochinteressantes.
„Gute Neuigkeiten?“, fragte Manni.
Bukowski reckte den Daumen hoch. „Komm, lass es uns zu Ende bringen.“
Als sie den Befragungsraum betraten, hob Marianne Fian nicht einmal den Kopf. Das Wasserglas stand unberührt am Tisch. Noch immer strahlte sie eine beneidenswerte Ruhe aus. Aber auf den zweiten Blick bemerkte Bukowski, dass die Ruhe aufgesetzt war. Das perfekte Make-up hatte Sprünge bekommen – haarfeine Risse in der porzellanenen Oberfläche.
Bukowski wartete, bis Manni die Kamera aktiviert hatte. Sie trieb ihre Reibeisenstimme in eine höhere Region und schaltete einen rosa Wattefilter dazu. „Frau Fian, bitte entschuldigen Sie die Verzögerung. Sie müssen hungrig sein. Können wir Ihnen etwas bringen? Ein Sandwich vielleicht? Oder mögen Sie lieber Pizza?“
Die Fian schüttelte den Kopf.
„Dann wenigstens einen Kaffee? Unser Espresso ist gar nicht so übel, keine Automatenbrühe wie in den meisten anderen Präsidien, darauf legt unser Chef großen Wert.“
„Danke, ich möchte nichts.“
„Gut, dann lassen Sie mich rekapitulieren. Sie haben geschlafen, mit Ohropax, weshalb Sie nicht mitbekommen haben, dass Ihr Mann gegen halb sechs Uhr morgens erstochen wurde. Mit dreizehn Messerstichen. Erst als zwanzig Minuten später die von ihm alarmierten Polizisten eintrafen und das Schlafzimmer betraten, sind Sie aufgewacht. Zu diesem Zeitpunkt waren Sie allerdings schon angezogen und sogar geschminkt. Tipptopp geschminkt. Finden Sie das nicht merkwürdig?“
„Weil mir nach der Morgentoilette schwindlig geworden ist. Da habe ich mich noch einmal hingelegt und bin eingenickt.“
„Und die ganze Zeit hatten Sie die Wachspfropfen in den Ohren, ja? Nimmt man die nicht raus, wenn man aufsteht?“
„Ja, doch, aber da war der Kampf wohl schon vorbei. Ich habe jedenfalls nichts gehört.“
„Und gesehen auch nicht?“
„Ich bin ja nur kurz ins Bad und wieder zurück ins Schlafzimmer.“
„Im Wohnzimmer und in der Küche waren Sie nicht?“
Marianne Fian schüttelte den Kopf.
„Wie ist dann das Blut auf Ihren Rock gekommen, das die Kollegen von der Kriminaltechnik vor wenigen Minuten als das Blut Ihres Mannes identifiziert haben?“
„Blut? Welches Blut?“
Bukowski schwieg ihr Ich-weiß-was-du-getan-hast-Schweigen.
„Das muss altes Blut sein. Vielleicht weil Herbert …“ Zum ersten Mal veränderte die Fian ihre Sitzposition. Sie rutschte auf ihrem Stuhl hin und her. „Weil er sich einmal beim Rasieren … vor zwei Wochen …“
Bukowski lächelte mild. Sie tätschelte den Handrücken der Fian. Einen weichen, weißen, gut gepolsterten Handrücken, bei dem die Fingerknöchel nicht als Erhebungen sichtbar waren, sondern als Grübchen, wie bei einem Kleinkind. „Sie sehen müde aus, Marianne. Wollen Sie mir nicht sagen, wie es sich wirklich abgespielt hat? Dann wären wir fertig für heute und Sie könnten sich ein bisschen hinlegen.“
Manni hob seine Brauen. Achtung, hieß das. Keine falschen Versprechungen. Die waren nämlich genauso verboten wie Drohungen.
„Ich weiß es nicht“, sagte die Fian. „Wirklich nicht.“
„Dann lassen Sie uns gemeinsam überlegen, wie es passiert sein könnte. Die Wohnungstür war unversehrt. Das heißt, es gibt genau drei Möglichkeiten. Entweder hat Herbert seinen Mörder selbst hereingelassen, so gegen fünf. Wer kommt da wohl in Frage? Der Bäckerjunge, der die Brötchen bringt? Die Zeitungsfrau? Sollen wir das glauben?“ Bukowski pausierte, um die Worte einsickern zu lassen. „Oder der Mörder hatte einen Schlüssel. Wer besitzt einen Schlüssel zu Ihrer Wohnung? Ihr Sohn vielleicht? Ein Nachbar? Ein Freund der Familie? Oder womöglich Ihr junger Lover Dominik Baldauf?“
Marianne Fian öffnete den Mund und schloss ihn wieder, als suche sie nach Worten. Vielleicht schnappte sie auch bloß nach Luft. Zum ersten Mal lag etwas Gehetztes in ihrem Blick und hinter den haarfeinen Sprüngen im Make-up lungerte Angst. Bukowski konnte sie riechen.
„Möglichkeit drei: Der Mörder war schon da. Dann können es wohl nur Sie selbst gewesen sein, Marianne.“
„Ich …“
„Ja? Wollen Sie mir etwas sagen?“
Das Prozedere wiederholte sich: Mundöffnen, Luftschnappen, Mundschließen. Der Augenblick dehnte sich, Sekundenbruchteile fühlten sich an wie Minuten.
Bukowski dachte an Leon, an das bevorstehende Wochenende. Die Vorfreude, die sich von allen Seiten anschlich; die sich nicht mehr lange zurückhalten ließ; die ihr warm über den Rücken rieselte. Reiß dich zusammen, dachte sie. Bring es mit Anstand zu Ende, auch wenn nichts dabei herausschaut. „Wollen Sie eine Pause machen?“ Sie signalisierte Manni, dass er die Kamera ausschalten sollte.
Mannis Zeigefinger bewegte sich zur Stopp-Taste.
„Ich …“
Der Finger zuckte zurück.
Die Fian würgte ein Wort hervor, das Bukowski nicht verstand.
„Wie bitte?“
„Ich habe …“
Und dann gestand Marianne Fian. Einfach so. Als könnte sie nicht anders. Als hätte Bukowski endlich den unter dem Make-up versteckten Schalter entdeckt. Wie auswendig gelernt spulte die Fian den Text ab. Sie habe ihren Mann erstochen, weil sie seine ständigen Beleidigungen wegen ihrer Körperfülle nicht mehr ertragen habe. Er selbst habe sie seit Jahren betrogen, habe sie nicht mehr angerührt, habe ihr dauernd zu verstehen gegeben, wie satt er sie habe. Demütigungen ohne Ende. Und gleichzeitig Eifersucht, weil er von ihrer Affäre mit Baldauf erfahren hatte.
Bukowski atmete auf. Manni atmete auf. Ob Marianne Fian ebenfalls aufatmete, war nicht festzustellen. Sie wurde jedenfalls in die Justizanstalt überstellt und Richterin Langer-Knorr vorgeführt, die die U-Haft verhängte.
„Fall abgeschlossen. Den Bericht schreibe ich morgen“, sagte Bukowski, als Manni und sie vor ihrer Lieblings-Würstelbude am Lerchenfelder Gürtel standen, bei Burenwurst und Bier. Die Wolken, die sich im Norden zusammenbrauten, beachteten sie nicht.
„Bravo, Jadis“, sagte Manni und klopfte Bukowski auf die Schultern. „Eins-a-Vernehmungstaktik. Der Chef wird staunen.“
Ja, dachte sie, das wird er bestimmt. Wenn er morgen wieder ins Büro kommt, wird seine Glatze vor Freude leuchten. Ein Mord, der geklärt war, bevor er Major Hanno Nowak, dem Leiter des LKA Außenstelle West, überhaupt zu Ohren kam, zählte bestimmt zu seinen Lieblingsfällen.
Als Manni den Meidlinger Dialekt des Chefs imitierte, lachte sie ganz entspannt. Sie tranken ein zweites Bier.
Die Übelkeit von vorhin war verflogen, mit Appetit biss Bukowski in ihre Wurst. Wie gut es ihr ging! Wie sie sich auf das Wochenende freute! Auf Leon.
Sakradi, ich habe ja versprochen, ihn anzurufen, fiel ihr ein. Sie verabschiedete sich von Manni und nahm die U6. Von der Station Alser Straße aus lief sie nach Hause. Sie setzte sich aufs Fensterbrett in der Küche, weil man von dort am besten telefonieren konnte. In aller Ruhe, mit einer Zigarette in der Hand.
Leon meldete sich nach dem dritten Klingeln.
„Carla, mein Schatz, endlich! Gut, dass du anrufst.“
„Was ist los? Du klingst geknickt. Hast du immer noch Schmerzen?“
„Schmerzen nicht. Aber dafür ein Problem. Ein ziemliches Problem.“ Das zweite „Problem“ wurde von einem Blitzschlag untermalt. Das Gewitter entlud sich genau über Bukowskis Wohnhaus. In kurzer Abfolge zuckten zwei weitere Blitze über der Sensengasse, gefolgt von durchgehendem Donnergrollen.
Passt gar nicht zur Jahreszeit, dachte sie, während Leon ihr das Problem erklärte. Ein Problem, das eigentlich eine Bitte war. Eine große Bitte.
Natürlich hatte es nichts damit zu tun, dass ihr plötzlich übel wurde, sie das Telefonat abbrechen musste und es gerade noch zur Toilette schaffte. Das musste am zu schnell getrunkenen zweiten Bier liegen, an der fetten Burenwurst oder daran, dass sie sich schon gestern Abend den Magen verdorben hatte.
Sie übergab sich. Danach spülte sie sich den Mund aus und stellte fest, dass es ihr wieder gutging. Ein letzter Blitz erhellte das Badezimmer. Bukowski erhaschte einen Blick auf ihr Gesicht im Spiegel. Es lächelte.
Sie dachte an Leons Bitte, dachte, dass es sich um eine Herausforderung handelte. Aber eine lohnende, ach was, eine wundervolle Herausforderung, sagte sie sich, und draußen setzte wie Applaus der Regen ein.
2
Aus dem Buch der Kränkungen
#4 Sandra
Der Regen ist dichter geworden. Schnüre statt Tropfen. Zwischen den Schnüren der Geruch nach nassem Hund. Und ein Vorgeschmack auf Nebel, tote Blätter, weiße Atemluftwolken.
Dir ist das egal. Du willst nicht warten, ob es vielleicht aufhört. Oder das Rad stehenlassen und ein Taxi rufen. Bloß so schnell wie möglich nach Hause, heiß duschen und in Frotteesocken und Flanellpyjama vor dem Fernseher lungern. Millionenshow. Millionenshowschlaf. Gibt‘s was Besseres nach einem Monstertag wie diesem?
Immerhin hast du schon in aller Früh mit deiner Mutter telefoniert, ohne zu streiten – eine Meisterleistung an Selbstbeherrschung. Du hast es dir nicht nehmen lassen, zur Arbeit zu radeln, hast die vierhundert Höhenmeter auf den Walderberg in einer sportlichen halben Stunde bewältigt. Am Vormittag hast du deine Urlaubsvertreterin eingeschult, an einer Besprechung des Betriebsrats teilgenommen und verschiedene Diätpläne für die nächste Woche erstellt – für deine adipösen Schützlinge, die Diabetiker, die Lactose- und Fructoseintoleranten und die untergewichtige Multiple-Sklerose-Patientin, die an einer unbestätigten Zöliakie leidet. Nachmittags hast du drei persönliche Beratungsgespräche geführt und einen Kochkurs mit Morbus-Parkinson-Patienten abgehalten. Mit den Parkis hast du Kartoffeln geschält, Karotten und Stangensellerie kleingeschnippelt, Petersilie gehackt und eine würzige Suppe zubereitet – alles mit dem ergonomisch geformten Besteck, das extra für diese Klientel entworfen wurde.
Als wäre das nicht genug, hast du deine Kollegin Heidi, die sich an der Achillessehne verletzt hat, beim Nordic-Walking-Kurs der Polyneuropathiker vertreten. Du hast mit deinem neuen Lover im Berggasthof Köll Eierlikörtorte gegessen, mit dem alten in der Cafeteria der Reha-Klinik Tee getrunken, und mit beiden im Pflegeartikellager gevögelt. Natürlich nicht zugleich. Und bestimmt nicht aus rasender Geilheit, sondern bloß, weil dir das Neinsagen so schwerfällt. Dieses kleine Wort, das so hart klingt, so unwiderruflich – du hast dich nie überwinden können, es in deinen Wortschatz aufzunehmen.
Kein Wunder, dass du jetzt müde bist. Du hast es eilig, nach Hause zu kommen. Einmal wegen der dichten Regenschnüre und der schnell heraufziehenden Dämmerung. Zum anderen weil du ahnst, dass hinter deinen Schläfen ein bohrender Kopfschmerz lauert.
Du setzt den Helm auf, schwingst dich auf dein Mountainbike und fährst los. Der Fahrtwind peitscht dir den Regen ins Gesicht, die Schnüre fühlen sich an wie Nadeln. Solange die Straße ansteigt, trittst du kräftig in die Pedale. In der Geraden nimmst du Tempo auf. Dann die Abfahrt.
Die Warntafel, die auf das fünfzehnprozentige Gefälle hinweist, beachtest du nicht, du kennst die Strecke in- und auswendig und preschst bergab. Legst dich in die erste Kurve. Bemerkst, dass dir mulmig ist. Schiebst die plötzliche Übelkeit auf die üppige Eierlikörtorte, weil du dir nichts anderes vorstellen kannst. Wer würde auch so misstrauisch sein und an K.o.-Tropfen denken?
Die Xenonscheinwerfer eines entgegenkommenden Autos blenden dich. Du erschrickst, verreißt den Lenker, hast Mühe, die Balance zu halten, bremst ab und fährst langsamer weiter.
Dann erwacht der Kopfschmerz. Von den Schläfen ausgehend schraubt er sich ins Schädelinnere. Vor der scharfen Linkskurve erfasst dich Schwindel. Der Asphalt scheint sich an den Rändern emporzuwölben.
Du würgst, lässt im Reflex beide Bremshebel los, anstatt sie stärker anzuziehen. Das Rad nimmt Fahrt auf, als hätte es nur auf diesen Augenblick gewartet. Immer schneller rast es auf die Leitschiene zu. Sein Vorderreifen bohrt sich in das Hindernis. Du wirst in hohem Bogen aus dem Sattel katapultiert, gleichzeitig entleert sich dein Magen.
Du fliegst. Fliegst und die Zeit steht still. Wie ein Zelt aus Flicken in verschiedenen Grautönen spannt sich der Himmel über die Szenerie. An einer Seite klafft ein Riss, durch den ein blasser Mond quillt.
Vollmond, denkst du, während du wie in Zeitlupe über die Böschung segelst, und du denkst, dass das Mondgesicht krank aussieht; dass du ihm eine Diät verordnen müsstest: kein Alkohol, dafür Tee aus Mariendistelsamen und Artischockensaft, um die Leber zu stärken. Du fliegst noch immer, fliegst an einem mageren Obstbäumchen vorbei, näherst dich endlich dem Boden. Kannst jeden Grashalm erkennen, Blumen, die einmal gelb geblüht haben müssen, den Scherhaufen einer Wühlmaus. Kurz vor dem Aufprall fällt dir das mit dem Kreis auf: Er schließt sich, denkst du. Denn bei Vollmond hast du das Licht der Welt erblickt und bei Vollmond wird dein Lebenslicht verlöschen.
Mit der Schulter voran schlägst du in der Wiese auf. Es knirscht, der Schmerz explodiert, du tauchst in eine sumpfige Brühe und versinkst.
Aber du versinkst nicht ganz. Es gelingt dir, den Kopf über der morastigen Oberfläche zu halten. Trotz des pulsierenden Schmerzes in der Schulter nimmst du den Geruch wahr: nach Erde, nach nassem Gras, Moos und Regen. Nach etwas Metallischem. Das wird Blut sein, denkst du, mein Blut. Es freut dich, dass dein Kopf funktioniert, dass er riechen und denken kann. Nur der Versuch, um Hilfe zu rufen, misslingt. Über deine Lippen kommt kein Laut, der in der Lage wäre, das Rauschen des Regens zu übertönen.
Und doch wirst du gehört. Es nähern sich Schritte.
Du öffnest die Augen, blinzelst die klebrige Flüssigkeit weg, die von deiner Braue tröpfelt; fokussierst den Blick auf den Mann, der über die Böschung geklettert ist, zu dir herunterrutscht und sich über dich beugt. Er kommt dir bekannt vor, aber es will dir nicht einfallen, wer er ist.
„Hilf mir“, hauchst du. Versuchst, dich zu erinnern.
Er nähert sein Gesicht und lächelt. Und jetzt, jetzt erkennst du ihn. Am Lächeln und an der zärtlichen Geste, mit der er seine Linke an deinen Fahrradhelm legt und mit der Rechten dein Kinn umfasst.
Du denkst, dass du Glück im Unglück gehabt hast; dass du nun doch nicht bei Vollmond sterben wirst, zumindest nicht bei diesem Vollmond. Du suchst seinen Blick, in dem etwas Fremdes flackert. Etwas an diesem Blick ist anders, denkst du und bist verwirrt. Aber du hältst dich an die vertrauten Gebärden und trotz der Schmerzen gelingt es dir, ihn anzulächeln.
Als er mit einem plötzlichen Ruck deinen Kopf verdreht, so kraftvoll und effizient, als hätte er sein Leben lang geübt, anderer Menschen Genick zu brechen, bleibt dir keine Zeit mehr, dein Lächeln zu widerrufen. Es begleitet dich in den Tod.
Ein Lächeln wie ein Kuss, der die schwere Süße von Honig atmet und die feine Bitterkeit von Salbei.
Im Namen des Honigs und des Salbeis, Sandra, ich vergebe dir.
Gelöscht am 14. September 2015
3
1. April
Er durchwühlte die oberste Schreibtischschublade und staunte über den Müll, der sich angesammelt hatte – ein angeschnäuztes Taschentuch, ein verbogener USB-Stick, ein Wecker, den ausgelaufene Batteriesäure zerstört hatte, ein mit einem Fettfleck verziertes Ansuchen um Zuerkennung eines Bildungszuschusses; fand nicht, was er suchte; fand es schließlich doch, unter dem Formular. Mit einem Ruck riss er den Beutel auf und saugte ihn aus. Die Suspension schmeckte nach Minze und linderte sein Sodbrennen sofort.
Befreit lehnte Nowak sich zurück. Trotzdem, er würde etwas ändern müssen, wenn er nicht mit Magenkrebs enden wollte wie sein Vater. Weniger Kaffee, dachte er. Oder überhaupt aufhören damit. Vielleicht wäre es angebracht, Kims Rat zu befolgen und es mit Käsepappeltee zu versuchen. Zumindest für ein, zwei Wochen?
Kim, dachte er und rang die Hände. Natürlich war ihm klar, dass nicht so sehr der Kaffee an seinem übersäuerten Magen schuld war, sondern vielmehr der Streit. Der Streit in erster Linie. Warum hatte er sein geliebtes Eheweib provozieren müssen? Weil sie ihre Unabhängigkeit liebte? Ihre eigenen Interessen verfolgte? War er nicht gerade deshalb stolz auf sie? Und sollte er nicht froh sein, dass sie mit seinem Beruf, seinen Überstunden, den Dienstreisen leben konnte? Die erste Frau, die es ihm nicht vorwarf, wenn er später als vereinbart nach Hause kam! Aber er, er hatte den Spieß umgedreht und gezickt, weil sie zu Pfingsten eine Ausbildung zur Reinkarnationstherapeutin machen wollte anstatt mit ihm wegzufahren.
„Na bravo!“, sagte Nowak laut und hieb seine Faust auf den Schreibtisch. Er betrachtete die Umrisse seines Kopfes, der sich im dunklen Computerbildschirm spiegelte. Hatte er sich verändert? Prüfend fuhr er über seine Glatze. Nein, nein. Eigentlich sah er immer noch passabel aus. Klar, er war nicht mehr der coole Hund von vor zehn Jahren, aber so spießig, wie er sich gerade fühlte, war er längst nicht. „Oder?“, fragte er sein Spiegelbild. „Oder?“
Ein dreifaches Klopfen riss ihn aus der kontemplativen Versenkung. Carla Bukowski trat ein, forsch wie immer, aber geschmeidigen Schrittes.
Nowak wischte die grüblerischen Gedanken weg und begrüßte sie mit Applaus. Den Hauch von Pink, der auf ihren Wangen erblühte, registrierte er mit Genuss. Typisch Carla, dachte er. Einerseits freute sie sich über sein Lob, andererseits war ihr diese Freude peinlich.
„Schwein gehabt“, winkte sie ab. „Genauso gut hätte Marianne Fian weiter schweigen können. Oder behaupten, dass sie es nicht war. Das bisschen Blut an ihren Kleidern hätte für eine Inhaftierung nicht ausgereicht.“
„Aber so war es nicht. Und das ist dein Verdienst, Carla. Manni hat deine Befragungstaktik jedenfalls in den höchsten Tönen gelobt.“ Und er, Nowak, hatte nicht schlecht gestaunt, als er heute Morgen ins Büro gekommen war, nach einem viertägigen Führungskräftelehrgang zum Thema „Kommunikation und Konfliktmanagement“, und weder von dem aktuellen Mordfall gewusst hatte, noch davon, dass er ihn bereits abhaken durfte.
Carla antwortete nicht. Sie hatte ihm den Rücken zugekehrt und schaute aus dem Fenster, als gäbe es in der Ottakringer Straße etwas Interessantes zu sehen. Vermutlich wollte sie nur abwarten, bis sich der Flush auf ihren Wangen wieder in die übliche Blässe zurückverwandelt hatte.
„Jedenfalls hast du den Fall in Rekordzeit gelöst.“
„Wir“, korrigierte sie. „Oskar und Mali haben viel mehr dazu beigetragen als Manni und ich. Das war Teamwork vom Feinsten. Und dass die Vernehmung nach einem zähen Beginn doch noch glatt gelaufen ist, war wie gesagt Glück.“
Stur, sturer, Bukowski, dachte er und grinste. Als sie sich zu ihm umdrehte, fiel ihm auf, dass ihre Wangen immer noch rosig schimmerten. Es handelte sich also nicht um eine gefühlsbedingte Gesichtsrötung, sondern um etwas weit Sensationelleres: Gruppeninspektorin Carla Bukowski ging es gut! Es ging ihr besser denn je. Es musste ihr gut gehen, denn seit Jahren hatte sie nicht so gesund ausgesehen.
„Hast du zugenommen?“, platzte es aus ihm heraus, bevor er sich klarmachen konnte, dass ihm die Frage in puncto „Courtoisie im Umgang mit MitarbeiterInnen“ keinen Stern eintragen würde.
Dementsprechend verwundert starrte sie ihn an. „Seit wann kümmerst du dich um das Gewicht deiner Untertanen?“
„Steht dir“, knurrte er und dachte, dass es gern noch ein paar Kilo mehr sein durften. Dass sie immer noch überaus schlank war, aber zumindest nicht mehr so klapperdürr wie nach ihrem Nervenzusammenbruch und den unbefugten Ermittlungen im Burgenland. War das wirklich schon anderthalb Jahre her? „Ich soll dich übrigens von Kim grüßen. Und fragen, ob du am Wochenende zu uns kommen magst. Es gibt Schweinsbraten.“ Zumindest hatten Kim und er das vor dem heutigen Streit vereinbart. Er konnte nur hoffen, dass sein Honeybunny es sich nicht anders überlegen würde. Aber das würde sie nicht, denn Carla war ihre beste Freundin. Die Chance, sie zu bekochen, würde Kim sich nicht entgehen lassen.
„Mit Kruste?“
„Was denn sonst?“
„Das klingt wirklich verlockend, aber …“
„Ein Mangalitza-Wollschweinderl von Kims Haus- und Hofmetzger in Pamhagen. Mit viel Kümmel …“
„Köstlich, aber ich …“
„… und noch mehr Knoblauch. Liebevoll mit dunklem Ottakringer übergossen.“ Er küsste seine Fingerspitzen.
„Ich wollte aber …“
„Du kannst deinen Leo gern mitbringen. Höchste Zeit, dass ich ihn auch endlich kennenlerne.“ Er war wirklich neugierig auf Carlas Lover. Den Mann, der offensichtlich schuld an ihrem Wohlbefinden war. Er wusste nur, dass er Journalist war und in Gmunden lebte. Und dass die beiden sich in Eisenstadt kennengelernt hatten, und zwar ausgerechnet bei den Barmherzigen Brüdern. Als Carla nach ihren eigenmächtigen Ermittlungen mit einer gebrochenen Nase, einer Stichwunde und einer Gehirnerschütterung im Krankenhaus gelandet war. Im Sommer 2014, jenem denkwürdigen Sommer, in dem er auch Kim kennen- und lieben gelernt hatte. Damit hatte für ihn eine Phase privaten Glücks begonnen, die er insgeheim seiner widerborstigen, dickköpfigen, aber im Innersten gutherzigen Gruppeninspektorin verdankte. „Also, kommt ihr?“
„Er heißt Leon. Und danke für die Einladung, aber ihr müsst euren grandiosen Schweinsbraten leider ohne uns verdrücken. Weil ich noch heute Abend nach Gmunden fahren wollte. Für vier Wochen. Das heißt natürlich nur, falls du den Urlaub genehmigst.“
Logisch genehmigte er, was denn sonst? Wie hätte er Carla diese Bitte abschlagen können? Zumal er sie wirklich mochte und vor Jahren selbst einmal mit ihr … Schwamm drüber. Er erbat sich einen schriftlichen Bericht über den Mordfall Fian. Danach sollte sie packen und ihren angesammelten Urlaub aufbrauchen. Er vergönnte es ihr. Und sie hatte ja einen guten Grund. Sie erzählte, dass Leon nach einer Bandscheiben-OP noch immer unter Gangstörungen leide und eine mehrwöchige Rehabilitation antreten müsse. Weil Leons Mutter sich außerstande fühle, so lange auf seinen Sohn aufzupassen, und weil Leons Exfrau Alkoholikerin sei und nicht vertrauenswürdig, habe sie, Carla, versprochen, den Jungen zu betreuen. Den kleinen Noah.
Ein schöner Zug von ihr, dachte Nowak, nachdem sie gegangen war. Und ein Zeichen, dass es ihr ernst war mit diesem Leon. Als ihr Chef und Freund wollte er das nach Kräften unterstützen. Seine Berufsgruppe hatte es in Sachen Beziehung eh so schwer! Die Scheidungsrate war erschreckend hoch. Er selbst war bereits zweimal geschieden, Oskar einmal. Mali hatte sich kürzlich getrennt, Hinnerk kam über dreiwöchige Affären selten hinaus und Manni fand überhaupt keine Partnerin. Umso mehr wünschte er sich, dass Carla und Leon miteinander glücklich werden sollten. So wie er und Kim. Ja, das wünschte er sich. Verdammt, das wünschte er sich wirklich!
Blumen, dachte er. Heute Abend werde ich Kim ein riesiges Gebüsch mitbringen. Dunkelrote, langstielige Rosen natürlich. Und ich werde ihr sagen, wie stolz ich auf sie bin. Und dass sie sich um Himmels willen für dieses Reinkarnationsdings anmelden soll.
Er strich sich ein paarmal über seine Glatze. Ertappte sich dabei, breit zu grinsen. Betrachtete noch einmal sein Gesicht im Bildschirm. Teufel auch, du bist ja ein Romantiker, dachte er. Ein ehemals cooler, unter der Oberfläche erschreckend konservativer Bulle mit Hang zum Kitsch. Und fuhr rasch den Computer hoch, um sich vom Anblick seines gespiegelten Quadratschädels zu befreien.
4
4. April
Die Sonne hatte die Wolkenschicht durchbrochen und tauchte die Esplanade in ein goldenes Licht. Als die Gepiercte den Espresso über die Theke schob, fühlte Bukowski sich wie eine Eidechse, die aus der Winterstarre erwacht war und sich der ersten Fliege gegenübersah. Gierig schnappte sie die Tasse und kippte das schwarze Gebräu hinunter, als wäre es lebensnotwendige Medizin. War es ja auch. Sie bestellte sofort Nachschub. „Aber diesmal einen doppelten, bitte.“ Dann zündete sie sich eine Zigarette an. Die erste für heute, und das mitten am Nachmittag, dachte sie nicht ohne Stolz.
„Na? Entzug?“ Beim Grinsen entblößte die Gepiercte einen blau verfärbten Zahn, der zur Farbe ihrer Fingernägel passte.
Bukowski grinste zurück. „Kann man so sagen.“ Seit Leon mit dem Rauchen aufgehört hatte, war es in seiner Wohnung strikt verboten. Strikter als strikt. Und weil es keinen Balkon gab, musste sie jedes Mal drei Stockwerke nach unten laufen und vor die Tür gehen, um dem Laster zu frönen. Da es das ganze Wochenende gestürmt und geschüttet hatte, hatte sie nicht einmal halb so viele Zigaretten konsumiert wie sonst, was ihr ohnehin sensibler Kreislauf übelnahm.
Ausreichend Koffein hätte den Nikotinmangel entschärft. Aber Leon war passionierter Grünteetrinker. In seiner Wohnung gab es keine Kaffeemaschine, bloß ein uraltes Glas mit Instantkaffee, der verklumpt war und nach allem Möglichen roch, nur nicht nach Kaffee. Bukowski hatte also das ganze Wochenende über gelitten – stumm gelitten, denn lieber hätte sie sich in den Hintern gebissen, als dem Mann ihres Herzens zu gestehen, wie sehr sie von ihren beiden Lebenselixieren abhängig war.
Was tut man nicht alles für die Liebe, dachte sie verträumt. Sie nahm den doppelten Espresso entgegen, zahlte und stellte sich so an die Schirmbar, dass sie den Spielplatz im Auge behalten konnte. Noah saß auf dem roten Pferd und gab der Federwippe die Sporen. Bukowski winkte ihm zu, er winkte zurück, ohne seinen Schaukelgalopp zu unterbrechen.
Abgesehen vom Lebenselixier-Defizit hatte sie natürlich in keiner Weise gelitten, sondern ein wunderbares Wochenende verbracht. Ein Wahnsinnswochenende. Zwei fabelhafte Tage. Und erst die Nächte, dachte sie. Du darfst auf keinen Fall die Nächte vergessen!
Sie bemerkte, dass sie mit offenem Mund in ihre Kaffeetasse lächelte. Es musste absolut bescheuert aussehen, wie immer, wenn sich Verliebtheit und Glück in einem Antlitz spiegelten.
„Steht Ihnen, wenn Sie lächeln“, sagte die Gepiercte und zeigte ihren blauen Zahn. Erschrocken trank Bukowski den Espresso aus und schob die Tasse zurück.
War sie glücklich?
Verliebtheit traf zu, keine Frage. Sie machte sich als innerliches Prickeln bemerkbar, das bereits seit mehreren Monaten anhielt. Genau genommen seit Silvester.
Kennengelernt hatte Bukowski Leon schon im vorletzten Sommer, in Eisenstadt. Damals waren sie beide Krankenhauspatienten gewesen und hatten einander nach einigen Anfangsschwierigkeiten bestenfalls sympathisch gefunden. Nach ihrer Entlassung waren sie in losem Kontakt geblieben, wobei es immer Leon war, der anrief. Er besuchte sie in Wien, sie gingen gemeinsam ins Kino, ins Theater, in Jazzcafés. Es gab gute Gespräche, Gespräche mit Wein, Gespräche ohne Wein, gemeinsames Lachen, gemeinsames Schweigen. Und Punkt. Mehr gab es nie. Mehr wusste Bukowski immer zu verhindern, auf mehr wollte sie sich nie einlassen.
„Feigling“, hatte ihre Freundin Kim gestichelt und hatte gefragt, wann sie, Carla, endlich wieder anfangen würde, zu leben. „Merkst du nicht, wie gut er dir tut? Wie lange willst du noch trauern? Sind acht Jahre nicht genug?“
Als Leon Ende Dezember wieder nach Wien gekommen war, waren es schon achteinhalb Trauerjahre gewesen und Bukowski begriff, dass die Mauern und Schutzzäune, die sie um ihr Herz errichtet hatte – mannshoch und obenauf mit Stacheldraht umwickelt – eigentlich nicht mehr nötig waren. Dass ihr das ausgerechnet zu Silvester klar wurde, verdankte sie einerseits einem Übermaß an Sekt. Andererseits der unergründlichen Tiefe von Leons Blick, in den es sich so gut eintauchen ließ – der Traunsee war eine Pfütze dagegen. Vielleicht verdankte sie es auch einer gewissen Sentimentalität, die mit Jahreswechseln zusammenhing, und mit der Sehnsucht, das kommende Jahr möge ein glücklicheres werden; weil auch jemand wie Bukowski – jemand, der Mann und Kind verloren hatte, auf die furchtbarste Weise verloren hatte – ein Recht auf Glück besaß. Oder etwa nicht?
In jener Silvesternacht hatten sie sich zum ersten Mal geliebt. Viel zu schnell und aufgeregt und stürmisch. In den langen Winternächten, die folgten, erkundeten sie einander langsam und gründlich, vorsichtig, wie auf Zehenspitzen. Schritt für Schritt tastete sich Bukowski voran, stets darauf bedacht, zum Rückzug bereit zu sein, falls ein Rückzug nötig wäre. Er war aber nicht nötig, ganz im Gegenteil. Sie lernte wieder, Lust zu empfinden und Lust zu geben, lernte, sich fallen zu lassen, die Kontrolle zu verlieren, zuerst versehentlich, dann absichtlich; sie in die Hände eines anderen zu legen, in Leons Hände. Sie begann, ihm zu vertrauen.
So viel zum Thema Verliebtheit. Aber bedeutete das auch, dass sie Leon liebte? So uneingeschränkt und bis ins Mark, wie sie Gregor geliebt hatte?
„Carla! Schau, was ich kann!“ Noah war von der Wippe zur Kletterpyramide gewechselt. Geschickt hangelte er sich hinauf, dann legte er sich in die Hängematte und ließ die Beine ganz entspannt hinunterhängen. Bukowski genoss die Sonnenstrahlen auf ihrer winterweißen Haut und schloss die Augen.
Als sie sie wieder aufschlug, erschrak sie. Eine dunkel gekleidete Gestalt stand über Noah gebeugt und sprach mit ihm. Eine Frau um die dreißig.
Mit drei Sätzen war Bukowski bei ihr. „Wer sind Sie?“
Erschrocken wich die Fremde zurück. „Ich …“ Einen Moment lang sah es aus, als wäre sie auf der Flucht und wollte Bukowski um Asyl bitten. Dann versteinerten ihre Gesichtszüge. Sie wandte sich ab und lief weg.
„Mama!“ Noah wollte hinterher. Aber als er aus der Hängematte sprang, verhedderte sich sein rechter Fuß in den Seilen. Er stolperte und fiel hin.
Bukowski half ihm auf die Beine. Vorsichtig krempelte sie das Hosenbein hoch und begutachtete das aufgescheuerte Knie. Es blutete nur ganz wenig. „Tut’s weh?“ Sanft strich sie ihm die Haare aus der Stirn.
Noahs Unterlippe zitterte. Aber er weinte erst, als ihn seine Mutter, die sofort umgekehrt war, an ihre Brust drückte.
„Ich heiße Carla“, sagte Bukowski und streckte Leons Exfrau die Hand hin.
„Anne.“
Gemeinsam trockneten sie die Tränen des Kleinen, säuberten sein Knie und klebten ein Donald-Duck-Pflaster auf die Wunde, das die Gepiercte aus dem Erste-Hilfe-Kasten der Schirmbar gezaubert hatte. Dann setzten sie sich in die Sonne. Über einem riesigen Eisbecher vergaß Noah schnell den Schmerz. Bukowski nutzte die Gelegenheit, sich einen weiteren Espresso einzuverleiben und Anne zu mustern, die gedankenversunken in ihrem Cappuccino rührte. Es dauerte eine Weile, bis sie auftaute und zu erzählen begann.
Bukowski staunte. Das Bild, das Leon ihr von seiner Exfrau vermittelt hatte, musste dringend korrigiert werden. Anne war zwar nervös, aber sie machte einen absolut vernünftigen Eindruck. Keine Spur von Niedertracht oder Verwahrlosung. Und nicht der geringste Hauch einer Fahne. Sie wirkt überhaupt nicht wie eine Trinkerin, dachte Bukowski.
„Ich habe viel falsch gemacht“, sagte Anne. „Aber das ist jetzt vorbei.“ Sie erzählte von ihrer erfolgreichen Entziehungskur, von ihrem Freund, der sie in jeder Hinsicht unterstützte, und von dem neuen Job als Verkäuferin im Supermarkt, vorübergehend, bis sie wieder eine Stelle als Kosmetikerin und Fußpflegerin finden würde. „Ich kann Verantwortung übernehmen, Carla.“
„Sicher kannst du das. Warum nicht?“
„Leon bezweifelt es. Er will mir meinen Sohn wegnehmen.“ Tränen traten in ihre Augen. Mit einer ungeduldigen Bewegung wischte sie sie weg.
„Aber nein, das will er bestimmt nicht.“
Anne schnäuzte sich. Sie kramte in ihrer Umhängetasche und zog einen Brief heraus. Ein gerichtliches Schreiben. Bukowski quälte sich durch das Juristendeutsch und schlussfolgerte, dass Leon die alleinige Obsorge für Noah beantragt hatte. Nach der Scheidung hatten Anne und er sich die Obsorge geteilt. Noah hatte bei Anne gelebt, bis sie es wegen ihrer Alkoholsucht nicht mehr schaffte, auf den Jungen aufzupassen. Seither hatte Leon sich um das Kind gekümmert. Und jetzt legte er es offensichtlich darauf an, künftig allein über alle Fragen zu entscheiden, die Noahs Erziehung betrafen.
Bukowski schluckte. Seltsam. Leon hatte ihr nichts davon erzählt, obwohl sie am Sonntag ausführlich über ihre gemeinsame Zukunft gesprochen hatten. Abends, bei einer Flasche Amarone, als Noah längst schlief. Ein romantischer Abend war es gewesen. Im Nachhinein betrachtet fast kitschig. Leon hatte gekocht, Bukowski hatte sich geschminkt, was bestimmt nicht öfter als dreimal im Jahr vorkam. Sie hatten einander zugeprostet und Leon hatte ihr ein Geschenk in die Hand gedrückt. Einen Ring. Nichts Teures – das konnte Leon sich nun wirklich nicht leisten – dafür schlicht und schön. Und so schmal und leicht er in Bukowskis Hand lag, so schwerwiegend war seine Bedeutung.
„Heirate mich“, sagte Leon.
„Wozu? Ich liebe dich auch so“, sagte Bukowski und dachte, dass sie einfach nicht für romantische Szenen taugte. Warum konnte sie ihre Freude nicht zeigen? Denn in Wahrheit freute sie sich wie ein Schnitzel. Oder etwa nicht?
Leon nahm es mit Humor, er hatte wohl mit etwas Ähnlichem gerechnet. „Überleg es dir, okay? Nach der Reha frage ich dich noch einmal.“
„Ich denke darüber nach“, versprach sie und hörte sich seine Pläne an. Im August wollte er nach Wien ziehen. Man hatte ihm eine feste Anstellung beim Kurier angeboten, als stellvertretender Leiter des Ressorts Investigative Recherche. Und er hatte zugegriffen. Denn erstens wurden die Zeiten härter, Leon älter und die Sicherheit einer Anstellung verlockender. Zweitens kam Noah im Herbst in die Schule. Leon wollte ihn unbedingt in eine Waldorfschule schicken, aber in Gmunden gab es keine. „Außerdem braucht er eine Mutter“, sagte er zu Bukowski. „Eine Mutter, auf die er sich verlassen kann, keine Säuferin. Und dich hat er auf Anhieb ins Herz geschlossen.“
Bukowski versicherte, dass sie Noah auch gern hatte, sehr gern sogar. Trotzdem hatte sie die ganze Nacht nicht schlafen können und sich immer wieder gefragt, ob sie eine so große Verantwortung übernehmen konnte. Die Verantwortung für einen Fünfjährigen. Samuel, Bukowskis eigener Sohn, war mit sechs Jahren gestorben. Verbrannt, weil Gregor, Samuels Vater, keinen anderen Ausweg gesehen hatte. Erweiterter Selbstmord. Fast neun Jahre waren seither vergangen, Trauerjahre, in denen Bukowski versucht hatte, zu vergessen und zu verzeihen. Nicht zuletzt sich selbst, denn natürlich fühlte sie sich mitschuldig.
„Nein“, murmelte sie, „ich glaube nicht, dass ich das kann.“
„Also nicht?“, fragte Anne.
Bukowski schreckte aus ihren Gedanken auf. „Was?“
„Du willst mir nicht helfen? Mit Leon reden, wegen Noah?“
„Aber ja. Doch. Natürlich helfe ich dir.“ Bukowski würde Leon sagen, dass sie ihn liebte. Dass sie Noah zwar eine gute Freundin sein konnte, ein Kumpel, eine Verbündete. Aber keine Mutter. Zumal er ja eine Mutter hatte, die er liebte und vermisste. Die nicht frei von Fehlern war, nein, aber wer war das schon? Anne hatte eine zweite Chance verdient.
Bukowski betrachtete die klebrige Faust, mit der Noah den kleinen Finger seiner Mama umklammerte. Sie versprach, dass alles gut werden und Leon von seinem Antrag auf alleinige Obsorge absehen würde. Ganz bestimmt. So wahr sie Bukowski heiße und Kriminalbeamtin sei.
Zum Abschied umarmte sie Anne und versuchte Noah damit zu trösten, dass er seine Mama bald wiedersehen werde. Großes Indianerehrenwort.
Trotzdem schluchzte der Kleine fast den ganzen Heimweg lang und Bukowski erntete böse Blicke von Esplanaden-Flanierern, die sie wohl für eine Rabenmutter hielten. Noah beruhigte sich erst, als er mitten in einer Blumenrabatte im Franz-Josef-Park eine aufregende Entdeckung machte: ein Tier – klein, weiß, mit rosa Öhrchen und schwarzen Knopfaugen. Es flüchtete sich direkt in Noahs aufgehaltene Hände. Als Bukowski das kleine Meerschwein begutachtete, klopfte sein winziges Herz aufgeregt gegen ihren Zeigefinger.
Die Frage, ob Noah es behalten durfte oder nicht, stellte sich gar nicht. Klar durfte er.
„Wenn es niemand vermisst“, wandte Bukowski vorsichtig ein, denn immerhin bestand die Möglichkeit, dass das Tier ausgebüxt war und gesucht wurde. Von einem kleinen Jungen wie Noah vielleicht.
„Und wenn der Junge sie gequält hat und sie deshalb davongelaufen ist?“
„Auf alle Fälle sollten wir ihm ein Haus besorgen.“ Sie dachte dabei an eine Schuhschachtel.
„Ihr“, korrigierte Noah mit unerschütterlicher Selbstverständlichkeit. „Sie heißt Ilse.“
Bukowski begriff, dass eine Schuhschachtel keine angemessene Unterkunft für Ilse wäre. Sie beeilte sich, eine Tierhandlung aufzusuchen, und kaufte einen geräumigen Käfig samt meerschweingerechter Inneneinrichtung und eine Großpackung Heu. Außerdem ein Buch über artgerechte Haltung und einen Korb voll Gemüse.
Abends, als Ilse zusammengerollt in ihrem Holzhäuschen schlief und Noah leise schnarchte, atmete Bukowski auf.
Bevor sie Leon vom Familienzuwachs und ihrer Begegnung mit Anne berichtete, trank sie sich mit dem letzten Rest des Amarone Mut an.
Sie rief Leons Nummer auf, öffnete das Wohnzimmerfenster und zündete sich eine Zigarette an. Was er nicht weiß, macht ihn nicht heiß, dachte sie und inhalierte.
In diesem Moment meldete er sich und sie hätte sich fast am Rauch verschluckt.
5
„Was hat er gefunden? Ein Meerschwein?“ Leon lachte leise. Dann ließ er sich die Geschichte haarklein erzählen und fragte immer wieder nach, hauptsächlich, um Carlas Stimme zu hören.
Das Wochenende hatte ihm die Augen geöffnet. Endlich war es ihm gelungen, ins Innerste seiner scheinbar so spröden Freundin zu schauen, und er war überrascht gewesen von der Wärme, die er dort vorgefunden hatte. Von der Tiefe ihrer Empfindungen. Der Wunsch, den Rest seines Lebens mit dieser Frau zu verbringen, drängte sich so in den Vordergrund, dass er ihn aussprechen musste. Sein überstürzter Antrag erschreckte sie, aber immerhin versprach sie, darüber nachzudenken. Und er wusste, dass sie Ja sagen würde. Natürlich würde sie.
„Wie hat er das Schwein genannt? Ilse? Dann pass bloß auf, dass er es nicht zu Tode streichelt. So heißt nämlich seine Lieblings-Kindergartentante.“
Carla lachte. „Mach dir keine Sorgen, dein Sohn geht sehr sorgsam mit Ilse um. Ich musste das schönste und größte Haus für sie kaufen.“ Sie hustete.
„Sag einmal, rauchst du? In meiner Wohnung?“
„Aber nein, wie kommst du darauf? Ilse frisst übrigens am liebsten Gurke aus Noahs Hand. Und wenn er mit ihr spricht, himmelt sie ihn mit ihren Knopfaugen an, das solltest du sehen.“
Leon nahm seine Brille ab und kaute am Bügel. „Sag, vermisst er mich eigentlich?“
„Dich nicht.“ Carlas Stimme klang plötzlich ernst.
„Wen denn sonst? Seine Oma wohl kaum!“ Während seines Krankenhausaufenthalts hatte Leons Mutter den Kleinen zu sich genommen. Was für eine Katastrophe! Noah war todunglücklich gewesen und die Oma vollkommen überfordert. Sie war zu alt und hatte im Grunde nie was mit Kindern anfangen können.
Vielleicht liegt mir deshalb so viel an einer intakten Beziehung, dachte er. Carla, Noah und ich, die kleine, aber feine Familie Ritter.
„Er vermisst Anne“, sagte Carla. „Wir sind ihr auf der Esplanade begegnet.“
Als er den Namen seiner Exfrau hörte, verflog die Wärme, die der Familiengedanke heraufbeschworen hatte. Alarmiert sprang Leon auf und stürmte hinaus in den Innenhof, wo die Raucher in kleinen Grüppchen zusammensaßen und Karten spielten. Er schritt forsch aus, obwohl seine Physiotherapeutin ihn ermahnt hatte, kleine, behutsame Schritte zu machen. Am anderen Ende des Hofes blickte er auf den Traunsee hinunter und auf die Berge, die sein Ostufer säumten: den Grünberg, den Traunstein und den Erlakogel, der im Volksmund „Schlafende Griechin“ hieß, weil seine Form der Silhouette einer Liegenden mit klassisch-antikem Profil entsprach.
Die Rechnung für seine Unvorsichtigkeit kassierte er in Form eines nadelfeinen Schmerzes, der bis in die kleine Zehe ausstrahlte.