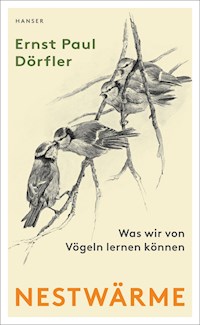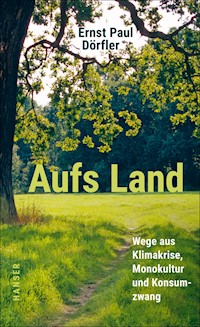
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Das Landleben als Chance für Klima und Umwelt? Inspirierende Perspektiven auf Nachhaltigkeit und Selbstversorgung von Ökologe Ernst Paul Dörfler
Wir haben den Blick für das Wesentliche verloren: unser Wohlergehen und das der Natur. Wir leben in engen Städten. Wir arbeiten viel, um immer mehr zu konsumieren. Leidenschaftlich und kompetent ruft der Ökologe Ernst Paul Dörfler dazu auf, endlich auszubrechen und nachhaltige Lösungen zu finden. Der Weg dorthin führt aufs Land. Als unbequemer Umweltschützer schon in der DDR vermittelt er glaubhaft wie kein Zweiter, was freies und selbstbestimmtes Leben bedeutet und wie es gehen kann. Wer weniger braucht, muss weniger arbeiten und verdienen, schont zugleich die natürlichen Lebensgrundlagen, lebt zufriedener und gesünder. Ob Stadt- oder Landmensch, dieses Buch rüttelt auf und zeigt Perspektiven für ein freies, umwelt- und klimafreundliches Leben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 396
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Wir haben den Blick für das Wesentliche verloren: unser Wohlergehen und das der Natur. Wir leben in engen Städten. Wir arbeiten viel, um immer mehr zu konsumieren. Leidenschaftlich und kompetent ruft der Ökologe Ernst Paul Dörfler dazu auf, endlich auszubrechen und nachhaltige Lösungen zu finden. Der Weg dorthin führt aufs Land. Als unbequemer Umweltschützer schon in der DDR vermittelt er glaubhaft wie kein Zweiter, was freies und selbstbestimmtes Leben bedeutet und wie es gehen kann. Wer weniger braucht, muss weniger arbeiten und verdienen, schont zugleich die natürlichen Lebensgrundlagen, lebt zufriedener und gesünder. Ob Stadt- oder Landmensch, dieses Buch rüttelt auf und zeigt Perspektiven für ein freies, umwelt- und klimafreundliches Leben.
Ernst Paul Dörfler
Aufs Land
Wege aus Klimakrise, Monokultur und Konsumzwang
Carl Hanser Verlag
Für Anne und Heiner, stellvertretend für die Kinder unserer Erde
1
Sehnsuchtsort und Wunderdroge
Wenn die Sonne an der Nord- und Ostseeküste untergeht, versammeln sich allabendlich an unzähligen Orten Menschen am Strand und auf den Seebrücken, die wie Zungen ins Meer hineinragen. Sie alle wollen Zeuge eines Naturschauspiels sein, Zeuge vom Abschied des Tages und vom Beginn der Nacht. Sie schauen gen Westen über das weite Meer, auf die untergehende Sonne, auf den Himmel mit seinen wechselnden Farben, belebt von den segelnden Botschaftern der Natur, den Vögeln. Schönheit und Freiheit sind in diesen Momenten vereint, in uns und um uns herum. Wir sind Teil des Geschehens und lassen uns mitnehmen. Wir haben uns danach gesehnt.
Im Herbst scheint sich diese Sehnsucht nochmals zu steigern. In kilometerlangen Schlangen aneinandergereiht schauen Menschen gespannt bis meditierend zum Horizont mit seinen bizarren Wolkenbildern: Frauen und Männer aller Generationen, Kinder, Mütter mit ihren Säuglingen auf dem Rücken, dazwischen ein aufgeregter kleiner Hund. Fast alle sind ausgerüstet mit Ferngläsern und Spektiven, mit Fotoapparaten mit und ohne Stativ, andere halten ihre Handys für Schnappschüsse bereit. Wie abgesprochen sind sie zum Tagesausklang auf die Deichkrone gekommen, um Zeugen eines der faszinierendsten Naturschauspiele zu werden, des alljährlichen Vogelzuges an einem der bedeutendsten Rastplätze. Der Einflug der Kraniche steht bevor. Tagsüber suchen die majestätischen Vögel im Umland nach Futter, doch am Abend, kurz vor Sonnenuntergang, kehren sie an ihre Schlafplätze zurück. Es sind die bewährten und sichersten Orte für eine ungestörte Nachtruhe, die Inseln und die Lagunen im Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft zwischen der Halbinsel Darß — Zingst und der Insel Hiddensee. Aus vielen Richtungen steuern Tausende der eleganten Segler auf ihre Schlafplätze zu. Jeder Kranich hat seinen ganz eigenen Ruf, so unverwechselbar wie der Fingerabdruck eines Menschen. Die vielstimmigen, trompetenartigen Kontaktrufe, mit denen sich die einzelnen Mitglieder der Vogelfamilien untereinander verständigen, sind für Naturfreunde der Inbegriff von Zugehörigkeit, von ansteckender Sehnsucht und von Fernweh. Diese Gefühle scheinen sich auf die Beobachter zu übertragen.
Das Naturerleben ist ein Urbedürfnis des Menschen. Ein tiefes Verlangen danach steckt in uns. Unser Körper braucht den Naturkontakt, die Berührung und die Reibung. Wir wollen die Natur immer wieder spüren, um uns unserer Lebendigkeit bewusst zu werden. Doch nicht nur Haut und Sinne wollen Natur erfahren, auch unsere Seele verlangt nach ihr. Naturerfahrung ist Seelenpflege.
Der Weg zur Natur ist ein Weg zu uns selbst. Wer bin ich? Lebe ich so, wie ich leben will, oder lebe ich nach einem fremden Programm, ferngesteuert? Die Begegnung mit der Natur hilft uns, das Wichtige, das Wesentliche zu erkennen. Abgeschaltete Sinne werden wiederbelebt. Das Lebenstempo wird gedrosselt. Innehalten ist angesagt. Wir atmen tief durch, genießen die saubere Luft und bemerken vielleicht, was uns im Leben tatsächlich fehlt: Zeit und Zuwendung.
Die Natur kennt keine Zeitnot. Und wir Menschen? Wir können uns an der geschenkten Zeit bedienen, aber sie ist für uns limitiert. Zeit ist eine Kostbarkeit. Nur mit Zeit ist auch Zuwendung möglich. Nur mit Zeit können wir uns kümmern, um uns und um unsere Mitwelt. Wie konnte es dazu kommen, dass wir beides arg vernachlässigen?
Wir haben die innere wie die äußere Natur aus dem Blick verloren. Körper und Seele leiden unter Entzug, sie drohen zu schwächeln und zu verkümmern. Nicht nur wir Menschen, die komplette Natur steckt in einer verhängnisvollen Misere, einer Misere, die wir lange nicht sehen wollten. Jetzt ist das Wegschauen nicht mehr möglich. Wir Menschen selbst sind die Verursacher der Umweltkrisen, die uns von allen Seiten treffen, aus der Luft, dem Wasser, der Erde und aus der Welt der Mikroben. Diese heranrollenden Krisenlawinen sind letztlich Ausdruck unserer Sinnkrisen. Wenn die Natur unser Hausarzt wäre, würde sie uns Besinnungslosigkeit oder gar Bewusstlosigkeit attestieren.
Die erfreuliche Nachricht: Besinnung und Bewusstsein lassen sich zurückgewinnen, neu aufbauen. Dafür brauchen wir Wissen und Begeisterung. Wir sind die Lernenden. Für die Lernstunden müssen wir Termine einplanen, Zeit, die wir in der »Universität Natur« verbringen, um ihre Weisheiten zu verstehen und sie in unser Leben hineinzulassen. »Natur neu lernen« steht nun auf dem Plan.
Wo finden wir sie, unsere Lehrerin? Wir können sie vielleicht schon bei einem bewussten Blick durch das Fenster einfangen. Sie wartet auf alle Fälle im nächsten Park, aber ganz besonders draußen vor den Toren der Stadt. Das weite Land ist die Hauptadresse für Naturbegegnungen. Es lohnt sich, die gewohnten Gemäuer — auch die im Kopf — hinter sich zu lassen, Wälder und Wiesen, Flüsse und Seen aufzusuchen und dort Zeit zu verbringen. Hier sprudeln unerschöpfliche Quellen für unsere Genesung. Der bewusste Aufenthalt in diesen Naturräumen lässt uns aufblühen, er euphorisiert. Wo wir uns in der Falle wähnten, werden kreative Lösungen sichtbar. Die Natur hält sie parat. Das Wahrnehmen der kleinen Wunder, der Blütenbesuch einer Hummel, der gaukelnde Flug eines Falters, die ersten Lieder der Meisen im Frühling lassen in uns auftauen, was erstarrt zu sein schien. Es sind unsere körpereigenen Drogen, die Endorphine, die ganz von selbst reichlich ausgeschüttet werden und in uns eine tiefe und nachhallende Lebensfreude auslösen. Diese Glückshormone sind auch der Schlüssel für starke Abwehrkräfte und das Fundament für eine stabile Gesundheit, für unser Wohlbefinden. Wir brauchen die Energie von innen wie von außen, um aus dem Krisenmodus auszusteigen. Die Natur hält alles bereit, was wir zum guten Leben brauchen.
Wollen wir gemeinsam aufbrechen und uns auf die Suche begeben? Lassen Sie sich einladen, einen tieferen Blick aufs Land und seine natürlichsten Geschenke zu werfen, Geschenke, die uns Lebensglück bescheren können.
2
Wo wir stehen
Das Leben auf dem Land ist öde, langweilig und Arbeit gibt es auch keine. Man hockt in seinem Kaff, es gibt nichts zu kaufen, kein Café, keinen Arzt weit und breit, keine Apotheke, keine Schule, das Internet läuft mit Einschlafgeschwindigkeit und nur selten verirrt sich ein Bus in diese Einsiedelei. Wozu auch für die paar Übriggebliebenen? Man fühlt sich vergessen, verlassen, abgehängt, ja abgeschnitten vom Puls der Zeit. Das Leben findet anderswo statt. Die Jugend hat die Flucht angetreten. Nur ein paar Alte harren noch aus, ihre Arme verschränkt, starren sie in eine Welt, die sie nicht mehr verstehen — Relikte aus einer vergangenen Epoche. An Schönwetterwochenenden fallen mancherorts die Landlust-Anhänger ein, sie suchen die Idylle, die Dorfromantik. Diese »Zugvögel« tanken Energie, genießen die freie Natur auf ihrem gepflegten Bilderbuchgrundstück, doch sie bleiben flüchtige Fremde.
Ist das alles, was das Dorf zu bieten hat? Daran will ich nicht glauben. Ist das Landleben wirklich unzumutbar geworden? Mitnichten! In keiner Stadt der Welt kann ich so viele Sonnenstunden genießen wie in meinem Dorf. Die Tage geizen nicht mit Licht und die Nächte sind noch wahrhaft dunkel, sternenklar und mäuschenstill. Ich kann auf der Milchstraße mit meinen Augen umherwandern, umgeben von Tausenden von Sternen. Das Universum ist für mich geöffnet und die Natur liegt mir zu Füßen. Den innigen Wunsch in Bertolt Brechts Geschichten des Herrn Keuner, »Ich würde gern mitunter aus dem Haus tretend ein paar Bäume sehen«, teile ich und Tag für Tag will ich ihn mir erfüllen, ohne erst »ins Freie« fahren zu müssen.
Der Fluss gleich nebenan, zehn Minuten zu Fuß, lädt mich zur Privataudienz ein. Zu jeder Stunde hat er geöffnet, wir tauschen uns aus und teilen manche Geschichte, manches Geheimnis. Er lebt seinen ganz eigenen Rhythmus, in seinem Auf und Ab, nur selten zeigt er sich im Mittelmaß. Er schwankt zwischen seinen Extremen, zwischen dem Überfluss und dem Mangel. Die weiten Wiesen der Flussaue gewähren mir den freien Blick. Zugleich spüre ich in meinem Rücken die schützende Geborgenheit des Waldes. Um die unendliche Lebensvielfalt zwischen Himmel und Erde wahrzunehmen, wünsche ich mir manchmal Facettenaugen, wie sie die Libelle besitzt.
Nach Jahrzehnten gesammelter Erfahrungen habe ich die Gewissheit gewonnen: Die Rückkehr auf das Land hat mir meine Freiheit, meine Selbstbestimmung, meine Gesundheit und meine Lebensfreude zurückgegeben. Fernab des Lärms und Gedränges kann ich der sein, der ich bin, so sein, wie mir gerade ist, das tun, wonach mir verlangt. Auch wenn wir es vergessen haben: Die Natur ist unser Zuhause.
Landflucht
Das echte Leben spielt sich anscheinend in der Stadt ab. Für Millionen Menschen bedeutet das Leben dort den Lebenstraum. Der Zustrom scheint nicht abreißen zu wollen, es ist die Völkerwanderung der Moderne. Weltweit brechen die Menschen auf, machen sich auf den Weg. Die Mehrzahl lebt inzwischen in Städten. Im Jahre 2050 sollen es 70 Prozent sein. 25 Megacities mit jeweils über zehn Millionen Einwohnern werden bereits rund um den Globus gezählt. Die Stadt scheint die erste Adresse für Fortschritt und Entwicklung zu sein, sie steht für das Morgen. Die Provinz? Das war gestern! Das Landei? Eine bedauernswerte, zurückgebliebene Spezies — im doppelten Sinne des Wortes!
Die Landflucht hat eine lange Geschichte. Die längste Zeit des menschlichen Zusammenlebens seit der Sesshaftwerdung spielte sich in dörflichen Siedlungen ab. Hier fanden das Leben und das Arbeiten statt. Kurze Wege und geschlossene Stoffkreisläufe waren selbstverständlich. Alles drehte sich um Nahrungsbeschaffung, um Wohnraum, um Schutz vor Feinden und Widrigkeiten. Das Leben war hart, entbehrungsreich und oft gnadenlos. Niemand will dorthin zurück, auch ich nicht.
Die erste und älteste Stadt der Welt, die »Mutter der Städte«, Uruk, lag im Zweistromland zwischen den Flüssen Euphrat und Tigris. Sie entstand mit ihren Tempeln und Palästen vor 6000 Jahren und soll immerhin 30.000 Einwohner beherbergt haben. Von ihrem einstigen Glanz sind nur Relikte erhalten. So ist es vielen Städten der Antike ergangen. Wo sich Reichtum häufte, drängten sich die Eroberer, um sich selbst zu bereichern.
Unsere mittelalterlichen Städte waren zum Schutz vor feindlichen Überfällen durch Stadtmauern und Wassergräben gesichert. Erst mit Beginn der Industrialisierung vor rund 200 Jahren sind die letzten Mauern gefallen, die Städte dehnten sich aus und wuchsen ins Land. In jener Zeit wurden die Städte immer stärker zu Orten der Arbeitsteilung. Neue Berufe entstanden und der Handel florierte. Die Landbevölkerung strömte zunehmend in die Städte. Die Menschen erhofften sich Arbeit und ein auskömmliches Leben mit mehr Unabhängigkeit und Freizeit. Ein neues Lebensgefühl breitete sich aus. Man trug nicht mehr nur eintönig graue, sondern erfreute sich an farbiger Kleidung, erregte damit öffentliche Aufmerksamkeit. Neue Begehrlichkeiten wurden geweckt. Das tägliche Einerlei des schlichten Landlebens fand in den Städten sein ersehntes Ende.
Die Landflucht im großen Stil setzte im 19. Jahrhundert mit der industriellen Revolution ein, befeuert durch Kohle und später durch Öl. Das wirtschaftliche Wachstum ließ auch die Städte immer größer werden. Heute stoßen die Städte an ihre Grenzen, an soziale, ökologische und gesundheitliche. Und viele Dörfer schrumpfen weiter. Ganze Landstriche dünnen nach und nach aus. Solche Veränderungen gab es auch schon in ferner Vergangenheit. So entstanden im Mittelalter aus Dörfern Wüstungen, weil die Menschen in ihrer angestammten Umgebung nicht mehr existieren konnten. Aber heute? Kann man auf dem Land wirklich nicht mehr (über)leben?
Das pulsierende, unterhaltsamere Leben in der Stadt hatte schon während der Industrialisierung nicht nur Glücksmomente zu bieten, es hatte auch seinen Preis: Nahrung und Wohnung muss man sich von nun an kaufen. Dafür braucht man Geld, das verdient werden musste. Die Arbeit in der Fabrik war oft einseitig und machte krank. Giftige Stoffe kamen in Umlauf, Bäche und Flüsse begannen zu stinken, man konnte bald nicht mehr aus ihnen trinken. Die Luft in den Städten war voller Rauch und nur schwer zu atmen. Die Sonne bekamen die Stadtbewohner im Winterhalbjahr kaum zu Gesicht, Vitamin-D-Mangel und Knochenweiche, die Rachitis, waren die Folge. Natur war, wenn überhaupt, in den Städten nur sehr eingeschränkt vorgesehen. So stießen die Freiheiten, die das Stadtleben versprach, schon damals an Grenzen: Umwelt und Gesundheit litten unter den neuen Verhältnissen. Bisher unbekannte Krankheitsbilder tauchten auf. Hier, im städtischen Raum, steht die Wiege vieler unserer heutigen Zivilisationskrankheiten.
Der Begriff »Mietskasernen« ist eine treffende Beschreibung der Architektur der in der Gründerzeit entstandenen Stadtteile. Das Menschenrecht »Wohnen« wurde der Profitmaximierung untergeordnet: Oft ging es darum, auf engem Raum möglichst viele Arbeitskräfte in Fabriknähe »unterzubringen«, damit sie für die Produktion zur Verfügung standen. Daran hat sich bis heute nur wenig geändert. Die Vielfalt der Lebensbedürfnisse des Menschen wurde und wird kaum berücksichtigt. Im Zuge des Industriezeitalters wurden die Menschen auch tagsüber zu »Höhlenbewohnern«. Sie tauschten Grün gegen Grau. Mit leblosem Beton kann ein Mensch schlecht in Resonanz treten. Aus dem Fenster betrachtet sehen für ihn dort alle Jahreszeiten gleich aus. Dem menschlichen Biorhythmus fehlen wichtige Taktgeber, das Licht und die Vegetation. »Grün beruhigt« ist keine leere Worthülse. Wir sind entwicklungsgeschichtlich auf diese Farbe geprägt, denn in grüner Umgebung sind die Überlebenschancen besser, die Grundbedürfnisse scheinen erfüllbar. Fehlt das lebendige Grün um uns herum, steigt unser Stresshormonspiegel. Unser angeborenes Verhalten treibt uns an, nach besseren Umweltbedingungen zu suchen. Lassen sich diese nicht finden, kann es auf Dauer zu depressiven Verstimmungen kommen. Das Einbeziehen von lebenden Pflanzen in die gebaute Wohnumwelt, »Phytoarchitektur« oder »biophiles Design« genannt, ist der Versuch, einen Ausweg aus diesem urbanen Dilemma des ungestillten Verlangens nach Naturkontakt zu finden. Aber grüne Farbtupfer, wie begrünte Fassaden, bieten einem Menschen noch keinen natürlichen Freiraum. Auch Zimmerblumen sind schön und bereichernd, aber liefern sie uns mehr als etwas Trost für entgangenes, echtes Naturerleben?
Mit dem Aufschwung der Ökologie, der Wissenschaft vom Haushalt der Natur und von den Wechselbeziehungen zwischen Lebensraum und Lebensgemeinschaft, erkannte man, dass die Stadt als Ganzes gewissermaßen ein parasitäres Leben führt — zu Lasten der Umwelt und der Gesundheit. Ein Parasit, auch Schmarotzer genannt, lebt gewöhnlich auf Kosten eines erheblich größeren Lebewesens. Lebt die Stadt in vergleichbarer Weise auf Kosten des Landes? Parasiten gehen bekanntlich ein, wenn ihr Wirt eingeht. Die Abhängigkeit ist total.
Dennoch strömen die Menschen auch heute noch voller Hoffnung in die künstlichen, urbanen Ökosysteme. Sie erträumen sich das große Glück, Arbeit, Wohlstand, Spaß, Zerstreuung, Anonymität und Freiheit. Hier spielt die Musik. Die Großstadt — ein spannender Lebensraum für aufgeweckte, neugierige Menschen mit kosmopolitischer, weltoffener Einstellung, ein florierendes Zentrum von Wirtschaft, Kultur, Bildung und Politik. Das Geld fließt in Strömen, großzügig wird investiert und es reicht trotzdem nicht. Untereinander stehen die Metropolen im harten Konkurrenzkampf um Attraktivität für Touristen und Führungskräfte. Alle Hebel werden in Bewegung gesetzt, um das Markenimage aufzupolieren. Den Großkonzernen werden rote Teppiche ausgerollt und Subventionen versprochen, um sie als Investoren zu gewinnen. Fußballstadien werden auf die Namen der Sponsoren umgetauft. Nicht zuletzt wird auf die Politik Einfluss genommen, um vom Fördertopf-Kuchen ein möglichst großes Stück abzubekommen. Der Lobbyismus erscheint erfolgversprechend, Wahlen werden in den Städten entschieden — und damit auch die Zukunft unseres Planeten. Die großen Verlierer sind die ländlichen Regionen. Sie stehen im Hintergrund und verkommen zu Rändern der Gesellschaft. Ihre Bewohner gelten als konservativ, unbeweglich, hinterwäldlerisch oder als schlichte Gemüter. Ihre Stimme verhallt in der Weite oder — schlimmer noch — sie äußert sich in Protesthaltungen. So driften Stadt und Land immer weiter auseinander. Schon werden erste Forderungen laut, so vom Institut für Wirtschaftsforschung Halle, den ländlichen Raum im Osten aufzugeben und die frei werdenden Mittel in die Metropolen zu leiten, statt sie weiter in ein »Fass ohne Boden« zu stecken, denn das platte Land habe eh keine Zukunft. Geht das — Stadt ohne Land?
Die Würfel scheinen gefallen: Die Anziehungskraft der Stadt ist unwiderstehlich. Die große Mehrheit der Menschen lebt inzwischen in Städten, in Deutschland sind es bereits zwei Drittel. Sind sie damit am Ziel ihrer Lebensträume?
Scheinbar im Widerspruch zur Wirklichkeit stehen die Resultate einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des ZDF, durchgeführt vom Meinungsforschungsinstitut »Forschungsgruppe Wahlen« im März 2018. Die Meinungsforscher kommen in ihrer großen Deutschland-Studie zu einem völlig unerwarteten Ergebnis: Immer mehr Städter sind von ihrem hektischen Umfeld genervt. 44 Prozent der Stadtbewohner träumen vom ruhigeren Landleben. 39 Prozent favorisieren das Leben in einer Kleinstadt und nur 16 Prozent würden die Großstadt bevorzugen. So weit die Wünsche. In der Realität verbringen aber mehr als doppelt so viele Menschen ihr Leben in einer Großstadt von über 100.000 Einwohnern. Exakt leben 77 Prozent der Deutschen in urbanen Ballungsgebieten und nur 15 Prozent in Dörfern mit weniger als 5000 Einwohnern.
Der verbreitete Traum vom Landleben ist längst als Marktlücke entdeckt worden. Die Landlust-Medien boomen. Wenn schon in der Stadt wohnen, dann wenigstens ein Abo-Heft im Zeitungsständer von der erträumten Welt da draußen voller Hochglanzbilder. Grüne Landschaft, so weit das Auge reicht, Bäume, an denen Hängematten baumeln, säuberlich kurz geschorener Rasen, dazwischen Blumenrabatten, Schmetterlinge, trällernde Vögel — das sind die vermarktungsfähigen Vorstellungen von der ländlichen Idylle. Diese Fantasien werden von vielen Seiten genährt und bedient. Erfüllt sich ein solcher Traum, währt er meist nur von Freitagabend bis Sonntagabend. Dann geht es wieder auf verstopften Straßen und mit viel Adrenalin im Blut zurück in die Stadt. Das Hamsterrad dreht sich weiter. So steigern wir das Bruttosozialprodukt.
Neben den Anhängern der Wochenend-Landlust gibt es die Pendler, eine ebenso wachsende Spezies. In keinem anderen Land der Welt wird so viel gependelt wie in Deutschland. Das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung hat in einer Studie ermittelt, dass seit 2013 mehr Menschen von der Großstadt ins nahe Umland ziehen als umgekehrt. Wohnen im grünen Speckgürtel, arbeiten in der City, zwischendurch Vollgas oder im Stau stehen. Die persönliche Klimabilanz ist fatal.
Der exorbitante Autoverkehr ist eine der größten CO2-Schleudern. Mehr noch: Die Pendlerpauschale verschlingt Jahr für Jahr Milliardensummen an Steuergeldern in Deutschland — »umweltschädliche Subventionen« nennt das Umweltbundesamt diesen Tatbestand und fordert deren Abschaffung, denn der Staat befördert durch seine Steuerpolitik die Klimakrise, indem er das Vielfahren wie auch das Vielfliegen belohnt. Die weiträumige Trennung zwischen Arbeiten und Wohnen macht unsere Umwelt krank und, wie ich später noch beschreiben werde, uns gleich dazu.
Illusion von Freiheit
Wir glauben, in einer freien Gesellschaft zu leben, und sind doch abhängig und fremdbestimmt wie nie zuvor. Wir haben uns auf einen Deal eingelassen, der durch globale Arbeitsteilung, durch mehr Tempo und Effizienzsteigerung ein schier endloses Wirtschaftswachstum hervorbringen sollte. Die Produktion wurde in ferne Länder mit billigen Arbeitskräften und kostenfreien Abfalldeponien ausgelagert und der Konsum wurde zu unserem Lebensinhalt. Je größer das Angebot, umso größer der Hunger. Nein, es ist kein echter, es ist ein manipulierter Hunger. Zu seiner Steigerung wird Knappheit vorgetäuscht: »Nur wenige Tage im Angebot!« Schon die Auswahl eines Artikels versetzt uns in Stress: Welches Modell zu welchem Preis sollte es sein? Könnte es morgen oder woanders billiger sein? Oder übermorgen schon ein neueres Modell geben? Egal ob Technik, Kleidung oder Nahrung — wer überschaut noch die ganze Palette und was steckt eigentlich hinter der glanzvollen Werbung, die unsere Kauflust anregen soll? Und brauchen wir das alles? Wird unser Leben dadurch leichter und schöner?
Die »Kauflaune« der Verbraucher ist ein gängiger Maßstab, ob es mit der Wirtschaft bergauf geht. Das locker sitzende Geld, die Kreditkarte machen es möglich. Gute Laune — hohe Umsätze — hohe Gewinne. So wird produziert und konsumiert auf Teufel komm raus, wenn nötig auf Pump. Immer neue Produkte und Dienstleistungen werden erfunden, uns aufgeschwatzt und aufgedrängt. Wir geraten immer mehr in Abhängigkeiten von der Industrie, von Banken und Versicherungen — und nicht zuletzt vom Gelderwerb. Der Stress wächst, man möchte doch mithalten im Rennen um die neuesten Modelle. Zwänge und Ängste breiten sich aus — und werden verdrängt durch noch mehr Konsum.
Wir haben es schlicht verlernt, uns um das wirklich Wichtige zu kümmern — um den Boden unter unseren Füßen und um uns selbst. Wir haben die Eigenverantwortung an die Politik delegiert, an die Industrie, an den Arzt und an die Apotheke. Und wenn etwas schiefläuft, sind die anderen schuld. Aber die werden es nicht richten, sie wollen verdienen, den Umsatz und den Gewinn steigern und sie wollen an der Macht bleiben. Und so laufen wir weiter und weiter wie die Lämmer hinterher. Quo vadis, Freiheit?
Niemand wird uns die Verantwortung abnehmen für das, was wir tun, und für das, was wir nicht tun. Fakt ist: Unsere fundamentalen Lebensgrundlagen sind in akuter Gefahr. Wir sind gefangen, befinden uns mitten in einem Strudel, der uns und unsere Mitwelt erfasst hat. Wir haben nur die eine Alternative: Wir müssen radikal und schnell umsteuern, wenn wir nicht untergehen wollen.
Abbildung 1: Wachstum und Geschwindigkeit sind positiv besetzte Begriffe. Doch mit wachsender Bevölkerung und steigendem Konsum wachsen auch die globalen Probleme wie die Klimaerwärmung, das Artensterben, die Ressourcenverknappung und die soziale Ungerechtigkeit.
Das Wissen um den Treibhauseffekt und das Aussterben von Pflanzen und Tieren durch die Zerstörung ihrer Lebensräume dringt immer weiter ins öffentliche Bewusstsein. Seit über einem halben Jahrhundert liegen Daten über die wachsenden Belastungen für unsere Umwelt und unsere Gesundheit vor. Warnungen von Wissenschaftlern hat es immer wieder gegeben, allerdings gingen diese Erkenntnisse im Wachstums- und Konsumrausch unter. Kaum jemand wollte sie hören, unbequeme Wahrheiten werden allzu gerne verdrängt und deren Botschafter dämonisiert. Auch ich habe diese Erfahrungen machen müssen.
In fast allen Teilen unserer Welt brennt die Erde, vielerorts auch ohne sichtbares Feuer. Die Zahl der vom Menschen verursachten Umweltkatastrophen hat sich in den letzten 30 Jahren verdreifacht. Stürme, Überflutungen, Dürren und Hungersnöte gehören zum Nachrichtenalltag. Wir nennen sie »Mutter Erde« oder »Mutter Natur« und heizen ihr tüchtig ein, indem wir sie plündern, vermüllen und vergiften. Mit immer raffinierteren Technologien raffen wir, was wir nur kriegen können. Wir benutzen den Planeten mitsamt seiner Atmosphäre als wilde, scheinbar kostenlose Müllkippe. Das Wasser steht uns fast bis zum Hals und so ganz nebenbei rauben wir uns die Luft zum Atmen. Alles, was wir der Erde antun, das tun wir uns selbst an. So wie die Mutter leidet, so leiden auch ihre Kinder.
Wer es immer noch nicht sieht, will es nicht sehen, will weitermachen wie bisher, als könne alles so bleiben, wie es ist, beim Alten. Man könnte verzweifeln, den Lebensmut, die Hoffnung auf Besserung verlieren. Doch für depressive Stimmung und endlose Debatten ist es zu spät. Wir haben vielleicht noch diese eine letzte Chance. Wenn schon die Europäische Union die reale Gefahr beschwört, dass die Menschheit dabei ist, sich selbst zu zerstören, dann ist es allerhöchste Zeit zum Handeln. Die Freiheit dazu haben wir. Jede und jeder kann damit beginnen, jetzt und sofort, ganz gleich, wo man sich aufhält!
Krisenmodus
Vor dem Jahr 2020 war es kaum auszudenken, was passiert, wenn Lieferketten ausfallen und die Versorgung in Frage gestellt wird. Der Corona-Pandemieausbruch hat uns gezeigt, wie Unvorstellbares zur Realität werden kann. Eine Krise löste die nächste aus: Die Gesundheitskrise führte zu einer Wirtschaftskrise. Dabei waren es Folgen eines blinden Wirtschaftens, Folgen einer rücksichtslosen Ausbeutung der Natur, die das Coronavirus hervorbrachte. Die Krisen stehen in Wechselwirkung zueinander. Es sind zwar nur jeweils die akuten Krisen, die gerade im Blickpunkt der Öffentlichkeit stehen. Die chronischen Krisen sind deshalb nicht abwesend, sie lauern weiter im Hintergrund. Die Rückzahlung der aufgenommenen Schulden wird Jahrzehnte dauern und setzt weiteres, ungestörtes Wirtschaftswachstum voraus.
Krisen liegen bekanntlich im Wesen unseres modernen Wirtschafts- und Gesellschaftssystems. Nach einer Phase des Wachstums kommt die Rezession. In der Krise verliert jeder einen Teil seiner Habe: der Reiche durch abstürzende Börsenkurse, der Arme, wenn er Arbeit und Einkommen verliert und sein Haushaltsbudget schrumpft. Dann erst merkt so mancher, dass die endlose Steigerung des Konsums kein Naturgesetz ist. Wachstumsprognosen, die gewöhnlich auf Zahlen der Vergangenheit basieren und denen man immer treuen Glauben geschenkt hat, sind dann nur noch Makulatur.
Wachstum und Rezession sind derzeit auch im Stadt-Land-Vergleich feststellbar. Das Dorf schrumpft, während die Stadt boomt. Immer mehr Menschen suchen in der Stadt die vermeintliche Krisensicherheit. Doch die Ballungsräume bergen prekäre Zustände. Im globalen Süden konzentriert sich das Elend in den Metropolen, aber auch in den reichen Ländern fordern sie ihren Tribut. Schmerzhafte Steigerungen der Wohnkosten, Existenzängste, Reizüberflutung, stressbedingte Erkrankungen, Abhängigkeit von Genussmitteln, dazu die erhöhte Ansteckungsgefahr, Enge, Lärm und Feinstaub — Begleiterscheinungen, die zunehmend Zweifel an der Stadt als idealem Lebensraum aufkommen lassen. Mit der Größe der Stadt nehmen Anonymität, Gewaltdelikte und damit die nötigen Vorkehrungen und Aufwendungen für die persönliche Sicherheit zu. Auf den Dörfern läuft der Alltag in der Tat friedfertiger ab. Ich habe diesen Unterschied schätzen gelernt.
Was geschieht mit uns Menschen, wenn wir in einer Art Dauerkrisenmodus leben? Mancher stumpft ab, flüchtet in Scheinwelten oder in Verschwörungstheorien, andere werden depressiv oder neigen zu Fatalismus, denn »machen kann man eh nix«, so der häufig zu hörende Tenor. Immer mehr Menschen sehen die Gefahr eines ohnmächtigen Ausgeliefertseins, spüren ein Unwohlsein und suchen nach einem Ausweg, nach Lösungen, vielleicht nach einem alternativen Lebensumfeld. Manche spüren eine wachsende Sehnsucht nach einem einfacheren, naturgemäßen, gesunden Leben, selbstbestimmt und friedlich, im frei gewählten Tempo und ohne Konsumnötigung. Eine Art von Lebensstil, der am ehesten außerhalb der Metropolen, fern der Konsumtempel zu realisieren wäre. Könnte es sein, dass das Landleben krisenfester, resilienter und weniger störungsanfällig ist?
In der Natur sind Krisen Ende und Anfang zugleich. Ein Ökosystem bricht zusammen, es muss weichen und ein neues entsteht. Die Natur hat alle Zeit der Welt, um Neues zu erschaffen.
Was uns Menschen eher selten bewusst wird: Rezessionen machen uns nicht nur arm. Wir können aus der Krise gestärkt hervorgehen und aus ihr lernen. Wir gewinnen an Lebenserfahrung und Einsichten, vielleicht auch eine Portion an Weisheit und Gelassenheit. Häufig beginnen wir erst in Krisenzeiten darüber nachzudenken, was wirklich für unser Leben wichtig ist. Plötzlich erscheinen uns Dinge, die wir noch gestern für unverzichtbar hielten, als banal und entbehrlich. Wir schütteln den Kopf über uns selbst. Wir stellen fest, dass wir über unsere Verhältnisse gelebt und unsere eigentlichen Bedürfnisse vergessen, ja missachtet haben. Wir beginnen zu sortieren, was bei den begrenzten Ressourcen noch leistbar ist und was nicht. Wir werden wachgerüttelt, gewinnen an Klarheit über die Welt und merken, wie verletzlich wir sind. Wir erhalten mit jeder Krise eine Chance, unserem Leben eine Wendung zu geben, verloren gegangene Freiheiten zurückzugewinnen.
Vorgetäuschte heile Welt
Wenn der Frühling anbricht, lockt es uns Menschen öfter als sonst nach draußen. Wir gehen in den Park oder unternehmen einen Ausflug in Feld und Flur vor den Toren der Stadt. Auch mich hält es dann keine Minute länger drinnen. Die aufgehende Saat, das zarte Grün, das aus den Knospen hervorbricht, erfreut das Auge und stiftet Hoffnung. Mit dem Erwachen der Natur lebt der Mensch auf, Frühlingsgefühle stellen sich ein, das war schon immer so. Unsere inneren Uhren sind mit denen der Natur aufeinander abgestimmt. Wir wollen in der schönsten Zeit des Jahres Augenzeuge des Neubeginns sein. Bald erstrahlen die Felder in sattem Gelb, wenn Ende April der Raps in Blüte steht, es ist eines der beliebtesten Fotomotive. Wer das aufblühende Geschehen nicht im Original erleben kann, bekommt es in Bildern beim Wetterbericht präsentiert.
Was viele Menschen jedoch für Natur halten, hat mit Natur nur noch wenig zu tun. Wir sehen tiefgrüne Wiesen und Felder und fühlen uns dem Natürlichen, dem Ursprünglichen dabei sehr nah. Welch ein Irrtum! Wir haben es mit verarmten, chemisch gereinigten Monokulturen zu tun. Alle unerwünschten Pflanzen werden vernichtet, nur eine einzige Art darf auf der Fläche verbleiben. Die Natur aber baut auf Vielfalt. Sie ist einer der Grundpfeiler für die Funktionstüchtigkeit ihrer Ökosysteme, sie verleiht Stabilität und ermöglicht erst die Fähigkeit zur Selbstregulation. Trotz ihrer fundamentalen Bedeutung schwindet die natürliche Vielfalt im rasanten Tempo. Nach dem Bericht der europäischen Umweltagentur EEA2020 geht es der Natur in Europa miserabel. 81 Prozent aller geschützten (!) Lebensräume und 60 Prozent der Tier- und Pflanzenarten weisen einen mangelhaften oder schlechten Zustand auf. Die Hauptschuld tragen eine nicht nachhaltige Land- und Forstwirtschaft, zunehmende Umweltverschmutzung und ein ungebremster Flächenverbrauch. Was sind die tieferen Gründe?
Es ist der wirtschaftliche Wachstumsdruck, es ist der Zwang, immer mehr und immer billiger zu produzieren. Diese aufgebauten und wachsenden Zwänge hinterlassen eine tiefe Spur der Verwüstung in der Vielfalt des Lebens. Die Biodiversität, die Vielfalt an Pflanzen und Tieren, geht uns unweigerlich verloren, wenn wir an dieser Wirtschaftsweise nichts ändern.
Anfangs wurde das Verschwinden der besonders schönen, der imposanten und possierlichen Arten beklagt. Die Orchideen zogen sich von den Wiesen zurück und der Hase machte sich vom Acker. Unbeachtet blieben die kleinen, unauffälligen Lebewesen, die Insekten, die mit Abstand zahlreichsten Vertreter der Tierwelt überhaupt. Diese hatte bis vor Kurzem kaum jemand auf dem Schirm, wenn man von den hübschen Tagfaltern einmal absieht. Derzeit rechnen die Wissenschaftler mit über acht Millionen Tierarten auf der Welt, überwiegend Insekten. Davon sind aber erst zwei Millionen Arten wissenschaftlich beschrieben. Das bedeutet: Drei Viertel der Tierarten auf unserem Heimatplaneten sind uns bislang fremd geblieben. Unzählige davon stehen auf der Kippe. Die Artenvielfalt schrumpft derzeit einhundert Mal schneller als ohne menschliches Zutun. Knapp 40.000 Tier- und Pflanzenarten sind akut vom Aussterben bedroht. Die meisten Menschen in den Städten bekommen von dem rasanten Artensterben kaum etwas mit und auch unter den Landbewohnern fällt oft nur den Älteren auf, dass da etwas nicht stimmt, dass es immer stiller und einförmiger in ihrem Umfeld wird.
Während die halbe Welt nach Jahrzehnten des Verdrängens endlich über den Klimawandel diskutiert, spielt sich im Hintergrund diese andere weltweite Tragödie ab, über deren dramatische Konsequenzen wir uns kaum bewusst zu sein scheinen. Wir sind Zeitzeugen und erleben gerade das größte Artensterben seit dem Verschwinden der Dinosaurier.
Abbildung 2: Derzeit läuft das größte Aussterben von Pflanzen- und Tierarten seit dem Verschwinden der Dinosaurier vor 66 Millionen Jahren. Laut UN-Bericht des Weltbiodiversitätsrates sind bis zu einer Million Arten vom Aussterben bedroht.
Damals, vor 66 Millionen Jahren, schlug ein gewaltiger Meteorit auf die Erde ein. Er verwüstete das Land und verdunkelte den Himmel für Jahre, die Pflanzen gingen ein und die großen Pflanzenfresser verhungerten. Nur wenige kleine, unterirdisch lebende Tierarten, die sich von Samen, Wurzeln und anderen Pflanzenresten ernähren konnten, überstanden das Inferno. Aus ihnen gingen die Säugetiere hervor, die nach den »Dinos« ihre Blütezeit erfuhren. Was damals der Meteorit bewirkte, übernimmt gerade der moderne Mensch. Mit seinen nicht enden wollenden Ansprüchen setzt er die Existenz vieler Lebewesen aufs Spiel. Aber was sollten uns Halbaffen und namenlose Insekten in den Baumkronen von Urwaldriesen kümmern, wenn es doch mit uns und unserer Wirtschaft immer bergauf geht?
Man kann es sich nur schwer vorstellen: Genau diese Winzlinge haben die größte Bedeutung für unser Überleben. Die Insekten in ihrer ganzen Vielfalt sind es, die uns indirekt ernähren, indem sie Blüten bestäuben, so dass die Pflanzen Früchte tragen und Samen ausbilden. Sie sind eine tragende Säule der Nahrungspyramide, auf deren Spitze sich eine einzige Art, nämlich der Mensch breitgemacht hat und noch über den Raubtieren thront. Diese Säule und mit ihr die komplette Pyramide bekommt immer mehr Löcher und Risse, sie wird schmaler und wackliger. Somit zerstören wir Menschen nicht nur die Nahrungsgrundlage für Fische und Vögel, sondern auch unsere eigene natürliche Lebensbasis.
Viele Menschen halten den Wald für die reine Natur, dort sei sie noch in Ordnung, so der Glaube. Doch die Wahrheit ist eine andere: In den Waldgebieten Mitteleuropas dominieren Fichten und Kiefern, sie wurden künstlich angelegt, um schnell viel Holz zu produzieren, es sind artenarme Forsten und sie sind alles andere als stabil. Nadelwaldforsten sind die reinsten Pulverfässer in Zeiten der Erderhitzung. Den steigenden Temperaturen, den zunehmenden Dürrezeiten, den Stürmen und der Brandgefahr haben sie kaum etwas entgegenzusetzen. Bei diesem Dauerstress haben auch Borkenkäfer & Co. ein leichtes Spiel. Gesunde und gut versorgte Bäume weisen durch klebrige Harzabscheidungen die Angreifer in die Schranken. Doch die kraft- und saftlosen, gestressten Einheitsbäume laden die Forstschädlinge geradezu ein, sich zu vermehren und auszubreiten. Der Anblick des Harzes hat mich persönlich tief erschüttert: Einst grüne Gebirgszüge präsentieren sich als ergrautes landschaftliches Skelett. Die Hälfte der Fichtenbestände hat das Waldgebirge in nur drei Jahren eingebüßt. In anderen Waldgebieten sieht es nicht viel anders aus.
Noch alarmierender ist es um die meisten Felder im gesamten Land bestellt. Auch wenn sie im Frühjahr durchweg tiefgrün erscheinen, ist die Agrarlandschaft weitgehend zu einer ökologischen Wüste verkommen. Wenn man die Felder nicht ständig mit Giften besprühte, um Insekten und Pilze abzutöten, würden die Ackerkulturen in ähnlicher Weise kollabieren wie die Wälder. Die großflächigen, einförmigen Anbausysteme sind Zuchtstationen für Schaderreger. Die meisten Felder kommen ohne regelmäßige Giftspritzungen nicht mehr über die Runden. Ohne Chemie scheint fast nichts mehr zu wachsen. Unser Weizen wird fünfmal, unsere Kartoffeln zehnmal im Jahr gespritzt und Apfelplantagen sogar 21 Mal, wie die Bundesregierung auf eine Anfrage mitteilte. Äpfel gehören neben Wein zu den chemieintensivsten Kulturen. Doch ist die permanente Begiftung unserer Landschaften eine dauerhafte Lösung? Klar ist: Der Wettlauf gegen die Schädlinge ist mit der chemischen Keule nicht zu gewinnen.
Lange wurden die Risiken und Nebenwirkungen kleingeredet und verdrängt. Gerne glaubte man den Versprechungen der Hersteller, dass die Wirkstoffe unbedenklich seien. Das ging mir genauso. Als in den 1960er Jahren die Insektengifte käuflich zu erwerben waren, habe ich — so wurde es empfohlen — das graue, staubige Pulver in einen feingewebten Nylon-Damenstrumpf gefüllt und es ohne jeden Schutz über die Kartoffelpflanzen gestäubt, um die Larven des Kartoffelkäfers abzutöten. Jahre später jobbte ich als Student einige Nachtschichten in einem Magdeburger Chemiebetrieb, in dem eines dieser Insektengifte hergestellt wurde. Es war das Gamma-Hexachlorcyclohexan, getauft auf den schönen Namen »Lindan«. Meine Arbeitskleidung stank danach derart widerlich, dass ich sie für immer entsorgen musste.
Mit zunehmendem Wissen wuchs meine Skepsis. Rachel Carsons Buch »Der stumme Frühling«, 1962 in den USA, 1963 erstmals in Deutsch erschienen und auf geheimen Wegen in die DDR geschmuggelt, öffnete mir die Augen. Es wirkte wie ein Alarmsignal. Die Autorin beschreibt detailliert die verheerenden Wirkungen von Pestiziden auf die Vögel und die Gesundheit der Menschen. Das Buch avancierte zur Bibel der weltweiten Umweltbewegung.
Die Agrargifte, selbst die längst verbotenen, tauchen inzwischen überall in unserer Umwelt auf: Im Boden, im Wasser, über die Nahrungskette gelangen sie in unser Essen, in unser Blut, in die Muttermilch. Pestizide, die für Bienen tödlich sind, sind auch für uns Menschen alles andere als gesund. Am Ende gibt es nur Verlierer — sowohl der Mensch als auch die Natur sind die Leidtragenden.
Jahrzehntelang haben die regierenden Politiker diese Form des Wirtschaftens als »gute fachliche Praxis« gedeckt und für angemessen befunden — entgegen allen Warnungen aus der Wissenschaft. Die Industrielobby hat »gute« Arbeit geleistet und dabei nicht schlecht verdient. Aber wer zahlt den Preis?
Nicht nur der Mensch, auch die Natur ist erfinderisch. Womit kaum jemand gerechnet hat: Die Schaderreger setzen sich zur Wehr. Sie werden zunehmend resistent gegen den Gifteinsatz. Mutationen machen es möglich. Kartoffelkäfer scheren sich kaum mehr um Insektizide und sogenannte Problemunkräuter, wie Windhalm und Fuchsschwanz, verschwinden trotz Herbizidspritzung nicht mehr vom Acker, sondern breiten sich weiter aus.
Was uns blüht …
Es hat geregnet, die ganze Nacht hindurch. Noch hängen die Wassertropfen an den Spitzen der Kiefernnadeln und spiegeln die aufgehende Sonne wie kleine Glaskugeln. Die meterhohen Gräser beugen sich mit ihren Blütenständen unter der ungewohnten Wasserlast. Kein Windhauch hatte die Regenwolken vertrieben. Wer hat nicht darauf gehofft? Die Bäume kämpfen um ihr Überleben, die Waldwege staubten bis gestern bei jedem meiner Schritte. Nun endlich brachte der Landregen Entspannung. Der Morgengesang der Vögel klingt frischer als sonst, er klingt nach Aufbruch. Alles scheint mit mir aufzuatmen. Die Luft ist rein wie lange nicht. Die Singdrossel in ihrem getupften Federkleid hatte bislang nur schmale Kost. Jetzt hüpft sie am Wegrand entlang und hofft auf den dicken Regenwurm, der lange im Untergrund ausharrte und sich jetzt vielleicht an die Oberfläche wagt. Nebenan auf der Wiese triumphiert das Kranichpaar im Duett, es scheint den Regen als großes Glück zu feiern. Dem Paar fehlte in diesem Frühjahr im Umfeld ihres Nestes das schützende Wasser für eine erfolgreiche Brut. Vielleicht klappt es im Folgejahr. Auch die Kranichhoffnung stirbt zuletzt.
Kraniche gab es auch schon vor drei Millionen Jahren, im Zeitalter des Pliozäns, allerdings weniger in unseren Breiten. Dafür streiften Elefanten und Giraffen durch Europas Savannen. Der Homo sapiens war noch längst nicht in Sicht. Die Temperaturen lagen in dieser fernen Wärmeperiode um drei Grad höher als in heutiger Zeit. Es gab kein Grönlandeis mehr und der Meeresspiegel lag um fast 20 Meter höher als heute. Forscher von der University of Southampton haben Fossilien aus jenem Zeitraum untersucht, in denen auch Spuren der damaligen Atmosphäre konserviert waren. Die Ergebnisse der Gasanalysen überraschten und sollten uns sehr zu denken geben: Die damalige CO2-Konzentration ist nahezu identisch mit dem gegenwärtigen CO2-Wert von 410 ppm. Das bedeutet nicht mehr und nicht weniger, dass unsere Treibhausgase schon jetzt eine Größenordnung erreicht haben, die einer Heißzeit entspricht. Diese Heißzeit ist nur deshalb noch nicht eingetreten, weil das globale Klima träge und zeitversetzt reagiert. Noch hat unser Planet Pufferkapazitäten. Wann diese aufgebraucht sein werden, wissen wir nicht. Wie drückte es der bekannte deutsche Klimaforscher und Gründungsdirektor des Institutes für Klimafolgenforschung in Potsdam (PIK), Hans Joachim Schellnhuber, aus: »Wir werden viel mehr Glück brauchen, als wir Verstand haben.«
Abbildung 3: Seit Beginn der Aufzeichnungen 1880 ist die globale Temperatur exponenziell um über ein Grad angestiegen, davon zur Hälfte in den letzten drei Jahrzehnten.
Während manche Menschen noch zweifeln oder darüber streiten, ob es einen Klimawandel überhaupt gibt, haben einige Vogelarten die globale Erwärmung bereits wahrgenommen und Konsequenzen gezogen. Schon Ende des letzten Jahrhunderts wanderten Vogelarten in Mitteleuropa ein, deren Heimat eigentlich der Mittelmeerraum ist. Ich staunte nicht schlecht, als ich erstmals den strahlend weißen Silberreiher und den exotisch bunten Bienenfresser an der Elbe entdeckte. Inzwischen brüten Hunderte von Bienenfressern in meiner Region und es werden jährlich mehr. Einwanderer gibt es auch unter den Möwen. Zu den heimischen Möwen gesellen sich immer öfter Mittelmeermöwen und Steppenmöwen. Schon deren Namen verraten einiges über ihre Klimaansprüche. Vögel haben eine feine sensorische Wahrnehmung, sie sind uns in dieser Disziplin klar überlegen, sie zweifeln nicht, sie handeln! Das merke ich auch am Verhalten unserer Gänse, die alles andere als »dumm« sind. Während unsere heimischen Graugänse noch vor Jahrzehnten als Zugvögel im Herbst bis nach Südwesteuropa zogen, überwintern sie inzwischen auch an der Elbe. Sie ersparen sich die anstrengende Flugreise, denn unsere schneearmen Winter lassen keinen Mangel an Grünfutter aufkommen. Auf der anderen Seite vermisse ich zunehmend die großen Schwärme von Saatgänsen, die einst ab Oktober zu Zehntausenden aus den Sumpfgebieten der russischen Tundra einflogen, um in den Wintermonaten auf dem Wasser der Elbe zu nächtigen. Sie haben dazugelernt und verkürzen ihre Flugrouten ebenso wie die ruflustigen, nordischen Singschwäne, deren Nachtkonzerte mir in der Winterstille sehr fehlen.
Inzwischen merken auch wir es in der Stadt und auf dem Land: Das Klima wird wärmer und extremer. Während Epidemien kommen und gehen, kennt die menschengemachte Erderwärmung bei allen natürlichen Schwankungen nur eine Richtung: Die globale Temperatur geht immer steiler nach oben. Lange Zeit wurde der Treibhauseffekt verharmlost (»Der Weinanbau wird profitieren!«). Nun schlägt die Krise mit voller Wucht zu. Die sich häufenden Wetterextreme sind nur der Anfang eines Prozesses, der sich selbst beschleunigen wird, wenn immer mehr Kipppunkte überschritten werden, die wiederum Dominoeffekte auslösen können. Schutzimpfungen wird es dagegen ebenso wenig geben wie eine Herdenimmunität und auch Schnelltests helfen nicht weiter. Einer dieser möglichen Kipppunkte ist der Golfstrom, der warmes Wasser aus der Karibik bis in den Nordatlantik befördert. West- und Nordeuropa erfreuen sich dadurch eines wintermilden Klimas. Nach einer internationalen Studie von 2021 unter Leitung von Professor Stefan Rahmstorf vom PIK Potsdam hat sich dieser Meeresstrom infolge des Klimawandels in den letzten sieben Jahrzehnten »beispiellos« abgeschwächt wie seit 1000 Jahren nicht mehr. Befürchtet werden dadurch extremere Wetterlagen, darunter mehr Winterstürme sowie heißere und trockene Sommer. Weitere mögliche Kipppunkte sind das Abschmelzen der Eismassen der Arktis und der Antarktis. In absehbarer Zeit kann Millionen Menschen das Wasser bis zum Halse stehen. Sie werden keine andere Wahl haben: Wenn sie überleben wollen, müssen sie vor den Fluten flüchten. Bis Mitte dieses Jahrhunderts wird mit 50 bis 200 Millionen Klimaflüchtlingen gerechnet. Andere Gebiete unserer Erde können zu unfruchtbaren und unbewohnbaren Wüsten verkommen. Neue Völkerwanderungen sind unausweichlich.
Wie wird sich das Leben in unseren Städten verändern? Das Mittelmeerklima kommt nach Mitteleuropa, das ist kaum noch aufzuhalten. Wie Klimawissenschaftler schon heute feststellen, heizen sich Städte an Sommertagen um bis zu zehn Grad mehr auf als das Umland. Beton und Asphalt wirken als Wärmespeicher und die zunehmend versteinten Vorgärten, ich nenne sie »Gärten des Grauens«, verschärfen das Problem. Tropennächte häufen sich in unseren Breiten. Werden offene Fenster noch die erwünschte Abkühlung für den nächtlichen Schlaf bringen? Oder geht es nur noch mit Klimaanlagen? Das Schizophrene: Diese Anlagen — in Häusern wie in Fahrzeugen — laufen noch viele Jahre anteilig mit fossilen Energieträgern und heizen damit das Klimageschehen weiter an. Als Extra-Klimakiller kommen die verwendeten fluorhaltigen Kältemittel (FKW) hinzu, die pro Molekül 2000 Mal schädlicher auf unser Klima wirken als das CO2, so das Öko-Institut. So wie die Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) wegen ihrer zerstörenden Wirkung auf die Ozonschicht weitgehend verboten wurden, müssen auch die FKWs schnellstmöglich aus dem (Auto-)Verkehr gezogen und durch CO2 als fluorfreies Kältemittel ersetzt werden. Damit ließe sich nach Experteneinschätzung ein halbes Grad an Erderwärmung bis 2100 einsparen.
Unser Überleben hängt in der Tat an einem seidenen Faden — am Klimafaden und am Faden der Energieversorgung. Was würde passieren, wenn die Stromversorgung ausfällt oder gar sabotiert wird? Technik ist hilfreich, macht aber auch verletzlich. Wir bilden uns ein, als freie Menschen zu leben, doch unsere Abhängigkeit von den Versorgungsstrukturen ist inzwischen total.
Wer es leugnet, steckt seinen Kopf in den Sand, was nicht einmal der Strauß wirklich tut. Wir sind von Krisen eingekreist, umzingelt. Es ist höchste Zeit, Natur neu zu lernen, zu verstehen und mit ihr zu kooperieren, statt sie ohne Pardon ausbeuten zu wollen. Nicht wir, die Natur weiß es besser! Wir, ihre Kinder, sind abhängig von der Natur und nicht umgekehrt. Jetzt geht es darum, sich auf die Wurzeln des Lebens zu besinnen und sich von scheinbar bequemen, aber letztlich doch fatalen Abhängigkeitsspiralen und Zwangsstrukturen zu befreien.
Kinder der Natur
Wir müssen endlich erkennen: Unser Wirtschaftssystem macht die Natur und letztlich uns selbst krank. Die ökologischen Belastungsgrenzen sind erreicht und überschritten. Zu lange glaubte man, die Natur beherrschen, austricksen zu können. Bis zum Letzten wurde und wird sie ausgebeutet. Nun stehen wir kurz vor einer Kapitulation. Wir brauchen dringend Alternativen, die sich an den Regeln der Natur orientieren.
Mein Wohnort liegt am Rande des Großschutzgebietes »Mittelelbe«. Schon 1979, noch in der DDR, wurde es von den Vereinten Nationen als erstes Biosphärenreservat ganz Deutschlands anerkannt. Mensch und Natur, so die Zielstellung der UNESCO für Biosphärenreservate, sollten in Harmonie koexistieren. Kurz vor der deutschen Wiedervereinigung wurden die Schutzgebiete erweitert und neue kamen hinzu. Die Nationalparks und Biosphärenreservate der DDR wurden als »Tafelsilber der Deutschen Einheit« gefeiert. Wenigstens hier sollte die Umwelt einigermaßen in natürlicher Ordnung sein. Aber selbst innerhalb der Schutzgebietsgrenzen leidet die Natur. Eichen, Eschen und Kiefern sterben reihenweise. Die überall aufgestellten Schutzgebietsschilder schützen nicht mehr. Ich erlebe es vor meiner Haustür: Die zunehmenden Dürreperioden, die überzogene Entwässerung und die stetige Vertiefung der Elbe durch die Verfolgung sinnloser Wasserstraßenpläne setzen den Wäldern und Auen im Biosphärenreservat zu. Es fehlt vor allem am Lebenselixier Wasser. Die Natur erledigt nun das, was sie tun muss: Das Kranke wird aussortiert, wirtschaftliche Fehler werden korrigiert und Platz für Neues, Gesundes geschaffen.
Noch schlechter ergeht es jenen Flächen innerhalb der Schutzgebiete, die landwirtschaftlich intensiv genutzt werden. Man mag es kaum glauben: Agrargifte in Schutzgebieten anzuwenden, ist in Deutschland zulässig, ja sogar Normalität. Das regelmäßige Spritzen mit Herbiziden, wie dem Unkrautvernichter Glyphosat, lässt alles pflanzliche Leben in kürzester Zeit ersticken. Kein Kräutlein bleibt am Leben, ein stilles Massensterben in der Fläche. Es irritiert mich immer wieder: Mitten im Frühling sind die Felder durchweg braun.
Und wie ergeht es den wild lebenden Tieren in unseren Schutzgebieten? Es sollte ihnen besser als anderswo gehen, möchte man meinen. Doch viele von ihnen sind auf dem Rückzug, vor allem die Offenlandarten und die der Feuchtgebiete. Bienen, Schmetterlinge, Libellen, Vögel und Amphibien haben es schwer. Ihre Lebensräume werden überdüngt und vergiftet. Aufmerksame Naturbeobachter beklagen diesen Trend seit Jahrzehnten, doch sie wurden lange nicht erhört. Endlich, 2021 hat auch die EU Deutschland wegen unzureichender Umsetzung der geltenden Naturschutzrichtlinien verklagt.
Wer weit weg, wer in der Stadt lebt, wer sein Leben zwischen Arbeit und Konsum verbringt, bemerkt das stille Sterben nicht. Oder er will es nicht bemerken. Doch das Wegschauen ist keine Lösung. Es geht nicht nur um das Überleben bunter Schmetterlinge und trällernder Vögel. Diese Tiere sind wichtige Botschafter der Natur. Mit ihrem Verschwinden verkünden sie die Gefährdung der Lebensgrundlagen, auch die von uns Menschen. Unsere Nahrungsmittelsicherheit und unsere Gesundheit sind eng mit dem Zustand unserer Natur verknüpft. Nur in einer gesunden Umwelt können auch wir Menschen gesund bleiben.
Ein weithin vernommenes Aufbruchssignal war das erfolgreiche Volksbegehren »Artenvielfalt und Naturschönheit in Bayern« im Jahr 2019, an dem 1,7 Millionen Wahlberechtigte teilgenommen haben. Ihr einhelliges Votum hat die Bayerische Staatsregierung zum Handeln und zur neuen Gesetzgebung genötigt — ein Paradebeispiel, wie durch gut organisierte Aktionen von unten demokratische Mitbestimmung funktionieren kann.
Wenn wir aufmerksam sind, können wir es wahrnehmen: Die Natur ruft um Hilfe. Ignorieren wir sie weiter, werden wir von einer Krise in die nächste stürzen. Das kann niemand wirklich wollen. Es ist mein Job und unser aller Job, die fundamentalen Lebensgrundlagen zu bewahren. Wir müssen unseren Blick weiten. Das vielfältige Leben draußen auf dem Land braucht uns und wir brauchen es genauso, egal, wo wir gerade zu Hause sind. Wir, die Kinder der Natur.
Land liefert
Betrachten wir das Verhältnis von Stadt und Land in unserer modernen Gesellschaft analytisch, so ist unschwer zu erkennen: Das Ökosystem Land liefert, das Ökosystem Stadt verbraucht. Kein anderes Ökosystem wächst so rasant wie die Stadt, allerdings auf Kosten der übrigen Ökosysteme. Die Stadt verbraucht zum Wachstum den Boden, das Wasser, die Luft, das Klima, die Pflanzen und die Tiere bis in die ländlichen Lebensräume hinein. Es ist uns kaum bewusst: Alles Lebensnotwendige kommt vom Land. Vom Sauerstoff über die Nahrung, die Energie, die Baustoffe für die Infrastruktur bis hin zu den Rohstoffen für die Industrie. Die Stadt hängt am Tropf ihres Umlandes. Ihr Energie- und Rohstoffhunger scheint grenzenlos und sie produziert große Mengen Abfall, Abwasser und Abluft. Das alles will, ja muss die Stadt wieder loswerden. Nur wie? Mülldeponien, Müllverbrennungsanlagen und Kläranlagen finden sich meist weit draußen vor den Toren der Stadt.
Weit draußen wachsen die Wälder. Die Wälder, so sagt man, spiegeln die Seele und die Befindlichkeit der Deutschen wider. Nur wie steht es um deren Befindlichkeit? Die Wälder schlucken lautlos den Staub und die Abgase. Sie verwandeln auf wunderbare Weise das Treibhausgas Kohlendioxid in lebensstiftenden Sauerstoff und in Zellulose. Sie erledigen die »Filterarbeit« als Dienstleistung wie selbstverständlich, dazu absolut klimaneutral. Doch zunehmend ächzen unsere Wälder unter dieser steigenden Last. Sie sind gestresst, überfordert, sie schwächeln und sterben nach und nach ab. Neben dem Wald wird die Atmosphäre als scheinbar kostenloser Müllschlucker für die Abgase missbraucht. Seit Beginn der Industrialisierung und Verstädterung steigt die Konzentration der Treibhausgase unvermindert an, diese werden bildhaft »auf Halde gekippt«.
Somit versorgt der außerstädtische Raum die städtischen Ballungsräume nicht nur mit dem Lebensnotwendigen, er übernimmt auch die Entsorgung von Überflüssigem und Schädlichem. Mit diesem Tatbestand erfüllt die Stadt in zweifacher Hinsicht die Kriterien eines Öko-Schmarotzers. Bliebe der Abfall nach dem Verursacherprinzip innerhalb der Stadt, wäre sie binnen kurzer Zeit zugemüllt. Von Ausgrabungen kennt man sie, die sogenannten Kulturschichten, bestehend aus Abfall, der einfach auf der Straße landete. Antike Städte wuchsen zu Anhöhen. Auch Paris oder London bewegen sich seit 2000 Jahren kontinuierlich nach oben. New York steht auf einer viele Meter mächtigen Müllschicht. Inzwischen sind die Müllmengen exorbitant gewachsen. Wenige Wochen ohne städtische Müllabfuhr, und es kommt zur Krise, es stinkt zum Himmel und Krankheitserreger haben freie Entfaltungsmöglichkeiten. Fazit: Eine Stadt ist ohne das befreiende Land nicht lebensfähig. Sie wäre im wahrsten Sinne des Wortes zum Untergang verurteilt.