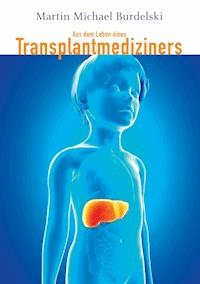
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Prof. Martin Burdelski begann seine Ausbildung zum Kinderarzt in Hannover. Als einer der ersten Kinderärzte in Deutschland wurde er in der gastrointestinalen Endoskopie und der Laparoskopie bei den Erwachsenen-Gastroenterologen ausgebildet. Bis zu seinem Ausscheiden aus der aktiven Pädiatrie hat er mehr als 5000 Endoskopien bei Kindern durchgeführt. 1978 wurde im Hannoveraner Team die erste Kinder-Lebertransplantation in Deutschland vorgenommen. Im Laufe der Zeit hat Prof. Burdelski fast 1000 Kinder-Lebertransplantationen in Hannover, Hamburg, Kiel und Riad als Verantwortlicher betreut. Kollegen in Ungarn, Bulgarien und Saudi-Arabien wurden in der pädiatrischen Lebertransplantationsmedizin ausgebildet. Sein wissenschaftliches Werk umfasst mehr als 180 Publikationen, Buchartikel und Bücher. An Auszeichnungen wurden ihm 2006 der Helmut Werner-Preis von „Kinderhilfe Organtransplantation“ (KiO) und 2012 der „Distinguished Service Award“ der Europäischen Gesellschaft für Gastroenterologie, Hepatologie und Ernährung (ESPGHAN) verliehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 47
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Der Anfang 1978
Die Zeit in Hannover
Die Zeit in Hamburg
Die Zeit in Kiel
Die Zeit in Riad
Rückblick
Vorwort
Mit dem Titel dieser Aufzeichnungen möchte ich keine falschen Assoziationen wecken. Ich bin weder ein begnadeter Schriftsteller noch ein Romantiker, mein Bericht enthält auch keine romantischen Inhalte. Er stellt lediglich den Versuch dar, eine rasante Entwicklungsperiode der Medizin aus meiner Perspektive festzuhalten, in die ich fast zufällig involviert war. Meine Begegnung mit der Lebertransplantation ist vergleichbar mit dem Kennenlernen der Jugendliebe, die einen – und hier gibt es dann doch eine Parallele zu Joseph von Eichendorff – nicht mehr loslässt, selbst jetzt, nach mehr als 35 Jahren.
Der Anfang 1978
„Wir können Kindern eine neue Leber einpflanzen. Wer kann sich um sie kümmern?” Da niemand außer mir im Raum war, der auf diese Frage von Professor Brölsch hätte antworten können, blieb mir nichts anderes übrig, als dieser Aufforderung – und als solche war sie gemeint – zuzustimmen. Daraus wurde eine Aufgabe, die mein Leben und auch das meiner Familie bestimmt und entscheidend geprägt hat. Sie erwies sich als schwierig und beglückend zugleich. In der Zeit von 1978 bis heute, 2015, habe ich alles erlebt, Überleben und Sterben, Erfolg und schmerzliche Niederlagen, Freundschaften und Anfeindungen. Vor allem aber habe ich Kinder und Erwachsene in ihrem ganzen Spektrum von Eigenschaften, Eigenheiten, Wünschen und Vorstellungen kennengelernt. Dies nicht nur in Deutschland, sondern auch in allen Ländern, in die mich meine Tätigkeit geführt hat.
Als ich Jugendlicher war, reifte mein Wunsch, Mediziner zu werden, zu einem festen Entschluss. Einige Jahre später, während des Studiums in Bonn, der kleinen Stadt am Rhein mit der dort wie in meiner Heimatstadt Düsseldorf prägenden positiven Lebenseinstellung, reduzierte sich Medizin schon auf die Kinderheilkunde. Ich hatte in vielen Praktika erfahren müssen, dass die Innere Medizin, so wie ich sie dabei kennenlernen konnte, im Wesentlichen Geriatrie bedeutet, mit keiner erfreulichen langfristigen Prognose bei Alzheimer und anderen, mit dem Alter assoziierten Erkrankungen. Anders stellte sich die Pädiatrie dar. Sie erlaubte Kindern in den meisten Fällen einen guten Start ins Leben.
Die Aufgaben eines Kinderarztes haben mich geformt. Ich habe mich immer viel mehr als Kinderarzt denn als Spezialist mit Schmalspur-Denken und -Wissen empfunden. Ohne profunde Kenntnisse in der allgemeinen Pädiatrie hätte ich auch die Probleme und Komplikationen, die mit der Transplantation auf mich zukommen sollten, niemals in den Griff bekommen können.
Zu Beginn meiner Tätigkeit gab es wie in anderen Subdisziplinen der Kinderheilkunde wie Kinderneurologie, -Pulmonologie, - nephrologie, - kardiologie oder -onkologie auch in der -gastroenterologie positive und negative Erfahrungen mit akuten und chronischen Leiden. Hier hat mich vor allem die sogenannte extrahepatische Gallengangsatresie beschäftigt. Sie hat uns die Grenzen unseres Könnens zur damaligen Zeit unbarmherzig vor Augen geführt:
Bei der Geburt gesunde, proppere Neugeborene entwickelten innerhalb weniger Tage und Wochen nach ihrer Geburt eine Gelbsucht, bekamen einen unerträglichen Juckreiz, nach Wochen einen Trommelbauch, Leistenbrüche, einen grausamen Schwund der Muskulatur, sodass sie aussahen wie gelbe Biafra-Kinder. Sie hatten fragile Knochen, die aus nichtigem Anlass zerbrachen. Die Eltern und Geschwister hatten keine ungestörte Nachtruhe mehr, denn der Juckreiz quälte nicht nur die betroffenen Kinder, sondern auch die gesamte Familie. Dazu kam eine soziale Isolation. Man rückte auf dem Spielplatz von dieser Familie weg, weil es „ansteckend“ sei. „Dass aber auch so kleine Kinder schon Alkohol bekommen.“
Die Kinder wurden uns meist nach vielen Irrwegen im Alter von wenigen Monaten mit allen Zeichen einer Lebererkrankung im Endstadium vorgestellt. Es gibt keine andere Lebererkrankung, die innerhalb weniger Wochen zu einem so kompletten Leberumbau und dann zu einem chronischen Leberversagen führt, als diese Gallengangsatresie. Bei der Hepatitis B und C beim Erwachsenen oder bei den sogenannten nutritiv-toxischen Lebererkrankungen durch Alkohol oder der primär biliären Zirrhose dauert es zum Beispiel bis zu einem vergleichbaren Endstadium in der Regel Jahrzehnte.
Patient mit massivem Aszites (Bauchwasser), riesiger Milz und Leber, Leistenbruch, hochgedrängtem Zwerchfell, „rachitischem Rosenkranz“ „Muscle wasting“ bei einem Endstadium einer sekundär biliären Zirrhose
Die betroffenen Kinder blickten uns mit großen Augen mit auffällig langen Wimpern an, wollten nichts essen, und nichts, aber auch gar nichts konnten wir mit Medikamenten mehr ausrichten. Diese Kinder starben qualvoll: Bluterbrechen durch geplatzte Krampfadern in der Speiseröhre, schmerzhaft durch Bauchwasser aufgetriebener Bauch, sodass kaum noch Platz für die Lungen übrig blieb, und das mit einem chronischen Leberversagen verbundene Koma, das man riechen konnte: Es riecht nach einem verfaulten Apfel. Die Eltern, aber auch wir, Schwestern und Ärzte, standen hilflos daneben und waren froh, dass die Quälerei dann endlich einmal vorbei war.
Die „Hannover Schule“ der Transplantchirurgen
Die „Hannover Schule“ der Transplantchirurgen
Auch wenn wir heute immer noch nicht die Ursachen dieser Erkrankung kennen, behandeln können wir die Erkrankung und auch die meisten anderen kindlichen Lebererkrankungen mithilfe der Lebertransplantation schon. Diese Behandlungsmöglichkeit stellt eine epochale Umkehr dar: Das Versagen der medikamentösen Therapie bei einer internistischen Erkrankung wird durch eine chirurgische Behandlung kompensiert.
Die „Hannover Schule“ der Pädiatrischen Transplantmediziner
Die „Hannover Schule“ der Pädiatrischen Transplantmediziner
Der Weg zu dieser Operation war in den Vereinigten Staaten erstmals aufgezeigt worden. Es waren dafür Ärzte gefordert, die bereit waren, über Grenzen oder das, was man damals als Grenze empfand, hinwegzugehen. Thomas Starzl, ein Amerikaner mit österreichischen Wurzeln, war der Erste, der den Mut zu solchen Schritten hatte. 1968 gelang ihm nach einigen zuvor erlittenen Fehlschlägen die erste erfolgreiche Lebertransplantation





























