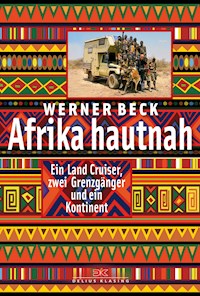Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Delius Klasing
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ist weniger mehr? Mit dieser Frage im Gepäck bricht der Autor in die Wildnis Sibiriens auf. Im Selbstversuch testet er, wie man dort fern jeder Zivilisation überleben kann. Spannend und schonungslos erzählt Beck in diesem Reisebericht von seinem Jahr in einer Jurte, in der er sogar den sibirischen Winter mit Extremtemperaturen von 35 Grad minus übersteht. Bis das Eis ihn bei einer Wanderung über den zugefrorenen Baikalsee fast verschlingt. Von den überall lauernden Gefahren berichtet Beck ebenso wie vom Glück der Stille und von der Faszination, die eine noch unberührte Natur auslösen kann. Ein Jahr am Baikalsee: sibirische Eiswüste, ursprüngliche Natur, ein Ort abseits der Hektik unserer zivilisierten Welt. Das ultimative Buch für Abenteuerlustige und Liebhaber von Extremreisen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 286
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für meine Frau Heti
ohne sie gäbe es diese Erfahrung nichtohne sie gäbe es diese Geschichte nichtohne sie gäbe es dieses Buch nicht
1. Auflage
© by Delius, Klasing & Co. KG, Bielefeld
Folgende Ausgaben dieses Werkes sind verfügbar:
ISBN 978-3-7688-3346-2 (Print)
ISBN 978-3-7688-8141-8 (E-Book)
ISBN 978-3-7688-8334-4 (E-Pub)
Lektorat: Birgit Radebold/Anja Ross
Fotos: Werner Beck
Karten: Inch3, Bielefeld
Umschlaggestaltung: Buchholz.Graphiker, Hamburg
Datenkonvertierung E-Book: HGV Hanseatische Gesellschaft für Verlagsservice, München
Alle Rechte vorbehalten! Ohne ausdrückliche Erlaubnis des Verlages darf das Werk, auch Teile daraus, nicht vervielfältigt oder an Dritte weitergegeben werden.
www.delius-klasing.de
Inhalt
Prolog
Ist weniger mehr?
9000 Kilometer immer der Sonne entgegen
Irkutsk, unerwartete Hürden
Am Tiefpunkt
Ust Barguzin – das Tor zur Wildnis
Der Würfel ist gefallen
Mausetot
Feuersbrunst
Die Pest der Taiga
Der Mann aus dem Nichts
Explosion am Strand
Abschied in der Finsternis
Allein
Die letzte Chance
Teufelsritt
Heiligabend – zum Davonlaufen
Gefährliches Eis
Eiskalt erwischt
Das Auge Sibiriens
Das Omen
Hinterhältige Bestie
Das bisschen Haushalt
Aufbruch ins Ungewisse
Die Insel der Vergessenen
Verzweifelt im Brucheis
Epilog
Prolog
Vollkommen allein!
Was um alles in der Welt mache ich Narr hier?
Das Eis unter meinen Filzstiefeln explodiert. Es schwingt, Haarrisse zischen und durchzucken die zernarbte, gefrorene Fläche. Spalten brechen auf. Pfeifen und Dröhnen erschüttern Mark und Bein.
Gnadenlos brechen die Naturgewalten über mich herein. Todesangst lähmt mich. Ich renne, renne um mein Leben. Die Risse klaffen immer weiter auseinander. Ich springe darüber hinweg und weiß nie: Trägt die Scholle? Bricht sie? Kippt sie? Dieses verdammte Eis will mich verschlingen.
Wird das eisige Wasser mein Grab?
Schweißgebadet wache ich auf. In wiederkehrenden Albträumen verfolgt mich die Angst vor der Gefahr auf dem Eis den ganzen langen, sibirischen Winter.
Denn dieses Schockerlebnis bei meiner ersten Eisexkursion zu Beginn des Kälteeinbruchs hat mir gezeigt, wie schnell das Limit überschritten sein kann.
Ist weniger mehr?
Angst, die Geißel der Menschheit, lähmt mit der ewigen Frage: »Ist das gefährlich?«
Aber die größte Gefahr beginnt mit dem Leben. Leben will ich intensiv. Also schob ich die Grenzen der Angst langsam, aber stetig, immer weiter hinaus.
Ob auf einem Tempelelefanten in Südindien, in einem Seekajak im Nordpazifik auf der Suche nach Killerwalen, mit Hundeschlitten in Lappland oder mit unserem Landcruiser durch die Sahara: Neugier und der Reiz des Ungewissen trieben mich und meine Frau Heti trotz meines Handicaps Diabetes in fremde Welten.
Eine Erfahrung auf dem Clearwater, einem Nebenfluss des Yukon, hob unser Leben aus den Angeln. Nachdem uns das Wasserflugzeug abgesetzt hatte, gab es nur einen Rückweg, der 200 Kilometer lang war und durch Bärenland und viel Wildwasser führte. Das Leben reduzierte sich aufs Wesentliche: Boot, Verpflegung und Fluss. Sonst nichts!
Der Sog einer unpassierbaren Stromschnelle packte das Kanadierboot. Mit weit aufgerissenen Augen starrte Heti entsetzt zu mir nach hinten. Links und rechts Steilufer. Ein Zurück war in dieser reißenden Strömung unmöglich. Die Falle schnappte zu.
»Rudern, Rudern!« Damit ich steuern kann, müssen wir schneller als die Strömung sein. Sonst knallen wir gegen die spitzen Felsen und sind samt Boot verloren.
Wie die TITANIC neigte sich der Kanadier nach vorn. Die Bootsspitze samt Heti versank im tosenden Wasserstrudel. Trotzdem stieß sie tapfer das Stechpaddel weiter in die Fluten wie ein Galeerensklave, der angekettet auf dem sinkenden Schiff ums Überleben kämpft.
Unfassbar, aber wir wurden ohne zu kentern durch diese dröhnende Wasserwand geschleudert.
In der kanadischen Wildnis leckten wir zum ersten Mal am Blut der Freiheit. Dieser süße und zugleich bittere Geschmack brannte sich tief und unvergesslich in unsere Köpfe ein. Er machte uns süchtig nach mehr.
Doch der Job hatte uns fest im Griff, und wir konnten immer nur eine kleine Dosis von maximal vier bis fünf Wochen erhaschen.
Die Zeit war noch nicht reif für eine längere Tour, unsere beiden Kinder waren zu klein und das Geld zu knapp.
Als wir 30 waren, saßen wir nächtelang am Küchentisch und fragten: »Was ist unser wichtigstes Lebensziel?«
Alles kam auf den Prüfstand: Status, Karriere, Beruf, Geld. Wir hinterfragten, verwarfen und nahmen wieder auf. Am Ende lag unser Lebensplan auf dem Küchentisch. Ungläubig lasen wir den letzten Satz wieder und wieder: »Mit 50 finanziell frei, unabhängig, Träume leben!« Uns war klar, mit 30 Jahren ist dieser Satz arrogant und provozierend. Aber er stand auf dem Papier, war formuliert und in unseren Köpfen fixiert.
In irgendeinem schlauen Buch stand: »Du kannst jedes Ziel erreichen, wenn du es nie aus den Augen verlierst.« Eine abgedroschene Floskel, aber ich glaubte daran und glaube es heute noch.
Konsequent wie bei einem Bausparvertrag legten wir Geld für unseren Traumsparvertrag auf die Seite und kauften vom ersten Ersparten einen Toyota Landcruiser. Auf ihn baute ich eine kleine Wohnkabine. Sie ist groß genug zum Schlafen, Essen und Kochen, aber klein genug, um autark abgelegene Ziele zu erreichen.
Das Gefährt ist geländegängig und unsere Basis, den »Blauen Planeten« in seiner ganzen Schönheit zu erleben.
Mit diesem Fahrzeug und einem schmalen Geldbeutel schaukelten wir die nächsten Jahre durch die Dünen der Sahara und erkundeten Nordafrika. Mehr war in der begrenzten Urlaubszeit nicht möglich. Das war uns zu wenig.
Nach über 20 Jahren hatte ich alle persönlichen Ziele in meinem Job erreicht. Dann wechselte die Firma den Besitzer, und die Firmenziele waren nicht mehr die meinen. Höchste Zeit, goodbye zu sagen.
Heti war schockiert. Mit flauem Magen schrieb auch sie ihre Kündigung und merkte, wie wichtig ihr die Arbeit als Chefsekretärin war.
Bereits mit 47 Jahren, früher als geplant, starteten wir unseren Lebenstraum. Vorbei war die regelmäßige Gehaltsüberweisung, vorbei die Sicherheit. Wohin führt dieser Weg?
Von Gefühlen zerrissen, sehe ich uns in fremden Ländern und Kulturen am Puls des Lebens, und Sekunden später falle ich in ein Horrorszenario. Das reicht von einem ständig leeren Geldbeutel bis zur Altersarmut und Essen auf Rädern.
Für Freunde und Bekannte sind wir schlicht »Spinner«, die in ihrem Unverstand nicht wissen, was sie tun. Ausgesprochen wird das natürlich nicht. Aber die große Freiheit hat ihren Preis und die Finanzierung ihre Haken. Finanzielle Sicherheit bis zum Grab ist ersatzlos gestrichen. Wir tauschen sie gegen die wunderbare Herausforderung, den Blauen Planeten für uns zu erobern.
Befreit brachen wir zu unserer Traumreise gen Osten auf. Die Reise ins Ungewisse führte uns in die entlegensten Regionen Sibiriens, der Mongolei, Zentralasiens, Pakistans, Chinas, Indiens, Nepals, des Nahen Ostens und Ägyptens. Der Traum dauerte 20 Monate. Wir bereisten 22 Länder intensiv und brachten einen unbezahlbaren Schatz an positiven Erfahrungen mit. Die Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit und Lebensfreude der Menschen in armen Ländern beeindruckte uns. Denn wir leben in einer Welt, in der Geld, Konsum, Karriere und Status zur allgegenwärtigen Gottheit erhoben werden, in der Kinder zu teuer sind und Psychiater reich werden, einer Zeit mit vielen unzufriedenen Gesichtern.
Während der vielen Reisen lernten wir auch die arme Welt kennen, in der Menschen leben mit vielen Kindern, einfachstem Essen und ohne Rente, dafür immer mit einem Lächeln auf den Lippen. Trotz ihrer Armut bringen sie uns eine überschwängliche Gastfreundschaft entgegen. Dieser irritierende und zugleich unerklärbare Widerspruch beschäftigt uns seit Langem. Denn wir beide kennen auch nur die glänzende Seite der Medaille, die andere Seite liegt im Dunkeln: das einfache Leben ohne Sicherheit, ohne Überfluss – nur auf die eigenen Talente gestützt. Dieses unbekannte Leben am Minimum suchten wir in der Natur und in der Wildnis am Nordostufer des Baikalsees. Die Sucht nach Einsamkeit und selbstbestimmtem Leben trieb uns in die sibirische Taiga zu Bären und Wölfen bei –40 °C. Wir begaben uns zugleich auf eine Reise zu uns selbst. Denn nur die eigene Erfahrung klärt die Frage: Ist weniger mehr?
9000 Kilometer immer der Sonne entgegen
»Vier Wochen und keinen Tag mehr«, plustert sich die mollige russische Grenzbeamtin arrogant auf. Ihre dünnen, purpurroten Lippen und der hochmütige Augenaufschlag passen überhaupt nicht zu der viel zu engen Rockuniform. Sie ist stur. Nur 30 Tage Autoeinfuhrgenehmigung will sie erlauben. Wir sind entsetzt und fragen uns: Erreichen wir in dieser Zeit mit unserem schweren Gefährt den Baikal? Was ist bei einer Autopanne oder einem Unfall?
»Kann sein, dass Sie eine Genehmigung für ein Jahr in Irkutsk bekommen«, sind ihre letzten abweisenden Worte.
Kann sein! Und wenn nicht? Dann müssen wir die 9000 Kilometer wieder zurückfahren. Tolle Aussichten!
Da hilft weder ein Hinweis auf die 7000 Kilometer lange marode Straße bis zum Baikalsee noch hartnäckiges Verhandeln. Es nutzt nichts, sich dumm zu stellen. Und auch ein freundlicher Fingerzeig auf unser Einjahresvisum ist verlorene Liebesmühe für die selbstherrliche Beamtin. Vorbei ist die Gemütlichkeit! So wird unsere Fahrt eine Jagd gegen die Zeit.
In Russland sehen die Straßen aus wie nach einem Bombenangriff. Trichter reiht sich an Trichter. Erst in letzter Sekunde gibt jeder davon seine wahre Tiefe preis. Wer nicht hellwach und reaktionsschnell wie ein Karnickel Haken schlägt, dessen Rad verschwindet auf Nimmerwiedersehen in tiefen Gruben. Ein Federbruch ist vorprogrammiert.
Leichte Fahrzeuge sind auf diesen Straßen von unschätzbarem Vorteil. Die kleinen, wendigen Ladas und Skodas tanzen beschwingt und elegant übers Schlaglochparkett – zwei links, eins rechts, geradeaus, wie graziöse Tänzer. Mein überladener Landcruiser und ich machen dabei eine plumpe Figur. 30 Prozent Übergewicht zerstören jede Eleganz.
Das Ortsschild Ufa. Ein Monument aus gewaltigen, in Beton gegossenen Buchstaben erinnert uns an Eric. Ufa ist keine unbekannte Stadt für uns. Denn genau hier stotterte auf unserer 20-monatigen Reise unser Auto und verlangte nach einer Toyotawerkstatt. Dort lernten wir Eric, den Werkstattleiter, kennen.
Ein Besuch nach drei Jahren wäre eine Überraschung.
Mit einem fröhlichen »Sdrastwutje Herta i Werner«, überrascht er uns. Strahlend stürmt Eric auf Heti zu. Umarmen oder Hand geben? Er ist unsicher. Heti nimmt ihm die Entscheidung ab und drückt ihn fest.
Kahl geschorener Schädel, volles Gesicht und runder Bauch, ich erkenne ihn fast nicht wieder. Ihm geht es gut. Er ist überwältigt. Niemals hätte er gedacht, uns wiederzusehen. Unbedingt müssen wir mit ihm nach Hause kommen. Gern sagen wir zu, um dem täglichen Kilometerfressen kurz zu entkommen.
Eric nimmt sich frei und manövriert uns durch den Empfangsraum zum Auto. Er fährt voraus mit seinem weißen Toyota Camry – seinem Statussymbol – und stoppt – vor einem klobigen Gebäude. Eric hämmert einen Code in das alte, abgegriffene Zahlenschloss, und der Sesam öffnet sich. Dahinter ein düsteres Treppenhaus mit hallendem Rohbauflair: raue, unbelegte Betontreppen, Aufputzinstallationen, grob verputzte Wände und unzählige überquellende Briefkästen. In jede Wohnung führt eine scheppernde Stahltüre, als wäre dahinter das gesamte Gold von Fort Knox versteckt.
Erst nach dieser Sicherheitsschleuse stehen wir vor der eigentlichen Wohnungstür. Erics Frau Nina, blond, schlank und leicht bekleidet, öffnet. Mir stockt der Atem. Ein Hitzeschwall wie beim Betreten der Sauna nimmt mir die Luft. Nach kurzer Akklimatisation erstaunt uns die helle Vierzimmerwohnung. Blumentapeten, dicke Teppichböden und dunkle Möbel erinnern an den Reiz der 1970er-Jahre. Noch mehr erstaunt uns, dass das Schlafzimmer auch als Wohnzimmer genutzt wird, je nach Bedarf.
Spitzbübisch zeigt Eric auf eine Falltür. Ein Ruck, und das Geheimnis der begehrten Erdgeschosswohnungen ist gelüftet: ein zwei mal zwei mal zwei Meter großer, kalter, dunkler Vorratskeller. Überlebenswichtig in sozialistischen Zeiten, als Obst und Gemüse gehamstert werden mussten. Heute lagert Eric voller Stolz die Ernte seiner Datscha da unten – ein unschätzbarer Vorteil.
Die Saunatemperaturen machen mich unruhig und nervös. Eric und Heti entblößen ihre Oberkörper so weit wie erlaubt und tragen nur noch Unterhemd beziehungsweise ein dünnes T-Shirt. Am besten hat es Nina in ihrer knappen, dünnen Kittelschürze. Nur ich kann nichts mehr ausziehen. Unter meinem dicken Rollkragenhemd vereinen sich Schweißströme zu Wasserfällen. Wie ein balzender Truthahn sitze ich mit hochrotem Kopf auf dem Sofa. Aber wie die Heizung zurückdrehen ohne Regler? Offensichtlich wurde nicht nur im Treppenhaus gespart. Die Fenster ersetzen den Thermostat. Fenster auf – kühl und zugig. Fenster zu – balzender Truthahn! Eric hat Mitleid und lüftet kurz. Das bedeutet für den Rest der Gesellschaft »anziehen«.
Nach dem Abendessen gehen wir ins Schlaf-Wohnzimmer zum altersschwachen PC, immerhin mit Internet. Eric ist ein cleveres Bürschchen. Per Download installiert er ein Übersetzungsprogramm Russisch-Deutsch und umgekehrt. Damit werden Fragen und Antworten konkreter. Emotionen bleiben in der Tastatur stecken. Eine seltsame Unterhaltung.
Am meisten interessiert sich Eric für unser Sozialsystem, speziell für die Rente. Ab wann bekommen wir Rente und wie viel? Aber ist sie auch sicher? Denn wenn im russischen Staatssäckel Ebbe herrscht, werden die Renten einfach ausgesetzt, und harter Überlebenskampf beginnt.
Mit meinem Ein-Finger-Suchsystem tippe ich in den PC, dass sie bisher immer ausbezahlt wurde. Ungläubig schaut er mich an und hämmert schmunzelnd in die Tastatur: »Warum nur hat Stalin Hitler aufgehalten?«
Ich lache schallend. Stalin würde sich im Grab umdrehen.
Zu früh endet der kurzweilige Abend. Am nächsten Tag arbeiten Nina und Eric wieder, und wir brechen zur größten Ebene dieser Erde auf. Doch vorher müssen wir das Uralgebirge überqueren, das Asien von Europa trennt.
Dahinter breitet sich flach wie ein Pfannkuchen und groß wie Australien die sibirische Tiefebene zwischen dem Ural und dem gewaltigen Jenissejfluss aus. Nur Birkenwälder, Sümpfe und Seen. Riesige Wasserläufe auf dem Weg zum Nordpolarmeer durchschneiden die Senke. Und doch ist diese Weite nur ein Teil einer noch viel gewaltigeren Landschaft – der Taiga. Sie vereint die größte zusammenhängende Biomasse unseres blauen Planeten. Der 3000 Kilometer tiefe Waldgürtel übertrifft das Ökosystem des tropischen Regenwaldes und ist somit der größte Sauerstoffproduzent der Schöpfung.
Diese grüne Lunge ist so breit wie der amerikanische Kontinent – 5000 Kilometer, immerhin ein Achtel des Erdumfanges. Nur eine Zuglinie und eine nicht durchgehend asphaltierte Straße verbinden Ural und Pazifik. Ganz Sibirien hängt an dieser lebenswichtigen Nabelschnur. Ihr Zustand würde jedem Chef einer deutschen Straßenmeisterei kalten Schweiß auf die Stirne treiben.
Kreuzungen sind auf sibirischen Straßen selten. Wohin sollte man in der dünn besiedelten Taiga auch abbiegen? Trotzdem tauchen unerwartet breite Abfahrten auf – geplant für grandiose sozialistische Traumstädte. Doch der Traum endet bereits nach zehn Metern im Sumpf. Die Wirklichkeit führt über tiefspurige Feldwege in kleine, von Moskau vergessene Taigadörfchen. Ohne Infrastruktur leben dort die Bewohner von dem, was die Natur hergibt.
Weiter Richtung Osten taut der letzte Schnee und verwandelt die Taiga in Morast. Wir sind Gefangene der Teerstraße und haben jetzt ein Problem, abgelegene, einsame Übernachtungsplätze zu finden! Ein Ausbruch in Wald- oder Feldweg wird sofort bestraft. Die Räder verschwinden bis zu den Achsen in Matsch und Dreck. Ade, ihr romantischen Übernachtungsplätze im Taigawald! Ab sofort ereilt uns das gleiche Schicksal wie die übermüdeten »Sibirian Highway Drivers«: die Stojankas. Diese Übernachtungs-Parkplätze direkt an der Straße stinken, haben meist einen Schotterbelag, sind laut, aber bewacht. Ein sicheres Geschäft, dem jetzt keiner entkommt. Rund um die Uhr ein Kommen und Gehen mit dröhnenden Motoren, quietschenden Bremsen und schlagenden Türen. Singende, später grölende Fahrer rauben uns den Schlaf. Einem Kühllastwagenfahrer sind wir äußerst sympathisch. Er parkt sein Gefährt zehn Zentimeter neben uns und unterhält uns die ganze Nacht mit seinem scheppernden Kühlaggregat. Ich hasse diese Lärmplätze! Mein Stimmungsbarometer steigt erst wieder, als wir morgens abfahren.
»Hier stinkt’s!«, Heti zieht die Nase hoch.
Beunruhigt frage ich mich: Könnten es die Bremsen sein? Doch alles ist okay. Also weiter! Der Gestank wird immer schlimmer. Nach einem Kilometer sehen wir, was brennt. Es ist die Taiga. Überall knistern die Flammen und über die Wiesen wälzen sich Feuerschwaden. Eine wabernde Rauchwand verschluckt die Straße. Und dahinter? Sollte der Asphalt brennen, explodiert das Auto.
Sicherheitshalber halte ich an. Da durchbricht ein Tanklastzug die grauweiße Wand und fährt freundlich winkend an uns vorbei. So schlimm kann es also nicht sein. Während der nächsten 20 bis 30 Kilometer hinterlassen die Flächenbrände verbrannte, stinkende Erde.
Am Abend auf einer sehr lauten Stojanka erfahre ich von einem Viehtransportfahrer – seinem Geruch nach ist er schon lange unterwegs –, dass diese Feuer jedes Frühjahr gelegt werden. Sie sollen altes Gras, Unkraut und den ganzen Müll verbrennen. Leider machen sich die Feuer oft selbstständig und fackeln ganze Landstriche ab.
Irkutsk, unerwartete Hürden
Es ist eine Zeitreise. Bis Irkutsk müssen wir die Uhr insgesamt sieben Stunden weiter Richtung Osten drehen, sonst würden wir bei Sonnenaufgang zu Mittag essen. Ja, wir wollen Russland erfassen, die Entfernung erfahren und dabei die Zeit fühlen. Es ist kein schneller Sprung von einer Welt in die andere wie beim Fliegen, sondern ein allmähliches Hineingleiten in ein anderes Leben.
Trotz des Zeitlimits, das uns an der russischen Grenze auferlegt wurde, haben wir dank ständigen Fahrerwechsels – einer schläft, der andere fährt – einige Tage früher das Paris Sibiriens, Irkutsk, erreicht.
In Irkutsk wird es ernst. Vieles muss entschieden und organisiert werden. Zahlreiche offene Fragen suchen nach Antworten und lassen mich nicht zur Ruhe kommen:
Finden wir eine Hütte?
Wo können wir unser Auto sicher unterstellen?
Welche Ausrüstungsgegenstände brauchen wir, und wo können wir sie kaufen?
Bekommen wir wirklich das Einjahres-Zollpapier fürs Auto?
Halten wir beide diese Zeit gemeinsam durch?
Hat mich die Sehnsucht, aus dem Alltag auszubrechen, zu weit getrieben?
Unsicherheit schleicht sich in meine Gedanken. Aber das Leben ist wie ein Lagerfeuer. Es kann gemütlich vor sich hin qualmen oder, mit dem Schür haken in Aufruhr gebracht, aufregend lodern. Ich muss aufpassen, dass ich mir nicht die Finger verbrenne.
Irkutsk ist oft als das Paris Sibiriens bezeichnet worden, so bereits 1860 von Nikolaj Segulnov, der sagte, wer Irkutsk nicht gesehen habe, habe auch Sibirien nicht gesehen. Damals, als Segulnov durch Irkutsk flanierte, war es eine Weltstadt mit europäischem Flair. Vor allem die Dekabristen prägten das kulturelle Leben, nachdem ihre Fesseln der Verbannung gelockert worden waren.* Leider entwickelte sich Irkutsk nicht wie die Metropole Paris. Der ehemalige Charme blitzt jedoch noch heute in prachtvollen Kaufmannsvillen und reich verzierten Blockhäusern auf. Irkutsk ist die Stadt der Holzhäuser, die aus dicken Taigastämmen gezimmert wurden. Flankiert werden sie noch immer von alten knorrigen Pappeln neben den schmalen Straßen. Äußerst ungewöhnlich für eine russische Metropole wurde das Stadtbild nicht durch Plattenbauten und kitschige kommunistische Monumentalbauten entstellt. Irkutsk konnte das Flair des 19. Jahrhunderts bis heute bewahren.
So habe ich mir eine sibirische Stadt immer vorgestellt. Es fehlen nur noch meterhoher Schnee und Pferdeschlitten mit Glöckchen. Die vielen Holzhäuser der Stadt haben meist keine Wasserversorgung und nur eine einfache Außentoilette.
Feuer ist für die Holzhäuserstadt der größte Feind. 1897 lag nach drei Tagen Feuersbrunst ein Drittel der Stadt in Schutt und Asche – 3000 Holzhäuser und 100 Steingebäude waren zerstört. Aufgrund eines Zarenerlasses wurde danach das Stadtzentrum aus Stein aufgebaut, meist in klassizistischem Stil. In Kombination mit den Holzhäusern erhielt dadurch die Stadt bis heute einen ganz besonderen Reiz.
Den hat sie auch gerade dann, wenn moderne, junge Damen selbstsicher durch die altmodische Fußgängerzone stolzieren wie auf dem roten Teppich in Hollywood. In figurbetonter, ja gewagt kurzer Kleidung präsentieren sie sich wie Weltstars bei der Oscarverleihung. Sie genießen es, wenn ihnen Männeraugen folgen, während sie auf hohen Pfennigabsätzen arrogant über den löcherigen Asphalt klackern.
Am Ende der stark frequentierten Fußgängerzone stoßen wir auf das mehrstöckige Zentralkaufhaus: Ein Konsumtempel, der alles bietet. Da unsere Kontaktadresse in Irkutsk, das Reisebüro RIM, übers Wochenende geschlossen hat, nutzen wir die Zeit und suchen im Kaufhaus Ausrüstungsgegenstände. Die Frage ist nur, nach welchen?
Im Moment ist das schwierig zu beantworten. Denn wir wissen nicht, wo uns der Zufall hintreibt und welche Voraussetzungen wir dort vorfinden werden. Jedoch die Zeit drängt und wir müssen Annahmen festlegen. Also gehen wir beim Erstellen der Ausrüstungsliste von einer einfachen, reparaturbedürftigen Hütte ohne brauchbares Inventar aus.
Entsprechend lang ist die Liste:
Motorsäge, Hammer, Beile, Hobel, Meißel, Spaten, Schaufel, Bügelsäge, Nägel, Schrauben, Eimer, Wasserbehälter und vieles, vieles mehr. Höchste Priorität hat ein kleines Stromaggregat zum Laden der Akkus unseres Satellitentelefons – die Rettungsleine für den Notfall.
Es ist schwierig, in einer fremden Sprache, in einem fremden Land und in einer fremden Stadt so viele, oft sehr spezielle Gegenstände zu finden. Aber das ganze Jammern hilft nichts, wir brauchen das Zeug.
Im Zentralkaufhaus gibt es tatsächlich von A wie Auspuff bis Z wie Zwiebeln fast alles. Ungewohnt für uns, sind die Waren nicht nach Abteilungen geordnet, sondern wie auf einem orientalischen Basar reiht sich in dem riesigen Kaufhaus ein kleines Geschäft ans andere. Auf mehreren Etagen wiederholt sich Gleiches und Ähnliches ohne Struktur. Das große Angebot ist gut für die Preise, aber schlecht für unsere Füße. Im Gegensatz zu den Einheimischen, die genau wissen, wo es was gibt, bezahlen wir in diesem Chaos viel Fersengeld. Mühselig müssen wir jeden Gegenstand suchen oder erfragen.
Ganz oben auf der Liste steht: Motorsäge. Obwohl wir lange suchen, finden wir keine. Fragen können wir auch nicht, denn das Wort »Motorsäge« wurde in unserem Wörterbuch vergessen. Was tun? Mir bleibt nur die Körpersprache. Ich wende mich an einen jungen Mann, gebe mein Bestes und werde zur Motorsäge. Das gelingt mir gut, denn Passanten bleiben bereits stehen. Beim Aufheulen des perfekt imitierten Startgeräusches ergreift der junge Mann kopfschüttelnd die Flucht.
Vorsichtshalber versuche ich danach mein Glück bei einem älteren Herrn, der etwas abseits, nicht so im Auge der Öffentlichkeit, steht. Seine klobigen Hände verraten ihn als Mann der Arbeit. Vielleicht habe ich bei ihm als Motorsäge mehr Glück. Während meiner Vorführung lacht er. Offensichtlich versteht er mich und sagt die Zahl 52. Meinen fragenden Blick deutet er richtig und zeigt auf die nächste Ladentür, über der in großen Ziffern 22 steht. Alles klar, ein freundliches »Spassiba« (Danke) und unsere Wege trennen sich. Wir gehen direkt in das Geschäft mit der Nummer 52. Jetzt müssen wir lachen. Anscheinend habe ich meine schauspielerischen Fähigkeiten überschätzt, denn vor mir reiht sich Rasenmäher an Rasenmäher.
Den freundlichen Verkäufer erheitere ich mit meinem jetzt verfeinerten Schauspiel. Er schickt uns in den Keller zu Laden Nr. 5. Gespannt, was es wohl dort zu kaufen gibt, machen wir uns auf den Weg. Volltreffer! Motorsägen in allen Varianten. Der verdiente Lohn des Schauspielers.
Mein erster Erfolg im Spiel: Wo gibt es was?
Drei Tage lang klappern wir Geschäfte ab und sind in der Irkutsker Einkaufsszene bereits bekannt.
Nur um einen Ausrüstungsgegenstand machten wir bisher einen großen Bogen. Als unverzichtbar wird er uns von den Einheimischen ans Herz gelegt. Doch mir liegt er wie ein Mühlstein im Magen und geht gegen meine Prinzipien. Aber fürs Überleben in der Wildnis soll er entscheidend sein – ein Bärentöter, ein großkalibriges Gewehr zum Schutz gegen die gefährlichen Braunbären.
Die Sibiriaken behaupten voller Stolz, Bären seien in ihrer Taiga so zahlreich wie Moskitos. Selbst kanadische Grizzlys sind dagegen brave Lämmchen. Denn wirklich gefährliche Bären gibt es nur in Russland und die bedrohlichsten an der Ostseite des Baikals.
Mit Widerwillen gehen wir in ein Waffengeschäft. Am Eingang – eine Ironie des Schicksals – erschreckt uns ein riesiger Braunbär mit aufgerissenem Maul und gefletschten Zähnen. Er steht aufrecht, ist sprungbereit und reicht bis zur Decke. Die Ausmaße des ausgestopften »Medwed«, so der russische Name, machen mich nachdenklich. Hoffentlich laufen uns solche gefährlichen Kraftmaschinen, die nur ein gezielter Gewehrschuss stoppen kann, in freier Natur nie über den Weg.
Als der bullige Verkäufer erfährt, dass wir einen Bärentöter ohne Waffenschein kaufen möchten, ist die klare Antwort:
»Nein, in diesem ›Magasin‹ nicht!«
»Welche Probleme erwarten uns, sollten wir mit einem Gewehr ohne Waffenschein erwischt werden?«
Er imitiert mit gespreizten Fingern vor seinen Augen Gitterstäbe.
»Wie lange?«
Darauf er gelassen:
»Sechs bis sieben Jahre:«
Das reicht und nimmt uns die Entscheidung ab. Erleichtert verlassen wir die Waffenkammer, nicht ohne den Bären im Vorbeigehen in den Hintern zu kneifen. Wir werden auch ohne Waffe klarkommen. Ich kann ein Gewehr nicht mal richtig halten, geschweige denn einen Bären mit einem gezielten Schuss ins Herz töten.
Wir werden es machen wie vor einigen Jahren in Kanada: Vorsichtig sein und viel Lärm machen. Notfalls wird Heti für die Bären Lieder singen. Lärm ist die sicherste Waffe, um ihnen nicht in die Krallen zu laufen, hoffen wir.
Endlich Montag. Wir sind gespannt, ob das Reisebüro RIM eine Hütte gefunden hat. Beim letzten Mailkontakt in Deutschland bot uns Alexej vom Reisebüro eine verlassene, reparaturbedürftige Hütte in einer ehemaligen Rangerstation an. Nur ein alter Ranger lebt noch dort. Das ist nicht der Traum unserer schlaflosen Nächte. Alexej versprach, während unserer langen Anreise etwas Einsames zu finden.
Heute ist die Stunde der Wahrheit. Heute haben wir einen Termin bei ihm.
Die Hoffnung schlägt in Enttäuschung um. Alexej ist nicht da und seine Mitarbeiterin weiß nichts Konkretes.
So kommen wir nicht weiter.
Aber wer hilft uns?
Unter der Rubrik »Hilfe vor Ort« finden wir im Reiseführer die Adresse von »Individualreisen«: Deutsche Leitung, Begegnungsreisen, Sprachreisen und individuelle Begleitung. Hört sich gut an, vielleicht können sie helfen?
Seltsamerweise führt uns die angegebene Adresse zu einem Wohnblock. Über der Eingangstür hängt das Schild »Hans Consulting«. Sind wir falsch? Da die Türe offen steht, betreten wir ein kleines Büro. Dort arbeiten drei Leute an Computern. Ein älterer Herr bemerkt uns und fragt, was wir suchen.
»Eigentlich suchen wir das Reisebüro Individualreisen.«
»Da sind sie hier richtig. Wir bieten sowohl Firmenberatung als auch Reisen an«, sagt er und öffnet die Tür ins andere Zimmer.
Herr Thomas Hans stellt sich vor und fragt nach unseren Wünschen. Ich erzähle von unseren Plänen und der einsamen Hütte am Ostufer des Baikals. Kein Problem, sie haben die besten Kontakte zu den Nationalparks. Peter, der Mann für besondere Fälle, er spricht perfekt Deutsch, nimmt sich unserer Wünsche an. Auch er macht uns Hoffnung und will noch heute bei seinen Kontaktpersonen Anfragen starten. Er ist überzeugt, dass er in vier bis fünf Tagen eine einsame Hütte gefunden hat.
»Sie haben noch genügend Zeit. Vor Mitte Juni können sie das Nordostufer des Baikals sowieso nicht erreichen. Denn der Baikal ist zurzeit mit dem Auto nicht mehr und mit dem Boot noch nicht befahrbar.«
Wir sind schockiert. Warten, warten und nochmals warten. Warten auf Alexej, warten auf Antwort, warten bis das Eis schmilzt. Wenn das so weitergeht, ist unser Jahresvisum abgelaufen, ohne dass wir den Baikal gesehen haben.
Unser Stimmungsbarometer fällt auf sibirische Temperaturen. Der unbefriedigende Zustand zerrt an unseren Nerven. Wir sind gereizt, die Luft im Auto wird immer dicker. Zudem müssen wir noch die gehassten Behördengänge erledigen. Ohne Registrierung und ohne Einjahreseinfuhrgenehmigung fürs Auto platzt der Traum wie eine Seifenblase.
Der freundliche Peter will uns dabei unterstützen.
»Alles kein Problem«, ist seine Aussage. Aber das kennen wir ja, die Probleme kommen später, doch sie kommen.
Peter war bereits beim Ovir, ähnlich unserem Einwohnermeldeamt. Er warnt uns eindringlich, heute nicht dorthin zu gehen, denn Menschenschlangen stehen bis in den Hof, alle warten auf Registrierung. Ergo beginnen wir mit der Zolleinfuhrgenehmigung fürs Auto. Sicherheitshalber meldet Peter uns dort an. Wir haben beim stellvertretenden Leiter, Michail Andrejwitsch, einen Termin.
Beim Zoll sagt man uns, er sei nicht da.
»Aber wir sind angemeldet«, reklamieren wir. Erst jetzt telefoniert die junge Dame kurz und stellt uns in einem kleinen Büro zum Warten ab. Wir glauben schon, sie habe uns vergessen, da öffnet sich schwungvoll die Tür. Schneidig setzt sich ein Major in Uniform an den wackeligen Schreibtisch und legt behutsam seine Schildkappe ab. Wortsalven schießen ohne Unterbrechung aus seinem Mund – er hat es eilig.
Heti blickt ihn kopfschüttelnd an und sagt:
»Medlennje paschalusta, ja ponimaju tolko tschut tschut po-russki.« (Langsam bitte, ich verstehe nur ein bisschen Russisch.) Ohne Reaktion spricht er weiter wie Göbbels. Erst als ich laut »medlennje« rufe, stutzt er. Aha, wir sind beim Militär – hier wird nur Befehlston verstanden.
Nach einigem Hin und Her erfahren wir, dass wir falsch sind. Hier ist die Polizei.
Mit dem Stadtplan über dem Lenkrad kämpfen wir uns zum richtigen Zollamt durch. Doch hier ist bereits am Schlagbaum Schluss. Der Pförtner sagt: »Falsch« und schickt uns zum Lkw-Zollamt, etwa zehn Kilometer vor der Stadt. Es ist bereits Mittag. Ich werde nervös und zum Pförtner pampig, obwohl er nichts für unsere Irrfahrt kann. Auf unser Drängen ruft er beim Lkw-Zollamt an und fragt nach der zuständigen Abteilung und Person. Wir sind vorsichtig geworden. Die Antwort überrascht:
»3. Stock, Zimmer 301, bei Svetlana melden.«
Optimistisch fahren wir los und stehen nach einigen Umwegkilometern endlich vor einem alten Büroblock. Er sieht aus, als warte er auf seinen Abbruch oder stürze bald ein – aber bitte nicht, bevor wir unsere Zollverlängerung haben.
Es ist zwei Uhr nachmittags. Die Zeit müsste noch reichen. Schnell rennen wir in den 3. Stock, Zimmer 301 zu Svetlana. Sie existiert leibhaftig. Nachdem sie unsere Papiere geprüft und kopiert hat, führt uns die kühle Blonde zum Vorgesetzten mit vielen kleinen Sternchen auf den Schultern. Obwohl sie ihn wie einen König hofiert, behandelt er Svetlana griesgrämig und herrisch. Lange starrt er regungslos in unsere Papiere, als würde er mit offenen Augen schlafen. Oder liegt es an der lähmenden Wirkung von Wodka? Plötzlich durchzuckt es ihn, wir erschrecken, als er hinterlistig, aber laut nach unserer Registrierung fragt.
»Die bekommen wir morgen«, erklären wir.
»Ohne Registrierung keine Zollverlängerung, basta!«
Obwohl wir bereits 4000 Rubel bezahlt haben, müssen wir unverrichteter Dinge wieder gehen. Zudem bekommen wir noch eine lächerlich niedrige Rechnung über 100 Rubel, wahrscheinlich die offizielle Rechnung.
Wir sind verpflichtet, diesen Betrag auf einer bestimmten Bank einzuzahlen und dabei den Registrierungsnachweis vorzulegen. Wieder eine zusätzliche Hürde, denn nur mit diesem Einzahlungsbeleg wird unser Vorgang weiterbearbeitet. Dann ist alles kein Problem, sagt man uns – so wie immer!
Zurück bei Peter im Büro greift der sich an den kahlen Kopf und sucht aussichtslos nach Haaren, die er raufen könnte. Resigniert stöhnt er:
»Diese verfluchte Bürokratie!«
Den Hof des Ovirs bevölkern auch heute Menschenmassen aus den unterschiedlichsten Regionen Asiens. Alle möchten registriert werden. Einige haben sogar vor dem Eingang übernachtet, um als Erste in der Schlange zu stehen. Auch für uns gilt: Auf ins Getümmel, in dem es keine Ordnung oder Struktur gibt, nur ein Schieben und Drängeln. Schmal wie Heringe quetschen wir uns ebenfalls in den Gang des Erdgeschosses, ohne das Ende der Schlange zu kennen. Vor uns öffnet sich eine Türe und ein Mann zwängt sich heraus. Sofort nutzen wir die Chance der offenen Türe, und flugs stehen wir in einem sehr großen, hohen Raum. Paradiesische Ruhe empfängt uns, kein verschwitzter Körper klebt an uns. Dafür sitzen zwei gepflegte Damen an ihren Tischen. Nachdem sie erfahren haben, dass wir Deutsche sind, überreichen sie uns die begehrten Formulare besonders freundlich. Leider ist die Formularausgabe nur das erste Etappenziel. Um die Ziellinie im 2. Stock zu erreichen, müssen wir uns mit den ausgefüllten Formularen nochmals anstellen. Mit Grauen denken wir an das erneute Spießrutenlaufen und Drängeln.
Wieder zurück in Peters Büro füllen wir gemeinsam die Vordrucke aus.
Das Wichtigste für die Registrierung ist eine feste Adresse. Unser zukünftiger Aufenthaltsort irgendwo am Baikalufer hat mit Sicherheit weder Straßennamen noch Hausnummer. Freundlicherweise hat uns Peter angeboten, seine Adresse anzugeben. Was täten wir nur ohne ihn?
Zurück unter den Menschenmassen beginnt die Tour der Leiden aufs Neue. Beim Endspurt kurz vor der Ziellinie ist das Gedränge unbarmherzig und die Luft zum Schneiden dick. Zu enger Menschenkontakt, schwitzende Leiber und ihre Ausdünstungen versetzen uns in Platzangst. Wie Marionetten werden wir vor einen der drei Schalter geschoben. Die Welt der älteren Dame dahinter endet an ihrer Milchglasscheibe. Stoisch prüft sie die Formulare, ohne uns zu beachten. Dann knallt der wichtige Stempel wie bei einer Auktion dreimal auf unsere Papiere. Wir haben den Zuschlag! Wer hätte das gedacht? Dieses Mal ganz ohne Probleme, so kann es weitergehen!
Ausgepresst wie Zitronen verlassen wir den Ovir. Mit der Registrierung in der Hand schaffen wir es gerade noch vor Mittag, die 100 Rubel für die Zollverlängerung einzubezahlen. Na also, geht doch! Ab sofort sind wir offiziell für ein Jahr in Russland zu Hause. Uns bleibt keine Zeit, den Sieg zu genießen. Die Bürokratie frisst Zeit ohne Ende. Deshalb rasen wir auf dem schnellsten Weg zurück zum Zollamt.
Svetlana ist heute noch frostiger. Überkorrekt hat sie abermals alles vorbereitet, und wieder führt kein Weg am arroganten Vorgesetzten vorbei. Das gleiche Prozedere wie gestern. Nur findet er heute nichts zum Meckern. Zähneknirschend unterschreibt er.
Es fehlt nur noch die Fahrzeugkontrolle. Danach haben wir die ersehnte Zolleinfuhrgenehmigung für ein ganzes Jahr in der Tasche.
»Einen kleinen Moment«, sagt Svetlana, und weg ist sie. Der kleine Moment dauert 45 Minuten, danach huscht sie eilig an uns vorbei und verschwindet durch die nächste Tür. Nach weiteren 30 Minuten kommt sie endlich mit ihrer Kollegin, Natascha, aus dem Zimmer. Natascha spricht Deutsch. Ungeduldig frage ich, ob es ein Problem gebe.
»Vielleicht ein kleines mit Herrn Fischer«, sagt Natascha verlegen.
Durch lange Korridore gehen wir alle zusammen in das Büro von Istvan Fischer, jung, blond und unsympathisch. Wir stehen vor der letzten Instanz, dem Fahrzeugkontrolleur.
Freundlich frage ich, wann er denn unser Auto überprüft.
Ohne uns anzuschauen, zischt er ein mürrisches »pol tschass« (halbe Stunde). Hoppla, kein gutes Omen. Dieser Mann kann uns große Probleme bereiten und uns das Auto bis auf den letzten Krümel ausräumen lassen. Also warten wir vier geduldig in seinem Büro. Nach 30 Minuten Verspätung kommt Herr Fischer zurück und geht ohne Entschuldigung an uns vorbei, als wären wir Luft.
Ich bitte Natascha, ihn zu fragen, wann es weitergeht. Eine hitzige Diskussion entbrennt. Beschämt übersetzt Natascha, dass Herr Fischer in 15 Minuten Feierabend hat und heute keine neue Arbeit mehr anfängt. Am Montag können wir wiederkommen.
Ich glaub, ich höre nicht richtig. Was haben wir diesem arroganten Beamten getan? So brauche ich mich nicht behandeln zu lassen.
Svetlana spürt das Erdbeben in mir. Beschämt schaut sie zur Seite. Nachdem ich mich wieder unter Kontrolle habe, bitte ich Natascha, wortwörtlich zu übersetzen:
»Seit über zwei Stunden warten wir auf Sie. Sie behandeln uns schlecht, lassen uns stehen und haben dann keine Zeit oder keine Lust – eine Unverschämtheit. Ich habe 4000 Rubel bezahlt und werde das Gebäude nicht verlassen, ehe das Auto kontrolliert ist.«
»Nein, es ist zu spät«, antwortet Fischer etwas vorsichtiger. Vehement verlange ich sofort nach seinem Vorgesetzten. Natascha zieht die Augenbrauen hoch. Für die Arme ist die Übersetzung äußerst unangenehm.
Fischer wendet sich ab und räumt in aller Ruhe seinen Schreibtisch auf. Ich bin kurz vor der Explosion. Svetlana und Natascha bemerken es. Ein kurzer Wortwechsel mit Fischer, die drei begeben sich in einen Nebenraum und schließen die Tür. Wir müssen nochmals warten.
Bereits nach zwei Minuten kommen sie zurück. Fischer geht wortlos an uns vorbei und Svetlana schaut auf den Boden. Natascha sagt:
»Fischer kontrolliert das Auto jetzt sofort.«
Ich bin verblüfft. Was haben die beiden Damen mit Fischer gemacht? War die Courage der Kolleginnen zu stark und Fischers Charakter zu schwach?
Svetlana zeigt uns den Weg zur Inspektionsgrube. Als ich auf die Grube fahre, ist es genau 17 Uhr und Feierabend. Fischer erwartet uns mit strengem Blick in korrekter Uniform. Wir sind auf das Schlimmste gefasst. Aber nichts dergleichen. Korrekt prüft er Motor- und Fahrzeugnummer. Nun will er die Wohnkabine inspizieren. Demonstrativ ziehe ich die Schuhe vor der Türe aus, stelle mich auf den Tritt und werfe einen anklagenden Blick auf