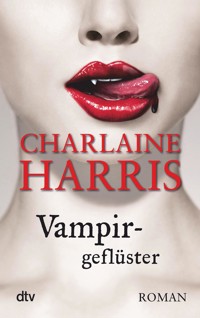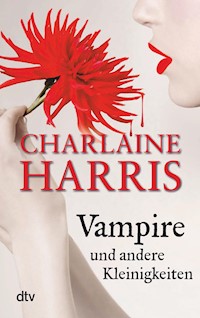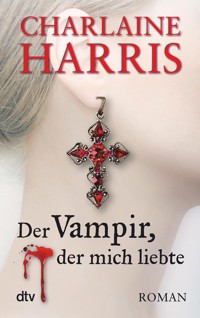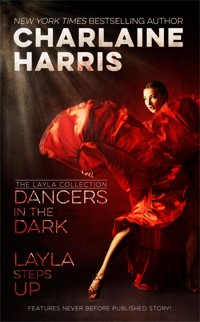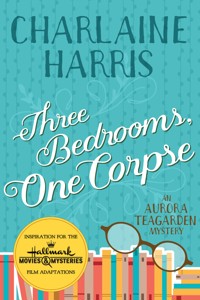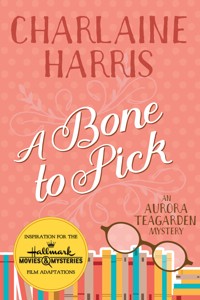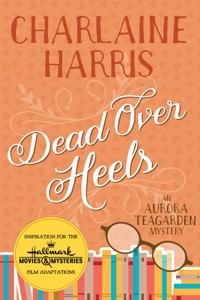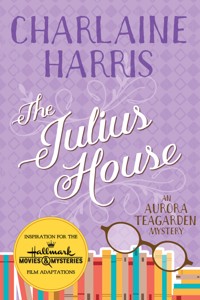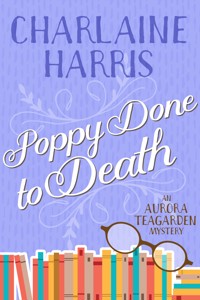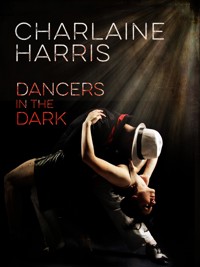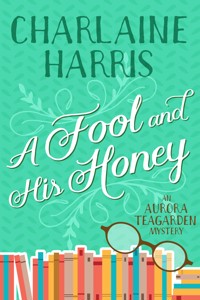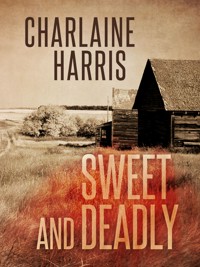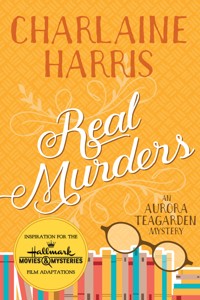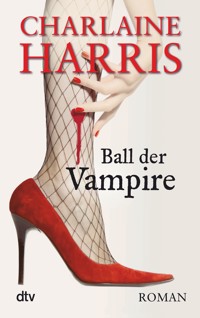
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Sookie Stackhouse
- Sprache: Deutsch
Wer ein Vampir-Erbe antritt, lebt gefährlich Sookie Stackhouse, die gedankenlesende Kellnerin aus Bon Temps, Louisiana, hat nicht gerade viele Verwandte. Dass unter den wenigen ausgerechnet eine Erbtante (bzw. Cousine) ist, hätte sie nie vermutet. Aber es ist eine Tatsache: Ihre kürzlich verstorbene Cousine Hadley hat sie zur Alleinerbin eingesetzt. Allerdings war Hadley nicht irgendwer, sondern die Gefährtin der Vampirkönigin von New Orleans. Und das macht das Erbe einigermaßen gefährlich. Jemand will ganz offensichtlich verhindern, dass Sookie zu viel über Hadleys Vergangenheit und Besitztümer herausfindet. Außerdem hat Eric, Sookies alte Flamme, ihre Begleitung zu einem großen Vampirtreffen in New Orleans erbeten und hier begegnet sie einigen sehr merkwürdigen Gestalten, von denen ein paar ihr gleich ans Leben wollen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 514
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Sookie Stackhouse, die gedankenlesende Kellnerin aus Bon Temps, Louisiana, hat nicht gerade viele Verwandte. Dass unter den wenigen ausgerechnet eine Erbtante (oder vielmehr -cousine) ist, hätte sie nie vermutet. Doch Tatsache ist: ihre kürzlich verstorbene Cousine Hadley hat sie zur Alleinerbin eingesetzt. Allerdings war Hadley nicht irgendwer, sondern die Gefährtin der Vampirkönigin von New Orleans. Und das macht das Erbe gefährlich. Jemand will offensichtlich verhindern, dass Sookie zu viel über Hadleys Vergangenheit und Besitztümer herausfindet. Außerdem hat Eric, Sookies alte Flamme, ihre Begleitung zu einem großen Vampirtreffen in New Orleans erbeten – und hier begegnet sie einigen sehr merkwürdigen Gestalten, von denen ein paar ihr gleich ans Leben wollen …
Von Charlaine Harris sind bei dtv außerdem erschienen:
Vorübergehend tot
Untot in Dallas
Club Dead
Der Vampir, der mich liebte
Vampire bevorzugt
Vampire schlafen fest
Ein Vampir für alle Fälle
Vampirgeflüster
Vor Vampiren wird gewarnt
Vampir mit Vergangenheit
Cocktail für einen Vampir
Vampirmelodie
Die Welt der Sookie Stackhouse
Vampire und andere Kleinigkeiten
Charlaine Harris
Ball der Vampire
Sookie Stackhouse Band 6
Roman
Deutsch von Britta Mümmler
Dieser Roman war schon fertig, als im Sommer 2005 der Hurrikan Katrina die amerikanische Golfküste verwüstete. Die Handlung spielt zum Teil in New Orleans, und so habe ich mit mir gerungen, ob ich die Katastrophe aus den Monaten August und September in ›Ball der Vampire‹ einarbeiten solle. Nach langem Nachdenken, und da Sookie die Stadt bereits im Frühling besucht, habe ich mich jedoch entschieden, das Buch in der ursprünglichen Fassung zu veröffentlichen.
Mit tiefem Mitgefühl denke ich an die Bewohner der schönen Stadt New Orleans und an die Menschen an den Küstenstrichen von Mississippi, dem US-Bundesstaat, der meine Heimat ist. Alle, die dort ihr Zuhause und ihr Leben wieder aufbauen müssen, schließe ich in meine Gebete ein.
Kapitel 1
Malerisch lag ich in den Armen des schönsten Mannes, den ich je gesehen hatte, doch er starrte mit leerem Blick auf mich herunter. »Denk an… Brad Pitt«, flüsterte ich. Die dunkelbraunen Augen zeigten noch immer nicht das geringste Interesse.
Okay, kein guter Vorschlag.
Ich rief mir Claudes letzten Liebhaber ins Gedächtnis, den Rausschmeißer einer Striptease-Bar.
»Denk an Charles Bronson«, schlug ich vor. »Oder an, äh, Edward James Olmos.« Und schließlich wurde ich mit dem Auflodern eines heißglühenden Blicks in diesen von langen Wimpern umrahmten Augen belohnt.
Man hätte meinen können, jetzt würde Claude mir jeden Moment den langen, raschelnden Rock hochschieben, mir das tiefausgeschnittene Mieder herunterreißen und über mich herfallen, bis ich um Gnade flehte. Doch bedauerlicherweise – für mich und alle anderen Frauen in Louisiana – setzte Claude auf das andere Team. Vollbusige Blondinen entsprachen leider überhaupt nicht seinem Wunschtraum. Raubeinige, leicht grobe Männer mit Hang zum Grübeln und vielleicht noch einem Dreitagebart, das war es, was ihn anmachte.
»Maria-Star, geh mal hin und streich ihr das Haar zurück«, befahl Alfred Cumberland, der Fotograf, ein stämmiger Schwarzer mit graumeliertem Haar und Schnauzbart. Schnell trat Maria-Star Cooper vor die Kamera und arrangierte eine Strähne neu, die sich aus meinem langen, blonden Haar gelöst hatte. Ich lag zurückgelehnt in Claudes rechtem Arm und klammerte mich mit der (für die Kamera unsichtbaren) linken Hand verzweifelt am Rückenteil seines schwarzen Gehrocks fest, während mein rechter Arm sanft auf seiner linken Schulter ruhte. Seine linke Hand lag an meiner Taille. Ich glaube, die Pose sollte wohl andeuten, dass er mich zu Boden gleiten lässt, um sich gleich über mich herzumachen.
Zu dem schwarzen Gehrock trug Claude schwarze Kniehosen, weiße Strümpfe und ein weißes Rüschenhemd. Ich trug ein langes blaues Kleid mit bauschigem Rock und jeder Menge Unterröcken. Obenrum war das Kleid, wie schon erwähnt, ziemlich knapp, und die winzigen Ärmel hatten sie mir die Schultern hinuntergeschoben. Ich konnte von Glück sagen, dass es in dem Fotostudio einigermaßen warm war. Der große grelle Scheinwerfer, der aussah wie eine Satellitenschüssel, gab nicht so viel Hitze ab, wie ich erwartet hatte.
Al Cumberland drückte unablässig den Auslöser, während Claude mich mit glühenden Blicken anschmachtete. Ich tat mein Bestes und schmachtete glühend zurück. Mein Privatleben war in den letzten Wochen, na, sagen wir mal: unterkühlt gewesen, und deshalb war ich durchaus bereit, ein bisschen zu glühen. Eigentlich hätte ich auch nichts dagegen gehabt, in Flammen zu stehen.
Maria-Star, eine wunderschöne junge Frau mit hellbrauner Haut und lockigen schwarzen Haaren, stand mit einem riesigen Schminkkoffer, Pinselchen und Kämmen für Reparaturen in allerletzter Minute parat. Als Claude und ich vorhin im Fotostudio ankamen, war ich ziemlich überrascht gewesen, dass ich die junge Assistentin des Fotografen kannte. Ich hatte Maria-Star zuletzt vor ein paar Wochen gesehen, als der neue Leitwolf von Shreveport bestimmt wurde. Damals hatte ich allerdings kaum Gelegenheit gehabt, sie genauer zu betrachten, denn der Wettkampf der Leitwolfkandidaten war furchteinflößend und blutig gewesen. Heute war ich entspannter und sah, dass Maria-Star nach dem Unfall im Januar, als sie von einem Auto angefahren worden war, wieder vollständig genesen war. Bei Werwölfen heilen Wunden schnell.
Maria-Star erkannte mich ebenfalls, und ich war erleichtert, als sie zurücklächelte. Mein Ansehen beim Werwolfrudel von Shreveport hatte, gelinde gesagt, ziemlich gelitten. Ohne es eigentlich zu wollen und völlig ahnungslos, hatte ich mich auf Seiten des unterlegenen Leitwolfkandidaten wiedergefunden. Der Sohn dieses Kandidaten, Alcide Herveaux, den ich mal für sehr viel mehr als nur einen guten Freund gehalten habe, fühlte sich während des Wettkampfs von mir im Stich gelassen; und der neue Leitwolf Patrick Furnan wusste von meinen Verbindungen zur Familie Herveaux. Ich war überrascht, dass Maria-Star gutgelaunt mit mir plauderte, während sie mir in das Kostüm half und mein Haar bürstete. Sie trug mir mehr Make-up auf, als ich je in meinem Leben im Gesicht gehabt hatte, doch als ich in den Spiegel blickte, bedankte ich mich spontan bei ihr. Ich sah großartig aus, wenn auch ganz und gar nicht wie Sookie Stackhouse.
Wäre Claude nicht so stockschwul, hätte mein Aussehen ihn sicher auch beeindruckt. Er ist der Bruder meiner Freundin Claudine und arbeitet als Stripper bei der Ladies’ Night im Hooligans; der Club gehört ihm inzwischen. Claude ist so lecker, dass einem das Wasser im Mund zusammenläuft: 1,85Meter groß, welliges schwarzes Haar, große braune Augen, klassische Nase und Lippen, die gerade voll genug sind. Er trägt die Haare lang, damit sie seine Ohren bedecken. Denn die hat er operieren lassen, so dass sie oben abgerundet sind wie bei den Menschen und nicht mehr spitz zulaufend, wie sie von Geburt an waren. Wer ein bisschen was von Supranaturalen versteht, erkennt die Schönheitsoperation der Ohren sofort und weiß, dass Claude ein Elf ist. Und das meine ich nicht als Witz. Er ist wirklich ein Supra, ich meine, im wahrsten Sinn des Wortes: ein Übernatürlicher. Claude ist ein Elf.
»Jetzt die Windmaschine«, ordnete Al an, und nach ein wenig Hin- und Hergeschiebe schaltete Maria-Star den großen Ventilator an. Nun schienen wir in einem Sturm zu stehen. Mein Haar flatterte wie eine blonde Fahne hinter mir, Claudes Haar blieb allerdings, wo es war, im Pferdeschwanz zurückgebunden. Nach ein paar Aufnahmen dieser Szene löste Maria-Star Claudes Haar und drapierte es ihm über eine Schulter, damit es im Luftstrom nur auf einer Seite nach vorn wehte und so den perfekten Hintergrund für sein perfektes Profil bildete.
»Wunderbar«, sagte Al und drückte noch ein paarmal auf den Auslöser. Maria-Star schob den Ventilator immer wieder an eine andere Stelle, so dass uns der stürmische Wind aus den verschiedensten Richtungen erfasste. Schließlich sagte Al zu mir, dass ich mich aufrichten könne. Dankbar streckte ich mich.
»Hoffentlich war das nicht zu anstrengend für deinen Arm«, sagte ich zu Claude, der bereits wieder ganz cool und gelassen blickte.
»Nee, kein Problem. Gibt’s hier keinen Fruchtsaft?«, fragte er Maria-Star. Claude war nicht gerade für seine Umgangsformen bekannt.
Die hübsche Werwölfin zeigte zu einem Kühlschrank in der Ecke des Fotostudios. »Becher stehen obendrauf«, sagte sie zu Claude. Ihr Blick folgte ihm, und sie seufzte. Das taten Frauen häufig, nachdem sie mit Claude gesprochen hatten. Und der Seufzer bedeutete immer: »Wie jammerschade.«
Maria-Star sah zu ihrem Boss hinüber, und da der noch konzentriert an seiner Ausrüstung herumschraubte, drehte sie sich freundlich lächelnd zu mir herum. Auch wenn sie eine Werwölfin war, weshalb ihre Gedanken nur schwer zu lesen waren, erkannte ich, dass sie mir irgendwas erzählen wollte… und sie war nicht sicher, wie ich es aufnehmen würde.
Telepathie macht keinen Spaß. Die Selbstachtung leidet ganz schön, wenn man weiß, was andere von einem denken. Und Gedankenlesen macht es fast unmöglich, mit ganz normalen Männern auszugehen. Denkt einfach mal darüber nach. (Und vergesst nicht, dass ich es weiß – ob es ganz normale Männer sind oder nicht.)
»Alcide macht eine ziemlich schwere Zeit durch, seit sein Vater den Wettkampf verloren hat«, begann Maria-Star mit gesenkter Stimme. Claude war damit beschäftigt, sich selbst im Spiegel zu betrachten, während er Fruchtsaft trank. Al Cumberland hatte einen Anruf auf dem Handy erhalten und war in sein Büro verschwunden, um dort ungestört zu telefonieren.
»Das kann ich mir vorstellen«, erwiderte ich. Da Jackson Herveaux von seinem Gegner getötet worden war, war es zu erwarten gewesen, dass sein Sohn mit einigen Höhen und Tiefen zu kämpfen haben würde. »Ich habe zum Gedenken eine Spende an den Tierschutzbund geschickt, und ich weiß, dass sie Alcide und Janice davon in Kenntnis setzen«, sagte ich. (Janice war Alcides jüngere Schwester und daher keine Werwölfin. Ich fragte mich, wie Alcide seiner Schwester eigentlich den Tod ihres Vaters erklärt hatte.) Als Antwort hatte ich eine Karte mit vorgedruckter Danksagung erhalten, eine von der Sorte, wie Beerdigungsinstitute sie versenden, ohne jedes persönliche Wort.
»Nun…« Sie schien nicht in der Lage, auszusprechen, was immer ihr auch im Halse steckte. Plötzlich erhaschte ich einen flüchtigen Eindruck davon. Schneidender Schmerz durchfuhr mich, und dann zog ich meine Schutzbarriere hoch und verbarrikadierte mich hinter meinem Stolz. Viel zu früh im Leben hatte ich lernen müssen, das zu tun.
Ich nahm eine Mappe mit Arbeitsproben von Alfred zur Hand und begann darin zu blättern, obwohl ich kaum etwas von all den Brautpaaren, Bar-Mizwas, Erstkommunionen und Silberhochzeiten darin sah. Dann klappte ich die Mappe wieder zu, legte sie zurück und versuchte ganz locker zu wirken, aber ich glaube, das hat nicht funktioniert.
Mit einem Lächeln, das ein müder Abklatsch von Maria-Stars betont freundlicher Miene war, sagte ich: »Alcide und ich sind nie richtig zusammen gewesen, weißt du.« Sicher, ich hatte Sehnsüchte und Hoffnungen gehabt, aber die waren nicht weit gediehen. Das Timing hatte nie gestimmt.
Maria-Stars Augen, die von einem viel helleren Braun waren als Claudes, weiteten sich vor Ehrfurcht. Oder war es Furcht? »Ich habe schon gehört, dass du das kannst«, sagte sie. »Aber es ist schwer zu glauben.«
»Ja«, erwiderte ich leicht genervt. »Nun, ich freue mich, dass du mit Alcide ausgehst, und ich habe kein Recht, was dagegen zu haben, selbst wenn es mich interessieren würde. Und das tut es nicht.« Das sprudelte etwas zu hastig aus mir heraus (und entsprach auch nicht ganz der Wahrheit), aber ich glaube, Maria-Star hat es schon richtig verstanden: Ich wollte mein Gesicht wahren.
Als ich in den Wochen nach dem Tod seines Vaters nichts von Alcide hörte, wusste ich, dass seine Gefühle für mich, wie immer sie auch ausgesehen hatten, erloschen waren. Das war ein Schlag gewesen, aber kein tödlicher. Ganz ehrlich, ich hatte nichts von Alcide erwartet. Aber verflixt noch mal, ich mochte ihn, und es tut immer weh, wenn man feststellt, dass man einfach ausgewechselt wird. Immerhin hatte Alcide vor dem Tod seines Vaters noch vorgeschlagen, dass wir zusammenziehen sollten. Und jetzt war er mit dieser jungen hübschen Werwölfin hier zusammen, vielleicht planten sie sogar bereits, kleine Werwölfchen zu bekommen.
Ich verbot mir diese Art Gedanken sofort. Schäm dich! Es ist total sinnlos, hier die Ziege zu spielen. Was auch, wenn ich drüber nachdachte, Maria-Star auf falsche Gedanken bringen konnte.
Schäm dich gleich doppelt!
»Ich hoffe, ihr seid sehr glücklich«, sagte ich.
Wortlos reichte sie mir eine andere Fotomappe, auf der AUGENBLICKE stand. Als ich sie aufschlug, bemerkte ich, dass die AUGENBLICKE nur Supras festhielten. Es waren Fotos von Zeremonien, die Menschen nie zu sehen bekamen… ein Vampirpaar, das in aufwendigen Kostümen vor einem riesigen Ankh-Kreuz posierte; ein junger Mann, der sich eben in einen Bären verwandelte, wahrscheinlich zum ersten Mal; die Aufnahme eines Werwolfrudels, dessen Mitglieder alle Wolfsgestalt angenommen hatten. Alfred Cumberland, der Fotograf des Übernatürlichen. Kein Wunder, dass er die erste Wahl für die Fotos gewesen war, mit denen Claude eine Karriere als Model für die Cover von Liebesromanen anzuschieben hoffte.
»Weiter geht’s«, rief Al, als er aus dem Büro eilte und sein Handy zuklappte. »Maria-Star, wir sind gerade für eine Doppelhochzeit gebucht worden, irgendwo da draußen in der Gegend, wo Miss Stackhouse wohnt.« Ich überlegte, ob er bei diesem Auftrag wohl normale Menschen oder übernatürliche Wesen fotografieren würde, aber es wäre unhöflich gewesen zu fragen.
Claude und ich kamen uns noch einmal ganz nahe. Ich folgte Alfreds Anweisungen und raffte den Rock hoch, damit meine Beine zu sehen waren. In der Epoche, in der mein Kleid getragen wurde, hatten die Frauen ihre Beine sicher noch nicht gebräunt oder rasiert, und meine Haut war braun und glatt wie ein Kinderpopo. Aber hey, was soll’s. Die Männer waren wahrscheinlich genauso wenig mit aufgeknöpftem Hemd durch die Gegend gelaufen.
»Heben Sie das Bein so hoch, als ob Sie’s gleich um ihn schlingen wollten«, kommandierte Al. »Also, Claude, das ist jetzt deine Chance zu glänzen. Du musst aussehen, als würdest du dir jede Sekunde die Hose herunterreißen. Wir wollen doch, dass die Leserinnen anfangen, schwer zu atmen, wenn sie dich ansehen!«
Claude wollte diese Fotos zu einer Mappe zusammenstellen und sie beim Wettbewerb zum »Romantischen Liebhaber« einreichen, der jedes Jahr von der Zeitschrift des Buchclubs »Romantische Zeiten« veranstaltet wurde.
Als er Al von seinen Plänen erzählte (soweit ich weiß, hatten sie sich auf einer Party kennen gelernt), riet der Fotograf ihm, sich mit dem Typ Frau aufnehmen zu lassen, der häufig auf den Umschlägen von Liebesromanen abgebildet ist. Er hatte dem Elf erklärt, dass sein dunkler Typ am besten zusammen mit einer blauäugigen Blondine zur Geltung kommen würde. Und ich war zufällig die einzige vollbusige blonde Frau in Claudes Bekanntenkreis, die bereit war, ihm umsonst zu helfen. Natürlich kannte Claude einige Stripperinnen, die es auch gemacht hätten; aber sie hätten erwartet, dafür bezahlt zu werden. Das hatte er mir mit seinem üblichen Feingefühl auf der Fahrt ins Fotostudio erzählt. Er hätte diese Details genauso gut für sich behalten und mir damit das gute Gefühl geben können, dass ich dem Bruder einer Freundin einen Gefallen tat – aber nein, in typischer Claude-Manier ließ er mich an seinem Wissen teilhaben.
»Okay, Claude, jetzt runter mit dem Hemd«, rief Alfred.
Claude war daran gewöhnt, zum Ausziehen aufgefordert zu werden. Seine breite, unbehaarte Brust war beeindruckend muskulös, so dass er ohne Hemd tatsächlich sehr gut aussah. Bei mir regte sich gar nichts. Vielleicht wurde ich langsam immun.
»Rock, Bein«, erinnerte Alfred mich, und ich sagte mir, dass es einfach nur ein Job war. Al und Maria-Star verhielten sich ganz professionell und unpersönlich, und cooler als Claude konnte sowieso keiner sein. Aber ich war es nicht gewöhnt, vor anderen Leuten die Röcke zu raffen, und für mich fühlte es sich wie eine ziemlich intime Sache an. Obwohl ich in Shorts genauso viel Bein zeigte, ohne je dabei rot zu werden, erschien mir das Raffen des langen Rocks doch irgendwie viel aufgeladener mit Sexualität. Ich biss die Zähne zusammen und legte den Stoff sorgfältig in Falten, damit ich ihn auch festhalten konnte.
»Miss Stackhouse, es soll so aussehen, als würde Ihnen das Spaß machen«, sagte Al. Er spähte hinter seiner Kamera hervor, die Stirn ziemlich unzufrieden gerunzelt.
Ich versuchte, nicht beleidigt zu sein. Schließlich hatte ich Claude versprochen, ihm einen Gefallen zu tun, und Gefallen sollten bereitwillig getan werden. Ich hob mein Bein so weit, dass mein Oberschenkel parallel zum Boden war, und streckte die nackte Fußspitze in einer, wie ich hoffte, graziösen Haltung nach unten. Dann legte ich beide Hände auf Claudes nackte Schultern und sah zu ihm auf. Seine Haut fühlte sich warm und weich an – aber es war weder erotisch noch erregend.
»Sie wirken gelangweilt, Miss Stackhouse«, sagte Alfred. »Sie sollen aussehen, als ob sie ihn gleich anspringen wollen. Maria-Star, mach sie mehr… mehr…« Seine Assistentin schoss auf mich zu und zog die kleinen Puffärmel noch weiter über meine Schultern herunter. Sie war etwas zu eifrig bei der Sache, und ich war nur froh, dass das Mieder ziemlich stabil war.
Tatsache war, dass Claude den ganzen Tag lang wunderschön und nackt dastehen könnte, ohne dass ich ihn begehren würde. Er ist ein mürrischer Typ mit äußerst schlechtem Benehmen. Selbst wenn er hetero wäre, hätte ich nichts mit ihm anfangen können – das war mir schon nach zehn Minuten in seiner Gesellschaft klar.
Wie Claude vorhin musste jetzt ich Zuflucht zu meiner Fantasie nehmen.
Ich dachte an den Vampir Bill, meine erste große Liebe in jeder Hinsicht. Doch statt Lust verspürte ich nur Wut. Bill traf sich mit einer anderen Frau, und das schon seit ein paar Wochen.
Okay, dann vielleicht Eric, Bills Boss, der einstige Wikinger? Mit dem Vampir Eric hatte ich im Januar einige Tage lang mein Haus und mein Bett geteilt. Nein, bloß nicht, das war zu gefährlich. Eric kannte ein Geheimnis, das ich für den Rest meines Lebens verbergen wollte. Da er allerdings an Gedächtnisverlust gelitten hatte, während er bei mir zu Hause war, konnte er sich nicht daran erinnern, dass mein Geheimnis irgendwo in seinem Hirn schlummerte.
Und auch ein paar andere Gesichter kamen mir noch in den Sinn – mein Boss Sam Merlotte, der Besitzer von Merlotte’s Bar. Nein, tu das nicht, stell dir nicht deinen Boss nackt vor, ganz schlechte Idee. Alcide Herveaux? Völlig ausgeschlossen, und erst recht nicht in Gegenwart seiner neuen Freundin… Okay, damit waren die realen Personen für meine Fantasien aufgebraucht; jetzt musste ich auf meine alten Lieblinge aus der fiktiven Welt zurückgreifen.
Aber Filmstars wirkten so langweilig, verglichen mit der übernatürlichen Welt, die ich kannte, seit Bill das erste Mal ins Merlotte’s gekommen war. Mein letztes irgendwie entfernt erotisches Erlebnis hatte – seltsamerweise – damit zu tun, dass eine blutende Wunde an meinem Bein abgeleckt wurde. Das war… beunruhigend gewesen. Aber sogar unter jenen ungewöhnlichen Umständen hatte sich tief in meinem Innern etwas geregt. Ich erinnerte mich, wie sich Quinns kahler Kopf bewegt hatte, während er auf ganz intime Weise den blutenden Kratzer ableckte, der feste Griff seiner warmen Hände an meinem Bein…
»So geht’s«, sagte Alfred und drückte ein ums andere Mal den Auslöser. Claude legte eine Hand um meinen Oberschenkel, als er spürte, dass meine Muskeln von der Anstrengung, ihn hochzuhalten, zu zittern begannen. So hielt wieder ein Mann mein Bein fest. Claude hatte kräftig zugegriffen, um meinen Oberschenkel zu stützen. Was mir durchaus half, aber es war kein bisschen erotisch.
»Und jetzt ein paar Bettfotos«, sagte Al genau in dem Augenblick, in dem ich es keine Sekunde länger ausgehalten hätte.
»Nein«, antworteten Claude und ich im Duett.
»Aber das ist Teil des Auftrags«, erklärte Al. »Keine Angst, keiner muss sich ausziehen. Solche Fotos mache ich nicht. Meine Frau würde mich umbringen. Ihr legt euch einfach beide so aufs Bett, wie ihr seid. Claude stützt sich auf einen Ellbogen und schaut auf Sie hinunter, Miss Stackhouse.«
»Nein«, erwiderte ich entschlossen. »Machen Sie ein paar Fotos von ihm, wie er allein im Wasser steht. Das wäre viel besser.« In der einen Ecke des Fotostudios war so eine Art künstlicher Teich, und Fotos von einem scheinbar nackten Claude, dem das Wasser von der Brust tropfte, würden höchst anziehend wirken (jedenfalls auf jede Frau, die ihm noch nie begegnet war).
»Was meinst du, Claude?«, fragte Al.
Jetzt brach sich Claudes Narzissmus Bahn. »Ich glaube, das wäre großartig, Al«, sagte er und versuchte, nicht zu begeistert zu klingen.
Ich ging schon auf den Umkleideraum zu, ich konnte es kaum erwarten, aus diesem Kostüm herauszukommen und wieder meine guten alten Jeans überzustreifen. Ich sah mich nach einer Uhr um. Um halb sechs begann meine Schicht im Merlotte’s, und vorher musste ich noch nach Bon Temps zurück, meine Kellnerinnenuniform von zu Hause holen und wieder zur Bar fahren.
»Danke, Sookie«, rief Claude mir hinterher.
»Gern, Claude. Und viel Glück bei diesem Wettbewerb.« Doch er bewunderte sich schon wieder im Spiegel.
Maria-Star brachte mich hinaus. »Tschüs, Sookie. Schön, dass wir uns mal wieder getroffen haben.«
»Find ich auch«, log ich. Und obwohl sie die verwickelte rote Gedankenwelt einer Werwölfin hatte, konnte ich erkennen, dass Maria-Star nicht verstand, warum ich Alcide einfach so aufgab. Schließlich sah der Werwolf auf robuste Art sehr gut aus, war ein unterhaltsamer Freund und ein heißblütiger Mann aus der heterosexuellen Liga. Und noch dazu besaß er jetzt eine eigene Baufirma und war ein wohlhabender Mann.
Eine Frage schoss mir durch den Kopf, und ehe ich nachgedacht hatte, sprach ich sie auch schon aus. »Wird eigentlich noch nach Debbie Pelt gesucht?«, fragte ich, geradeso wie jemand, der in einer Wunde bohrt. Debbie war Alcides Langzeitfreundin gewesen, auch wenn sich die beiden zwischendurch immer mal wieder getrennt hatten. Sie war ein echtes Miststück gewesen.
»Nicht mehr von denselben Leuten«, sagte Maria-Star. Ihre Miene verdüsterte sich. Maria-Star dachte genauso ungern an Debbie wie ich, wenn auch aus völlig anderen Gründen. »Die von den Pelts angeheuerten Privatdetektive haben den Fall aufgegeben; sie sagten, sie würden die Familie nur schröpfen, wenn sie noch weitermachen. Das habe ich jedenfalls gehört. Und die Polizei gibt es zwar nicht zu, aber sie hat auch einen toten Punkt erreicht. Ich bin den Pelts nur einmal begegnet, als sie kurz nach Debbies Verschwinden nach Shreveport kamen. Eine wirklich wilde Familie.« Ich blinzelte verwirrt. Das war ein ziemlich hartes Urteil, vor allem von einer Werwölfin.
»Sandra, die andere Tochter, ist die schlimmste. Sie hat Debbie sehr gern gehabt, und nur ihretwegen heuern die Pelts noch immer irgendwelche seltsamen Leute in der Sache an. Ich glaube ja, dass Debbie entführt wurde. Oder vielleicht hat sie sich umgebracht. Als Alcide sich von ihr losgesagt hat, ist sie wahrscheinlich durchgedreht.«
»Vielleicht«, murmelte ich ohne große Überzeugung.
»So ist er besser dran. Ich hoffe, sie taucht nie wieder auf«, sagte Maria-Star.
Ich war derselben Meinung wie Maria-Star, nur dass ich im Gegensatz zu ihr ganz genau wusste, was Debbie zugestoßen war; und das war es auch, was zwischen Alcide und mir stand und uns getrennt hatte.
»Ich hoffe, er sieht sie nie wieder«, bekräftigte Maria-Star. Ihr hübsches Gesicht war düster und zeigte einen Anflug ihrer eigenen wilden Seite.
Alcide mochte sich ja vielleicht mit Maria-Star treffen, aber er hatte sich ihr nicht vollständig anvertraut. Alcide wusste, dass er Debbie nie wiedersehen würde. Und das war meine Schuld.
Ich habe sie nämlich erschossen.
Ich habe mehr oder weniger meinen Frieden mit dieser Tat gemacht, aber an die schiere Tatsache muss ich immer wieder denken. Es ist unmöglich, jemanden zu töten und nach einer solchen Tat weiterzumachen wie vorher. Die Konsequenzen verändern dein Leben.
Zwei Priester kamen in die Bar.
Klingt wie der erste Satz in einem blöden Witz. Aber diese beiden Priester hatten kein Känguru dabei, und es saß weder ein Rabbi am Tresen noch eine Blondine. Ich hatte bereits jede Menge Blondinen gesehen, ein Känguru mal im Zoo, einen Rabbi zwar noch nie, aber diese beiden Priester schon oft. Regelmäßig alle zwei Wochen trafen sie sich im Merlotte’s zum Abendessen.
Pater Dan Riordan, glattrasiert und von frischer roter Gesichtsfarbe, war der katholische Priester, der jeden Samstag in die kleine Kirche in Bon Temps kam und die Messe abhielt. Und der bleiche, bärtige Pfarrer Kempton Littrell war der Geistliche der Episkopalen und hielt alle zwei Wochen das heilige Abendmahl in der winzigen Episkopalkirche in Clarice ab.
»Hallo, Sookie«, sagte Pater Riordan. Er war Ire, ein richtiger Ire, nicht bloß irischer Abstammung. Ich hörte ihn unglaublich gern reden in diesem typischen Singsang. Er trug eine schwarze Brille mit dicken Gläsern und war etwa Mitte vierzig.
»’n Abend, Pater. Hallo, Pfarrer Littrell. Was darf ich Ihnen denn bringen?«
»Für mich einen Scotch mit Eis, Miss Sookie. Und für dich, Kempton?«
»Oh, bloß ein Bier. Und die frittierten Hühnchenstreifen im Korb, bitte.« Der Episkopalgeistliche trug eine Brille mit Goldrand und war jünger als Pater Riordan. Ein sehr gewissenhafter Mann.
»Gern.« Ich lächelte die beiden an. Da ich ihre Gedanken lesen konnte, wusste ich, dass sie von Grund auf gute Menschen waren, und das freute mich. Es ist immer ziemlich beunruhigend, aus den Gedanken von Geistlichen zum Beispiel herauszulesen, dass sie kein bisschen besser sind als man selbst; und nicht nur das, die meisten versuchen es nicht einmal zu sein.
Inzwischen war es vollständig dunkel draußen, und so überraschte es mich nicht, als Bill Compton ins Merlotte’s kam. Was ich von den beiden Priestern nicht behaupten konnte. Die Kirchen in Amerika kamen mit der Existenz von Vampiren nicht so richtig klar. Ihre Haltung konfus zu nennen, war noch milde ausgedrückt. Die katholische Kirche befand sich zurzeit in Beratungen über die Frage, ob die Kirche alle Vampire verdammen und den Kirchenbann über sie verhängen oder sie als potentielle Katholiken in ihrem Schoß willkommen heißen sollte. Die Episkopalkirche hatte sich dagegen ausgesprochen, Vampire zu Priestern zu weihen, sie durften allerdings das Abendmahl empfangen – auch wenn eine beträchtliche Anzahl von Laien dazu noch immer sagte: »Nur über meine Leiche.« Unglücklicherweise hatten die meisten von ihnen keine Ahnung, wie hoch die Wahrscheinlichkeit war, dass es genau dazu kam.
Beide Priester sahen mit Bedauern, dass Bill mir einen flüchtigen Kuss auf die Wange gab und sich dann an seinen Lieblingstisch setzte. Bill würdigte sie kaum eines Blickes, schlug seine Zeitung auf und begann zu lesen. Dabei wirkte er stets sehr ernst, so als würde er aufmerksam den Wirtschaftsteil studieren oder die neuesten Nachrichten aus dem Irak. Aber ich wusste, dass er zuerst die Ratgeberkolumne las und dann die Comics, auch wenn er die Witze oft nicht verstand.
Bill war allein gekommen, was mal eine nette Abwechslung war. Gewöhnlich brachte er die hübsche Selah Pumphrey mit. Ich verabscheute sie von Herzen. Bill war meine erste große Liebe und mein erster Liebhaber gewesen, wahrscheinlich würde ich nie ganz über ihn hinwegkommen. Vielleicht wollte er das auch gar nicht. Zu jeder ihrer Verabredungen schien er Selah ins Merlotte’s zu schleppen. Als wollte er sie mir ständig irgendwie vorführen. Nicht gerade das, was man tut, wenn einem die Verflossene völlig egal ist, oder?
Ohne dass er mich darum bitten musste, brachte ich ihm sein Lieblingsgetränk, »TrueBlood«, Blutgruppe 0.Wie es sich gehörte, stellte ich es direkt vor ihm auf einer Serviette ab. Ich hatte mich schon zum Gehen gewandt, da spürte ich plötzlich eine kühle Hand auf meinem Arm. Wann immer er mich berührte, durchfuhr es mich; vielleicht würde das ewig so bleiben. Bill hatte mir stets deutlich zu verstehen gegeben, wie aufregend er mich fand, und nach einem Leben ohne Beziehungen oder Sex hatte es mich enorm aufgerichtet, dass Bill mich für attraktiv hielt. Auch andere Männer sahen mich auf einmal an, als sei ich interessanter geworden. Jetzt wusste ich, warum die Leute so viel an Sex dachten; Bill hatte mich gründlich unterwiesen.
»Sookie, warte einen Moment.« Ich sah in seine braunen Augen, die in dem bleichen Gesicht noch viel dunkler wirkten. Sein glattes braunes Haar glänzte seidig. Er war schlank und breitschultrig und hatte starke, muskulöse Arme; da erkannte man noch den Farmer, der er einst gewesen war. »Wie geht’s dir denn so?«
»Prima«, sagte ich und versuchte, nicht zu erstaunt zu klingen. So was kam nicht oft vor, Smalltalk war nicht gerade Bills Stärke. Selbst als wir noch zusammen waren, war er nicht das gewesen, was man gesprächig nennt. Und sogar Vampire können Workaholics sein: Bill war zu einem Computerfreak geworden. »Und dir? Alles in Ordnung?«
»Ja. Wann fährst du nach New Orleans, um das Erbe anzutreten?«
Das erschreckte mich jetzt richtig. (Was daran liegt, dass ich die Gedanken von Vampiren nicht lesen kann. Deshalb mag ich Vampire ja so gern. Ich find’s wunderbar, mit Leuten zusammen zu sein, die mir ein Rätsel sind.) Meine Cousine war vor ungefähr sechs Wochen in New Orleans ermordet worden, und Bill war bei mir gewesen, als der Abgesandte der Königin von Louisiana mir die Nachricht überbrachte… und den Mörder meinem Urteil auslieferte. »Vermutlich werde ich irgendwann nächsten Monat oder so Hadleys Apartment auflösen. Ich habe Sam noch nicht gefragt, wann ich frei nehmen kann.«
»Tut mir leid, dass du deine Cousine verloren hast. Hast du sehr um sie getrauert?«
Ich hatte Hadley seit Jahren nicht gesehen, und es wäre auch mehr als seltsam gewesen, sie wiederzutreffen, nachdem sie eine Vampirin geworden war. Aber als Mensch mit sehr wenigen lebenden Verwandten tat es mir um jeden Einzelnen leid. »Ein bisschen«, erwiderte ich.
»Du weißt also noch nicht, wann du fährst?«
»Nein. Erinnerst du dich an ihren Rechtsanwalt, Mr Cataliades? Wenn eine beglaubigte Testamentsabschrift vorliegt, will er mir Bescheid geben. Er hat versprochen, dass alles in der Wohnung so bleibt, wie es ist, und wenn der Rechtsberater der Königin sagt, dass er sich um die Wohnung kümmert, kann man das wohl unbesehen glauben. Mich hat’s bislang nicht sonderlich interessiert, um ehrlich zu sein.«
»Vielleicht fahre ich mit dir nach New Orleans, wenn du nichts gegen einen Reisegefährten hast.«
»Na so was«, sagte ich, mit nur einem Anflug von Spott in der Stimme. »Hätte nicht eher Selah was dagegen? Oder willst du sie mitnehmen?« Das konnte ja eine lustige Reise werden.
»Nein.« Und er machte zu. Aus Bill war einfach nichts mehr herauszubekommen, wenn er diesen Zug um den Mund hatte. Das wusste ich aus Erfahrung.
Okay, um ehrlich zu sein: Ich war verwirrt.
»Ich lass es dich wissen«, erwiderte ich, obwohl ich nicht so richtig schlau aus ihm wurde. Auch wenn es mir wehtat, Bill zu treffen, vertraute ich ihm doch. Bill würde mich nie verletzen. Er würde auch nie zulassen, dass jemand anders mich verletzte. Aber es gibt mehr als nur eine Art von Verletzung.
»Sookie«, rief Pfarrer Littrell, und ich eilte davon.
Ich blickte mich noch einmal kurz um und sah, dass Bill lächelte, ein kleines Lächeln voller Zufriedenheit. Was das zu bedeuten hatte, wusste ich nicht, aber ich sah Bill gern lächeln. Hoffte er vielleicht, unsere Beziehung wiederbeleben zu können?
»Wir waren uns nicht sicher«, sagte Pfarrer Littrell, »ob wir Sie unterbrechen sollten oder nicht.« Ich sah ihn verständnislos an.
»Wir waren ein wenig besorgt, weil Sie so lange und so konzentriert mit dem Vampir gesprochen haben«, erklärte Pater Riordan. »Wollte dieser Höllenkerl Sie in seinen Bann ziehen?«
Plötzlich klang sein irischer Singsang gar nicht mehr charmant. Stirnrunzelnd sah ich ihn an. »Das meinen Sie nicht ernst, oder? Sie wissen doch, dass Bill und ich eine ganze Zeit lang zusammen waren. Anscheinend wissen Sie nicht allzu viel über Höllenkerle, wenn Sie schon Bill für einen halten.« Ich war in Bon Temps und um unser schönes Städtchen herum schon sehr viel unheimlicheren Gestalten begegnet als Bill. Und einige davon waren Menschen. »Pater Riordan, ich weiß, was ich tue, und ich kenne das Wesen von Vampiren besser, als Sie es jemals kennen lernen werden. – Pfarrer Littrell«, fügte ich hinzu, »möchten Sie Honigsenf oder Ketchup zu Ihren frittierten Hühnchenstreifen?«
Pfarrer Littrell entschied sich, leicht verdattert, für Honigsenf, und dann stürzte ich mich in meine Arbeit, um diesen kleinen Zwischenfall abzuschütteln. Was würden die beiden Geistlichen wohl erst sagen, wenn sie wüssten, was sich vor ein paar Wochen in dieser Bar abgespielt hatte? Da hatten sich die Stammkunden zusammengerottet, um mich von jemandem zu befreien, der mich töten wollte.
Da dieser Jemand ein Vampir gewesen war, hätten die beiden es wahrscheinlich gebilligt.
Ehe er das Merlotte’s verließ, kam Pater Riordan noch »auf ein Wort« zu mir, wie er sagte. »Sookie, ich weiß, dass Sie im Moment nicht gut auf mich zu sprechen sind, aber ich möchte Sie für jemand anderen um etwas bitten. Auch wenn Sie mir wegen meines Verhaltens vorhin nicht mehr zuhören wollen – tun Sie es bitte trotzdem, für diese anderen.«
Ich seufzte. Pater Riordan bemühte sich wenigstens, ein guter Mensch zu sein. Widerwillig nickte ich.
»So ist’s recht. Eine Familie aus Jackson hat Kontakt mit mir aufgenommen…«
Sofort schrillten alle meine Alarmglocken. Debbie Pelt war aus Jackson.
»Die Familie Pelt, ich weiß, dass Sie schon von ihr gehört haben. Die Pelts sind noch immer auf der Suche nach ihrer Tochter, die im Januar verschwunden ist. Debbie. Sie haben mich angerufen, weil ihr Pfarrer mich kennt und weiß, dass ich die Gemeinde von Bon Temps betreue. Die Pelts möchten Sie gern besuchen, Sookie. Sie möchten mit jedem sprechen, der ihre Tochter in der Nacht, in der sie verschwand, gesehen hat, und sie fürchten, Sie könnten sie abweisen, wenn sie einfach unangemeldet bei Ihnen vor der Tür stehen. Die Pelts fürchten, Sie könnten wütend sein, weil ihre Privatdetektive und die Polizei Sie befragt haben, und dass Sie ihnen gegenüber vielleicht ungehalten sind.«
»Ich will sie nicht sehen«, erwiderte ich. »Pater Riordan, ich habe schon alles gesagt, was ich weiß.« Das war die Wahrheit. Ich hatte es nur nicht der Polizei oder den Pelts gesagt. »Ich will nicht mehr über Debbie reden.« Auch das war die Wahrheit, die reine Wahrheit. »Richten Sie ihnen bitte mit allem gebotenen Respekt aus, dass es nichts mehr zu besprechen gibt.«
»Das werde ich tun«, entgegnete er. »Aber eines muss ich Ihnen schon sagen, Sookie: Ich bin enttäuscht.«
»Tja, da habe ich ja heute einen richtig schlechten Abend«, sagte ich. »Wo Sie jetzt auch noch Ihre gute Meinung von mir verloren haben.«
Er ging ohne ein weiteres Wort – genau das hatte ich erreichen wollen.
Kapitel 2
Kurz bevor die Bar am nächsten Abend schloss, passierte noch etwas Merkwürdiges. Sam hatte uns gerade signalisiert, den Gästen zu sagen, dass wir jetzt die letzte Runde Drinks servieren würden, da kam jemand ins Merlotte’s, den wiederzusehen ich nie erwartet hatte.
Er bewegte sich erstaunlich lautlos für einen so großen Mann. An der Tür blieb er stehen und sah sich nach einem freien Tisch um, und ich bemerkte ihn, weil das gedämpfte Licht der Bar auf seinem rasierten Kopf schimmerte. Er war sehr groß, sehr muskulös, hatte eine stolze Nase, leuchtend weiße Zähne und volle Lippen. Sein olivfarbener Teint passte sehr gut zu dem bronzefarbenen Sportjackett, das er über einem schwarzen Hemd und dazu passender Hose trug. Und auch wenn Motorradstiefel an ihm normaler gewirkt hätten, steckten seine Füße in glänzenden Halbschuhen.
»Quinn«, flüsterte Sam. Seine Hände hielten inne, obwohl er gerade dabei war, einen Tom Collins zu mixen. »Was macht der denn hier?«
»Ich wusste gar nicht, dass du ihn kennst«, sagte ich und wurde rot, als mir einfiel, dass ich erst am Tag zuvor an den Mann mit dem Kahlkopf gedacht hatte. Er war derjenige, der das Blut von der Kratzwunde an meinem Bein geleckt hatte – ein sehr interessantes Erlebnis.
»Jeder in meiner Welt kennt Quinn«, erklärte Sam mit ausdrucksloser Miene. »Aber ich wundere mich, dass du ihn kennst, schließlich bist du keine Gestaltwandlerin.« Anders als Quinn war Sam kein großer Mann. Aber er war sehr stark, wie die meisten Gestaltwandler, und seine rotblonden Locken umrahmten sein Gesicht, dass er aussah wie ein Engel.
»Ich kenne Quinn vom Wettkampf der Leitwolfkandidaten«, sagte ich. »Er war der, äh, Wettkampfrichter.« Sam und ich hatten uns natürlich über den Führungswechsel an der Spitze des Werwolfrudels von Shreveport unterhalten. Shreveport ist nicht sehr weit von Bon Temps entfernt, und was bei den Werwölfen geschieht, ist ziemlich wichtig, wenn man irgendeine Art Gestaltwandler ist.
Ein echter Gestaltwandler wie Sam kann sich in jedes Tier verwandeln, auch wenn jeder Gestaltwandler natürlich ein Lieblingstier hat. Und um es noch komplizierter zu machen: Alle, die ihre Menschengestalt in eine Tiergestalt verwandeln können, nennen sich Gestaltwandler, obwohl nur die wenigsten so vielseitig sind wie Sam. Gestaltwandler, die sich bloß in ein einziges Tier verwandeln können, werden Wergeschöpfe genannt: Wertiger (wie Quinn), Werbären, Werwölfe. Die Werwölfe halten sich allerdings für was Besseres und fühlen sich in Zähigkeit und Kultur allen anderen Gestaltwandlern überlegen.
Werwölfe sind zahlenmäßig die größte Untergruppe der Gestaltwandler, doch verglichen mit der Gesamtzahl der Vampire sind es noch immer verschwindend wenige. Das hat verschiedene Gründe. Die Geburtenzahl der Werwölfe ist niedrig, die Sterblichkeitsrate der Neugeborenen liegt viel höher als unter den Menschen, und nur das erstgeborene Kind eines vollblütigen Werwolfpaares wird selbst zu einem vollblütigen Werwolf. Und zwar in der Pubertät – als wäre die Pubertät an sich nicht schon schlimm genug.
Gestaltwandler sind äußerst verschwiegen. Eine Angewohnheit, die sie nur schwer ablegen können, selbst einem verständnisvollen und etwas seltsamen Menschen wie mir gegenüber. Die Gestaltwandler haben sich der Öffentlichkeit noch nicht zu erkennen gegeben, und erst nach und nach lerne ich ihre Welt so langsam kennen.
Selbst Sam hat viele Geheimnisse, von denen ich nichts weiß, und ihn zähle ich zu meinen Freunden. Sam verwandelt sich in einen Collie. In dieser Gestalt kommt er mich oft besuchen. (Manchmal schläft er auf meinem Bettvorleger.)
Quinn hatte ich bislang nur in seiner menschlichen Gestalt gesehen.
Ich hatte Quinn nicht erwähnt, als ich Sam von dem Kampf zwischen Jackson Herveaux und Patrick Furnan um die Position des Leitwolfs im Shreveport-Rudel erzählte. Jetzt blickte mich Sam verärgert an, weil ich ihm das vorenthalten hatte. Aber es war keine Absicht gewesen. Ich sah wieder zu Quinn hinüber. Er hatte die Nase ein wenig gehoben und schnupperte in die Luft, er folgte einem Geruch. Wem war er auf der Spur?
In Arlenes Bereich, der näher bei der Tür lag, waren einige Tische frei, und als Quinn schließlich trotzdem zielsicher auf einen Tisch in meinem Bereich zusteuerte, wusste ich die Antwort: Er war mir auf der Spur.
Okay, zugegeben, so ganz geheuer war mir das nicht.
Ich warf Sam einen Blick von der Seite zu, um zu sehen, wie er reagierte. Seit fünf Jahren schon vertraute ich ihm, und er hatte mich noch nie enttäuscht.
Sam nickte mir zu. Auch wenn er nicht gerade glücklich wirkte. »Frag ihn, was er will«, sagte er mit so leiser Stimme, dass es eher wie ein Knurren klang.
Ich wurde nervöser und nervöser, je näher ich dem neuen Gast kam. Ich spürte, wie meine Wangen sich röteten. Warum war ich so aufgeregt?
»Hallo, Quinn.« Es wäre albern gewesen, so zu tun, als würde ich ihn nicht wiedererkennen. »Was kann ich dir bringen? Wir schließen zwar leider bald, aber für ein Bier oder einen Drink reicht die Zeit noch.«
Er schloss die Augen und atmete tief ein, als wollte er mich inhalieren. »Ich würde dich in einem pechschwarzen Raum erkennen«, sagte er und lächelte mich an. Es war ein offenes, herzliches Lächeln.
Ich sah weg und unterdrückte das unwillkürliche Lächeln, das mir auf die Lippen trat. Ich benahm mich irgendwie… schüchtern. (Unsinn, ich benehme mich nie schüchtern. Vielleicht wäre verschämt der bessere Ausdruck, aber den kann ich einfach nicht leiden.)
»Tja, danke«, begann ich vorsichtig. »Das war doch ein Kompliment, oder?«
»So war es gemeint. Wer ist der Hund da hinter dem Tresen, der mir diesen Raus-hier-Blick zuwirft?«
Er benutzte das Wort Hund als ganz sachliche Bezeichnung, nicht als abfällige Beschimpfung.
»Das ist mein Boss, Sam Merlotte.«
»Er interessiert sich für dich.«
»Das will ich hoffen. Ich arbeite immerhin schon seit fast fünf Jahren für ihn.«
»Hmmm. Wie wär’s mit einem Bier?«
»Gern. Was für eins?«
»Budweiser.«
»Kommt sofort«, sagte ich und ging. Ich wusste, dass er mich den ganzen Weg bis zum Tresen beobachtete, denn ich konnte seinen Blick spüren. Und ich wusste aus seinen Gedanken, auch wenn sie schwer zu lesen waren, dass er mich mit Bewunderung betrachtete.
»Was will er?« Sam wirkte beinahe… borstig. Wäre er in seiner Hundegestalt gewesen, hätte er ganz sicher die Nackenhaare aufgestellt.
»Ein Budweiser«, sagte ich.
Sam blickte mich finster an. »Das habe ich nicht gemeint, und das weißt du auch.«
Ich zuckte die Achseln. Ich hatte keine Ahnung, was Quinn wollte.
Sam knallte das volle Glas direkt neben meine Hand auf den Tresen, so dass ich zusammenzuckte. Ich sah ihn mit hochgezogenen Augenbrauen an, damit er merkte, wie verärgert ich war, und brachte dann das Bier zu Quinn.
Quinn zahlte gleich und gab mir ein gutes Trinkgeld, kein lächerlich hohes, bei dem ich mir gekauft vorgekommen wäre. Ich steckte es in die Tasche und machte die Runde an den anderen Tischen.
»Besuchst du jemanden hier in der Gegend?«, fragte ich Quinn, als ich einen Tisch abgeräumt hatte und auf dem Rückweg an ihm vorbeikam. Die meisten Gäste wollten zahlen und verließen nach und nach das Merlotte’s. Etwas weiter außerhalb gab es eine Kneipe, die bis spät in die Nacht offen hatte. Sam tat immer so, als wüsste er nichts davon, doch die meisten Stammgäste gingen sowieso nach Hause und legten sich ins Bett. Wenn es so was gab wie eine auf Familie ausgerichtete Bar, dann das Merlottes’s.
»Ja«, erwiderte Quinn. »Dich.«
Darauf fiel mir erst mal keine Antwort ein.
Ich lief weiter und lud am Tresen die Gläser von meinem Tablett, so zerstreut, dass ich beinahe eins fallen ließ. Ich konnte mich nicht erinnern, wann ich zuletzt so verwirrt gewesen war.
»Geschäftlich oder privat?«, fragte ich, als ich das nächste Mal an ihm vorbeikam.
»Beides«, sagte Quinn.
Die Freude ließ ein wenig nach wegen des geschäftlichen Teils, aber es schärfte meine Aufmerksamkeit… und das war sehr gut. Man muss geistig immer absolut präsent sein, wenn man mit Supras zu tun hat. Übernatürliche Wesen haben Ziele und Wünsche, die normale Menschen gar nicht erfassen können. Und das kann ich nun wirklich beurteilen, denn ich bin schon mein ganzes Leben lang unfreiwillig Zeugin der »normalen« Ziele und Wünsche von Menschen.
Quinn war schließlich der letzte Gast in der Bar – sonst waren nur noch die anderen Kellnerinnen und Sam da–, stand vom Stuhl auf und sah mich erwartungsvoll an. Ich ging zu ihm hinüber und lächelte munter, wie ich es immer tue, wenn ich unter Anspannung stehe. Und ich staunte ziemlich, als ich merkte, dass er beinahe genauso angespannt war wie ich. Das konnte ich seinen Gedanken entnehmen.
»Lass uns zu dir nach Hause fahren, wenn es dir recht ist.« Er sah mich ernst an. »Sollte dich das nervös machen, können wir natürlich auch woanders hinfahren. Aber ich möchte noch heute Abend mit dir sprechen, es sei denn, du bist zu erschöpft.«
Das war höflich genug, fand ich. Arlene und Danielle waren sichtlich bemüht, nicht herüberzustarren – na ja, sie bemühten sich, nur dann herüberzustarren, wenn Quinn es nicht merkte–, und Sam hatte sich umgedreht, fummelte an irgendwas hinter der Bar herum und ignorierte den anderen Gestaltwandler einfach. Er benahm sich richtiggehend daneben.
Schnell überdachte ich Quinns Vorschlag. Wenn er zu mir nach Hause kam, wäre ich ihm ausgeliefert. Mein Haus liegt ziemlich entlegen. Mein einziger Nachbar ist mein Exfreund Bill, und der wohnt auf der gegenüberliegenden Seite des alten Friedhofs. Andererseits, wäre Quinn jemand gewesen, den ich regelmäßig sehe, hätte ich keine Bedenken gehabt, mich von ihm nach Hause bringen zu lassen. Und dem, was ich von seinen Gedanken mitbekam, entnahm ich, dass er mir nichts Böses wollte.
»In Ordnung«, sagte ich schließlich. Er entspannte sich und schenkte mir noch einmal sein offenes, herzliches Lächeln.
Ich räumte sein leeres Glas ab und bemerkte, dass drei Augenpaare mich missbilligend musterten. Sam war verärgert, und Danielle und Arlene konnten nicht verstehen, wieso irgendjemand mich ihnen vorziehen sollte; obwohl Quinn sogar diese beiden Kellnerinnen stutzig machte. Quinn strahlte eine Andersartigkeit aus, die selbst dem fantasielosesten Menschen auffallen musste.
»Bin gleich fertig«, sagte ich.
»Lass dir Zeit.«
Ich füllte die kleinen rechteckigen Porzellanbehälter auf den Tischen mit Zuckertütchen und Süßstoff auf, sorgte dafür, dass die Serviettenhalter voll waren, und überprüfte die Salz- und Pfefferstreuer. Es dauerte nicht lange, dann war ich fertig. Ich holte meine Tasche aus Sams Büro und rief ihm einen Abschiedsgruß zu.
Quinn fuhr in einem dunkelgrünen Pick-up hinter mir her. Im Schein der Parkplatzlaterne hatte der Wagen brandneu ausgesehen mit den sauberen Reifen und den glänzenden Radkappen, der großen Fahrerkabine und dem eingebauten Schlafplatz. Quinns Pick-up war der schickste Wagen, den ich seit langem gesehen hatte. Mein Bruder Jason wäre ganz scharf darauf gewesen, obwohl er einen mit pink und lila Flammen an den Seiten besitzt.
Ich fuhr auf der Hummingbird Road Richtung Süden und bog nach links in meine Auffahrt ab. Es ging ein Stück durch den Wald, dann kam ich zu der Lichtung, auf der das alte Haus unserer Familie steht. Ich hatte die Außenbeleuchtung eingeschaltet, ehe ich zur Arbeit fuhr, und auf dem Leitungsmast befand sich auch noch ein automatisch anspringendes Sicherheitslicht, so dass das Grundstück gut ausgeleuchtet war. Ich fuhr ums Haus herum nach hinten, wo ich immer parkte, und Quinn parkte neben mir.
Er stieg aus und blickte sich um. Im Schein des Sicherheitslichts zeigte sich ihm ein absolut ordentlicher Hof mit Garten. Die Auffahrt war in tadellosem Zustand, und vor kurzem erst hatte ich den Geräteschuppen frisch gestrichen. Es gab einen Propangastank, der durch keine Gartengestaltung zu verbergen war, doch meine Großmutter hatte viele schöne Blumen und Büsche angepflanzt zusätzlich zu den Beeten, die meine Familie in den letzten hundertfünfzig Jahren hier angelegt hatte. Ich wohnte auf diesem Grund und Boden, in diesem Haus, seit ich sieben war, und ich liebte es.
Mein Haus ist nichts Besonderes. Anfangs war es ein ganz normales Bauernhaus, das über die Jahrzehnte immer wieder umgebaut und vergrößert wurde. Ich versuche, es zu pflegen sowie Hof und Garten gut in Schuss zu halten. Große Reparaturen kann ich natürlich nicht selbst machen, aber da hilft Jason mir manchmal. Er war nicht gerade glücklich, als Großmutter mir das Haus hinterließ, doch er war mit einundzwanzig in das Haus unserer Eltern umgezogen. Die Hälfte, die davon mir zusteht, habe ich mir nie von ihm auszahlen lassen. Ich fand Großmutters Testament fair. Es dauerte aber eine Weile, bis auch Jason zugeben konnte, dass sie genau das Richtige getan hatte.
Mein Bruder und ich waren uns in den letzten Monaten wieder nähergekommen.
Ich schloss die Hintertür auf, die in die Küche führte. Quinn sah sich neugierig um, während ich meine Jacke über einen der Stühle hängte, die unter den Tisch mitten im Raum geschoben waren, an dem ich alle meine Mahlzeiten einnahm.
»Sie ist noch nicht fertig«, sagte Quinn.
Die Küchenschränke standen auf dem Boden und mussten noch montiert werden. Wenn dann erst mal die Wände gestrichen und die Arbeitsplatten installiert waren, würde ich endlich zur Ruhe kommen.
»Meine alte Küche ist vor ein paar Wochen abgebrannt«, sagte ich. »Den Leuten von der Baufirma war ein Auftrag abgesagt worden, und sie haben das hier in Rekordzeit hochgezogen. Doch dann kamen die Küchenschränke nicht pünktlich, und sie haben den nächsten Auftrag angenommen. Als die Küchenschränke endlich eintrafen, waren die Arbeiter dort noch nicht ganz fertig, aber irgendwann demnächst tauchen sie hier hoffentlich noch mal auf.« Inzwischen konnte ich wenigstens wieder in meinem eigenen Haus wohnen. Sam war äußerst großzügig gewesen und hatte mich in einem seiner Häuser, die er vermietet, wohnen lassen – wie ich das genossen hatte, die ebenen Böden, das neue Badezimmer, die Nachbarn! Aber es geht doch nichts über das eigene Zuhause.
Der neue Herd war bereits angeschlossen, kochen konnte ich also, und über die Küchenschränke auf dem Boden hatte ich Sperrholzplatten gelegt, so dass ich eine Arbeitsfläche hatte. Der neue Kühlschrank glänzte und summte leise vor sich hin, ganz anders als Großmutters dreißig Jahre altes Exemplar. Wie unglaublich neu alles war, fiel mir jedes Mal wieder auf, wenn ich über die – jetzt breitere und eingefasste – hintere Veranda ging und die neue, viel schwerere Tür mit dem Guckloch und dem Riegel aufschloss.
»Hier beginnt das alte Haus«, sagte ich und ging von der Küche in die Diele. Im restlichen Haus hatten nur ein paar Holzbohlen in den Fußböden ausgewechselt werden müssen, und alles war frisch gestrichen. Nicht nur waren Wände und Decken voller Rußflecken gewesen, ich hatte auch den Brandgeruch loswerden müssen. Einige Gardinen hatte ich ausgewechselt, ein paar Teppiche weggeworfen und ansonsten geschrubbt, geputzt und gewaschen. Eine ganze Zeit lang war dafür jede freie Minute, die ich wach war, draufgegangen.
»Gute Arbeit.« Quinn sah sich die Stelle an, wo die beiden Teile des Hauses miteinander verbunden waren.
»Komm doch ins Wohnzimmer.« Es machte mir Spaß, jemandem das Haus zu zeigen, jetzt, da die Polstermöbel gereinigt waren, keine Wollmäuse über den Boden huschten und das Glas in den Bilderrahmen glänzte. Die Gardinen im Wohnzimmer waren neu, die alten hatte ich schon seit mindestens einem Jahr rauswerfen wollen.
Gott sei Dank war ich versichert gewesen, und Gott sei Dank hatte ich eine Menge Geld damit verdient, Eric vor seinen Feinden zu verstecken. Meine Ersparnisse waren jetzt zwar ziemlich geschröpft, aber immerhin hatte ich welche gehabt, als ich sie brauchte; dafür war ich enorm dankbar.
Im Kamin lag Holz aufgeschichtet, doch es war zu warm, um Feuer zu machen. Quinn setzte sich in einen Lehnstuhl, und ich setzte mich ihm gegenüber. »Möchtest du was trinken – Bier, Kaffee, Eistee?«, fragte ich, wie es sich für eine gute Gastgeberin gehörte.
»Nein, danke«, erwiderte er und lächelte mich an. »Ich wollte dich wiedersehen, seit ich dich in Shreveport kennen gelernt habe.«
Ich versuchte, seinem Blick standzuhalten. Der Drang, zu Boden zu sehen oder meine Hände zu betrachten, überwältigte mich fast. Seine Augen hatten wirklich diese lilabraune Farbe, an die ich mich nur zu gut erinnerte. »Das ist ein schwerer Tag für die Familie Herveaux gewesen«, sagte ich.
»Du bist eine Weile mit Alcide ausgegangen«, stellte er in neutralem Ton fest.
Einige mögliche Antworten schossen mir durch den Kopf, und ich entschied mich für: »Ich habe ihn seit dem Wettkampf der Werwölfe nicht mehr gesehen.«
Sein Lächeln wurde breiter. »Du bist nicht fest mit ihm zusammen?«
Ich schüttelte den Kopf.
»Dann bist du also ungebunden?«
»Ja.«
»Ich würde niemandem auf die Zehen treten?«
Ich versuchte zu lächeln, doch das Ergebnis meiner Mühe war vermutlich nicht sonderlich geglückt. »Das habe ich nicht gesagt.« Es gab da schon gewisse Zehen. Aber die hatten kein Recht dazu, mir im Weg zu stehen.
»Mit ein paar verärgerten Exfreunden komme ich schon zurecht. Würdest du also mal mit mir ausgehen?«
Ein, zwei Sekunden lang sah ich ihn an und dachte nach. In seinen Gedanken las ich nichts als Hoffnung: keine Falschheit, keine Selbstsucht. Meine Vorbehalte lösten sich in nichts auf.
»Ja«, sagte ich, »gern.« Sein herzliches Lächeln war so ansteckend, dass ich ebenfalls lächelte, und diesmal echt und aufrichtig.
»Abgemacht«, sagte er. »Den erfreulichen Teil hätten wir also besprochen. Kommen wir nun zum geschäftlichen Teil, der damit nichts zu tun hat.«
»Okay«, erwiderte ich und hörte auf zu lächeln. Dazu würde sich hoffentlich später wieder Gelegenheit finden, doch alles Geschäftliche zwischen uns würde unweigerlich mit Supranaturalen zu tun haben und war daher ein Grund zur Sorge.
»Hast du schon mal von der Südstaatenkonferenz gehört?«
Die Konferenz der Vampire: Alle Könige und Königinnen aus den Südstaaten versammelten sich zu Beratungen über… Vampirangelegenheiten. »Eric hat mal davon gesprochen.«
»Hat er dich gebeten, dort für ihn zu arbeiten?«
»Er sagte, dass er mich vielleicht brauchen würde.«
»Als die Königin von Louisiana erfuhr, dass ich hier in der Gegend bin, bat sie mich, dich um deine Dienste zu ersuchen. Das dürfte Erics Pläne hinfällig machen.«
»Da musst du Eric fragen.«
»Du brauchst es ihm nur mitzuteilen. Die Wünsche der Königin sind Eric Befehl.«
Ich spürte förmlich, wie mir mein Gesichtsausdruck entglitt. Ich wollte Eric, dem Sheriff von Bezirk Fünf, gar nichts mitteilen. Seine Gefühle für mich verwirrten Eric. Und eins kann ich euch versichern: Vampire mögen es überhaupt nicht, wenn sie sich verwirrt fühlen. Der Sheriff konnte sich an die kurze Zeit, die er bei mir im Haus versteckt gewesen war, nicht mehr erinnern. Und diese Gedächtnislücke hatte Eric fast wahnsinnig gemacht; er muss immer alles unter Kontrolle haben und das heißt, dass er sich in jeder einzelnen Sekunde der Nacht bewusst sein will, was er tut. Also hatte er abgewartet, bis er etwas für mich tun konnte, und als Gegenleistung einen detaillierten Bericht über all das verlangt, was bei mir zu Hause passiert war.
Tja, vielleicht bin ich da etwas zu sehr ins Detail gegangen. Eric war nicht sonderlich überrascht, dass wir Sex hatten. Aber er war ziemlich fassungslos, als ich ihm erzählte, dass er bereit gewesen war, seine hart erkämpfte Position in der Vampirhierarchie aufzugeben, um mit mir zusammenzuleben.
Wenn ihr Eric kennen würdet, wüsstet ihr, dass das für ihn ein ziemlich unerträglicher Gedanke war.
Seitdem sprach er nicht mehr mit mir. Wenn wir uns mal begegneten, starrte er mich bloß an, als versuche er, seine eigenen Erinnerungen an diese Zeit aufleben zu lassen und mir einen Irrtum nachzuweisen. Es machte mich traurig, dass die Beziehung, die wir mal hatten – nicht das heimliche Glück jener paar Tage, sondern die unterhaltsame Freundschaft eines Mannes und einer Frau, die nicht viel gemeinsam hatten außer Sinn für Humor–, nicht mehr zu existieren schien.
Natürlich, es war meine Aufgabe, Eric zu erzählen, dass seine Königin ihn verdrängt hatte. Aber Lust dazu hatte ich nicht.
»Kein Lächeln mehr auf den Lippen«, stellte Quinn fest. Er wirkte selbst recht ernst.
»Na ja, Eric ist…« Ich wusste nicht, wie ich den Satz beenden sollte. »Er ist ein komplizierter Typ«, sagte ich lahm.
»Was wollen wir bei unserer ersten Verabredung machen?«, fragte Quinn, der kein Problem damit zu haben schien, einfach das Thema zu wechseln.
»Wir könnten ins Kino gehen«, schlug ich vor, um den Ball ins Rollen zu bringen.
»Ja, könnten wir, und danach gehen wir in Shreveport essen. Vielleicht bei Ralph & Kacoo’s«, erwiderte er.
»Die Langustenschwänze dort sollen sehr gut sein, habe ich gehört«, sagte ich und ließ den Ball des Gesprächs weiterrollen.
»Und mag nicht jeder Langustenschwänze? Oder wir könnten zum Bowling gehen.«
Mein Großonkel hatte begeistert Bowling gespielt. Ich sah seine Füße in den Bowlingschuhen noch heute vor mir. Ich schauderte bei dem Gedanken. »Das kann ich nicht.«
»Wir könnten uns ein Hockeyspiel ansehen.«
»Das würde sicher Spaß machen.«
»Oder wir könnten zusammen in deiner neuen Küche kochen und dann einen Film auf DVD ansehen.«
»Lass uns das erst mal zurückstellen.« Für eine erste Verabredung war es mir ein bisschen zu vertraulich; nicht, dass ich viel Erfahrung mit ersten Verabredungen gehabt hätte. Aber ich wusste, dass die Nähe eines Schlafzimmers nur dann eine gute Idee war, wenn es einem auf keinen Fall etwas ausmachte, dort im Laufe des Abends möglicherweise zu landen.
»Wir könnten uns das Musical ›The Producers‹ ansehen. Das läuft zurzeit im ›Strand‹.«
»Wirklich?« Okay, das klang aufregend. In Shreveports restauriertem Theater »Strand« gastierten Bühnenproduktionen, und von Schauspiel über Musical bis Ballett war alles dabei. Ich hatte noch nie ein richtiges Stück auf der Bühne gesehen. Wäre das nicht schrecklich teuer? Aber Quinn hätte es sicher nicht vorgeschlagen, wenn er es sich nicht leisten könnte. »Wirklich?«, wiederholte ich.
Er nickte, sehr erfreut über meine Reaktion. »Ich kann fürs Wochenende Karten reservieren. Wie sieht denn dein Arbeitsplan aus?«
»Freitagabend habe ich frei«, sagte ich ganz glücklich. »Und, äh, meine Karte zahle ich natürlich selbst.«
»Du bist eingeladen«, sagte Quinn obenhin. In seinen Gedanken las ich, dass er mein Angebot erstaunlich fand. Und rührend. Hmmm. Das gefiel mir nicht. »Okay, abgemacht. Wenn ich wieder an meinem Notebook sitze, reserviere ich online Karten. Ich weiß, dass es noch ein paar sehr gute gibt, denn ich habe mir mal angesehen, was so läuft, ehe ich hierhergekommen bin.«
Ich machte mir natürlich schon über angemessene Kleidung Gedanken. Aber das vertagte ich auf einen späteren Zeitpunkt. »Quinn, wo wohnst du eigentlich?«
»Ich habe ein Haus außerhalb von Memphis.«
»Oh.« Das schien mir denn doch eine sehr große Entfernung zu sein, wenn man hin und wieder gemeinsam ausgehen und sich kennen lernen wollte.
»Ich bin Manager in einer Agentur namens Special Events. Wir sind so eine Art geheimes Tochterunternehmen von Extrem (Elegante) Events. Das Firmenlogo hast du bestimmt schon mal gesehen: E(E)E?« Die Klammern malte er mit den Fingern in die Luft. Ich nickte. E(E)E plante und organisierte sehr extravagante Veranstaltungen in ganz Amerika. »Für Special Events arbeiten vier Manager, und jeder von uns beschäftigt wiederum ein paar Leute in Vollzeit, andere in Teilzeit. Da wir viel auf Reisen sind, haben wir überall im Land Wohnungen. Manchmal sind es bloß Zimmer im Haus von Freunden oder Geschäftspartnern, manchmal Apartments. Wenn ich in dieser Gegend hier bin, wohne ich in Shreveport, im Gästehaus hinter der Villa eines Gestaltwandlers.«
In knapp zwei Minuten hatte ich eine ganze Menge über ihn erfahren. »Du organisierst also Veranstaltungen in der Welt der Supras, wie den Wettkampf der Leitwolfkandidaten?« Das war ein gefährlicher Auftrag gewesen, der noch dazu einiges an Spezialausrüstung erfordert hatte. »Aber was gibt es denn sonst noch? Ein neuer Leitwolf wird ja nur in größeren Abständen mal bestimmt. Wie oft bist du auf Reisen? Welche anderen Events stellst du auf die Beine?«
»Hauptsächlich arbeite ich im Südosten, von Georgia bis Texas.« Er hatte sich vorgebeugt, seine großen Hände ruhten auf seinen Knien. »Von Tennessee bis runter nach Florida. Wer in diesen Bundesstaaten ein Event ausrichten will – Leitwolf-Wettkämpfe, Himmelfahrtsriten für Schamanen und Hexen oder hierarchische Vampirhochzeiten nach allen Regeln der Kunst–, der kommt zu mir.«
Ich erinnerte mich an die außergewöhnlichen Fotos in Alfred Cumberlands Mappe AUGENBLICKE. »Und da gibt es so viele, dass du immer zu tun hast?«
»Oh, ja«, sagte Quinn. »Natürlich ist manches von den Jahreszeiten abhängig. Vampire heiraten im Winter, weil dann die Nächte so viel länger sind. Erst im Januar habe ich eine hierarchische Vampirhochzeit in New Orleans organisiert. Und einiges andere ist beispielsweise an den Kalender der Wiccas gebunden. Oder auch an Lebensphasen wie die Pubertät.«
Ich konnte mir noch immer nichts Genaues unter den Zeremonien vorstellen, die er da arrangierte. Doch auf eine Beschreibung konnte ich bis zu einem späteren Mal warten. »Und es gibt bei Special Events noch drei andere Manager, die das gleiche machen, auch Vollzeit? Oh, tut mir leid. Ich will dich nicht so ausfragen. Aber das ist eine unglaublich interessante Art, Geld zu verdienen.«
»Freut mich, dass du es so siehst. Man muss ziemlich gut mit Leuten umgehen können, ein Auge für Details und ein Händchen fürs Organisatorische haben.«
»Und man muss absolut tough sein«, murmelte ich einen meiner Gedanken vor mich hin.
Er lächelte, ein sehr bedächtiges Lächeln. »Kein Problem für mich.«
Ja, Quinn schien in der Tat ziemlich tough.
»Und man muss die Kunden richtig einschätzen und in die richtige Richtung lenken können, damit sie glücklich und zufrieden sind mit dem, was man für sie getan hat«, fügte er hinzu.
»Kannst du mir ein paar Geschichten erzählen? Oder bist du zur Vertraulichkeit verpflichtet?«
»Die Kunden schließen einen Vertrag mit uns, aber eine Vertraulichkeitsklausel hat noch keiner verlangt«, sagte Quinn. »Ich habe natürlich auch nicht viel Gelegenheit, vom Job zu erzählen, denn die meisten Kunden stehen ja außerhalb der normalen Welt. Tut richtig gut, mal darüber zu reden. Normalerweise muss ich den Frauen erzählen, ich sei Berater oder sonst irgend so ein Schwindler.«
»Mir tut’s auch gut, mal zu reden, ohne ständig befürchten zu müssen, ich könnte Geheimnisse verraten.«
»Dann ist es doch ein Glück, dass wir uns begegnet sind, hm?« Und wieder dieses offene, herzliche Lächeln. »Jetzt brauchst du aber erst mal deine Ruhe, schließlich bist du gerade aus der Arbeit gekommen.« Quinn stand auf und streckte sich. Eine eindrucksvolle Sache bei jemandem, der so muskulös war wie er. Es war höchst unwahrscheinlich, dass Quinn nicht wusste, wie gut er aussah, wenn er sich so streckte. Ich blickte zu Boden, um mein Lächeln zu verbergen. Es störte mich kein bisschen, dass er mich beeindrucken wollte.
Er ergriff meine Hand und zog mich mit einer fließenden Bewegung auf die Füße. Ich konnte spüren, wie er sich ganz auf mich konzentrierte. Seine Hand war warm und fest. Damit hätte er mir alle Knochen brechen können.
Eine ganz normale Frau dachte wohl kaum je darüber nach, wie schnell ihr neuer Freund sie töten könnte, doch ich war nie eine ganz normale Frau gewesen. Ich war anders – das war mir klar geworden, als ich alt genug war, zu begreifen, dass nicht jedes Kind wusste, was seine Familienangehörigen über es dachten. Nicht jedes kleine Mädchen wusste, ob die Lehrerin es mochte, verachtete oder mit seinem