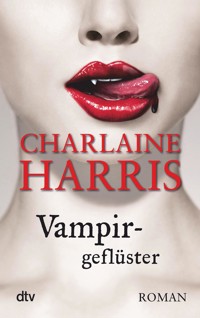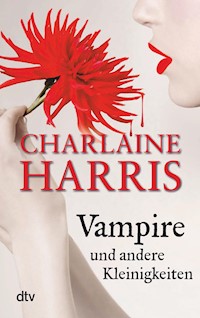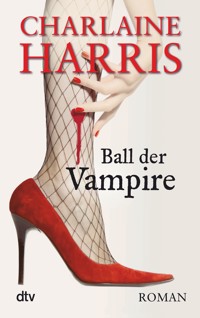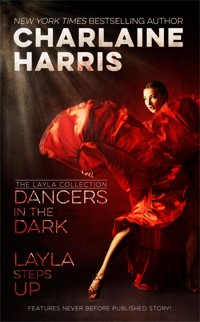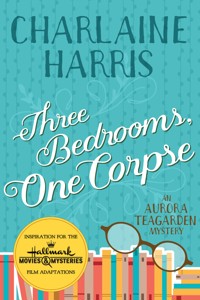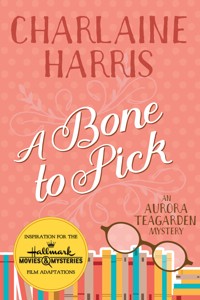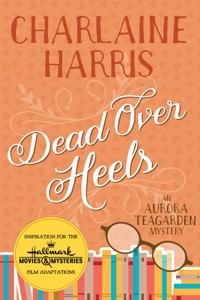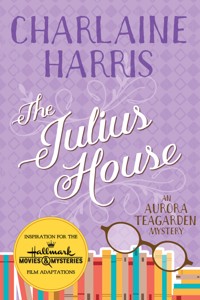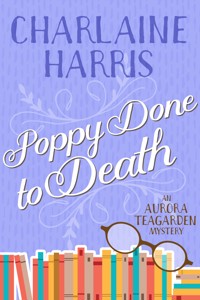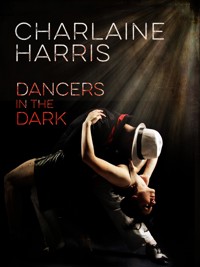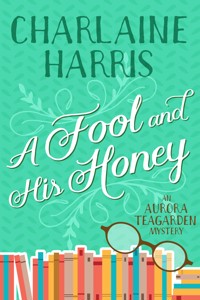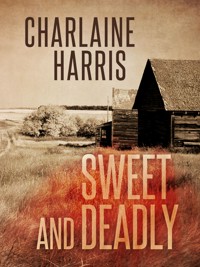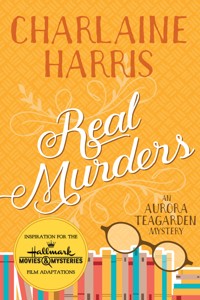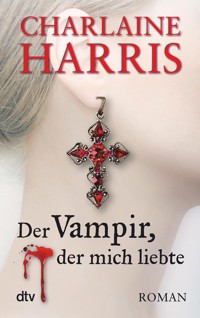
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Sookie Stackhouse
- Sprache: Deutsch
»Charlaine Harris zaubert wieder ihren ganze eigenen Mix aus Spannung, Humor und Romantik zusammen.« Love Letter, Berlin Sookie Stackhouse ist Kellnerin in einer Bar in Louisiana. Sie ist hübsch, jung, ihr Job macht ihr Spaß. Eines Nachts trifft sie auf dem Nachhauseweg auf einen umherirrenden Vampir. Er hat kaum einen Faden am Leib und außerdem sein Gedächtnis verloren. Zum Glück kennt ihn Sookie: Es ist Eric, der Boss ihres Ex-Freunds Bill. An sich ist er ein draufgängerischer, aggressiver Typ, doch mit dem Gedächtnis ist ihm anscheinend ein Teil seiner Persönlichkeit verlorengegangen: auf einmal ist er freundlich, zuvorkommend und schutzbedürftig. Aber er hat ein gewaltiges Problem: Ein Hexenzirkel ist in die kleine Stadt eingefallen und verlangt Schutzgeld von Eric, der ein erfolgreicher Vampir-Bar-Unternehmer ist. Er weigert sich zu zahlen, mit desaströsen Folgen. Sookie nimmt ihn bei sich auf, mit dem Erfolg, daß eine gefährliche Situation die andere jagt. Und da Eric ein sehr attraktiver Vampir ist, kommen die beiden sich bald ziemlich nah.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 475
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Sookie Stackhouse ist Kellnerin in einer Bar in Louisiana. Sie ist hübsch, jung, ihr Job macht ihr Spaß. Eines Nachts trifft sie auf dem Nachhauseweg auf einen umherirrenden Vampir. Er hat kaum einen Faden am Leib und außerdem sein Gedächtnis verloren. Zum Glück kennt ihn Sookie: Es ist Eric, der Boss ihres Ex-Freunds Bill. An sich ist er ein draufgängerischer, aggressiver Typ, doch mit dem Gedächtnis ist ihm anscheinend ein Teil seiner Persönlichkeit verlorengegangen: auf einmal ist er freundlich, zuvorkommend und schutzbedürftig. Aber er hat ein gewaltiges Problem: Ein Hexenzirkel ist in die kleine Stadt eingefallen und verlangt Schutzgeld von Eric, der ein erfolgreicher Vampir-Bar-Unternehmer ist. Er weigert sich zu zahlen, mit desaströsen Folgen. Sookie nimmt ihn bei sich auf, mit dem Erfolg, dass eine gefährliche Situation die andere jagt. Und da Eric ein sehr attraktiver Vampir ist, kommen die beiden sich bald ziemlich nah.
Von Charlaine Harris sind bei dtv außerdem erschienen:
Vorübergehend tot
Untot in Dallas
Club Dead
Vampire bevorzugt
Ball der Vampire
Vampire schlafen fest
Ein Vampir für alle Fälle
Vampirgeflüster
Vor Vampiren wird gewarnt
Vampir mit Vergangenheit
Cocktail für einen Vampir
Vampirmelodie
Die Welt der Sookie Stackhouse
Vampire und andere Kleinigkeiten
Charlaine Harris
Der Vampir, der mich liebte
Sookie Stackhouse Band 4
Roman
Deutsch von Britta Mümmler
Der Brief klebte an meiner Tür, als ich von der Arbeit nach Hause kam. Ich hatte im Merlotte’s die Schicht vom Lunch bis zum frühen Abend gehabt, und da es fast Ende Dezember war, wurden die Tage bereits ziemlich früh dunkel. Also musste mein Exfreund Bill– Bill Compton oder Bill der Vampir, wie die meisten Stammgäste im Merlotte’s ihn nennen – seine Nachricht innerhalb der letzten Stunde hinterlassen haben. Er kann nämlich nicht aufstehen, ehe es dunkel ist.
Ich hatte Bill seit über einer Woche nicht gesehen, und unsere Trennung war nicht gerade so gelaufen, dass ich sie freundschaftlich nennen würde. Trotzdem fühlte ich mich ganz elend, als ich den Umschlag mit meinem Namen darauf berührte. Und jetzt glaubt sicher jeder, ich hätte vorher – obwohl schon sechsundzwanzig – noch nie einen richtigen Freund gehabt oder eine echte Trennung durchgemacht.
Tja, stimmt.
Normale Typen wollen eben nicht mit einer ausgehen, die so seltsam ist wie ich. Schon seit ich in die Schule kam, sagen die Leute, dass ich irgendwie einen Knall hätte.
Tja, stimmt ebenfalls.
Das heißt allerdings nicht, dass nicht auch ich gelegentlich an der Bar angegrapscht werde. Die Typen betrinken sich. Ich sehe gut aus. Und dann vergessen sie schon mal, dass ihnen mein seltsamer Ruf und mein immerwährendes Lächeln nicht ganz geheuer sind.
Doch nur mit Bill bin ich je so richtig zusammen gewesen, so ganz intim. Die Trennung von ihm hat mir sehr wehgetan.
Ich öffnete den Briefumschlag erst, als ich an meinem alten, zerkratzten Küchentisch saß. Ich trug immer noch meinen Mantel, nur meine Handschuhe hatte ich in irgendeine Ecke gefeuert.
Liebste Sookie, ich wollte bei dir vorbeischauen und mit dir reden, wenn du dich etwas von den unglückseligen Ereignissen der letzten Zeit erholt hast.
»Unglückselige Ereignisse« – dass ich nicht lache. Die blauen Flecken waren irgendwann wieder verblasst, aber eins meiner Knie schmerzte immer noch bei Kälte, und ich fürchtete, dass das auch auf Dauer so bleiben würde. Und all meine zahlreichen Verletzungen hatte ich mir zugezogen bei dem Versuch, meinen treulosen Freund aus der Gefangenschaft einer Gruppe von Vampiren zu retten, zu denen auch seine frühere Flamme Lorena gehörte. Ich hatte immer noch nicht begriffen, wieso Lorena eine solche Macht über Bill besaß, dass er ihrer Aufforderung gefolgt und nach Mississippi gegangen war.
Wahrscheinlich hast du viele Fragen zu dem, was passiert ist.
Verdammt richtig.
Wenn du mich persönlich sprechen möchtest, komm an die Haustür und lass mich ein.
Au weia. Darauf war ich nicht gefasst gewesen. Ich dachte eine Minute lang nach. Dann hatte ich mich entschieden. Zwar vertraute ich Bill nicht mehr, aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass er mich körperlich angreifen würde, und so ging ich zurück durchs Haus zur Eingangstür. Ich öffnete und rief: »Okay, komm rein.«
Er trat aus dem Wald, der die Lichtung umgab, auf der mein altes Haus stand. Es gab mir einen Stich, als ich ihn sah. Bill war breitschultrig und schlank, immerhin hatte er sein Leben lang den an mein Grundstück angrenzenden Grund und Boden landwirtschaftlich bearbeitet. Und er war hart und zäh geworden in seinen Jahren als Soldat der Konföderierten, bevor er 1867 starb. Bills Nase glich haargenau dem auf griechischen Vasen abgebildeten Ideal. Sein Haar war dunkelbraun und seine Augen waren ebenso dunkel.
Er sah noch ganz genauso aus wie zu jener Zeit, als wir einander kennen lernten, und so würde er auch immer aussehen.
Er zögerte, ehe er über die Schwelle trat. Aber ich hatte es ihm ja erlaubt, und so trat ich zur Seite, um ihn in mein picobello aufgeräumtes Wohnzimmer mit den alten, gemütlichen Möbeln zu lassen.
»Danke«, sagte er mit seiner kühlen ruhigen Stimme, eine Stimme, die mir noch immer Schauer schierer Lust bescherte. Vieles zwischen uns war schief gelaufen, aber im Bett hatte es garantiert nicht seinen Anfang genommen. »Ich wollte dich noch sprechen, bevor ich gehe.«
»Wohin gehst du?« Ich versuchte, so ruhig zu klingen wie er.
»Nach Peru. Auf Anordnung der Königin.«
»Arbeitest du immer noch an deiner, äh, Datenbank?« Ich wusste fast gar nichts über Computer, aber Bill war durch intensive Fachlektüre zum Computerspezialisten geworden.
»Ja. Aber ich muss noch etwas mehr Recherche betreiben. Ein sehr alter Vampir in Lima besitzt umfassendes Wissen über jene unserer Art auf seinem Kontinent. Ich habe mich zu einem Gespräch mit ihm verabredet. Und ich werde auch ein wenig Sightseeing machen, während ich dort unten bin.«
Ich bezwang den Impuls, Bill eine Flasche synthetisches Blut anzubieten, wie es eigentlich die Gastfreundschaft gebot. »Setz dich doch«, sagte ich und nickte zum Sofa hinüber. Ich selbst setzte mich auf die Kante des alten Lehnsessels dem Sofa gegenüber. Dann herrschte Schweigen, ein Schweigen, das mir noch bewusster machte, wie unglücklich ich war.
»Wie geht’s Bubba?«, fragte ich schließlich.
»Im Moment ist er in New Orleans«, sagte Bill. »Die Königin hat ihn von Zeit zu Zeit ganz gern um sich, und hier in der Gegend war er im letzten Monat so oft zu sehen, dass es angeraten schien, ihn woanders hinzubringen. Er kommt aber bald zurück.«
Wer Bubba sah, erkannte ihn sofort. Jeder kennt sein Gesicht. Sein »Übergang« war nicht so ganz gelungen. Wahrscheinlich hätte der Aufwärter im Leichenschauhaus, zufällig ein Vampir, den winzigen Funken Leben, der noch in ihm war, ignorieren sollen. Aber als echter Fan von ›Love Me Tender‹ hatte er der Versuchung nicht widerstehen können; und jetzt schob die gesamte Südstaaten-Vampir-Gemeinde Bubba herum, damit er nirgends auffiel.
Wieder herrschte Schweigen. Ich hatte eigentlich vorgehabt, meine Schuhe und die Kellnerinnenuniform abzustreifen, mir ein gemütliches Hauskleid anzuziehen und mich mit einer Pizza vor den Fernseher zu setzen. Kein besonders ambitioniertes Vorhaben, aber immerhin mein eigenes. Stattdessen saß ich nun hier und litt vor mich hin.
»Wenn du mir etwas zu sagen hast, fängst du am besten jetzt gleich damit an«, erklärte ich.
Er nickte, fast wie zu sich selbst. »Ich muss dir das erklären«, sagte er. Seine weißen Hände arrangierten sich wie von allein in seinem Schoß. »Lorena und ich–«
Unwillkürlich zuckte ich zusammen. Diesen Namen wollte ich nie wieder hören. Wegen Lorena hatte er mich fallen gelassen.
»Ich muss dir das erzählen«, sagte er, beinahe verärgert. Mein Zucken war ihm nicht entgangen. »Gib mir doch eine Chance.« Einen Augenblick zögerte ich, dann nickte ich.
»Ich bin nach Jackson gefahren, als sie mich rief, weil ich nicht anders konnte«, sagte er.
Ich zog die Augenbrauen hoch. Das hatte ich doch schon mal gehört. Das hieß so viel wie »Ich konnte mich nicht beherrschen« oder »Ich konnte keinen Gedanken oberhalb der Gürtellinie mehr fassen«.
»Vor langer Zeit ist sie meine Geliebte gewesen. Eric hat dir ja schon erzählt, dass Affären unter Vampiren nicht lange andauern, obwohl sie sehr intensiv verlaufen. Allerdings hat Eric dir nicht erzählt, dass Lorena die Vampirin war, die mich herüberholte.«
»Auf die dunkle Seite?«, fragte ich, biss mir aber gleich auf die Lippe. Dies Thema sollte ich besser nicht leichtfertig anschneiden.
»Ja«, bestätigte Bill ernst. »Und danach waren wir zusammen, als Liebespaar, was nicht immer der Fall ist.«
»Aber du hattest sie verlassen…«
»Ja, vor ungefähr achtzig Jahren waren wir an dem Punkt angelangt, wo wir uns gegenseitig nicht länger ertrugen. Seitdem hatte ich Lorena nie wieder gesehen, obwohl ich natürlich von ihren Taten wusste.«
»Oh, natürlich«, sagte ich ausdruckslos.
»Aber ich musste ihrer Aufforderung gehorchen. Das ist ein absoluter Befehl. Wenn dein Schöpfer ruft, musst du Folge leisten.« Seine Stimme klang eindringlich.
Ich nickte und versuchte verständnisvoll zu wirken. Ich schätze, allzu gut ist mir das nicht gelungen.
»Sie befahl mir, dich zu verlassen«, sagte er. Mit seinen dunklen Augen starrte er mich an. »Sie sagte, wenn ich es nicht täte, würde sie dich töten.«
Langsam verlor ich die Beherrschung. Ich biss in die Innenseite meiner Wange, ganz fest, um mich zu konzentrieren. »Also hast du ohne Erklärung oder Gespräch mit mir einfach entschieden, was das Beste für mich und dich wäre.«
»Das musste ich«, sagte er. »Ich musste ihrem Befehl gehorchen. Und ich wusste auch, dass sie fähig war, dir etwas anzutun.«
»Nun, da hast du immerhin Recht.« Lorena hatte tatsächlich alle Schikanen ihres untoten Daseins aufgeboten, um mich direkt ins Grab zu verfrachten. Doch ich hatte sie zuerst erwischt – okay, nur mit ziemlich viel Glück. Aber immerhin.
»Und jetzt liebst du mich nicht mehr«, sagte Bill, den Anflug eines fragenden Tonfalls in der Stimme.
Darauf hatte ich selbst keine eindeutige Antwort.
»Keine Ahnung«, sagte ich. »Ich kann mir nicht vorstellen, dass du zu mir zurückkommen möchtest. Nach all dem, was passiert ist. Schließlich habe ich deine Schöpferin umgebracht.« Und in meiner Stimme schwang ebenfalls der Anflug eines fragenden Tonfalls, doch im Grunde überwog bei mir bittere Enttäuschung.
»Dann sollten wir uns eine Zeit lang nicht sehen. Nach meiner Rückkehr können wir miteinander reden, das heißt, wenn du möchtest. Gibst du mir einen Abschiedskuss?«
Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich Bill nur zu gern geküsst hätte. Doch selbst der Wunsch danach erschien mir falsch. Wir standen auf, und ich berührte mit den Lippen flüchtig seine Wange. Seine weiße Haut hatte dieses besondere Leuchten, das die Vampire von den Menschen unterscheidet. Es hatte mich ziemlich überrascht, als ich bemerkte, dass nicht jeder es so deutlich sah wie ich.
»Triffst du dich noch mit dem Werwolf?«, fragte er, als er schon fast aus der Tür war.
»Wen meinst du?«, fragte ich zurück und widerstand der Versuchung, mit den Augenlidern zu klimpern. Er verdiente keine Antwort, und das wusste er auch. »Wie lange wirst du denn weg sein?«, fragte ich etwas zu lebhaft, und er warf mir einen nachdenklichen Blick zu.
»Das steht noch nicht genau fest. Zwei Wochen vielleicht«, antwortete er.
»Vielleicht reden wir dann«, sagte ich und wandte das Gesicht ab. »Ich gebe dir aber deinen Schlüssel wieder.« Ich zog mein Schlüsselbund aus der Handtasche.
»Nein, bitte behalte ihn«, sagte er. »Vielleicht brauchst du ihn, während ich weg bin. Geh im Haus ein und aus, wie du willst. Meine Post wird im Postamt gelagert, und ich glaube, alle anderen offenen Angelegenheiten habe ich auch geklärt.« Also war ich seine letzte offene Angelegenheit. Ich schluckte die aufsteigende Wut hinunter, die in letzter Zeit nur allzu bereitwillig in mir brodelte.
»Ich wünsche dir eine gute Reise«, sagte ich kühl, schloss die Tür hinter ihm und rannte in mein Schlafzimmer. Schließlich hatte ich vorgehabt, ein Hauskleid anzuziehen und ein bisschen fernzusehen. Und genau das würde ich jetzt, zum Teufel noch mal, auch tun.
Während ich meine Pizza in den Ofen schob, musste ich mir allerdings doch ein paarmal die Wangen trocknen.
Kapitel 1
Die Silvesterparty in Merlotte’s Bar & Grill war endlich, endlich vorbei. Der Besitzer der Bar, Sam Merlotte, hatte alle Angestellten gefragt, ob sie an diesem Abend arbeiten würden, aber nur Holly, Arlene und ich waren dazu bereit gewesen. Charlsie Tooten meinte, sie sei zu alt, um das Chaos eines Silvesterabends in der Bar zu ertragen; Danielle hatte schon seit langem geplant, mit ihrem Freund auf eine schicke Party zu gehen; und die Neue konnte erst in zwei Tagen anfangen. Ich schätze, Arlene, Holly und ich konnten einfach besser aufs Amüsement verzichten als aufs Geld.
Und außerdem hatte ich sowieso keine andere Einladung. Wenn ich im Merlotte’s arbeite, gehöre ich wenigstens irgendwie dazu.
Ich fegte die Papierschnipsel zusammen und ermahnte mich noch mal, Sam gegenüber nicht zu erwähnen, was für eine miserable Idee diese Konfettitüten gewesen waren. Wir hatten uns da alle bereits ziemlich deutlich ausgedrückt, und selbst der gutmütige Sam hatte es mittlerweile satt. Es war nicht fair, das alles Terry Bellefleur allein sauber machen zu lassen, obwohl das Fegen und Wischen der Böden ja eigentlich sein Job war.
Sam zählte das Geld aus der Kasse und verpackte es in Kuverts, weil er es noch zum Nachtdepot der Bank bringen wollte. Er wirkte müde, aber zufrieden.
Er klappte sein Handy auf. »Kenya? Kannst du mich jetzt zur Bank fahren? Okay, wir treffen uns in einer Minute an der Hintertür.« Kenya, eine Polizistin, begleitete Sam oft zum Nachtdepot, vor allem nach einem Abend mit hohen Einnahmen.
Ich war auch zufrieden mit meinen Einnahmen. Ich hatte jede Menge Trinkgeld bekommen. Vielleicht so um die dreihundert Dollar oder sogar noch mehr, schätzte ich – und ich brauchte jeden einzelnen Penny davon. Ich hätte mich richtig darauf gefreut, mein Geld zu Hause ganz genau nachzuzählen, aber ich war nicht sicher, ob mein Hirn dazu noch in der Lage war.
Der Lärm und das Chaos der Party, die ständige Rennerei von der Theke und der Küchendurchreiche zu den Gästen und wieder zurück, die enorme Unordnung, gegen die wir unaufhörlich ankämpften, die andauernde Kakophonie all der Gehirne… das alles zusammen hatte mich absolut erschöpft. Gegen Ende war ich so müde gewesen, dass ich nicht mal mehr meinen armen Geist schützen konnte und jede Menge Gedanken durchgesickert waren.
Telepathische Fähigkeiten zu besitzen ist nicht so einfach. Und meistens macht es überhaupt keinen Spaß.
An diesem Abend war es sogar noch schlimmer gewesen als sonst. Die Gäste der Bar, die ich fast alle seit Jahren kannte, waren nicht nur ausgelassen hemmungsloser Stimmung, da gab es zudem einige Neuigkeiten, die sie mir brennend gern erzählen wollten.
»Hab’ gehört, dein Typ is’ runter nach Südamerika«, sagte Chuck Beecham, ein Autoverkäufer, mit einem boshaften Funkeln in den Augen. »Da wirste ja jetzt mächtig einsam sein, ganz ohne ihn da draußen in deinem Haus.«
»Willste etwa seinen Platz einnehmen, Chuck?«, fragte der Mann neben ihm an der Bar, und beide brachen, Männer unter sich, in schallendes Gelächter aus.
»Nee, Terrell«, sagte der Autoverkäufer. »Hab’ keine Lust auf das, was Vampire übrig lassen.«
»Entweder ihr benehmt euch oder ihr verschwindet durch die Tür da drüben«, sagte ich bestimmt. Ich spürte Wärme in meinem Rücken und wusste, dass mein Boss, Sam Merlotte, sie über meine Schulter hinweg musterte.
»Ärger?«, fragte er.
»Sie wollten sich gerade entschuldigen«, sagte ich und sah Chuck und Terrell direkt in die Augen. Sie senkten die Köpfe.
»Tut mir leid, Sookie«, murmelte Chuck, und Terrell nickte zustimmend. Ich nickte knapp zurück und wandte mich ab, um eine andere Bestellung aufzunehmen. Aber sie hatten es geschafft, mich zu verletzen.
Und das war auch ihr Ziel gewesen.
Ich spürte einen Stich in der Herzgegend.
Ich war ziemlich sicher, dass die meisten Einwohner von Bon Temps, Louisiana, nichts von unserer Entfremdung wussten. Es war nicht Bills Art, seine persönlichen Angelegenheiten auszuplaudern, und meine auch nicht. Arlene und Tara wussten natürlich ein bisschen was, schließlich solltest du es deinen besten Freundinnen erzählen, dass du mit deinem Typen Schluss gemacht hast, selbst wenn du die richtig interessanten Details auslassen musst. (Wie beispielsweise die Tatsache, dass du die Frau umgebracht hast, derentwegen er dich verlassen hat. Wofür ich aber nichts konnte. Wirklich nicht.) Jeder, der mir also erzählte, dass Bill das Land verlassen hatte, und annahm, ich wüsste nichts davon, tat das in boshafter Absicht.
Vor seinem letzten Besuch bei mir hatte ich Bill zuletzt gesehen, als ich ihm die Disketten und den Computer zurückbrachte, die er bei mir versteckt hatte. Ich war bei Einbruch der Dunkelheit hingefahren, so dass die Sachen nicht lange auf seiner Veranda herumstehen mussten. Er kam heraus, als ich gerade wieder abfuhr, aber ich hielt nicht mehr an.
Eine gemeine Frau hätte die Disketten Bills Boss Eric gegeben. Und eine nachtragende Frau hätte die Disketten samt Computer einfach behalten und Bill (und Eric) die Erlaubnis entzogen, ihr Haus zu betreten. Also war ich, hatte ich mir selbst stolz gesagt, weder eine gemeine noch eine nachtragende Frau.
Bill hätte natürlich, rein praktisch betrachtet, einfach irgendeinen Menschen beauftragen können, bei mir einzubrechen und die Sachen zu stehlen. Ich glaubte aber nicht, dass er das tun würde. Allerdings brauchte er den Kram dringend zurück, wenn er nicht Ärger mit der Chefin seines Bosses bekommen wollte. Ich kann aufbrausend sein, ja so richtig wütend werden, wenn ich provoziert werde. Aber ich bin nicht bösartig.
Arlene hat mir schon oft gesagt, dass ich einfach zu nett bin für diese Welt, obwohl ich immer wieder beteuere, dass das nicht stimmt. (Tara sagt das nie; ob sie mich besser kennt?) Düster überlegte ich, dass Arlene irgendwann im Laufe dieses hektischen Abends unweigerlich von Bills Abreise erfahren würde. Und natürlich, keine zwanzig Minuten nach Chucks und Terrells Stichelei bahnte sie sich einen Weg durch die Menge und tätschelte mir die Schulter. »Diesen unterkühlten Mistkerl brauchst du wirklich nicht«, sagte sie. »Was hat der schon je für dich getan?«
Ich nickte schwach, um ihr zu zeigen, wie sehr ich ihre moralische Unterstützung schätzte. Doch dann gab es an einem Tisch eine Bestellung über zwei Whiskey sour, zwei Bier und einen Gin Tonic, und ich musste sausen, was mir eine willkommene Ablenkung war. Als die Gäste ihre Drinks hatten, stellte ich mir dieselbe Frage. Was hatte Bill für mich getan?
Ich hatte zwei Krüge Bier an zwei verschiedene Tische gebracht, ehe ich das alles zusammengezählt hatte.
Er hatte mich in die Kunst des Sex eingeführt, was ich wirklich genossen hatte; mich mit einer Menge anderer Vampire bekannt gemacht, was ich definitiv nicht genossen hatte; mein Leben gerettet, obwohl es eigentlich, wenn ich so darüber nachdachte, gar nicht in Gefahr geraten wäre, wenn ich ihn nicht gekannt hätte. Außerdem hatte ich ihn auch ein-, zweimal gerettet, die Schuld war also beglichen. Und er hatte mich »Liebling« genannt und es zu dem Zeitpunkt auch ehrlich gemeint.
»Nichts«, murmelte ich vor mich hin, während ich eine verschüttete Piña Colada aufwischte und unser letztes frisches Geschirrtuch der Frau reichte, die den Cocktail umgestoßen hatte, denn ein großer Teil davon war auf ihrer Bluse gelandet. »Er hat nichts für mich getan.« Sie lächelte und nickte, da sie offensichtlich annahm, dass ich ihr mein Mitgefühl ausdrückte. Es war zum Glück viel zu laut, um irgendetwas zu verstehen.
Aber ich wäre froh, wenn Bill zurückkäme. Immerhin war er mein nächster Nachbar. Unsere Grundstücke wurden nur von dem alten Gemeindefriedhof voneinander getrennt und lagen beide an der Landstraße südlich von Bon Temps. Ohne Bill war ich ganz allein da draußen.
»Peru, hab’ ich gehört«, sagte mein Bruder Jason. Er hielt seine neueste Eroberung im Arm, eine kleine, schlanke, dunkelhaarige Einundzwanzigjährige von irgendwo aus der finstersten Provinz. (Ich hatte sie in die Gästeliste eingetragen.) Dann sah ich sie mir genauer an. Jason wusste es nicht, doch sie war irgendeine Art Gestaltwandlerin. Die sind leicht zu erkennen. Sie war eine attraktive junge Frau, aber bei Vollmond verwandelte sie sich in irgendetwas mit Federn oder Fell. Ich sah, wie Sam sie hinter Jasons Rücken finster anstarrte, um sie daran zu erinnern, dass sie sich auf seinem Territorium zu benehmen hatte. Sie starrte einfach zurück. Mich beschlich das Gefühl, dass sie sich sicher nicht in ein Kätzchen oder ein Eichhörnchen verwandelte.
Ich überlegte, ob ich mich an ihre Gedanken dranhängen und sie lesen sollte, doch das ist bei Gestaltwandlern gar nicht so einfach. Ihre Gedanken sind chaotisch und rot, hin und wieder gelingt es allerdings, eine ganz gute Vorstellung von ihren Gefühlen zu bekommen. Genau wie bei den Werwölfen.
Sam selbst verwandelt sich in einen Collie, wenn der Mond hell und rund ist. Manchmal trottet er den ganzen Weg bis zu meinem Haus hinaus, und ich stelle ihm dann eine Schale Essensreste hin und lasse ihn, wenn das Wetter gut ist, auf meiner hinteren Veranda ein kleines Nickerchen machen oder, wenn das Wetter schlecht ist, in meinem Wohnzimmer. Ins Schlafzimmer lasse ich ihn allerdings nicht mehr, weil er nackt erwacht – und in dem Zustand sehr verführerisch aussieht. Doch das Letzte, was ich brauche, ist eine Affäre mit meinem Boss.
Heute Nacht war kein Vollmond, Jason war also in Sicherheit. Ich beschloss, ihm gegenüber kein Wort über seine Freundin zu verlieren. Jeder hat doch sein Geheimnis. Und ihr Geheimnis war einfach nur etwas schillernder.
Außer der Freundin meines Bruders, und Sam natürlich, waren an diesem Silvesterabend noch zwei weitere übernatürliche Geschöpfe in Merlotte’s Bar. Das eine war eine wunderschöne, mindestens eins achtzig große Frau mit langem, welligem dunklem Haar. Todschick gestylt in einem hautengen, langärmligen orangen Kleid, war sie ganz allein aufgetaucht und hatte sich darangemacht, jeden Mann in der Bar kennen zu lernen. Ich wusste nicht, was sie war, aber an ihrem Gedankenmuster konnte ich erkennen, dass sie nicht zu uns Menschen gehörte. Das andere Geschöpf war ein Vampir, der mit einer Gruppe junger Leute gekommen war, die alle so um die zwanzig waren. Ich kannte keinen von ihnen. Die Anwesenheit eines Vampirs löste nicht mehr als ein paar verstohlene Seitenblicke einiger Partygäste aus. Was zeigte, dass sich seit der Großen Enthüllung die Haltung der Leute deutlich entspannt hatte.
Vor ein paar Jahren, am Abend der Großen Enthüllung, traten die Vampire überall auf der Welt im Fernsehen auf, um von ihrer Existenz zu berichten. Das war ein Abend, an dem so manche Theorie auf dieser Welt schlichtweg umgehauen wurde und von Grund auf neu arrangiert werden musste.
Diese Coming-out-Party war ausgelöst worden durch die Entwicklung von synthetischem Blut in Japan, das die Ernährung der Vampire sicherstellte. Seit der Großen Enthüllung haben die Vereinigten Staaten zahlreiche politische und soziale Umwälzungen erlebt in dem holprigen Prozess der Eingliederung unserer neuesten Mitbürger, die eben zufällig tot sind. Die Vampire haben jetzt ein offizielles Image und auch eine öffentliche Erklärung zu ihren Lebensumständen abgegeben – sie behaupten, unter einer Allergie gegen Sonnenlicht zu leiden und dass Knoblauch eine schwerwiegende Stoffwechselerkrankung bei ihnen auslöse–, aber ich kenne auch die andere Seite der Vampir-Welt. Meine Augen sehen mittlerweile eine ganze Menge Dinge, die die meisten Menschen niemals wahrnehmen. Und fragt mich mal, ob dieses Wissen mich glücklich gemacht hat.
Nein.
Aber ich muss zugeben, dass mir die Welt jetzt viel interessanter erscheint als vorher. Ich bin ziemlich viel allein (weil ich nun mal nicht Norma Normal bin), und da kommt mir das zusätzliche Gedankenfutter ganz gelegen. Die Angst und die Gefahr dagegen weniger. Ich habe die private Seite der Vampire gesehen und vieles über Werwölfe und Gestaltwandler und anderes gelernt. Werwölfe und Gestaltwandler halten sich am liebsten im Schatten – bis jetzt – und warten ab, wie die Vampire mit ihrem Schritt in die Öffentlichkeit zurechtkommen.
All das ging mir so durch den Kopf, während ich Tablett um Tablett mit leeren Gläsern und Bierkrügen einsammelte und Tack, dem neuen Koch, beim Beladen und Entladen des Geschirrspülers half. (Sein richtiger Name lautet Alphonse Petacki. Wen wundert’s, dass ihm »Tack« besser gefällt?) Als wir unseren Part der Reinigungsaktion fast beendet hatten und dieser lange Abend endlich zu Ende war, umarmte ich Arlene und wünschte ihr ein frohes neues Jahr, und sie schloss mich ebenfalls in die Arme. Hollys Freund wartete am Angestellteneingang auf der Rückseite des Gebäudes auf sie, und Holly winkte uns zu, während sie ihren Mantel überzog und davoneilte.
»Welche Wünsche fürs neue Jahr habt ihr denn so, Ladys?«, fragte Sam. Mittlerweile lehnte Kenya am Tresen und wartete auf ihn, ihre Miene war ruhig und aufmerksam. Kenya kam ziemlich regelmäßig zum Lunch hierher mit ihrem Kollegen Kevin, der so blass und dünn war wie sie dunkel und rund. Sam stellte die Stühle auf die Tische, damit Terry Bellefleur, der ganz früh am Morgen kam, den Boden wischen konnte.
»Gute Gesundheit und den richtigen Mann«, sagte Arlene pathetisch und griff sich mit flatterigen Händen ans Herz. Wir lachten. Arlene hatte schon viele Männer gefunden – viermal war sie verheiratet gewesen–, aber sie hält immer noch Ausschau nach Mr Right. Ich konnte »hören«, wie Arlene dachte, dass Tack vielleicht jener eine war. Das erstaunte mich denn doch; ich hatte nicht mal gewusst, dass sie ihn schon bemerkt hatte.
Die Überraschung stand mir ins Gesicht geschrieben, und Arlene sagte in unsicherem Tonfall: »Meinst du, ich sollte es aufgeben?«
»Verdammt, nein«, entgegnete ich prompt und machte mir Vorwürfe, weil ich mein Mienenspiel nicht besser im Griff hatte. Es lag einfach daran, dass ich so müde war. »Dieses Jahr klappt’s ganz bestimmt, Arlene.« Ich lächelte zu Bon Temps’ einziger schwarzer Polizistin hinüber. »Du musst doch auch einen Wunsch fürs neue Jahr haben, Kenya. Oder einen guten Vorsatz.«
»Ich wünsch’ mir immer Frieden zwischen Männern und Frauen«, sagte Kenya. »Würd’ meinen Job viel einfacher machen. Und mein guter Vorsatz: beim Bankdrücken siebzig Kilo schaffen.«
»Wow«, sagte Arlene. Ihr rotgefärbtes Haar bildete einen schrillen Kontrast zu Sams rotgoldenen Naturlocken, als sie ihn flüchtig umarmte. Er war nicht viel größer als Arlene – immerhin misst sie ja auch gut eins siebzig, einige Zentimeter mehr als ich. »Ich werde neun Pfund abnehmen, das ist mein guter Vorsatz.« Wir lachten alle. Das war schon in den letzten vier Jahren Arlenes guter Vorsatz gewesen. »Und wie sieht’s bei dir aus, Sam? Wünsche und gute Vorsätze?«, fragte sie.
»Ich hab’ alles, was ich brauche«, sagte er, und ich spürte die blaue Woge der Aufrichtigkeit, die von ihm ausging. »Mein Vorsatz ist, auf dem eingeschlagenen Kurs weiterzumachen. Die Bar läuft großartig, mir gefällt es in meinem Wohnwagen und die Leute hier sind genauso gut wie die Leute anderswo.«
Ich wandte mich ab, um mein Lächeln zu verbergen. Das war eine ziemlich doppeldeutige Aussage gewesen. Die Leute in Bon Temps waren tatsächlich genauso gut wie die Leute anderswo.
»Und du, Sookie?«, fragte er. Alle sahen mich an, Arlene, Kenya und Sam. Ich umarmte Arlene noch einmal, weil ich das gern tue. Ich bin zehn Jahre jünger als sie – vielleicht sogar mehr, Arlene behauptet zwar, sechsunddreißig zu sein, aber ich habe da so meine Zweifel. Und wir sind schon befreundet, seit wir gemeinsam bei Merlotte’s anfingen, nachdem Sam die Bar gekauft hatte, vor etwa fünf Jahren.
»Na komm, sag schon«, redete Arlene mir zu. Sam legte den Arm um mich. Kenya lächelte, verschwand aber in die Küche, um sich ein bisschen mit Tack zu unterhalten.
Ganz impulsiv nannte ich ihnen plötzlich meinen Wunsch. »Ich möchte nicht noch mal zusammengeschlagen werden«, sagte ich. Meine Müdigkeit und die späte Stunde in Kombination führten zu einem höchst unangebrachten Ausbruch von Ehrlichkeit. »Ich will nicht wieder ins Krankenhaus und ich will zu keinem Arzt mehr gehen müssen.« Und ich wollte auch kein Vampirblut mehr zugeführt bekommen, das einen in Windeseile heilte, aber verschiedenste Nebenwirkungen hatte. »Mein guter Vorsatz lautet also, mich von allem Ärger fern zu halten.«
Arlene sah mich ziemlich schockiert an, und Sam wirkte – nun, Sams Reaktion konnte ich nicht richtig einschätzen. Doch da ich Arlene umarmt hatte, umarmte ich jetzt auch ihn und spürte die Stärke und Wärme seines Körpers. Man denkt, Sam wäre schmal gebaut, solange man ihn nicht mal mit freiem Oberkörper Vorratskisten hat schleppen sehen. Er ist richtig stark und ganz ebenmäßig gebaut, und er hat eine sehr hohe natürliche Körpertemperatur. Ich spürte, wie er mir einen Kuss aufs Haar drückte, und dann sagten wir alle gute Nacht zueinander und gingen zur Hintertür hinaus. Sams Truck parkte vor seinem Wohnwagen, der im rechten Winkel zu Merlotte’s Bar dastand, doch für die Fahrt zur Bank stieg er in Kenyas Streifenwagen. Sie würde ihn auch wieder nach Hause bringen, und dann konnte Sam zusammenklappen. Er war seit unzähligen Stunden auf den Beinen, wie wir alle.
Als Arlene und ich unsere Autos aufschlossen, bemerkte ich, dass Tack in seinem alten Pick-up wartete. Ich hätte darauf wetten mögen, dass er Arlene nachfahren würde.
Mit einem letzten »Gute Nacht!«-Ruf durch die kühle Stille dieser Louisiana-Nacht trennten wir uns und begannen jeder unser neues Jahr.
Ich bog ab auf die Hummingbird Road, die mich zu meinem Haus führen würde, das ungefähr drei Meilen südöstlich der Bar liegt. Es war eine ungeheure Erleichterung, endlich allein zu sein, und ich spürte, wie ich mich geistig entspannte. Meine Scheinwerfer huschten über die dicht an dicht stehenden Baumstämme der Kiefern, die das Rückgrat der Holzindustrie dieser Gegend waren.
Die Nacht war extrem dunkel und kalt. Und es gibt natürlich keine Straßenlaternen auf den Landstraßen da draußen. Kein Lebewesen rührte sich, weit und breit nicht. Obwohl ich mir immer wieder sagte, dass ich auf Wildwechsel gefasst sein musste, fuhr ich wie auf Autopilot. Meine Gedanken wurden von der simplen Vorstellung beherrscht, mein Gesicht abzuschrubben, mir mein wärmstes Nachthemd anzuziehen und ins Bett zu klettern.
Irgendetwas Weißes leuchtete auf im Kegel der Scheinwerfer meines alten Autos.
Ich keuchte auf, mit einem Ruck aus meinem schläfrigen Wunschtraum von Wärme und Ruhe herausgerissen.
Ein rennender Mann: Um drei Uhr morgens am ersten Januar rannte er die Landstraße entlang, und offenbar rannte er um sein Leben.
Ich drosselte das Tempo und überlegte, was ich tun sollte. Ich war eine unbewaffnete Frau und allein unterwegs. Wenn irgendetwas Furchtbares hinter ihm her war, würde ich vielleicht auch dran glauben müssen. Andererseits lag es mir nicht, jemanden leiden zu lassen, wenn ich helfen konnte. Im Bruchteil einer Sekunde nahm ich wahr, dass der Mann groß, blond und nur mit einer Jeans bekleidet war, ehe ich neben ihm anhielt. Ich beugte mich hinüber, um das Fenster der Beifahrerseite herunterzukurbeln.
»Kann ich Ihnen helfen?«, rief ich. Er warf mir einen panischen Blick zu und rannte weiter.
Doch in diesem Moment erkannte ich ihn. Ich sprang aus dem Auto und lief hinter ihm her.
»Eric!«, schrie ich. »Ich bin’s!«
Er fuhr herum und fauchte mit gebleckten Fangzähnen. Ich blieb so abrupt stehen, dass ich fast das Gleichgewicht verlor, die Hände von mir gestreckt in einer Geste des Friedens. Wenn Eric sich zum Angriff entschlossen hatte, war ich eine tote Frau. So viel dazu, die gute Samariterin spielen zu wollen.
Warum erkannte Eric mich nicht? Ich kannte ihn doch nun schon seit vielen Monaten. Er war Bills Boss in dieser komplizierten Vampir-Hierarchie, die ich allmählich zu begreifen lernte. Eric war der Sheriff von Bezirk Fünf, und er war ein Vampir auf dem Weg nach oben. Zudem war er ein hinreißender Typ und konnte hervorragend küssen, doch das war nicht die treffendste Beschreibung für seinen momentanen Zustand. Fangzähne und starke, zu Klauen gekrümmte Hände waren das, was ich sah. Eric war in höchster Alarmbereitschaft, aber er schien sich vor mir nicht weniger zu fürchten als ich mich vor ihm. Er setzte nicht zum Angriff an.
»Bleib, wo du bist, Mädchen«, warnte er mich. Seine Stimme klang, als habe er Halsschmerzen, ganz wund und rau.
»Was tust du hier draußen?«
»Wer bist du?«
»Du weißt verdammt gut, wer ich bin. Was ist los mit dir? Warum bist du hier draußen ohne dein Auto unterwegs?« Eric fuhr eine schnittige Corvette, was ganz und gar seinem Wesen entsprach.
»Du kennst mich? Wer bin ich?«
Also das haute mich glatt um. Es klang keineswegs so, als würde er einen Witz reißen. Vorsichtig sagte ich: »Natürlich kenne ich dich, Eric. Es sei denn, du hast einen eineiigen Zwillingsbruder. Hast du doch nicht, oder?«
»Keine Ahnung.« Er ließ die Arme sinken, seine Fangzähne schienen sich zurückzuziehen und er richtete sich aus seiner sprungbereiten Haltung wieder auf. Definitiv eine Verbesserung der Atmosphäre, wie ich fand.
»Du weißt nicht, ob du einen Bruder hast?« Jetzt verstand ich gar nichts mehr.
»Nein. Ich weiß es nicht. Ich heiße Eric?« Im grellen Licht meiner Scheinwerfer wirkte er einfach nur bemitleidenswert.
»Wow.« Etwas Hilfreicheres fiel mir absolut nicht ein. »Eric Northman lautet der Name, unter dem du bekannt bist. Warum bist du hier draußen?«
»Das weiß ich auch nicht.«
So langsam schälte sich da ein Leitmotiv heraus, wie mir schien. »Ehrlich? Du kannst dich an gar nichts erinnern?« Ich versuchte die Überzeugung abzuschütteln, dass er sich jeden Moment grinsend über mich beugen und mir lachend alles erklären würde, um mich dann in irgendwelchen Ärger hineinzuziehen, was unweigerlich damit enden würde, dass ich… zusammengeschlagen wurde.
»Ehrlich.« Er trat einen Schritt näher, und beim Anblick seiner nackten weißen Brust bekam ich vor lauter Mitgefühl eine Gänsehaut. Und erst jetzt (da ich keine Angst mehr hatte) merkte ich auch, wie verloren er aussah. Es lag ein Ausdruck in seinem Gesicht, den ich bei dem selbstsicheren Eric früher nie gesehen hatte und der mich auf unerklärliche Weise traurig stimmte.
»Aber du weißt, dass du ein Vampir bist, oder?«
»Ja.« Er schien erstaunt über meine Frage. »Und du bist keiner.«
»Nein, ich bin ein Mensch, und ich muss mir sicher sein können, dass du mich nicht verletzt. Obwohl du das natürlich schon längst hättest tun können. Und glaub mir, auch wenn du dich nicht dran erinnern kannst, wir sind so eine Art Freunde.«
»Ich werde dich nicht verletzen.«
Ich sagte mir, dass wahrscheinlich schon Hunderte und Tausende Leute vor mir genau diese Worte zu hören bekommen hatten, ehe Eric ihnen die Kehle durchgebissen hatte. Doch Tatsache ist auch, dass Vampire nicht töten müssen, wenn sie ihr erstes Jahr hinter sich gebracht haben. Ein kleiner Schluck hier, ein kleiner Schluck da, so läuft das normalerweise. Als er so verloren aussah, fiel es mir besonders schwer, mich daran zu erinnern, dass er mich mit seinen bloßen Händen zerstückeln konnte.
Zu Bill hatte ich irgendwann mal gesagt, dass es wohl am cleversten von den Außerirdischen wäre (wenn sie die Erde denn heimsuchen würden), in Gestalt von weißen Kaninchen mit langen Schlappohren aufzutauchen.
»Komm, steig in mein Auto, ehe du hier festfrierst«, sagte ich. Mich beschlich das ungute Gefühl, dass ich da wieder in etwas hineingezogen wurde. Aber ich wusste nicht, was ich sonst tun sollte.
»Ich kenne dich wirklich?«, sagte er, als ob er es sich gut überlegen müsste, zu so jemand Gefährlichem ins Auto zu steigen wie einer Frau, die fünfundzwanzig Zentimeter kleiner, viele Pfund leichter und um einige Jahrhunderte jünger war als er.
»Ja«, sagte ich, unfähig, meine aufkeimende Ungeduld zu unterdrücken. Ich war nicht sonderlich erfreut über mich selbst, da ich immer noch halb vermutete, dass mir aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen übel mitgespielt werden sollte. »Jetzt mach schon, Eric. Ich friere und du auch.« Eigentlich sind Vampire grundsätzlich ja nicht so empfindlich, was extreme Temperaturen betrifft, doch Eric hatte eine Gänsehaut. Die Toten können frieren. Und sie überleben es – sie überleben überhaupt fast alles–, aber es ist ziemlich schmerzhaft für sie, so viel ich weiß. »O mein Gott, Eric, du bist ja barfuß.« Das sah ich jetzt erst.
Da er mich nahe genug an sich heranließ, ergriff ich seine Hand. Er ließ sich auch von mir zum Auto führen, und ich verstaute ihn auf dem Beifahrersitz. Als ich auf meine Seite hinüberging, sagte ich ihm noch, er solle das Fenster hochkurbeln, und nachdem er eingehend den Mechanismus studiert hatte, tat er es auch.
Ich nahm eine alte Decke von der Rückbank, die ich im Winter (für Footballspiele und so) dort aufbewahrte, und wickelte Eric darin ein. Er zitterte nicht, natürlich nicht, denn er war ja ein Vampir; aber ich ertrug es nicht länger, bei diesen Temperaturen so viel nackte Haut zu sehen. Und ich stellte die Heizung auf die höchste Stufe (was in meinem alten Auto nicht viel besagt).
Erics nackte Haut hatte mir nie zuvor kalte Schauer verpasst – als überhaupt einmal so viel von ihm zu sehen gewesen war, hatte ich das genaue Gegenteil gefühlt. Inzwischen war ich überdreht genug, um laut loszukichern, ehe ich meine eigenen Gedanken zensieren konnte.
Eric wirkte verschreckt und warf mir einen Seitenblick zu.
»Du bist wirklich der Letzte, den zu treffen ich erwartet hätte«, sagte ich. »Bist du etwa hier herausgekommen, um Bill zu besuchen? Er ist weg.«
»Bill?«
»Der Vampir, der hier draußen wohnt. Mein Exfreund.«
Er schüttelte den Kopf. Jetzt wirkte er wieder absolut verängstigt.
»Du hast keine Ahnung, wie du überhaupt hierher geraten bist?«
Wieder schüttelte er den Kopf.
Ich unternahm den angestrengten Versuch, einen klaren Gedanken zu fassen, aber dabei blieb es dann auch, beim Versuch. Ich war völlig erledigt. Obwohl es mir einen heftigen Adrenalinstoß versetzt hatte, als ich die Gestalt auf der dunklen Straße rennen sah, nahm der Pegel jetzt sehr schnell wieder ab. Ich erreichte die Abzweigung zu meinem Haus, bog links ab und fuhr dann durch den dunklen, stillen Wald meine kurvenreiche und so schön geebnete Auffahrt entlang – deren Schotterbelag übrigens Eric für mich hatte machen lassen.
Das war der eigentliche Grund, warum Eric jetzt hier bei mir im Auto saß, statt wie ein weißes Riesenkaninchen durch die Nacht zu rennen. Er war intelligent genug gewesen, mir das zu geben, was ich wirklich wollte. (Natürlich hatte er auch monatelang versucht, mich ins Bett zu kriegen. Doch die Auffahrt hatte er gemacht, weil ich sie brauchte.)
»Wir sind da«, sagte ich und fuhr zur Rückseite meines alten Hauses. Ich stellte den Motor aus. Zum Glück hatte ich heute Nachmittag, als ich zur Arbeit ging, die Außenbeleuchtung eingeschaltet, so saßen wir wenigstens nicht in völliger Finsternis.
»Hier wohnst du?« Er spähte über die Lichtung, auf der das alte Haus stand, anscheinend nervös wegen des Weges vom Auto zur Hintertür.
»Ja«, sagte ich leicht verzweifelt.
Er sah mich an mit Augen, in denen das Weiße rund um das Blau der Iris zu sehen war.
»Ach, komm schon«, sagte ich, es kam ziemlich barsch heraus. Ich stieg aus dem Auto und ging die Stufen zur hinteren Veranda hinauf, die ich nie abschloss, denn hey, mal ehrlich, warum sollte ich eine Veranda abschließen? Ich schließe doch die Tür, die ins Haus führt, ab. Nach einem Augenblick des Herumtastens hatte ich sie geöffnet und das Licht, das ich in der Küche immer brennen ließ, ergoss sich nach draußen. »Du kannst reinkommen«, sagte ich, damit er über die Türschwelle treten konnte. Die Decke noch immer eng um sich geschlungen, folgte er mir.
Im hellen Licht der Küchenlampe wirkte Eric wirklich mitleiderregend. Seine nackten Füße bluteten, was ich zuvor gar nicht bemerkt hatte. »Oh, Eric«, sagte ich traurig und holte eine Waschschüssel aus dem Schrank. Ich ließ heißes Wasser ins Spülbecken laufen. Es würde alles sehr schnell heilen, wie immer bei Vampiren, aber ich musste seine Wunden einfach säubern. Die Jeans waren am Hosensaum völlig verdreckt. »Zieh sie aus«, sagte ich. Sie würden sowieso nur nass werden, wenn ich seine Füße einweichte und er die Hose dabei anbehielt.
Ohne den geringsten lüsternen Blick oder irgendwelche anderen Anzeichen, dass er diese Entwicklung der Dinge genoss, wand Eric sich aus der Jeans heraus. Ich warf sie auf die hintere Veranda, um sie am nächsten Morgen zu waschen, und versuchte meinen Gast nicht anzustarren, der jetzt nur mit einer Unterhose bekleidet dastand, die definitiv aus dem Rahmen fiel: ein hellrotes Exemplar im Tangaformat, dessen Stretchqualitäten ganz offensichtlich über Gebühr strapaziert wurden. Okay, noch eine große Überraschung. Ich hatte Erics Unterwäsche bisher nur ein einziges Mal gesehen – immer noch einmal mehr als gut für mich war–, und da hatte er seidene Boxershorts getragen. Wechselten Männer den Stil tatsächlich so radikal?
Ohne sich zu produzieren und ohne jeden Kommentar schlang der Vampir wieder die Decke um sich. Hmmm. Jetzt war ich mir sicher, dass er nicht er selbst war. Kein anderer Beweis hätte mich derart überzeugen können. Eric war über eins neunzig groß und die reine Pracht (wenn auch eine marmorweiße Pracht), und das wusste er ganz genau.
Ich zeigte auf einen der Stühle am Küchentisch. Gehorsam zog er ihn hervor und setzte sich. Ich bückte mich, um die Waschschüssel auf den Boden zu stellen, und setzte vorsichtig seine großen Füße ins Wasser. Eric stöhnte, als die Wärme seine Haut berührte. Ich schätze, selbst Vampire können diesen Kontrast spüren. Ich nahm einen sauberen Lappen aus dem Schrank unter dem Spülbecken und etwas flüssige Seife und wusch seine Füße. Ich ließ mir Zeit damit, denn ich musste mir außerdem überlegen, was ich als Nächstes tun sollte.
»Du warst nachts unterwegs«, äußerte er zögerlich.
»Ich war auf dem Weg von der Arbeit nach Hause, wie du an meiner Kleidung siehst.« Ich trug unsere Winteruniform, ein langärmliges weißes, hochgeschlossenes T-Shirt, auf dem über der linken Brust »Merlotte’s Bar« eingestickt war und das zu einer schwarzen Hose getragen wurde.
»Frauen sollten so spät in der Nacht nicht allein draußen sein«, sagte er missbilligend.
»Tja, wem sagst du das.«
»Nun, dir, einer Frau. Frauen unterliegen viel eher der Gefahr, von einem Angriff überwältigt zu werden, als Männer und sollten besser geschützt–«
»Nein, ich meinte, ich bin ganz deiner Meinung. Wenn’s nach mir gegangen wäre, hätte ich so spät nicht mehr gearbeitet.«
»Aber warum warst du dann draußen?«
»Ich brauche das Geld«, sagte ich, trocknete mir die Hände ab, holte das Bündel Geldscheine aus meiner Hosentasche und legte es auf den Tisch. »Ich muss das Haus instand halten, mein Auto ist alt und klapprig, und ich muss Steuern und Versicherungen zahlen. Wie jeder andere auch«, fügte ich hinzu für den Fall, dass er meinte, ich würde mich beklagen. Ich hasse Gejammer, aber er hatte ja gefragt.
»Gibt es denn keinen Mann in deiner Familie?«
Hin und wieder merkt man ihnen ihr Alter an. »Ich hab’ einen Bruder. Ich kann mich nicht erinnern, ob du Jason je kennen gelernt hast.« Ein Schnitt an seinem linken Fuß sah besonders schlimm aus. Ich goss noch mehr heißes Wasser in die Schüssel, um die Temperatur wieder etwas zu erhöhen. Dann versuchte ich, allen Schmutz zu entfernen. Er zuckte zusammen, als ich mit dem Waschlappen sanft über die Ränder der Wunde fuhr. Die kleineren Kratzer und blauen Flecke schienen zu verblassen, noch während ich sie mir ansah. Hinter mir sprang der Heißwasserboiler an, und das vertraute Geräusch war irgendwie beruhigend.
»Erlaubt dein Bruder dir diese Arbeit denn?«
Ich versuchte mir Jasons Gesicht vorzustellen, wenn ich ihm erzählte, dass ich erwartete, für den Rest meines Lebens von ihm versorgt zu werden, weil ich eine Frau war und nicht außerhalb des Hauses arbeiten sollte. »Oh, um Himmels willen, Eric.« Missmutig sah ich zu ihm auf. »Jason hat seine eigenen Probleme.« Wie etwa sein Dasein als chronischer Egoist und Schürzenjäger.
Ich stellte die Waschschüssel zur Seite und tupfte Eric mit einem Geschirrtuch trocken. Dieser Vampir hatte jetzt wirklich saubere Füße. Ziemlich steif erhob ich mich. Mein Rücken schmerzte. Meine Füße schmerzten. »Hör mal, ich glaube, am besten rufe ich Pam an. Sie wird wahrscheinlich wissen, was mit dir los ist.«
»Pam?«
Es war, als hätte ich einen besonders nervtötenden Zweijährigen um mich.
»Deine Stellvertreterin.«
Gleich würde er wieder eine Frage stellen, das konnte ich schon riechen. Ich hob die Hand. »Warte einfach einen Moment. Lass mich erst mal bei ihr anrufen und herausfinden, was passiert ist.«
»Aber was, wenn sie sich gegen mich gestellt hat?«
»Dann müssen wir das erst recht wissen. Je eher, desto besser.«
Ich legte die Hand auf das alte Telefon, das an der Küchenwand ganz am Ende der Arbeitsplatte hing. Daneben stand ein hoher Hocker. Auf diesem Hocker hatte meine Großmutter immer gesessen, wenn sie ihre stundenlangen Telefonate führte, einen Block und einen Stift griffbereit. Ich vermisste sie jeden Tag aufs Neue. Doch im Moment war in meiner emotionalen Palette kein Platz für Trauer oder gar Nostalgie übrig. Ich suchte in meinem kleinen Adressbuch die Nummer vom Fangtasia heraus, der Vampir-Bar in Shreveport, die Erics Haupteinnahmequelle war und als Basisstützpunkt seiner Operationen diente – die, so viel hatte ich verstanden, sehr breit angelegt waren. Ich hatte keine Ahnung, wie breit oder worum es sich bei diesen anderen Projekten handelte, und im Grunde wollte ich das auch gar nicht so genau wissen.
In der Zeitung von Shreveport hatte ich gelesen, dass im Fangtasia am Silvesterabend ebenfalls eine Party stattfinden würde – »Beginn das neue Jahr mit Biss«–, also wusste ich, dass ich dort jemanden erreichen würde. Während das Telefon klingelte, öffnete ich den Kühlschrank und holte eine Flasche Blut für Eric heraus. Ich tat sie in die Mikrowelle und stellte die Schaltuhr ein. Er folgte all meinen Bewegungen mit nervösen Blicken.
»Fangtasia«, sagte eine männliche Stimme mit Akzent.
»Chow?«
»Ja, womit kann ich Ihnen dienen?« Gerade noch rechtzeitig hatte er sich an seine Telefonrolle als sexy Vampir erinnert.
»Ich bin’s, Sookie.«
»Oh«, sagte er in sehr viel natürlicherem Tonfall. »Frohes neues Jahr, Sook, aber hör mal, wir haben hier jede Menge zu tun.«
»Sucht ihr nach jemandem?«
Ein langes, aufgeladenes Schweigen folgte.
»Moment«, sagte er schließlich, und dann hörte ich nichts mehr.
»Pam«, sagte Pam. Sie hatte so lautlos nach dem Telefonhörer gegriffen, dass ich zusammenfuhr, als ich ihre Stimme hörte.
»Hast du noch einen Meister?« Ich wusste nicht, wie viel ich am Telefon sagen durfte. Ich wollte herausbekommen, ob sie diejenige war, die Eric in diesen Zustand versetzt hatte, oder ob sie ihm gegenüber noch loyal war.
»Hab’ ich«, sagte sie bestimmt. Offensichtlich hatte sie verstanden, was ich wissen wollte. »Wir sind dabei… wir haben hier ein paar Probleme.«
Ich ließ mir das durch den Kopf gehen, bis ich sicher war, dass ich verstanden hatte, was da zwischen den Zeilen lag. Pam erzählte mir, dass sie Eric immer noch die Treue hielt und dass Erics Gefolge irgendeiner Art von Angriff ausgesetzt war oder sich in einer kritischen Situation befand.
»Er ist hier«, sagte ich. Pam schätzte knappe Aussagen.
»Lebt er?«
»Ja.«
»Verletzungen?«
»Geistig.«
Eine lange Pause diesmal.
»Stellt er eine Gefahr für dich dar?«
Pam hätte sich garantiert nicht allzu viel daraus gemacht, wenn Eric beschlossen hätte, mich bis auf den letzten Tropfen auszusaugen. Doch ich schätze, sie fragte sich, ob er bei mir unterkommen konnte.
»Im Augenblick nicht, denke ich. Es ist mehr das Gedächtnis«, erwiderte ich.
»Ich hasse Hexen. Die Menschen hatten genau die richtige Idee: an einen Pfahl binden und auf dem Scheiterhaufen verbrennen.«
Weil gerade die Menschen, die Hexen verbrannt hatten, denselben Pfahl auch mit Begeisterung Vampiren durchs Herz getrieben hätten, amüsierte mich das ein wenig – wenn auch nicht sehr, angesichts der Uhrzeit. Ich vergaß sofort wieder, was sie gesagt hatte, und gähnte.
»Morgen Abend kommen wir zu dir«, sagte sie schließlich. »Kannst du ihn heute bei dir behalten? In weniger als vier Stunden geht die Sonne auf. Hast du einen sicheren Platz?«
»Ja. Aber bei Einbruch der Dunkelheit seid ihr hier, hörst du? Ich will nicht noch mal in euren Vampir-Mist verwickelt werden.« Normalerweise drücke ich mich nicht so unverblümt aus. Aber wie gesagt, es war eine lange Nacht gewesen.
»Wir werden da sein.«
Wir legten gleichzeitig auf. Eric starrte mich mit seinen blauen Augen unverwandt an. Sein Haar war ein einziges wildes Durcheinander verhedderter blonder Locken. Sein Haar hatte exakt dieselbe Farbe wie meines, und ich habe ebenso blaue Augen wie er. Aber damit haben die Ähnlichkeiten auch schon ein Ende.
Ich überlegte kurz, ob ich sein Haar bürsten sollte, aber ich war einfach zu müde.
»Okay, Folgendes haben wir ausgemacht«, sagte ich zu ihm. »Für den Rest der Nacht bleibst du hier und morgen auch noch, und Pam und die anderen holen dich morgen Abend ab und erzählen dir, was passiert ist.«
»Du lässt doch niemanden herein?«, fragte er. Ich sah, dass er das Blut ausgetrunken hatte und nicht mehr ganz so mitgenommen wirkte, ein Glück.
»Eric, ich werde mein Bestes tun, um dich zu schützen«, sagte ich sanft. Ich rieb mir das Gesicht mit den Händen. Gleich würde ich im Stehen einschlafen. »Jetzt komm schon«, sagte ich und ergriff seine Hand. Die Decke fest umklammert, trottete er hinter mir die Diele entlang, ein schneeweißer Riese in einer winzigen roten Unterhose.
Im Laufe der Jahre war an mein altes Haus immer wieder angebaut worden, dennoch war es nie mehr als ein bescheidenes Bauernhaus gewesen. Um die letzte Jahrhundertwende hatte es ein zweites Stockwerk erhalten mit zwei zusätzlichen Schlafzimmern und einer Dachkammer, wohin ich allerdings nur noch höchst selten gehe. Meistens ist dort abgeschlossen, schon um Strom zu sparen. Unten gibt es auch zwei Schlafzimmer, ein kleineres, das ich benutzt habe, bis meine Großmutter starb, und ihr größeres Zimmer, das schräg gegenüber auf der anderen Seite der Diele liegt. Nach ihrem Tod bin ich in das größere Zimmer gezogen. Doch das Versteck, das Bill gebaut hatte, war im kleineren Schlafzimmer. Ich führte Eric dort hinein, knipste das Licht an, versicherte mich, dass die Rollläden heruntergelassen waren, und zog noch die Vorhänge vor. Dann öffnete ich den eingebauten Schrank, nahm die paar darin liegenden Sachen heraus, schlug das Stückchen Teppich zurück, das den Boden bedeckte, und legte die Falltür frei. Darunter befand sich ein lichtdichter Raum, den Bill vor ein paar Monaten gebaut hatte, damit er auch über Tag bleiben konnte oder ein Versteck besaß, wenn es ihm zu Hause einmal nicht sicher genug erschien. Bill liebte es, Schlupflöcher zu haben, und ich könnte schwören, dass es einige gab, von denen ich nichts wusste. Wenn ich ein Vampir wäre (Gott bewahre), hätte ich allerdings auch welche.
Ich schlug mir diese Gedanken an Bill schnell wieder aus dem Kopf, da ich meinem widerstrebenden Gast erklären musste, wie er die Falltür über sich so schloss, dass der Teppich wieder darüber fiel. »Wenn ich aufstehe, werde ich die anderen Sachen wieder in den Schrank tun, dann sieht es ganz normal aus«, versicherte ich ihm und lächelte ihn ermutigend an.
»Ich muss da doch jetzt noch nicht hinein?«, fragte er.
Eric richtete eine Bitte an mich: Die Welt stand wirklich Kopf. »Nein«, sagte ich und versuchte, meiner Stimme einen freundlichen Tonfall zu verleihen. Ich konnte nur noch an mein eigenes Bett denken. »Das muss nicht sein. Geh einfach vor Sonnenaufgang hinein. Das wirst du wohl auf keinen Fall verpassen, stimmt’s? Ich meine, du kannst doch nicht einschlafen und erst bei Sonnenschein wieder aufwachen, oder?«
Er dachte einen Augenblick nach und schüttelte den Kopf. »Nein«, sagte er. »Ich weiß, dass das nicht passieren kann. Darf ich so lange mit in dein Zimmer?«
O Gott, dieser Welpenblick. Von einem 1,95Meter großen uralten Wikinger-Vampir. Das war einfach zu viel. Ich besaß nicht mehr genug Energie, um noch laut loszulachen, also stieß ich nur ein trauriges kleines Kichern aus. »Also, komm«, sagte ich mit einer Stimme so schwach wie meine Beine. Ich knipste das Licht in dem kleinen Zimmer aus, ging durch die Diele und schaltete die Lampe in meinem eigenen Zimmer an, das gelb und weiß und sauber und warm war, und schlug die Tagesdecke, die Decke und das Laken zurück. Während Eric verloren in einem alten Lehnsessel auf der anderen Seite des Bettes saß, zog ich mir Schuhe und Socken aus, holte ein Nachthemd aus der Kommode und ging ins Badezimmer. Nach zehn Minuten war ich wieder draußen, mit frisch geputzten Zähnen und sauberem Gesicht und eingehüllt in ein sehr altes, sehr weiches Flanellnachthemd, cremeweiß und über und über mit blauen Blümchen bestickt. Die Bündchen waren ausgefranst und die Rüsche am Saum gab ein klägliches Bild ab, aber ich liebte es sehr. Nachdem ich das Licht ausgemacht hatte, fiel mir ein, dass mein Haar noch in seinem üblichen Pferdeschwanz hochgebunden war. Ich zog das Haargummi, das es zusammenhielt, ab und schüttelte den Kopf, damit es locker auseinander fiel. Sogar meine Kopfhaut schien sich zu entspannen und ich seufzte erleichtert auf.
Als ich in das hohe alte Bett kletterte, tat mein nervtötender Riesenwelpe dasselbe. Hatte ich ihm tatsächlich erlaubt, zu mir ins Bett zu kommen? Nun, ich war so müde, dass es mir völlig egal war, ob Eric es irgendwie auf mich abgesehen haben sollte, sagte ich mir, während ich mich unter die weichen alten Laken und die Decke und das Deckbett kuschelte.
»Äh, übrigens?«
»Hmmm?«
»Wie heißt du?«
»Sookie. Sookie Stackhouse.«
»Danke, Sookie.«
»Bitte, Eric.«
Weil er so verloren klang – der Eric, den ich kannte, war immer ganz selbstverständlich davon ausgegangen, dass jedermann ihm zu Diensten zu stehen hatte–, tastete ich unter dem Laken nach seiner Hand. Als ich sie fand, legte ich meine darauf. Er drehte seine Hand herum, so dass unsere Handflächen sich berührten, und seine Finger schlangen sich in meine.
Und auch wenn ich es nie für möglich gehalten hätte, dass man einschlafen kann, während man mit einem Vampir Händchen hält, so war es doch genau das, was ich nun tat.
Kapitel 2
Ich wurde nur langsam wach. Eingekuschelt in meine Bettdecke lag ich da und streckte ab und zu einen Arm oder ein Bein, während ich mich allmählich wieder an die unwirklichen Ereignisse der letzten Nacht erinnerte.
Eric lag nicht mehr bei mir im Bett, also konnte ich davon ausgehen, dass er sich in seinem Schlupfloch niedergelassen hatte. Ich ging ins andere Zimmer und stellte wie versprochen die Sachen in den Schrank zurück, so dass alles ganz normal aussah. Die Uhr zeigte Mittag und draußen schien strahlend die Sonne, obwohl die Luft kalt war. Zu Weihnachten hatte Jason mir ein Thermometer geschenkt, das die Außentemperatur maß und sie mir drinnen auf einem digitalen Display anzeigte. Jetzt wusste ich also schon mal zwei Dinge: Es war Mittag, und draußen herrschten null Grad.
In der Küche stand immer noch die Schüssel auf dem Boden, in der ich Erics Füße gewaschen hatte. Als ich das Wasser ins Spülbecken kippte, sah ich, dass Eric irgendwann die Flasche ausgespült hatte, in der das synthetische Blut gewesen war. Ich musste noch ein paar davon besorgen, ehe er aufstand, denn einen hungrigen Vampir will wohl keiner gern im Haus haben. Und außerdem war es nur höflich, Pam und allen, die sonst noch aus Shreveport herüberkamen, eine Flasche anzubieten. Sie würden mir die Sache erklären – oder auch nicht. Sie würden Eric mitnehmen und sich selbst der Lösung jener geheimnisvollen Probleme widmen, die der Vampir-Gemeinde von Shreveport zusetzten. Und ich würde hier in Frieden leben können. Oder auch nicht.
Merlotte’s Bar war am Neujahrstag bis vier Uhr geschlossen. Am Neujahrstag und am Tag darauf waren Charlsie und Danielle und die Neue zum Dienst eingeteilt, weil wir anderen am Silvesterabend gearbeitet hatten. Ich hatte also zwei ganze Tage frei… und mindestens einen davon würde ich völlig allein mit einem geistig verwirrten Vampir im Haus verbringen. Das Leben war schön.
Ich trank zwei Tassen Kaffee, tat Erics Jeans in die Waschmaschine, las eine Weile in einem Liebesroman und sah mir meinen brandneuen Kalender mit dem »Wort des Tages« an, den Arlene mir zu Weihnachten geschenkt hatte. Mein erstes Wort im neuen Jahr lautete »Sang-froid«. War das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Omen?
Kurz nach vier kam Jason in einem irren Tempo in seinem schwarzen Pick-up mit den pink und lila Flammen an den Seiten meine Auffahrt hinaufgedonnert. Ich war inzwischen geduscht und angezogen, nur mein Haar war noch nass. Ich hatte so ein Pflegezeug hineingesprüht und fuhr jetzt langsam mit der Bürste hindurch, während ich vor dem Kamin saß und im Fernsehen ein Footballspiel ansah, damit mir beim Bürsten nicht langweilig wurde; den Ton hatte ich allerdings ganz leise gestellt. Ich dachte über Erics Zwangslage nach und aalte mich in der Wärme des Feuers in meinem Rücken.
In den letzten paar Jahren war der Kamin nur selten genutzt worden, weil Holz in so großen Mengen unheimlich teuer war. Doch Jason hatte einige Bäume, die im letzten Jahr bei einem Eissturm umgeknickt waren, zersägt, und jetzt hatte ich einen großen Vorrat und genoss die warmen Flammen.
Mein Bruder stapfte die Vorderstufen herauf und klopfte flüchtig an die Tür, ehe er eintrat. Wie ich war auch er in diesem Haus aufgewachsen. Wir waren zu unserer Großmutter gezogen, nachdem unsere Eltern gestorben waren, und sie hatte deren Haus vermietet, bis Jason mit zwanzig sagte, er sei jetzt alt genug, um allein zu wohnen. Mittlerweile war Jason achtundzwanzig und der Boss einer Straßenbautruppe. Ein ziemlich rasanter Aufstieg für einen Jungen vom Land, der nicht viel Bildung besaß. Ich dachte, er wäre zufrieden damit, bis er vor ein, zwei Monaten plötzlich ruhelos wurde.
»Prima«, sagte er, als er das Kaminfeuer sah. Er stellte sich genau davor, um seine Hände zu wärmen – womit er mir die ganze Wärme nahm. »Wann warst du denn letzte Nacht zu Hause?«, fragte er über die Schulter.
»Ich schätze, ich war um drei im Bett.«
»Wie fandest du die Kleine, mit der ich rumhing?«
»Ich finde, mit der solltest du dich besser nicht mehr treffen.«