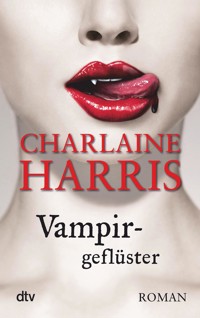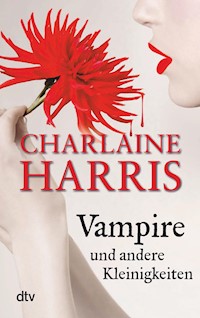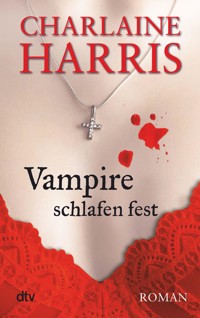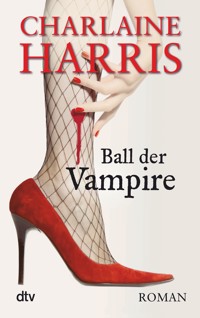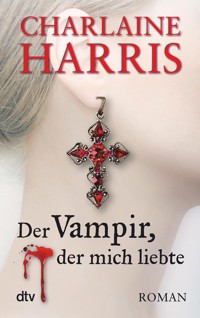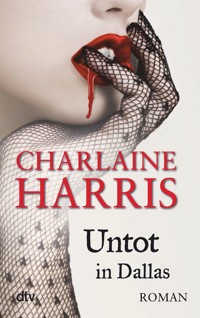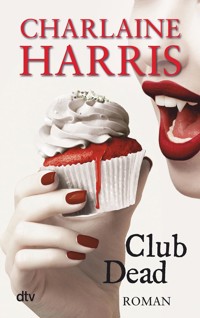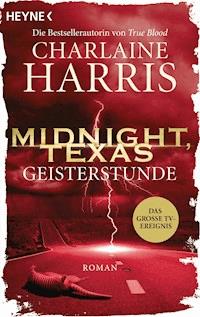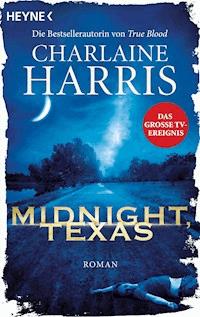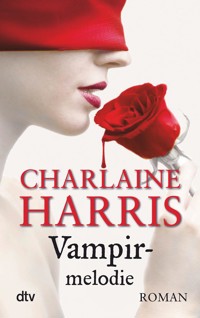6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Sookie Stackhouse
- Sprache: Deutsch
Die Romane zur TV-Serie ›Trueblood‹ Es ist Frühling in Bon Temps, und er bringt für Sookie Stackhouse, die gedankenlesende Kellnerin, einige Enthüllungen, die ihr Leben ziemlich auf den Kopf stellen werden ... Wieder einmal scheint Sookie Probleme geradezu magisch anzuziehen. Diesmal wird sie Zeugin, als eine Brandbombe auf Sam Merlottes Bar geworfen wird. Alles deutet auf einen Überzeugungstäter hin, der es auf Gestaltwandler abgesehen hat. Doch Sookie glaubt nicht recht an diese einfache Lösung. Gemeinsam mit Sam versucht sie, den wahren Schuldigen zu finden. Außerdem lässt sie sich unvorsichtigerweise in die komplizierten Pläne der Vampire Eric und Pam hineinziehen, die sich ihres Meisters entledigen wollen. Kurz: Sookie lebt gefährlich wie eh und je!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 534
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Charlaine Harris
Vampir mit Vergangenheit
Roman
Deutsch von Britta Mümmler
Deutsche Erstausgabe 2012
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
© für die deutschsprachige Ausgabe:
2012dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlags zulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Konvertierung Koch, Neff & Volckmar GmbH,
KN digital– die digitale Verlagsauslieferung, Stuttgart
eBook ISBN 978-3-423-41367-1 (epub)
ISBN der gedruckten Ausgabe 978-3-423-21386-8
Ausführliche Informationen über unsere Autoren und Bücher finden Sie auf unserer Website
www.dtv.de/ebooks
Ich möchte dieses Buch dem Andenken meiner Mutter widmen.
Sie hätte es keineswegs seltsam gefunden, dass ihr ein Fantasyroman gewidmet wird, denn sie war mein größter Fan und meine treuste Leserin. Es war so viel Bewundernswertes an meiner Mutter. Ich vermisse sie jeden Tag.
Kapitel 1
Die Dachkammer war stets abgeschlossen gewesen bis zum Tod meiner Großmutter. Am Tag danach hatte ich ihren Schlüssel gefunden und den Raum in jener furchtbaren Zeit geöffnet, um nach ihrem Hochzeitskleid zu suchen, denn mir war die verrückte Idee gekommen, dass sie darin begraben werden sollte. Doch schon nach den ersten Schritten hatte ich kehrtgemacht und war wieder gegangen, ohne die Tür hinter mir abzuschließen.
Jetzt, zwei Jahre später, öffnete ich diese Tür erneut. Sie quietschte so unheilverkündend in den Angeln, als wäre es Mitternacht an Halloween und nicht ein sonniger Mittwochmorgen Ende Mai. Die breiten Holzdielen protestierten unter meinen Füßen, als ich über die Schwelle trat. Dunkle Gebilde umringten mich, und ein schwacher Hauch von Moder lag in der Luft– der Geruch alter, längst vergessener Dinge.
Das ursprüngliche Haus der Familie Stackhouse war schon vor vielen Jahrzehnten aufgestockt worden, weil mehr Schlafzimmer gebraucht wurden. Erst als die kinderreichste Stackhouse-Generation immer stärker ausdünnte, hatte man etwa ein Drittel des neuen Stockwerks als Stauraum abgetrennt. Seit Jason und ich nach dem Tod unserer Eltern bei unseren Großeltern gelebt hatten, war die Tür zu dieser Dachkammer immer abgeschlossen gewesen. Gran hatte wohl einfach nicht ständig hinter uns herräumen wollen, falls wir die Dachkammer als einen prima Platz zum Spielen auserkoren hätten.
Jetzt gehörte das Haus mir, und der Schlüssel hing an einem Band um meinen Hals. Es gab nur noch drei direkte Stackhouse-Nachkommen– meinen Bruder Jason, mich und den Sohn meiner verstorbenen Cousine Hadley, einen kleinen Jungen namens Hunter.
Ich fuhr mit der Hand durch die schemenhafte Dunkelheit auf der Suche nach einer herabhängenden Schnur, bekam sie schließlich zu fassen und zog daran. Das trübe Licht einer nackten Glühbirne fiel auf jahrzehntealten Krempel der Familie Stackhouse.
Cousin Claude und Großonkel Dermot traten hinter mir ein. Dermot atmete so laut aus, dass es fast wie ein Schnauben klang. Claude blickte düster drein. Er bedauerte bestimmt schon, dass er angeboten hatte, mir beim Ausräumen der Dachkammer zu helfen. Aber ich würde meinem Cousin nicht erlauben, sich aus der Verantwortung zu stehlen, und erst recht nicht, solange noch ein weiterer kräftiger Mann als Helfer da war. Denn noch ging Dermot überall dorthin, wohin Claude ging, sodass ich zwei zum Preis von einem hatte. Doch wer konnte schon sagen, wie lange es bei dieser Konstellation bleiben würde. Heute Morgen war mir plötzlich klar geworden, dass es bald schon zu heiß sein würde, um sich hier oben lange aufhalten zu können. Das tragbare Klimagerät, das meine Freundin Amelia für eins der Schlafzimmer angeschafft hatte, machte es im Wohnbereich erträglich. Aber wir hatten natürlich nie Geld dafür hinausgeworfen, auch noch eins für die Dachkammer zu kaufen.
»Wie wollen wir vorgehen?«, fragte Dermot. Er war blond und Claude dunkelhaarig, und die beiden wirkten wie zwei prachtvolle Statuen. Claude hatte ich mal gefragt, wie alt er sei, und es stellte sich heraus, dass er davon nur eine höchst vage Vorstellung besaß. Elfen behielten die Zeit nicht so im Blick wie wir, aber Claude war mindestens ein Jahrhundert älter als ich. Im Vergleich zu Dermot war er allerdings noch ein Kind, denn mein Großonkel glaubte, mir siebenhundert Jahre vorauszuhaben. Aber es war nicht eine Falte zu sehen, nicht ein graues Haar, nirgends schlaffes Gewebe, bei keinem von beiden.
Da sie sehr viel mehr Elf waren als ich– ich war’s nur zu einem Achtel–, schienen wir alle ungefähr im gleichen Alter zu sein, Ende zwanzig. Aber das würde sich schon in ein paar Jahren ändern, wenn ich älter auszusehen begann als meine uralten Verwandten. Obwohl Dermot meinem Bruder Jason wirklich sehr ähnlich sah, hatte ich gestern bemerkt, dass Jason in den Augenwinkeln bereits Krähenfüße hatte. Ein Zeichen des Alterns, das bei Dermot vielleicht nie zu sehen sein würde.
Ich zwang mich ins Hier und Jetzt zurück. »Ich schlage vor, wir tragen die Sachen ins Wohnzimmer runter«, sagte ich. »Dort ist es sehr viel heller, und man wird leichter erkennen können, was aufzuheben sich lohnt und was nicht. Und wenn wir alles aus der Dachkammer raushaben, kann ich dort putzen, sobald ihr beide euch auf den Weg in die Arbeit macht.« Claude besaß einen Strip-Club in Monroe, in den er jeden Tag fuhr, und Dermot ging überall dorthin, wohin Claude ging. Wie immer…
»Wir haben drei Stunden«, stellte Claude fest.
»Dann sollten wir uns an die Arbeit machen«, erwiderte ich mit einem strahlenden, fröhlichen Lächeln auf den Lippen– mein Gesichtsausdruck für alle Fälle.
Ungefähr eine Stunde später hätte ich es mir am liebsten noch mal überlegt, aber es war bereits zu spät, das Ganze abzublasen. (Und der Anblick von Claude und Dermot, die beide mit nacktem Oberkörper arbeiteten, war auch nicht zu verachten.) Meine Familie lebt in diesem Haus schon, seit es hier im Landkreis Renard Stackhouses gibt. Also seit über hundertfünfzig Jahren. Und wir haben Unmengen an Zeug aufbewahrt.
Das Wohnzimmer begann sich ruckzuck zu füllen. Überall standen Bücherkisten, Koffer voller Kleider, Möbelstücke und Vasen herum. Die Familie Stackhouse war nie reich gewesen, hatte aber offensichtlich stets geglaubt, es würde sich für alles– egal, wie schäbig oder ramponiert es war– schon noch ein Verwendungszweck finden, wenn es nur lange genug aufbewahrt wurde. Sogar die beiden Elfen wollten schließlich eine Pause machen, als sie einen unglaublich schweren Holztisch die schmale Treppe hinunterbugsiert hatten. Wir setzten uns auf die vordere Veranda hinaus. Die beiden Männer hockten sich auf das Geländer, und ich ließ mich in die Verandaschaukel fallen.
»Wir könnten im Garten alles auf einen Haufen werfen und es verbrennen«, schlug Claude vor. Und das sollte kein Witz sein. Claudes Sinn für Humor war bestenfalls verschroben zu nennen, glänzte aber meist durch Abwesenheit.
»Nein!« Ich bemühte mich, nicht so gereizt zu klingen, wie ich mich fühlte. »Dieses Zeug ist wertlos, ich weiß. Aber wenn Stackhouses früherer Generationen meinten, dass es dort oben aufbewahrt werden sollte, schulde ich ihnen zumindest den Gefallen, alles in Augenschein zu nehmen.«
»Liebste Großnichte«, begann Dermot, »ich fürchte, Claude hat ganz recht. Zu sagen, dieser Krempel sei ›wertlos‹, ist noch höflich ausgedrückt.« Wenn man Dermot erst mal reden hörte, wusste man gleich, dass seine Ähnlichkeit mit Jason rein äußerlicher Natur war.
Ich blickte die Elfen finster an. »Für euch beide ist das meiste davon natürlich bloß Sperrmüll, aber für Menschen hat es ja vielleicht noch einen gewissen Wert«, sagte ich. »Ich werde mal die Theatergruppe in Shreveport anrufen und fragen, ob sie irgendwas von den Kleidern oder den Möbeln haben wollen.«
Claude zuckte die Achseln. »So werden wir immerhin etwas los«, erwiderte er. »Aber die meisten Stoffe eignen sich nicht mal mehr als Lumpen.« Wir hatten einige Kartons auf die Veranda hinausgestellt, als im Wohnzimmer langsam kein Durchkommen mehr war, und er stieß mit dem großen Zeh gegen einen davon. Auf dem Etikett stand, dass Vorhänge darin waren, aber man konnte nur noch raten, wie die ursprünglich mal ausgesehen hatten.
»Du hast ja recht«, gab ich zu. Ich stieß mich mit dem Fuß ab und schaukelte einen Augenblick lang vor mich hin. Dermot ging unterdessen ins Haus und kam mit einem Glas Pfirsichtee mit jeder Menge Eis darin zurück. Schweigend reichte er es mir. Ich dankte ihm und betrachtete trübselig all die alten Sachen, die irgendwer einst geschätzt hatte. »Okay, werfen wir alles auf einen Haufen und verbrennen es«, sagte ich und beugte mich doch den Vernunftgründen. »Vielleicht hinterm Haus, dort, wo ich sonst immer das Laub verbrenne?«
Dermot und Claude starrten mich entsetzt an.
»Okay, gleich hier auf dem Kies geht’s auch«, sagte ich. Als meine Auffahrt das letzte Mal neu mit Kies ausgestreut wurde, hatte auch der mit Holzlatten eingefasste Parkplatz vor dem Haus eine frische Schicht erhalten. »Ist ja nicht so, dass ich oft Besuch bekomme.«
Als Dermot und Claude schließlich Schluss machten, um sich für die Fahrt nach Monroe zu duschen und umzuziehen, ragte auf dem Parkplatz ein beachtlicher Haufen unnützer Sachen in die Höhe, der nur noch auf eine Fackel wartete. Die Stackhouse-Ehefrauen früherer Generationen hatten auch Unmengen überzähliger Bettlaken und Tagesdecken aufbewahrt, aber die meisten waren im gleichen verrotteten Zustand wie die Vorhänge. Noch mehr bedauerte ich, dass viele der Bücher verschimmelt und von Mäusen angefressen waren. Ich seufzte und warf auch sie auf den Haufen, obwohl mir bei der Vorstellung, Bücher zu verbrennen, gar nicht wohl war. Aber kaputte Möbelstücke, zerschlissene Regenschirme, fleckige Tischsets, ein uralter Lederkoffer voll großer Löcher… all diese Sachen würde wohl nie wieder jemand brauchen.
Die Fotos, die wir entdeckt hatten– gerahmt, in Alben geklebt oder einzeln–, legten wir in einen gesonderten Karton im Wohnzimmer. Dokumente wurden in einem weiteren Karton gesammelt. Und ich hatte auch ein paar alte Puppen gefunden. Aus dem Fernsehen wusste ich, dass manche Leute Puppen sammelten. Vielleicht waren die ja etwas wert? Es waren sogar ein paar alte Gewehre unter all dem Krempel und auch ein Schwert. Wo genau waren eigentlich die Antiquitätenexperten, wenn man sie mal brauchte?
Später im Merlotte’s erzählte ich meinem Boss Sam von meinem Tag. Sam, ein kompakter Mann, der wirklich enorme Körperkräfte besaß, staubte hinter dem Tresen Flaschen ab. Es war nicht viel los an diesem Abend. Ehrlich gesagt, war das Geschäft schon in den letzten paar Wochen nicht mehr so gut gelaufen. Keine Ahnung, ob diese Flaute damit zusammenhing, dass hier in der Gegend mit der Hühnerfarm bald ein großer Arbeitgeber schließen würde, oder eher mit der Tatsache, dass einige Leute plötzlich was gegen Sam hatten, weil er Gestaltwandler war. (Die zweigestaltigen Geschöpfe hatten versucht, den erfolgreichen Eintritt der Vampire in die menschliche Gesellschaft nachzuvollziehen, aber das war nicht sonderlich gut gelaufen.) Und dann gab’s seit Kurzem auch noch eine neue Bar, Vic’s Redneck Roadhouse, ungefähr zehn Meilen westlich der Autobahn. Ich hatte gehört, dass das Redneck Roadhouse alle möglichen Sexy-Girl-Wettbewerbe veranstaltete, Turniere im Bierkrug-Pingpong und Werbe-Aktionen à la »Bring ’nen Kumpel mit, zahl die Hälfte«– so einen richtigen Scheiß eben.
Populären Scheiß. Scheiß, der Gäste in Scharen anzog.
Aber aus welchen Gründen auch immer, Sam und ich hatten Zeit, um über Dachkammern und Antiquitäten miteinander zu reden.
»In Shreveport gibt’s einen Laden namens Splendide«, sagte Sam. »Die Besitzer sind beide Gutachter. Die könntest du mal anrufen.«
»Woher weißt du das denn?« Okay, das war vielleicht nicht besonders taktvoll.
»Na ja, ich weiß eben nicht nur, wie man Drinks mixt, sondern auch noch ein paar andere Dinge«, sagte Sam und warf mir einen Blick von der Seite zu.
Ich musste erst mal einen Bierkrug nachfüllen für einen meiner Tische. Als ich mich wieder umdrehte, erwiderte ich: »Klar, du weißt natürlich alle möglichen Dinge. Ich wusste bloß nicht, dass du dich für Antiquitäten interessierst.«
»Tu ich auch nicht. Aber Jannalynn. Im Splendide kauft sie am liebsten ein.«
Ich blinzelte leicht, bemüht, mir meine Verwirrung nicht anmerken zu lassen. Jannalynn Hopper, mittlerweile seit ein paar Wochen mit Sam zusammen, war so wild und grausam, dass sie zur Vollstreckerin des Reißzahn-Rudels ernannt worden war– und das, obwohl sie erst einundzwanzig war und die Statur einer Siebtklässlerin hatte. Es fiel schwer, sich Jannalynn dabei vorzustellen, wie sie nach einem antiken Bilderrahmen suchte oder die Maße einer Kommode aus der Kolonialzeit für ihre Wohnung in Shreveport nahm. (Und wenn ich schon dabei bin: Ich weiß nicht mal, wo sie wohnt. Hat Jannalynn eigentlich ein eigenes Haus?)
»Darauf wäre ich im Leben nicht gekommen«, sagte ich und zwang mich, Sam anzulächeln. Ich persönlich war nämlich der Meinung, dass Jannalynn nicht gut genug war für Sam.
Aber das behielt ich natürlich für mich. Ich sag bloß Glashaus, Steine und all das, stimmt’s? Schließlich war ich selbst mit einem Vampir zusammen, dessen Mordliste die von Jannalynn mit Sicherheit noch übertraf, denn Eric war über tausend Jahre alt. Und in einem dieser schrecklichen Momente, die einen manchmal zufällig überkommen, wurde mir plötzlich klar, dass jeder der Männer, mit denen ich je zusammen gewesen war– auch wenn das, zugegeben, nur eine kurze Liste ist–, ein Mörder war.
Und ich selbst auch.
Ein Gedanke, den ich sofort wieder abschütteln musste, sonst wäre ich den ganzen Abend lang völlig deprimiert herumgelaufen.
»Hast du auch Namen und eine Telefonnummer von diesen Antiquitätenhändlern?« Ich konnte bloß hoffen, dass die nach Bon Temps kommen würden. Sonst würde ich glatt einen Lastwagen mieten müssen, um all den Krempel aus der Dachkammer nach Shreveport zu schaffen.
»Ja, in meinem Büro«, sagte Sam. »Ich habe selbst mit Brenda, der weiblichen Hälfte des Geschäftsduos, geredet, weil ich Jannalynn was Besonderes zum Geburtstag schenken will. Der ist bald. Und heute Morgen hat Brenda – Brenda Hesterman– angerufen und mir gesagt, dass sie ein paar Sachen hätte, die ich ansehen sollte.«
»Dann könnten wir morgen doch vielleicht zusammen zu ihr fahren?«, schlug ich vor. »Mein ganzes Wohnzimmer steht voller Krempel und einiges auch draußen auf der Veranda vorne, und das gute Wetter wird nicht ewig halten.«
»Könnte es nicht sein, dass Jason irgendwas davon haben will?«, fragte Sam zurückhaltend. »Ich meine nur, von wegen Familienkram und so.«
»Er hat sich vor etwa einem Monat schon einen kleinen runden Beistelltisch geholt«, sagte ich. »Aber ich sollte ihn vermutlich besser mal fragen.« Ich dachte kurz darüber nach. Das Haus und alles darin gehörte mir, da Gran es mir hinterlassen hatte. Hmmmm. Ach was, eins nach dem anderen. »Fragen wir Ms Hesterman doch erst mal, ob sie sich die Sachen anschauen kommt. Und falls wertvolle Stücke darunter sein sollten, kann ich mir darüber immer noch Gedanken machen.«
»Okay«, erwiderte Sam. »Klingt gut. Soll ich dich morgen um zehn abholen?«
Das war eigentlich etwas zu früh für mich, um schon aufgestanden und fertig angezogen zu sein, weil ich Spätschicht hatte. Aber ich stimmte zu.
Sam schien sich zu freuen. »Dann kannst du mir sagen, was du von dem, was immer Brenda mir auch zeigen will, hältst. Wird bestimmt gut sein, die Meinung einer Frau zu hören.« Er fuhr sich mit der Hand durchs Haar, das ihm (wie üblich) wirr vom Kopf abstand. Vor einigen Wochen hatte er es sich richtig kurz schneiden lassen, und jetzt war es im heiklen Stadium des Nachwachsens. Sams Haar hat eine schöne Farbe, so eine Art Rotblond; aber weil es von Natur aus lockig ist, schien es sich jetzt, da es nachwuchs, nicht für eine einzige Richtung entscheiden zu können. Ich unterdrückte das Verlangen, eine Bürste hervorzuziehen und etwas Ordnung hineinzubringen. Denn das war nichts, was eine Angestellte für ihren Boss tun sollte.
Kennedy Keyes und Danny Prideaux, die stundenweise zur Aushilfe als Barkeeperin beziehungsweise Rausschmeißer für Sam arbeiteten, kamen herein und setzten sich auf zwei der leeren Barhocker. Kennedy ist eine wunderschöne Frau. Vor einigen Jahren hat sie bei der Wahl zur Miss Louisiana mal den zweiten Platz belegt, und sie sieht immer noch aus wie eine echte Schönheitskönigin. Ihr volles kastanienbraunes Haar glänzt nur so, und ihre Haarspitzen würden es gar nicht wagen, Spliss zu bekommen. Ihr Make-up ist makellos, sie geht regelmäßig zur Maniküre und Pediküre, und ein Kleidungsstück von Wal-Mart würde Kennedy nicht mal dann tragen, wenn ihr Leben davon abhinge.
Vor einigen Jahren war ihre Zukunft, die eine schicke Country-Club-Hochzeit im benachbarten Landkreis und eine große Erbschaft von ihrem Daddy hätte einschließen sollen, allerdings aus der Bahn geworfen worden, als sie nämlich wegen Totschlags im Gefängnis gelandet war.
Wie so ziemlich jeder, den ich kannte, war auch ich der Meinung gewesen, dass ihr Freund es verdient hatte, nachdem ich ihr blau und grün verfärbtes, angeschwollenes Gesicht auf den Fahndungsfotos gesehen hatte. Doch sie hatte schon gestanden, ihn erschossen zu haben, als sie die Polizei anrief, und seine Familie besaß einigen Einfluss, sodass Kennedy keine Chance gehabt hatte, davonzukommen. Sie war immerhin zu einer geringen Strafe verurteilt worden und wegen guter Führung frühzeitig entlassen worden, weil sie den anderen Insassen Benehmen und Körperpflege beigebracht hatte. Als Kennedy ihre Zeit abgesessen hatte und wieder draußen war, hatte sie sich eine kleine Wohnung in Bon Temps gemietet, wo eine Tante von ihr lebte, Marcia Albanese. Und Sam hatte ihr so ziemlich gleich, nachdem er sie kennengelernt hatte, einen Job angeboten, den sie sofort annahm.
»Hey, Kumpel«, sagte Danny zu Sam. »Machst du uns zwei Mojitos?«
Sam holte die Minze aus dem Kühlschrank und machte sich an die Arbeit. Als er die Drinks fast fertig hatte, reichte ich ihm noch die Limettenscheiben.
»Was hast du denn heute Abend noch vor?«, fragte ich Kennedy. »Du siehst ja geradezu hinreißend aus.«
»Ich hab endlich fünf Kilo runter!«, rief sie, und als Sam eins der Cocktailgläser vor sie hinstellte, hob sie es in die Höhe und prostete Danny zu. »Auf meine einstige Figur! Und darauf, dass ich auf dem besten Wege bin, da wieder hinzukommen!«
Danny schüttelte den Kopf. »Hey! Du brauchst doch echt gar nix tun, um wunderschön auszusehn.« Ich musste mich wegdrehen, um nicht entnervt aufzustöhnen. Danny war ein richtig harter Kerl und hätte in keiner entgegengesetzteren Umgebung aufwachsen können als Kennedy– die einzige Erfahrung, die die beiden teilten, war das Gefängnis–, aber herrje, es war kaum auszuhalten, wie der Kennedy anschmachtete. Ich konnte noch dort, wo ich stand, die Hitze spüren. Man musste wahrlich nicht Gedanken lesen können, um Dannys glühende Verehrung zu erkennen.
Wir hatten die Vorhänge an den Fenstern nach vorne raus noch nicht zugezogen, und als ich bemerkte, dass es draußen schon dunkel war, ging ich darauf zu. Obwohl ich aus der hellen Bar auf den dunklen Parkplatz hinaussah, waren dort draußen Lichter zu erkennen und irgendwas bewegte sich… bewegte sich schnell. Auf die Bar zu. Den Bruchteil einer Sekunde lang dachte ich noch, seltsam, und dann sah ich das Aufflackern einer Flamme.
»Runter!«, schrie ich, doch das Wort hatte meinen Mund noch nicht ganz verlassen, da zerbarst auch schon die Fensterscheibe, und die Flasche mit dem feurig roten Inhalt landete auf einem der Tische, an dem niemand saß, zerstörte den Serviettenhalter und fegte die Salz- und Pfefferstreuer in irgendwelche Ecken. Brennende Servietten waren von der Wucht des Aufpralls aufgeflogen und segelten auf den Fußboden, die Stühle, die Leute. Der Tisch selbst war beinahe augenblicklich in Flammen aufgegangen.
Danny bewegte sich schneller, als ich es je bei einem Menschen gesehen hatte. Er stieß Kennedy vom Barhocker, klappte den Tresendurchgang auf und schob sie hinter die Bar. Einen kurzen Augenblick lang herrschte dort eine Art Stau, weil Sam mit einer sogar noch schnelleren Bewegung den Feuerlöscher von der Wand gerissen hatte und durch den Durchgang hindurch auf das Feuer zurennen wollte, um es zu löschen.
Ich spürte Hitze an meinen Oberschenkeln, und als ich an mir herabschaute, sah ich, dass meine Schürze von einer der Servietten Feuer gefangen hatte. Es ist mir zwar peinlich, aber ich muss zugeben, dass ich laut gekreischt habe. Sam wirbelte im Nu herum, sprühte mich an und wandte sich dann gleich wieder dem Feuer zu. Die Gäste schrien, versuchten, die Flammen zu ersticken, oder rannten in den Gang hinein, der an den Toiletten und Sams Büro vorbei zum hinteren Ausgang und Parkplatz führte. Einer unserer alten Stammgäste, Jane Bodehouse, blutete stark und hielt sich mit der Hand die zerschnittene Kopfhaut. Sie hatte am Fenster gesessen, nicht an ihrem üblichen Platz am Tresen, und war deshalb wohl von herumfliegenden Glasscherben getroffen worden. Jane taumelte und wäre gestürzt, wenn ich sie nicht am Arm gepackt hätte.
»Gehen Sie da lang«, schrie ich ihr ins Ohr und schob sie in die richtige Richtung. Sam sprühte mit dem Feuerlöscher in den größten Brandherd hinein und versuchte, ihn so nach bewährter Methode im Keim zu ersticken. Doch die brennenden Servietten, die überall hingeflogen waren, hatten noch viele weitere kleine Feuer verursacht. Ich schnappte mir die beiden Krüge mit Wasser und Tee vom Tresen und begann, den Flammen auf dem Boden systematisch zu folgen. Die Krüge waren voll, und so blieb die Wirkung nicht aus.
Einer der Fenstervorhänge hatte ebenfalls Feuer gefangen, und ich machte einige Schritte darauf zu, zielte sorgfältig und schüttete den restlichen Tee darüber. Doch die Flammen erstarben nicht ganz. Also griff ich nach dem verlassenen Glas Wasser, das auf einem der Tische stand, und ging viel näher an das Feuer heran, als ich eigentlich vorgehabt hatte. Immer wieder zurückzuckend goss ich die Flüssigkeit auf den qualmenden Vorhang. Hinter mir spürte ich eine seltsam flackernde Hitze, und ein abscheulicher Gestank stieg mir in die Nase. Da traf mich plötzlich mit großer Wucht ein Schwall Chemikalien im Rücken. Seltsam, was war das denn? Doch als ich herumfuhr, sah ich bloß noch, wie Sam sich mit dem Feuerlöscher in der Hand wieder von mir wegdrehte.
Mein Blick fiel durch die Durchreiche direkt in die Küche hinein. Antoine, der Koch, war gerade dabei, alle Geräte auszuschalten. Sehr klug. In der Ferne hörte ich schon die Sirenen der Feuerwehr, doch ich war viel zu sehr damit beschäftigt, nach kleinen rötlich gelben Flammen Ausschau zu halten, um große Erleichterung zu empfinden. Meine Augen tränten unaufhörlich vom Rauch und all den Chemikalien, und meine Blicke schossen wie ein Flipperball von hier nach dort, während ich wie eine Verrückte hustete und versuchte, aufflackernde Flammen zu entdecken. Sam war in sein Büro gerannt, um den zweiten Feuerlöscher zu holen, und tauchte mit dem Ding im Anschlag wieder auf. Wir wankten von einer Seite des Raums zur anderen, immer auf dem Sprung, die nächste Flamme zu ersticken.
Keiner von uns beiden sah irgendetwas anderes.
Sam zielte noch einmal auf die Flasche, die das Feuer ausgelöst hatte, danach stellte er den Feuerlöscher ab. Er beugte sich vornüber, beide Hände auf die Oberschenkel gestützt, und atmete schwer keuchend, so erledigt war er. Dann fing er an zu husten. Einen Augenblick später bückte er sich nach der Flasche.
»Nicht anfassen!«, rief ich eindringlich, und seine Hand hielt auf halbem Wege inne.
»Natürlich nicht«, erwiderte er mit Selbstvorwurf in der Stimme. Dann richtete er sich wieder auf. »Hast du gesehen, wer sie geworfen hat?«
»Nein«, sagte ich. Wir waren die Einzigen, die noch im Merlotte’s waren. Ich konnte hören, wie die Feuerwehr näher und immer näher kam, und wusste, dass uns nicht mehr viel Zeit blieb, allein miteinander zu reden. »Könnten dieselben Leute gewesen sein, die manchmal draußen auf dem Parkplatz demonstrieren. Ich hab allerdings noch nie gehört, dass diese religiösen Spinner was für Brandbomben übrig haben.« Nicht alle in der Gegend waren begeistert gewesen, als sie nach der Großen Enthüllung der Vampire erfuhren, dass es auch noch Geschöpfe wie Werwölfe und Gestaltwandler gab, und das »Tabernakel des Heiligen Wortes« in Clarice hatte seine Mitglieder hin und wieder zu Demonstrationen vors Merlotte’s geschickt.
»Sookie«, sagte Sam, »tut mir leid, das mit deinem Haar.«
»Was ist damit?«, fragte ich und hob die Hand, um mir an den Kopf zu fassen. Doch so langsam setzte der Schock ein. Es fiel mir schwer, die Bewegung meiner Hand zu koordinieren.
»Das Ende deines Pferdeschwanzes ist versengt«, erwiderte Sam. Und mit einem Mal setzte er sich hin. Was ich für eine prima Idee hielt.
»Das also stinkt hier so«, stellte ich fest und sackte neben ihn auf den Fußboden. Und da hockten wir, mit dem Rücken an den Tresen gelehnt. Die Stühle waren in dem allgemeinen Getümmel, als alle zum Hinterausgang strebten, sowieso überall verstreut worden. Mein Haar war verbrannt. Ich spürte, wie mir Tränen über die Wangen liefen. Ganz schön albern, ich weiß, aber ich konnte nicht anders.
Sam griff nach meiner Hand und drückte sie, und so saßen wir immer noch da, als die Feuerwehrleute hereinstürmten. Obwohl das Merlotte’s außerhalb der Stadtgrenze liegt, war die Berufsfeuerwehr von Bon Temps gekommen und nicht die freiwillige Feuerwehr.
»Ich glaube, der Wasserschlauch ist überflüssig«, rief Sam. »Das Feuer ist schon gelöscht.« Er wollte unbedingt noch weiteren Schaden von seiner Bar abwenden.
»Brauchen Sie beide Erste Hilfe?«, fragte Truman La Salle, der Feuerwehrhauptmann. Aber seine Blicke wanderten umher, und seine Worte klangen fast geistesabwesend.
»Mir geht’s gut«, erwiderte ich nach einem Blick zu Sam. »Aber Jane hat Schnittwunden am Kopf, von den Glasscherben, sie ist draußen hinterm Haus. Und du, Sam?«
»Meine rechte Hand ist anscheinend leicht verbrannt«, sagte er und presste die Lippen aufeinander, als würde er den Schmerz erst in diesem Augenblick spüren. Er ließ meine Hand los, um seine rechte mit seiner linken zu reiben, und diesmal zuckte er regelrecht zusammen.
»Das musst du verarzten lassen«, sagte ich. »Brandwunden tun höllisch weh.«
»Ja, das merk ich gerade«, stöhnte Sam und kniff die Augen zusammen.
Bud Dearborn kam in dem Moment herein, als Truman »Okay!« rief. Der Sheriff musste schon im Bett gelegen haben, denn seine Kleidung wirkte etwas zusammengewürfelt, und er trug keinen Hut, sonst sein steter Begleiter. Sheriff Dearborn war mittlerweile vermutlich Ende fünfzig, und man sah ihm jede Minute davon an. Er hatte schon immer wie ein Pekinese ausgesehen. Doch jetzt sah er aus wie ein grau gewordener. Ein paar Minuten lang ging er, den Blick auf den Boden geheftet, durch die Bar, fast so, als wollte er in der Unordnung herumschnüffeln. Schließlich schien er genug gesehen zu haben, kam zu mir und baute sich direkt vor mir auf.
»Was haben Sie jetzt schon wieder angestellt?«, fragte er.
»Irgendwer hat eine Brandbombe durchs Fenster geworfen«, erwiderte ich. »Damit habe ich nichts zu tun.« Ich war viel zu schockiert, um wütend zu klingen.
»Haben die’s auf Sie abgesehen, Sam?«, fragte der Sheriff und ging dann davon, ohne eine Antwort abzuwarten.
Sam stand langsam vom Boden auf, drehte sich nach mir um und reichte mir die linke Hand. Ich griff danach und er zog mich hoch. Und weil Sam so viel stärker ist, als er wirkt, war ich im Nu auf den Beinen.
Ein paar Minuten lang stand die Zeit still. Ich glaube, ich hatte wohl einen richtigen kleinen Schock.
Als Sheriff Dearborn seine langsame, sorgfältige zweite Runde durch die Bar beendet hatte, kam er wieder zu Sam und mir.
Und zu diesem Zeitpunkt hatten wir es bereits mit einem weiteren Sheriff zu tun.
Eric Northman, mein Freund und Vampirsheriff des Bezirks Fünf, zu dem Bon Temps gehörte, kam so rasant durch die Tür, dass Bud Dearborn und Truman La Salle zusammenzuckten, als er plötzlich neben ihnen stand. Ich dachte schon, Bud würde jeden Moment seine Waffe ziehen. Eric ergriff mich bei den Schultern und beugte sich vor, um mir in die Augen zu sehen. »Bist du verletzt?«, fragte er.
Es war, als hätte seine Sorge mir erlaubt, meine tapfere Haltung aufzugeben. Ich spürte, wie mir eine Träne über die Wange lief. Nur eine einzige. »Meine Schürze hatte Feuer gefangen, aber ich glaube, meine Beine sind okay«, sagte ich und musste mich sehr bemühen, ruhig zu klingen. »Ich habe nur etwas Haar eingebüßt, bin also ziemlich glimpflich davongekommen. Bud, Truman, ich weiß nicht, ob Sie meinen Freund Eric Northman aus Shreveport schon mal kennengelernt haben.« Ein Satz, in dem so einige zweifelhafte Fakten steckten.
»Woher wussten Sie, dass es hier Schwierigkeiten gibt, Mr.Northman?«, fragte Truman La Salle.
»Sookie hat mich mit ihrem Handy angerufen«, sagte Eric. Das war eine Lüge, aber ich legte keinen gesteigerten Wert darauf, dem Feuerwehrhauptmann und dem Sheriff von Bon Temps unsere Blutsbande zu erklären. Und Eric selbst würde einem Menschen nie freiwillig irgendwelche Informationen geben.
Das Wundervollste, aber auch Erschreckendste an Erics Liebe für mich war, dass ihm alles andere vollkommen egal war. Er ignorierte die beschädigte Bar, Sams Brandwunden, die Polizisten und die Feuerwehrleute, die immer noch das Gebäude überprüften (und ihn aus den Augenwinkeln beobachteten).
Eric ging einmal um mich herum, um die Sache mit meinen Haaren einschätzen zu können. Nach einem langen Augenblick sagte er schließlich: »Ich sehe mir noch deine Beine an. Und dann suchen wir einen Arzt und einen Beautysalon auf.« Seine Stimme war absolut kalt und ruhig, aber ich wusste, dass er innerlich vor Wut schäumte. Seine Wut rollte durch unsere Blutsbande, genauso wie meine Angst und mein Schock ihn auf die Gefahr aufmerksam gemacht hatten, in der ich mich befand.
»Schatz, es gibt anderes, worüber wir uns Gedanken machen müssen.« Ich zwang mich, zu lächeln und ganz gelassen zu sprechen. Im hintersten Winkel meines Hirns sah ich draußen schon einen rosaroten Krankenwagen mit quietschenden Reifen vorfahren, aus dem ein Team Notfallkosmetiker mit Taschen voller Scheren, Kämme und Haarspray sprang. »Um mein versengtes Haar können wir uns auch morgen noch kümmern. Viel wichtiger ist doch, herauszufinden, wer das hier getan hat und warum.«
Eric sah Sam so finster an, als wäre der Angriff seine Schuld. »Ja, klar, seine Bar ist natürlich viel wichtiger als deine Sicherheit und dein Wohlbefinden«, sagte er. Sam wirkte ziemlich erstaunt über diese Erwiderung, und ein erster Anflug von Wut huschte über sein Gesicht.
»Wenn Sam nicht so schnell zum Feuerlöscher gegriffen hätte, wären wir alle jetzt ziemlich übel zugerichtet.« Ganz gelassen bleiben und immer weiterlächeln, sagte ich mir. »Dann hätten jetzt sowohl die Bar als auch die Gäste sehr viel größere Probleme.« Lange würde ich diese falsche Gelassenheit nicht mehr aufrechterhalten können, und Eric bemerkte das natürlich.
»Ich bringe dich nach Hause«, sagte er.
»Aber erst, wenn ich mit ihr gesprochen habe«, warf Bud Dearborn ein, der einen beachtlichen Mut bewies mit dieser Bemerkung. Eric war schon furchterregend genug, wenn er gute Laune hatte, aber um wie viel mehr erst, wenn er die Fangzähne ausfuhr, so wie jetzt. Starke Gefühlsregungen rufen das bei Vampiren hervor.
»Schatz…«, begann ich, hatte aber größte Mühe, meine eigene Laune aufrechtzuerhalten. Ich schlang einen Arm um Erics Taille und setzte noch einmal an. »Schatz, Bud und Truman tragen hier die Verantwortung, und sie müssen ihren Vorschriften folgen.« Und auch wenn ich zitterte, was er natürlich spüren konnte, versicherte ich ihm noch einmal: »Mir geht’s gut.«
»Du hattest Angst«, entgegnete Eric, und seine Wut darüber, dass mir etwas zugestoßen war, das er nicht hatte verhindern können, durchflutete auch mich. Ich unterdrückte ein Seufzen. Na toll, jetzt durfte ich hier wieder mal den Babysitter für Erics aufgewühlte Emotionen machen, obwohl ich mich viel lieber meinem eigenen Nervenzusammenbruch hingegeben hätte. Aber Vampire sind nun mal vor allem eins, sobald sie jemanden als den ihren auserkoren haben: besitzergreifend. Auch wenn sie sonst immer enorm darauf bedacht sind, in der menschlichen Gesellschaft aufzugehen und bloß keinen unnötigen Aufruhr zu verursachen. Dies war eine Überreaktion.
Eric war wütend, okay, aber normalerweise war er auch ziemlich pragmatisch. Er wusste, dass ich nicht ernsthaft verletzt war. Verwundert sah ich ihn an. Mein hünenhafter Wikinger war schon seit ein, zwei Wochen nicht mehr der Alte. Irgendetwas anderes als nur der Tod seines Schöpfers schien ihn zu belasten, doch ich hatte noch nicht genug Mut aufgebracht, um ihn zu fragen, was eigentlich los sei. Ich hatte es mir leicht gemacht und einfach nur den Frieden genießen wollen, der mal ein paar Wochen lang geherrscht hatte.
Vielleicht war das ein Fehler gewesen. Irgendetwas Großes übte Druck auf ihn aus, und all diese Wut war eine Folge davon.
»Wie sind Sie so schnell hierhergekommen?«, fragte Bud Dearborn Eric.
»Ich bin geflogen«, sagte Eric völlig selbstverständlich, und Bud Dearborn und Truman La Salle sahen sich mit großen Augen an. Eric besaß diese Fähigkeit schon seit (mehr oder weniger) tausend Jahren und achtete gar nicht auf die Verwunderung der beiden. Er konzentrierte sich ganz auf mich, und seine Fangzähne waren immer noch zu sehen.
Sie konnten nicht wissen, dass Eric meine ausbrechende Angst schon in dem Augenblick gespürt hatte, als ich die rennende Gestalt draußen auf dem Parkplatz sah. Ich hatte ihn nicht erst anrufen müssen, nachdem der Brandanschlag passiert war. »Je schneller wir alles klären«, sagte ich zu ihm mit einem fürchterlich angestrengten Lächeln, bei dem auch ich die Zähne entblößte, »desto schneller können wir gehen.« Ich versuchte, wenn auch nicht sonderlich subtil, Eric eine Botschaft zu senden. Schließlich beruhigte er sich so weit, dass er immerhin das mitbekam.
»Natürlich, mein Liebling«, sagte er. »Du hast vollkommen recht.« Doch seine Hand, mit der er meine ergriff, drückte viel zu fest zu, und seine Augen glühten derart, dass sie wie kleine blaue Laternen aussahen.
Bud und Truman wirkten enorm erleichtert. Die Anspannung ließ etwas nach. Vampire bedeuteten immer Drama.
Während Sams Hand medizinisch versorgt wurde und Truman Fotos machte von dem, was von der Flasche noch übrig war, fragte Bud mich, was ich gesehen hatte.
»Ich habe auf einmal draußen auf dem Parkplatz jemanden auf das Haus zurennen sehen, und dann flog auch schon die Flasche durchs Fenster«, erzählte ich. »Ich weiß nicht, wer sie geworfen hat. Und als das Fenster kaputt war und wegen der brennenden Servietten überall Feuer ausbrach, habe ich nichts anderes mehr gesehen als Leute, die versuchten, hier herauszukommen, und Sam, der versuchte, das Feuer zu löschen.«
Bud fragte mich einige Male auf verschiedene Weise immer dasselbe, aber ich konnte ihm nicht sehr viel mehr helfen, als ich es schon getan hatte.
»Was meinen Sie, warum würde jemand dem Merlotte’s oder Sam so etwas antun wollen?«, fragte Bud.
»Ich verstehe das auch nicht«, sagte ich. »Sie wissen ja, dass wir vor einigen Wochen draußen auf dem Parkplatz diese Demonstranten vom Tabernakel des Heiligen Wortes hatten. Aber die sind seitdem nur einmal wiedergekommen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass einer von denen so einen… war das etwa ein Molotowcocktail?«
»Woher wissen Sie das, Sookie?«
»Na ja, erstens lese ich Bücher. Und zweitens erzählt Terry hin und wieder von Waffen, auch wenn er sonst nicht viel über den Krieg redet.« Terry Bellefleur, Detective Andy Bellefleurs Cousin, war ein mit Orden dekorierter, aber traumatisierter Vietnamveteran. Er machte sauber im Merlotte’s, wenn alle gegangen waren, und vertrat Sam ab und zu mal hinter dem Tresen. Manchmal hing er auch nur in der Bar herum und sah zu, wie die Leute kamen und gingen. Terry hatte nicht allzu viele Freunde.
Als Bud endlich zufrieden war, gingen Eric und ich zu meinem Auto. Er nahm mir den Schlüssel aus den zitternden Händen. Ich stieg an der Beifahrerseite ein. Er hatte ja recht. Ich sollte besser erst wieder fahren, wenn ich mich von meinem Schock erholt hatte.
Eric hatte viel mit dem Handy telefoniert, während ich mit Bud gesprochen hatte, sodass ich nicht total überrascht war, als vor meinem Haus ein Auto stand. Es war Pams Wagen, und sie saß nicht allein darin.
Eric fuhr an die Rückseite, wo ich immer parke, und ich sprang sofort aus dem Auto, lief durchs Haus und schloss die Vordertür auf. Eric folgte mir gemächlichen Schrittes. Wir hatten auf der kurzen Fahrt nicht ein einziges Wort gewechselt. Er war mit seinen Gedanken woanders gewesen und immer noch schlechter Laune. Mich hatte der ganze Vorfall absolut schockiert. Erst als ich jetzt auf meine vordere Veranda trat und »Kommt herein!« rief, war ich wieder etwas mehr ich selbst.
Pam und ihr Begleiter, ein Mensch, stiegen aus. Es war ein junger Mann, vielleicht einundzwanzig, und so dünn, dass er schon ausgemergelt wirkte. Sein Haar war blau gefärbt und extrem geometrisch geschnitten, fast so, als hätte er sich eine Schachtel auf den Kopf gestülpt, sie leicht schräg versetzt, und dann an den Kanten entlang rundum die Haare abgeschnitten. Und alles, was sich dieser Form nicht gefügt hatte, war ausrasiert worden.
Ich will’s mal so nennen: ein echter Hingucker.
Pam lächelte, als sie den Ausdruck in meinem Gesicht sah, und ich setzte schleunigst eine einladendere Miene auf. Pam war schon Vampirin, seit Victoria auf dem englischen Thron gesessen hatte, und Erics rechte Hand, seit er sie von ihren Streifzügen durch Nordamerika zu sich gerufen hatte. Er war ihr Schöpfer.
»Hallo«, begrüßte ich den jungen Mann, als er durch die Haustür trat. Er war extrem nervös. Sein Blick schoss auf mich, weg von mir, zielte auf Eric und nahm dann sozusagen das Zimmer unter Beschuss, um jede Einzelheit aufzusaugen. Ein Anflug von Geringschätzung huschte über sein glatt rasiertes Gesicht beim Anblick meines unordentlichen Wohnzimmers, das bestenfalls als gemütlich durchgehen konnte, selbst wenn es aufgeräumt war.
Pam gab ihm einen Schlag auf den Hinterkopf. »Sprich, wenn du angesprochen wirst, Immanuel!«, knurrte sie. Sie stand etwas hinter ihm, sodass er nicht sehen konnte, wie sie mir zuzwinkerte.
»Hallo, Ma’am«, sagte er zu mir und trat einen Schritt vor. Seine Nase zuckte.
»Du riechst komisch, Sookie«, sagte Pam.
»Das kommt vom Feuer«, erklärte ich.
»Davon kannst du mir gleich erzählen.« Ihre hellblonden Augenbrauen schossen in die Höhe. »Sookie, dieser Mann hier ist Immanuel Earnest«, begann sie. »Er schneidet Haare im Friseursalon Death by Fashion in Shreveport. Und er ist der Bruder meiner Geliebten Miriam.«
Das war ziemlich viel Information in nur drei Sätzen. Ich bemühte mich, das alles aufzunehmen.
Eric beäugte Immanuels Frisur mit fasziniertem Abscheu. »Den hast du mitgebracht, um Sookies Haar zu richten?«, fragte er Pam. Sein Mund war zu einer sehr schmalen Linie zusammengepresst. Ich konnte spüren, wie seine Skepsis durch die Blutsbande zwischen uns pulsierte.
»Miriam sagt, er ist der Beste«, sagte Pam achselzuckend. »Meine Haare wurden schon seit hundertfünfzig Jahren nicht mehr geschnitten. Woher soll ich so was wissen?«
»Sieh ihn dir doch an!«
So langsam begann ich, mir Sorgen zu machen. Selbst wenn man die Umstände berücksichtigte, hatte Eric richtig miese Laune. »Mir gefallen seine Tattoos«, sagte ich. »Die Farben sind echt hübsch.«
Diesen Immanuel zierte nämlich nicht nur ein extremer Haarschnitt, er war auch noch von aufwendigen Tattoos übersät. Aber nirgends ein »MOM«, »BETTY BLUE« oder die üblichen nackten Damen. Stattdessen zogen sich von seinen Handgelenken bis zu den Schultern kunstvoll verschlungene, farbenfrohe Designs. Er würde, selbst wenn er nackt war, noch angezogen wirken. Und unter einem seiner dünnen Arme hielt der Friseur ein flaches Lederetui.
»Sie wollen mir also die hässlichen Teile abschneiden?«, sagte ich fröhlich.
»Die von Ihrem Haar«, erwiderte er penibel. (Ich war mir nicht sicher, ob diese besondere Beschwichtigung wirklich nötig gewesen wäre.) Er sah mich an, dann wieder zu Boden. »Haben Sie eine Art Barhocker?«
»Ja, in der Küche«, sagte ich. Als ich meine ausgebrannte Küche neu einrichtete, hatte ich aus lauter Gewohnheit auch wieder so einen hohen Hocker gekauft wie den, auf dem meine Gran während ihrer Gespräche am alten Telefon immer gehockt hatte. Das neue Telefon war schnurlos, und ich musste nicht mehr in der Küche bleiben, wenn ich es benutzte. Aber der Küchentresen hatte einfach zu fremd ausgesehen ohne einen Hocker daneben.
Meine drei Gäste folgten mir, und ich zog den Hocker mitten in den Raum. Es war so gerade eben Platz für alle, als Pam und Eric sich an die andere Seite des Küchentisches setzten. Eric starrte Immanuel auf unheilverkündende Weise finster an, und Pam wartete einfach nur darauf, dass wir sie mit einem unserer Gefühlsausbrüche unterhalten würden.
Ich kletterte auf den Hocker und setzte mich mit geradem Rücken aufrecht hin. Meine Beine schmerzten, meine Augen brannten und meine Kehle war kratzig. Doch ich zwang mich, den Friseur anzulächeln. Immanuel war richtig nervös. Und das wünscht man sich eigentlich nicht bei einem Typen mit einer scharfen Schere in der Hand.
Immanuel löste das Haargummi, das meinen Pferdeschwanz hielt. Ein langes Schweigen trat ein, während er sich den Schaden ansah. Es waren keine guten Gedanken, die er da dachte. Schließlich holte meine Eitelkeit mich ein. »Ist es sehr schlimm?«, fragte ich und bemühte mich, das Zittern in meiner Stimme zu unterdrücken. Jetzt, da ich zu Hause und in Sicherheit war, brachen die Reaktionen langsam durch.
»Ich muss ungefähr acht Zentimeter abschneiden«, sagte Immanuel so leise, als würde er mir erzählen, dass ein Verwandter todkrank sei.
Und zu meiner Schande reagierte ich ziemlich genau so, als wäre das die Neuigkeit gewesen. Ich spürte, wie mir die Tränen in die Augen traten, und meine Lippen bebten. Das ist doch lächerlich!, sagte ich zu mir selbst. Mein Blick wanderte nach links, als Immanuel sein Lederetui auf den Küchentisch legte. Er öffnete den Reißverschluss und nahm einen Kamm heraus. Außerdem waren einige, von speziellen Laschen gehaltene Scheren darin und ein Elektrorasierer mit ordentlich aufgerollter Schnur. Ein fliegender Händler der Friseurbranche: Sie brauchen einen Haarschnitt? Ich komme zu Ihnen ins Haus.
Pam schrieb mit unglaublicher Geschwindigkeit eine SMS.Sie lächelte, als wäre ihre Nachricht unglaublich lustig. Eric sah mich unverwandt an, in düstere Gedanken versunken. Die konnte ich nicht lesen, aber ich erkannte natürlich auch so, dass er irgendwie enorm unglücklich war.
Ich seufzte und richtete meinen Blick wieder geradeaus. Ich liebte Eric, aber im Augenblick wollte ich bloß, dass er sich seine Grübelei sonst wohin steckte. Ich spürte, wie Immanuel mein Haar anfasste und mich zu kämmen begann. Es fühlte sich seltsam an, wenn er die Spitzen erreichte. Ein kleines Ziehen und ein komisches Geräusch verrieten mir jedes Mal, dass wieder etwas von meinem verbrannten Haar zu Boden gefallen war.
»Dieser Schaden ist nicht mehr zu reparieren«, murmelte Immanuel. »Ich werde es abschneiden. Dann waschen Sie es. Und dann schneide ich noch mal nach.«
»Diesen Job machst du keine Minute länger«, sagte Eric plötzlich, und Immanuel hörte sofort mit dem Kämmen auf, bis er begriff, dass Eric mit mir sprach.
Ich hätte am liebsten etwas Schweres gepackt und damit nach meinem Schatz geworfen. Und direkt seinen hübschen, sturen Kopf getroffen. »Darüber reden wir später«, sagte ich, ohne ihn anzusehen.
»Was wird als Nächstes passieren? Du bist zu angreifbar!«
»Darüber reden wir später.«
Im Augenwinkel sah ich, wie Pam den Kopf abwendete, damit Eric ihr süffisantes Grinsen nicht bemerkte.
»Braucht sie nicht irgendwas zum Umhängen?«, fuhr Eric Immanuel knurrend an. »Um ihre Kleider zu bedecken.«
»Eric«, mischte ich mich ein, »da ich sowieso nach Rauch und Ruß stinke und mit diesem Zeug aus dem Feuerlöscher vollgespritzt bin, dürfte es wohl kaum nötig sein, meine Kleider vor verbrannten Haaren zu schützen.« Eric schnaubte zwar nicht, aber es fehlte nicht viel. Immerhin schien er mitgekriegt zu haben, dass ich sein Verhalten absolut nervtötend fand, denn nun hielt er den Mund und riss sich am Riemen.
Was für eine unglaubliche Erleichterung.
Immanuels Hände waren erstaunlich ruhig für jemanden, der zusammen mit zwei Vampiren und einer angekokelten Kellnerin in eine Küche gepfercht war, und er kämmte mich, bis mein Haar so geschmeidig war wie nur möglich. Dann griff er zur Schere. Ich konnte spüren, wie der Friseur sich ganz auf seine Aufgabe konzentrierte. Immanuel war ein Meister der Konzentration, stellte ich fest, denn seine Gedanken waren ja ein offenes Buch für mich.
Es dauerte wirklich nicht lange. Die verbrannten Teile schwebten zu Boden wie traurige Schneeflocken.
»Jetzt sollten Sie duschen gehen und danach mit sauber gewaschenem, nassem Haar wiederkommen«, sagte Immanuel. »Dann werde ich alles auf eine Länge schneiden. Wo haben Sie Besen und Schaufel?«
Ich erklärte ihm rasch, wo er beides finden würde, und dann entschwand ich in mein Schlafzimmer und ging einmal quer hindurch in mein privates Bad. Einen Augenblick lang fragte ich mich, ob Eric mir wohl folgen würde, denn von früheren Erfahrungen her wusste ich, wie gut ihm meine Dusche gefiel. Doch so, wie ich mich gerade fühlte, wäre es sehr viel besser, wenn er in der Küche bleiben würde.
Ich zog meine stinkenden Kleider aus und ließ das Wasser so heiß laufen, wie ich es ertragen konnte. Es tat richtig gut, in die Duschwanne zu steigen und mich von der Hitze und Feuchtigkeit umhüllen zu lassen. Als das warme Wasser auf meine Beine traf, durchfuhr mich ein stechender Schmerz. Eine Zeit lang konnte ich weder Dankbarkeit noch irgendeine Art Freude empfinden. Ich erinnerte mich bloß noch daran, was für eine Angst ich gehabt hatte. Doch als ich auch das überstanden hatte, war mir ein Gedanke gekommen.
Diese Gestalt, die ich mit der Flasche in der Hand auf das Merlotte’s hatte zurennen sehen– ich war mir zwar nicht vollkommen sicher, aber ich hatte den Verdacht, dass es kein Mensch gewesen war.
Kapitel 2
Ich stopfte meine verrußten, stinkenden Klamotten in den Wäschekorb im Bad. Die würde ich erst mal in Seifenlauge einweichen müssen, ehe ich auch nur versuchen könnte, sie zu waschen. Aber ich würde sie natürlich nie aussortieren, bevor sie sauber waren und ich einschätzen konnte, wie groß der Schaden wirklich war. Die Zukunft meiner schwarzen Arbeitshose beurteilte ich allerdings schon jetzt nicht allzu optimistisch. Ich hatte gar nicht bemerkt, dass sie leicht angekokelt war, bis ich sie über meine empfindlichen Oberschenkel herunterzog und sah, dass meine Haut knallrot war. Erst da erinnerte ich mich wieder daran, wie ich im Merlotte’s an mir herabgeblickt hatte und meine Schürze brennen sah.
Ich untersuchte meine Beine und stellte fest, dass es viel schlimmer hätte kommen können. Die Flammen hatten zwar meine Schürze erfasst, aber nicht meine Hose, und Sam war sehr schnell gewesen mit dem Feuerlöscher. Jetzt wusste ich erst zu schätzen, dass er die Feuerlöscher jedes Jahr überprüfte, sie bei der Feuerwehr neu auffüllen ließ und auch die Rauchmelder hatte anbringen lassen, denn einen Moment lang stand mir vor Augen, was alles hätte passieren können.
Tief durchatmen, sagte ich zu mir selbst, als ich meine Beine trocken tupfte. Tief durchatmen. Denk dran, wie gut es sich anfühlt, sauber zu sein. Es hatte sich wunderbar angefühlt, den Ruß abzuwaschen, mein Haar zu shampoonieren und all den Gestank wegzuspülen.
Ich konnte gar nicht aufhören, darüber nachzugrübeln, was ich nun eigentlich gesehen hatte, als ich aus dem Fenster des Merlotte’s blickte: eine kleine Gestalt, die auf das Gebäude zurannte und in der einen Hand etwas hielt. Und auch wenn ich nicht zu sagen wusste, ob es sich bei der Gestalt um einen Mann oder eine Frau gehandelt hatte, war ich mir in einem doch sicher: Die Gestalt war ein Supra gewesen, und zwar vermutlich ein zweigestaltiges Geschöpf. Eine Vermutung, die mir immer mehr zur Gewissheit wurde, als ich daran dachte, wie schnell und beweglich dieses Etwas gewesen war und wie kraftvoll und zielgenau der Wurf– die Flasche war mit einer solchen Wucht aufs Fenster getroffen, dass die Scheibe zerborsten war. Das hätte ein Mensch nicht so leicht fertiggebracht.
Ich konnte mir natürlich nicht hundertprozentig sicher sein. Aber Vampire hantierten nun mal nicht allzu gern mit Feuer. Irgendetwas an der Existenzform der Vampire sorgte dafür, dass sie besonders schnell in Flammen aufgingen. Nur ein äußerst selbstsicherer oder äußerst rücksichtsloser Fangzahn wäre bereit, einen Molotowcocktail als Waffe zu benutzen.
Schon allein aus dem Grund hätte ich darauf wetten mögen, dass der Attentäter ein zweigestaltiges Geschöpf war– ein Gestaltwandler oder ein Wergeschöpf irgendeiner Art. Klar, es gab natürlich auch noch andere Supras wie Elfen, Kobolde und Dämonen, und alle waren schneller als die Menschen. Der ganze Anschlag war leider viel zu rasant passiert, als dass ich die Gedanken des Angreifers hätte ausloten können. Das aber wäre notwendig gewesen, um irgendetwas zu erkennen. Vampire zum Beispiel sind Punkte tiefer Stille für mich, eine Art Loch im Äther, und auch die Gedanken der Elfen kann ich nicht lesen, obwohl es da große Unterschiede in den Hirnmustern gibt. Die Gedanken einiger zweigestaltiger Geschöpfe sind ziemlich genau zu entziffern, die anderer wiederum gar nicht, aber ihre Gehirne sehe ich immer als warme, viel beschäftigte Masse vor mir.
Normalerweise bin ich eine entscheidungsfreudige Person. Doch als ich mich jetzt abtrocknete und mein nasses Haar kämmte (was sich seltsam anfühlte, weil ich mit dem Kamm soviel schneller durch war), fragte ich mich, ob ich meine Vermutungen Eric tatsächlich anvertrauen sollte. Wenn ein Vampir jemanden liebt– oder auch nur als seinen Besitz betrachtet–, kann sein Beschützerwille ziemlich drastisch ausgeprägt sein. Eric zog gern in den Kampf und tat sich oft schwer damit, die taktische Klugheit eines Schrittes abzuwägen gegen seinen instinktiven Wunsch, das Schwert zu schwingen. Ich rechnete zwar nicht damit, dass er die Gemeinschaft der zweigestaltigen Geschöpfe gleich angreifen würde, doch angesichts seiner gegenwärtigen Laune schien es mir klüger zu sein, meine Vermutungen zumindest noch so lange für mich zu behalten, bis ich einen Beweis, welcher Art auch immer, hatte.
Ich zog eine Schlafanzughose und ein T-Shirt der »Lady Falcons« von Bon Temps an, meines ehemaligen Softballteams, und warf noch einen sehnsüchtigen Blick aufs Bett, ehe ich mein Schlafzimmer verließ und mich wieder der seltsamen Truppe in meiner Küche anschloss. Eric und Pam tranken gerade jeder eine Flasche synthetisches Blut, das ich immer im Kühlschrank habe, und Immanuel nippte an einer Coke. Ich war entsetzt, dass ich ihnen gar keine Erfrischungen angeboten hatte, doch Pam sah mich gelassen an, als sie meinen Blick auffing. Sie hatte sich um alles gekümmert. Dankbar nickte ich ihr zu, und zu Immanuel sagte ich: »Ich bin jetzt so weit.« Er erhob seine magere Gestalt aus dem Küchenstuhl und deutete auf den Hocker.
Diesmal packte mein neuer Friseur ein dünnes Plastikcape aus, das nur die Schultern bedeckte, und band es mir um den Hals. Er kämmte mein Haar selbst noch einmal durch und betrachtete es dabei aufmerksam. Ich versuchte, Eric mit einem Lächeln zu versichern, dass das alles gar nicht so schlimm sei. Doch ich war nicht mit dem Herzen dabei. Pam starrte mit finsterem Blick auf ihr Handy. Eine SMS schien ihr ganz und gar nicht zu gefallen.
Immanuel hatte die Zeit offenbar damit überbrückt, Pams Haar zu frisieren. Ihre goldblonde Mähne, die ganz glatt und seidig war, wurde von einem blauen Haarband aus dem Gesicht gehalten. Sehr viel ähnlicher konnte man Alice im Wunderland nicht mehr sehen. Pam trug zwar kein blaues Kleid mit weit ausgestelltem Rock und weißer Schürze, aber immerhin etwas Hellblaues: ein Etuikleid, vielleicht aus den 1960er-Jahren, und Pumps mit acht Zentimeter hohen Absätzen. Und eine Perlenkette.
»Was ist los, Pam?«, fragte ich, nur weil das Schweigen in meiner Küche langsam lastend wurde. »Hat dir jemand eine unverschämte SMS geschickt?«
»Nichts ist los«, knurrte sie, und ich hatte Mühe, nicht zurückzuzucken. »Es passiert absolut überhaupt gar nichts. Victor ist immer noch unser Boss. Unsere Position bessert sich nicht die Bohne. Und auf unsere Anfragen bekommen wir keine Antworten. Wo ist Felipe? Wir brauchen ihn.«
Eric funkelte sie wütend an. Wow, Aufruhr im Paradies. Ich hatte die beiden noch nie in einem ernsthaften Streit erlebt.
Pam war Erics einziges »Kind«, das ich je kennengelernt habe. Sie hatte ihr eigenes Leben gelebt, nachdem sie ihre ersten paar Jahre als Vampirin mit ihm verbracht hatte. Es war ihr gut ergangen, aber sie hatte mir erzählt, dass sie recht gern zu Eric zurückgekehrt war. Er hatte Pam wieder zu sich gerufen, weil er einen zuverlässigen Stellvertreter brauchte, nachdem die einstige Vampirkönigin von Louisiana ihn zum Sheriff von Bezirk Fünf ernannt hatte.
Die angespannte Atmosphäre in der Küche legte sich auch auf Immanuel, der sich immer weniger auf seinen Job zu konzentrieren vermochte… und der bestand darin, mein Haar zu schneiden.
»Entspannt euch, Leute«, sagte ich entschlossen.
»Was hat es eigentlich mit all dem Krempel da draußen in deiner Auffahrt auf sich?«, fragte Pam, und ihr britischer Akzent schien deutlich durch. »Ganz zu schweigen von deinem Wohnzimmer und der Veranda. Willst du einen Garagenverkauf aufziehen?« Man konnte geradezu hören, wie stolz sie darauf war, das richtige Vokabular zu kennen.
»Fast fertig«, murmelte Immanuel, der in Reaktion auf die wachsende Anspannung immer hektischer mit seiner Schere hantierte.
»Das hat alles in meiner Dachkammer gestanden, Pam«, erwiderte ich, froh, über etwas so Alltägliches und (wie ich hoffte) Beruhigendes reden zu können. »Claude und Dermot haben mir beim Ausmisten geholfen. Und morgen Vormittag will ich mit Sam zu einem Antiquitätenhändler fahren– na ja, jedenfalls hatten wir das vor. Ich weiß nicht, ob Sam dazu jetzt noch Zeit hat.«
»Siehst du!«, rief Pam Eric zu. »Sie lebt mit anderen Männern zusammen. Sie geht mit anderen Männern einkaufen. Was für ein Ehemann bist du eigentlich?«
Eric war mit einem Satz über den Küchentisch gesprungen, die Hände nach Pams Hals ausgestreckt.
Und schon im nächsten Augenblick wälzten sich die beiden in dem ernsthaften Versuch, sich gegenseitig zu verletzen, auf dem Boden. Ich wusste nicht, ob Pam tatsächlich fähig war, Eric zu verletzen, da sie ja sein Geschöpf war. Aber sie verteidigte sich wie eine Wilde mit voller Kraft, und da gibt es feine Unterschiede bei Vampiren.
Ich konnte nicht mehr schnell genug vom Hocker klettern, um nicht in Mitleidenschaft gezogen zu werden. Es schien unvermeidlich, dass sie in den Hocker hineinkrachen würden, und genau das passierte im nächsten Augenblick natürlich auch schon. Ich kippte um und landete bei den beiden auf dem Boden, nicht ohne dabei mit der Schulter noch gegen den Küchentresen zu knallen. Immanuel machte klugerweise einen Satz rückwärts und ließ auch seine Haarschere nicht fallen, ein Segen für uns alle. Einer der Vampire hätte sie sich vielleicht als Waffe geschnappt und ihre glänzenden Schneiden in irgendeinem meiner Körperteile versenkt.
Mit erstaunlicher Kraft packte Immanuel mich plötzlich am Arm, riss mich hoch und weg von den beiden. Wir taumelten aus der Küche bis ins Wohnzimmer, wo wir keuchend mitten in dem vollgestellten Raum stehen blieben und aufmerksam die Diele hinunterspähten für den Fall, dass die Kämpfhähne uns folgen sollten.
Ich hörte ein Poltern und Krachen und ein anhaltendes, etwas verwirrendes Geräusch, das ich schließlich als ein Knurren identifizierte.
»Klingt, als würden zwei Pitbulls aufeinander losgehen«, meinte Immanuel, der erstaunlich gelassen blieb. Ich war froh, einen Menschen um mich zu haben.
»Keine Ahnung, was mit den beiden los ist«, erwiderte ich. »So habe ich sie noch nie erlebt.«
»Pam ist frustriert«, erklärte er mit einer Vertrautheit, die mich überraschte. »Sie möchte gern ein eigenes ›Kind‹ erschaffen, aber aus irgend so einem Vampirgrund geht das nicht.«
Ich konnte mein Erstaunen nicht verhehlen. »Und das alles wissen Sie– woher? Tut mir leid, ich will nicht unhöflich klingen, aber ich habe ziemlich viel mit Pam und Eric zu tun, und Sie habe ich bisher noch nie gesehen.«
»Pam ist mit meiner Schwester zusammen.« Immanuel schien sich aus meiner Direktheit nichts zu machen, ein Glück. »Mit meiner Schwester Miriam. Meine Mutter ist religiös«, erzählte er. »Und etwas verrückt. Die Sache ist die, meine Schwester ist krank und wird immer kränker, und Pam möchte Mir sehr gern herüberholen, bevor es noch schlimmer wird mit ihr. Doch wenn Pam sich nicht langsam beeilt, wird Mir bis in alle Ewigkeit bis auf die Knochen abgemagert sein.«
Ich wusste kaum, was ich sagen sollte. »Welche Krankheit hat Ihre Schwester denn?«, fragte ich.
»Leukämie«, sagte Immanuel. Obwohl er seine gelassene Fassade aufrechterhielt, konnte ich den Schmerz, die Angst und die Sorge in seinen Gedanken lesen.
»Daher kennt Pam Sie also.«
»Ja. Aber sie hatte recht vorhin. Ich bin wirklich der beste Friseur in Shreveport.«
»Das glaube ich Ihnen gern«, erwiderte ich. »Und das mit Ihrer Schwester tut mir ehrlich leid. Man hat Ihnen wohl nicht erzählt, warum Pam Miriam nicht herüberholen kann?«
»Nein, aber ich glaube nicht, dass Eric das Problem ist.«
»Vielleicht nicht.« Aus der Küche war ein Schrei und ein Klappern zu hören. »Ich frage mich, ob ich da nicht besser eingreifen sollte.«
»Das würde ich an Ihrer Stelle bleiben lassen.«
»Na, hoffentlich haben die beiden wenigstens vor, für die Renovierung meiner Küche aufzukommen«, sagte ich und tat mein Bestes, um eher wütend zu klingen als ängstlich.
»Er könnte ihr nämlich einfach befehlen, aufzuhören, wissen Sie, und das müsste sie dann tun.« Immanuel klang fast beiläufig.
Genau, damit hatte er absolut recht. Als Erics Geschöpf musste Pam seinem direkten Befehl unbedingt gehorchen. Doch aus irgendeinem Grund sprach Eric das magische Wort nicht. Die beiden machten lieber meine Küche dem Erdboden gleich. Als mir dämmerte, dass Eric das Ganze einfach beenden konnte, wann immer er wollte, verlor ich selbst die Beherrschung.
Obwohl Immanuel noch vergeblich nach meinem Arm griff, stapfte ich barfuß ins Badezimmer in der Diele, nahm den großen Henkelkrug, den Claude immer benutzte, wenn er die Badewanne sauber machte, füllte ihn mit kaltem Wasser und ging zurück in die Küche. (Ich war ein bisschen wackelig auf den Beinen nach dem Sturz vom Hocker, aber es ging schon.) Eric lag auf Pam drauf und drosch auf sie ein. Er hatte Blut im Gesicht. Pam hatte die Hände in seine Schultern verkrallt, um ihn auf Abstand zu halten. Sie fürchtete wohl, dass er sie sonst beißen würde.
Ich suchte mir eine günstige Position und schätzte die Gießkurve ab. Als ich sicher war, dass es klappen würde, schüttete ich das gesamte kalte Wasser auf die sich prügelnden Vampire.
Und wieder hatte ich ein Feuer gelöscht, wenn auch ein ganz anderes diesmal.
Pam kreischte wie ein Teekessel, als das kalte Wasser ihr übers Gesicht lief, und Eric schrie etwas in einer Sprache, die ich zwar nicht kannte, aber es klang ziemlich unflätig. Den Bruchteil einer Sekunde lang meinte ich, jetzt würden sie sich beide auf mich stürzen. Breitbeinig stand ich da, den leeren Krug in der Hand, und erwiderte ihre wütenden Blicke genauso wütend. Dann machte ich auf dem Absatz kehrt und ging davon.
Immanuel staunte nicht schlecht, als er mich unversehrt und in einem Stück zurückkommen sah. Offensichtlich wusste er nicht, ob er mich nun bewundern oder für einen Dummkopf halten sollte.
»Sie sind verrückt, Lady«, sagte er, »aber immerhin sieht Ihr Haar wieder gut aus. Sie sollten in den Salon kommen und sich noch ein paar Strähnchen machen lassen. Ich gebe Ihnen einen Preisnachlass. Bei mir kostet es gewöhnlich mehr als irgendwo sonst in Shreveport.« Das fügte er ganz sachlich hinzu.
»Oh. Danke. Ich werd’s mir überlegen.« Erschöpft von meinem langen Tag und meinem Wutausbruch– Wut und Angst laugen einen echt aus–, setzte ich mich in eine leere Ecke meines Sofas und winkte Immanuel zum Lehnstuhl hinüber, dem einzigen Sessel im Zimmer, der nicht mit Krempel aus der Dachkammer belegt war.
Wir schwiegen und lauschten, ob die Prügelei in der Küche weitergehen würde. Doch der Lärm blieb zum Glück aus. Nach einer Weile sagte Immanuel mit entschuldigender Miene: »Ich hätte mich ja längst auf den Weg gemacht, wenn ich nicht mit Pam hier wäre.«
»Kein Problem«, erwiderte ich und unterdrückte ein Gähnen. »Mir tut nur leid, dass ich nicht in die Küche kann. Ich könnte Ihnen noch etwas zu trinken oder zu essen anbieten, wenn die beiden da endlich herauskommen würden.«
Er schüttelte den Kopf. »Die Coke hat gereicht, danke. Ich bin kein großer Esser. Was, glauben Sie, tun die beiden da gerade? Ficken?«
Wie bitte? Man sah mir meinen Schock hoffentlich nicht allzu deutlich an. Ja, stimmte, Pam und Eric waren, gleich nachdem er sie zur Vampirin gemacht hatte, ein Liebespaar gewesen. Sie hatte mir sogar einmal erzählt, wie sehr sie diese Phase ihrer Beziehung genossen hatte, auch wenn sie über die Jahrzehnte hinweg herausfand, dass sie mehr auf Frauen stand. Das war mal das eine. Und außerdem war Eric inzwischen mit mir verheiratet, zwar auf so unverbindliche Vampirart, aber ich war mir ziemlich sicher, dass sogar die Ehe von Vampir und Mensch den Sex mit einer anderen in der Küche der Ehefrau ausschloss, oder?
Andererseits…
»Pam steht normalerweise auf Frauen.« Ich bemühte mich, sicherer zu klingen als ich eigentlich war. Wenn ich daran dachte, dass Eric mit einer anderen zusammen war, hätte ich ihm am liebsten all sein schönes blondes Haar ausgerissen. Büschelweise. Mitsamt der Wurzel.
»Sie ist zumindest bisexuell«, warf Immanuel ein. »Meine Schwester und Pam sind auch schon zusammen mit einem Mann ins Bett gegangen.«
»Ah ja. Okay.« In einer Art Stopp-Geste hielt ich eine Hand in die Höhe. Manche Dinge wollte ich mir nicht einmal vorstellen.
»Sie sind ein bisschen prüde für jemanden, der etwas mit einem Vampir hat«, bemerkte Immanuel.
»Ja. Ja, das bin ich.« Mit diesem Adjektiv hätte ich mich selbst nie beschrieben, aber im Vergleich zu Immanuel– und Pam– war ich wohl definitiv sittenstreng.
Ich selbst sah darin allerdings lieber einen höher entwickelten Sinn für Privatsphäre.
Schließlich kamen auch Pam und Eric zu uns ins Wohnzimmer, und Immanuel und ich setzten uns angespannt