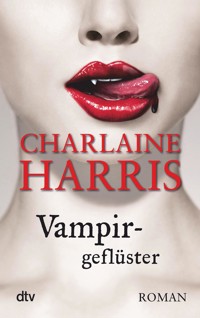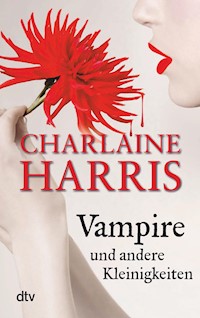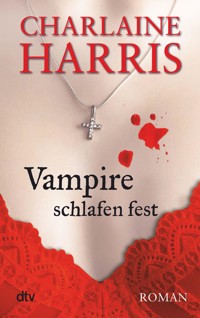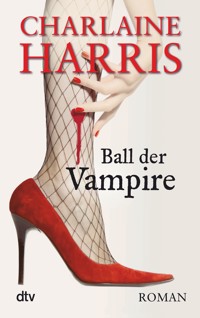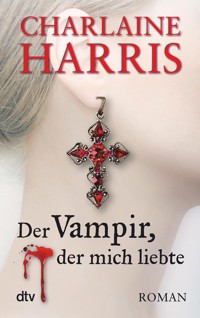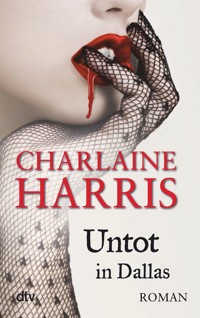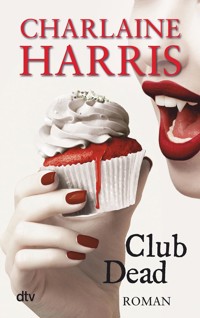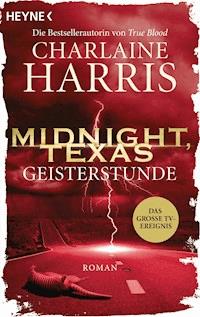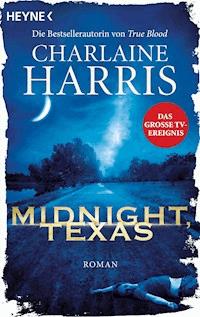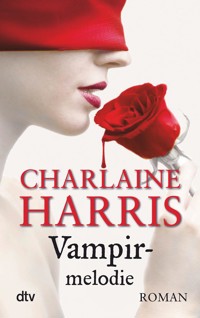9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Midnight, Texas-Serie
- Sprache: Deutsch
Mysteriöses ereignet sich in Midnight, in Texas: Aus dem örtlichen Pfandleihhaus verschwinden Waffen, nur um später an den Schauplätzen dramatischer Selbstmorde wieder aufzutauchen. Vampir Lemuel ist sofort klar, dass es hier nicht mit rechten Dingen zu geht. Bei seinen Recherchen findet er heraus, das die rätselhafte Selbstmordserie etwas mit Midnight selbst zu tun hat. Denn es gibt einen Grund, warum sich Hexen, Vampire, Werwölfe und Schattengeschöpfe aller Art in Midnight so wohl fühlen. Einen Grund, der selbst einem gestanden Vampir die Haare zu Berge stehen lässt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 536
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Das Buch
Eines Abends Anfang Oktober nimmt sich die obdachlose Tabby Ann Masterson direkt unter der Ampel der einzigen Straßenkreuzung Midnights das Leben. Eine Woche später erschießt sich ein Durchreisender an genau derselben Stelle. Die Bewohner Midnights sind zwar an allerhand gewöhnt, aber zwei Selbstmorde innerhalb von so kurzer Zeit, das kann nicht mit rechten Dingen zugehen. Der Vampir Lemuel und seine Vertraute, die geheimnisvolle und betörend schöne Olivia Charity, wollen der Sache auf den Grund gehen. Bei ihren Recherchen finden sie heraus, dass die rätselhaften Selbstmorde etwas mit Midnight selbst zu tun haben. Denn es gibt einen Grund, warum sich Hexen, Vampire, Werwölfe und Schattengeschöpfe aller Art in Midnight so wohl fühlen. Einen Grund, der selbst einem gestandenen Vampir wie Lemuel die Haare zu Berge stehen lässt …
Die MIDNIGHT, TEXAS-Serie:
Erster Band: Midnight-Texas
Zweiter Band: Geisterstunde
Dritter Band: Nachtschicht
Die Autorin
Charlaine Harris wuchs im Mississippi-Delta auf und begann schon in frühen Jahren mit dem Schreiben. Sie ist eine der international erfolgreichsten Fantastikautorinnen der USA. Ihre bekannteste Romanserie True Blood, um die hellsichtige Kellnerin Sookie Stackhouse, wurde als große TV-Serie verfilmt. Charlaine Harris lebt mit ihrer Familie in Arkansas.
Mehr über Charlaine Harris und ihre Werke erfahren Sie auf:
www.charlaineharris.com
Charlaine Harris
MIDNIGHT, TEXAS
NACHTSCHICHT
Roman
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Titel der amerikanischen Originalausgabe
NIGHTSHIFT
Deutsche Übersetzung von Sonja Rebernik-Heidegger
Deutsche Erstausgabe 11/20189
Redaktion: Diana Mantel
Copyright © 2016 by Charlaine Harris
Copyright © 2018 der deutschsprachigen Ausgabe und der Übersetzung by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung: Das Illustrat GbR, München
Coverillustration: Patrick Knowles
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN: 978-3-641-22088-4V002
www.heyne.de
Für die Menschen, die mich all die Jahre unterstützt haben: Paula Woldan, mein Agent Joshua Bilmes (Los, JABberwocky!), Steve Fisher und Debbie Deuble-Hille, meine Vertreter an der Westküste und Agenten bei der APA, meine Website-Moderatoren VK, LB, MS und ME (ihr wisst, dass ihr gemeint seid), das wunderbare Team von Penguin (damals und heute) – und vor allem mein Mann Hal.
Der Selbstmörder taucht Anfang Oktober auf.
Es ist ein Mann mittleren Alters mit einem ungepflegten Bart. Er parkt seinen ramponierten Pick-up direkt vor dem Midnight Hotel, und die von sechs Uhr abends bis Mitternacht dort arbeitende Rezeptionistin – eine junge Studienanfängerin namens Marina Desoto – erzählt Deputy Anna Gomez später, dass sie zuerst davon ausging, dass er sich nur ein Zimmer nehmen wollte. Wobei Marina verschweigt, dass sie sogar ein wenig aufgeregt war, da in den paar Monaten, die sie bereits im Hotel arbeitet, gerade einmal sechs Leute während ihrer Schicht um ein Zimmer baten.
Doch Marinas Hoffnungen auf einen neuen Hotelgast werden gleich darauf zerschlagen.
Sie beobachtet durch die Glastür, wie der Mann aus dem Pick-up taumelt, »als wäre er betrunken«, wie sie später Deputy Gomez und Sheriff Arthur Smith zu Protokoll gibt.
Und nachdem Gomez Marinas Familie kennt, ist ihr durchaus klar, dass die junge Frau mit dem Verhalten betrunkener Mitmenschen mehr als vertraut ist.
»Was ist dann passiert?«, fragt Deputy Gomez.
»Er ging irgendwie komisch. Ganz schräg, als würde ihn ein starker Magnet zur Mitte der Kreuzung ziehen, und dann hat er …« Marina verstummt, und Tränen laufen über ihre Wangen. Sie hebt die Hand, presst sich zwei ausgestreckte Finger an die Stirn, krümmt den Daumen und tut so, als würde sie den Abzug einer imaginären Pistole drücken.
»Und das konnten Sie wirklich von der Rezeption aus sehen?«, fragt Smith skeptisch, da er den Blickwinkel bereits kontrolliert hat.
»Nein, von der Rezeption aus hat man nicht die ganze Kreuzung im Blick«, erwidert Marina hastig, obwohl es nicht so aussieht, als hätte sie die wahre Bedeutung der Frage begriffen. »Ich bin aufgestanden und zur Tür gegangen, um sie zu verschließen, weil er sich so seltsam verhalten hat.«
»Das war sehr schlau«, lobt Gomez. »Also, hatte er die Waffe bereits in der Hand, als er auf die Kreuzung zuging?«
»Nein, er zog sie erst dort aus seinem Hosenbund. Und dann hat er sich in den Kopf geschossen.«
Gomez zwingt sich, ihren Blick weiter auf Marina zu richten, obwohl er immer wieder von dem dunklen Bündel angezogen wird, das zusammengesackt auf der Straße liegt. Daneben wartet bereits ein Krankenwagen, der die Leiche in die Gerichtsmedizin bringen soll.
»Hat er vorher noch etwas gesagt? Oder haben Sie vielleicht gesehen, dass er telefoniert hat?«, fragt Smith, obwohl er die Antworten auf diese Fragen im Grunde bereits kennt. Er hat vorhin ein billiges Mobiltelefon in der Brusttasche des Mannes entdeckt.
»Nein, Sir«, erwidert Marina. »Er ist bloß ausgestiegen und hat sich erschossen.« Sie beginnt erneut zu weinen, und Deputy Gomez tätschelt ihr seufzend den Rücken.
Anna Gomez konnte Midnight noch nie leiden, und in ihren Augen sind die Leute, die hier wohnen, solange schuldig, bis sie ihr das Gegenteil bewiesen haben, ganz egal, was ihr Vorgesetzter dazu sagt. Doch nicht einmal Gomez kann den Stadtbewohnern die Schuld für diesen Selbstmord in die Schuhe schieben – obwohl sie es nur allzu gerne getan hätte.
Gomez gibt dem Prickeln nach, das sie plötzlich verspürt, und dreht sich um – und bemerkt, dass alle Blicke auf sie gerichtet sind. Die Bewohner Midnights sind nacheinander aus ihren Häusern getreten und beobachten nun aufmerksam, was in ihrer Stadt vor sich geht. Ihre Reaktion ist vermutlich vollkommen natürlich, wenn man bedenkt, dass mitten in der Nacht plötzlich Sirenen losheulten und das Blaulicht der Einsatzfahrzeuge aufblitzte, aber deshalb fühlt sich Gomez noch lange nicht wohler dabei.
Midnight und alle Leute, die hier wohnen, sind ihr einfach unheimlich. Wobei sie ihnen zugutehalten muss, dass niemand näher kommt, um Fragen zu stellen oder einen letzten Blick auf die Leiche zu werfen.
Dabei kommt Anna Gomez allerdings kein einziges Mal in den Sinn, dass jeder einzelne Stadtbewohner schon ganz genau weiß, wie eine Leiche aussieht.
1
Am nächsten Abend trafen sich die Bewohner Midnights in Bobo Winthrops Pfandleihhaus, in dem dieser tagsüber selbst auch arbeitete.
Der Laden befand sich in einem sehr alten Gebäude, dessen Holzdielen freundlich knarrten, und bot die seltsamsten Dinge zum Verkauf. Im weitläufigen Eingangsbereich standen zum Beispiel zahllose Stühle jeglichen Alters und in allen erdenklichen Farben und Ausführungen, sodass er sich als gemütlicher Treffpunkt für eine Lagebesprechung der Stadtbewohner geradezu anbot. An der linken Wand neben dem Eingang war ein Ladentisch mit einem Barhocker zu sehen, auf dem Bobo normalerweise saß, wenn Kunden im Laden waren.
Wenn gerade niemand da war, bevorzugte Bobo allerdings seinen mit Samt bezogenen Lieblingslehnstuhl. Der war zwar ziemlich alt und bereits ein wenig durchgesessen, aber Bobo fand ihn trotzdem sehr bequem und nebenbei auch noch hübsch. Er hatte ihn so gedreht, dass er den ganzen Laden im Blick hatte – von den überladenen Regalen, die die seltsamsten Hinterlassenschaften der menschlichen Spezies beherbergten, bis zu den Schaukästen, in denen es glänzte und glitzerte. Es gab zum Beispiel ein ganzes Regal mit verschiedensten Schleifmaschinen, während sich in einem anderen unzählige Kaugummiautomaten aneinanderdrängten. Und natürlich war da auch noch der Schmuck – egal ob echt oder eindeutig unecht.
In einer etwas abgelegenen Ecke im hinteren Teil des Ladens lagerten schließlich die Gegenstände, die möglicherweise magische Fähigkeiten besaßen. Fiji Cavanaugh, die Hexe, die gleich auf der anderen Seite der Witch Light Road wohnte, hatte ihm vor einiger Zeit vorgeschlagen, sich jedes Objekt genauer anzusehen, bevor Bobo es zum Verkauf anbot.
Heute Abend war Fiji die Erste, die den Laden betrat. Sie lächelte, als sie Bobo sah, und nahm in einem Stuhl Platz, von dem aus sie die anderen Gäste im Blick haben würde. Die Hexe war Ende zwanzig, hatte braune Augen, einen herrlich kurvigen Körper und golden schimmernde Haut – zumindest an den Stellen, die sie nicht ständig vor der texanischen Sonne schützte.
Der Rev und sein Schützling Diederik kamen als Nächstes und ließen sich direkt neben Fiji nieder. Der Rev war ein kleiner, knochiger Mann, der selten sprach und irgendwie ausgedörrt wirkte. Seine schütteren schwarzen Haare waren sorgfältig nach hinten gekämmt, und er trug jeden Tag dasselbe: ein weißes Hemd, schwarze Hosen, einen schwarzen Mantel, einen schwarzen Cowboyhut, Cowboystiefel und eine Schnürsenkelkrawatte mit einem türkisfarbenen Stein. Er hatte scheinbar irgendwann beschlossen, dass sein Leben um einiges einfacher werden würde, wenn er sich keine Gedanken über seine Kleidung machen musste.
Diederik war das genaue Gegenteil seines älteren Begleiters, denn er wirkte kerngesund und strotzte geradezu vor Lebensfreude. Der Junge sah aus wie neunzehn, und man mochte glauben, dass er wie Marina Desoto das erste Jahr aufs College ging – doch das war ein Trugschluss. Diederik hatte ein breites, olivfarbenes Gesicht, leicht schräg stehende, violette Augen und dichte, dunkle Haare. Er hatte die Statur eines Wrestlers, doch er bewegte sich unerwartet anmutig.
Bevor er sich setzte, drückte er Fiji einen Kuss auf die Wange. Sie lächelte und hoffte, dass es möglichst mütterlich wirkte. Als sie Diederik vor ein paar Monaten kennengelernt hatte, war er noch ein kleiner Junge gewesen, doch mittlerweile war ein erwachsener Mann mit einem großen Interesse am weiblichen Geschlecht aus ihm geworden.
Fijis Blick wanderte zu Olivia Charity, die außer ihr die einzige Frau in der Runde war. Hatte Olivia ebenfalls gemischte Gefühle, was Diederik betraf? Nein. Sie spürte, dass Olivia nichts dergleichen empfand. Diederik war bloß ein kleiner, unbedeutender Punkt auf Olivias Radar.
Kurz darauf wandte sich Olivia an Fiji und erzählte ihr, über wen sie gerade wirklich nachgedacht hatte. »Lemuel arbeitet noch immer an der Übersetzung der Bücher«, seufzte sie, obwohl Fiji gar nicht danach gefragt hatte. »Ich habe das Gefühl, als hätte er nichts anderes mehr im Sinn als diese verdammten alten Schinken.«
»Ach du meine Güte«, erwiderte Fiji, weil ihr einfach nichts Besseres einfiel. Sie wusste zwar, dass Lemuel so hoch konzentriert arbeiten konnte, aber auch sie hatte ihn noch nie so erlebt. Die Bücher, von denen die Rede war, waren jahrzehntelang im Pfandleihhaus versteckt gewesen – und genauso lange hatte Lemuel nach ihnen gesucht. Irgendwann hatte Lemuel das Pfandleihhaus an Bobo verkauft, wobei er weiterhin die Nachtschicht im Laden übernahm. Bobo hatte die Bücher zwar durch Zufall gefunden, doch er hatte nichts von ihrer Wichtigkeit geahnt und sie mit in seine Wohnung genommen, um sie sich eines Tages genauer anzusehen. Inzwischen hatte Lemuel erkannt, dass er die Sprache, in der eines der Bücher verfasst war, nicht beherrschte, und natürlich war ausgerechnet dieses Buch das Wichtigste von allen, obwohl Fiji keine Ahnung hatte, warum eigentlich.
Chuy Villegas und Joe Strong, die gemeinsam die Antique Gallery und das angeschlossene Nagelstudio führten, nickten Bobo freundlich zu, als sie den Laden betraten. Chuy klopfte Fiji auf die Schulter, und Diederik erhob sich und umarmte die beiden, bevor er ihren Hund am Kopf kraulte. Chuy und Joe ließen sich nebeneinander nieder, und Rasta, ihr kleiner Pekinese, wanderte schnuppernd umher, begrüßte alle Anwesenden und legte sich schließlich vor Chuys Füße.
Manfred Bernardo, ein Hellseher, der das Haus nebenan von Bobo gemietet hatte, eilte herein, wählte einen Stuhl neben seinem Vermieter und begrüßte die anderen mit einem Handzeichen oder einem kurzen Hallo. Manfred war fast genauso klein und dürr wie der Rev, und seine zahllosen Piercings erzielten einen durchaus dramatischen Effekt. Vor Kurzem hatte er außerdem begonnen, sich tätowieren zu lassen, und nun schob er den Ärmel seines T-Shirts hoch, um Fiji sein neuestes Tattoo zu zeigen. Es war ein Uroboros. Fiji schüttelte lächelnd den Kopf.
»Warum setzt du dich freiwillig solchen Schmerzen aus?«, fragte sie.
»Weil es meine Kunst von mir verlangt«, erwiderte Manfred übertrieben dramatisch, und alle lachten. Er betrachtete sein Tattoo bewundernd und meinte dann: »Außerdem finde ich, dass ich damit wie ein richtig harter Kerl aussehe.«
Keiner der Anwesenden brachte zur Sprache, warum sie heute hier zusammengekommen waren.
Sie warteten auf Lemuel, der jedoch erst kommen würde, nachdem die Sonne untergegangen war, was Anfang Oktober kurz vor halb acht geschah.
Eine der zahllosen Uhren im Pfandleihhaus schlug zur halben Stunde, und eine Minute später stieg Lemuel die Treppe von seiner Kellerwohnung zum Laden hoch. Er nahm zu Bobos Linken Platz, und mit seiner Anwesenheit hatten alle das Gefühl, dass sie vollständig waren.
Die beiden Männer waren genauso verschieden wie der Rev und Diederik. Bobo wirkte eigentlich immer entspannt, und obwohl er mittlerweile in den Dreißigern war, seine Haare langsam heller wurden und sein Blick irgendwie traurig wirkte, hätte er immer noch eine gute Figur als Model für ein zwangloses, aber teures Produkt – wie etwa eine Sonnenbrille – gemacht. Lemuel wäre hingegen niemals als Mensch durchgegangen. Dafür war seine Haut viel zu weiß, und seine Augen waren seltsam grau. Außerdem bewegte er sich nicht einmal wie ein Mensch.
»Kannte jemand von euch den Mann, der sich gestern Abend umgebracht hat?«, fragte Fiji in die kleine Runde. »Er hieß Joshua Allen, oder?«
»Das stand zumindest in den Nachrichten.«
»Also ich kannte ihn nicht«, erwiderte Lemuel, und seine raue Stimme schien überhaupt nicht zu seiner strahlend weißen Erscheinung zu passen. »Aber ich kannte die Erste.«
Einen Moment lang herrschte absolute Stille.
»Die Erste? Was meinst du damit?«, fragte Olivia.
»Die Erste, die sich dort umgebracht hat.« Lemuels blassgraue Augen wanderten von einem zum anderen. Falls er darauf wartete, dass jemand zustimmend nickte, wurde er enttäuscht.
Fiji sah ihn verblüfft an. »Wann war denn das? Vor zehn Jahren?« Manchmal verloren Vampire jegliches Zeitgefühl.
»Nein, vor einer Woche«, erwiderte Lemuel ausdruckslos. »Es geschah letzten Dienstag um drei Uhr morgens. Eine Obdachlose hat sich direkt unter der Ampel an der Kreuzung erstochen. Ich kannte sie flüchtig. Ihr Name war Tabby Ann Masterson.«
Sogar Olivia hatte nicht mit diesem Paukenschlag gerechnet. »Davon hast du mir ja gar nichts erzählt«, meinte sie.
»Ich bin nicht davon ausgegangen, dass es etwas mit Midnight zu tun hat«, erwiderte er. »Und außer mir war niemand wach.«
Lemuel schlief am Tag und arbeitete die Nacht über im Pfandleihhaus, das sich direkt an der Kreuzung zwischen der Witch Light Road und dem Davy Highway befand, die beide durch Midnight verliefen. Obwohl er die meiste Zeit hinter dem Ladentisch saß, hatte er die Kreuzung mehr oder weniger immer im Blick, und wenn er näher ans Fenster trat, sah er sie noch besser.
Fiji brachte das Schweigen der anderen ein wenig zum Schmunzeln. Selbst wenn Lemuel der Kreuzung den Rücken zugewandt hätte, als der Selbstmord passiert war, hätte ihn niemand infrage gestellt. Lemuel war der älteste Bewohner der Stadt, den mehr als hundert Jahre von den anderen trennten, und er war nicht dafür bekannt, Scherze zu machen oder sich etwas einzubilden.
»Ich kannte Tabby Ann auch«, meinte sie schließlich. »Sie kam einmal zu mir und war scheinbar auf der Suche nach meiner Großtante. Offensichtlich hat Tante Mildred ihr ab und zu etwas zu Essen gegeben, und ich habe die Tradition fortgesetzt. Doch als sie beim nächsten Mal vorbeischaute, war ich nicht zu Hause, und sie pinkelte mir einfach auf die Veranda hinter dem Haus. Ich musste einen Zauber aussprechen, um herauszufinden, wer das gewesen war, weil Mr. Snuggly nichts davon mitbekommen hatte.«
»Und was ist mit der Leiche passiert?«, fragte Manfred. »Mit der von Tabby Ann, meine ich. Was hast du mit ihr gemacht?« Es folgte erneutes Schweigen. »Moment! Tut mir leid. Das geht mich ja im Grunde genommen gar nichts an.« Er streckte die Hände aus, als wollte er die unnötigen Informationen gar nicht mehr hören.
Lemuel schenkte Manfred ein kurzes Lächeln. »Tabby Ann Masterson war obdachlos«, erklärte er. »Aber das war nicht immer so. Ich kannte sie bereits, als es ihr noch besser ging. Damals hatte sie einen Mann, Kinder und ein Zuhause. Doch mittlerweile hat sie niemanden mehr.«
»Zwei Selbstmorde«, meinte Joe Strong, der genauso aussah, wie sein Name es vermuten ließ. »An derselben Stelle, in derselben Stadt. Und es ist unmöglich, dass Joshua Allen Tabby Ann nacheifern wollte, denn er konnte ja gar nichts von ihrem Selbstmord wissen.«
»Laut dem Online-Artikel, den ich gelesen habe, war er ein Wanderarbeiter«, berichtete Manfred.
»Was bedeutet, dass er nirgendwo hingehörte und niemandem fehlen wird«, erwiderte Olivia bitter. »Aber warum hat er sich ausgerechnet in Midnight umgebracht? Könnte es ein Zufall sein?«
Das bezweifelte Fiji irgendwie – und sie sah es an den Gesichtern der anderen, dass es ihnen genauso ging.
»Es sieht eher so aus, als würde etwas Übersinnliches dahinterstecken«, meinte Bobo, der sich damit zum ersten Mal an diesem Abend zu Wort meldete. Er wirkte seit Tagen ein wenig niedergeschlagen, und keiner kannte den Grund dafür. Fiji, die stets ein Auge auf Bobo hatte, war aufgefallen, dass er sie ununterbrochen anstarrte, auch wenn sie gerade nichts sagte, und dieser Umstand machte sie nervös. Sie wusste nicht, was dahintersteckte, aber sie befürchtete, dass es nicht denselben Grund hatte, aus dem sie selbst Bobo so gerne ansah. Tatsächlich war es eine ihrer Lieblingsbeschäftigungen, Bobo anzusehen.
Fiji wischte sich die Haare aus dem Gesicht und zwang sich, sich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren. »Vermutlich ist die Kreuzung der Grund dafür«, meinte sie langsam. »Es könnte zwar ein Zufall sein, dass zwei Selbstmorde in einer Woche geschehen sind, aber diese beiden Menschen starben an derselben Stelle. Und das kann eigentlich nicht grundlos passiert sein.«
In diesem Moment hob Chuy Villegas zögerlich die Hand. Als er die Aufmerksamkeit sämtlicher Anwesenden hatte, meinte er: »Die Geister sind in Aufruhr.«
Manfred richtete sich auf und starrte Chuy an. Er war klein, dunkelhäutig und in den Vierzigern und sah damit ganz und gar nicht aus wie ein Mann, der auf so nüchterne Weise über Geister sprach. (Manfred hingegen kam dem Klischee mit seinen Piercings, den Tattoos und den platinblond gefärbten Haaren schon ziemlich nahe.)
»Du siehst Geister?«, fragte Manfred und bemühte sich, möglichst unbeeindruckt zu klingen.
»Ja, wir beide können Geister sehen«, antwortete Joe, der genauso muskulös, aber größer und hellhäutiger war als sein Partner.
»Auch Tante Mildred?«, fragte Fiji überrascht. Ihre Großtante hatte ihr das Häuschen hinterlassen, in dem sie seitdem wohnte, und Fiji hatte das Leben in Midnight angenommen, als wäre sie hier geboren worden.
»Ja, ständig«, erwiderte Chuy.
»Geht es ihr gut?« Fiji wirkte ein wenig besorgt.
»Ja, klar«, versicherte Joe ihr. »Aber in letzter Zeit sind sie und die anderen Geister aus ihrer Routine ausgebrochen.«
Manfred wollte zwar unbedingt wissen, wie die »Routine« eines Geistes aussah, aber ihm war klar, dass er damit vom Thema abgelenkt hätte, also fragte er stattdessen nur: »Darf ich euch dazu später noch ein paar Fragen stellen?«, und Chuy nickte ergeben.
»Dann spüren sie also auch die Anziehungskraft der Kreuzung«, vermutete Lemuel. »Oder etwas ist auf dem Weg nach Midnight. Etwas Schlimmes. Etwas, vor dem wir uns in Acht nehmen sollten.«
Fiji räusperte sich. »Ich glaube ehrlich gesagt, dass es bereits hier ist. Warum sollten sonst zwei Menschen an derselben Stelle sterben?«
»Können wir es töten?«, fragte Diederik aufgeregt.
»Nicht, bevor wir herausgefunden haben, worum es sich handelt und wie die Konsequenzen aussehen würden«, antwortete Joe und wandte sich an Lemuel. »Beschäftigst du dich deswegen so eingehend mit den Büchern? Weil du Informationen über etwas Übersinnliches suchst, das mit der Stadt in Verbindung steht?«
»Ich arbeite noch an der Übersetzung des letzten Buches«, erwiderte Lemuel knapp. »Diese Bücher wurden von Vampiren verfasst, und von einigen der Bücher gibt es weltweit nur noch dieses eine Exemplar. Als ich sie mir näher angesehen habe, stieß ich auf ein Buch, von dem ich glaube, dass es mir irgendwann genauere Informationen über Midnight liefern wird. Es scheint sich um eine Sammlung übersinnlicher Orte in den USA zu handeln, und es gibt sogar eine Karte. Aber um den Text lesen zu können, musste ich zuerst jemanden finden, der mir sagen konnte, in welcher Sprache er verfasst ist.«
»Wann wurde das Buch denn geschrieben?«, fragte der Rev.
»Vor einigen Hundert Jahren, weshalb es im Grunde zu den jüngsten Büchern der Sammlung gehört. Allerdings wurde es in einer Sprache verfasst, die schon seit mindestens zweitausend Jahren nicht mehr gesprochen wird.«
Der Rev nickte, und Fiji hatte keine Ahnung, ob der alte Priester zufrieden, überrascht oder verärgert war.
»Aber für welche Art Leser wäre ein solches Buch denn dann bestimmt? Und warum musst du es übersetzen?«, fragte sie neugierig. »Wenn es um die USA geht, dann sollte es doch auf Englisch sein, oder?«
»Es wurde von einer Vampirin geschrieben, die durch die Vereinigten Staaten zog, bevor ich geboren wurde.«
»Und trotzdem ist es erst ein paar Hundert Jahre alt?« Fiji verstand das Ganze einfach nicht.
»Ja. Dem Einband und dem Druckverfahren nach zu urteilen wurde es vor etwa zweihundert Jahren gedruckt. Allerdings glaube ich, dass es bereits lange Zeit vorher geschrieben wurde.«
»Aber …« Sie brach ab und beschloss, lieber in Ruhe nachzudenken als weiterzusprechen, was im Umgang mit Lemuel immer eine weise Entscheidung war.
»Die Vampirin stammte also aus einer Kultur, die es schon lange nicht mehr gibt«, vermutete Joe.
Lemuel nickte. »Ja, aus einer Kultur noch vor den Römern. Ich glaube, sie war Etruskerin. Ich habe den Entwurf eines Wörterbuches gefunden, das von einem Nachfahren der einzigen etruskischen Vampirin verfasst wurde, von der ich jemals gehört habe. Es hilft zwar, aber es geht trotzdem nur sehr langsam voran.«
Rasta winselte. Joe hob den kleinen Hund auf seinen Schoß, und Chuy streckte die Hand aus, um Rastas Kopf zu kraulen.
»Könntest du das Buch nicht zuerst mal überfliegen und nachsehen, ob du unsere Kreuzung irgendwo entdeckst?«, fragte Manfred vorsichtig. Es war eine heikle Angelegenheit, Lemuel einen Ratschlag zu erteilen.
»Ich traue mich nicht, es nur zu überfliegen, weil ich Angst habe, dass ich dann den entscheidenden Hinweis übersehe«, erwiderte Lemuel. »Die Stadt bekam ihren Namen erst am Ende des neunzehnten Jahrhunderts. Falls sie überhaupt in dem Buch vorkommt, wird sie also vermutlich nur beschrieben und nicht namentlich erwähnt. In der Zwischenzeit müssen wir auf jeden Fall die Augen nach weiteren Selbstmördern offen halten.«
»Du meinst, es kommen noch mehr?«, fragte Bobo und warf Fiji einen erschrockenen Blick zu.
»Warum sollte es nach zwei Toten enden?«, erwiderte Lemuel.
»Wenigstens sterben sie in der Nacht«, meinte Fiji, die krampfhaft versuchte, der Sache etwas Positives abzugewinnen. »Außerdem hat bis jetzt noch niemand von der ersten Toten erfahren.«
»Und das ist besser, weil …?«, fragte Manfred und sah Fiji mit hochgezogenen Augenbrauen an.
»Weil wir so die Möglichkeit haben, es zu vertuschen«, erklärte Diederik sofort. »Wie Lemuel bei dem ersten Opfer.«
»Könnt ihr euch die Schlagzeilen vorstellen?«, murmelte Bobo leise, doch die anderen hörten trotzdem jedes Wort. »›Was führt Selbstmörder in diese abgelegene texanische Kleinstadt?‹«
»Liebling, das klingt, als wollten sie dich zu größerer Eile antreiben«, meinte Olivia zu Lemuel, und der Vampir lächelte. »Ich schaffe immerhin einiges während der Schicht im Laden.«
Lemuel übernahm die Nachtschicht im Pfandleihhaus, das nur für den kurzen Zeitraum vom späten Nachmittag bis zum Sonnenuntergang und von Sonnenaufgang bis etwa neun Uhr morgens geschlossen war, wenn Bobo es wieder öffnete.
»Sollten wir vielleicht Wache schieben?«, fragte Fiji. »Um die Leute davon abzuhalten, sich umzubringen?«
Manfred verzog widerwillig den Mund, Joe und Chuy sahen einander grimmig an, und Olivia zog abwehrend die Schultern hoch. Obwohl die Bewohner Midnights an seltsame und blutige Geschehnisse gewöhnt waren, schienen sie nicht gerade begeistert.
»Ich bin mir nicht sicher, wie wir sie aufhalten sollen«, meinte Bobo schließlich, und alle sahen ihn an. »Wenn jemand dazu fest entschlossen ist, geht er doch einfach da raus und erschießt sich. So wie der Kerl gestern Abend.« Er zuckte mit den Schultern. »Ich glaube nicht, dass man ihn hätte aufhalten können.«
»Aber dieser Selbstmord geschah ohne Vorwarnung, und mittlerweile wissen wir Bescheid«, entgegnete Fiji.
»Ich bezweifle, dass wir wirklich die ganze Nacht wach bleiben sollten, weil vielleicht die Chance besteht, dass noch jemand hier haltmacht und sich umbringt«, meinte Manfred. »Es hätte schon jemand direkt neben Joshua Allen stehen müssen, um ihn davon abzuhalten. Er stieg doch offenbar aus seinem Auto, machte ein paar Schritte, zog die Waffe und Bum! Was wäre passiert, wenn ihm einer von uns in die Quere gekommen wäre? Vielleicht hätte er uns dann ebenfalls erschossen?«
Die anderen nickten zustimmend.
»Okay, dann schieben wir keine Wache«, fasste Lemuel zusammen. »Aber ich werde auf jeden Fall weiter Ausschau nach weiteren Selbstmordkandidaten auf der Kreuzung halten.«
»Habt ihr den neuen Kerl, der das Gas’n’Go übernommen hat, eigentlich schon kennengelernt?«, fragte Olivia.
Chuy und Joe lächelten. Zwischen ihrer Wohnung und der Tankstelle mit Minimarkt lag bloß ein leer stehendes Gebäude. »Ihr solltet ihn euch unbedingt ansehen«, meinte Chuy. »Er ist … etwas Besonderes.«
Fiji, die gerade dabei war, den Zauber rückgängig zu machen, der Außenstehende während ihres Treffens vom Pfandleihhaus fernhalten sollte, beendete noch schnell ihre Arbeit, bevor sie sich wieder ins Gespräch einklinkte. »Wollt ihr uns vielleicht einen kleinen Hinweis geben?«, fragte sie.
»Nein. Ihr müsst ihn euch schon selbst ansehen«, lachte Chuy. »Teacher war gestern bei uns, um die Dusche und den Wasserhahn zu reparieren, und er scheint echt froh zu sein, dass er den Job im Gas’n’Go nicht mehr machen muss.«
»Es hat ihn doch niemand dazu gezwungen«, erwiderte Joe.
»Er hat gesagt, die Bezahlung wäre gut gewesen, und er bekam regelmäßig sein Geld.« Olivia zuckte mit den Schultern. »Ein solches Angebot schlägt man nicht aus, vor allem, wenn man ein Baby zu Hause hat. Außerdem hat Madonna es genossen, immer zu wissen, wo er sich gerade aufhielt. Obwohl es ihr andererseits nicht recht war, dass er ständig nur gearbeitet hat.«
»Es überrascht mich, dass sie dir das alles erzählt hat«, meinte Joe.
Es war allgemein bekannt, dass Madonna ziemlich schweigsam war. Keiner der anderen Bewohner Midnights hatte das Gefühl, sie wirklich gut zu kennen, und egal, wie freundlich ihr Mann Teacher auch war, er erzählte nie etwas über sein Leben oder seine Vergangenheit. Es gab also genügend Gründe, die Reeds nicht zu einem Treffen wie diesem einzuladen.
»Ich werde dem Gas’n’Go sobald wie möglich einen Besuch abstatten. Es ist immer schön, ein neues Gesicht in der Stadt zu sehen«, erklärte Fiji fröhlich und erhob sich, um nach Hause zu gehen.
Joe und Chuy lachten.
Doch bevor Fiji die beiden fragen konnte, was denn an dem Neuankömmling so witzig war, betrat ein Kunde das Pfandleihhaus.
Er war sehr jung, wirkte abgezehrt und zog ein Mädchen hinter sich her. Sie war im Teenageralter, aber es war offensichtlich, dass sie schon einiges erlebt hatte – und die Art, wie ihr Blick hin und her sprang, ließ vermuten, dass sie sich die Welt mit chemischen Substanzen verschönert hatte.
»Hier«, meinte der Junge zu Lemuel und schubste ihm das Mädchen entgegen. »Ich will sie verpfänden!«
Alle Anwesenden erstarrten und warteten darauf, was Lemuel erwidern würde.
»Ich nehme keine lebenden Menschen oder Tiere als Pfand«, erklärte der Vampir freundlich. »Und falls du jetzt glaubst, dass sie mir tot lieber wäre, dann solltest du vielleicht noch mal über diese Vermutung nachdenken.«
»Dann verpfände ich eben meine Seele!« Der Junge lachte trotzig und übertrieben laut und hatte offensichtlich das Gefühl, Lemuel einen überaus großzügigen Vorschlag gemacht zu haben.
»So etwas sollte man lieber nicht sagen«, erklärte Chuy und schob sich zwischen den Stühlen näher an den Jungen heran. »Du hast nämlich nur eine Seele, und du kannst dir weder vorstellen, wie viel sie wert ist, noch, wie viel es dich kostet, sie zu verlieren. Wofür brauchst du denn das Geld?«
Der Junge schien unter Chuys strengem Blick in sich zusammenzusinken. »Ich schulde jemandem eine Menge Kohle, und ich wollte Ecstasy verkaufen, um die Kohle wieder hereinzubekommen – aber sie hat einfach das ganze Zeug genommen!«, erklärte er und versetzte dem Mädchen einen wütenden Klaps auf den Hintern.
»Du meinst, sie hat die ganzen Tabletten geschluckt?«, rief Manfred entsetzt. »Sollten wir sie dann nicht lieber in ein Krankenhaus bringen?«
Auf diese Idee wäre der Junge ganz offensichtlich selbst nicht gekommen, denn er zuckte unbekümmert mit den Schultern, als wollte er sich über solche Kleinigkeiten keine weiteren Gedanken machen. Seine eigenen Probleme schienen sehr viel wichtiger. »Also, will sie vielleicht sonst jemand von euch haben?«, fragte er. »Es macht ihr sicher nichts aus. Sie wird sich nachher nicht mal mehr daran erinnern.«
Manfred ballte die Hände zu Fäusten und machte einen Schritt auf den Jungen zu, und Fiji reagierte ganz ähnlich. Doch zu ihrer Überraschung war Chuy schneller. Eigentlich wollte er gerade seinen Schlüssel aus der Hosentasche ziehen, doch stattdessen wanderte seine Hand zum Gesicht des Jungen. Er drückte den Daumen auf dessen Stirn und murmelte etwas, an das sich Fiji allerdings später nicht mehr erinnern konnte. Im nächsten Moment wich sämtliche Spannung aus dem Körper des Jungen, und er ließ die Hand des benebelten Mädchens los, das sofort auf einen der Stühle sank.
Chuy nahm seinen Daumen von der Stirn, und der Junge stammelte: »Es tut mir leid.« Sein Blick war beinahe so leer wie der des Mädchens, doch sein Körper wirkte entspannt und aufnahmebereit. »Es tut mir leid«, wiederholte er. »Ich sollte jetzt nach Hause fahren und über meine Probleme nachdenken. Und ich sollte auf keinen Fall noch jemanden mithineinziehen. Es ist widerwärtig, andere Menschen zum Verkauf anzubieten.«
»Ja«, murmelte Chuy traurig. »Das ist es, mein Junge. Du bist zwar ein böser Mensch, aber immerhin noch so jung. Vielleicht schaffst du es, dich noch zu ändern.«
»Ich werde es versuchen«, versprach der Junge und verließ das Pfandleihhaus ohne ein weiteres Wort. Kurz darauf hörten sie, wie er seinen Wagen startete und davonfuhr.
»Und was machen wir jetzt mit dem Mädchen?«, fragte Fiji.
Joe kniete vor dem Stuhl des Mädchens nieder und nahm ihre Hand. »Ihre Eltern heißen Margaret und Louis Hatter und wohnen in Davy«, erklärte er, und niemand fragte ihn, woher er das wusste.
Manfred nahm sein Smartphone in die Hand, um die Adresse herauszusuchen. Anschließend legte er es auf den Ladentisch, wo er es später prompt liegen ließ. »Ich bringe sie nach Hause«, bot er an. »Fiji, könntest du vielleicht auch mitkommen, für den Fall, dass sie denken, ich hätte den Zustand dieser kleinen Idiotin am Ende auch noch ausgenutzt?«
»Okay«, meinte sie und warf Bobo einen schnellen Blick zu, der sie (erneut!) mit einem Ausdruck auf dem Gesicht ansah, den sie nicht deuten konnte. Er schien an einem äußert unangenehmen Ort gefangen, und im nächsten Moment wandte er sich ab, trat durch die Tür, die ins Treppenhaus führte, und lief ins obere Stockwerk hoch. Kurz darauf fiel seine Wohnungstür hinter ihm ins Schloss.
Fiji seufzte, ohne es überhaupt zu merken, und machte sich daran, Manfred zu helfen. Sie nahmen das Mädchen zwischen sich, um es über die Auffahrt neben dem Pfandleihhaus zu Manfreds Auto zu bringen. Dort angekommen nahm Fiji den Kopf des Mädchens und Manfred ihre Beine, und sie verfrachteten sie mit einiger Mühe auf den Rücksitz. Die Augen des Mädchens blieben die kurze Fahrt über geöffnet, und sie schien die Musterung der Decke zu bewundern.
Sie brauchten länger als erwartet, um das Haus der Hatters zu finden, da die Straßen in Davy nicht ausreichend beschildert waren und Manfred sein Telefon ja im Laden vergessen hatte. Endlich parkte Manfred doch noch vor einem kleinen Haus in einer bescheidenen Straße.
Er nahm die Hände des Mädchens und zog es vom Rücksitz. Anschließend schlang Fiji einen Arm um seine Schulter, und Manfred übernahm die andere Seite. Das Mädchen hing wie ein Sack Mehl zwischen ihnen, während sie es durch den kleinen Vorgarten schleppten und anschließend an der Tür klingelten.
Diese wurde wenig später von einer etwa vierzigjährigen Frau geöffnet. Als sie das Mädchen sah, sackten ihre Schultern erleichtert – oder vielleicht auch resigniert – nach unten.
»Oh, Marilyn«, meinte sie traurig. »Schon wieder.«
»Sind Sie Margaret Hatter?«, fragte Fiji. »Ihre Mom?«
»Ja«, erwiderte Margaret und klang nicht gerade begeistert. »Moment, ich nehme Sie Ihnen ab.« Sie stellte keine Fragen und brachte auch keinerlei Anschuldigungen vor, während sie ungelenk versuchten, die leblose junge Frau an ihre Mutter zu übergeben.
»Wir haben sie schon so gefunden«, erklärte Fiji, die unbedingt klarstellen wollte, dass Manfred und sie nichts mit Marilyns Zustand zu tun hatten.
»Ja, klar«, erwiderte die Frau, als hätte ihr Fiji eine schier unglaubliche Geschichte aufgetischt. »Natürlich, meine Liebe.«
Fiji klappte betroffen den Mund auf und wollte bereits Einspruch gegen diese unterschwellige Anschuldigung erheben, doch in diesem Moment meinte Manfred übertrieben laut: »Ich hoffe, es geht ihr bald besser«, und zog Fiji von der Tür fort, die sich ohnehin bereits schloss.
Auf der Fahrt zurück nach Midnight schwiegen sie beide. Als Manfred sie schließlich vor ihrem Haus aussteigen ließ, meinte Fiji: »Ich wollte einfach nicht, dass sie denkt…« Das Gespräch mit Mrs. Hatter ließ ihr einfach keine Ruhe.
»Hör auf damit, Fiji«, unterbrach Manfred sie. »Mrs. Hatter hat uns keine einzige Frage gestellt. Sie hätte auch das Schlimmste angenommen, wenn wir mit Flügeln, weißen Roben und einem Engelschor vor ihrer Tür aufgetaucht wären.«
»Ja, und ich kann es ihr nicht verübeln«, erwiderte Fiji.
Manfred seufzte. »Nein, ich auch nicht.«
»Ich hoffe, dass die Probleme damit ein Ende haben«, meinte Fiji nach einer kurzen Pause.
»Das hoffen wir alle, aber du weißt genau, dass es nicht so sein wird …«
Fiji beobachtete von ihrer Veranda aus, wie Manfreds Auto sich langsam in Bewegung setzte. Nachdem kein anderes Fahrzeug zu sehen war, wendete er mitten auf der Witch Light Road. Sie blieb noch ein paar Minuten draußen und starrte zur Kreuzung hinüber. Beinahe erwartete sie, noch eine weitere unglückliche Seele zu entdecken, die mit einer Waffe in der Hand auf die Straße taumelte, doch sie sah dort nur die einzige Ampel in Midnight, die fest entschlossen ihrem gewohnten Rhythmus folgte.
Das Zusammentreffen der Witch Light Road und des Davy Highways war der Grund, warum Midnight überhaupt existierte. Die kleine Stadt war einzig und allein wegen dieser beiden Straßen gegründet worden, die damals lediglich zwei unbefestigte Wege gewesen waren.
Fiji sah, dass in der Tankstelle, die auf der gegenüberliegenden Seite der Kreuzung lag, noch Licht brannte und sich jemand im Laden bewegte. Kurz darauf ging das Licht aus, und ein Mann trat heraus und versperrte die Tür hinter sich. Er ging nach Norden auf das Haus zu, in dem schon der ehemalige Pächter des Gas’n’Go gewohnt hatte. Dabei bewegte er sich schnell und leichtfüßig, doch abgesehen davon konnte Fiji auf den ersten Blick nichts Besonderes an ihm erkennen. Plötzlich packte sie die Neugierde, und sie wollte den neuen Mitbürger möglichst bald kennenlernen. Sie würde einfach etwas für ihn backen und es ihm in den Laden bringen.
Nachdem sie noch einen Augenblick lang gewartet hatte, kehrte Fiji ins Haus zurück und öffnete eine versperrte Schublade unter dem Ladentisch, in der sich eine seltsame Sammlung verschiedenster gebrauchter Gegenstände befand: ein zerknülltes Papiertaschentuch, ein Lippenstift, eine Serviette, ein Messer, ein Füller, eine Flasche mit Handdesinfektionsmittel und noch einiges mehr. Fiji holte die gefaltete Dollarnote heraus, die im Pfandleihhaus aus Chuys Tasche gefallen war, und legte sie auf eine Karteikarte, auf der bereits Chuys Name stand. Anschließend schloss sie die Schublade vorsichtig und versperrte sie sorgfältig.
Obwohl sie eigentlich vorgehabt hatte, noch eine Weile im Bett zu lesen, ging sie doch noch einmal zurück zum Fenster und blickte zur Ampel hinaus.
Sie versuchte herauszufinden, ob etwas anders war, aber es gab nichts zu sehen – nicht einmal für eine Hexe.
Trotzdem war Fiji sich sicher, dass die Kreuzung plötzlich eine heimtückische Anziehungskraft ausübte. Sie hoffte zwar, dass es keine Auswirkungen auf die Leute hatte, die an der Kreuzung wohnten, aber im Grunde konnte sie sich nicht vorstellen, dass sie davon unbeeinflusst bleiben würden.
Es konnte einfach kein Zufall sein, dass sich zwei Menschen, die einander vermutlich nicht gekannt hatten, innerhalb weniger Tage an derselben Stelle das Leben genommen hatten. Immerhin war die Kreuzung kein berühmtes Ziel für Selbstmörder wie zum Beispiel die Golden Gate Bridge oder die Niagarafälle. Es war einfach ein Punkt im Nirgendwo, an dem sich zwei unbedeutende Straßen in einer winzigen Stadt kreuzten – und auch in der Nähe gab es nichts Besonderes.
Oder etwa doch? Führten nicht genau solche Geschehnisse dazu, dass sogar vernünftige Menschen einen Ort plötzlich als verflucht bezeichneten oder dachten, es würde spuken?
»Na ja«, meinte sie zu ihrem orangeroten Kater Mr. Snuggly, der sich gerade neben sie gestellt hatte. »Ich schätze, wir werden schon sehr bald mehr darüber erfahren.«
2
Den nächsten Morgen widmete Fiji einer ihrer Lieblingsbeschäftigungen – der Gartenarbeit. Sie liebte es, ihre Finger in die Erde zu graben, zu gießen, Pflanzen zu setzen und Unkraut zu entfernen, nach Schädlingen Ausschau zu halten und Kräuter und Tomaten zu ernten, wenn die Zeit dafür gekommen war … das alles waren Dinge, die einer Hexe guttaten und ihr halfen, mit den Elementen Erde, Luft und Wasser in Verbindung zu bleiben. Außerdem sorgten sie dafür, dass Fiji sich geerdet und wohlfühlte. Es machte natürlich auch Spaß, im Laden zu stehen und mit Menschen Kontakt zu haben, aber das Haus war nun mal kein lebender Organismus.
Im Inquiring Mind gab es alles zu kaufen, was für das »Hexenhandwerk light« notwendig war, wie Fiji es immer nannte. Sie hatte sehr wenige Dinge im Angebot, die für die höhere Hexenkunst benötigt wurden, weil es einfach keinen Markt dafür gab. Abgesehen von ihrer Großtante Mildred Loeffler hatte Fiji noch keine andere Hexe kennengelernt. Tante Mildred hatte vor Fiji in dem Häuschen gewohnt und war als Witwe darauf angewiesen gewesen, sich selbst über Wasser zu halten. Das war ihr mit dem nicht ganz offiziellen Verkauf von Kräutertinkturen und mit dem einen oder anderen Zauber, mit dem sie ihren Kunden geholfen hatte, ganz gut gelungen. Außerdem war sie eine hervorragende Köchin gewesen und hatte immer wieder Feierlichkeiten und Partys mit ihrem Essen beliefert.
Fiji dachte an Tante Mildred, während sie weiterarbeitete. Sie war ein wenig aus der Fassung geraten, als Joe und Chuy ihr erzählt hatten, dass sich ihre Tante so viele Jahre nach ihrem Tod immer noch in Midnight aufhielt. Fiji fragte sich, was das wohl in Hinsicht auf Tante Mildreds Seele bedeutete. Sollte sie es wagen, Joe und Chuy zu fragen, ob sie immer noch hier herumschwirrte, weil sie einfach keinen Einlass ins Paradies gefunden hatte? Glaubte Fiji selbst eigentlich an den Himmel? Oder an die Hölle?
Im Großen und Ganzen tat sie das wohl.
Sie machte sich daran, die Erde im Gemüsebeet aufzulockern, und überlegte, was wohl aus Tabby Ann Mastersons Seele geworden war. Für die katholische Kirche war Selbstmord eine schlimme Sünde, und soweit sie wusste, traf das auch auf die meisten anderen Religionen zu. Aber woher sollte man wissen, ob es tatsächlich eine Sünde war? Was, wenn man schreckliche Schmerzen hatte und es keine Hoffnung auf Heilung gab? Würde sie in diesem Fall jemanden bitten, sie zu erlösen? Ihre Gedanken kreisten eine Zeit lang um diese Fragen, doch dann beschloss sie, das Thema abzuhaken. Es hat keinen Sinn, sich über Fragen Gedanken zu machen, auf die niemand eine Antwort weiß, dachte Fiji. Wenigstens pinkelt Tabby Ann jetzt nicht mehr auf meine Veranda.
Im Großteil der USA war bereits der Herbst hereingebrochen, doch in Texas war es noch immer Sommer, obwohl die Abende und Nächte bereits kühl waren. Fiji war dankbar, dass es auch morgens noch angenehm frisch war. Mr. Snuggly setzte sich neben sie. Er sah ihr gerne bei der Arbeit zu, vor allem, wenn sie in der Sonne arbeitete. Am Vortag hatte er eine Maus gefangen und war daher noch immer unheimlich stolz auf sich selbst.
»Fang jetzt ja nicht wieder von dieser Maus an«, meinte Fiji, und der Kater warf ihr einen verletzten Blick zu.
»Und schau mich nicht so an«, fuhr sie fort. »Wenn man dir so zuhört, könnte man glatt meinen, es wäre keine Maus sondern ein Löwe gewesen.«
»Gut«, erwiderte Mr. Snuggly. »Dann lasse ich sie das nächste Mal eben dein Brot fressen.« Er stolzierte mit aufgerichtetem Schwanz davon und ließ sich auf der anderen Seite des Gartens in der Sonne nieder.
»Was hat er denn?«, fragte Bobo Winthrop. Fiji hatte seine Schritte gehört, weshalb sie nicht überrascht war, als er plötzlich neben ihr stand. Sie hielt den Blick gesenkt, denn sie wusste durchaus, dass sie die Angewohnheit hatte, viel zu oft zu grinsen, wenn Bobo in der Nähe war.
»Ach, er ist bloß beleidigt, weil ich die Geschichte von der Maus, die er gestern erlegt hat, langsam nicht mehr hören kann«, erwiderte Fiji. Sie zog noch mehr Unkraut aus der Erde und warf es in ihren Eimer. »Obwohl ich durchaus bereit wäre, sie mir noch einmal anzuhören, wenn er den Kadaver nicht ausgerechnet in meinen Schuh gelegt hätte.«
Bobo lachte. Sein Lachen klang natürlich, als würde es einfach zu ihm gehören. In den letzten Monaten hatte er viel zu selten gelacht. Er war gerade joggen gewesen und trug ein uraltes ärmelloses Sweatshirt und noch ältere Jogginghosen. Außerdem schwitzte er, obwohl die Luft angenehm kühl war.
»Nimm dir doch einen Stuhl und erzähl mir, was es Neues gibt«, schlug Fiji vor, die noch immer auf dem Boden kniete. Doch anstatt einen Klappstuhl von der Veranda zu holen, ließ sich Bobo neben ihr nieder. Sie seufzte innerlich. Bobo war gelenkig und fit und hatte genau das richtige Gewicht für seine Größe, obwohl er einige Jahre älter war als sie. »Wie alt bist du eigentlich?«, fragte Fiji, bevor sie sich der Schwerkraft ergab und sich ebenfalls nach hinten sinken ließ.
»Fünfunddreißig«, antwortete er. »Warum?«
Fiji fühlte sich plötzlich dick und niedergeschlagen. »Ach, nur so!«, erwiderte sie und bemühte sich, möglichst fröhlich zu klingen. »Also, was führt dich hierher?« Bobo sollte eigentlich bald das Pfandleihhaus öffnen, und auch Fiji musste noch duschen, bevor sie in ihren Laden ging.
»Weißt du, was wir brauchen, Fiji?« Er wirkte so ernst, dass ihr Herz ein wenig schneller zu schlagen begann.
Ihr fielen einige Dinge ein, die sie brauchten – oder besser gesagt: die sie brauchte.
»Was denn?«, fragte sie und versuchte, nicht zu atemlos zu klingen.
»Wir brauchen Urlaub.«
Sie wollte hundertprozentig sicher sein, dass sie Bobo richtig verstanden hatte, bevor sie sich noch zum Narren machte, also fragte sie vorsichtig nach: »Willst du auf eine einsame Insel? Oder an den Grand Canyon? Meinst du diese Art von Urlaub?«
»Gibt es noch eine andere Art Urlaub?«, fragte er lachend. »Ja, genau das brauchen wir. Wann hast du Midnight das letzte Mal für mehr als ein paar Stunden verlassen?«
»Vor zwei Jahren«, erwiderte sie, ohne lange nachzudenken.
»Ich habe vielleicht drei Mal auswärts übernachtet, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich länger als einen Tag fort gewesen wäre. Sogar Lemuel war auf Reisen, weil er jemanden finden wollte, der ihm bei der Übersetzung der Bücher helfen kann. Chuy besucht ständig seine Verwandten, und Joe fährt zu verschiedenen Antiquitätenmessen. Manfred fliegt alle paar Monate für ein paar Tage nach Dallas, Los Angeles oder Miami, und Olivia ist ohnehin die meiste Zeit unterwegs!«
»Aber der Rev nicht«, meinte Fiji.
»Nein, der Rev nicht, da gebe ich dir recht. Und die Reeds auch nicht. Und Diederik lebt erst seit ein paar Monaten hier, weshalb er nicht zählt.«
Langsam hatte Fiji das Gefühl, als würde Bobo tatsächlich vorschlagen, dass sie zusammen verreisen sollten – wie ein Paar. Obwohl sie es irgendwie trotzdem noch nicht ganz glauben konnte. Sie wagte einen Versuch. »Dann meinst du also, dass du und ich vielleicht nach Hawaii oder ins Death Valley fliegen sollten?«
»Ja, genau das meine ich.« Er schien es tatsächlich ernst zu meinen. Fiji sah ihn an, und der Wind fuhr durch seine hellen Haare.
Sie hatte so lange auf diesen Moment gewartet. Es kam ihr vor, als würde sie einen makellosen, schimmernden Kristall des Glücks in den Händen halten. Doch dann wand sich Bobo plötzlich kaum merklich und musterte sie besorgt.
»Wir können uns natürlich getrennte Zimmer nehmen«, erklärte er.
Sie hatte absolut keine Ahnung, wie er das meinte, aber der Kristall zersprang sofort in tausend Stücke.
Fiji kratzte den letzten Rest Selbstbeherrschung, den sie noch aufbringen konnte, zusammen, um ihm nicht zu zeigen, wie sehr er sie gerade verletzt hatte. Etwas in ihr zerriss, und sie verlor jegliche Hoffnung. »Ich schaffe das einfach nicht mehr«, erklärte sie mit gesenktem Blick. »Du solltest jetzt gehen.«
Ihr bester Freund, von dem sie schon so lange gehofft hatte, dass er irgendwann mehr als das sein würde, sah sie schockiert an – aber nicht schockiert genug, um ihr vorzumachen, dass er nicht genau wusste, was hier los war. »Bitte lass mich noch mal von vorne anfangen«, flehte Bobo.
»Nein!« Sie stemmte sich hoch und machte sich ausnahmsweise einmal keine Gedanken darüber, wie dick und schwerfällig sie dabei aussah. »Nein. Ich gehe jetzt. Mach doch, was du willst.« Sie winkte ab, um ihm zu zeigen, wie egal ihr das alles war, bevor sie durch die Hintertür ins Haus trat und hinter sich abschloss. Irgendwie hatte es Mr. Snuggly geschafft, noch schnell zu ihr in den Flur zu schlüpfen.
»Ich bin fertig mit ihm«, erklärte Fiji ihrem Kater. »Ich ertrage das einfach nicht mehr.«
Mr. Snuggly hielt wohlweislich die Klappe.
Wenig später trat Fiji unter die Dusche, und das Wasser, das in ihr Gesicht prasselte, vermischte sich mit den Tränen, die über ihre Wangen liefen.
»Fiji«, meinte sie zu sich selbst. »Du bist eine verdammte Idiotin!«
Es war eine härtere, zähere Hexe, die schließlich das Wasser abdrehte, sich abtrocknete und anzog, um gerade noch rechtzeitig ihren Laden aufzusperren. Ein Auto hielt vor dem Randstein. Gut, eine Ablenkung ist genau das, was ich jetzt brauche, dachte Fiji bei sich. Doch als sie noch einmal hinsah, erkannte sie überrascht, dass ihr das Auto bekannt vorkam – und sie war noch um einiges überraschter, als ihr Blick auf die Frau fiel, die gerade ausstieg.
Ihre erste Kundin an diesem Tag war ihre Schwester.
»Kiki?«, fragte sie ungläubig.
»Ja, genau die bin ich«, rief ihre Schwester fröhlich.
Waikiki Cavanaugh Ransom war vier Jahre älter als Fiji, und obwohl alle Frauen der Familie Cavanaugh einen mehr oder weniger kurvig-runden Körper geerbt hatten, hatte Kiki es geschafft, sich durch Hungerkuren und Sport so weit zu bringen, dass sie diesen durchaus angenehmen Zustand wohl nie erreichen würde. Kiki war etwas größer als ihre Schwester und trug leuchtend grüne Kontaktlinsen, die ihre Augen außergewöhnlich funkeln ließen. Das war neu. Genauso wie Kikis Haarfarbe, die an ein goldenes Weizenfeld erinnerte. Fiji hatte gerade genug Zeit, das alles auf sich wirken zu lassen, bevor Kiki vor ihr stand.
Die Schwestern umarmten sich, und Fiji freute sich einige Sekunden lang einfach nur, dass ihre Schwester von Houston hierhergefahren war, um sie zu besuchen. Doch dann erinnerte sie sich daran, wie Kiki nun mal war.
»Ich bin natürlich froh, dich zu sehen … aber ich bin auch ein wenig überrascht«, meinte Fiji, anstatt ihrem ersten Impuls zu folgen und Kiki zu fragen, was zum Teufel sie hier verloren hatte.
Immerhin hatte sie niemand aus der Familie besucht, seit sie ihr Erbe angenommen hatte und hierhergezogen war, und die Reise, die Fiji vor zwei Jahren unternommen hatte, um an Weihnachten zu Hause zu sein, war ein schrecklicher Fehler gewesen.
»Na ja, es wurde eben einfach mal Zeit, Fiji! Du bist die einzige Schwester, die ich habe! Weißt du, ich bereue den Streit, den wir hatten. Mom dachte einfach, dass Tante Mildreds Haus ihr zustehen würde, und es hat vielleicht so ausgesehen, als hätte ich mich auf ihre Seite geschlagen – aber mittlerweile weiß ich es besser. Es ist mir bewusst, dass damals viele schlimme Dinge gesagt wurden.«
»Und du hast zwei Jahre gebraucht, um mir das zu sagen? Nachdem du in der Zwischenzeit vielleicht drei Mal angerufen hast?«
»Hey, lass es gut sein, okay? Ich versuche hier gerade, mich wieder mit dir zu vertragen!« Kiki schob ihre Schwester ein Stückchen von sich weg und lächelte tadelnd.
Doch Fiji war heute einfach nicht in der Stimmung für solche Spielchen. Sie verschränkte die Arme vor der Brust. »Ich lasse es ganz sicher nicht gut sein. Raus damit! Es muss doch einen Grund geben, warum du den langen Weg von Houston hierher auf dich genommen hast. Ich würde vorschlagen, wir setzen uns, und dann reden wir darüber.«
Fiji deutete auf die beiden Korbstühle, die in der Mitte des Ladens neben einem kleinen Tisch standen, und Kiki ließ sich auf einen der beiden sinken.
Sie hat sich gesetzt, nachdem ich sie darum gebeten habe, dachte Fiji. Das heißt, dass sie gleich eine Gegenleistung verlangen wird.
»In Ordnung«, meinte Kiki. »Aber ich könnte vorher noch eine Tasse Kaffee vertragen.«
Wer hätte das gedacht? »Ich werde mich wie eine höfliche Gastgeberin verhalten, sobald du mir gesagt hast, was los ist«, entgegnete Fiji. Sie hatte keine Ahnung, wohin sie diese neue, härtere Fiji führen würde, aber bis jetzt fühlte es sich ziemlich gut an.
»Ich habe Marty verlassen«, erklärte Kiki und schien auf einmal den Tränen nahe. »Ich wollte einfach eine Zeit lang aus der Stadt raus, aber ich habe kein Geld, also schlug Mom vor, dass ich eine Weile bei dir wohnen soll, nachdem du ja ein ganzes Haus für dich alleine hast.«
»Jetzt tu nicht so, als würdest du mich darum beneiden«, erwiderte Fiji. »Du konntest Tante Mildred nicht ausstehen, du hast nie wirklich Zeit mit ihr verbracht, und du dachtest, dieses Haus wäre eine heruntergekommene Absteige. Daraus hast du keinen Hehl gemacht – und dann hatten Mom und du trotz allem die Nerven, überrascht zu sein, als Tante Mildred mir das Haus vermacht hat.«
»Aber das habe ich ihr doch nie gesagt«, erwiderte Kiki trotzig. »Tante Mildred, meine ich …«
»Glaubst du, sie war bescheuert? Glaubst du, sie wusste das nicht auch so?«
Das war scheinbar genau das, was Kiki glaubte. Als hätten ein falsches Lächeln, ein paar Umarmungen und ab und zu eine nette Bemerkung dazu geführt, dass Tante Mildred das Offensichtliche übersah.
»Dann gefällt dir das Haus also wirklich?« Kiki schien ehrlich überrascht.
»Ja, ich liebe es«, erwiderte Fiji bestimmt. »Ich liebe das Haus, ich liebe meinen Laden, und ich liebe diese Stadt.« Trotz allem, fügte sie in Gedanken noch hinzu, ohne näher darüber nachzudenken, was genau sie damit meinte.
»Ich dachte, du würdest es bloß renovieren und anschließend verkaufen«, lachte Kiki.
»An wen denn? Glaubst du, dass es hier in der Gegend einen florierenden Immobilienmarkt gibt?«
»Na ja, vermutlich nicht«, erwiderte Kiki immer noch lächelnd. »Dann lebst du also wirklich gerne hier?«
»Ja, ich lebe wirklich gerne hier.« Fiji lächelte ebenfalls – zumindest bleckte sie die Zähne. »Dann hast du Marty also verlassen? Was hat denn das Fass zum Überlaufen gebracht?«
»Er hat meinen Schmuck gestohlen und verpfändet. Und anschließend wollte er mir weismachen, er hätte ihn verloren.«
»Wofür hat er denn das Geld gebraucht?«
»Er ist spielsüchtig«, erwiderte Kiki rundheraus. »Aber er lässt sich nicht helfen, und er hat inzwischen beinahe unser ganzes Geld verspielt. Ich musste raus, um mich und meine letzten Besitztümer zu retten. Ich habe einige Sachen bei Mom am Dachboden verstaut, und dann bin ich los.«
»Und jetzt bist du hier.« Fiji roch eine riesige Ratte, die sehr viel größer war als die winzige Maus, die Mr. Snuggly am Vortag in ihrem Schuh verstaut hatte.
»Ja, jetzt bin ich hier.«
»Warum bist du nicht bei Mom geblieben?«
»Sie hat klargestellt, dass sie mir nicht helfen würde, falls Marty zu ihr kommt, um mit mir zu sprechen.«
»Wie sieht Dad denn die Sache? Er war doch immer bereit, seine Lieblinge zu verteidigen.« Fiji war sich ziemlich sicher, dass sie nicht zu dieser Gruppe gehörte.
»Ich weiß ja nicht, wie oft du mit Mom redest, aber …«
»Im Grunde nie. Was ist denn los?«, fragte Fiji alarmiert. Kikis Stimme klang plötzlich ernst, als wollte sie Fiji auffordern, ganz genau zuzuhören.
»Dad hat Alzheimer.«
Fiji starrte ihre Schwester an. »Und Mom und du seid nicht auf die Idee gekommen, mir das zu sagen?«, fragte sie kraftlos.
Kiki spitzte die Lippen. »Ich sage es dir doch jetzt. Außerdem wissen wir es noch nicht so lange. Ich besuche die beiden etwa zweimal die Woche, aber mir ist lange Zeit nicht aufgefallen, dass etwas nicht stimmt. Er wirkte zwar ab und zu ein wenig gedankenverloren, aber es war meiner Meinung nach nichts, worüber man sich Sorgen machen musste. Er hat nur immer wieder den Autoschlüssel und sein Telefon verlegt – solche Dinge eben.« Sie sah sich bewundernd im Laden um, doch Fiji wusste es besser. »Eines Tages rief er mich aus dem Baumarkt an. Er hatte keine Ahnung, wie er nach Hause kommen sollte.«
»Aber er wusste, dass er dich anrufen kann?« Fiji tat sich schwer, die Situation zu begreifen.
»Ihm gefiel das Foto neben meiner Telefonnummer, also hat er mich angerufen.« Kiki schüttelte den Kopf. »Es hätte noch viel schlimmer kommen können.«
»Das muss ziemlich Furcht einflößend gewesen sein. Für ihn. Und für dich auch.«
Kiki nickte. »Ja, darauf kannst du wetten.«
»Also hast du beschlossen, dass du nach deiner Trennung hierherkommst und nicht zu Mom fährst?«
»Ja, genau«, erwiderte Kiki fest entschlossen. »Du weißt doch, dass sie Marty von Anfang an gehasst hat, und ich könnte ihre Freude über unsere Trennung nicht ertragen. Außerdem wäre es ziemlich anstrengend gewesen, sich mit ihr gemeinsam um Dad zu kümmern, und ich brauche Entspannung und keinen weiteren Stress.«
Nachdem Fiji genauso wenig vorhatte, ihrer Mutter bei der Pflege ihres Vaters zu helfen, konnte sie dagegen kaum etwas einwenden. »Ja, das verstehe ich«, meinte sie stattdessen, und das tat sie tatsächlich. Allerdings wusste sie genau, dass Waikiki Cavanaugh Ransom ihr etwas verschwieg, und sie nahm an, dass sie es früher oder später schon noch zu hören bekommen würde. Im Moment konnte sie Kiki jedenfalls unmöglich nach Houston zurückschicken, auch wenn ihr diese Möglichkeit einen Moment lang sehr verlockend erschien. Doch das familiäre Band zwischen ihnen bestand noch immer, egal wie enttäuscht die neue Fiji darüber war.
»Na gut, das Gästezimmer ist gleich dort hinten«, erklärte Fiji. »Ich bin mir sicher, dass du dich noch daran erinnerst.« Wenn ihre Familie ihre Tante besucht hatte, war Kiki natürlich ebenfalls dabei gewesen. »Das Haus ist ja nicht so groß.«
Fiji ging den kleinen Flur entlang. Das Badezimmer lag links, ihr Schlafzimmer rechts, und das Gästezimmer befand sich neben dem Schlafzimmer auf der linken Seite, gegenüber der Küche. Der Raum war ziemlich klein, aber nachdem sie sich einen Schuppen für den Garten gekauft hatte, konnte mittlerweile wenigstens jemand darin schlafen, denn er wurde nicht mehr als Abstellraum benutzt.
Bobo hatte ihr geholfen, den Schuppen aufzustellen. Na ja, eigentlich hatte Bobo den Schuppen aufgestellt, und Fiji und Diederik hatten ihm dabei geholfen, wobei ihnen auch Teacher Reed fachmännisch zur Seite gestanden hatte. Die glückliche Erinnerung an diesen Tag wurde ihr jedoch sofort vermiest, als ihr wieder einfiel, dass sie nun mit Sicherheit wusste, dass Bobo und sie immer nur gute Freunde und niemals ein Liebespaar sein würden.
Doch Fiji schob ihre Trauer beiseite. Sie wollte sich vor ihrer Schwester keine Blöße geben.
Im Zimmer befanden sich ein Einzelbett mit einer bunten Patchworkdecke und ein roter Nachttisch mit einer Lampe und einer Taschentuchbox darauf. Abgesehen davon gab es nur ein schmales Regal (aus dem Pfandleihhaus) und einen genauso schmalen Kleiderschrank (ebenfalls aus dem Pfandleihhaus).
Kiki sah sich angespannt um. Man musste kein Gedankenleser sein, um zu erkennen, dass sie nicht viel von ihrer neuen Behausung hielt.
Fiji beschloss, das zu ignorieren.
»Okay, dann hole ich mal meinen Koffer«, erklärte Kiki und deutete mit dem Daumen den Flur hinunter. »Ist das dort das einzige Badezimmer?«
»Ja, ich weiß, dass du etwas anderes gewöhnt bist, aber wir haben Glück, dass Tante Mildred damals überhaupt ein Bad und eine Toilette einbauen ließ. Früher befand sich die Toilette im Garten.«
»Bäh.« Kikis angeekeltes Gesicht war Antwort genug. Sie wandte sich ab und machte sich auf den Weg zu ihrem Auto, das immer noch vor dem Laden stand.
»Du kannst das Auto hinter dem Haus neben meinem Wagen parken«, rief Fiji ihrer Schwester hinterher.
Als Kiki den Laden verlassen hatte, setzte sie sich auf den Stuhl hinter dem Ladentisch und ließ den Kopf in die Hände sinken. Normalerweise hätte sie jetzt Bobo angerufen und ihm die Neuigkeiten erzählt, immerhin hatte sie tatsächlich Besuch von einem Familienmitglied erhalten! Aber das konnte sie heute natürlich auf keinen Fall tun. Sie überlegte, Manfred anzurufen, doch auch dafür war sie irgendwie nicht in der Stimmung.
Meine Schwester ist hier, und ich bin mir sicher, dass mehr dahintersteckt, als sie zugibt; das Gedächtnis meines Dads zerfällt langsam zu Staub; und ich habe mich gerade emotional von dem Mann gelöst, in den ich drei Jahre lang verliebt war – was kommt heute eigentlich noch alles auf mich zu?, fragte sich Fiji.
In diesem Moment klingelte das Glöckchen über der Ladentür, und Fiji stand auf, um die erste Kundin des Tages zu begrüßen. »Hi!«, meinte sie und hoffte, dass sie einigermaßen gefasst klang. »Wie kann ich Ihnen helfen?«
»Haben Sie vielleicht ein Zeremonienmesser? Ich bin mir nicht sicher, wie man den Namen ausspricht … ein Athame?« Die Kundin war eine Frau mittleren Alters, und sie sah sich im Laden um, als würde das Messer jeden Augenblick vor ihr Gestalt annehmen. Sie kam Fiji irgendwie bekannt vor.
Fiji musterte die Frau genauer und fragte sich, woher sie sie kannte. Eigentlich hätte sie diese Frau niemals für eine ernsthafte Hexe gehalten. Sie war klein und eher stämmig und hatte eine Dauerwelle, die ihre grauen Haare zu strengen Locken formte. Ihr einziges Make-up war ein leuchtend rosafarbener Lippenstift, und sie trug eine Hose von Chico’s und praktische Sandalen von SAS.
»Kennen wir uns?«, fragte Fiji.
Die Kundin hob zögernd den Blick. »Vielleicht«, antwortete sie vage und sah sich erneut im Laden um. Langsam machte sich in Fiji das Gefühl breit, dass mit dieser Frau etwas nicht stimmte. Offensichtlich war der heutige Tag voller Begegnungen, die sie nicht erwartet hatte, dabei war es noch nicht einmal zehn Uhr.
»Ich habe mehrere Athamen zur Auswahl. Ich bewahre sie hier im Ladentisch auf, wenn Sie einen Blick darauf werfen möchten.«
Die Frau trat auf sie zu, und Fiji deutete auf die Glasplatte, unter der acht Athamen in verschiedenen Ausführungen und Größen ausgestellt waren. Die Kundin starrte wie gebannt auf die Messer. Fiji wollte ihr bereits Auskunft über die verschiedenen Materialien geben, doch die Frau hatte keinerlei Fragen. Es gab ein Knochen-Athame, das eher schlicht gehalten war, ein aufwendig graviertes Athame aus Stahl, ein ziemlich Furcht einflößend und praktikabel aussehendes Messer, und ein weiteres, das einem schottischen Sgian Dhu nachempfunden war.
Während die Kundin die Auswahl begutachtete, musterte Fiji ihre Kundin. Sie war sich sicher, dass sie sie schon einmal gesehen hatte.
»Athamen haben sehr spezielle Einsatzgebiete«, meinte Fiji schließlich, um dem Schweigen ein Ende zu bereiten. »Wozu brauchen Sie es denn?«
Doch die Frau schüttelte lediglich den Kopf, überlegte noch einmal kurz und meinte schließlich: »Ich möchte das hier.« Sie deutete auf das schärfste Messer im Schaukasten. Es bestand aus Edelstahl und sah von allen am brauchbarsten aus. Außerdem machte es als einziges Athame den Eindruck, als könnte es tatsächlich Schaden anrichten. Athamen mussten im Grunde nicht scharf sein, denn sie waren lediglich dazu gedacht, Energien umzuleiten. Manche Hexen verwendeten ihre Athamen zwar auch im Alltag, weil sie der Meinung waren, dass die tägliche Nutzung den Klingen mehr Macht verlieh, aber die meisten Messer wurden ausschließlich für bestimmte Zeremonien gebraucht, wie etwa auch Fijis Athame, das sie sorgfältig verschlossen aufbewahrte.
»Wozu brauchen Sie es denn?«, fragte Fiji erneut und bemühte sich, nicht zu grinsen.
Die Frau sah sie ausdruckslos an. »Ach wissen Sie … ich brauche es für ein Treffen meines Hexenzirkels«, meinte sie schließlich.
Das war die falsche Antwort. Üblicherweise machte nur eine Priesterin während eines Hexenzirkels von einem Athame Gebrauch – und wenn diese Frau eine Priesterin war, dann fraß Fiji einen Besen.
Fiji hatte noch nie in einer derartigen Zwickmühle gesteckt. Was wieder einmal ein Beweis dafür ist, dass heute ein wahrhaft besonderer Tag ist, dachte sie bitter.
»Sie gehören einem Hexenzirkel an?«, fragte sie und bemühte sich, so neutral wie möglich zu klingen. »Ich wusste gar nicht, dass es hier in der Nähe so etwas gibt. Das ist ja sehr interessant.«
»Aber ja«, meinte die Frau, ohne näher darauf einzugehen. »Sie wären überrascht.«
Ja, das wäre ich auf alle Fälle, dachte sich Fiji. Aber was sollte schon passieren? Immerhin konnte sich die Frau im nächsten Supermarkt oder Jagdgeschäft ein sehr viel längeres und schärferes Messer kaufen, nicht wahr?