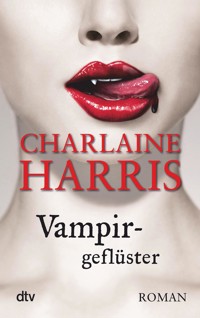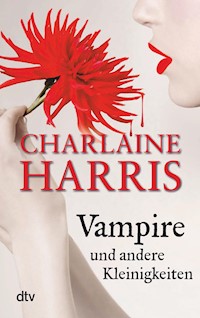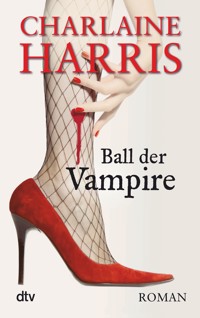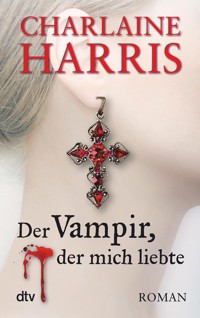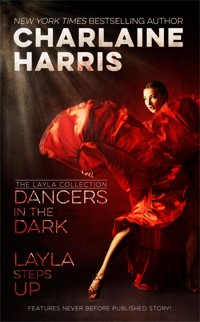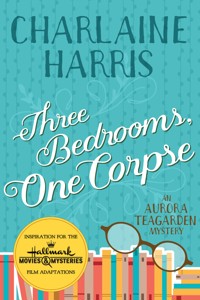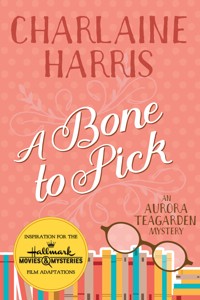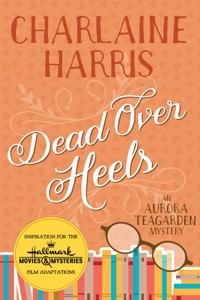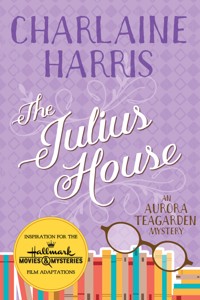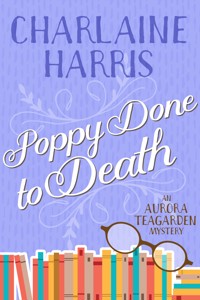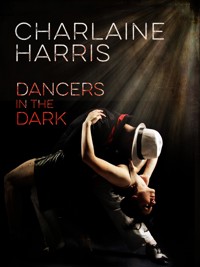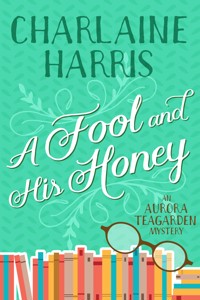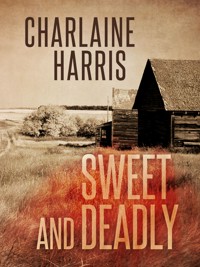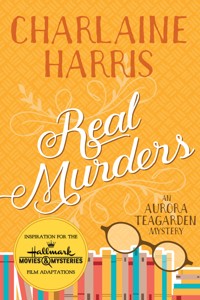6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Sookie Stackhouse
- Sprache: Deutsch
Der Roman zur TV-Serie TRUEBLOOD Sookie Stackhouse, die gedankenlesende Kellnerin, wird von den neuesten Entwicklungen in Bon Temps/Louisiana mitten ins Herz getroffen: Erst ertappt sie Eric, ihren Vampir-Liebhaber, in flagranti mit den Fangzähnen im Hals einer anderen Frau. Kurze Zeit später wird ebendiese Frau tot in Erics Garten gefunden. Ein besonders ungünstiger Zeitpunkt für einen solchen Skandal, denn gerade weilt der Vampirkönig von Louisiana, Arkansas und Nevada in der kleinen Stadt. Es ist an Sookie und Bill, dem für die Region zuständigen Vampirermittler, das Verbrechen aufzuklären. Und dann wird Sookie selbst zur Zielscheibe. Wer ist ihr Feind?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 528
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Sookie Stackhouse, die gedankenlesende Kellnerin, wird von den neuesten Entwicklungen in Bon Temps/Louisiana mitten ins Herz getroffen: Erst ertappt sie Eric, ihren Vampir-Liebhaber, in flagranti mit den Fangzähnen im Hals einer anderen Frau. Kurze Zeit später wird ebendiese Frau tot in Erics Garten gefunden. Ein besonders ungünstiger Zeitpunkt für einen solchen Skandal, denn gerade weilt der Vampirkönig von Louisiana, Arkansas und Nevada in der kleinen Stadt. Es ist an Sookie und Bill, dem für die Region zuständigen Vampirermittler, das Verbrechen aufzuklären. Und dann wird Sookie selbst zur Zielscheibe. Wer ist ihr Feind?
Von Charlaine Harris sind bei dtv außerdem erschienen:
Vorübergehend tot
Untot in Dallas
Club Dead
Der Vampir, der mich liebte
Vampire bevorzugt
Ball der Vampire
Vampire schlafen fest
Ein Vampir für alle Fälle
Vampirgeflüster
Vor Vampiren wird gewarnt
Vampir mit Vergangenheit
Vampirmelodie
Die Welt der Sookie Stackhouse
Vampire und andere Kleinigkeiten
Charlaine Harris
Cocktail für einen Vampir
Sookie Stackhouse Band 12
Roman
Deutsch von Britta Mümmler
Julia, dieses Buch ist für dich.
Ich liebe dich, mein Schatz.
Kapitel 1
Es war höllisch heiß, selbst so spät am Abend noch. Ich hatte einen arbeitsreichen Tag im Merlotte’s hinter mir, und das Letzte, was ich wollte, war in einem überfüllten Nachtclub zu sitzen und meinem Cousin dabei zuzusehen, wie er sich nackt auszog. Doch es war Damenabend im Hooligans, wir hatten diesen Ausflug schon seit Tagen geplant, und der Club war voll krakeelender und kreischender Frauen, die wild entschlossen waren, sich bestens zu amüsieren.
Meine hochschwangere Freundin Tara saß rechts neben mir, und Holly, die wie ich und Kennedy Keyes in Sam Merlottes Bar arbeitete, saß an meiner anderen Seite. Kennedy und Michele, die Freundin meines Bruders, saßen uns gegenüber am Tisch.
»Sook-iiee«, rief Kennedy und grinste mich an. Kennedy hatte vor ein paar Jahren beim Schönheitswettbewerb zur Miss Louisiana mal den zweiten Platz belegt. Trotz ihres zwischenzeitlichen Aufenthalts im Gefängnis sah sie wieder genauso atemberaubend und gepflegt aus wie zuvor, samt derart blendend weißer Zähne, dass ein entgegenkommender Bus glatt von der Straße abkommen konnte.
»Wie schön, dass du beschlossen hast, doch zu kommen, Kennedy«, sagte ich. »Und Danny hat nichts dagegen?« Noch am Nachmittag dieses Tages hatte sie irgendwelchen Unsinn dahergeredet, und ich war überzeugt gewesen, dass sie zu Hause bleiben würde.
»Hey, ich will doch mal ’n paar knackige Kerle nackt sehen, du etwa nicht?«, erwiderte Kennedy.
Ich sah in die Runde der anderen am Tisch. »Also, falls ich nichts verpasst habe, kriegen wir doch alle ziemlich regelmäßig einen nackten Kerl zu sehen«, erwiderte ich. Ich hatte gar nicht witzig sein wollen, aber meine Freundinnen kreischten vor Lachen. Sie waren einfach total albern.
Es war doch bloß die Wahrheit: Ich war jetzt bereits seit einer Weile mit Eric Northman zusammen, Kennedy und Danny Prideaux waren sich mittlerweile ziemlich nahegekommen, Michele und Jason wohnten quasi schon zusammen, Tara war verheiratet und schwanger, verdammt noch mal, und Holly war mit Hoyt Fortenberry verlobt, der kaum noch mal in seinem eigenen Apartment vorbeisah.
»Du musst doch zumindest neugierig sein«, sagte Michele mit erhobener Stimme, um den Lärm zu übertönen. »Auch wenn du Claude zu Hause dauernd siehst. Aber da ist er ja immer angezogen, deshalb …«
»Ja, wann ist sein eigenes Haus eigentlich so weit, dass er wieder einziehen kann?«, fragte Tara. »Wie lange können solche Klempnerarbeiten denn dauern?«
Die Rohrleitungen in Claudes Haus in Monroe waren bestens in Schuss, soweit ich wusste. Aber diese Klempnergeschichte klang einfach besser als: »Mein Cousin ist ein Elf, und er braucht hier die Nähe anderer Elfen, weil er nicht zurückkann in die Elfenwelt. Und deshalb kam auch mein Großonkel Dermot, der ein Halbelf ist und das Abbild meines Bruders, gleich noch dazu.« Das Elfenvolk will, im Gegensatz zu den Vampiren und den Werwölfen, dass seine Existenz ein großes Geheimnis bleibt.
Außerdem stimmte auch Micheles Vermutung nicht, dass ich Claude noch niemals nackt gesehen hatte. Der atemberaubend gut aussehende Claude war zwar mein Cousin – und ich laufe zu Hause garantiert nicht nackt herum –, aber die Elfen hatten zur Nacktheit eben ein völlig zwangloses Verhältnis. Mit seinem langen schwarzen Haar, der grüblerischen Miene und dem Waschbrettbauch war Claude einfach zum Anbeißen … bis er den Mund aufmachte. Dermot, der auch bei mir wohnte, war viel maßvoller in seinem Auftreten … vielleicht weil ich ihm erzählt hatte, was ich von nacktärschigen Verwandten hielt.
Ich mochte Dermot entschieden lieber als Claude. Meine Gefühle für Claude konnte man bestenfalls als gemischt bezeichnen. Und keins dieser Gefühle war sexueller Natur. Im Gegenteil, erst vor Kurzem hatte ich ihn nach einem Streit nur äußerst widerwillig wieder bei mir aufgenommen.
»Es macht mir nichts aus, Claude und Dermot im Haus zu haben. Die beiden haben mir schon oft geholfen«, sagte ich ausweichend.
»Was ist eigentlich mit Dermot? Strippt der auch?«, fragte Kennedy hoffnungsvoll.
»Er arbeitet hier als so eine Art Manager. Wär ziemlich seltsam für dich, Michele, wenn er strippen würde, was?«, sagte ich. Dermot glich meinem Bruder bis aufs Haar, und Jason war nun schon sehr lange fest mit Michele zusammen – »sehr lange« nach Jasons Maßstäben.
»Ja, das könnte ich mir nicht ansehen«, erwiderte sie. »Außer vielleicht, um mal einen Vergleich zu haben!« Wir lachten alle.
Während die anderen sich weiter über Männer unterhielten, sah ich mich in dem Club um. Ich war noch nie im Hooligans gewesen, wenn es so voll war, und ich war auch noch nie zum Damenabend hier gewesen. Es gab eine Menge zu sehen – die Angestellten zum Beispiel.
Den Eintritt hatten wir bei einer sehr vollbusigen jungen Frau mit Schwimmhäuten zwischen den Fingern bezahlt. Ein Lächeln war über ihr Gesicht gehuscht, als sie meinen erstaunten Blick bemerkte. Doch keine meiner Freundinnen hatte sie eines zweiten Blickes gewürdigt. Und als wir den Club betraten, wurden wir gleich von einem Kobold namens Bellenos in Empfang genommen und an unseren Tisch geführt. Den hatte ich zuletzt gesehen, als er mir den Kopf eines Feindes auf dem Tablett servierte. Im wahrsten Sinn des Wortes.
Auch an Bellenos schien keiner meiner Freundinnen etwas aufzufallen – aber ich fand, dass er nicht wie ein normaler Mensch aussah. Sein dickes kastanienbraunes Haar lag glatt am Kopf an und wirkte irgendwie fellartig, seine schrägen schwarzbraunen Augen standen weit auseinander, seine Sommersprossen waren größer als die eines jeden Menschen und die Spitzen seiner scharfen, zweieinhalb Zentimeter langen Zähne schimmerten im gedämpften Licht des Clubs. Bei unserer ersten Begegnung hatte Bellenos sich noch nicht als Mensch tarnen können. Jetzt schon.
»Viel Spaß, Ladys«, hatte er uns mit seiner tiefen Stimme zugeraunt. »Dieser Tisch hier ist reserviert für Sie.« Und als er sich umdrehte, um zum Eingang zurückzukehren, hatte er mir noch so ein gewisses Lächeln zugeworfen.
Wir saßen direkt an der Bühne. Auf einem von Hand beschrifteten Kärtchen mitten auf der Tischdecke stand »Ladys aus Bon Temps«.
»Hoffentlich kann ich mich mal so richtig persönlich bei Claude bedanken«, schmachtete Kennedy mit einem anzüglichen Grinsen. Sie haderte definitiv mit Danny; und das mutmaßte ich nicht bloß. Michele kicherte und stupste Tara an.
Mittlerweile hatten sie alle begriffen, dass Claude so eine Art Leckerbissen war.
»Der Typ mit dem rotbraunen Haar, der uns an den Tisch gebracht hat, steht auf dich, Sookie«, sagte Tara besorgt. Ich wusste, dass sie an meinen echten Freund und unechten Vampirehemann Eric Northman dachte und daran, dass er bestimmt nicht allzu begeistert wäre über einen Fremden, der mir schöne Augen machte.
»Er war bloß höflich, weil ich Claudes Cousine bin«, erwiderte ich.
»Na sicher doch! Nein, der hat dich angesehen, als wärst du ein in Eiscreme getauchter Schokokeks«, sagte sie. »Der hätte dich am liebsten mit Haut und Haaren verschlungen.«
Damit hatte sie wohl nicht ganz unrecht, wenn auch nicht in dem Sinn, wie sie es meinte. Was nicht heißen soll, dass ich die Gedanken von Bellenos besser lesen konnte als die irgendeines anderen übernatürlichen Geschöpfs … aber Kobolde sind nicht allzu wählerisch, was ihren Speiseplan betrifft, um es mal so auszudrücken. Ich konnte nur hoffen, dass Claude das bunt gemischte Elfenvolk gut im Auge behielt, das er hier im Hooligans um sich geschart hatte.
Doch inzwischen klagte Tara schon darüber, dass ihr Haar in der Schwangerschaft all sein Volumen verloren habe, und Kennedy sagte: »Gönn dir mal eine Conditioner-Haarkur im Death by Fashion in Shreveport. Immanuel ist der Beste.«
»Er hat mir mal die Haare geschnitten«, erzählte ich, und sie sahen mich alle erstaunt an. »Wisst ihr nicht mehr? Als mein Haar versengt war?«
»Ach ja, nach dem Bombenanschlag aufs Merlotte’s.« Daran erinnerte Kennedy sich. »Das war Immanuel? Wow, Sookie, ich wusste gar nicht, dass du ihn kennst.«
»Ein bisschen«, sagte ich. »Ich wollte mir eigentlich noch ein paar Strähnchen machen lassen, aber er hat die Stadt verlassen. Sein Friseursalon ist allerdings noch geöffnet.« Ich zuckte die Achseln.
»Alle großen Talente verlassen Louisiana«, warf Holly ein. Und während sie sich darüber unterhielten, versuchte ich, mein Hinterteil einigermaßen bequem auf dem zwischen Holly und Tara gequetschten Metallklappstuhl zu platzieren. Irgendwie gelang es mir, mich hinunterzubeugen und meine Handtasche sicher zwischen den Beinen zu verstauen.
Dann blickte ich mich um, und als ich all die aufgeregten Gäste sah, entspannte ich mich langsam. Warum sollte ich das alles nicht auch ein wenig genießen? Ich wusste doch schließlich schon seit meinem letzten Besuch hier, dass der Nachtclub voll heimatloser Elfen war. Ich war umgeben von Freundinnen, die alle wild entschlossen waren, sich bestens zu amüsieren. Warum sollte ich es mir da nicht erlauben, mich gemeinsam mit ihnen zu amüsieren? Claude und Dermot waren immerhin meine Verwandten und würden schon dafür sorgen, dass mir nichts Schlimmes passierte. Stimmt’s? Es gelang mir, Bellenos ein Lächeln zu schenken, als er noch einmal an unseren Tisch kam und die Kerze anzündete. Und ich lachte über einen schmutzigen Witz von Michele, bis eine Kellnerin herbeigeeilt kam, um unsere Bestellungen aufzunehmen. Mein Lächeln schwand. Ich kannte sie von meinem letzten Besuch.
»Ich bin Gabe und werde Sie heute Abend bedienen«, sagte sie gerade so lebhaft, wie man es sich wünschte. Sie hatte hellblondes Haar und war sehr hübsch. Aber da ich selbst zum Teil Elfe war (dank eines unglaublichen Leichtsinns meiner Großmutter), konnte ich hinter die schöne Fassade dieser Blondine blicken. Ihre Haut war gar nicht so honigbraun, wie sie jedem erschien, sondern blass, blassgrün. Ihre Augen hatten keine Pupillen … oder waren ihre Pupillen und ihre Iris vielleicht nur von dem gleichen Schwarz? Als von den anderen gerade keine hinsah, warf sie mir mit klimpernden Augenlidern einen Blick zu. Sie schien zwei zu haben. Augenlider, meine ich. An jedem Auge. Es fiel mir auf, weil sie sich so weit zu mir herunterbeugte.
»Willkommen, Schwester«, murmelte sie mir ins Ohr, und schon hatte sie sich wieder aufgerichtet und strahlte die anderen an. »Was darf ich Ihnen denn bringen?«, fragte sie mit einem perfekten Louisiana-Akzent.
»Nun, Gabe, zuerst will ich Ihnen gleich mal sagen, dass die meisten von uns auch im Service arbeiten und wir Ihnen keinen Ärger machen werden«, sagte Holly.
Gabe erwiderte ihr Zwinkern. »Das freut mich sehr! Nicht dass Sie Mädels hier am Tisch nach Ärger aussehen. Ich mag die Damenabende.«
Während meine Freundinnen ihre Drinks und ihre Portionen frittiertes Gemüse oder Tortilla-Chips bestellten, sah ich mich noch einmal im Club um und fand meinen ersten Eindruck bestätigt. Keiner der Kellner war ein Mensch. Die einzigen Menschen hier waren die Gäste.
Als ich dran war, bestellte ich mir ein Bud Light. Gabe beugte sich noch einmal zu mir herunter: »Wie geht’s denn dem prachtvollen Vampir, Schätzchen?«
»Prima«, erwiderte ich steif, auch wenn das nur wenig mit der Wahrheit zu tun hatte.
»Wie witzig!«, rief Gabe und gab mir einen Klaps auf die Schulter, so als hätte ich etwas besonders Geistreiches gesagt. »Ladys, alles klar so weit? Ich geh dann mal Ihr Essen bestellen und Ihre Drinks holen.« Ihr blondes Haar leuchtete wie ein Leuchtturm, als sie sich mit routinierten Manövern durch die Menge davonschob.
»Ich wusste gar nicht, dass du die Angestellten hier alle kennst. Aber genau, wie geht’s Eric eigentlich? Seit dem Brand im Merlotte’s habe ich ihn gar nicht mehr gesehen«, sagte Kennedy. Sie hatte Gabes Frage offenbar mitgekriegt. »Eric ist wirklich ein wahrer Prachtkerl.« Sie nickte wissend.
Dem stimmten alle meine Freundinnen im Chor zu. Ja, Eric war wirklich unbestreitbar ein Bild von einem Mann. Der Umstand, dass er tot war, sprach allerdings gegen ihn, vor allem in Taras Augen. Sie hatte auch Claude kennengelernt und war nicht weiter darauf eingegangen, dass er irgendwie anders wirkte. Aber Eric, der nie auch nur versuchte, als Mensch durchzugehen, würde immer auf ihrer schwarzen Liste stehen. Tara hatte mal richtig schlechte Erfahrungen mit einem Vampir gemacht, und das hatte sich ihr unauslöschlich eingeprägt.
»Er kommt kaum mal aus Shreveport raus, weil er so viel Arbeit hat«, sagte ich. Mehr aber auch nicht. Über Erics Geschäfte zu reden war immer unklug.
»Und es macht ihm nichts aus, dass du anderen Männern beim Strippen zusiehst? Das hast du ihm doch bestimmt erzählt, oder?«, fragte Kennedy mit einem strahlenden, aber angespannten Lächeln. Ja, es gab definitiv Schwierigkeiten im Kennedy-und-Danny-Land. Aber nein, danke, darüber wollte ich gar nichts wissen.
»Ich glaube, Eric ist so überzeugt davon, auch nackt gut auszusehen, dass er nichts dagegen hat, wenn ich andere so sehe«, erwiderte ich. Ich hatte Eric erzählt, dass ich ins Hooligans gehe. Allerdings hatte ich ihn nicht um Erlaubnis gefragt – so wie Kennedy ihren eigenen Worten nach Danny –, ich ließ mich schließlich nicht von ihm herumkommandieren. Doch die Frage, was er wohl geantwortet hätte, war mir natürlich auch durch den Kopf geschwirrt. Seit ein paar Wochen liefen die Dinge zwischen uns nicht allzu glatt. Ich wollte unser angeschlagenes Boot nicht gefährden – nicht wegen so einer albernen Sache.
Mein Schatz hatte nicht nur ein entspanntes Verhältnis dazu, dass ich andere Männer nackt sah; er machte sich auch keine Sorgen über das Ziel unseres kleinen Ausflugs. Er schien sich nicht mal vorstellen zu können, dass im Stripclub von Monroe irgendeine Gefahr lauern könnte. Sogar Pam, seine Stellvertreterin, hatte bloß die Achseln gezuckt, als Eric ihr erzählt hatte, welches Amüsement wir Menschenfrauen uns ausgeguckt hatten. »Da gibt’s keine Vampire«, hatte sie nur gesagt und das Thema wieder fallen lassen, allerdings nicht ohne den symbolischen Seitenhieb auf Eric, dass ich ja wohl unbedingt mal andere Männer im Adamskostüm sehen wolle.
Mein Cousin Claude hatte alle möglichen heimatlosen Elfen im Hooligans aufgenommen, seit die Portale zur Elfenwelt von meinem Urgroßvater Niall geschlossen worden waren. Er hatte sie aus einem Impuls heraus plötzlich versiegelt, in völliger Umkehr seiner bisherigen Politik, dass Menschen und Elfen sich ungehindert miteinander vermischen sollten. Nicht alle Elfen und andere Geschöpfe des Elfenvolks hatten Zeit gehabt, in die Elfenwelt zurückzukehren, bevor diese Portale sich schlossen. Nur ein sehr kleines, das im Wald hinter meinem Haus lag, stand noch einen winzigen Spalt offen. Und von Zeit zu Zeit drangen Neuigkeiten daraus hervor.
Da sie anfangs meinten, die Einzigen zu sein, waren Claude und mein Großonkel Dermot bei mir eingezogen. In meiner Nähe hofften sie, etwas Geborgenheit zu finden, denn auch ich habe ja einen Schuss Elfenblut. Das Leben im Exil war schrecklich für sie. Sosehr sie die Welt der Menschen bis dahin auch geliebt hatten, jetzt sehnten sie sich nach ihrer Heimat.
Mit der Zeit waren dann weitere Geschöpfe des Elfenvolks im Hooligans aufgetaucht, und inzwischen wohnten Dermot und Claude, vor allem Claude, nicht mehr ständig bei mir. Was mir eine Menge Probleme ersparte – Eric konnte nicht über Nacht bei mir bleiben, wenn die beiden Elfen im Haus waren, einfach weil der Elfengeruch so berauschend wirkt auf Vampire. Doch gelegentlich vermisste ich Großonkel Dermot, den ich immer gern um mich gehabt hatte.
Gerade als ich an ihn dachte, entdeckte ich Dermot hinter dem Tresen. Er war zwar der Bruder meines Elfengroßvaters, doch er sah kein bisschen älter aus als Ende zwanzig.
»Sookie, da ist einer deiner Verwandten«, sagte Holly. »Seit Taras Baby-Party hab ich ihn gar nicht mehr gesehen. Mein Gott, er sieht wirklich genauso aus wie Jason!«
»Die Familienähnlichkeit ist sehr groß«, gab ich zu. Ich warf einen Blick auf Jasons Freundin Michele, die ganz und gar nicht erfreut war, Dermot zu sehen. Sie hatte Dermot mal getroffen, als er noch durch einen Fluch mit Wahnsinn geschlagen war. Inzwischen war er wieder bei Sinnen, das wusste sie, aber sie würde sich wohl trotzdem nicht allzu schnell für ihn erwärmen können.
»Ich hab nie verstanden, wie genau du mit ihm verwandt bist«, meinte Holly. In Bon Temps kannte jeder die Familie des anderen und wusste, wer mit wem verwandt war.
»Da gab’s mal ein uneheliches Kind«, erklärte ich zurückhaltend. »Aber mehr sag ich dazu nicht. Ich hab’s selbst erst nach Grans Tod erfahren, aus alten Unterlagen der Familie.«
Holly blickte wissend drein, was schon eine Leistung war für sie.
»Wenn du mit der Geschäftsleitung hier so gut stehst, kriegen wir da einen Drink aufs Haus oder so was?«, fragte Kennedy. »Vielleicht einen Striptanz am Tisch gratis?«
»Schätzchen, du willst garantiert nicht, dass sich einer der Stripper auf deinen Schoß setzt!«, meinte Tara. »Wer weiß, wo das Ding schon überall gesteckt hat!«
»Du bist doch bloß sauer, weil du keine Chancen mehr hast«, murmelte Kennedy vor sich hin, und ich warf ihr einen vielsagenden Blick zu. Tara war hypersensibel in dieser Hinsicht, da sie ihre gute Figur verloren hatte.
»Hey, sie haben doch schon einen Tisch direkt an der Bühne für uns reserviert«, erwiderte ich. »Jetzt wollen wir mal nicht gleich übertreiben.«
Zum Glück kamen in diesem Augenblick unsere Drinks. Gabe bekam ein fürstliches Trinkgeld von uns allen.
»Lecker«, sagte Kennedy nach einem großen Schluck. »Das ist ’n echt abgefahrener Apple Martini.«
Wie auf ein Zeichen hin erloschen in diesem Augenblick die Lampen des Nachtclubs, und die Bühne erstrahlte im Glanz der Scheinwerfer. Die Musik begann zu spielen, und dann kam Claude herausstolziert – in silbrig glitzernden Trikothosen und Stiefeln, und sonst nichts.
»Großer Gott, Sookie, der ist ja echt zum Anbeißen!«, rief Holly, und ihre Worte flogen direkt in Claudes scharfe Elfenohren. (Die Spitzen hatte er sich operativ entfernen lassen, damit er keine Kraft darauf verschwenden musste, wie ein Mensch auszusehen. Aber sein Gehör hatte diese Prozedur natürlich nicht beeinträchtigt.) Claude sah zu unserem Tisch herüber, und als er mich entdeckte, lächelte er. Er wackelte mit dem Hintern, dass seine Hose im Licht der Scheinwerfer nur so glitzerte, und die sich in dem Club drängenden Frauen begannen erwartungsvoll zu klatschen.
»Ladys«, sprach Claude ins Mikrofon, »sind Sie bereit, sich im Hooligans zu amüsieren? Sind Sie bereit für ein paar fantastische Männer, die Ihnen zeigen werden, was sie zu bieten haben?« Er fuhr sich mit der Hand über seinen bewundernswerten Waschbrettbauch und hob eine Augenbraue – zwei völlig unspektakuläre Gesten, die ihn aber unglaublich sexy und unglaublich anzüglich wirken ließen.
Die Musik wurde lauter, und das Publikum kreischte. Selbst die hochschwangere Tara stimmte mit ein in den begeisterten Chor, als hinter Claude nacheinander aufgereiht Männer auf die Bühne getanzt kamen. Einer von ihnen trug eine Polizeiuniform (falls Polizisten sich denn je entschließen sollten, ihre Hosen mit Glitzersteinen zu schmücken), einer hatte ein Lederkostüm an, einer war als Engel gekleidet – wirklich, sogar mit Flügeln! Und der Letzte in der Reihe war …
Plötzlich herrschte Totenstille an unserem Tisch. Wir alle saßen da, den Blick gebannt auf die Bühne gerichtet, und wagten es nicht, zu Tara hinüberzusehen.
Denn der letzte Stripper in der Reihe war ihr Ehemann JB du Rhone – als Bauarbeiter verkleidet, mit Schutzhelm, Sicherheitsweste, falschem Blaumann und einem schweren Werkzeuggürtel um die Hüfte. Statt Schraubenschlüsseln und Schraubenziehern steckten in den Schlaufen jedoch andere nützliche Dinge wie ein Cocktailshaker, ein Paar flauschige Handschellen und einige andere Sachen, die ich nicht erkennen konnte.
Es war nicht zu übersehen, dass Tara keine Ahnung davon gehabt hatte.
Von allen Oh, Scheiße!-Momenten meines Lebens war dies der OSM Nummer eins.
Alle Ladys aus Bon Temps saßen wie versteinert da, als Claude die Männer unter ihren Strippernamen vorstellte (JB war »Randy«). Eine von uns musste das Schweigen brechen. Und plötzlich sah ich ein Licht am Ende des Tunnels.
»Oh, Tara«, begann ich in einem so ernsten Tonfall, wie man ihn nur anschlagen konnte. »Das ist ja so lieb von ihm.«
Die anderen drehten sich alle gleichzeitig zu mir um, im Gesicht die verzweifelte Hoffnung, ich möge diese schrecklich peinliche Situation irgendwie retten. In Taras Gedanken konnte ich zwar lesen, dass sie JB am liebsten im Schlachthof abgeliefert hätte mit der Anweisung an den Metzger, ihn zu Hackfleisch zu verarbeiten. Doch ich stürzte mich auf meine Aufgabe.
»Das tut er natürlich nur für dich und die Babys«, fuhr ich fort und legte alle Ernsthaftigkeit, die ich aufbringen konnte, in meine Stimme. Ich beugte mich zu ihr hinüber und ergriff ihre Hand. Sie sollte mich über den Lärm der Musik hinweg unbedingt verstehen. »Das Extrageld, das er damit verdient, ist natürlich als große Überraschung für dich gedacht.«
»Nun«, erwiderte Tara steif. »Ich bin enorm überrascht.«
Aus dem Augenwinkel heraus sah ich, wie Kennedy die Augen schloss aus Dankbarkeit für diese Idee. Die Erleichterung, die durch Hollys Gedanken flutete, konnte ich quasi spüren. Und auch Michele entspannte sich sichtlich. Jetzt, da die anderen einen Weg vor sich sahen, beschritten sie ihn alle. Kennedy begann sofort, die äußerst glaubwürdige Geschichte zu erzählen, dass JB ihr bei seinem letzten Besuch im Merlotte’s anvertraut habe, welche Sorgen er sich wegen der Arztrechnungen mache.
»Weil ihr ja Zwillinge kriegt, hat er Angst, dass du deswegen länger im Krankenhaus bleiben musst«, fabulierte Kennedy. Sie dachte sich das meiste von all dem aus, doch es klang gut. Während ihrer Laufbahn als Schönheitskönigin (und vor ihrer Laufbahn als verurteilte Straftäterin) war Kennedy zu einer Meisterin vorgetäuschter Aufrichtigkeit geworden.
Schließlich schien Tara sich etwas zu entspannen, doch ich überwachte ihre Gedanken, damit wir die Situation im Griff behielten. Sie wollte keine größere Aufmerksamkeit auf unseren Tisch ziehen, indem sie uns alle zum Gehen aufforderte, was ihr erster Gedanke gewesen war. Und als Holly zögernd anmerkte, dass wir natürlich auch gehen könnten, falls es Tara zu unangenehm sei, warf Tara uns allen einen verbissenen Blick zu. »Ach was, auf keinen Fall«, sagte sie.
Gott sei Dank kamen dann unsere nächsten Drinks, und kurz darauf wurde das Essen serviert. Wir bemühten uns alle, so zu tun, als wäre gar nichts Ungewöhnliches passiert, und das gelang uns auch schon ziemlich gut, als die Musik immer lauter »Touch My Nightstick« zu spielen begann und so den Auftritt des »Polizisten« ankündigte.
Er war ein vollblütiger Elf, etwas zu schlank für meinen Geschmack, aber er sah wirklich gut aus. Einen hässlichen Elf würde man auch nicht finden. Und er konnte tatsächlich tanzen, und es machte ihm auch noch Spaß. Jeder Zentimeter seines nach und nach freigelegten Körpers war genau so muskulös und verführerisch, wie er nur sein konnte. »Dirk« hatte ein fantastisches Gefühl für Rhythmus und schien sich bestens zu amüsieren. Er schwelgte lustvoll in der Freude, im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen. Waren etwa alle Elfen so selbstverliebt wie Claude und sich ihrer eigenen Schönheit genauso bewusst?
Dirk wirbelte in sexy Verrenkungen über die Bühne, und eine schockierende Anzahl Dollarscheine wurden ihm in den winzigen Männertanga gesteckt, der nach einiger Zeit sein einziges noch verbliebenes Kleidungsstück war. Es war klar, dass Dirk von der Natur großzügig bestückt worden war und dass er die Aufmerksamkeit genoss. Hin und wieder versuchte eine besonders kesse Frau, ihn zu streicheln, doch Dirk wich sofort zurück und hob tadelnd den Finger ob dieser Frechheit.
»Och«, rief Kennedy, als das zum ersten Mal geschah, und ich musste ihrem Gefühl irgendwie beipflichten. Doch Dirk war tolerant, wenn nicht sogar auffordernd. Einer besonders großzügigen Spenderin gab er einen flüchtigen Kuss, was das Gekreisch noch weiter anheizte. Im Abschätzen von Trinkgeld bin ich eigentlich ziemlich gut, aber ich konnte nicht mal ansatzweise erraten, wie viel Dirk bekommen hatte, als er die Bühne schließlich verließ – zumal er in Abständen immer wieder mal Hände voller Dollar an Dermot weiterreichte. Der Auftritt endete haargenau mit den letzten Takten der Musik, und nach einer Verbeugung verließ Dirk die Bühne.
Schon kurz darauf hatte der Stripper seine glitzernde Polizeihose wieder angezogen (wenn auch nur die) und kam noch einmal heraus, mischte sich unter das Publikum und lächelte nickend, wenn Frauen ihm Drinks, Telefonnummern und noch mehr Bargeld anboten. Dirk nippte nur einmal kurz an den Drinks, nahm die Telefonnummern mit einem charmanten Lächeln entgegen und stopfte sich die Dollarscheine in den Hosenbund, bis es aussah, als würde er einen grünen Gürtel tragen.
Diese Art von Entertainment würde ich selbst zwar nicht regelmäßig brauchen, doch ehrlich gesagt konnte ich auch nicht erkennen, was daran so schlimm sein sollte. Hier konnten mal die Frauen völlig ungefährdet johlen, kreischen und ausgelassen toben. Und sie amüsierten sich offenbar bestens. Selbst wenn einige dieser Frauen so fasziniert waren, dass sie jede Woche herkamen (eine Menge Gedanken verrieten mir eine Menge Dinge) – was soll’s, es war doch bloß ein Abend. Die Ladys wussten nicht, dass sie sich für Geschöpfe aus der Elfenwelt begeisterten, okay. Aber gerade diese Unkenntnis, dass die von ihnen so bewunderten Körper (abgesehen von JBs) und Fähigkeiten übernatürlicher Herkunft waren, trug bestimmt nicht unerheblich zu ihrem Spaß bei.
Die anderen Stripper boten Ähnliches. Der Engel »Gabriel« war alles andere als engelsgleich, und als er sich zu den Klängen von »Your Heavenly Body« scheinbar von seinen Flügeln befreite (ich hätte schwören können, dass sie noch dran waren, wenn auch unsichtbar), flatterten weiße Federn durch die Luft und danach auch fast alles andere, das er angehabt hatte. Wie der Polizist war er topp in Form und offensichtlich bestens bestückt. Und außerdem war er glatt rasiert wie ein Babypopo, auch wenn’s schwerfiel, ihn und das Wort »Baby« in demselben Gedanken unterzubringen. Die Frauen griffen nach den herumflatternden Federn und nach dem Geschöpf, das sie getragen hatte.
Als Gabriel danach noch einmal zum Publikum herauskam – die Flügel jetzt wieder sichtbar und nur angetan mit einem weißen Monokini –, musterte Kennedy ihn, als er zufällig an unserem Tisch stehen blieb. Kennedy hatte auch die letzten paar Hemmungen verloren, die sie noch gehabt haben mochte, während ihre Drinks einer nach dem anderen dahingeschwunden waren. Der Engel sah Kennedy mit glühend goldenem Blick tief in die Augen – das zumindest war es, was ich mitbekam. Kennedy reichte ihm mit einem anzüglich schiefen Grinsen ihre Visitenkarte und strich ihm über den Waschbrettbauch. Als er sich von ihr abwandte, schob ich ihm sanft einen Fünfdollarschein in die Hand und zog Kennedys Karte wieder heraus. Die goldenen Augen sahen mich direkt an.
»Schwester«, raunte er. Sogar im aufbrandenden Lärm über den Auftritt des nächsten Strippers konnte ich seine Stimme hören.
Er lächelte und ließ sich zu meiner großen Erleichterung davontreiben. Hastig verbarg ich Kennedys Karte in meiner Handtasche. Allerdings nicht ohne im Geiste die Augen zu verdrehen, dass eine Teilzeit-Barkeeperin überhaupt eine Visitenkarte besaß; typisch Kennedy.
Tara hatte bislang zumindest keinen schrecklichen Abend verlebt. Doch als der Augenblick herannahte, in dem JB die Bühne betreten würde, wuchs die Anspannung an unserem Tisch unweigerlich. Schon als er mitten auf der Bühne als »Randy« zu den Klängen von »Nail-Gun Ned« zu tanzen begann, war klar, dass er nicht wusste, dass seine Frau im Publikum saß. (JBs Gedanken sind wie ein offenes Buch mit ungefähr zwei Wörtern pro Seite.) Seine Tanzeinlage war erstaunlich professionell. Ich jedenfalls hatte nicht mal geahnt, wie gelenkig JB war. Wir Ladys aus Bon Temps bemühten uns nach Kräften, den Blick der anderen zu meiden.
Randy amüsierte sich einfach prächtig. Als auch er sich schließlich bis auf seinen Männertanga ausgezogen hatte, teilten alle – okay, fast alle – seine Begeisterung, wie die Anzahl der Dollarscheine, die er einstrich, bewies. In JBs Gedanken las ich, dass all diese Bewunderung ein großes Bedürfnis in ihm stillte. Seine schwangere Ehefrau hatte es langsam satt, jedes Mal vor Wollust zu glühen, wenn sie ihn nackt sah. Doch JB war so gewöhnt an Bestätigung, dass er geradezu danach gierte – ganz egal, wie er sie bekam.
Tara hatte etwas vor sich hin gemurmelt und den Tisch verlassen, als ihr Ehemann auftrat, sodass er sie nicht sah, als er direkt vor uns über die Bühne tanzte. In dem Moment, als er uns so nahe kam, dass er erkannte, wer wir waren, huschte ein sorgenvoller Schatten über sein schönes Gesicht. Doch er war Entertainer genug, um einfach weiterzumachen, ein Glück. Ich war sogar ein bisschen stolz auf JB. Selbst in diesem arktisch klimatisierten Club schwitzte er bei seinen Drehungen und Windungen. Er wirkte kraftvoll, athletisch und sexy. Und wir alle beobachteten besorgt, ob er genauso viel Trinkgeld bekam wie die anderen Stripper, auch wenn wir es ein bisschen heikel fanden, selbst etwas beizusteuern.
Als JB die Bühne verlassen hatte, kam Tara zurück. Sie setzte sich und sah mit äußerst seltsamer Miene in unsere Runde. »Ich hab’s mir von dort hinten aus angesehen«, gab sie zu, da wir alle angespannt warteten. »Hat er ziemlich gut gemacht.«
Wir atmeten auf, quasi unisono.
»Schätzchen, er war richtig, richtig gut«, versicherte Kennedy und nickte so begeistert, dass ihr kastanienbraunes Haar hin und her schwang.
»Du kannst von Glück sagen, so einen Ehemann zu haben«, warf Michele ein. »Und eure Babys werden hinreißend sein und eine wahnsinnig gute Körperbeherrschung haben.«
Wir wussten nicht, wie viel eventuell zu viel sein könnte in so einem Fall, und daher waren wir alle erleichtert, als der laute Chor von »Born to Ride Rough« den Auftritt des Strippers in Leder ankündigte. Er war zumindest teilweise ein Dämon, von einem Stamm allerdings, dem ich noch nie begegnet war. Seine Haut war rötlich, was meine Freundinnen vermuten ließ, er könnte amerikanischer Ureinwohner sein. (So sah er meiner Ansicht nach ganz und gar nicht aus, doch ich wollte nicht widersprechen.) Aber es stimmte schon, er hatte glattes schwarzes Haar und dunkle Augen und wusste, wie man einen Tomahawk schwang. Seine Brustwarzen waren gepierct, was mich nicht besonders anmachte, bei vielen im Publikum jedoch gut anzukommen schien.
Ich klatschte und lächelte, doch in Wahrheit begann ich, mich ein bisschen zu langweilen. Im Gegensatz zu Eric war ich in letzter Zeit emotional nicht mehr auf derselben Wellenlänge unterwegs, auch wenn wir im Hinblick auf Sex prima harmonierten (keine Ahnung, wie das möglich war). So langsam begann ich zu glauben, dass ich verwöhnt war. Denn so etwas wie langweiligen Sex gab es mit Eric nicht.
Ob er wohl für mich tanzen würde, wenn ich ihn lieb darum bitte, fragte ich mich. Einen Augenblick lang gab ich mich einer sehr schönen Fantasie darüber hin, doch dann erschien Claude wieder auf der Bühne, immer noch in seiner silbrig glitzernden Trikothose und Stiefeln.
Claude war absolut überzeugt davon, dass alle Anwesenden es kaum erwarten konnten, noch mehr von ihm zu sehen zu bekommen, und diese Art Selbstvertrauen zahlte sich aus. Auch er war extrem biegsam und gelenkig.
»Oh mein Gott!«, rief Michele, und ihre rauchige Stimme brach beinah. »Na! Der braucht eigentlich nicht mal einen Partner, was?«
»Wow.« Holly stand der Mund offen.
Sogar ich, die ihn schon in seiner ganzen Pracht zu sehen bekommen hatte und zudem wusste, wie unausstehlich Claude sein konnte – sogar ich spürte eine kleine Erregung dort unten, wo ich in diesem Fall nichts spüren sollte. Claudes Freude an all der Aufmerksamkeit und Bewunderung war fast rührend in ihrer Reinheit.
Zum großen Finale des Abends sprang Claude von der Bühne und tanzte in seinem Männertanga durch das Publikum. Alle schienen wild entschlossen, auch ihre letzten Dollarscheine noch loswerden zu wollen – und ihre Fünfer und ein paar Zehner. Claude verteilte mit großer Hingabe Küsse, doch intimeren Berührungen wich er mit einer Wendigkeit aus, die ihn fast schon als ein übernatürliches Geschöpf verraten hätte. Als er sich unserem Tisch näherte, steckte Michele ihm einen Fünfer in den G-String und sagte: »Das hast du echt verdient, Kumpel«, und Claude erwiderte ihr Lächeln mit einem Strahlen. Dann blieb er neben mir stehen und gab mir einen Kuss auf die Wange. Ich erschrak. Die Frauen an den umliegenden Tischen kreischten und verlangten auch nach einem Kuss. Ich blieb zurück mit dem Bild seines glühenden dunklen Blicks vor Augen und dem unerwarteten Schauer, den die Berührung seiner Lippen hinterließ.
Jetzt wollte ich nur noch ein großzügiges Trinkgeld für Gabe dalassen und hier verschwinden.
Tara fuhr uns alle zurück, da Michele sagte, sie sei zu beschwipst. Ich wusste, dass Tara froh war, einen Grund zu haben, nichts sagen zu müssen. Die anderen plapperten dafür umso mehr und gaben Tara so Zeit, mit den Ereignissen des Abends fertigzuwerden.
»Ich hoffe, mir hat’s nicht zu gut gefallen«, sagte Holly gerade. »Ich fänd’s schrecklich, wenn Hoyt dauernd in einen Stripclub gehen würde.«
»Würde es dir was ausmachen, wenn er ein Mal hinginge?«, fragte ich.
»Na ja, schön fänd ich’s nicht«, gab sie aufrichtig zu. »Aber wenn er hinginge, weil er zu einer Junggesellenparty eingeladen ist oder so was, würde ich deshalb keinen großen Aufstand machen.«
»Ich fänd’s schrecklich, wenn Jason hinginge«, warf Michele ein.
»Glaubst du denn, er würde dich mit einer Stripperin betrügen?«, fragte Kennedy. Da sprach bestimmt der Alkohol.
»Wenn er das täte, würde er hochkantig rausfliegen, mit einem blauen Auge«, erwiderte Michele mit einem hämischen Schnauben. Doch schon einen Augenblick später fügte sie in milderem Tonfall hinzu: »Ich bin etwas älter als Jason, und mein Körper ist vielleicht nicht mehr so ganz das, was er mal war. Ich sehe großartig aus nackt, versteht mich nicht falsch. Aber wahrscheinlich nicht so großartig wie diese jungen Stripperinnen.«
»Männer sind nie zufrieden mit dem, was sie haben, egal wie gut es ist«, murmelte Kennedy.
»Was ist los mit dir, Schätzchen? Hast du dich mit Danny wegen einer anderen Frau verkracht?«, fragte Tara völlig unverblümt.
Kennedy warf Tara einen strahlenden, aber harten Blick zu, und einen Moment lang glaubte ich, sie würde etwas Schneidendes erwidern. Dann hätten wir hier einen offenen Streit. Doch Kennedy erwiderte: »Da läuft irgendwas Geheimes, und er will mir nicht sagen, was es ist. Am Montag, Mittwoch und Freitag ist er morgens und abends nie da. Aber er will mir nicht erzählen, wohin er geht, und auch nicht, warum.«
Da die Tatsache, dass Danny absolut vernarrt war in Kennedy, auch dem Dümmsten sonnenklar war, verschlug es uns allen vor lauter Verwunderung ob ihrer Blindheit die Sprache.
»Hast du ihn mal gefragt?«, sagte Michele schließlich in ihrer direkten Art.
»Um Gottes willen, nein!« Kennedy war zu stolz (und zu ängstlich, aber das wusste nur ich), um Danny geradeheraus zu fragen.
»Nun, ich weiß zwar nicht, wen ich fragen soll oder was, aber wenn ich etwas höre, erzähl ich’s dir. Ich glaube, du musst dir wirklich keine Sorgen darüber machen, dass Danny dich betrügt«, sagte ich. Wie konnte sich hinter einem so schönen Gesicht nur eine so massive Unsicherheit verbergen, wunderte ich mich.
»Danke, Sookie.« Ein leichtes Schluchzen lag in ihrer Stimme. Ach du meine Güte. Mit einem Mal war die ganze Freude des Abends verflogen.
Wir kamen keinen Augenblick zu früh vor meinem Haus an. In meinem lebhaftesten, fröhlichsten Tonfall verabschiedete ich mich, dankte allen, und dann eilte ich auch schon auf meine vordere Haustür zu. Die große Sicherheitslampe war natürlich eingeschaltet, und Tara fuhr natürlich auch erst weiter, nachdem ich die Tür erreicht und aufgeschlossen hatte und im Haus verschwunden war. Ich schloss umgehend hinter mir ab. Denn auch wenn rund ums Haus Schutzzauber gezogen waren, um übernatürliche Feinde fernzuhalten, konnten Schlösser und Schlüssel doch nie schaden.
Ich hatte heute nicht nur gearbeitet, sondern auch ein lärmendes Publikum und dröhnend pulsierende Musik ertragen, und dann waren da noch all die Dramen meiner Freundinnen. Wenn man Gedanken lesen kann, ist man irgendwann ziemlich erschöpft. Doch ganz im Widerspruch dazu fühlte ich mich viel zu aufgedreht und ruhelos, um direkt ins Schlafzimmer zu gehen. Ich beschloss, noch nach meinen E-Mails zu sehen.
Es war schon einige Tage her, seit ich Gelegenheit gehabt hatte, mich an den Computer zu setzen. Ich hatte zehn Nachrichten bekommen. Zwei waren von Kennedy und Holly, die mir schrieben, wann sie mich abholen kämen. Da das bereits erledigt war, löschte ich beide. Die nächsten drei waren Werbemails. Die machte ich gar nicht erst auf. Amelia hatte mir einen kurzen Gruß mit einem Anhang geschickt, der sich als ein Foto von ihr und ihrem Freund Bob in einem Café in Paris herausstellte. »Der Freundeskreis hier drüben ist sehr gastfreundlich. Ich glaube, mein kleines Problem mit meinem NICHT-Freundeskreis ist mir verziehen worden. Was ist mit uns beiden?«
»Freundeskreis« war Amelias Codewort für »Hexenzirkel«. Amelias kleines Problem war aufgetreten, nachdem sie Bob aus Versehen in einen Kater verzaubert hatte. Und jetzt, da er wieder ein Mensch war, hatten die beiden ihre Beziehung fortgesetzt. Man stelle sich vor. Und nun Paris! »Manche Leute stehen einfach auf der Sonnenseite des Lebens«, sagte ich laut vor mich hin. Und was Amelia und mich betraf – sie hatte mich tief verletzt mit ihrem Versuch, Alcide Herveaux in mein Sexleben hineinzubugsieren. So etwas hätte ich nie von ihr erwartet. Nein, ich hatte ihr noch nicht endgültig verziehen, aber ich bemühte mich.
In diesem Augenblick klopfte es leise an meiner vorderen Haustür. Ich erschrak und fuhr herum in meinem Drehstuhl. Ich hatte weder ein Auto noch Schritte gehört. Normalerweise hieß das, ein Vampir stand vor der Tür. Doch als ich meine Spezialfühler ausstreckte, war das Hirn, auf das ich traf, nicht jener Punkt tiefer Stille eines Vampirs, sondern etwas ganz anderes.
Wieder klopfte es leise. Nervös trat ich ans Fenster und spähte hinaus. Dann entriegelte ich die Tür und riss sie auf.
»Urgroßvater!«, rief ich und warf mich ihm in die Arme. »Ich dachte, ich würde dich nie wiedersehen! Wie geht es dir? Komm doch herein!«
Niall roch einfach wundervoll – wie alle Elfen. Für ein paar besonders empfindliche Vampirnasen verströme auch ich einen Anflug von diesem Duft, obwohl ich selbst ihn nicht wahrnehmen kann.
Mein Exfreund Bill hatte mir mal erzählt, dass die Elfen für ihn so rochen, wie seiner Erinnerung nach ein frischer Apfel schmeckte.
Umhüllt von der überwältigenden Aura meines Urgroßvaters erlebte ich eine Gefühlsaufwallung und Verwunderung, die ich immer verspürte, wenn ich in seiner Nähe war. Hochgewachsen und majestätisch stand er da in seinem makellosen schwarzen Anzug mit dem weißen Hemd und der schwarzen Krawatte. Niall wirkte schön und altertümlich zugleich.
Und er war auch ein kleines bisschen unzuverlässig, wenn es um Fakten ging. Die Tradition besagt, Elfen können nicht lügen, und auch die Elfen selbst werden einem das stets erzählen – aber eigentlich umgehen sie die Wahrheit, wann immer es ihnen passt. Manchmal dachte ich, dass Niall eben schon so lange lebte und seine Erinnerung ihn einfach trog. Es war zwar schwierig, sich darauf zu besinnen, wenn ich in seiner Nähe war, aber ich zwang mich, es im Hinterkopf zu behalten.
»Mir geht es gut, wie du siehst.« Mit einer Geste wies er an seiner prachtvollen Erscheinung herab; doch zu seiner Ehrenrettung sei angemerkt, dass er meine Aufmerksamkeit sicher einfach nur auf seinen völlig unverletzten Zustand lenken wollte. »Und du bist wunderschön, wie immer.«
Elfen drücken sich oft auch ein bisschen blumig aus – es sei denn, sie leben schon seit langer Zeit unter den Menschen, so wie Claude.
»Ich dachte, du wärst hinter den versiegelten Portalen verschwunden.«
»Ich habe das Portal in deinem Wald vergrößert«, sagte er so, als wäre diese Tat die Folge einer zufälligen Laune. Nach dem großen Aufhebens, das er darum gemacht hatte, das Elfenvolk zum Schutz der Menschheit einzusperren, all seine geschäftlichen Beziehungen zur Menschenwelt zu kappen und so weiter, hatte er jetzt einfach eine Öffnung vergrößert und war durch diese zurückgekommen … um sich nach meinem Wohlergehen zu erkundigen? Dass daran etwas oberfaul war, konnte ja wohl selbst die liebevollste Urenkelin nicht übersehen.
»Ich wusste, dass es dieses Portal gibt«, erwiderte ich, weil mir nichts anderes einfiel.
Er neigte den Kopf. Sein weißblondes Haar bewegte sich wie ein Satinvorhang. »Warst du es, die die Leiche dort hineingeschoben hat?«
»Tut mir leid. Ich wusste nicht, wohin sonst damit.« Die Beseitigung von Leichen war nicht mein größtes Talent.
»Sie wurde vollständig vertilgt, falls das deine Absicht war. Aber lass das in Zukunft bitte sein. Wir wollen uns dort nicht dauernd um das Portal versammeln«, sagte er in milde tadelndem Ton, gerade so als hätte ich ein Haustier vom Abendbrottisch gefüttert.
»Tut mir leid«, wiederholte ich. »Also – warum bist du hier?« Ich nahm die Unverblümtheit meiner Worte wahr und spürte, wie ich rot anlief. »Ich meine, womit habe ich die Ehre deines Besuches verdient? Kann ich dir etwas zu trinken oder zu essen anbieten?«
»Nein, vielen Dank, Liebes. Wo warst du heute Abend? Du riechst nach Elfen und nach Menschen und nach noch vielen anderen Dingen.«
Ich holte einmal tief Luft und versuchte, den Damenabend im Hooligans zu erklären. Mit jedem Satz kam ich mir immer mehr wie ein Dummkopf vor. Nialls Miene war gar nicht zu beschreiben, als ich ihm erzählte, dass Menschenfrauen einmal in der Woche dafür bezahlten, Männern dabei zuzusehen, wie sie sich die Kleidung auszogen. Er verstand es einfach nicht.
»Machen Männer das auch?«, fragte Niall. »In Gruppen in spezielle Häuser gehen und dafür bezahlen, dass sie Frauen beim Ausziehen zusehen?«
»Ja«, bestätigte ich. »Männer machen das noch viel öfter als Frauen. Das ist genau das, was an allen anderen Abenden der Woche im Hooligans stattfindet.«
»Und Claude verdient damit Geld«, sagte Niall verwundert. »Warum bitten die Männer die Frauen nicht einfach, sich die Kleider auszuziehen, wenn sie ihre Körper sehen wollen?«
Ich holte noch einmal tief Luft, atmete aber wieder aus, ohne noch einen weiteren Erklärungsversuch zu unternehmen. Manche Themen sind einfach zu kompliziert, um mal eben so schnell erklärt zu werden, vor allem einem Elf, der nie in unserer Welt gelebt hat. Niall war ein Tourist, kein Ansässiger. »Können wir das ganze Thema nicht ein anderes Mal diskutieren, oder vielleicht auch niemals? Es gibt doch bestimmt etwas viel Wichtigeres, worüber du mit mir reden möchtest«, sagte ich.
»Natürlich. Darf ich mich setzen?«
»Sei mein Gast.« Wir setzten uns aufs Sofa, aber einander zugewandt, sodass wir uns ins Gesicht sahen. Es gibt nichts Schlimmeres als einen Elf, der einen taxiert, um sich jedes einzelnen Makels, den man hat, bewusst zu werden.
»Du hast dich sehr gut erholt«, sagte er zu meiner Überraschung.
»Stimmt«, erwiderte ich und versuchte, den Blick nicht auf meine Oberschenkel zu senken, so als würden all meine Narben durch die Kleidung hindurchschimmern. »Es hat aber eine Weile gedauert.« Niall meinte, ich würde gut aussehen für jemanden, der gefoltert worden war. Denn zwei berühmt-berüchtigte Elfen, deren Zähne so spitz gefeilt gewesen waren wie die der Kobolde, hatten mir so einige ernsthafte körperliche Schäden zugefügt. Niall und Bill waren gerade noch rechtzeitig gekommen, um meinen Körper und meine Seele zu retten, wenn auch nicht all mein Fleisch. »Danke, dass ihr rechtzeitig da wart«, sagte ich und zwang mich zu einem Lächeln. »Ich werde nie vergessen, wie froh ich war, euch alle zu sehen.«
Niall wehrte meine Dankbarkeit mit einem Handwedeln ab. »Du bist meine Blutsverwandte«, sagte er. Das war ihm Grund genug. Ich dachte an meinen Großonkel Dermot, Nialls halb menschlichen Sohn, der überzeugt war, dass Niall ihn durch einen Fluch mit Wahnsinn geschlagen hatte. Irgendwie ein Widerspruch, hm? Ich hätte meinen Urgroßvater fast darauf hingewiesen, doch ich wollte keinen Ärger, weil ich ihn schon so lange nicht gesehen hatte.
»Als ich heute Abend durch das Portal kam, habe ich im Erdboden um dein Haus Blut gerochen«, sagte er plötzlich. »Menschliches Blut, Elfenblut. Und jetzt bemerke ich, dass auch oben in deiner Dachkammer Elfenblut ist, das erst vor Kurzem vergossen wurde. Und es wohnen Elfen hier. Wer?« Nialls sanfte Hände ergriffen meine, und ich spürte, wie mich eine Welle des Wohlgefühls durchflutete.
»Claude und Dermot wohnen hier, ab und zu jedenfalls«, sagte ich. »Wenn Eric länger bei mir bleibt, übernachten sie in Claudes Haus in Monroe.«
Niall sah sehr, sehr nachdenklich drein. »Welchen Grund hat Claude dir dafür genannt, dass er in deinem Haus wohnen will? Warum hast du das erlaubt? Hattest du Sex mit ihm?« Er klang nicht wütend oder erschüttert, aber die Fragen selbst hatten eine gewisse Schärfe.
»Erst einmal, ich habe nie Sex mit Verwandten«, erwiderte ich mit eigener Schärfe in der Stimme. Mein Boss, Sam Merlotte, hatte mir mal erzählt, dass für die Elfen solche Beziehungen nicht unbedingt tabu sind, aber für mich auf jeden Fall. Und noch einmal holte ich tief Luft. Herrje, ich würde noch anfangen zu hyperventilieren, wenn Niall länger blieb.
Ich versuchte es erneut, und diesmal bemühte ich mich, meine Empörung etwas abzuschwächen. »Sex unter Verwandten ist etwas, das Menschen nicht dulden«, erzählte ich ihm und hielt gleich inne, ehe ich noch irgendwelche Bemerkungen hinterherschob. »Ich habe mit Dermot und Claude in einem Bett geschlafen, weil sie mir sagten, dass sie sich dann besser fühlen würden. Und ich gebe zu, dass es auch mir geholfen hat. Sie wirken beide irgendwie verloren, seit sie nicht mehr in die Elfenwelt hineinkönnen. Ein ganzer Haufen Elfenvolk ist draußen geblieben, und es geht ihnen ziemlich miserabel.« Ich tat mein Bestes, um nicht vorwurfsvoll zu klingen, aber das Hooligans war wirklich zu so etwas wie einem Lager für Exilanten geworden.
Niall ließ sich nicht ablenken. »Natürlich will Claude in deiner Nähe sein«, erwiderte er. »Die Gesellschaft anderer, die ebenfalls Elfenblut haben, ist immer erstrebenswert. Hattest du je den Verdacht … dass er andere Gründe haben könnte?«
War das ein Hinweis oder einfach nur ein ganz normales Zögern von Niall beim Sprechen? Ehrlich gesagt, hatte ich tatsächlich schon mal daran gedacht, dass die beiden Elfen einen anderen Grund haben könnten, warum sie sich so sehr zu meinem Haus hingezogen fühlten. Aber ich dachte – ich hoffte –, es wäre etwas, das ihnen gar nicht bewusst war. Dies war die Gelegenheit, mein Herz auszuschütten und mehr Informationen über einen Gegenstand zu erhalten, der sich in meinem Besitz befand. Ich öffnete den Mund, um Niall von dem Geheimfach des alten Schreibtisches zu erzählen und was ich darin gefunden hatte.
Doch mein Sinn für Vorsicht, den ich im Laufe meines Lebens als Telepathin entwickelt hatte … nun ja, dieser Sinn hüpfte auf und ab und schrie: »Halt die Klappe!«
»Glaubst du, sie haben einen anderen Grund?«, fragte ich stattdessen.
Mir fiel auf, dass Niall nur seinen vollblütigen Elfenenkel Claude erwähnt hatte, nicht jedoch seinen halb menschlichen Sohn Dermot. Da Niall sich mir gegenüber immer sehr liebevoll verhalten hatte, obwohl ich nur eine winzige Spur Elfenblut besaß, konnte ich nicht verstehen, warum er Dermot gegenüber nicht ebenso liebevoll war. Dermot hatte einige schlimme Dinge getan, okay; aber zu jener Zeit war er mit einem Fluch belegt gewesen. Niall zeigte jedoch keinerlei Nachsicht mit ihm. Und in diesem Augenblick sah Niall mich skeptisch an, den Kopf zur Seite geneigt.
Meine Wangen verzogen sich zu meinem breitesten Lächeln. Mir wurde immer mulmiger zumute. »Claude und Dermot waren mir eine große Hilfe. Sie haben all die alten Sachen aus der Dachkammer heruntergetragen, die ich dann an einen Antiquitätenladen in Shreveport verkauft habe.« Niall erwiderte mein Lächeln, stand auf, und noch ehe ich »Jack Robinson« sagen konnte, war er die Treppe hinaufgeglitten. Ein paar Minuten später kam er wieder herunter. Ich saß währenddessen einfach nur mit offen stehendem Mund da. Das war selbst für einen Elf ein seltsames Verhalten.
»Du hast dort oben wohl Dermots Blutspuren gerochen?«, fragte ich vorsichtig.
»Mir scheint, ich habe dich irritiert, Liebes.« Niall lächelte mich an, und seine Schönheit wärmte mich. »Warum wurde dort oben in der Dachkammer Blut vergossen?«
Niall benutzte nicht einmal das Pronomen »sein«. »Ein Mensch, der auf der Suche nach mir war, kam ins Haus«, erzählte ich. »Dermot arbeitete zu diesem Zeitpunkt mit einem Schleifgerät und konnte ihn nicht kommen hören. Und da hat der Mensch ihm eins verpasst.« Und weil Niall mich verständnislos ansah, fügte ich erklärend hinzu: »Er hat ihn auf den Kopf geschlagen.«
»Ist es das Blut dieses Menschen, das ich draußen im Erdboden rieche?«
Oje, es waren so viele gewesen. Vampire und Menschen, Werwölfe und Elfen. Darüber musste ich erst einmal einen Augenblick lang nachdenken. »Könnte sein«, erwiderte ich schließlich. »Bellenos hat Dermot geheilt, und sie haben den Kerl gefasst …« Ich hielt inne. Bei der Erwähnung von Bellenos’ Namen flackerten Nialls Augen auf, aber nicht vor Freude.
»Bellenos, der Kobold«, sagte er.
»Ja.«
Abrupt drehte er den Kopf, und ich wusste, dass er etwas gehört hatte, das mir entgangen war.
Wir waren offenbar zu sehr in unser Gespräch vertieft gewesen, um ein Auto die Auffahrt heraufkommen zu hören. Doch Niall hatte den Schlüssel im Schloss gehört.
»Na, Cousine, hat dir die Show gefallen?«, rief Claude von der Küche her, und mir blieb noch Zeit genug, um zu denken: Noch ein OSM, ehe Claude und Dermot ins Wohnzimmer kamen.
Einen Augenblick lang herrschte eisiges Schweigen. Die drei Elfen sahen sich in alle Richtungen um, so als wäre dies die Schießerei mit den Earp-Brüdern am O. K. Corral. Jeder wartete darauf, dass einer der anderen eine Geste machte, die entscheiden würde, ob sie miteinander kämpften oder redeten.
»Mein Haus, meine Regeln«, sagte ich und sprang vom Sofa auf, so als hätte jemand Feuer unter meinem Hintern gelegt. »Keine Prügelei! Nein! Auf keinen Fall!«
Und wieder herrschte angespanntes Schweigen, bis Claude endlich sagte: »Natürlich nicht, Sookie. Prinz Niall – Großvater –, ich hatte gefürchtet, ich würde dich nie wiedersehen.«
»Claude«, sagte Niall und nickte seinem Enkel zu.
»Hallo, Vater«, sagte Dermot sehr leise.
Doch Niall sah seinen Sohn nicht einmal an.
Wie peinlich.
Kapitel 2
Elfen. Immer ein Problem für sich. Meine Großmutter Adele hätte da zweifellos zugestimmt. Sie hatte eine lange Affäre mit Dermots Zwillingsbruder Fintan gehabt, und meine Tante Linda und mein Vater Corbett (beide mittlerweile schon seit Jahren tot) waren die Folgen gewesen.
»Vielleicht ist es an der Zeit, endlich Klartext zu reden«, sagte ich und bemühte mich, zuversichtlich zu wirken. »Niall, vielleicht könntest du uns mal erklären, warum du so tust, als würde Dermot nicht direkt dort stehen. Und warum du ihn mit diesem verrückten Fluch geschlagen hast.« Die Oprah Winfrey für Elfen – das war ich.
Oder auch nicht. Niall sah mich mit seinem herrischsten Blick an.
»Dieser da hat sich mir widersetzt«, sagte er und deutete mit einem Kopfnicken auf seinen Sohn.
Dermot neigte den Kopf. Ich wusste nicht, ob er den Blick gesenkt hielt, um Niall nicht zu provozieren oder um seine Wut zu verbergen, oder ob er einfach nicht wusste, wo er anfangen sollte.
Mit Niall verwandt zu sein, selbst um zwei Ecken, war nicht einfach. Ich konnte mir nicht vorstellen, enger an ihn gebunden zu sein. Wenn Nialls Schönheit und Macht mit einer schlüssigen Handlungsweise und einer edlen Gesinnung einhergegangen wären, hätte er etwas von einem Engel gehabt.
Dieser Gedanke hätte mir in keinem unpassenderen Moment durch den Kopf schießen können.
»Du siehst mich so seltsam an«, sagte Niall. »Was hast du, Liebes?«
»In all der Zeit, die er hier war«, begann ich, »war mein Großonkel immer freundlich, fleißig und umsichtig. Dermot ist bloß psychisch ein bisschen angeknackst, aber das ist eine direkte Folge davon, dass er jahrelang mit Wahnsinn geschlagen war. Warum also hast du das getan? ›Er hat sich mir widersetzt‹ ist nicht wirklich eine Antwort.«
»Du hast kein Recht, mir Fragen zu stellen«, entgegnete Niall in seinem majestätischsten Ton. »Ich bin der einzige noch lebende Elfenprinz.«
»Ich weiß nicht, warum das bedeuten soll, dass ich dir keine Fragen stellen kann. Ich bin Amerikanerin«, sagte ich aufrecht.
Seine schönen Augen musterten mich kühl. »Ich liebe dich«, sagte er äußerst lieblos, »aber du nimmst dir zu viel heraus.«
»Wenn du mich liebst oder mich zumindest auch nur ein bisschen respektierst, müsstest du meine Frage beantworten. Ich liebe Dermot auch.«
Claude stand völlig reglos da, geradezu wie ein Abbild der Neutralität. Ich wusste, dass er sich nicht auf meine Seite schlagen würde, oder auf Dermots, oder auch auf Nialls. Für Claude gab es nur eine Seite, und das war seine eigene.
»Du hast dich mit den Wasserelfen verbündet«, sagte Niall zu Dermot.
»Nachdem du mich mit dem Fluch geschlagen hattest«, protestierte Dermot und sah kurz zu seinem Vater auf.
»Du hast ihnen geholfen, Sookies Vater zu töten«, fuhr Niall fort. »Deinen Neffen.«
»Das habe ich nicht getan«, erwiderte Dermot leise. »Und da irre ich mich nicht. Sogar Sookie glaubt mir und lässt mich hier wohnen.«
»Du warst nicht bei Verstand. Ich weiß, dass du das nie getan hättest, wenn du nicht mit einem Fluch geschlagen gewesen wärst«, sagte ich.
»Da siehst du, wie viel Verständnis sie hat, und trotzdem hast du keins für mich«, sagte Dermot zu Niall. »Warum hast du mich mit diesem Fluch geschlagen? Warum?« Er sah seinen Vater jetzt direkt an, die Empörung stand ihm ins Gesicht geschrieben.
»Aber das habe ich nicht getan«, entgegnete Niall. Er klang ehrlich überrascht. Und endlich wandte er sich direkt an Dermot. »Ich würde nie den Geist meines eigenen Sohnes verwirren, sei er nun zur Hälfte Mensch oder nicht.«
»Claude hat mir erzählt, du hättest mich verflucht.« Dermot sah Claude an, der noch immer abwartete, in welche Richtung die Dinge sich entwickeln würden.
»Claude«, sagte Niall, und die Kraft seiner Stimme ließ meinen Kopf dröhnen, »wer hat dir das gesagt?«
»Das ist doch allgemein bekannt unter dem Elfenvolk«, erwiderte Claude. Er hatte sich auf das hier vorbereitet und war gewappnet, Rede und Antwort zu stehen.
»Sagt wer?« Niall würde nicht so schnell lockerlassen.
»Murray hat es mir erzählt.«
»Murray hat dir erzählt, dass ich meinen Sohn mit einem Fluch geschlagen habe? Murray, der Freund meines Feindes Breandan?« In Nialls vornehmem Gesicht stand Ungläubigkeit.
Der Murray, den ich mit Grans Handspaten getötet habe?, dachte ich, aber mir war klar, dass ich besser nicht dazwischenfunken sollte.
»Murray hat es mir erzählt, ehe er die Seiten wechselte«, erwiderte Claude abwehrend.
»Und wer hat es Murray erzählt?«, fragte Niall mit einem Anflug von Entnervtheit in der Stimme.
»Ich weiß nicht.« Claude zuckte die Achseln. »Er klang so sicher, dass ich ihn nie danach gefragt habe.«
»Claude, komm mit mir«, sagte Niall nach einem Augenblick angespannten Schweigens. »Wir werden mit deinem Vater und dem Rest unserer Leute reden. Wir werden herausfinden, wer dieses Gerücht über mich in die Welt gesetzt hat. Und wir werden herausfinden, wer Dermot wirklich mit diesem Fluch geschlagen hat.«
Ich hatte erwartet, dass Claude begeistert sein würde, denn er hatte unbedingt in die Elfenwelt zurückkehren wollen, seit ihm der Zugang dorthin verwehrt war. Doch er wirkte völlig betrübt, wenn auch nur einen Moment lang.
»Und was ist mit Dermot?«, fragte ich.
»Für ihn ist es zu gefährlich«, sagte Niall. »Derjenige, der ihn mit dem Fluch geschlagen hat, wartet vielleicht nur darauf, ihm wieder etwas anzutun. Ich werde Claude mitnehmen … und, Claude, wenn du irgendwelchen Ärger machst mit deinem menschlichen Verhalten …«
»Schon verstanden. Dermot, würdest du die Leitung des Clubs übernehmen, bis ich wiederkomme?«
»Mach ich«, sagte Dermot, aber er wirkte so benommen von der unerwarteten Entwicklung der Ereignisse, dass ich mir nicht sicher war, ob er wusste, was er sagte.
Niall drückte mir einen Kuss auf den Mund, und der feine Geruch der Elfen stieg mir in die Nase. Und dann glitten Claude und er auch schon durch die Hintertür hinaus und in den Wald hinein. »Gehen« wäre ein viel zu profanes Wort, um die Art ihrer Fortbewegung zu beschreiben.
Dermot und ich blieben allein in meinem unansehnlichen Wohnzimmer zurück. Und zu meiner Bestürzung begann mein Großonkel (der ein klein bisschen jünger aussah als ich) zu weinen. Seine Knie gaben nach, sein ganzer Körper bebte, und er presste die Handballen gegen die Augen.
Mit wenigen Schritten war ich bei ihm und sank neben ihm auf die Knie. Ich legte einen Arm um ihn und sagte: »Das habe ich garantiert auch nicht erwartet.« Was ihn offenbar derart verblüffte, dass er kurz auflachte. Dann hickste er wie von einem Schluckauf und sah mich aus geröteten Augen an. Mit meiner freien Hand griff ich nach der Schachtel Papiertaschentücher auf dem Tisch neben dem Lehnsessel. Ich zog eins heraus und tupfte Dermots feuchte Wangen ab.
»Ich kann gar nicht glauben, dass du so nett zu mir bist«, sagte er. »Es kam mir von Anfang an unglaublich vor, wenn man bedenkt, was Claude dir über mich erzählt hat.«
Das hatte mich selbst etwas überrascht, um die Wahrheit zu sagen.
»Ich bin überzeugt, dass du nicht einmal dort warst an dem Abend, als meine Eltern starben«, sagte ich vollkommen aufrichtig. »Und wenn du dort warst, dann nur unter Zwang. Meiner Erfahrung nach bist du absolut liebenswert.«
Dermot lehnte sich an mich wie ein müdes Kind. Ein ganz normaler Menschenmann hätte sich mittlerweile schon die größte Mühe gegeben, sich zusammenzureißen. Ihm wäre es peinlich gewesen, seine Verletzlichkeit zu zeigen. Dermot dagegen schien sich gern von mir trösten zu lassen.
»Fühlst du dich jetzt besser?«, fragte ich nach ein paar Minuten.
Er atmete tief ein. Ich wusste, dass er meinen Elfenduft einsog und dass er ihm helfen würde. »Ja«, sagte er. »Ja.«
»Du solltest erst mal duschen gehen und dich richtig ausschlafen«, riet ich ihm, bemüht, irgendetwas zu sagen, das nicht total lahm klang oder so, als würde ich mich um ein Kleinkind kümmern. »Wetten, Niall und Claude sind in null Komma nichts wieder zurück, und du wirst …« Doch hier verließen sie mich, denn ich wusste gar nicht, was Dermot eigentlich wollte. Claude hatte sehnsüchtig auf eine Rückkehr in die Elfenwelt gehofft, und dieser Wunsch war ihm nun erfüllt worden. Ich war einfach davon ausgegangen, dass das auch Dermots Ziel wäre. Doch nachdem Claude und ich ihn von dem Fluch befreit hatten, hatte ich ihn nie danach gefragt.
Als Dermot schließlich ins Badezimmer trottete, ging ich durchs Haus und überprüfte alle Fenster und Türen, was Teil meines allabendlichen Rituals war. Und während ich noch Geschirr abwusch und abtrocknete, versuchte ich mir vorzustellen, was Claude und Niall wohl in diesem Moment machten. Wie sah die Elfenwelt aus? So wie das magische Land Oz, in dem Film?
»Sookie«, sagte Dermot hinter mir, und ich fuhr derart zusammen, dass ich gleich wieder im Hier und Jetzt war. Er stand in einer karierten Pyjamahose in der Küche, seinem normalen Schlafzeug. Sein goldblondes Haar war noch feucht vom Duschen.
»Fühlst du dich besser?« Ich lächelte ihn an.
»Ja. Könnten wir heute Nacht zusammen schlafen?«
Es war, als hätte er gefragt: »Können wir uns ein Kamel besorgen und es als Haustier behalten?« Wegen Nialls Frage nach Claude und mir kam mir Dermots Bitte ziemlich seltsam vor. Ich war einfach nicht in elfenliebender Stimmung, egal wie unschuldig es auch gemeint war. Und ehrlich gesagt, ich war mir nicht so sicher, ob er nicht doch meinte, wir sollten mehr tun als nur schlafen. »Ähhhh … nein.«
Dermot wirkte derart enttäuscht, dass ich mich gleich bei Schuldgefühlen ertappte. Das konnte ich nicht ertragen, ich musste es erklären.
»Hör mal, ich weiß, dass du keinen Sex mit mir haben willst, und ich weiß auch, dass wir alle uns schon ein paar Mal zusammen in ein Bett gelegt und dann alle wie ein Stein geschlafen haben … Das hat gutgetan, ja, es war heilsam. Aber es gibt ungefähr zehn Gründe dafür, warum ich das nicht mehr will. Erstens, es ist einfach total bizarr, für einen Menschen. Zweitens, ich liebe Eric, und ich sollte nur mit ihm ins Bett gehen. Drittens, du bist verwandt mit mir, deshalb wird mir geradezu übel, wenn wir in einem Bett miteinander liegen. Und außerdem siehst du meinem Bruder so ähnlich, dass du jederzeit als er durchgehen könntest, und das macht jede auch nur andeutungsweise sexuelle Situation doppelt übelkeiterregend. Ich weiß, das sind keine zehn Gründe, aber ich glaube, das sollte reichen.«
»Findest du mich denn nicht attraktiv?«
»Darum geht’s doch gar nicht!« Meine Stimme wurde lauter, und ich hielt kurz inne, um mich wieder zu beruhigen. Dann sprach ich in leiserem Ton weiter. »Es ist vollkommen egal, wie attraktiv ich dich finde. Natürlich siehst du gut aus. Genau wie mein Bruder. Aber ich fühle mich nicht sexuell zu dir hingezogen, und ich finde dieses In-einem-Bett-schlafen einfach seltsam. Deshalb machen wir diesen Elfen-Wohlfühl-Schlafmarathon nicht mehr.«
»Es tut mir leid, dass ich dich so verärgert habe«, sagte er, sogar noch unglücklicher.