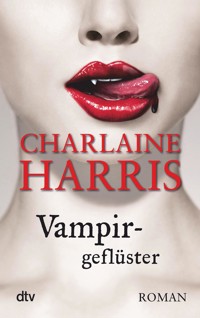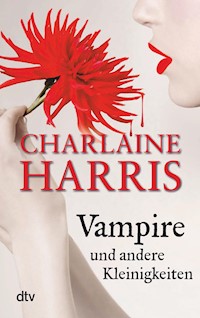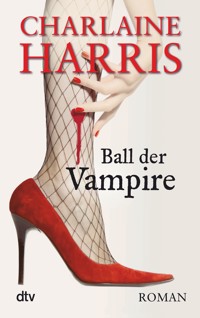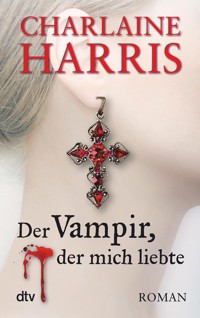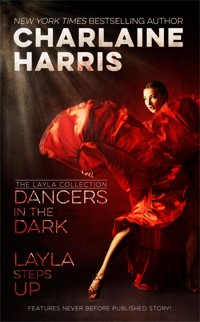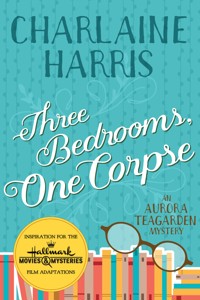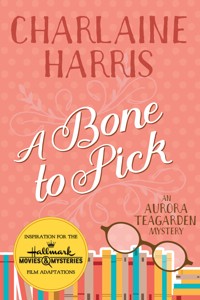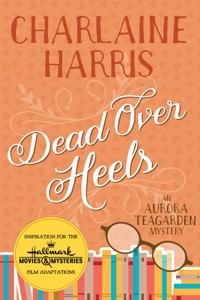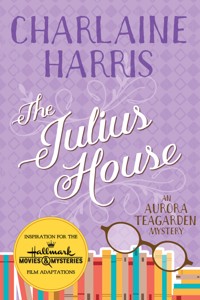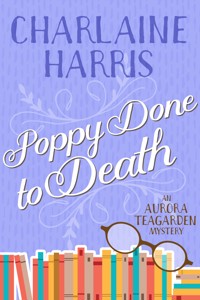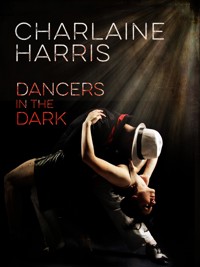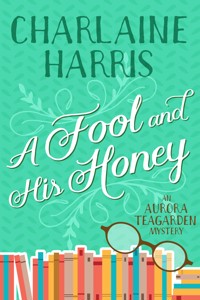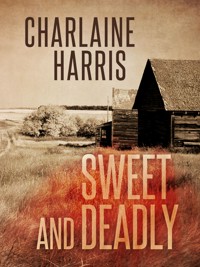6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Sookie Stackhouse
- Sprache: Deutsch
Platz 1 der ›New York Times‹- Bestsellerliste Sookie Stackhouse, die gedankenlesende Kellnerin, musste einiges wegstecken in der letzten Zeit – die gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen übernatürlichen Wesen, in die sie verwickelt war, sind nicht leicht zu verkraften. Immerhin ist ihre Beziehung zu dem Vampir Eric anscheinend in eine neue Phase getreten. Doch dann tauchen zwei Vampire aus Erics wechselvoller Vergangenheit auf. Sie sind ein gefährliches Paar. Und sie haben ihre eigenen Pläne, was Sookies Zukunft betrifft. Es sieht ganz so aus, als würde Sookies sehnsüchtiger Wunsch nach ein bisschen Ruhe und Frieden noch lange nicht erfüllt werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 496
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Sookie Stackhouse, die gedankenlesende Kellnerin, musste einiges wegstecken in der letzten Zeit – die gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen übernatürlichen Wesen, in die sie verwickelt war, sind nicht leicht zu verkraften. Immerhin ist ihre Beziehung zu dem Vampir Eric anscheinend in eine neue Phase getreten. Doch dann tauchen zwei Vampire aus Erics wechselvoller Vergangenheit auf. Sie sind ein gefährliches Paar. Und sie haben ihre eigenen Pläne, was Sookies Zukunft betrifft. Es sieht ganz so aus, als würde Sookies sehnsüchtiger Wunsch nach ein bisschen Ruhe und Frieden noch lange nicht erfüllt werden.
Von Charlaine Harris sind bei dtv außerdem erschienen:
Vorübergehend tot
Untot in Dallas
Club Dead
Der Vampir, der mich liebte
Vampire bevorzugt
Ball der Vampire
Vampire schlafen fest
Ein Vampir für alle Fälle
Vampirgeflüster
Vampir mit Vergangenheit
Cocktail für einen Vampir
Vampirmelodie
Die Welt der Sookie Stackhouse
Vampire und andere Kleinigkeiten
Charlaine Harris
Vor Vampiren wird gewarnt
Sookie Stackhouse Band 10
Roman
Deutsch von Britta Mümmler
Dieses Buch ist unserem Sohn Patrick gewidmet, der unsere Hoffnungen, Träume und Erwartungen für sein Leben nicht nur erfüllte, sondern übertraf.
MÄRZ
Erste Woche
»Ich habe ein schlechtes Gewissen, dass ich dich einfach so allein lasse«, sagte Amelia. Ihre Augen waren verquollen und rot. So sahen sie, mal mehr, mal weniger, schon seit Tray Dawsons Beerdigung aus.
»Du musst tun, was du tun musst«, erwiderte ich und schenkte ihr ein besonders strahlendes Lächeln. Ich konnte die Schuld, Scham und allgegenwärtige Trauer als schwarzes Knäuel durch Amelias Gedanken trudeln sehen. »Es geht mir schon viel besser«, versicherte ich ihr und hörte mich dann fröhlich immer weiterplappern; irgendwie schien ich kein Ende finden zu können. »Ich kann wieder prima laufen, und die Löcher sind auch alle zugeheilt. Siehst du?« Ich zog meinen Jeansbund ein wenig herunter, um ihr eine Stelle zu zeigen, die herausgebissen gewesen war. Die Zahnabdrücke waren kaum noch zu erkennen, auch wenn die Haut nicht sonderlich glatt und noch deutlich heller war als die umliegenden Partien. Hätte ich nicht eine so enorme Dosis Vampirblut bekommen, würde die Narbe jetzt noch aussehen, als hätte mich ein Hai gebissen.
Amelia sah hin und schnell wieder weg, als könne sie es nicht ertragen, den Beweis für den Angriff zu sehen. »Es ist nur so, dass Octavia mir dauernd E-Mails schreibt und sagt, ich müsse nach Hause kommen und den Urteilsspruch des Hexenrates, oder was davon übrig ist, akzeptieren«, sagte sie hastig. »Und ich muss mir all die Reparaturen an meinem Haus mal ansehen. Seit wieder ein paar Touristen da sind und die Leute zurückkommen und ihre Häuser wieder aufbauen, ist auch der Laden für Magie wieder geöffnet. Ich kann dort Teilzeit arbeiten. Außerdem, sosehr ich dich mag und so gern ich hier wohne, seit Tray tot ist…«
»Glaub mir, ich versteh dich.« Wir waren das Ganze schon ein paar Mal durchgegangen.
»Es ist nicht so, dass ich dir die Schuld daran gebe«, sagte Amelia und versuchte, meinen Blick aufzufangen.
Sie gab mir wirklich nicht die Schuld. Da ich ihre Gedanken lesen konnte, wusste ich, dass sie die Wahrheit sagte.
Nicht mal ich gab mir, zu meiner eigenen Überraschung, vollständig die Schuld daran.
Gut, es stimmte, dass Tray Dawson, Amelias Freund und ein Werwolf, getötet worden war, während er als mein Bodyguard fungierte. Und es stimmte auch, dass ich das in meiner Nähe lebende Werwolfrudel um einen Bodyguard gebeten hatte, weil sie mir einen Gefallen schuldeten und mein Leben beschützt werden musste. Aber ich war dabei gewesen, als Tray Dawson von der Hand eines schwertschwingenden Elfen getötet wurde, und ich wusste, wer dafür verantwortlich war.
Ich fühlte mich also nicht direkt schuldig. Aber ich war tief unglücklich darüber, dass ich zusätzlich zu all den anderen schrecklichen Erlebnissen auch noch Tray verloren hatte. Meine Cousine Claudine, eine vollblütige Elfe, war ebenfalls in dem Elfenkrieg gestorben, und da sie wirklich und wahrhaftig mein Schutzengel gewesen war, vermisste ich sie in vielerlei Hinsicht. Und sie war schwanger gewesen.
Mich quälten starke Schmerzen und alle möglichen Gefühle des Bedauerns, körperlich wie seelisch. Während Amelia mit den Armen voller Kleider die Treppe hinunterlief, stand ich in ihrem Schlafzimmer und versuchte, mich zu sammeln. Schließlich richtete ich mich gerade auf und griff nach einem Karton voll Badezimmerkrimskrams. Langsam und vorsichtig stieg ich die Treppe hinunter, und so schaffte ich es bis nach draußen zu Amelias Auto. Sie hatte gerade die Kleider über die Kartons gebreitet, die schon im Kofferraum standen, und drehte sich um.
»Das sollst du doch nicht!«, rief sie besorgt. »Deine Wunden sind noch nicht alle verheilt.«
»Mir geht’s gut.«
»Ganz und gar nicht. Du schreckst immer zusammen, wenn jemand überraschend ins Zimmer kommt, und ich merke doch, dass deine Handgelenke noch wehtun«, sagte Amelia, griff nach dem Karton und schob ihn auf die Rückbank. »Außerdem verlagerst du dein Gewicht immer noch aufs linke Bein und hast Schmerzen, wenn es regnet. Trotz all des Vampirbluts.«
»Die Schreckhaftigkeit vergeht wieder. Und mit der Zeit verblassen die Erinnerungen, dann denk ich auch nicht mehr ständig daran«, sagte ich zu Amelia. (Wenn die Telepathie mich eines gelehrt hatte, dann, dass die Menschen die gravierendsten und schmerzlichsten Erinnerungen in sich begraben konnten, wenn man ihnen nur genug Zeit und Ablenkung gab.) »Es ist ja nicht einfach das Blut irgendeines Vampirs. Es ist Erics Blut. Ein sehr wirksames Zeug. Und meine Handgelenke sind schon viel besser.« Dass genau in diesem Moment die Nerven darin herumzüngelten wie Schlangen, erwähnte ich lieber nicht. Ein Resultat davon, dass sie mehrere Stunden lang gefesselt gewesen waren. Dr.Ludwig, eine Ärztin der Supranaturalen, hatte mir versichert, dass meine Nerven – und meine Handgelenke – wieder völlig normal funktionieren würden, irgendwann.
»Ja, und da wir gerade von Blut reden…« Amelia holte tief Luft und nahm allen Mut zusammen, um etwas zu sagen, von dem sie wusste, dass es mir nicht gefallen würde. Doch weil ich es schon wusste, noch ehe sie es ausgesprochen hatte, war ich gewappnet. »Hast du mal daran gedacht… Sookie, du hast mich zwar nicht um Rat gefragt, aber ich finde, du solltest lieber kein Blut mehr von Eric bekommen. Ich meine, ich weiß, dass du mit ihm zusammen bist, aber du musst auch an die Konsequenzen denken. Manchmal wandeln die Leute sich ganz zufällig. Es ist ja nicht so, als wär’s eine mathematische Gleichung.«
Ich wusste es zu schätzen, dass Amelia sich Sorgen um mich machte, aber hier war sie auf privates Territorium vorgedrungen. »Wir tauschen kein Blut«, sagte ich. Doch. »Er nippt nur mal an mir, wenn… na, du weißt schon, im Augenblick des Glücks.« Zurzeit erlebte Eric allerdings viel mehr Augenblicke des Glücks als ich, leider. Doch ich gab die Hoffnung nicht auf, dass der magische Zauber des Schlafzimmers zurückkehren würde; denn wenn irgendein Mann fähig war, jemanden durch Sex zu heilen, dann Eric.
Amelia lächelte, und genau darauf hatte ich es abgesehen. »Wenigstens…« Sie wandte sich ab, ohne den Satz zu beenden, aber sie dachte: Wenigstens hast du Lust auf Sex.
Ich hatte gar nicht so sehr Lust auf Sex, sondern eher das Gefühl, ich sollte immer wieder aufs Neue versuchen, ihn zu genießen. Aber darüber wollte ich nun wirklich nicht reden. Die Fähigkeit loszulassen – der Schlüssel zu gutem Sex – war mir während der Folter abhandengekommen. Ich war absolut hilflos gewesen und konnte nur hoffen, dass ich mich auch in dieser Hinsicht wieder erholen würde. Ich wusste, dass Eric meinen Mangel an Erfüllung spürte. Er hatte mich schon mehrmals gefragt, ob ich sicher sei, dass ich Sex haben wolle. Fast jedes Mal hatte ich ja gesagt, mit der Fahrrad-Theorie im Hinterkopf. Ja, ich war heruntergefallen. Aber ich war immer bereit, wieder aufzusteigen und es noch einmal zu versuchen.
»Wie läuft eure Beziehung denn so?«, fragte Amelia. »Von den Freuden der Lust mal abgesehen.« Mittlerweile waren all ihre Sachen im Auto verstaut. Jetzt schindete sie Zeit, da sie den Moment fürchtete, in dem sie in ihr Auto steigen und abfahren musste.
Es war nur Stolz, der mich davon abhielt, mich bei ihr auszuheulen.
»Ich glaube, es läuft ziemlich gut mit uns«, erwiderte ich und bemühte mich sehr, fröhlich zu klingen. »Ich weiß allerdings immer noch nicht, was ich selbst empfinde und was den Blutsbanden geschuldet ist.« Es tat irgendwie gut, nicht nur über meine ganz normale Mann-Frau-Liebesbeziehung reden zu können, sondern auch über meine übernatürliche Verbindung mit Eric. Schon bevor ich im Elfenkrieg verwundet worden war, hatte Eric und mich das verbunden, was die Vampire Blutsbande nennen, da wir bereits mehrmals das Blut des anderen gehabt hatten. Ich konnte spüren, wo in etwa Eric sich aufhielt und in welcher Stimmung er war, und genauso erging es ihm mit mir. In meinem Hinterkopf war er immer irgendwie präsent – so als hätte man einen Ventilator oder eine Klimaanlage eingeschaltet, damit es ein wenig summt, weil man dann besser einschlafen kann. (Es war gut für mich, dass Eric nur nachts wach war, denn so konnte ich wenigstens einen Teil des Tages ganz ich selbst sein. Ob er dasselbe empfand, wenn ich abends ins Bett ging?) Das soll nicht heißen, dass ich Stimmen in meinem Kopf hörte oder so etwas – zumindest nicht mehr als sonst. Aber wenn ich mich glücklich fühlte, musste ich mich immer erst mal versichern, dass ich selbst es war, die sich glücklich fühlte, und nicht Eric. Dasselbe galt für Wut. Eric steckte voller Wut, voll kontrollierter und sorgsam unterdrückter Wut, vor allem in letzter Zeit. Aber vielleicht bekam er die auch von mir. Ich hatte zurzeit nämlich selbst eine ziemliche Wut im Bauch.
Ich hatte Amelia komplett vergessen und war unvermittelt in mein depressives Loch gefallen.
Sie riss mich wieder heraus. »Das ist doch bloß eine faule Ausrede«, sagte sie scharfzüngig. »Komm schon, Sookie. Entweder du liebst ihn oder du liebst ihn nicht. Hör endlich auf, das Nachdenken darüber immer aufzuschieben, indem du eure Blutsbande für alles verantwortlich machst. Bla, bla, bla. Wenn du diese Blutsbande so sehr hasst, warum hast du dann nicht versucht herauszufinden, wie du dich davon befreien kannst?« Amelia registrierte den Ausdruck in meinem Gesicht, und plötzlich schwand ihre Gereiztheit. »Soll ich Octavia mal fragen?«, fragte sie in sanfterem Ton. »Wenn es einer weiß, dann sie.«
»Ja, das würde ich gern herausfinden«, sagte ich nach einem kurzen Augenblick. Ich holte tief Luft. »Du hast vermutlich recht. Ich war so deprimiert, dass ich alle Entscheidungen aufgeschoben oder die bereits getroffenen nicht umgesetzt habe. Eric ist wirklich großartig. Aber ich finde ihn… etwas übergriffig.« Eric hatte eine starke Persönlichkeit und war es gewohnt, der große Fisch im Teich zu sein. Und er wusste, dass er noch alle Zeit der Welt hatte.
Die hatte ich nicht.
Darauf war er bisher nicht zu sprechen gekommen, aber früher oder später würde er es tun.
»Aber übergriffig oder nicht, ich liebe ihn«, fuhr ich fort. Das hatte ich noch nie laut ausgesprochen. »Und darauf kommt es vermutlich an.«
»Vermutlich.« Amelia versuchte, mich anzulächeln, doch es blieb ein kläglicher Versuch. »Hör zu, mach einfach weiter damit, mit dieser Selbsterforschung.« Einen Augenblick lang stand sie nur da, mit diesem erstarrten halben Lächeln im Gesicht. »Also, Sook, ich mache mich jetzt besser auf den Weg. Mein Dad erwartet mich. Bestimmt wird er sich wieder in all meine Angelegenheiten einmischen, sobald ich in New Orleans ankomme.«
Amelias Dad war reich, mächtig und glaubte kein bisschen an Amelias Kräfte. Doch er machte einen großen Fehler, wenn er ihre Hexenkünste nicht respektierte. Amelia trug magische Kräfte in sich, sie war damit geboren worden, wie jede echte Hexe. Und wenn Amelia eines Tages erst mal mehr Übung und Disziplin hatte, würde sie richtig angsteinflößend sein – mit voller Absicht angsteinflößend, und nicht mehr, weil ihre Fehler so furchtbar drastisch waren. Hoffentlich hatte ihre Mentorin Octavia ein Programm in petto, um Amelias Talent zu fördern und auszubilden.
Nachdem ich Amelia auf der Auffahrt nachgewinkt hatte, schwand das breite Lächeln aus meinem Gesicht, und ich setzte mich auf die Veranda und weinte. Es brauchte in letzter Zeit nicht viel, damit ich in Tränen ausbrach, und die Abreise meiner Freundin war jetzt genau der richtige Anlass. Es gab so vieles, um das ich weinen musste.
Meine Schwägerin Crystal war ermordet worden. Mel, ein Freund meines Bruders, war hingerichtet worden. Tray, Claudine und der Vampir Clancy waren in Ausübung ihrer Pflicht getötet worden. Und weil sowohl Crystal als auch Claudine schwanger gewesen waren, standen sogar noch zwei weitere Tote auf der Liste.
Das hätte in mir vor allem wohl die Sehnsucht nach Frieden auslösen sollen. Doch statt zum Ghandi von Bon Temps zu mutieren, wusste ich tief in meinem Herzen, dass es noch jede Menge Leute gab, die ich tot sehen wollte. Für die meisten Toten, die meinen Lebensweg pflasterten, war ich nicht direkt verantwortlich. Doch mich quälte der Gedanke, dass keiner von ihnen gestorben wäre, wenn es mich nicht gegeben hätte. In meinen düstersten Momenten – und dies war einer von ihnen – fragte ich mich, ob mein Leben den Preis wert war, den es gekostet hatte.
MÄRZ
Ende der ersten Woche
Als ich an einem bewölkten, kühlen Morgen ein paar Tage nach Amelias Abreise aufstand, saß mein Cousin Claude auf der vorderen Veranda. Claude verstand es nicht so gut wie mein Urgroßvater Niall, seine Anwesenheit zu verbergen. Weil Claude ein Elf war, konnte ich seine Gedanken nicht lesen – doch ich konnte immerhin erkennen, dass sein Geist da war, falls das nicht etwas zu undurchsichtig formuliert ist. Obwohl die Luft recht frisch war, ging ich mit meinem Kaffee auf die Veranda hinaus, denn ich hatte es geliebt, den ersten Becher auf der Veranda zu trinken, bevor ich… vor dem Elfenkrieg.
Ich hatte meinen Cousin seit Wochen nicht gesehen, auch während des Elfenkriegs nicht, und auch er hatte seit Claudines Tod keinen Kontakt mit mir aufgenommen.
Ich hatte einen zweiten Becher für Claude mitgebracht und reichte ihn ihm. Schweigend nahm er ihn entgegen. Die Möglichkeit, dass er ihn mir aus der Hand schlagen könnte, hatte ich in Betracht gezogen. Sein unerwartetes Auftauchen warf mich aus der Bahn. Ich hatte keine Ahnung, was jetzt kommen würde. Der Wind fuhr durch sein langes schwarzes Haar und ließ es flattern wie ebenholzfarbene Bänder. Seine karamellbraunen Augen waren gerötet. »Wie ist sie gestorben?«, fragte er.
Ich setzte mich auf die oberste Verandastufe. »Das habe ich nicht gesehen«, sagte ich, über meine Knie gekauert. »Wir waren in diesem alten Gebäude, das Dr.Ludwig als Krankenhaus benutzte. Ich glaube, Claudine wollte verhindern, dass die feindlichen Elfen den Flur entlangkommen und das Zimmer stürmen, in das ich mich mit Bill, Eric und Tray verkrochen hatte.« Ich sah zu Claude hinüber, um mich zu vergewissern, ob er das Gebäude kannte, und er nickte. »Ich bin ziemlich sicher, dass Breandan sie getötet hat; eine ihrer Stricknadeln steckte in seiner Schulter, als er plötzlich in der demolierten Tür auftauchte.«
Breandan war der Feind meines Urgroßvaters und ebenfalls ein Elfenprinz gewesen. Er vertrat die Überzeugung, dass Menschen und Elfen keinen Umgang miteinander haben sollten. Und daran glaubte er geradezu fanatisch. Er wollte, dass die Elfen ihre Streifzüge in die Welt der Menschen völlig aufgaben, trotz ihrer großen finanziellen Investitionen in die irdische Geschäftswelt und all der Dinge, die sie dort produzierten… Dinge, mit deren Hilfe sie sich der modernen Welt anpassen konnten. Breandan verabscheute vor allem die gelegentlichen Liebesbeziehungen mit Menschen, ein Luxus, den sich die Elfen gönnten, und die Kinder aus diesen Liaisons hasste er ebenfalls. Er wollte, dass die Elfen abgeschottet lebten, in ihre eigene Welt eingesperrt, und nur mit ihresgleichen Umgang hatten.
Seltsamerweise hatte mein Urgroßvater beschlossen, genau das zu tun, nachdem die Elfen besiegt waren, die an diese Apartheidspolitik glaubten. Nach all dem Blutvergießen kam Niall zu dem Schluss, dass Frieden unter den Elfen und Sicherheit für die Menschen nur gewährleistet wären, wenn sich die Elfen in ihre Welt zurückzögen. So hatte Breandan im Tod doch noch sein Ziel erreicht. In meinen düstersten Momenten fand ich, dass Nialls Entscheidung den ganzen Elfenkrieg sinnlos gemacht hatte.
»Sie hat dich verteidigt«, sagte Claude und holte mich damit zurück in die Gegenwart. Es lag nichts in seiner Stimme. Keine Anschuldigung, keine Wut, nicht mal eine Frage.
»Ja.« Es war Teil ihrer Aufgabe gewesen, mich zu beschützen. Auf Nialls Befehl hin.
Ich nahm einen großen Schluck Kaffee. Claudes Becher ruhte unberührt auf der Lehne des Verandaschaukelstuhls. Vielleicht fragte Claude sich, ob er mich töten sollte. Claudine war seine letzte lebende Schwester gewesen.
»Du wusstest von der Schwangerschaft«, sagte er schließlich.
»Sie hat es mir erzählt, kurz bevor sie getötet wurde.« Ich stellte meinen Becher ab, schlang die Arme um meine Knie und wartete darauf, dass der Schlag auf mich niederging. Anfangs machte es mir nicht einmal etwas aus, was umso schrecklicher war.
»Ich weiß, dass Neave und Lochlan dich in ihrer Gewalt hatten«, sagte Claude. »Humpelst du deshalb?« Der Themenwechsel überraschte mich.
»Ja«, erwiderte ich. »Sie hatten mich einige Stunden in ihrer Gewalt. Niall und Bill Compton haben sie getötet. Nur damit du es weißt – es war Bill, der Breandan getötet hat, mit dem Eisenspaten meiner Großmutter.« Der Handspaten war eigentlich schon seit Generationen in meiner Familie, doch ich verband ihn immer mit meiner Großmutter.
Lange Zeit saß Claude, so wunderschön und rätselhaft wie eh und je, einfach nur da. Er sah mich nie direkt an und trank auch seinen Kaffee nicht. Dann schien er eine Entscheidung getroffen zu haben, denn er stand einfach auf und ging die Auffahrt in Richtung Hummingbird Road entlang davon. Ich weiß nicht, wo sein Auto parkte. Mir schien es, als wäre er den ganzen Weg von Monroe zu Fuß gekommen oder auf einem Zauberteppich hergeflogen. Ich ging zurück ins Haus, sank gleich hinter der Tür auf die Knie und weinte. Meine Hände zitterten. Meine Handgelenke schmerzten.
Während wir uns unterhielten, hatte ich die ganze Zeit darauf gewartet, dass er zu seinem Schlag ausholte.
Jetzt wurde mir klar, dass ich leben wollte.
MÄRZ
Zweite Woche
»Heb deinen Arm ganz hoch, Sookie!«, sagte JB.Vor lauter Konzentration hatte sich sein hübsches Gesicht in Falten gelegt. Mit einem Zweikilogewicht in der Hand hob ich langsam meinen linken Arm. Herrje, tat das weh. Und rechts war es das Gleiche.
»Okay, jetzt die Beine«, sagte JB, als meine Arme vor Anstrengung zitterten. JB war kein staatlich anerkannter Physiotherapeut, aber er war Personal Trainer und hatte daher praktische Erfahrung damit, Leuten über verschiedene Verletzungen hinwegzuhelfen. So viele auf einmal wie bei mir hatte er wahrscheinlich noch nie gesehen, denn ich war gebissen, mit dem Messer verletzt und gefoltert worden. Doch ich hatte JB die Einzelheiten nicht erklären müssen, und er würde nicht bemerken, dass meine Verletzungen alles andere als typisch für die waren, die man bei einem Autounfall davontrug. Ich wollte nicht, dass irgendwelche Spekulationen über meine körperlichen Probleme in Bon Temps die Runde machten – deshalb ging ich weiterhin gelegentlich zu Dr.Amy Ludwig, die verdächtig einem Hobbit glich, und bat JB du Rhone um Hilfe, der zwar ein guter Trainer war, aber dumm wie Toastbrot.
JBs Ehefrau, meine Freundin Tara, saß auf einer der Hantelbänke und las ›Was Sie erwartet, wenn Sie schwanger sind‹. Tara war im fünften Monat und entschlossen, die beste Mutter zu werden, die sie nur sein konnte. Und weil JB zwar willens, aber nicht besonders helle war, übernahm Tara die Rolle des Elternteils, der die meiste Verantwortung trug. Sie hatte sich ihr Highschool-Taschengeld als Babysitter verdient und dadurch ein wenig Erfahrung in der Kinderbetreuung. Als sie jetzt die Seiten umblätterte, runzelte sie die Stirn, ein mir aus unserer Schulzeit vertrauter Anblick.
»Hast du inzwischen einen Arzt gefunden?«, fragte ich, nachdem ich meine Beinübungen beendet hatte. Meine vordere Oberschenkelmuskulatur brannte, vor allem der verletzte Muskel im linken Bein. Wir hatten uns in dem Fitnesscenter getroffen, in dem JB arbeitete, und es war schon nach Geschäftsschluss, weil ich kein Mitglied war. Aber JBs Chef hatte dem vorübergehenden Arrangement zugestimmt, um JB bei Laune zu halten. JB war ein enormer Gewinn für das Fitnesscenter; seit er dort arbeitete, hatten sich wesentlich mehr neue Kundinnen angemeldet.
»Ich glaube schon«, sagte Tara. »Es standen vier zur Auswahl im Landkreis, und wir haben mit allen gesprochen. Inzwischen hatte ich schon meinen ersten Termin bei Dr.Dinwiddie, hier in Clarice. Es ist ein kleines Krankenhaus, ich weiß, aber ich bin kein Risikofall, und es ist so nah.«
Clarice war nur ein paar Meilen entfernt von Bon Temps, wo wir alle wohnten. Man brauchte weniger als zwanzig Minuten von meinem Haus bis zum Fitnesscenter.
»Ich habe viel Gutes über ihn gehört«, sagte ich. Die Schmerzen in meinen Oberschenkeln machten mich ganz schwummerig im Kopf. Kalter Schweiß trat mir auf die Stirn. Gewöhnlich hatte ich mich immer für fit gehalten, und meistens war ich auch glücklich gewesen. Doch jetzt gab es Tage, an denen ich es gerade mal schaffte, aufzustehen und zur Arbeit zu gehen.
»Sook«, sagte JB, »sieh dir mal an, was hier für ein Gewicht draufliegt.« Er lächelte mich breit an.
Jetzt erst bemerkte ich, dass ich zehn Dehnübungen mit fünf Kilo mehr drauf gemacht hatte als üblich.
Ich erwiderte sein Lächeln. Es hielt nicht lange an, aber ich wusste, ich hatte etwas erreicht.
»Vielleicht kannst du dann ja mal bei uns babysitten«, sagte Tara. »Wir werden dem Kind beibringen, dich Tante Sookie zu nennen.«
Ich würde eine Nenntante werden. Ich würde auf ein Baby aufpassen. Sie vertrauten mir. Unwillkürlich begann ich, Pläne für die Zukunft zu machen.
MÄRZ
Dieselbe Woche
Die nächste Nacht verbrachte ich mit Eric. Wie mindestens drei- oder viermal die Woche wachte ich keuchend auf, von Grauen erfüllt, orientierungslos wie auf hoher See. Ich klammerte mich an ihn, als würde ein Sturm mich davonwehen, wenn er nicht mein Anker wäre. Ich weinte bereits, als ich aufwachte. Das passierte nicht zum ersten Mal, doch dieses Mal weinte Eric mit mir, blutige Tränen, die seine bleichen Wangen auf erschreckende Weise rot streiften.
»Nicht«, bat ich ihn. Ich hatte mich immer bemüht, ganz die Alte zu sein, wenn ich mit ihm zusammen war. Doch er wusste es natürlich besser. Heute Nacht konnte ich seine Entschlossenheit spüren. Eric hatte mir etwas zu sagen, und er würde es mir sagen, ob ich es hören wollte oder nicht.
»Ich konnte deine Angst und deine Schmerzen in jener Nacht spüren«, begann er. »Aber ich konnte nicht zu dir kommen.«
Endlich erzählte er mir das, was ich schon so lange wissen wollte.
»Warum nicht?«, fragte ich, sehr bemüht, meine Stimme ruhig klingen zu lassen. Es mag unglaubwürdig erscheinen, aber ich war in einer so labilen Verfassung gewesen, dass ich mich nicht getraut hatte, ihn danach zu fragen.
»Victor wollte mich nicht gehen lassen«, erzählte Eric. Victor Madden war sein Boss und von Felipe de Castro, dem König von Nevada, damit beauftragt worden, das eroberte Königreich Louisiana zu leiten.
Meine erste Reaktion auf Erics Erklärung war bittere Enttäuschung. Diese Story hatte ich schon einmal gehört. Ein mächtigerer Vampir als ich hat mich dazu gezwungen: Bills Entschuldigung für die Rückkehr zu seiner Schöpferin Lorena, vielen Dank auch. »Klar«, erwiderte ich, drehte mich um und kehrte ihm den Rücken zu. Der kalte Kummer der Ernüchterung beschlich mich. Ich beschloss, mich anzuziehen und zurück nach Bon Temps zu fahren, sobald ich genug Kraft dafür aufbrachte. Die Anspannung, Frustration und Wut in Eric zehrten an mir.
»Victors Leute hatten mich mit Silberketten gefesselt«, sagte Eric hinter mir. »Ich hatte überall Brandwunden.«
»Wirklich.« Ich versuchte, nicht ganz so skeptisch zu klingen, wie ich war.
»Ja, wirklich. Ich wusste, dass du irgendwie in Gefahr schwebtest. Victor war an dem Abend im Fangtasia, so als hätte er schon im Voraus gewusst, dass er dort sein sollte. Als Bill anrief, um mir zu sagen, dass sie dich gekidnappt hätten, gelang es mir noch, Niall anzurufen, ehe drei von Victors Leuten mich an die Wand ketteten. Als ich… nun ja, protestierte, sagte Victor, er könne mir nicht erlauben, im Elfenkrieg Partei zu ergreifen. Ganz egal, was dir passiert, sagte er, ich dürfe mich nicht einmischen.«
Wut ließ Eric eine ganze Zeit lang verstummen. Sie floss auch durch mich hindurch, wie ein beißender, eisiger Strom. Mit erstickter Stimme nahm er den Faden seiner Geschichte wieder auf.
»Pam hatten Victors Leute ebenfalls gefangen genommen und isoliert, obwohl sie sie nicht anketteten.« Pam war Erics Stellvertreterin. »Da Bill in Bon Temps war, konnte er Victors telefonische Nachrichten ignorieren. Niall traf sich bei deinem Haus mit Bill, um deine Spur aufzunehmen. Bill hatte von Lochlan und Neave schon gehört. Das hatten wir alle. Wir wussten, dass deine Zeit bald ablaufen würde.« Ich lag noch immer mit dem Rücken zu Eric da, aber ich hörte nicht nur seine Stimme. Sondern auch Kummer, Wut, Verzweiflung.
»Wie konntest du dich von den Ketten befreien?«, fragte ich in die Dunkelheit hinein.
»Ich erinnerte Victor daran, dass Felipe dir Schutz versprochen hatte, und zwar höchstpersönlich. Victor tat so, als würde er mir nicht glauben.« Ich spürte, wie das Bett ruckelte, als Eric sich in die Kissen zurückwarf. »Einige der Vampire waren stark und ehrenhaft genug, sich daran zu erinnern, dass sie Felipe verpflichtet waren und nicht Victor. Sie wollten sich Victor zwar nicht offen widersetzen, ließen Pam aber hinter seinem Rücken unseren neuen König anrufen. Und als Pam Felipe am Apparat hatte, erzählte sie ihm, dass du und ich geheiratet hatten. Dann verlangte sie, dass Victor ans Telefon gerufen wurde und Felipe mit ihm redete. Victor wagte es nicht, sich zu weigern, und Felipe befahl ihm, mich gehen zu lassen.« Vor ein paar Monaten war Felipe de Castro König von Nevada, Louisiana und Arkansas geworden. Er war mächtig, alt und sehr gerissen. Und er stand tief in meiner Schuld.
»Hat Felipe Victor bestraft?« Die Hoffnung stirbt zuletzt.
»Ja, da liegt’s«, sagte Eric. Irgendwo auf seinem langen Lebensweg hatte mein geliebter Wikinger anscheinend auch mal Shakespeares ›Hamlet‹ gelesen. »Victor behauptete zunächst, er hätte unsere Trauung schon ganz vergessen.« Obwohl sogar ich manchmal versuchte, sie zu vergessen, machte mich das doch wütend. Victor selbst hatte mit in Erics Büro gesessen, als ich Eric den Zeremoniendolch überreichte – in völliger Unkenntnis darüber, dass ich mit dieser Handlung eine Vermählung vollzog, nach Vampirart. Nun, ich war vielleicht ahnungslos gewesen, aber Victor ganz bestimmt nicht. »Und dann sagte Victor zu unserem König, dass unsere Ehe sowieso eine einzige Farce sei und ich nur meine menschliche Geliebte vor den Elfen retten wolle. Vampirleben dürften aber nicht für die Rettung von Menschen geopfert werden. Und er sagte zu Felipe, dass er Pam und mir nicht geglaubt habe, als wir ihm erzählten, Felipe habe dir Schutz versprochen, nachdem du ihn vor Sigebert gerettet hattest.«
Ich drehte mich herum und sah Eric an. Das Mondlicht, das durch das Fenster hereinfiel, tauchte ihn in silbrig-dunkle Schatten. Meine kurze Erfahrung mit jenem mächtigen Vampir, der eine so große Machtfülle an sich gerissen hatte, sagte mir, dass Felipe de Castro beileibe kein Dummkopf war. »Ist ja nicht zu fassen. Warum hat Felipe Victor nicht getötet?«, fragte ich.
»Darüber habe ich natürlich auch viel nachgedacht. Ich glaube, Felipe muss so tun, als würde er Victor glauben. Anscheinend erkennt Felipe selbst langsam, dass Victors Ehrgeiz sich seit seiner Ernennung zum Repräsentanten des gesamten Bundesstaates Louisiana bis zur Unanständigkeit gesteigert hat.«
Ich stellte fest, dass ich Eric ganz emotionslos betrachten konnte, während ich über das nachdachte, was er gesagt hatte. Mit meiner Vertrauensseligkeit hatte ich mir in der Vergangenheit schon oft die Finger verbrannt, und diesmal würde ich mich dem Feuer nicht ohne sorgfältiges Abwägen nähern. Es war das eine, mit Eric zu lachen oder sich auf die Nächte zu freuen, in denen wir uns gemeinsam in der Dunkelheit wälzten. Doch etwas ganz anderes war es, ihm weitaus verletzlichere Gefühle zu offenbaren. Mit Vertrauen hatte ich es gerade wirklich nicht so.
»Du warst ziemlich mitgenommen, als du zum Krankenhaus kamst«, sagte ich ausweichend. Als ich in der alten Fabrik wieder zu mir kam, die Dr.Ludwig als eine Art Feldlazarett nutzte, war ich so schwer verletzt gewesen, dass ich meinte, es sei einfacher zu sterben als zu leben. Bill, der mich gerettet hatte, litt an einer Vergiftung, weil Neave ihn mit ihren Silberzähnen gebissen hatte, und es war ungewiss gewesen, ob er überleben würde. Und der bereits tödlich verwundete Tray Dawson, Amelias Werwolffreund, hatte noch lange genug durchgehalten, um durchs Schwert zu sterben, als Breandans Truppen das Krankenhaus stürmten.
»Während du in Neaves und Lochlans Gewalt warst, habe ich mit dir gelitten«, erwiderte Eric und sah mir direkt in die Augen. »Ich litt mit dir, ich blutete mit dir – nicht nur, weil wir durch Blutsbande verbunden sind, sondern wegen der Liebe, die ich für dich empfinde.«
Skeptisch zog ich eine Augenbraue hoch. Ich konnte nicht anders, auch wenn ich spürte, dass er es ernst meinte. Ich wollte gern glauben, dass Eric mir sehr viel schneller zu Hilfe geeilt wäre, wenn er gekonnt hätte. Und ich wollte gern glauben, dass er das Echo des Horrors meiner Zeit bei den Elfenfolterern vernommen hatte.
Doch Schmerzen, Blut und Grauen waren meine eigenen gewesen. Er hatte sie vielleicht auch empfunden, aber an einem anderen Ort. »Ich glaube dir, dass du da gewesen wärst, wenn du gekonnt hättest«, sagte ich mit einer Stimme, die viel zu ruhig war. »Das glaube ich wirklich. Ich weiß, dass du sie getötet hättest.« Eric beugte sich auf einen Ellbogen gestützt zu mir und drückte mit seiner großen Hand meinen Kopf an seine Brust.
Ich konnte nicht abstreiten, dass ich mich besser fühlte, seit er sich dazu durchgerungen hatte, es mir zu erzählen. Doch ich fühlte mich nicht so viel besser, wie ich gehofft hatte, auch wenn ich jetzt wusste, warum er nicht gekommen war, als ich nach ihm schrie. Ich konnte sogar verstehen, warum es so lange gedauert hatte, bis er es mir erzählte. Hilflosigkeit war etwas, das Eric nicht oft erlebte. Er war ein Supra, und er war unglaublich stark und ein großartiger Kämpfer. Aber er war kein Superheld, und gegen etliche zu allem entschlossene Mitglieder seiner eigenen Art konnte er allein nichts ausrichten. Und mir wurde klar, dass er mir jede Menge Blut gegeben hatte, als er sich selbst noch von den Nachwirkungen der Silberketten erholen musste.
Schließlich entspannte sich etwas in mir angesichts der Logik seiner Geschichte. Ich glaubte ihm mit meinem Herzen und nicht nur mit meinem Verstand.
Eine rote Träne fiel auf meine nackte Schulter und rann hinab. Ich wischte sie mit dem Finger ab, legte den Finger an seine Lippen – und gab ihm seinen Schmerz zurück. Ich hatte genug eigenen.
»Ich glaube, wir müssen Victor töten«, sagte ich, und sein Blick traf den meinen.
Es war mir endlich gelungen, Eric zu überraschen.
MÄRZ
Dritte Woche
»Tja«, sagte mein Bruder, »wie du siehst, bin ich noch immer mit Michele zusammen.« Er stand mit dem Rücken zu mir und wendete die Steaks auf dem Grill. Ich saß in einem Klappstuhl und blickte über den großen Teich mit dem Steg hinweg. Es war ein wunderschöner Abend, kühl und frisch. Ich war zufrieden damit, nur dazusitzen und ihm bei der Arbeit zuzusehen; ja ich genoss es, Jason um mich zu haben. Michele war im Haus und bereitete einen Salat zu. Ich konnte sie ein Lied von Travis Tritt singen hören.
»Freut mich«, erwiderte ich, und das meinte ich ernst. Es war das erste Mal seit Monaten, dass mein Bruder und ich wieder privat miteinander zu tun hatten. Jason hatte seine eigene schlechte Zeit durchgemacht. Seine von ihm getrennt lebende Ehefrau und sein ungeborenes Kind waren auf furchtbare Weise umgekommen. Er hatte herausgefunden, dass sein bester Freund in ihn verliebt gewesen war, krankhaft verliebt. Doch während ich ihm jetzt so beim Grillen zusah und seine Freundin im Haus drinnen singen hörte, erkannte ich, dass Jason ein echter Überlebenskünstler war. Hier war er, mein Bruder: hatte wieder eine Freundin und freute sich darauf, gleich ein Steak zu essen und die Stampfkartoffeln, die ich mitgebracht hatte, und auch den Salat, den Michele gerade zubereitete. Ich konnte Jasons Entschlossenheit, das Leben zu genießen, nur bewundern. Mein Bruder war in vielerlei Hinsicht kein allzu gutes Vorbild, aber ich konnte wohl kaum mit dem Finger auf andere zeigen.
»Michele ist eine gute Frau«, sagte ich zu ihm.
Das war sie wirklich – wenn auch vielleicht nicht in dem Sinn, wie unsere Großmutter diesen Begriff benutzt hätte. Michele Schubert nahm kein Blatt vor den Mund und sprach absolut unverblümt über alles. Man konnte sie auch nicht in Verlegenheit bringen, denn sie hätte nie etwas getan, wozu sie nicht stand. Und nach demselben Prinzip völliger Offenheit handelte sie auch im Umgang mit anderen. Wenn Michele auf jemanden sauer war, erfuhr man es garantiert von ihr selbst. Sie war als Sekretärin für die Autowerkstatt des Ford-Händlers tätig, und es war ein Zeichen ihrer Effizienz, dass sie immer noch für ihren früheren Schwiegervater arbeitete. (Der hatte angeblich mal gesagt, dass er sie sogar noch etwas lieber mochte als seinen eigenen Sohn, an manchen Tagen jedenfalls.)
Michele kam auf die Terrasse heraus. Sie trug die Jeans und das Poloshirt mit Ford-Logo, die sie auch zur Arbeit trug. Ihr dunkles Haar war zu einem Knoten gebunden. Michele gefielen schweres Make-up, große Handtaschen und High Heels. Jetzt lief sie allerdings barfuß. »Hey, Sookie, magst du Ranch-Dressing?«, fragte sie. »Sonst haben wir auch Honigsenf.«
»Ranch ist prima«, erwiderte ich. »Brauchst du Hilfe?«
»Nee, alles bestens.« Micheles Handy fing an zu klingeln. »Verdammt, Paps Schubert schon wieder. Der Mann findet auch mit beiden Händen seinen Arsch nicht.«
Sie ging zurück ins Haus, das Handy am Ohr.
»Ich mache mir allerdings Sorgen, dass ich sie in Gefahr bringen könnte«, sagte Jason in dem zurückhaltenden Ton, den er anschlug, wenn er mich nach meiner Meinung zu etwas Übernatürlichem fragen wollte. »Ich meine… dieser Elf, Dermot, der so aussieht wie ich. Weißt du, ob der noch in der Gegend ist?«
Er hatte sich zu mir umgedreht und lehnte jetzt am Geländer der Terrasse, die er an das Haus meiner Eltern angefügt hatte. Mom und Dad hatten es gebaut, als sie Jason erwarteten, konnten es aber nicht sehr viel länger als ein Jahrzehnt genießen. Sie waren gestorben, als ich sieben war. Und als Jason schließlich alt genug war, um allein zu wohnen – seiner Ansicht nach jedenfalls–, war er bei unserer Großmutter aus- und in dieses Haus eingezogen. Zwei, drei Jahre lang hatte er so manche wilde Party gefeiert, doch mit der Zeit war er ruhiger geworden. Heute Abend war sehr deutlich zu erkennen, dass seine jüngsten Verluste ihn noch weiter ernüchtert hatten.
Ich nahm einen Schluck aus meiner Flasche. Normalerweise trank ich nicht viel – ich sah bei der Arbeit zu viel übermäßigen Alkoholkonsum–, doch es war einfach unmöglich, an einem so schönen Abend ein kaltes Bier abzulehnen. »Ich würde auch gern wissen, wo Dermot ist«, sagte ich. Dermot war der zweieiige Zwillingsbruder von Fintan, der unser Großvater und ein Halbelf gewesen war. »Niall hat sich mit all den anderen Elfen, die sich ihm anschließen wollten, in die Elfenwelt zurückgezogen und diese versiegelt. Und ich kann nur beten, dass Dermot bei ihm in der Elfenwelt ist. Claude ist hiergeblieben. Ich habe ihn vor zwei Wochen getroffen.« Niall war unser Urgroßvater, und Claude war sein Enkel aus Nialls Ehe mit einer anderen vollblütigen Elfe.
»Claude, der Stripper.«
»Der Besitzer eines Strip-Clubs, der nur am Damenabend selbst strippt«, korrigierte ich. »Und unser Cousin modelt auch für Cover von Liebesromanen.«
»Ja, die Frauen fallen bestimmt alle reihenweise in Ohnmacht, wenn er bloß vorbeigeht. Michele hat ein Buch mit ihm vorn drauf, in so ’nem Flaschengeistkostüm. Das kostet er sicher bis ins Letzte aus.« Jason klang eindeutig eifersüchtig.
»Worauf du wetten kannst. Und er ist leider auch eine echte Nervensäge«, erwiderte ich und lachte zu meiner eigenen Überraschung.
»Triffst du dich oft mit ihm?«
»Nur das eine Mal, seit ich verletzt wurde. Aber als ich gestern die Post aus dem Briefkasten holte, waren von ihm zwei Freikarten für den Damenabend im Hooligans drin.«
»Und, wirst du da mal hingehen?«
»Jetzt jedenfalls nicht. Vielleicht wenn ich… bessere Laune habe.«
»Glaubst du, Eric hätte was dagegen, wenn du ’nen anderen Typen nackt siehst?« Mit dieser beiläufigen Erwähnung meiner Beziehung mit einem Vampir versuchte Jason mir zu zeigen, wie sehr er sich verändert hatte. Willens war er also, ein Punkt für meinen Bruder.
»Ich weiß nicht genau«, erwiderte ich. »Aber ich würde anderen Männern nicht beim Strippen zusehen, ohne es Eric vorher zu erzählen. Damit er die Chance hat, selbst etwas dazu zu sagen. Würdest du es Michele denn nicht erzählen, wenn du in einen Club gehst, in dem Frauen strippen?«
Jason lachte. »Ich würd’s zumindest erwähnen, nur um zu sehen, was sie dazu sagt.« Er legte die Steaks auf eine Platte und deutete in Richtung gläserner Schiebetür. »Es ist so weit«, sagte er, und ich schob die Tür für ihn zur Seite. Ich hatte vorhin schon den Tisch gedeckt, und jetzt schenkte ich Tee ein. Michele hatte den Salat und die gestampften Kartoffeln auf den Tisch gestellt und die A1-Steaksoße aus der Speisekammer geholt. Mein Bruder liebte seine A1.Mit der großen Grillgabel legte Jason ein Steak auf jeden Teller. Und schon zwei Minuten später aßen wir. Es war irgendwie richtig gemütlich, wir drei so zusammen.
»Calvin war heute bei uns im Autohaus«, sagte Michele. »Er überlegt, seinen alten Pick-up in Zahlung zu geben.« Calvin Norris, ein Mann Mitte vierzig, war ein guter Mensch mit einem guten Job, der eine große Verantwortung auf den Schultern trug. Er war der Anführer der Werpanther, die in der kleinen Gemeinde Hotshot lebten und zu denen auch mein Bruder gehörte.
»Ist er noch mit Tanya zusammen?«, fragte ich. Tanya Grissom arbeitete, genau wie Calvin, für das Sägewerk Norcross, half manchmal aber auch im Merlotte’s aus, wenn eine der anderen Kellnerinnen nicht arbeiten konnte.
»Ja, sie wohnt sogar bei ihm«, erzählte Jason. »Die beiden streiten ziemlich oft, aber ich glaub, sie bleibt bei ihm.«
Als Anführer der Werpanther tat Calvin Norris stets sein Bestes, um nicht in Vampirangelegenheiten verwickelt zu werden. Und seit die Wergeschöpfe an die Öffentlichkeit getreten waren, hatte er noch sehr viel mehr um die Ohren. Er selbst hatte gleich am nächsten Tag im Pausenraum bei Norcross erklärt, dass er zweigestaltig war. Seit sich das herumgesprochen hatte, wurde Calvin nur noch größerer Respekt entgegengebracht. Er genoss einen guten Ruf in der Gegend von Bon Temps, obwohl die meisten Leute, die draußen in Hotshot wohnten, mit Argwohn betrachtet wurden, weil die Gemeinde so abgeschieden und seltsam war.
»Wieso hast du dich eigentlich nicht geoutet, als Calvin es tat?«, fragte ich Jason. Das war ein Gedanke, den ich in seinem Kopf noch nie entdeckt hatte.
Mein Bruder blickte nachdenklich drein, ein Ausdruck, der bei ihm etwas seltsam wirkte. »Ich glaub, ich bin einfach noch nicht so weit, all die Fragen zu beantworten, die dann kommen«, erwiderte er. »Das ist was sehr Privates, die Verwandlung. Michele weiß es, und nur darauf kommt’s an.«
Michele lächelte ihn an. »Ich bin wirklich stolz auf Jason«, sagte sie, und das wollte schon einiges heißen. »Er hat sich aufgerafft, es mir zu erzählen, als er sich in einen Panther verwandelte. Ganz freiwillig war’s also nicht. Aber er macht das Beste draus. Kein Gejammer. Und er wird’s den Leuten sagen, wenn er so weit ist.«
Ich konnte nur staunen über Jason und Michele. »Ich habe nie zu irgendwem ein Wort gesagt«, versicherte ich ihm.
»Hätt ich auch nie angenommen. Calvin sagt, Eric ist so ’ne Art Vampirboss.« Jason wechselte das Thema.
Eigentlich rede ich mit Nichtvampiren nicht über Vampirangelegenheiten. Das ist einfach keine gute Idee. Aber Jason und Michele hatten mir etwas anvertraut, und so wollte auch ich ihnen etwas anvertrauen. »Eric hat einige Macht. Aber er hat einen neuen Boss bekommen, und die Lage ist zurzeit etwas heikel.«
»Willst du drüber reden?« Ich wusste natürlich nur zu gut, dass Jason sich selbst nicht sicher war, ob er hören wollte, was immer ich zu erzählen hatte. Aber er bemühte sich sehr, ein guter Bruder zu sein.
»Lieber nicht«, sagte ich und sah seine Erleichterung. Sogar Michele war froh, dass sie sich wieder ihrem Steak zuwenden konnte. »Aber abgesehen von den Schwierigkeiten, die er mit anderen Vampiren hat, läuft es prima zwischen Eric und mir. Es ist ja immer ein Geben und Nehmen in Beziehungen, stimmt’s?« Jason hatte über die Jahre zwar jede Menge Beziehungen gehabt, doch von diesem Geben und Nehmen hatte er erst vor Kurzem gehört.
»Ich rede übrigens wieder mit Hoyt«, warf Jason ein, und ich verstand sofort, was das bedeutete. Hoyt war jahrelang so was wie der Schatten meines Bruders gewesen, hatte sich aber eine ganze Weile nicht mehr bei ihm blicken lassen. Hoyts Verlobte Holly, die mit mir im Merlotte’s arbeitete, war nämlich nicht gerade Jasons größter Fan. Es überraschte mich, dass mein Bruder sich wieder mit seinem besten Freund vertragen hatte, und es überraschte mich sogar noch mehr, dass Holly dieser Versöhnung zugestimmt hatte.
»Ich hab mich ziemlich verändert, Sookie«, sagte Jason, als hätte er (ausnahmsweise mal) meine Gedanken gelesen. »Ich will Hoyt ein guter Freund sein und Michele ein guter Partner.« Er sah Michele mit ernster Miene an und legte seine Hand auf ihre. »Und ich will ein besserer Bruder sein. Wir beide haben ja bloß noch uns. Mal abgesehen von dieser Elfenverwandtschaft, aber die würde ich am liebsten schnellstens vergessen.« Peinlich berührt sah er auf seinen Teller hinunter. »Ich kann kaum glauben, dass Gran unseren Grandpa betrogen hat.«
»Ich erkläre mir das so«, begann ich. Ich hatte mit derselben Ungläubigkeit zu kämpfen gehabt. »Gran wollte unbedingt Kinder haben, und die hätte sie von Grandpa nicht bekommen können. Vielleicht hat Fintan sie ja verzaubert. Elfen können Gedanken manipulieren, genau wie Vampire. Und du weißt, wie wunderschön sie sind.«
»Claudine auf jeden Fall. Und wenn man ’ne Frau ist, sieht vermutlich auch Claude richtig gut aus.«
»Claudine hatte es sogar noch stark abgeschwächt, weil sie als Mensch durchgehen wollte.« Claudine, Claudes Drillingsschwester, war eine atemberaubende, 1,80Meter große Schönheit gewesen.
»Grandpa war nicht gerade ein Bild von einem Mann, was das Aussehen angeht«, warf Jason ein.
»Ja, ich weiß.« Wir sahen einander an und gestanden uns schweigend die Macht äußerlicher Attraktivität ein. Dann fragten wir gleichzeitig: »Und Gran?« Und mussten lachen, wir konnten nicht anders. Michele bemühte sich sehr, ein ernstes Gesicht zu machen, doch schließlich konnte auch sie uns nur noch angrinsen. Es war schon schwierig genug, sich vorzustellen, dass die eigenen Eltern Sex hatten. Aber die eigenen Großeltern? Völlig daneben.
»Weil wir gerade von Gran reden. Ich wollte dich fragen, ob ich den Tisch haben kann, den sie auf dem Dachboden aufbewahrt hat«, sagte Jason. »Den kleinen runden, antiken, der früher neben dem Lehnsessel im Wohnzimmer stand?«
»Na klar, komm irgendwann mal vorbei und hol ihn dir«, erwiderte ich. »Er steht wahrscheinlich noch genau dort, wo du ihn abgestellt hast, als Gran dich bat, ihn auf den Dachboden zu schaffen.«
Bald darauf fuhr ich nach Hause, mit meinem fast leeren Topf Stampfkartoffeln, einem übrig gebliebenen Steak und frohen Herzens.
Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass ein Abendessen mit meinem Bruder und seiner Freundin eine große Sache ist. Doch als ich an diesem Abend zu Hause war, schlief ich die ganze Nacht hindurch bis zum nächsten Morgen, zum ersten Mal seit Wochen.
MÄRZ
Vierte Woche
»Na also«, sagte Sam. Ich musste mich anstrengen, um ihn zu verstehen. Irgendwer hatte in der Jukebox Jace Everetts Song »Bad Things« ausgewählt, und fast jeder in der Bar sang mit. »Jetzt hast du schon dreimal gelächelt heute Abend.«
»Du zählst mit, wie oft ich lächle?« Ich stellte mein Tablett ab und warf ihm einen Blick zu. Sam, mein Boss und guter Freund, ist ein echter Gestaltwandler und kann sich in jedes beliebige warmblütige Tier verwandeln. Wie es mit Eidechsen, Schlangen und Käfern steht, habe ich ihn noch nicht gefragt.
»Na ja, tut gut, dieses Lächeln wieder zu sehen«, sagte Sam. Er arrangierte einige Flaschen im Regal neu, nur um beschäftigt zu wirken. »Ich hab’s vermisst.«
»Tut auch gut, wieder Lust zum Lächeln zu haben«, erwiderte ich. »Übrigens, der Haarschnitt gefällt mir.«
Verlegen strich Sam sich mit der Hand über den Kopf. Sein Haar war so kurz, dass es wie eine rotgoldene Kappe anlag. »Es wird bald Sommer. Ich dachte, das ist vielleicht mal ganz angenehm.«
»Ist es wohl.«
»Hast du schon mit Sonnenbaden angefangen?« Für meine Sommerbräune war ich berühmt.
»Oh, ja.« Dieses Frühjahr hatte ich sogar besonders früh begonnen. An dem Tag, als ich mir zum ersten Mal den Bikini angezogen hatte, war allerdings die Hölle los gewesen. Außerdem hatte ich einen Elf getötet. Aber das war Vergangenheit. Gestern hatte ich mich wieder in die Sonne gelegt, und es war gar nichts passiert. Auch wenn ich zugeben muss, dass ich das Radio nicht mit hinausgenommen hatte, weil ich es unbedingt mitkriegen wollte, falls sich wieder irgendetwas an mich heranschleichen würde. Doch es war nichts zu sehen gewesen. Ich hatte sogar eine bemerkenswert friedliche Stunde lang in der Sonne gelegen und einen Schmetterling beobachtet, der hin und wieder vorbeiflog. Einer der Rosensträucher meiner Ururgroßmutter blühte, und der Duft hatte etwas tief in mir drin geheilt. »Ich fühle mich einfach pudelwohl in der Sonne«, sagte ich zu Sam. Da fiel mir plötzlich ein, dass die Elfen mir erzählt hatten, ich würde von den Himmelselfen abstammen, und nicht von den Wasserelfen. Ich hatte zwar keine Ahnung von so etwas, fragte mich aber, ob meine Leidenschaft für die Sonne wohl eine ererbte Vorliebe war.
»Bestellung fertig!«, rief Antoine, und ich lief zur Küchendurchreiche, um die Teller zu holen.
Antoine hatte sich inzwischen gut eingewöhnt im Merlotte’s, und wir hofften alle, er würde den Job als Koch behalten. Heute Abend fuhrwerkte er in der kleinen Küche herum, als hätte er acht Arme. Die Speisekarte des Merlotte’s bot zwar nicht mehr als das Übliche– Hamburger, Hühnchenstreifen, einen Salat mit Hühnchenstreifen, Pommes frites mit Chilisoße, frittierte Essiggurken im Teigmantel–, doch Antoine hatte alles mit erstaunlicher Geschwindigkeit gemeistert. Er war schon Mitte fünfzig und hatte New Orleans verlassen, nachdem er den Hurrikan Katrina im Louisiana Superdome überlebt hatte. Ich konnte Antoine nur bewundern für seine positive Einstellung und seine Entschlossenheit, noch mal ganz von vorn zu beginnen, nachdem er alles verloren hatte. Und er war auch gut zu D’Eriq, der ihm bei der Vorbereitung des Essens half und die Tische abräumte. D’Eriq war lieb, aber langsam.
Holly arbeitete an diesem Abend auch, und während sie mit Drinks und Tellern herumlief, blieb sie zwischendrin immer mal wieder bei ihrem Verlobten Hoyt Fortenberry stehen, der auf einem der Barhocker saß. Hoyts Mutter passte nämlich an den Abenden, die Hoyt mit Holly verbringen wollte, nur allzu gern auf Hollys kleinen Jungen auf. Es war fast unmöglich, bei Hollys Anblick noch die mürrische Wicca im Gothic-Stil in ihr zu erkennen, die sie in der vorherigen Phase ihres Lebens gewesen war. Ihr Haar hatte wieder seine natürliche dunkelbraune Farbe und war jetzt fast schulterlang, ihr Make-up war dezent, und sie lächelte die ganze Zeit. Hoyt, der wieder der beste Freund meines Bruders war, seit sie ihre Streitigkeiten beigelegt hatten, wirkte viel stärker, jetzt, da er von Holly Rückendeckung hatte.
Ich blickte zu Sam hinüber, der gerade einen Anruf auf dem Handy entgegennahm. Sam telefonierte in letzter Zeit ganz schön oft mit dem Ding, und ich vermutete, dass er eine Neue hatte. Ich hätte es herausfinden können, wenn ich lange genug in seinen Kopf hineingesehen hätte (obwohl Gestaltwandler schwerer zu entziffern sind als normale Menschen), doch ich bemühte mich stets, Sams Gedanken nicht zu lesen. Es ist einfach unhöflich, in den Gedanken der Leute herumzustöbern, die man mag. Sam lächelte, während er redete, und es tat gut, ihn – wenigstens zeitweise – mal so sorglos zu sehen.
»Siehst du den Vampir Bill oft?«, fragte Sam, als ich ihm eine Stunde später half, die Bar zu schließen.
»Nein. Ich habe ihn schon länger nicht gesehen«, sagte ich. »Ich frage mich schon, ob Bill mir aus dem Weg geht. Ich bin zweimal bei ihm zu Hause vorbeigegangen und habe ihm ein Sixpack TrueBlood dagelassen und eine Karte mit einem Dank für all das, was er getan hat, als er mich retten kam. Aber er hat mich nie angerufen oder ist herübergekommen.«
»Er war vorgestern Abend hier, als du frei hattest. Ich glaube, du solltest ihn mal besuchen«, meinte Sam. »Aber mehr sage ich nicht.«
MÄRZ
Ende der vierten Woche
An einem schönen Abend einige Tage später stöberte ich in meinem Wandschrank herum und suchte nach meiner größten Taschenlampe. Sams Vorschlag, dass ich Bill mal besuchen sollte, hatte mich nicht mehr losgelassen, und so beschloss ich, als ich nach der Arbeit nach Hause kam, über den Friedhof zu Bills Haus hinüberzugehen.
Der Friedhof »Trautes Heim« ist der älteste im Landkreis Renard. Dort ist jedoch nicht mehr allzu viel Platz für weitere Tote, weshalb es am südlichen Stadtrand von Bon Temps einen dieser neuen »Bestattungsparks« mit in den Boden eingelassenen Grabplatten gibt. Entsetzlich. Da ist mir »Trautes Heim« tausendmal lieber, auch wenn das Gelände uneben ist, die Bäume alle uralt sind und einige der Zäune um die Grabstellen herum völlig schief und krumm dastehen, von den ältesten Grabsteinen ganz zu schweigen. Wann immer wir dem wachsamen Auge unserer Großmutter entwischen konnten, haben Jason und ich als Kinder dort gespielt.
Der Weg durch die Grabstätten und Bäume hindurch zu Bills Haus war mir noch bestens vertraut aus der Zeit, als er mein allererster Freund gewesen war. Die Frösche und Insekten hatten eben erst mit ihren Sommergesängen begonnen, und ihr Spektakel würde mit zunehmender Wärme nur noch lauter werden. Mir fiel ein, dass D’Eriq mich mal gefragt hatte, ob ich nicht Angst hätte, so nahe bei einem Friedhof zu wohnen, und ich musste lächeln. Vor den Toten, die unter der Erde lagen, fürchtete ich mich nicht. Die auf der Erde herumlaufenden Toten waren sehr viel gefährlicher. Ich hatte im Garten eine Rose abgeschnitten und legte sie auf das Grab meiner Großmutter. Sie spürte sicher, dass ich da war und an sie dachte.
Es brannte ein schwaches Licht im alten Haus der Familie Compton, das ungefähr zur selben Zeit gebaut worden war wie meins. Ich klingelte an der Tür. Wenn Bill nicht irgendwo draußen im Wald herumstreunte, war er bestimmt zu Hause, denn sein Auto war da. Aber ich musste eine Weile warten, bis sich die Tür knarrend öffnete.
Bill schaltete die Außenbeleuchtung auf der Veranda an, und ich versuchte, nicht vor Schreck nach Luft zu schnappen. Er sah furchtbar aus.
Bill hatte sich eine Silbervergiftung zugezogen im Elfenkrieg, die er Neaves Silberzähnen verdankte. Seine Vampirfreunde hatten ihm zwar sofort danach – und seitdem immer wieder – Unmengen an Blut gegeben, doch ich sah mit einiger Sorge, dass seine Haut immer noch aschgrau war statt weiß. Sein Schritt war zögerlich, und er ging ein wenig vornübergebeugt, wie ein alter Mann.
»Sookie, komm doch herein«, sagte er. Sogar seine Stimme klang nicht mehr so kräftig wie früher.
Seine Worte klangen höflich, doch ich konnte nicht sagen, was er wirklich von meinem Besuch hielt. Die Gedanken der Vampire kann ich nicht lesen, einer der Gründe, warum ich anfangs so fasziniert gewesen war von Bill. Es kann sich wohl jeder vorstellen, wie berauschend die Stille ist nach dem unentwegten aufdringlichen Gelärme um mich herum.
»Bill«, begann ich und versuchte, weniger schockiert zu klingen, als ich es war. »Geht es dir besser? Dieses Gift in deinem Körper… Wirst du es los?«
Ich hätte schwören können, dass er seufzte. Mit einer Geste bat er mich, ihm voraus ins Wohnzimmer zu gehen. Die Lampen waren aus. Bill hatte Kerzen angezündet. Ich zählte acht Stück. Was er bei diesem flackernden Licht hier wohl allein gemacht hatte? Vielleicht eine CD gehört? Er liebte Musik, vor allem Bach. Ziemlich beunruhigt setzte ich mich aufs Sofa, während Bill in seinem Lieblingssessel auf der anderen Seite des niedrigen Tisches Platz nahm. Er sah so attraktiv aus wie immer, aber seinem Gesicht fehlte es an Lebhaftigkeit. Es war überdeutlich, dass er litt. Jetzt wusste ich, warum Sam wollte, dass ich ihn besuche.
»Geht’s dir gut?«, fragte er.
»Schon viel besser«, erwiderte ich vorsichtig. Er hatte gesehen, wie schlimm sie mich zugerichtet hatten.
»Die Narben, die… Wunden?«
»Die Narben sind noch zu sehen, aber schon viel weniger, als ich je erwartet hätte. Und die Löcher im Fleisch sind zugewachsen. In diesem Oberschenkel habe ich noch so eine Art Grübchen«, sagte ich und klopfte auf mein linkes Bein. »Aber Oberschenkel hatte ich ja sowieso schon immer mehr als genug.« Ich versuchte zu lächeln, war aber, ehrlich gesagt, zu besorgt, als dass es mir gelang. »Wird es bei dir denn besser?«, fragte ich zögernd.
»Es geht mir nicht schlechter«, erwiderte er und zuckte kaum merklich die Schultern.
»Und was ist mit der Apathie?«, fragte ich.
»Irgendwie scheine ich gar nichts mehr zu wollen«, sagte er nach einer längeren Pause. »Ich habe kein Interesse mehr an meinem Computer und auch keine Lust, meine Datenbank mit neu hereinkommenden Infos zu aktualisieren. Eric schickt ab und zu Felicia herüber, und sie macht dann die Bestellungen fertig und schickt sie ab. Sie gibt mir auch Blut, wenn sie hier ist.« Felicia war die Barkeeperin des Fangtasia und noch nicht allzu lange eine Vampirin.
Konnten Vampire an Depressionen leiden? Oder lag es an der Silbervergiftung?
»Kann dir nicht irgendwer helfen? Ich meine, dir helfen, gesund zu werden?«
Er lächelte leicht süffisant. »Doch, meine Schöpferin. Wenn ich von Lorena trinken könnte, wäre ich jetzt schon völlig gesund.«
»Tja, so ein Mist.« Ich konnte ihm einfach nicht zeigen, wie sehr mich das bedrückte, aber autsch. Ich hatte Lorena getötet. Doch ich schüttelte das Gefühl wieder ab. Es war nötig gewesen, sie zu töten, und es war vorbei und längst erledigt. »Hat sie noch andere zu Vampiren gemacht?«
Bill wirkte etwas weniger apathisch. »Ja, hat sie. Es gibt noch eine Tochter.«
»Und, wäre das eine Hilfe? Wenn du Blut von dieser Vampirin bekämst?«
»Ich weiß nicht. Vielleicht. Aber ich werde sie nicht… ich kann mich nicht an sie wenden.«
»Weil du nicht weißt, ob es wirklich helfen würde? Ihr alle braucht unbedingt mal ein Handbuch ›Praktische Tipps‹ oder so was.«
»Ja«, sagte er, als wäre das eine völlig neue Idee. »Ja, so was brauchen wir tatsächlich.«
Ich würde Bill nicht fragen, warum er zögerte, mit jemandem Kontakt aufzunehmen, der ihm helfen könnte. Bill war ein sturer und eigensinniger Mann, und ich konnte ihn sowieso nicht vom Gegenteil überzeugen, solange er sich nicht selbst dazu entschloss. Einen Augenblick lang saßen wir schweigend da.
»Liebst du Eric?«, fragte Bill plötzlich. Seine dunkelbraunen Augen fixierten mich mit jener ungeteilten Aufmerksamkeit, die großen Anteil daran gehabt hatte, dass ich mich zu ihm hingezogen fühlte, als wir uns zum ersten Mal begegneten.
Gab’s denn für jeden, den ich kannte, nichts wichtigeres mehr als meine Beziehung zum Sheriff von Bezirk Fünf? »Ja«, sagte ich ruhig. »Ich liebe ihn.«
»Sagt er, dass er dich liebt?«
»Ja.« Ich hielt seinem Blick stand.
»In manchen Nächten wünschte ich, er würde sterben«, sagte Bill.
Heute Abend waren wir wirklich ehrlich. »In der Hinsicht ist zurzeit ziemlich viel im Gange. Und ein paar Leute würde ich selbst auch nicht vermissen«, gab ich zu. »Daran muss ich immer denken, wenn ich um die Menschen trauere, die ich geliebt habe und die gestorben sind, wie Claudine, Gran und Tray.« Und das waren nur die ganz oben auf der Liste. »Ich kann mir also vorstellen, wie du dich fühlst. Aber ich… wünsche Eric bitte nichts Schlechtes.« Ich könnte es nicht ertragen, noch mehr wichtige Menschen in meinem Leben zu verlieren.
»Wen würdest du denn gern tot sehen, Sookie?« Ein Funken Neugier blitzte in seinen Augen auf.
»Das werde ich dir bestimmt nicht erzählen.« Ich lächelte ihm halbherzig zu. »Du würdest womöglich wieder versuchen, mir einen Gefallen zu tun. So wie bei Onkel Bartlett.« Als ich herausfand, dass Bill den Bruder meiner Großmutter, der mich als Kind missbrauchte, ermordet hatte – da hätte ich einen Schnitt machen und abhauen sollen. Wäre mein Leben dann nicht ganz anders verlaufen? Aber dafür war es jetzt zu spät.
»Du hast dich verändert«, sagte Bill.
»Allerdings. Ein paar Stunden lang habe ich geglaubt, ich müsse sterben, und ich hatte Schmerzen wie noch nie zuvor. Neave und Lochlan haben es unglaublich genossen. Das hat tief in mir einen Schalter umgelegt. Als du zusammen mit Niall die beiden getötet hast, war das, als wäre mein eindringlichstes Gebet, das ich je ausgestoßen habe, erhört worden. Eigentlich bin ich Christin, aber es erscheint mir immer öfter wie eine Anmaßung, das von mir zu behaupten. In mir steckt noch jede Menge Wut. Wenn ich nicht schlafen kann, denke ich an all die Leute, denen es egal war, wie viel Schmerzen und Sorgen sie mir bereitet haben. Und ich denke daran, wie gut es mir gehen würde, wenn sie tot wären.«
Daran, dass ich Bill von dieser schrecklichen, geheimen Seite erzählen konnte, zeigte sich, wie nahe wir uns einmal gestanden hatten.
»Ich liebe dich«, sagte er. »Und nichts, was immer du auch sagst oder tust, wird das je ändern. Wenn du mich bitten würdest, eine Leiche für dich zu verscharren – oder jemanden aus dem Weg zu räumen–, würde ich es ohne Zögern tun.«
»Zwischen uns stehen einige schlimme Dinge, Bill, aber du wirst immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben.« Ich krümmte mich innerlich, als ich diese abgedroschene Phrase aus meinem eigenen Mund kommen hörte. Aber manchmal sind Klischees eben wahr; und dies war die Wahrheit. »Ich bin es doch wohl kaum wert, dass man so starke Gefühle für mich hegt.«
Es gelang ihm zu lächeln. »Zu der Frage, ob du es wert bist: Ich glaube nicht, dass Liebe viel mit dem Wert des Gegenstandes der Liebe zu tun hat. Davon abgesehen, würde ich deiner Einschätzung widersprechen. Ich halte dich für eine wunderbare Frau, und ich glaube, du versuchst immer, der beste Mensch zu sein, der du sein kannst. Niemand könnte… sorglos und heiter sein… nachdem er dem Tod so nah war wie du.«
Ich stand auf, um zu gehen. Sam hatte gewollt, dass ich Bill besuche, um dessen Situation zu verstehen, und das hatte ich getan. Als auch Bill aufstand und mich zur Tür brachte, bemerkte ich, dass er sich nicht mehr so blitzschnell bewegte wie früher. »Du wirst doch weiterleben, oder?«, fragte ich ihn, plötzlich besorgt.
»Ich glaube schon«, erwiderte er, als machte es ohnehin keinen Unterschied. »Aber gib mir doch einen Kuss für alle Fälle.«
Ich legte ihm einen Arm um den Hals, den Arm, dessen Hand nicht die Taschenlampe hielt, und ließ ihn seine Lippen auf meine drücken. Seine Berührung und sein Geruch riefen eine Menge Erinnerungen in mir wach. Lange, sehr lange, wie mir schien, standen wir aneinandergepresst da, doch statt eine wachsende Erregung zu empfinden, wurde ich immer ruhiger. Mit seltsamer Deutlichkeit nahm ich wahr, wie ich atmete – langsam und gleichmäßig, fast wie jemand, der schlief.
Ich merkte, dass Bill besser aussah, als ich schließlich einen Schritt zurücktrat. Erstaunt hob ich die Augenbrauen.
»Dein Elfenblut hilft mir«, erklärte er.
»Ich bin doch nur zu einem Achtel Elfe. Und du hast gar kein Blut von mir bekommen.«
»Nähe«, erwiderte er kurz angebunden. »Die Berührung von Haut auf Haut.« Seine Lippen umspielte ein Lächeln. »Wenn wir Sex hätten, würde meine Genesung noch viel schneller voranschreiten.«
Blödsinn, dachte ich. Aber ich kann nicht verhehlen, dass diese kühle Stimme etwas aufrührte südlich meines Nabels, ein kurzes Aufwallen von Lust. »Bill, dazu wird es nicht kommen«, sagte ich. »Aber du solltest dieses andere Vampirkind von Lorena finden.«
»Ja«, erwiderte er. »Vielleicht.« Seine dunklen Augen glühten seltsam; aber vielleicht war das auch nur eine Folge der Silbervergiftung oder des Kerzenlichts. Ich wusste, er würde sich nicht bemühen, mit Lorenas anderem Kind Kontakt aufzunehmen. Welchen Funken auch immer mein Besuch in ihm zum Glühen gebracht hatte, er begann bereits wieder zu erlöschen.