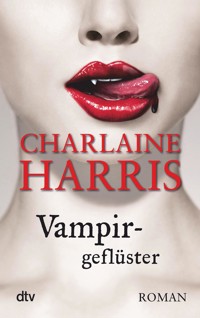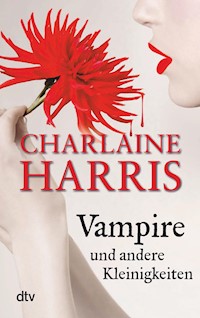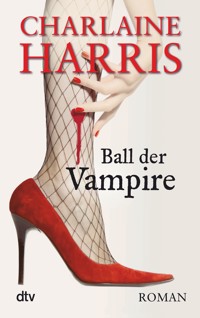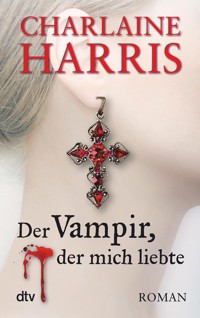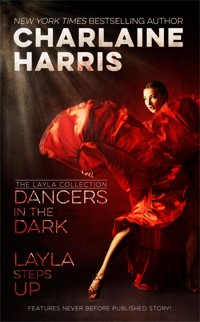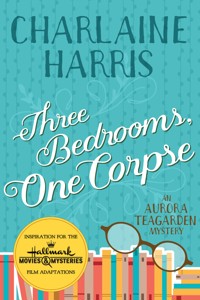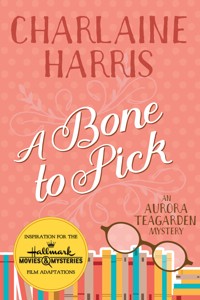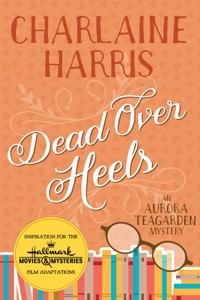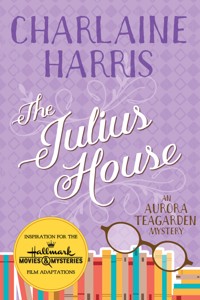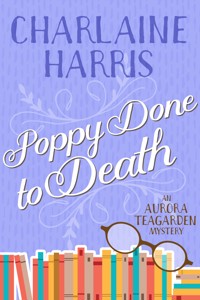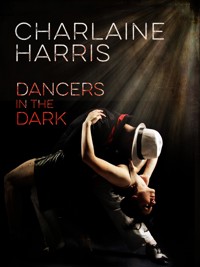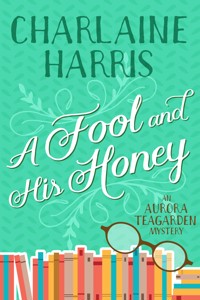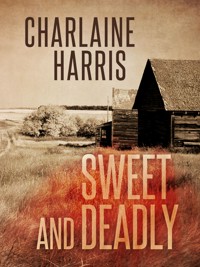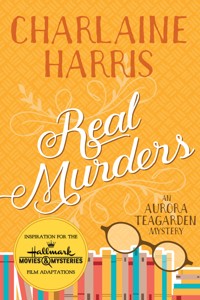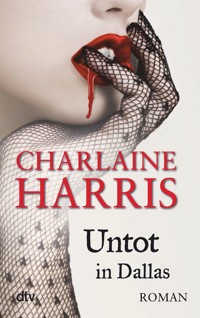
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Sookie Stackhouse
- Sprache: Deutsch
Ein ermordeter Kollege, ein verschwundener Vampir – und dann tauchen auch noch Werwölfe auf! Sookie Stackhouse, die gedankenlesende Kellnerin, hat es zurzeit nicht leicht. Erst wird einer ihrer Kollegen ermordet, dann sieht sie sich unversehens einem schaurigen Geschöpf gegenüber, das ihr mit giftigen Krallen tiefe Wunden zufügt. Zum Glück sind schnell ein paar Vampire zur Stelle, die ihr netterweise das Gift aus den Adern saugen. Womit sie ihr das Leben retten. Als einer der Blutsauger sie um einen Gefallen bittet, willigt sie daher ein, nach Dallas zu fahren und dort nach einem verschwundenen Vampir zu suchen. Ein gefährlicher Auftrag …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 495
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Sookie Stackhouse, die gedankenlesende Kellnerin, hat es zurzeit nicht leicht. Erst wird einer ihrer Kollegen ermordet, dann sieht sie sich unversehens einem schaurigen Geschöpf gegenüber, das ihr mit giftigen Krallen tiefe Wunden zufügt. Zum Glück sind schnell ein paar Vampire zur Stelle, die ihr netterweise das Gift aus den Adern saugen. Womit sie ihr das Leben retten. Als einer der Blutsauger sie um einen Gefallen bittet, willigt sie daher ein, nach Dallas zu fahren und dort nach einem verschwundenen Vampir zu suchen. Ein gefährlicher Auftrag …
Charlaine Harris
Untot in Dallas
Sookie Stackhouse Band 2
Roman
Deutsch von Dorothee Danzmann
Ich widme dieses Buch allen, denen Vorübergehend tot gut gefallen hat und die mir dies auch mitgeteilt haben. Das war für mich eine große Ermutigung, für die ich mich herzlich bedanke.
Mein Dank geht zudem an Patsy Asher von Remember the Alibi in San Antonio, Texas, Chloe Green aus Dallas sowie all die hilfsbereiten Freunde im Cyberspace, die ich über DorothyL kennenlernte und die alle meine Fragen prompt und begeistert beantwortet haben.
Mein Beruf ist der Schönste der Welt.
Kapitel 1
Andy Bellefleur war sturzbetrunken. Das passiert Andy wirklich nicht oft. Ich muss es wissen – ich kenne die Schluckspechte von Bon Temps. Meine Arbeit im Lokal Sam Merlottes, der ich jetzt bereits seit ein paar Jahren nachgehe, hat mich mit so gut wie allen von ihnen bekanntgemacht. Andy Bellefleur, Sohn dieser Stadt und Ermittler in der kleinen Polizeitruppe, die wir unser Eigen nennen, hatte sich jedenfalls noch nie zuvor im Merlottes betrunken, und ich hätte natürlich nur zu gern gewusst, warum der heutige Abend da eine Ausnahme bildete.
Man kann Andy und mich wahrlich nicht als enge Freunde bezeichnen, ich konnte ihn also unmöglich direkt fragen. Aber mir stehen andere Mittel und Wege zur Verfügung, und ich beschloss, mich ihrer zu bedienen. Ich versuche wirklich, mich meiner Behinderung – oder meiner Gabe, je nachdem, wie Sie es sehen wollen – nur eingeschränkt zu bedienen und mein Talent nur einzusetzen, wenn es gilt, Dinge herauszufinden, die mich oder die Meinen in irgendeiner Weise betreffen könnten. Aber manchmal siegt auch ganz einfach die Neugier über alle guten Vorsätze.
Ich schob also mein geistiges Visier hoch und las Andys Gedanken. Gleich darauf tat es mir auch schon leid.
Andy hatte einen Mann wegen Kindesentführung verhaften müssen. Dieser Mann hatte ein zehnjähriges Mädchen aus seiner Nachbarschaft in den Wald gelockt und vergewaltigt. Das Mädchen lag im Krankenhaus, und der Mann saß im Gefängnis, aber der Schaden war angerichtet und ließ sich nicht wiedergutmachen. Ich war den Tränen nahe. Dieses Verbrechen erinnerte mich allzu sehr an Geschehnisse aus meiner eigenen Vergangenheit. Andy gefiel mir gleich etwas besser, weil die Sache ihn so sehr deprimierte.
„Gib mir deine Autoschlüssel, Andy”, befahl ich streng, woraufhin er mir ein wenig verständnislos dreinschauend sein breites Gesicht zuwandte. Es folgte ein langes Schweigen, aber dann waren meine Worte und deren Bedeutung endlich wohl doch bis in Andys vernebelte Hirnwindungen gedrungen. Umständlich durchwühlte der Detective die Taschen seiner Jeans und überreichte mir schließlich einen schweren Schlüsselbund. Ich stellte ihm daraufhin einen weiteren Bourbon mit Cola hin. „Der geht auf mich”, sagte ich und ging hinüber zum Telefon am anderen Tresenende, um Portia, Andys Schwester, anzurufen. Die Geschwister Bellefleur bewohnten gemeinsam ein etwas heruntergekommenes, riesiges zweistöckiges Haus aus der Zeit vor dem Bürgerkrieg. Das Haus hatte schon bessere Tage gesehen und war einst prachtvoll gewesen. Es lag in einer der hübschesten Straßen im schönsten Teil Bon Temps’. Hier, in der Magnolia Creek Road, lagen die Häuser allesamt zu einem Streifen Parkland hin, durch den sich ein kleiner Fluss schlängelte. Hier und da querten anmutige Fußgängerbrücken diesen Fluss, und zu beiden Seiten des Parks verlief eine Straße. An der Magnolia Creek Road befand sich noch eine Reihe weiterer alter Anwesen, die sich aber in einem weit besseren Zustand befanden als Belle Rive, das Haus der Bellefleurs. Weder Portia als Anwältin noch Andy als Polizist verdienten genug, um Belle Rive so instand zu halten, wie es hätte getan werden müssen, und das Geld, das man eigentlich braucht, um ein solches Haus und das dazugehörige Anwesen angemessen zu unterhalten, war längst fort. Caroline, die Großmutter der beiden, weigerte sich jedoch stur und standhaft zu verkaufen.
Portia ging nach dem zweiten Klingeln an den Apparat.
„Portia, hier spricht Sookie Stackhouse”, sagte ich, wobei ich die Stimme erheben musste, um den Kneipenlärm zu übertönen.
„Du bist wohl arbeiten?”
„Ja. Andy ist hier. Angeschickert und ziemlich durch den Wind. Ich habe ihm die Autoschlüssel abgenommen. Kannst du ihn abholen kommen?”
„Andy ist betrunken? Das kommt ja wirklich selten vor. Klar, ich bin in zehn Minuten da”, versprach Portia und legte auf.
„Sookie, du bist lieb”, verkündete Andy plötzlich.
Die Cola-Bourbon-Mischung, die ich ihm eingeschenkt hatte, hatte er bereits ausgetrunken. Ich nahm ihm hastig das Glas weg, damit er nicht nach einem weiteren Drink fragen konnte. „Vielen Dank für die Blumen, Andy”, sagte ich. „Du bist auch ziemlich okay.”
„Wo issen … der Liebste?”
„Direkt hinter Ihnen”, ertönte eine kühle Stimme, und unmittelbar hinter Andys Rücken tauchte Bill Compton auf. Über Andys Kopf hinweg, der dem Polizisten immer wieder auf die Brust zu sinken drohte, nickte ich meinem Freund zu. Bill war ungefähr einen Meter neunzig groß, mit dunkelbraunem Haar und ebensolchen Augen. Er besaß die breiten Schultern und harten, muskulösen Arme eines Mannes, der jahrelang körperliche Arbeit hat leisten müssen. Bill hatte zusammen mit seinem Vater den elterlichen Hof bewirtschaftet, nach dem Tod des Vaters dann allein, bis er Soldat geworden und in den Krieg gezogen war. In den Bürgerkrieg.
„Hallo, VB!”, rief Charlsie Tootens Mann Micah. Bill hob beiläufig die Hand, um den Gruß zu erwidern, und mein Bruder Jason sagte: „Guten Abend, Vampirbill”, und zwar vollendet höflich und freundlich. Jason, der Bill anfangs nicht gerade mit offenen Armen in unserem kleinen Familienkreis aufgenommen hatte, hatte nunmehr in seinem Verhalten meinem Freund gegenüber eine völlig neue Seite aufgeschlagen. Wobei ich allerdings in dieser Frage noch immer sozusagen im Geiste die Luft anhielt, denn ich wusste nicht, wie lange dieses neue Benehmen andauern würde.
„Für einen Blutsauger sind Sie eigentlich ganz in Ordnung, Bill”, sagte Andy Bellefleur plötzlich laut und vernehmlich, während er sich auf seinem Barhocker so umdrehte, dass er Bill direkt ansehen konnte. Ich überprüfte meine Einschätzung von Andys Betrunkenheitsgrad und korrigierte die Werte nach oben; Andy hatte bisher noch keine große Begeisterung an den Tag gelegt, was die Integration von Vampiren in den amerikanischen Alltag betraf. „Danke”, erwiderte Bill. „Sie sind auch nicht übel – für einen Bellefleur.” Dann beugte er sich über den Tresen, um mir einen Kuss zu geben. Bills Lippen waren ebenso kühl wie seine Stimme. Daran hatte ich mich erst gewöhnen müssen – genau wie an die Tatsache, dass ich keinen Herzschlag hörte, wenn ich meinen Kopf auf seine Brust legte. „Guten Abend, Schatz”, sagte Bills sanfte, leise Stimme. Ich schob ihm ein Glas mit dem synthetischen Blut zu, das die Japaner entwickelt hatten, Blutgruppe B Negativ, und er leerte es in einem Zug. Dann leckte er sich die Lippen. Fast umgehend sah er etwas rosiger aus als zuvor.
„Wie war dein Treffen, Schatz?”, wollte ich wissen, denn Bill hatte den Großteil der Nacht in Shreveport verbracht.
„Das erzähle ich dir später.”
Ich hoffte inständig, Bill möge bei seiner Arbeit keine ebenso herzzerreißende Geschichte erlebt haben wie Andy. „Gut”, sagte ich. „Ich wäre dir dankbar, wenn du Portia helfen könntest, Andy ins Auto zu hieven, wenn sie kommt. Da ist sie ja schon.” Ich wies mit dem Kinn auf die Tür.
In der Regel trug Portia die Berufskleidung ihrer Zunft: Rock, Bluse, Jackett, Nylons und Pumps mit flachen Absätzen, aber an diesem Abend hatte sie sich Jeans und ein leicht verschlissenes Sophie-Newcombe-T-Shirt übergezogen. Portia war ebenso stämmig gebaut wie ihr Bruder, aber sie hatte wunderschönes langes, dickes, kastanienbraunes Haar, das sie sorgfältig pflegte – das einzige Anzeichen dafür, dass sie noch nicht aufgegeben hatte. Zielstrebig bahnte sie sich einen Weg durch die lärmende Menge im Lokal, ohne nach rechts oder links zu sehen.
„Der ist ja wirklich ziemlich hinüber”, stellte sie mit einem abschätzenden Blick auf ihren Bruder fest, wobei sie sich bemühte, Bills Anwesenheit gar nicht wahrzunehmen. Mein Vampir verunsicherte sie sehr. „Oft passiert das ja nicht, aber wenn mein Bruder schon mal beschließt, sich einen hinter die Binde zu kippen, macht er keine halben Sachen.”
„Lass Bill Andy zum Auto tragen, Portia”, schlug ich vor. Andy war größer als seine Schwester und untersetzt, er war eindeutig zu schwer für sie.
„Danke, ich glaube, das schaffe ich allein”, erwiderte sie fest, wobei sie Bill, der mich fragend ansah und eine Braue hochgezogen hatte, immer noch keines Blickes würdigte.
Also sah ich zu, wie Portia ihrem Bruder den Arm um die Taille legte und versuchte, den Betrunkenen vom Barhocker zu bekommen. Andy jedoch ließ sich nicht bewegen. Daraufhin sah Portia sich suchend um. Offenbar hatte sie gehofft, Sam um Hilfe bitten zu können, denn Sam wirkt zwar klein und zäh, ist aber ziemlich stark. „Sam arbeitet heute im Country Club”, erklärte ich ihr. „Er betreut die Bar bei einer Geburtstagsfeier. Es wäre wirklich am besten, wenn Bill dir hilft.”
„Also gut”, erwiderte die Anwältin daraufhin steif, wobei sie den Blick unverwandt auf das blank geputzte Holz des Tresens gerichtet hielt. „Danke.”
Blitzschnell hatte Bill Andy gepackt und brachte ihn zur Tür, wobei er ihn wirklich mehr oder weniger tragen musste, denn Andys Beine waren wie Wackelpudding. Micah sprang auf, um die Tür zu öffnen. So konnte Bill Andy mit Schwung auf den Kundenparkplatz befördern.
„Danke”, sagte Portia. „Hat er bezahlt?”
Ich nickte.
„Gut!” Portia schlug mit der flachen Hand auf den Tresen, womit sie mir zu verstehen gab, dass sie sich nun wieder auf den Weg machen würde. Dann eilte sie Bill nach, wobei sie sich auf dem Weg zur Tür noch einen ganzen Haufen gut gemeinter Ratschläge anhören musste.
So kam es, dass der alte Buick von Detective Andy Bellefleur die ganze Nacht und noch einen Gutteil des nächsten Morgens auf dem Parkplatz des Merlottes stand. Der Buick war leer gewesen, als Andy ihn abgestellt hatte, um die Kneipe aufzusuchen. Das würde der Detective später beschwören. Er würde weiterhin aussagen, am fraglichen Abend hätten ihn die aufwühlenden Erlebnisse seines Arbeitstages so sehr beschäftigt, dass er vergaß, die Autotüren abzuschließen.
Irgendwann zwischen zwanzig Uhr, als Andy auf dem Parkplatz des Merlottes angekommen war, und zehn Uhr am nächsten Morgen, als ich dort eintraf, um beim Herrichten des Lokals für den nächsten Tag behilflich zu sein, bekam Andys Auto einen Insassen.
Einen Insassen, dessen Auftauchen für den Polizisten ziemlich peinlich werden würde.
Denn dieser Insasse war tot.
* * *
Eigentlich hätte ich an diesem Morgen gar nicht dort sein sollen. Ich hatte die Nacht zuvor die Spätschicht gearbeitet, und dasselbe hätte ich eigentlich auch an diesem Tag tun sollen. Aber Bill hatte mich gebeten, mit einer meiner Kolleginnen zu tauschen, denn er wollte, dass ich mit ihm nach Shreveport fuhr. Sam hatte nichts dagegen gehabt, und so hatte ich meine Freundin Arlene gebeten, meine Spätschicht zu übernehmen. Arlene hätte an diesem Tag eigentlich frei haben sollen, aber ihr war viel an den Trinkgeldern gelegen, die wir nachts kassierten und die viel besser waren als die tagsüber. So hatte sie sich gern bereit erklärt, an diesem Tag um siebzehn Uhr zur Arbeit zu erscheinen.
Andy hatte vorgehabt, gleich am Morgen sein Auto abzuholen. Ihn hatte jedoch ein übler Kater geplagt, weswegen er es nicht über sich gebracht hatte, Portia dazu zu bewegen, ihn rasch vor der Arbeit beim Merlottes vorbeizubringen. Unser Lokal liegt etwas außerhalb – ganz und gar nicht auf Andys Arbeitsweg. Portia wollte ihren Bruder lieber in der Mittagspause abholen und mit ihm zum Mittagessen zu uns herausfahren, wobei er dann gleich seinen Wagen wieder mit in die Stadt würde nehmen können.
So wartete der Buick samt seinem stummen Insassen weit länger darauf, abgeholt zu werden, als er eigentlich hätte warten sollen.
Ich hatte in dieser Nacht sechs Stunden geschlafen und fühlte mich von daher ziemlich gut. Wenn man wie ich ein Tagmensch ist, dann kann einen die Beziehung zu einem Vampir ganz schön aus dem Biorhythmus bringen. Wir hatten das Lokal gegen eins geschlossen. Dann war ich mit Bill zusammen nach Hause gefahren – in sein Haus. Wir waren in seinen Whirlpool gestiegen und hatten danach noch ein paar andere nette Dinge getan. Ich war kurz nach zwei Uhr morgens ins Bett gekommen, und als ich aufstand, war es bereits neun Uhr und Bill natürlich schon lange über alle Berge.
Ich trank zum Frühstück eine Menge Wasser und Orangensaft und nahm Vitamintabletten und ein Eisenpräparat. Das hatte ich mir angewöhnt, seit Bill in mein Leben getreten war und mit ihm außer Liebe, Abenteuern und vielen aufregenden Erlebnissen auch die ständige Bedrohung, irgendwann einmal anämisch zu werden. Gott sei Dank wurde es langsam kühler. Ich saß auf Bills Veranda und trug eine Strickjacke zur schwarzen Hose, die wir bei der Arbeit im Merlottes anhatten, wenn es für Shorts nicht mehr warm genug war. Mein weißes Polohemd zeigte über der linken Brust eingestickt den Namenszug des Merlottes.
Während ich die Morgenzeitung überflog, stellte ich halb unbewusst fest, dass das Gras eindeutig nicht mehr so schnell wuchs wie noch vor ein paar Wochen und dass ein paar der Blätter an den Bäumen aussahen, als wollten sie sich schon bald bunt färben. Vielleicht würden an diesem Freitag ja selbst die Temperaturen im Footballstadion der Highschool halbwegs erträglich sein.
In Louisiana tut sich der Sommer schwer mit dem Abschiednehmen. Das gilt selbst für den nördlichen Teil des Bundesstaates. Der Herbst hält recht halbherzig seinen Einzug, als könne er jederzeit wieder verschwinden und uns erneut der erstickenden Hitze überantworten, die hier im Juli herrscht. Er gibt sich ungern zu erkennen. Aber ich war auf der Hut an diesem Morgen, weshalb ich seine Spuren durchaus entdecken konnte. Herbst und Winter – das hieß längere Nächte, mehr Zeit mit Bill, mehr Stunden zum Schlafen.
Also war ich guter Laune, als ich zur Arbeit fuhr, und beim Anblick des Buick, der einsam und allein dort auf dem großen Kundenparkplatz vor unserem Lokal stand, kam mir die Erinnerung an Andys überraschende Zechtour am Abend zuvor wieder in den Sinn. Ich muss gestehen, ich lächelte beim Gedanken daran, wie er sich an diesem Morgen wohl fühlen mochte. Gerade wollte ich vom Kundenparkplatz abbiegen und ums Haus herumfahren, um meinen Wagen dort hinten auf dem Parkplatz der Angestellten abzustellen, da bemerkte ich, dass die rechte hintere Tür von Andys Wagen ein wenig offen stand. Das hieß aber auch, dass die Innenbeleuchtung des Wagens brannte und dass sich die Batterie entlud. Das würde Andy gehörig ärgern. Er würde ins Lokal kommen und einen Abschleppwagen rufen oder jemanden bitten müssen, ihm Starthilfe zu geben. Also schaltete ich mein Auto in den Leerlauf und stieg aus, wobei ich den Motor laufen ließ. Wie sich herausstellte, war ich viel zu optimistisch gewesen. Ich hätte den Motor lieber abstellen sollen.
Ich wollte die hintere Tür von Andys Wagen schließen, aber das war nicht möglich, die Tür gab gerade mal zwei Zentimeter nach. Also warf ich mich mit dem ganzen Körper dagegen, denn ich dachte, so könnte ich das Schloss auf jeden Fall zum Einschnappen bringen und mich dann einfach rasch wieder davonmachen. Aber auch so ließ sich die Tür nicht schließen. Dann wehte ein Lufthauch über den Parkplatz, und ich bekam einen ganz schrecklichen Geruch in die Nase, der mir vor Entsetzen die Kehle zuschnürte. Der Geruch war mir nicht unbekannt. Ich hielt mir die Hand vor den Mund – was allerdings bei diesem Gestank wenig half – und warf einen vorsichtigen Blick auf den Rücksitz des Wagens.
„Oh Himmel!”, flüsterte ich dann entsetzt. „Scheiße.” Irgendjemand hatte Lafayette, einen der Köche, die sich um die Küche im Merlottes kümmerten, auf den Rücksitz gezwängt. Er war nackt. Sein schmaler brauner Fuß mit den tiefrot lackierten Fußnägeln hatte verhindert, dass die Wagentür sich schließen ließ, und es war Lafayettes Leiche, die hier derart zum Himmel stank.
Ich stolperte zurück, kletterte wieder in meinen Wagen und fuhr um das Haus herum zum Angestelltenparkplatz, wobei ich die ganze Zeit ohne Unterlass auf die Hupe drückte. Da kam auch schon Sam Merlotte aus dem Hintereingang gestürzt, eine Schürze um die Taille gebunden. Ich bremste, stellte den Motor ab und war so schnell aus dem Auto gesprungen, dass ich gar nicht recht mitbekam, ob und wie ich diese Dinge getan hatte. Dann klebte ich auch schon an Sam wie eine statisch aufgeladene Socke frisch aus dem Wäschetrockner.
„Was ist passiert?”, ertönte die Stimme meines Chefs dicht an meinem Ohr. Ich lehnte mich etwas zurück, um Sam anschauen zu können. Den Kopf brauchte ich dazu nicht zu recken, denn Sam war ein kleiner Mann. Sein rotgoldenes Haar glitzerte in der Sonne. Er hatte tiefblaue Augen, die weit aufgerissen und fragend auf mich gerichtet waren.
„Lafayette!”, sagte ich, und dann fing ich an zu weinen, was zwar lächerlich und albern war und nun wirklich niemandem nutzte, was ich aber nicht verhindern konnte. „Er ist tot. In Andy Bellefleurs Auto.”
Sam legte den Arm fester um meinen Rücken und zog mich ganz dicht zu sich heran. „Arme Sookie!”, sagte er liebevoll. „Es tut mir so leid, dass du das sehen musstest. Ich rufe die Polizei. Der arme Lafayette!”
Man braucht keine außergewöhnlichen kulinarischen Vorkenntnisse, wenn man im Merlottes kochen will, und die Köche wechseln recht häufig. Sams Speisekarte bietet eigentlich nur Fritten und Sandwiches. Lafayette hatte zu meiner Verwunderung länger bei uns ausgeharrt als die meisten anderen. Lafayette war schwul gewesen, schillernd schwul, strahlend schwul, ein Schwuler mit Make-up und irrsinnig langen Nägeln. Im nördlichen Louisiana sind die Menschen weniger tolerant als in New Orleans, und Lafayette wird es doppelt so schwer gehabt haben wie andere, denn er war noch dazu schwarz. Trotz seiner Probleme – oder vielleicht gerade deswegen – war mein Kollege immer fröhlich gewesen, auf sehr unterhaltsame Art zu Späßen und Schabernack aufgelegt, klug und noch dazu ein wirklich fähiger Koch. Er hatte eine Spezialsauce kreiert, in die er seine Hamburger vor dem Braten kurz eintauchte, und viele unserer Kunden verlangten stets ausdrücklich nach einem Lafayette-Burger.
„Hatte er Verwandte hier in der Gegend?”, wollte ich von Sam wissen, nachdem wir uns, beide ein wenig peinlich berührt, voneinander gelöst hatten, um uns auf den Weg zum Telefon in Sams Büro zu machen.
„Er hatte hier einen Vetter”, erwiderte Sam und tippte rasch die Notrufnummer 911 in sein Telefon. „Bitte kommen Sie sofort ins Merlottes in der Hummingbird Road”, bat er, als jemand den Anruf entgegengenommen hatte. „Hier liegt ein toter Mann in einem abgestellten Fahrzeug. Auf dem Parkplatz vor der Gaststätte. Sie sollten vielleicht auch Andy Bellefleur Bescheid sagen. Bei dem abgestellten Fahrzeug handelt es sich nämlich um sein Auto.”
Das überraschte Quietschen am anderen Ende der Leitung konnte selbst ich noch hören, obwohl ich in der Bürotür stehen geblieben war.
Gerade traten Holly Cleary und Danielle Grey lachend durch die Hintertür, die beiden Kellnerinnen, die außer mir noch in der Tagschicht arbeiten sollten. Beide Frauen waren Mitte zwanzig und geschieden. Sie waren ihr ganzes Leben lang miteinander befreundet gewesen, und ihnen schien keine Arbeit etwas auszumachen, solange sie sie gemeinsam verrichten konnten. Holly hatte einen fünfjährigen Sohn, der in die Vorschule ging, Danielle eine siebenjährige Tochter und einen Sohn, der noch zu klein für die Schule war und daher bei Danielles Mutter blieb, wenn Danielle arbeiten ging. Auch wenn die beiden in meinem Alter waren, war ich nie richtig warm mit ihnen geworden. Das lag daran, dass beide sehr darauf bedacht waren, einander genug zu sein.
„Was ist denn los?”, fragte Danielle, als sie meinen Gesichtsausdruck sah, und sofort verzog sich auch ihr Gesicht – schmal und sommersprossenübersät – besorgt.
„Warum steht Andys Wagen da vorn auf dem Parkplatz?”, wollte Holly wissen, wobei mir einfiel, dass sie einmal eine Weile mit Andy zusammen gewesen war. Holly war eine Frau mit kurzem blonden Haar, das ihr wie verwelkte Narzissen in die Stirn hing, und mit der hübschesten Haut, die ich je zu Gesicht bekommen hatte. „Er hat die Nacht darin verbracht?”
„Nein”, sagte ich, „aber jemand anderes.”
„Wer denn?”
„Lafayette liegt in Andys Auto.”
„Andy hat einer schwarzen Schwuchtel gestattet, in seinem Auto zu übernachten?” Das kam von Holly, die die Direktere der beiden war.
„Was ist mit Lafayette?”, wollte Danielle wissen, denn sie war die Gescheitere der beiden.
„Das wissen wir nicht”, erwiderte Sam. „Die Polizei ist auf dem Weg.”
Danielle sah ihn nachdenklich an. „Damit willst du uns wohl zu verstehen geben”, sagte sie ganz langsam, „dass Lafayette tot ist?”
„Ja”, sagte ich. „Genau das meinen wir.”
„Nun, wir sollen in einer Stunde den Laden hier aufmachen.” Holly stemmte die Hände in die Hüften. „Was wollen wir diesbezüglich tun? Wenn die Polizei erlaubt, dass wir aufmachen, wer soll dann hier kochen? So oder so werden Kunden kommen, und die werden zu Mittag essen wollen.”
„Wir sollten alles wie gewohnt vorbereiten”, sagte Sam. „Für den Fall der Fälle. Auch wenn ich persönlich ja glaube, dass wir frühestens heute Nachmittag werden öffnen können.” Mit diesen Worten ging er zurück in sein Büro, um einen unserer Aushilfsköche zu bewegen, diese Schicht zu übernehmen.
Es war unheimlich, die ganze Routine ablaufen zu lassen, die erforderlich ist, um unser Lokal für Gäste herzurichten – als könne jeden Moment Lafayette hereingestöckelt kommen, auf den Lippen eine haarsträubende Geschichte über eine Party, auf der er unlängst gewesen war, ganz so, wie er noch vor ein paar Tagen hereingekommen war. Dann näherten sich mit heulenden Sirenen auf der Landstraße, die am Merlottes vorbeiführt, verschiedene Polizeifahrzeuge und fuhren kurz darauf knirschend auf Sams kiesbestreutem Kundenparkplatz vor. Als wir die Stühle von den Tischen geholt, die Tische selbst zurechtgerückt, Besteck in Servietten gerollt und Teller bereitgestellt hatten, kam die Polizei zu uns ins Lokal.
Das Merlottes liegt außerhalb der Stadtgrenzen, also war der Sheriff des Landkreises, Bud Dearborn, zuständig. Bud war ein guter Freund meines Vaters gewesen; inzwischen hatte er graumeliertes Haar. Sein Gesicht wirkte leicht eingedrückt, wie das eines Pekinesen in Menschengestalt, und er hatte dunkelbraune Augen, in denen sich nur schwer etwas lesen ließ. Er trug schwere Stiefel und die Baseballkappe seines Lieblingsvereins, als er unser Lokal betrat, woraus ich schloss, dass man ihn von der Arbeit auf seinem Hof abberufen hatte. Zusammen mit Bud betrat Alcee Beck den Raum, der einzige afroamerikanische Detective, den die hiesige Kreispolizei vorweisen konnte. Alcee war so schwarz, dass sein blütenweißes Hemd im Kontrast dazu regelrecht leuchtete. Er trat in Schlips und Kragen auf, der Schlips anständig gebunden, der Anzug makellos. Alcees Schuhe waren auf Hochglanz poliert, und man hätte sich darin spiegeln können.
Alcee und Bud sorgten dafür, dass unser Landkreis funktionierte – besser gesagt, dass all die wichtigen Elemente funktionierten, von denen dann abhing, dass der Landkreis funktionierte. Auch Mike Spencer, Beerdigungsunternehmer und amtlicher Leichenbeschauer, spielte in Kreisangelegenheiten eine wichtige Rolle. Auch er war ein guter Freund Buds. Ich hätte jede Wette gemacht, dass sich Mike Spencer bereits draußen auf dem Parkplatz befand, um den armen Lafayette offiziell für tot zu erklären.
Bud Dearborn fragte: „Wer hat die Leiche gefunden?”
„Ich”, verkündete ich, woraufhin die beiden leicht ihre Marschrichtung änderten und direkt auf mich zukamen.
„Können wir Ihr Büro benutzen, Sam?” wollte Bud Dearborn wissen und wies mich, ohne Sams Antwort überhaupt abzuwarten, mit einer Kopfbewegung an, ihn dorthin zu begleiten.
„Klar, machen Sie nur”, erwiderte mein Chef trocken. „Sookie, geht es wieder?”
„Alles in Ordnung.” Ob das der Wahrheit entsprach, hätte ich selbst nicht genau sagen können, aber alles, was Sam hätte tun können, um mir zu helfen, hätte ihn nur in Schwierigkeiten gebracht und doch letztlich nichts geändert. Bud nickte mir zu, ich solle mich setzen, aber ich schüttelte den Kopf. Ich wollte lieber stehen. Bud und Alcee machten es sich auf den Stühlen bequem, die in Sams Büro herumstanden: Bud setzte sich natürlich in Sams großen Schreibtischsessel, während Alcee sich mit der nächstbesten Sitzgelegenheit begnügte, ein Stuhl immerhin, dessen Sitz gepolstert war.
„Wann hast du Lafayette das letzte Mal lebend gesehen?”, wollte Bud wissen.
Darüber musste ich erst nachdenken.
„Gestern Abend hat er nicht gearbeitet”, sagte ich. „Gestern Abend hat Anthony gearbeitet, Anthony Bolivar.”
„Wer ist das?” Alcee legte seine breite Stirn in Falten. „Der Name kommt mir nicht bekannt vor.”
„Ein Freund Bills. Er war auf der Durchreise und brauchte einen Job. Er hat über Arbeitserfahrung verfügt.” Anthony Bolivar hatte während der großen Weltwirtschaftskrise in den 30er Jahren als Koch in einem Schnellrestaurant gearbeitet.
„Soll das heißen, der Koch im Merlottes ist ein Vampir?”
„Na und?”, gab ich zurück, wobei ich spüren konnte, wie mein Gesicht sich verzog und ich eine sture Miene aufzusetzen begann. Auch meine Brauen zogen sich zusammen, und mein Gesicht insgesamt wurde immer wütender. Ich bemühte mich wirklich, den beiden Polizisten nicht beim Denken zuzuhören, tat mein Bestes, mich aus der ganzen Sache herauszuhalten, aber das war weiß Gott nicht einfach. Bud Dearborn war durchschnittlich, aber Alcees Gedanken leuchteten wie die Strahlen eines Leuchtturms, dessen Signale man einfach nicht übersehen kann. Im Moment strahlte er Ekel aus. Ekel und Angst.
Als ich Bill noch nicht kannte und noch nicht erfahren hatte, wie sehr dieser meine Behinderung – er nannte sie eine Gabe – zu schätzen wusste, hatte ich alles darangesetzt, mich und alle anderen glauben zu machen, ich könne nicht wirklich Gedanken „lesen“. Aber Bill war es gelungen, mich aus dem kleinen Gefängnis zu befreien, das ich mir selbst errichtet hatte, und durch ihn ermutigt hatte ich zu trainieren und zu experimentieren begonnen. Für ihn hatte ich gelernt, Dinge in Worte zu fassen, die ich seit Jahren spürte. Manche Menschen, wie jetzt gerade Alcee, sandten klare, deutliche Botschaften. Meist jedoch ließen sich die Gedanken anderer mal besser, mal schlechter lesen, wie bei Bud Dearborn. Das hing sehr davon ab, wie stark die jeweiligen Gefühle waren und wie klar die betreffenden Personen im Kopf waren; ja selbst das Wetter mochte, soweit ich das beurteilen konnte, eine gewisse Rolle spielen. Manche Leute waren einfach generell ziemlich wirr im Kopf, und es war fast unmöglich, mitzubekommen, was sie dachten. Bei solchen Menschen konnte ich unter Umständen Stimmungen ablesen, aber das war auch alles.
Bill gegenüber hatte ich auch eingestehen können, dass die Bilder klarer wurden, wenn ich die Menschen berührte, denen ich zuhören wollte. Das war, als hätte man endlich Kabelfernsehen bekommen, nachdem man vorher nur eine Zimmerantenne hatte. Weiter hatte ich festgestellt, dass ich durch die Gedanken anderer gleiten konnte wie ein Fisch durchs Wasser, wenn ich den Betreffenden vorher Bilder „geschickt“ hatte, bei denen sie sich hatten entspannen können.
Es gab nichts, was ich in diesem Augenblick weniger gern getan hätte, als durch die Gedanken Alcee Becks zu gleiten wie ein Fisch durchs Wasser. Aber es ließ sich nicht vermeiden, dass ich völlig unfreiwillig ein Bild von Alcees Reaktionen erhielt: Der Detective reagierte fast schon abergläubisch panisch auf die Mitteilung, in der Küche des Merlottes arbeite ein Vampir. Als ihm klar wurde, dass ich die Frau war, von der er schon so viel gehört hatte – die, die mit einem Vampir zusammen war –, ekelte er sich. Zudem war er der felsenfesten Überzeugung, Lafayette habe der schwarzen Gemeinde unserer Gegend geschadet und sei eine Schande für sie gewesen, weil er seine Homosexualität offen gelebt hatte. Außerdem ging Alcee davon aus, jemand müsse es wohl auf Andy Bellefleur abgesehen haben, denn warum hätte man dem Kollegen sonst die sterblichen Überreste eines schwulen schwarzen Mannes in sein Auto legen sollen? Alcee fragte sich, ob Lafayette AIDS gehabt haben mochte und ob dieser Virus nun irgendwie bis in die Sitze von Andys Auto gesickert war, um dort munter zu überleben. Wenn es sein Auto wäre, dachte Alcee, würde er es jedenfalls umgehend verkaufen.
Wenn ich Alcee berührt hätte, hätte ich auch noch seine Telefonnummer und die Körbchengröße seiner Ehefrau erfahren.
Bud sah mich mit einem merkwürdigen Ausdruck in den Augen prüfend an. „Hatten Sie etwas gesagt?”, fragte ich.
„Ja. Ich hatte gefragt, ob du Lafayette im Laufe des vergangenen Abends hier im Lokal gesehen hast. Kam er in die Kneipe, um etwas zu trinken?”
„Ich habe ihn nie als Gast hier gesehen.” Wenn ich es recht bedachte, hatte ich Lafayette auch nie trinken sehen. Zum ersten Mal wurde mir klar, dass wir hier zwar mittags ein gemischtes Publikum hatten, die Gäste, die abends und nachts bei uns tranken, jedoch fast ausschließlich Weiße waren.
„Wo hat Lafayette seine Freizeit verbracht?”
„Das kann ich Ihnen wirklich nicht sagen.” Wenn Lafayette Geschichten erzählte, dann pflegte er den Beteiligten immer falsche Namen zu geben, um Unschuldige zu schützen. Na ja: eigentlich ja, um Schuldige zu schützen. „Wann hast du ihn das letzte Mal gesehen?”
„Tot, draußen im Auto.”
Bud schüttelte den Kopf. „Lebend, Sookie!”
„Hmmm. Ich glaube … vor drei Tagen. Er war noch hier, als ich meinen Dienst antrat, und wir haben einander kurz begrüßt. Ach – und er erzählte mir von einer Party, bei der er gewesen war.” Ich versuchte, mich genau an Lafayettes Worte zu erinnern. „Er sagte, er sei in einem Haus gewesen, in dem allerhand sexuelle Fisimatenten stattfanden.”
Die beiden starrten mich mit offenen Mündern an.
„Die Formulierung stammt von ihm! Ich weiß nicht, inwieweit das wirklich stimmte!” Ich sah Lafayettes Gesicht förmlich vor mir, wie es ausgesehen hatte, als er mir die Geschichte erzählte, erinnerte mich an die gezierte Art, in der er immer wieder den Finger auf die Lippen gelegt hatte, um mir zu verstehen zu geben, dass er sich weder über Namen noch Orte genauer auslassen würde.
„Warst du nicht der Meinung, jemand sollte davon wissen?” Bud wirkte völlig fassungslos.
„Die Rede war von einer privaten Party. Warum hätte ich irgendjemandem davon erzählen sollen?”
Aber es ging nicht an, dass solche Partys in den Grenzen ihrer Gemeinde stattfanden, und so funkelten mich beide Männer zornig an. Bud sagte mit zusammengekniffenen Lippen: „Hat Lafayette auch etwas von Drogen erwähnt, die bei diesen Zusammenkünften konsumiert wurden?”
„Von Drogen war, soweit ich mich erinnern kann, nicht die Rede.”
„Fand die Party im Haus eines Weißen oder eines Schwarzen statt?”
„Eines Weißen”, sagte ich und wünschte, ich hätte Nichtwissen vorgetäuscht. Lafayette war von dem Haus fasziniert gewesen – was aber nicht daran gelegen hatte, dass es besonders groß oder besonders protzig gewesen wäre. Was hatte ihn eigentlich so beeindruckt? Wobei ich nicht hätten sagen können, ob das Wort „beeindruckt“ es überhaupt traf und was es für Lafayette bedeutete. Lafayette war in armen Verhältnissen aufgewachsen und sein Leben lang arm geblieben. Ich war mir aber sicher, dass er im Zusammenhang mit der Party vom Haus eines Weißen gesprochen hatte, denn ich erinnerte mich, dass er gesagt hatte: „Und dann die ganzen Bilder da an der Wand, jeder einzelne Typ so weiß wie eine Lilie, und allesamt grinsen sie wie die Alligatoren.” Diesen Kommentar ließ ich der Polizei gegenüber jedoch unerwähnt, und die beiden Beamten stellten mir keine weiteren Fragen.
Ich erklärte noch, wie es dazu gekommen war, dass sich Andy Bellefleurs Wagen überhaupt auf unserem Parkplatz befand, und durfte dann Sams Büro verlassen. Ich verzog mich hinter den Tresen. Was auf dem Parkplatz geschah, wollte ich gar nicht sehen, und Gäste, die ich hätte bedienen können, gab es noch keine, denn die Polizei hatte beide Zufahrten zu unserem Grundstück abgesperrt.
Sam war dabei, alle Flaschen hinter dem Tresen neu anzuordnen und sie bei der Gelegenheit auch gleich abzustauben. Holly und Danielle hatten sich an einem der Rauchertische im Lokal niedergelassen, damit Danielle eine rauchen konnte.
„Wie ist es gelaufen?”, wollte Sam wissen.
„Keine große Sache. Dass Anthony hier arbeitet, hat ihnen nicht gefallen, und was ich ihnen über die Party erzählt habe, mit der Lafayette neulich so angegeben hatte, mochten sie auch nicht gern hören. Hast du das eigentlich mitbekommen? Die Sache mit der Orgie?”
„Mir hat er auch so etwas erzählt. Das muss ein ziemlich wichtiger Abend für ihn gewesen sein. Wenn die Party wirklich stattgefunden hat.”
„Meinst du, Lafayette hat sich das einfach ausgedacht?”
„Ich glaube nicht, dass in Bon Temps allzu viele bisexuelle Swinger-Partys stattfinden, bei der noch dazu Vertreter beider Rassen willkommen sind”, erwiderte Sam.
„Aber das denkst du doch nur, weil dich noch nie jemand zu einer eingeladen hat”, gab ich etwas spitz zu bedenken, wobei ich mich allerdings auch fragte, ob ich wirklich über alles Bescheid wusste, was in unserer kleinen Stadt so vor sich ging. Eigentlich hätte doch gerade ich eher als irgendwer sonst hier Bon Temps wie meine Westentasche kennen müssen, denn immerhin war mir – entschied ich mich dafür, danach Ausschau zu halten – jede Information mehr oder weniger frei zugänglich. „Ich gehe doch recht in der Annahme, dass dich noch nie jemand zu so was eingeladen hat?”, hakte ich nach.
„Ja”, sagte Sam und warf mir von der Seite her ein halbes Lächeln zu, während er gleichzeitig eine Whiskyflasche saubermachte.
„Ich glaube, auch meine Einladungen sind alle auf dem Postweg verlorengegangen”, meinte ich versöhnlich.
„Meinst du, Lafayette könnte gestern Nacht noch einmal hergekommen sein, um uns mehr von dieser Party zu erzählen?”
Ich zuckte die Achseln. „Vielleicht hatte er sich auch nur mit irgendwem auf dem Parkplatz verabredet. Jeder weiß, wo das Merlottes ist. Hatte er eigentlich seinen Gehaltsscheck schon?” Es war Wochenende, und am Ende einer Woche pflegte uns Sam unseren Lohn auszuhändigen.
„Nein. Möglich, dass er deswegen hier war. Aber ich hätte ihm den Scheck ja ohnehin am nächsten Tag gegeben – an seinem nächsten Arbeitstag. Heute also.”
„Ich frage mich, wer Lafayette zu dieser Party eingeladen hat.”
„Gute Frage.”
„Meinst du, er war so blöd, irgendwen erpressen zu wollen?”
Sam wischte mit dem Tuch über das Furnier des Tresens. Der Tresen war blitzblank, aber es fiel Sam schwer, die Hände ruhig zu halten. Das hatte ich auch schon früher an ihm beobachtet. „Ich glaube nicht”, sagte er nach einigem Nachdenken. „Nein, die Leute hatten nur ganz bestimmt die falsche Person eingeladen. Du weißt, wie indiskret Lafayette war. Nicht nur hat er uns erzählt, dass er an solch einer Party teilgenommen hat – wobei ich wetten könnte, dass er das nicht hätte tun dürfen –, er hätte aus der ganzen Sache vielleicht auch mehr machen wollen, als anderen, nun, anderen Teilnehmern angenehm war.”
„So etwas wie Kontakt halten zu anderen, die auch auf der Party waren, meinst du? Ihnen in der Öffentlichkeit zuzwinkern und so?”
„So was in der Art.”
„Ich schätze, wenn man mit jemandem Sex hat oder jemandem beim Sex zusieht, dann fühlt man sich hinterher wohl irgendwie gleichberechtigt”, sagte ich nachdenklich, wobei ich mir meiner Sache nicht sicher war, denn ich hatte auf diesem Gebiet wenig Erfahrung. Aber Sam nickte.
„Lafayette wollte akzeptiert werden als das, was er war. Das wollte er mehr als alles andere”, sagte er. Dem konnte ich nur zustimmen.
Kapitel 2
Um halb fünf konnten wir wieder aufmachen. Zu dem Zeitpunkt waren wir alle schon so gelangweilt, dass es nicht mehr feierlich war. Ich schämte mich dafür – immerhin war ein Mensch gestorben, den wir gut gekannt hatten –, aber es ließ sich nicht leugnen, wir waren einfach ziemlich erpicht darauf, endlich wieder einmal jemand anderen zu Gesicht zu bekommen als unser kleines Team. Den Tag über hatten wir das Lager aufgeräumt, Sams Büro gründlich entrümpelt und einige Runden Karten gespielt, wobei Sam fünf Dollar und noch einen Haufen Kleingeld gewonnen hatte – all das, was man eben so tut, wenn man der eigentlichen Arbeit nicht nachgehen kann. Als Terry Bellefleur, Andys Vetter, durch die Hintertür trat, ein Mann, der oft bei uns als Tresenbedienung oder Koch aushalf, waren wir alle froh, ihn zu sehen.
Terry dürfte meiner Schätzung nach Ende fünfzig sein. Er ist Vietnamveteran und hat anderthalb Jahre in Kriegsgefangenschaft verbracht. Terry hatte ein paar auffällige Narben im Gesicht, und meine Freundin Arlene wusste zu erzählen, dass die Narben an seinem Körper sogar noch drastischer seien. Terry war ein Rotschopf – allerdings sah es aus, als wollte er mit jedem Monat grauer werden.
Ich persönlich habe Terry immer gemocht. Er gab sich alle erdenkliche Mühe, nett zu mir zu sein – außer, er hatte gerade einen seiner dunklen Tage. Wenn Terry sich in einem seiner schwarzen Löcher befand, dann durfte man ihm nicht zu nahetreten, das wusste jeder. Terrys dunkle Tage folgten unausweichlich auf Nächte, in denen er von Alpträumen heimgesucht worden war, wovon all seine Nachbarn ein Lied singen konnten. In den Nächten, in denen mein Kollege schlecht träumte, waren seine Schreie in der ganzen Nachbarschaft zu hören.
In Terrys Gedanken las ich nie, wirklich nie.
An diesem Tag hatte es den Anschein, als ginge es Terry gut. Seine Schultern wirkten entspannt, und seine Blicke schossen nicht wild in der Gegend umher. „Wie geht es dir, meine Süße?”, erkundigte er sich teilnahmsvoll und klopfte mir besorgt auf die Schulter.
„Danke, es geht. Ich bin traurig wegen Lafayette.”
„Ja. Er war wirklich in Ordnung.” Das war aus Terrys Mund ein riesiges Kompliment. „Hat seine Arbeit gemacht, war immer pünktlich, hielt die Küche sauber. Hat nie schlecht über Leute geredet.” So zu funktionieren war Terrys ganz großer Ehrgeiz. „Dann geht er einfach hin und stirbt in Andys Buick!”
„Ich fürchte, Andys Auto ist ein wenig …” Verzweifelt durchforstete ich mein Hirn nach dem neutralsten Ausdruck für das, was ich sagen wollte.
„Er sagt, es lässt sich saubermachen.” Terry wollte das Thema so schnell wie möglich beenden.
„Hat er dir gesagt, was Lafayette zugestoßen ist?”
„Es sieht aus, als habe ihm irgendwer den Hals gebrochen, sagt Andy, und allem Anschein nach war er auch … na ja, an ihm war herumgemacht worden.” Terrys braune Augen flackerten, und er mochte mich nicht ansehen, was zeigte, dass er sich bei der Unterhaltung sehr unwohl fühlte. „Herumgemacht” – das bedeutete in Terrys Sprachgebrauch etwas Gewalttätiges, Sexuelles.
„Wie schrecklich!” Hinter mir waren Danielle und Holly aufgetaucht, und nun ließ sich auch Sam blicken, auf dem Weg zum Müllcontainer hinter dem Haus, in der Hand einen weiteren Sack voll Gerümpel, das er aus seinem Büro geräumt hatte.
„Er sah nicht allzu …”, fuhr ich stockend fort, „eigentlich sah der Wagen nicht sehr … nicht so …”
„Nicht aus, als hätten die Polster viele Flecken abbekommen?”
„Genau!”
„Andy denkt, er sei woanders umgebracht worden.”
„Igitt”, sagte Holly. „Lasst uns von etwas anderem reden. Mir wird ganz anders.”
Terry warf über meine Schulter hinweg einen Blick auf die Frauen. Er konnte weder Danielle noch Holly leiden und machte auch keine Anstalten, sein Verhältnis zu den beiden zu verbessern. Woran das lag, wusste ich nicht. Ich gab mir wirklich viel Mühe, den Menschen eine gewisse Privatsphäre zu lassen, besonders, seit ich mein Talent besser im Griff hatte. Nachdem Terry die beiden ein paar Sekunden lang unverwandt angeschaut hatte, hörte ich, wie sie sich wieder entfernten.
„Portia kam letzte Nacht und hat Andy abgeholt?”, fragte er.
„Ja, ich rief sie an. Er konnte nicht mehr fahren. Ich wette, er wünscht jetzt, ich hätte ihn fahren lassen.” Ich würde es nie schaffen, die Nummer eins auf Andys Beliebtheitsskala zu werden!
„Hatte sie Probleme, ihn ins Auto zu kriegen?”
„Bill half ihr.”
„Vampirbill? Dein Liebster?”
„Genau.”
„Ich hoffe, das hat sie nicht zu Tode erschreckt”, meinte Terry nachdenklich. Er schien sich nicht mehr daran zu erinnern, dass ich auch noch da war.
Sofort spürte ich, wie sich mein Gesicht verzog. „Es gibt keinen Grund, warum Bill Portia Bellefleur zu Tode erschrecken sollte”, sagte ich spitz, und die Art, wie ich das sagte, drang wohl durch den Nebel privater Reflexionen, in dem Terry gefangen war.
„Portia ist gar nicht so zäh, wie alle immer denken”, erklärte er. „Du dagegen, du bist von außen ein süßer kleiner Sahnehappen, aber innen drin bist du ein Bullterrier.”
„Jetzt weiß ich nicht, ob ich mich gebauchpinselt fühlen oder dir lieber eins auf die Nase geben soll!”
„Da siehst du! Wie viele Frauen – und Männer – wagen schon, so etwas einem Verrückten ins Gesicht zu sagen?” Terry lächelte – wie ein Gespenst wohl lächeln würde. Ich hatte bis zu diesem Augenblick nicht gewusst, wie sehr sich mein Kollege des Rufs bewusst war, in dem er stand.
Ich reckte mich auf die Zehenspitzen und drückte ihm zum Zeichen dafür, dass ich keine Angst vor ihm hatte, einen Kuss auf die zernarbte Wange. Aber kaum hatte ich mich wieder auf die Hacken zurückfallen lassen, da musste ich mir auch schon eingestehen, dass das eigentlich so gar nicht stimmte. Unter bestimmten Umständen würde ich mich vor diesem so tief verletzten Mann nicht nur enorm in Acht nehmen, ich würde mich vielleicht sogar sehr vor ihm fürchten.
Terry band sich die weiße Kochschürze um und machte sich daran, die Küche zu eröffnen. Wir anderen gingen an die Arbeit. Ich würde allerdings nicht lange an den Tischen bedienen können, denn gegen sechs wollte ich die Arbeit beenden, um mit Bill nach Shreveport zu fahren. Ein wenig unangenehm war es mir schon, dass Sam mich für all die Stunden würde bezahlen müssen, die ich mehr oder weniger nur im Merlottes herumgehangen und darauf gewartet hatte, endlich an die Arbeit gehen zu können. Aber wenigstens hatten wir es geschafft, Sams Büro zu entrümpeln und das Lager aufzuräumen und das zählte doch auch etwas.
Die Polizei hatte die Absperrung unseres Parkplatzes aufgehoben, und sofort setzte ein stetiger Kundenstrom ein, so stetig, wie man ihn in Bon Temps überhaupt erleben kann. Andy und Portia waren unter den Ersten, die kamen, und ich sah, wie Terry seine Cousine und seinen Vetter durch die Durchreiche zur Küche hindurch beobachtete. Die beiden winkten ihm zu, und er hob seinen Kochlöffel, um ihren Gruß zu erwidern. Wie war eigentlich der genaue Verwandtschaftsgrad der drei? Ein Vetter ersten Grades war Terry für Portia und Andy gewiss nicht, das wusste ich genau. Bei uns ist es aber durchaus üblich, jemanden Vetter oder Onkel oder Tante zu nennen, auch wenn Blutsbande nur sehr dünn oder manchmal auch überhaupt nicht vorhanden sind. Als meine Eltern durch eine plötzliche Flutwelle, die ihren Wagen von einer Brücke fegte, ums Leben kamen, hatte die beste Freundin meiner Mutter alle Anstrengungen unternommen, mich jede oder wenigstens jede zweite Woche im Haus meiner Großmutter zu besuchen und mir ein kleines Geschenk zu bringen. Für mich ist diese Frau mein Leben lang Tante Patty gewesen.
Ich beantwortete die Fragen der Kunden, die auf mich einstürzten, so weit ich Zeit hatte. Außerdem servierte ich Salat und Hamburger und Putengeschnetzeltes und Hühnerbrüstchen, bis mir ganz schwindelig war. Als ich irgendwann einmal auf die Uhr sah, war es auch schon Zeit für mich zu gehen. Ich begab mich in den Waschraum der Damen, um mich ein wenig frisch zu machen, und fand dort die Kollegin vor, die für mich arbeiten sollte, meine Freundin Arlene. Arlenes flammend rotes Haar (in diesem Monat noch zwei Farbstufen röter als sonst) war kunstvoll auf ihrem Kopf aufgetürmt, und ihre engsitzenden Hosen teilten aller Welt mit, dass sie sieben Pfund abgenommen hatte. Arlene war bereits viermal verheiratet gewesen und befand sich auf der Suche nach Ehemann Nummer fünf.
Wir unterhielten uns kurz über den Mord, und ich brachte sie auf den aktuellsten Stand, was die Situation an meinen Tischen betraf. Dann holte ich meine Handtasche aus Sams Büro und verschwand durch die Hintertür. Es war noch nicht dunkel, als ich vor meinem Haus vorfuhr. Ich wohne ungefähr vierhundert Meter vom Merlottes entfernt in einem kleinen Wäldchen, durch das eine wenig befahrene Landstraße führt. Mein Haus ist alt, einzelne Teile datieren aus einer Zeit, die über hundertvierzig Jahre zurückliegt. Es ist aber so oft umgebaut und verändert worden, dass es nicht wirklich als Haus aus der Zeit vor dem Bürgerkrieg zählen kann. Es ist ohnehin nur ein einfaches Bauernhaus. Meine Oma, Adele Hale Stackhouse, hatte es mir hinterlassen, und ich liebte es sehr. Bill sprach oft davon, dass ich lieber in sein Haus ziehen sollte, das auf der anderen Seite des alten Friedhofs auf einem kleinen Hügel stand, aber es widerstrebte mir, mein eigenes Reich zu verlassen.
Rasch zog ich meine Kellnerinnentracht aus und stellte mich vor den geöffneten Kleiderschrank. Wenn wir in Vampirangelegenheiten nach Shreveport fuhren, wollte Bill in der Regel, dass ich mich hübsch machte. Warum, das hatte ich noch nicht herausgefunden. Er wollte ja beileibe nicht, dass mir irgendwer anderes den Hof machte; gingen wir aber ins Fangtasia, dann sollte ich besonders hübsch aussehen. Das Fangtasia war eine Bar in Shreveport, die sich im Besitz von Vampiren befand und im Wesentlichen von Touristen besucht wurde.
Männer!
Ich sah mich unfähig zu entscheiden, was ich anziehen sollte, also sprang ich stattdessen erst einmal unter die Dusche. Mir war nicht wohl zumute, wenn ich ans Fangtasia dachte, irgendetwas in mir zog sich dann immer zusammen. Die Vampire, denen die Bar gehörte, waren ein wichtiger Bestandteil der internen Machtstruktur der Vampirkreise. Ich war für sie so etwas wie ein begehrenswerter Neuerwerb, seit sie mein einzigartiges Talent entdeckt hatten. Nur die Tatsache, dass sich Bill beherzt Zugang zu den Selbstverwaltungsstrukturen der Vampirwelt verschafft hatte und nun dort eine Funktion bekleidete, sorgte für meine Sicherheit. Das bedeutete, ich durfte wohnen, wo ich wollte und weiterhin meinem erwählten Beruf nachgehen. Im Austausch für diese Zugeständnisse hatte ich aufzutauchen, wenn ich gerufen wurde, und musste meine telepathischen Fähigkeiten in den Dienst der Vampire Shreveports stellen. Vampire, die bürgerlich leben und Teil der amerikanischen Gesellschaft sein wollten, konnten ihre Belange nicht mehr wie früher durch Folter und Terror durchsetzen; sie mussten sich gemäßigtere Methoden einfallen lassen.
Ich stand unter der Dusche, das heiße Wasser prasselte mir auf den Rücken, und ich spürte, wie ich mich mehr und mehr entspannte und mich wohler zu fühlen begann.
„Soll ich mich zu dir gesellen?”
„Scheiße!” Mein Herz klopfte so rasch und heftig, dass ich mich gegen die Wand der Duschkabine lehnen musste, um nicht umzukippen.
„Entschuldige! Hast du denn die Badezimmertür nicht aufgehen hören?”
„Nein, verdammt. Warum rufst du nicht einfach ‚Schatz, hier bin ich’ oder so was, ehe du auftauchst?”
„Entschuldigung!”, wiederholte Bill, aber es klang nicht sehr ernst gemeint. „Brauchst du jemanden, der dir den Rücken schrubbt?”
„Nein danke!”, zischte ich. „Ich bin nicht in der Stimmung, mir den Rücken schrubben zu lassen.”
Bill grinste, wobei ich sehen konnte, dass seine Fangzähne nicht ausgefahren waren. Gehorsam zog er den Duschvorhang zu.
Wenig später trat ich aus dem Bad, ein großes Handtuch mehr oder weniger züchtig um meinen Körper geschlungen. Bill lag auf meinem Bett, die Schuhe fein säuberlich auf dem kleinen Teppich vor meinem Nachtschränkchen nebeneinander postiert. Er trug ein langärmliges dunkelblaues Hemd, Jeans und Socken, die farblich auf das Hemd abgestimmt waren. Seine flachen Halbschuhe waren blank geputzt. Er trug das dunkelbraune Haar nach hinten gekämmt, und seine langen Koteletten sahen eindeutig nach Nostalgielook aus.
Nun zeugten sie ja auch von der Mode einer vergangenen Zeit – nur dass den meisten Menschen wohl nicht klar war, wie weit die Zeit zurücklag, in der Bills Koteletten Mode gewesen waren.
Bill hat wunderschön geschwungene Brauen und eine kühn gebogene Nase. Sein Mund ist von der Art, wie man sie von griechischen Statuen kennt — zumindest von denen, die ich schon einmal auf Bildern bewundern konnte. Bill war ein paar Jahre nach dem Bürgerkrieg gestorben (nach dem Aggressionskrieg der Nordstaaten, wie Oma zu sagen pflegte).
„Was steht heute Abend auf dem Programm?”, fragte ich. „Sind wir geschäftlich unterwegs oder zum Vergnügen?”
„Es ist immer ein Vergnügen, mit dir zusammen zu sein”, erwiderte Bill.
„Warum fahren wir nach Shreveport?”, beharrte ich, denn ich kann eine ausweichende Antwort durchaus als solche erkennen.
„Wir sind hinzitiert worden”, musste er zugeben.
„Von wem?”, wollte ich wissen.
„Eric natürlich.”
Seit sich Bill um das Amt des Ermittlers für den 5. Bezirk beworben und die Wahl gewonnen hatte, unterstand er Eric, wurde aber auch von Eric beschützt. Wie Bill mir erklärt hatte, hieß das, dass jeder, der Bill angriff, es auch mit Eric zu tun bekam, und dass Bills Besitztümer Eric heilig waren. Zu diesen Besitztümern gehörte auch ich. Das stimmte mich nicht besonders froh, war aber deutlich besser als ein paar andere Alternativen.
Ich stand vor dem Spiegel und verzog missmutig das Gesicht.
„Du hast eine Abmachung mit Eric.”
„Das stimmt”, musste ich eingestehen. „Ich habe eine Abmachung mit Eric.”
„An die musst du dich auch halten.”
„Genau das habe ich auch vor.”
„Zieh die enge Jeans an, die, die an der Seite geschnürt wird”, schlug Bill vor.
Die Hose war keine echte Jeans, denn sie war nicht aus festem Leinen, sondern aus einem Stretchstoff. Sie saß mir ziemlich weit unten auf der Hüfte, und Bill sah mich sehr gern darin. Mehr als einmal hatte ich mich gefragt, ob Bill sich wohl in Britney-Spears-Phantasien erging, was meine Person betraf. Aber ich wusste, wie gut mich die Hose kleidete, also zog ich sie an. Dazu eine blauweiß karierte Bluse, die vorn geknöpft wurde und ungefähr vier Zentimeter unter meinem BH endete. Um ein wenig Unabhängigkeit zu demonstrieren (Bill sollte nicht vergessen, dass ich eine eigenständige Frau bin), trug ich das Haar nicht offen, wie er es gern hatte, sondern fasste es hoch oben am Kopf zu einem Pferdeschwanz zusammen. Ich schlang eine blaue Schleife um das Gummiband, das den Pferdeschwanz zusammenhielt, und legte dann rasch ein wenig Make-up auf. Ein- oder zweimal warf Bill einen verstohlenen Blick auf seine Armbanduhr, aber ich nahm mir die Zeit, die ich brauchte. Wenn es ihm so wichtig war, dass ich einen guten Eindruck auf seine Vampirfreunde machte, dann musste er eben auf mich warten.
Kaum saßen wir im Auto auf dem Weg nach Shreveport, da verkündete Bill: „Ich konnte heute eine Geschäftsidee realisieren.”
Ehrlich gesagt fragte ich mich schon die ganze Zeit, woher Bills Geld wohl stammte. Er wirkte nicht reich, arm aber auch nicht, und arbeitete nie, es sei denn, er tat es in den Nächten, die wir nicht zusammen verbrachten.
Ich wusste wohl, dass jeder Vampir, der sein Geld wert war, problemlos reich werden konnte, eine Tatsache, die mich ziemlich verunsicherte. Wer in der Lage ist, die Köpfe von Menschen in gewissem Maße zu kontrollieren, dem fällt es nicht schwer, jemanden davon zu überzeugen, sich von seinem Geld zu trennen. Oder er bringt andere dazu, ihm Börsengeheimnisse anzuvertrauen und Aktientipps zu geben. Ehe ihnen offiziell das Recht zu existieren zugestanden worden war, hatten Vampire auch keine Steuern zahlen müssen. Selbst die US-Regierung hatte eingestehen müssen, dass man Tote nicht besteuern kann. Gab man ihnen Rechte, wie zum Beispiel das Wahlrecht – so hatte der Kongress irgendwann einmal logisch geschlussfolgert –, dann konnte man sie auch dazu verpflichten, Steuern zu zahlen.
Als den Japanern die Entwicklung synthetischen Bluts gelungen war, was den Vampiren die Möglichkeit gab, zu „leben“, ohne menschliches Blut zu sich nehmen zu müssen, da hatten die Vampire aus ihren Särgen kriechen dürfen. „Wir müssen keine Menschen zu Opfern machen”, konnten sie nun sagen. „Wir sind keine Bedrohung.”
Doch ich wusste, dass es für Bill den Höhepunkt der Ekstase bedeutete, von mir trinken zu dürfen. In der Hauptsache nährte er sich von Lebenssaft (ein beliebtes Markenprodukt im Bereich synthetisches Blut), aber es war ihm weitaus lieber, an meinem Hals zu nippen. Er hatte keine Probleme damit, in einer dicht besetzten Bar vor allen Leuten eine Flasche A positiv zu leeren. Wollte er sich jedoch einen Mund voll Sookie einverleiben, dann war es weiß Gott angebracht, das in der Privatatmosphäre unserer eigenen Häuser zu tun, denn die Wirkung war eine ganz andere. Ein Weinglas Lebenssaft barg keinerlei erotische Reize für Bill.
„Was hast du denn da in die Wege geleitet?”, wollte ich wissen.
„Ich habe das kleine Einkaufszentrum bei der Autobahn gekauft. Das, in dem sich auch das LaLaurie befindet.”
„Wem hast du es abgekauft?”
„Das Land gehörte den Bellefleurs. Sie hatten Sid Matt Lancaster beauftragt, sich um Bebauung und Vermietung zu kümmern.”
Sid Matt war einmal für meinen Bruder anwaltlich tätig gewesen. Er arbeitete schon seit Urzeiten in unserer Gegend, und sein Name hatte weitaus mehr Gewicht bei uns als der Portias.
„Schön für die Bellefleurs. Sie versuchen seit Jahren, den Komplex zu verkaufen. Sie brauchen dringend Bargeld. Hast du das Land und das Einkaufszentrum erworben? Wie groß ist das Grundstück?”
„Nur ein knapper Hektar”, erklärte Bill, „aber die Lage ist hervorragend.” Er klang wie ein Geschäftsmann. So hatte ich ihn noch nie reden hören.
„Das ist doch das Einkaufszentrum, in dem sich außer dem LaLaurie auch noch ein Friseur und Taras Togs befinden, nicht?” Außer dem Country Club war das LaLaurie das einzige Restaurant für gehobene Ansprüche in Bon Temps. Hierhin führte man seine Ehefrau aus, wenn es die Silberhochzeit zu feiern galt; hierhin ging man mit seinem Chef, wenn man befördert werden wollte, und ins LaLaurie führten junge Männer ihre Damen, wenn sie einmal wirklichen Eindruck schinden wollten. Aber ich hatte gehört, es liefe nicht gut.
Ich hatte nicht die geringste Ahnung, wie man ein Geschäft führt oder wie man Geschäfte macht. Ich war mein Leben lang nie wirklich arm, aber immer nur ein oder zwei Schritte von der Armut entfernt. Meine Eltern hatten das Glück gehabt, auf ihrem Land auf eine kleine Ölquelle zu stoßen, und hatten das Geld, das ihnen diese Quelle eingebracht hatte, gut angelegt, ehe diese ihr Sprudeln wieder einstellte – was ziemlich rasch geschah. Ohne diesen Extragroschen hätten Jason, Oma und ich immer von der Hand in den Mund leben müssen. Auch so waren wir in den Jahren, in denen Oma uns großzog, ein- oder zweimal kurz vor dem Punkt gewesen, an dem wir Haus und Grundstück meiner Eltern hätten verkaufen müssen, um das Haus meiner Oma halten und Steuern zahlen zu können.
„Wie funktioniert das dann?”, wollte ich wissen. „Dir gehören die Gebäude, in denen sich die drei Betriebe befinden, und die zahlen Miete an dich?”
Er nickte. „Wenn du also irgendwas mit deinen Haaren anstellen willst, dann gehst du in Zukunft ins Clip and Curl.”
Ich war in meinem ganzen Leben nur ein einziges Mal beim Friseur gewesen. Wenn meine Haarspitzen fransig wurden und sich spalteten, ging ich hinüber zum Wohnwagen meiner Freundin Arlene, und sie schnitt sie mir wieder zurecht. „Meinst du denn, ich muss zum Friseur?”, fragte ich verunsichert.
„Nein. Dein Haar ist wunderschön.” Bill sagte das im Brustton der Überzeugung, und ich nahm es ihm ab. „Aber solltest du mal hingehen wollen – im Clip and Curl machen sie auch Maniküre und verkaufen Haarpflegeprodukte.” Das Wort Haarpflegeprodukte sprach er aus, als stamme es aus einer Fremdsprache. Mühsam unterdrückte ich ein Lächeln.
„Außerdem”, fuhr er fort, „kannst du jetzt jederzeit jemanden ins LaLaurie ausführen, ohne zahlen zu müssen.”
Ich drehte mich so, dass ich Bill entgeistert anstarren konnte.
„Tara weiß auch, dass sie jedes Kleidungsstück auf meine Rechnung setzen soll, das du bei ihr kaufst.”
Ich spürte meinen Geduldsfaden: Er wurde überdehnt, dann riss er. Leider bekam der arme Bill das gar nicht mit. „Mit anderen Worten”, sagte ich langsam, stolz darauf, wie unbeteiligt meine Stimme klang, „alle wissen, dass sie sich gut um die Mätresse des neuen Besitzers zu kümmern haben.”
Da schien Bill zu verstehen, dass er einen Fehler gemacht hatte. „Sookie …”, hob er an, aber das wollte ich mir gar nicht erst gefallen lassen. Mein Stolz hatte sich aufgebäumt und mir voll ins Gesicht geschlagen. Ich verliere nicht oft die Geduld, aber wenn meine Nerven mit mir durchgehen, dann mache ich keine halben Sachen.
„Warum kannst du mir nicht irgendwelche verdammten Blumen schicken, wie die Freunde anderer Frauen das tun? Oder mal eine Schachtel Pralinen? Ich mag Pralinen! Schick mir doch einfach mal eine Grußkarte, das wäre doch mal was! Oder ein Kätzchen oder ein schönes Halstuch!”
„Ich wollte dir doch etwas schenken”, sagte Bill vorsichtig.
„Du hast es so weit gebracht, dass ich mir vorkomme wie eine ausgehaltene Frau, und du hast auf jeden Fall dafür gesorgt, dass die Leute, die in diesen Geschäften arbeiten, denken, du würdest mich aushalten!”
So weit ich das im schwachen Licht der Armaturenbeleuchtung feststellen konnte, arbeitete Bill hart daran zu verstehen, warum das, was ich von ihm wollte, denn so anders sein sollte als das, was er mir angeboten hatte. Wir waren gerade an der Autobahnausfahrt zum Mimosa Lake vorbei; auf der Seite der Straße, auf der sich der See befand, sah ich im Licht der Scheinwerfer von Bills Wagen die Bäume, die als dichter Wald den See umstanden.
Zu meiner großen Verwunderung beschloss das Auto, an genau dieser Stelle einmal kurz zu husten und dann stehen zu bleiben. Ich nahm das als Zeichen.
Hätte Bill geahnt, was ich vorhatte, dann hätte er wohl die Türen verriegelt; so konnte er nur erschrocken zusehen, wie ich aus dem Auto kletterte und zum Wald hinüberstolzierte, dessen Bäume gleich neben der Straße in den Himmel ragten.
„Sookie, komm sofort zurück!” Endlich war auch Bill wütend. Das hatte ja lange genug gedauert.
Ich zeigte ihm einen Vogel und trat in den Wald hinein.
Ich wusste genau, dass ich Bill nicht würde daran hindern können, mich zurück in den Wagen zu befördern, wenn er das wirklich wollte. Mein Freund ist wohl zwanzigmal stärker und schneller als ich. Nachdem ich ein paar Sekunden durch die Finsternis gestapft war, wünschte ich fast, er würde mich holen kommen. Aber dann bäumte sich mein Stolz erneut auf; ich wusste einfach, dass das, was ich getan hatte, vollkommen richtig gewesen war. Bill war sich offenbar über die Art unserer Beziehung immer noch nicht im Klaren, und ich wollte ein für alle Mal Klarheit schaffen. Sollte er seinen Arsch ruhig nach Shreveport bewegen, um seinem Vorgesetzten Eric meine Abwesenheit zu erläutern. Dann würde er endlich mal kapieren, welche Auswirkungen sein Verhalten nach sich ziehen konnte.
„Sookie?”, rief Bill nun von der Straße her. „Ich gehe zur nächsten Tankstelle und hole einen Mechaniker!”
„Na dann viel Glück!”, murmelte ich leise und vergnügt. Eine rund um die Uhr geöffnete Tankstelle mit festangestelltem Mechaniker? Da hatte Bill wohl die 50er Jahre oder irgendeine andere historische Epoche im Sinn!
„Du führst dich auf wie ein Kind”, rief Bill. „Ich könnte dich holen kommen, aber damit verschwende ich nicht meine Zeit. Wenn du dich beruhigt hast, komm bitte zurück zum Auto, setz dich rein und verriegele die Türen von innen. Ich gehe jetzt.” Auch Bill hatte seinen Stolz.
Mit gemischten Gefühlen, einerseits erleichtert, andererseits aber auch besorgt, hörte ich bald darauf, wie Bill mit Vampirgeschwindigkeit die Straße entlangrannte. Er war wirklich gegangen.
Wahrscheinlich dachte er, er würde mir eine Lehre erteilen – wo doch genau umgekehrt ein Schuh daraus wurde! Ich war es, die ihm eine Lehre erteilte – das wiederholte ich mir im Kopf wieder und wieder, und gleich würde er ja auch zurück sein, da war ich mir ganz sicher. Ich musste lediglich darauf achten, dass ich nicht zu tief in den Wald ging und am Ende noch in den See fiel.
Es war wirklich sehr finster hier zwischen den Kiefern. Der Mond war noch nicht ganz voll, aber wir hatten eine sternenklare Nacht; alle freien Flächen leuchteten kühl und matt, und im Gegensatz dazu warfen die Bäume pechschwarze Schatten.
Zuerst suchte ich den Weg zurück zur Straße, dann holte ich tief Luft und marschierte fest entschlossen Richtung Bon Temps, genau die entgegengesetzte Richtung zu der, die Bill eingeschlagen hatte. Ich fragte mich, wie viele Kilometer wir wohl zurückgelegt haben mochten, ehe Bill mit der Unterhaltung anfing, die mich dann so wütend gemacht hatte. Ich versuchte, mich zu beruhigen, indem ich mir versicherte, allzu viele könnten es nicht gewesen sein. Dann beglückwünschte ich mich zu der Entscheidung, Turnschuhe statt hochhackige Sandalen angezogen zu haben. Leider hatte ich keinen Pulli dabei; langsam, aber sicher überzog eine Gänsehaut die bloße Haut zwischen meinem kurzen Oberteil und der tiefsitzenden Hose. Ich verfiel in einen gemäßigten Trab, immer den Parkstreifen neben der Straße entlang. Straßenbeleuchtung gab es keine – so wäre es mir wohl ziemlich übel ergangen, hätte der Mond nicht geschienen.