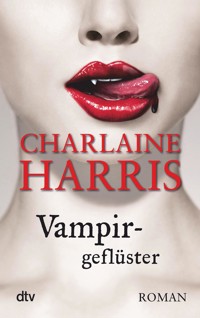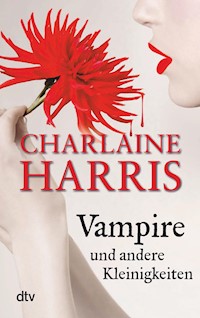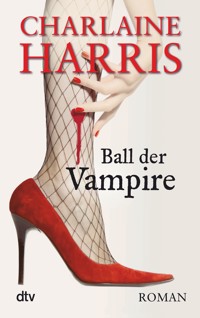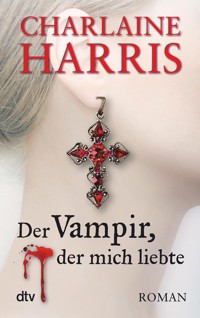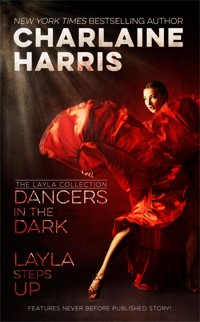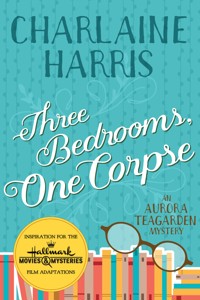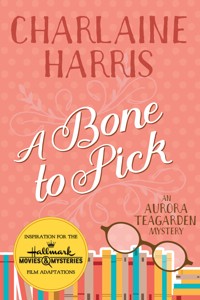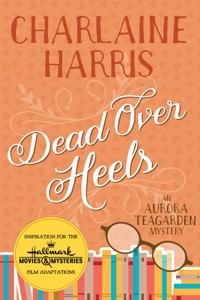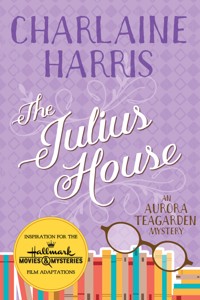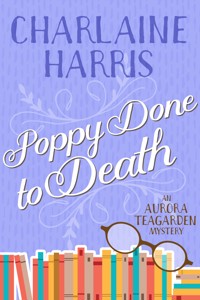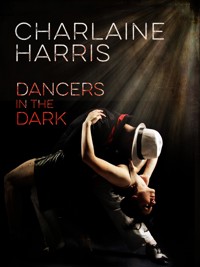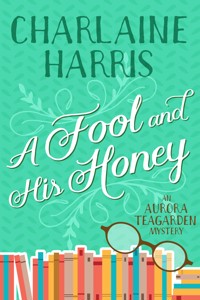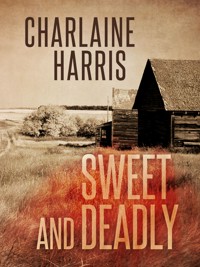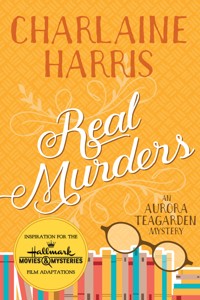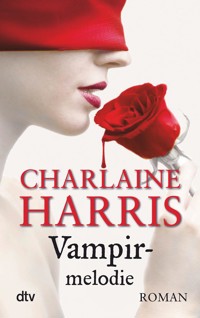
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Sookie Stackhouse
- Sprache: Deutsch
Der krönende Abschluss der Kult-Vampirserie! Sookie Stackhouse, die gedankenlesende Kellnerin, hat das unangenehme Gefühl, dass sie es sich mit Eric, ihrem Vampirfreund, nachhaltig verscherzt hat; und womöglich bei der gesamten Vampirgemeinde in Ungnade gefallen ist. Dann wird die kleine Stadt Bon Temps von einem schockierenden Mord erschüttert – und Sookie wird unter Mordverdacht festgenommen. Nachdem sie gegen Kaution freigelassen wurde, macht sie sich auf die Suche nach dem wahren Mörder. Dabei muss sie schmerzhaft erfahren, wie undeutlich die Grenzen zwischen Wahrheit und Lügen, zwischen Gerechtigkeit und Blutvergießen in Bon Temps sind. Aber auch die Liebe hat noch ein Wörtchen mitzureden …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 507
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Sookie Stackhouse, die gedankenlesende Kellnerin, hat das unangenehme Gefühl, dass sie es sich mit Eric, ihrem Vampirfreund, nachhaltig verscherzt hat; und womöglich bei der gesamten Vampirgemeinde in Ungnade gefallen ist. Dann wird die kleine Stadt Bon Temps von einem schockierenden Mord erschüttert – und Sookie wird unter Mordverdacht festgenommen. Nachdem sie gegen Kaution freigelassen wurde, macht sie sich auf die Suche nach dem wahren Mörder. Dabei muss sie schmerzhaft erfahren, wie undeutlich die Grenzen zwischen Wahrheit und Lügen, zwischen Gerechtigkeit und Blutvergießen in Bon Temps sind. Aber auch die Liebe hat noch ein Wörtchen mitzureden …
Von Charlaine Harris sind bei dtv außerdem erschienen:
Vorübergehend tot
Untot in Dallas
Club Dead
Der Vampir, der mich liebte
Vampire bevorzugt
Ball der Vampire
Vampire schlafen fest
Ein Vampir für alle Fälle
Vampirgeflüster
Vor Vampiren wird gewarnt
Vampir mit Vergangenheit
Cocktail für einen Vampir
Die Welt der Sookie Stackhouse
Vampire und andere Kleinigkeiten
Charlaine Harris
Vampirmelodie
Sookie Stackhouse Band 13
Roman
Deutsch von Britta Mümmler
Dieses Buch ist all den treuen Lesern gewidmet, die diese Buchserie von Anfang bis Ende verfolgt haben. Viele haben die Romane schon vor ›True Blood‹ gelesen, andere kamen erst später dazu, doch alle zeigten stets ein unglaubliches Engagement, wenn es um Ideen, Spekulationen und Meinungen zu Sookies Zukunft ging. Es ist mir leider nicht möglich, all meine Leser mit dem Ende der Buchserie zufriedenzustellen, deshalb bin ich meinem eigenen Plan gefolgt – jenem, den ich schon von Anfang an hatte – und hoffe, dass alle ihn passend finden.
Prolog
Januar
Der Geschäftsmann aus New Orleans, dessen graues Haar ihn als einen Mann Mitte fünfzig auswies, war in Begleitung seines viel jüngeren und größeren Bodyguards und Chauffeurs an dem Abend, als er im French Quarter den Teufel traf. Es war ein im Voraus vereinbartes Treffen.
»Es ist wirklich der Teufel, mit dem wir uns treffen?«, fragte der Bodyguard. Er war angespannt – was allerdings auch kein Wunder war.
»Nicht der Teufel, sondern ein Teufel.« Der Geschäftsmann war nach außen hin kühl und gefasst, auch wenn es in seinem Inneren vielleicht ganz anders aussah. »Seitdem er mich auf dem Bankett der Handelskammer angesprochen hat, habe ich eine ganze Menge Dinge erfahren, die ich nicht wusste.« Er hielt nach allen Seiten Ausschau nach dem Geschöpf, mit dem er verabredet war. »Und er hat mich davon überzeugt, dass er der ist, als der er sich ausgibt«, erzählte er seinem Bodyguard. »Ich dachte immer, meine Tochter spinnt einfach ein bisschen. Ich dachte, sie bildet sich ihre Kräfte nur ein, um auch irgendetwas … Eigenes zu haben. Inzwischen mus ich aber zugeben, dass sie wirklich gewisse Fähigkeiten hat, wenn auch nicht annähernd so große, wie sie meint.«
Es war kalt und feucht an diesem Januarabend, sogar in New Orleans. Der Geschäftsmann trat von einem Fuß auf den anderen, um sich warm zu halten. »Es ist offenbar Tradition, sich an einer Kreuzung zu treffen«, erklärte er seinem Bodyguard. Auf den Straßen war nicht so viel los wie im Sommer, doch es gingen immer noch genug Touristen und Einheimische ihren feucht-fröhlichen Abendvergnügungen nach. Er hatte keine Angst, sagte der Geschäftsmann sich selbst. »Ah, da kommt er ja.«
Der Teufel war ein gut gekleideter Mann, ganz wie der Geschäftsmann. Seine Krawatte war von Hermès. Sein Anzug aus Italien. Und er trug maßgefertigte Schuhe. Seine Augen waren ungewöhnlich klar, das Weiß funkelte, und die Iris war purpurbraun, aus einem gewissen Blickwinkel wirkte sie fast rot.
»Was haben Sie für mich?«, fragte der Teufel in einem Tonfall, der erkennen ließ, dass er nur mäßig interessiert war.
»Zwei Seelen«, erwiderte der Geschäftsmann. »Tyrese will sich mir anschließen.«
Der Blick des Teufels wanderte zum Bodyguard. Nach einem kurzen Augenblick nickte dieser. Er war ein massiger Mann, ein hellhäutiger Afroamerikaner mit hellbraunen Augen.
»Aus freiem Willen?«, fragte der Teufel völlig sachlich. »Alle beide?«
»Aus freiem Willen«, sagte der Geschäftsmann.
»Aus freiem Willen«, bestätigte der Bodyguard.
»Dann lassen Sie uns zum Geschäft kommen«, erwiderte der Teufel.
»Geschäft« war ein Wort, bei dem der ältere Mann sich gleich wohler fühlte. Er lächelte. »Wunderbar. Ich habe die Dokumente dabei, und sie sind schon unterschrieben.« Tyrese öffnete eine schmale Ledermappe und holte zwei Bogen Papier hervor: kein Pergament oder Menschenhaut, nichts derart Theatralisches oder Exotisches – einfaches Computerpapier, das die Sekretärin des Geschäftsmannes bei OfficeMax gekauft hatte. Tyrese hielt dem Teufel die Dokumente hin.
Der warf nur einen kurzen Blick darauf. »Sie müssen noch mal unterschreiben«, sagte er dann. »Für diese Unterschrift reicht Tinte nicht aus.«
»Das hatte ich für einen Scherz von Ihnen gehalten.« Der Geschäftsmann runzelte die Stirn.
»Ich mache niemals Scherze«, erwiderte der Teufel. »Oh, glauben Sie mir, ich habe Sinn für Humor, wirklich. Aber nicht, wenn es um Verträge geht.«
»Müssen wir tatsächlich …?«
»Mit Blut unterschreiben? Ja, unbedingt. So verlangt es die Tradition. Und Sie werden es jetzt tun.« Er deutete den ausweichenden Blick des Geschäftsmannes richtig. »Niemand wird sehen, was Sie tun, das verspreche ich Ihnen«, sagte er. Der Teufel hatte seine Worte kaum beendet, da waren die drei Männer auch schon von Stille umhüllt, und ein dichter Dunstschleier senkte sich zwischen ihnen und dem Geschehen auf der Straße herab.
Der Geschäftsmann seufzte vernehmlich, um deutlich zu machen, für wie melodramatisch er diese Tradition hielt. »Tyrese, Ihr Messer«, wandte er sich an den Bodyguard.
Tyreses Messer kam erschreckend plötzlich zum Vorschein, vermutlich aus dem Mantelärmel; die Schneide war unverkennbar scharf, und sie blitzte auf im Licht der Straßenbeleuchtung. Der Geschäftsmann streifte seinen Mantel ab und gab ihn Tyrese. Dann knöpfte er sich eine Manschette auf und rollte den Ärmel hoch. Vielleicht wollte er dem Teufel beweisen, was für ein hartgesottener Kerl er war, jedenfalls schnitt er sich selbst mit dem Messer in den linken Arm. Ein kleines Rinnsal von Blut belohnte seine Mühen, und er sah dem Teufel direkt ins Gesicht, als er die Schreibfeder ergriff, die dieser irgendwie herbeigeschafft hatte … und das sogar noch geschmeidiger als Tyrese sein Messer. Der Geschäftsmann tauchte die Feder ins Blut und setzte seinen Namen unter das obere Dokument, das der Bodyguard ihm mit der Ledermappe als Schreibunterlage hinhielt.
Als er fertig war, gab der Geschäftsmann dem Bodyguard das Messer zurück und zog sich seinen Mantel wieder an. Tyrese vollzog die gleiche Prozedur wie sein Boss. Als auch er seinen Vertrag unterschrieben hatte, blies er darüber, um das Blut zu trocknen, so als hätte er einen dicken Filzstift benutzt, der verschmieren könnte.
Der Teufel lächelte, als sie die Unterschriften geleistet hatten. Und in dem Augenblick, da er es tat, wirkte er so gar nicht mehr wie ein wohlhabender Geschäftsmann.
In seinem Gesicht stand eine geradezu höllische Freude.
»Sie erhalten einen Unterschriftenbonus«, sagte er zu dem Geschäftsmann, »da Sie mir noch eine weitere Seele gebracht haben. Übrigens, wie fühlen Sie sich?«
»Genauso wie immer«, erwiderte der Geschäftsmann und knöpfte seinen Mantel zu. »Etwas ungehalten, vielleicht.« Und plötzlich lächelte er, und seine aufblitzenden Zähne wirkten ebenso scharf wie das Messer vorhin. »Wie fühlen Sie sich, Tyrese?«, fragte er seinen Angestellten.
»Ein bisschen aufgewühlt«, gab Tyrese zu. »Aber alles okay so weit.«
»Nun, Sie waren beide von Anfang an schlechte Menschen«, sagte der Teufel ohne jede Wertung im Tonfall. »Die Seelen der Unschuldigen sind reiner. Aber ich freue mich, Sie zu haben. Sie halten sich vermutlich an die übliche Liste von Wünschen? Reichtum? Den Sieg über Ihre Feinde?«
»Ja, das alles will ich«, erwiderte der Geschäftsmann in leidenschaftlicher Aufrichtigkeit. »Und ich habe ja noch einen weiteren Wunsch frei, wegen des Unterschriftenbonus. Oder kann ich mir den bar auszahlen lassen?«
»Oh«, sagte der Teufel sanft lächelnd, »ich zahle nicht in bar, nur in Gefälligkeiten.«
»Kann ich in dieser Sache noch einmal auf Sie zukommen?«, fragte der Geschäftsmann nach kurzem Nachdenken. »Und mir erst einmal eine Gutschrift geben lassen?«
Der Teufel zeigte ein gewisses Interesse. »Sie wollen doch nicht etwa einen Alfa Romeo haben, oder eine Nacht mit Nicole Kidman, oder das größte Haus im French Quarter?«
Der Geschäftsmann schüttelte entschieden den Kopf. »Mir wird sicher noch etwas einfallen, das ich haben will, und dann hätte ich gern die Möglichkeit, es auch wirklich zu bekommen. Ich war ein erfolgreicher Mann bis zum Hurrikan Katrina. Und nach Katrina dachte ich, ich würde richtig reich werden, da ich unter anderem auch einen Holzhandel besitze. Alle brauchten Holz.« Er holte einmal tief Atem und fuhr fort, seine Geschichte zu erzählen, obwohl der Teufel recht gelangweilt wirkte. »Doch es war schwierig, die Geschäfte überhaupt wieder in Gang zu bringen. Sehr viele Leute konnten keinen einzigen Cent erübrigen, weil sie völlig ruiniert waren, und alle anderen mussten erst einmal auf die Zahlungen von der Versicherung warten. Ich habe ein paar Fehler gemacht und gehofft, die risikofreudigeren Bauherren würden mich schon rechtzeitig bezahlen … Aber es endete alles damit, dass ich mich vollkommen übernommen habe. Alle schulden mir Geld, und mein eigener Kreditrahmen ist mittlerweile so hauchdünn wie ein Kondom, das einem Elefanten übergezogen wurde. Das spricht sich langsam herum.« Er sah zu Boden. »Ich verliere den Einfluss, den ich in dieser Stadt einmal besaß.«
Möglich, dass der Teufel all diese Dinge schon gewusst und den Geschäftsmann aus genau diesem Grund angesprochen hatte. Aber an der Leidensgeschichte des Geschäftsmannes war er ganz eindeutig nicht interessiert. »Reichtum also«, fuhr er forsch dazwischen. »Und ich bin schon gespannt auf Ihren zusätzlichen Wunsch. Tyrese, was wollen Sie haben? Ihre Seele gehört mir auch.«
»Ich glaube nicht an Seelen«, sagte Tyrese ausdruckslos. »Und mein Boss auch nicht, denke ich. Es macht uns nichts aus, Ihnen das zu geben, von dem wir glauben, dass wir es sowieso nicht haben.« Er grinste den Teufel an, so von Mensch zu Mensch, was ein Fehler war. Der Teufel war kein Mensch.
Der Teufel erwiderte das Lächeln. Ein Anblick, bei dem Tyreses Grinsen schwand. »Was wollen Sie haben?«, wiederholte der Teufel. »Noch einmal werde ich nicht fragen.«
»Ich will Gypsy Kidd. Ihr richtiger Name lautet Katy Sherboni, falls Sie den brauchen. Sie arbeitet im Nachtclub Bourbon Street Babes. Ich will, dass sie mich genauso liebt wie ich sie.«
Der Geschäftsmann war enttäuscht von seinem Angestellten. »Tyrese, Sie sollten lieber um etwas Beständigeres bitten. Sex ist in New Orleans doch überall zu kriegen, und Mädchen wie Gypsy gibt es haufenweise.«
»Das stimmt nicht«, erwiderte Tyrese. »Ich glaube zwar nicht, dass ich eine Seele habe, aber ich weiß, dass es die wahre Liebe nur einmal gibt im Leben. Und ich liebe Gypsy. Wenn sie mich wiederliebt, bin ich ein glücklicher Mensch. Und wenn Sie Geld verdienen, Boss, verdiene auch ich Geld. Ich werde genug haben. Ich bin nicht habgierig.«
»Aber ich bin die Verkörperung der Habgier«, warf der Teufel beinahe liebenswürdig ein. »Zu guter Letzt werden Sie sich noch wünschen, dass Sie mich wenigstens um ein paar Staatsanleihen gebeten hätten, Tyrese.«
Der Bodyguard schüttelte den Kopf. »Ich bin zufrieden mit meinem Handel. Geben Sie mir Gypsy, der Rest wird sich schon finden. Das weiß ich.«
Der Teufel sah ihn mit einem Ausdruck an, der sehr dem des Mitleids glich, wenn dieses Gefühl einem Teufel denn überhaupt möglich war.
»Amüsieren Sie sich, hören Sie?«, sagte er zu den beiden neuen Seelenlosen. Sie konnten nicht recht einschätzen, ob er sich über sie lustig machte oder ob er es ernst meinte. »Tyrese, Sie werden mich bis zu unserem endgültigen Treffen nicht wiedersehen.« Dann sah er den Geschäftsmann an. »Und wir beide, Sir, werden uns irgendwann in der Zukunft noch einmal begegnen. Rufen Sie mich einfach an, wenn Sie sich für einen Unterschriftenbonus entschieden haben. Hier ist meine Visitenkarte.«
Der Geschäftsmann griff nach der schlichten weißen Karte. Es stand nur eine Telefonnummer darauf. Doch es war nicht die Nummer, die er angerufen hatte, um dieses Rendezvous hier zu verabreden. »Und was, wenn es noch Jahre dauert?«, fragte er.
»Das wird nicht der Fall sein«, erwiderte der Teufel, nun schon aus einiger Entfernung. Als der Geschäftsmann wieder aufblickte, war der Teufel bereits einen halben Block weit weg. Nach weiteren sieben Schritten schien er irgendwie mit dem schmutzigen Gehweg zu verschmelzen, und es blieb nichts von ihm als ein Schemen in der kalten feuchten Luft.
Der Geschäftsmann und sein Bodyguard drehten sich um und gingen eilig in die entgegengesetzte Richtung davon. Der Bodyguard sah den Teufel in dieser Gestalt nie wieder. Und der Geschäftsmann nicht bis zum Juni.
Juni
Weit entfernt – Tausende von Meilen – lag ein großer dünner Mann an einem Strand von Baja. Er hielt sich nicht an einem der Touristenorte auf, wo er vielen anderen Gringos begegnet wäre, die ihn vielleicht erkannt hätten. Dort verkehrte er regelmäßig in einer heruntergekommenen Bar, eigentlich eher einer Art Hütte. Gegen etwas Bargeld lieh der Besitzer seinen Gästen ein großes Handtuch und einen Sonnenschirm und schickte von Zeit zu Zeit seinen Sohn mit einem frischen Drink vorbei. Solange man denn weitertrank.
Obwohl der große Dünne nur Coca-Cola trank, musste er Unsummen dafür hinblättern – auch wenn er das gar nicht zu bemerken schien, oder vielleicht war es ihm auch egal. Er trug einen Hut, eine Sonnenbrille und Badehosen und hockte, zusammengekauert im Schatten des Sonnenschirms, auf seinem Handtuch. Dicht bei ihm stand ein uralter Rucksack, und seine Flipflops, die einen leichten Geruch von heißem Gummi verströmten, lagen gleich daneben im Sand. Der große Dünne hörte sich etwas auf dem iPod an, und sein Lächeln verriet, dass ihm gefiel, was er da hörte. Er hob den Hut und fuhr sich mit den Fingern durchs Haar. Es war goldblond, doch am bereits nachwachsenden Haaransatz war zu erkennen, dass diese Farbe nur sein natürliches Grau verdeckte. Seinem Körper nach zu urteilen war er Mitte vierzig. Sein Kopf war klein im Vergleich zu seinen breiten Schultern, und er wirkte nicht wie ein Mann, der es gewöhnt war, mit den Händen zu arbeiten. Er wirkte aber auch nicht reich; sein ganzes Ensemble, die Flipflops und die Badehose, der Hut und das beiseitegeworfene T-Shirt, war von Wal-Mart oder einem sogar noch billigeren Ein-Dollar-Laden.
Es lohnte sich nicht, wohlhabend zu wirken auf Baja, nicht bei der heutigen Lage der Dinge. Das war viel zu gefährlich, denn auch Gringos blieben von der Gewalt nicht verschont. Deshalb hielten die meisten Touristen sich auch in den bekannten Urlaubsorten auf, reisten per Flugzeug an und ab und fuhren nie quer durchs Land. Es gab noch einige weitere Exilanten hier in der Gegend, meistens Männer ohne Anhang, die etwas Verzweifeltes … oder Geheimnisvolles an sich hatten. Ihre Gründe, sich einen derart riskanten Ort zum Leben auszusuchen, blieben besser verborgen. Fragen zu stellen konnte sich als sehr ungesund erweisen.
Einer dieser Exilanten, der erst vor Kurzem eingetroffen war, ließ sich nun in der Nähe des großen Dünnen nieder, in allzu großer Nähe, als dass es reiner Zufall gewesen wäre an einem so wenig besuchten Strand. Der große Dünne sah sich den unwillkommenen Neuen aus dem Augenwinkel heraus an, seine dunkle Sonnenbrille hatte anscheinend optische Gläser. Der Neue war ein Mann Mitte dreißig, weder groß noch klein, weder gut aussehend noch hässlich, weder schmächtig noch muskulös. Körperlich war er Durchschnitt, in jeder Hinsicht. Dieser Durchschnittsmann beobachtete den großen Dünnen schon seit ein paar Tagen, und der große Dünne war sofort davon überzeugt gewesen, dass er sich ihm früher oder später nähern würde.
Der Durchschnittsmann hatte mit großer Umsicht den optimalen Zeitpunkt abgewartet. Die beiden saßen an einem Strandabschnitt, wo niemand sie hören oder sich ihnen unbemerkt nähern konnte, und trotz all der Satelliten in der Stratosphäre war es doch nicht möglich, dass irgendwer sie hätte sehen können, ohne selbst gesehen zu werden. Der große Dünne wurde größtenteils von seinem Sonnenschirm verdeckt, und er bemerkte, dass sein Besucher in dessen Schatten saß.
»Was hören Sie sich da an?«, fragte der Durchschnittsmann und zeigte auf die Ohrstöpsel, die der große Dünne in den Ohren hatte.
Er sprach mit leichtem Akzent; ein Deutscher vielleicht? Jedenfalls ein Mann aus irgendeinem dieser europäischen Länder, dachte der große Dünne, der nicht weitgereist war. Und außerdem hatte der Neue ein bemerkenswert unangenehmes Lächeln. Es wirkte okay, mit den hochgezogenen Mundwinkeln und den entblößten Zähnen, doch irgendwie sah es so aus, als würde ein Tier die Zähne fletschen, kurz bevor es zubeißt.
»Sind Sie schwul? Kein Interesse«, sagte der große Dünne. »Dafür werden Sie übrigens im Höllenfeuer schmoren.«
»Ich stehe auf Frauen«, erwiderte der Durchschnittsmann. »Sehr sogar. Manchmal mehr, als sie wünschen.« Sein Lächeln wurde ziemlich animalisch. Und er fragte noch einmal: »Was hören Sie sich da an?«
Der große Dünne war unschlüssig und blickte seinen Besucher ungehalten an. Doch es war schon einige Tage her, seit er zuletzt mit jemandem gesprochen hatte. Schließlich beschloss er, die Wahrheit zu sagen. »Ich höre mir eine Predigt an.«
Der Durchschnittsmann zeigte sich nur wenig überrascht. »Wirklich? Eine Predigt? Für einen Geistlichen hätte ich Sie gar nicht gehalten.« Doch sein Lächeln besagte etwas anderes. Der große Dünne begann, sich unwohl zu fühlen. Und an die Pistole in seinem Rucksack zu denken, der nur eine Armlänge entfernt war. Wenigstens hatte er die Riemen offen gelassen, als er ihn abgestellt hatte.
»Sie irren sich, aber dafür wird Gott Sie nicht strafen«, erwiderte der große Dünne gelassen mit einem nachsichtigen Lächeln. »Ich höre mir eine meiner eigenen alten Predigten an. Eine, mit der ich Unmengen von Menschen Gottes Wahrheit verkündet habe.«
»Und, hat Ihnen jemand geglaubt?« Der Durchschnittsmann neigte neugierig den Kopf.
»Viele haben mir geglaubt. Sehr viele. Ich hatte damals eine ziemlich große Gefolgschaft. Doch eine junge Frau namens … Eine junge Frau brachte mich zu Fall. Und sorgte in gewisser Weise auch dafür, dass meine Ehefrau ins Gefängnis kam.«
»Heißt diese junge Frau vielleicht Sookie Stackhouse?«, fragte der Durchschnittsmann, der nun seine Sonnenbrille abnahm und erstaunlich helle Augen sehen ließ.
Der große Dünne wandte dem anderen ruckartig den Kopf zu. »Woher wissen Sie das?«, fragte er.
Juni
Der Teufel nahm gerade mit kritischem Blick Schmalzgebäck zu sich, als der Geschäftsmann an seinen Tisch draußen vor dem Café kam. Dem Teufel fiel Copley Carmichaels energiegeladener Schritt auf. Er wirkte noch sehr viel wohlhabender als zu jener Zeit, da er noch nicht pleite war. Carmichaels Name war dieser Tage wieder häufig im Wirtschaftsteil der Zeitung zu lesen. Eine Kapitalspritze hatte ihn sehr schnell erneut zu einer wirtschaftlichen Größe in New Orleans gemacht, und sein politischer Einfluss wuchs in dem Maße, wie er Geld in New Orleans’ immer noch stockende Wirtschaft pumpte, die durch den Hurrikan Katrina einen schweren Schlag erlitten hatte. Mit dem er selbst allerdings, wie der Teufel sofort jedem gegenüber betonte, der ihn darauf ansprach, absolut nichts zu tun gehabt hatte.
Heute wirkte Carmichael gesund und kraftvoll und zehn Jahre jünger, als er tatsächlich war. Er setzte sich ohne einen Gruß an den Tisch des Teufels.
»Wo ist denn Ihr Mann, Mr Carmichael?«, fragte der Teufel nach einem Schluck Kaffee.
Carmichael bestellte eben ein Getränk beim Kellner. Erst als der junge Mann weg war, erwiderte er: »Tyrese hat seit einiger Zeit ziemliche Schwierigkeiten, ich habe ihm frei gegeben.«
»Mit der jungen Frau? Dieser Gypsy?«
»Natürlich«, sagte Carmichael mit einem Anflug von Hohn in der Stimme. »Ich wusste schon, als er darum bat, dass er mit dem Ergebnis nicht zufrieden sein würde. Doch er war so überzeugt, dass die wahre Liebe letztlich alles überwinden würde.«
»Und, hat sie das nicht?«
»Oh, doch, Gypsy ist völlig verrückt nach ihm. Sie liebt ihn so sehr, dass sie ständig Sex mit ihm hat. Sie konnte sich nicht zurückhalten, obwohl sie wusste, dass sie HIV-positiv ist … was sie Tyrese gar nicht erst anvertraut hat.«
»Ah«, sagte der Teufel. »Nicht meine Idee, das Virus. Und wie geht es Tyrese?«
»Er ist inzwischen auch HIV-positiv«, erzählte Carmichael achselzuckend. »Er ist in Behandlung. Aids ist heute ja nicht mehr das sofortige Todesurteil, das es einst war. Aber das Ganze nimmt ihn emotional sehr mit. Ich hatte ihn immer für vernünftiger gehalten.«
»Und nun möchten Sie also um Ihren Unterschriftenbonus bitten«, sagte der Teufel. Copley Carmichael sah keinen Zusammenhang zwischen den beiden Themen.
»Ja.« Carmichael grinste den Teufel an, beugte sich vertraulich vor und flüsterte kaum wahrnehmbar: »Ich weiß genau, was ich will. Ich will, dass Sie ein Cluviel Dor für mich finden.«
Der Teufel wirkte ehrlich überrascht. »Woher wissen Sie von der Existenz dieses seltenen Gegenstandes?«
»Meine Tochter hat es einmal in einem Gespräch erwähnt«, erklärte Carmichael ohne einen Anflug von Scham. »Es klang interessant, doch sie hörte auf zu reden, ehe sie den Namen der Person genannt hatte, die vermutlich eins besitzt. Also ließ ich von einem Mann, den ich kenne, ihr E-Mail-Konto hacken. Das hätte ich schon viel früher tun sollen. Es war eine Offenbarung. Sie lebt mit so einem Kerl zusammen, dem ich nicht traue. Und nach unserem letzten Gespräch wurde sie so wütend auf mich, dass sie sich seitdem weigert, sich mit mir zu treffen. Doch nun kann ich sie im Auge behalten, ohne dass sie es überhaupt weiß, und sie vor ihren eigenen schlechten Entscheidungen bewahren.«
Er meinte vollkommen ernst, was er da sagte. Der Teufel erkannte, dass Carmichael überzeugt davon war, dass er seine Tochter liebte und dass er wusste, was in jeder Hinsicht das Beste für sie war.
»Amelia hat also einmal mit jemandem über ein Cluviel Dor geredet«, sagte der Teufel. »Und das führte dazu, dass sie es Ihnen gegenüber erwähnte. Wie interessant. Keiner hatte eins seit … nun, solange ich zurückdenken kann. Cluviel Dors werden vom Elfenvolk hergestellt … und Sie wissen vermutlich selbst, dass das keine süßen kleinen Geschöpfe mit Flügeln sind.«
Carmichael nickte. »Ich staune immer noch, wenn ich höre, was dort draußen alles existiert«, erwiderte er. »Ich muss inzwischen davon ausgehen, dass es Elfen wirklich gibt. Und ich muss in Betracht ziehen, dass meine Tochter doch keine solche Spinnerin ist. Auch wenn ich glaube, dass sie sich Illusionen macht, was ihre eigenen Fähigkeiten angeht.«
Der Teufel hob seine perfekten Augenbrauen. Es schien in der Familie Carmichael nicht nur eine Person zu geben, die sich Illusionen hingab. »Zum Cluviel Dor … das Elfenvolk hat sie alle verbraucht. Ich glaube, es gibt kein einziges mehr auf der Erde, und ich kann seit dem Umsturz nicht mehr in die Elfenwelt hinein. Das eine oder andere Geschöpf hat die Elfenwelt ausgestoßen … aber es kommt niemand mehr hinein.« Er blickte leicht bedauernd drein.
»Ein Cluviel Dor ist noch vorhanden, und soweit ich es verstanden habe, hält eine Freundin meiner Tochter es verborgen«, erwiderte Copley Carmichael. »Ich weiß, dass Sie es finden können.«
»Faszinierend«, sagte der Teufel ziemlich aufrichtig. »Und wozu wollen Sie es benutzen? Nachdem ich es gefunden habe?«
»Ich will meine Tochter zurückhaben«, sagte Carmichael mit einer solchen Intensität, dass seine Gefühle beinahe greifbar waren. »Ich will die Macht besitzen, ihr Leben zu verändern. Das ist es, was ich mir wünschen werde, wenn Sie es für mich aufgestöbert haben. Die Frau, die weiß, wo es ist … sie wird es wahrscheinlich nicht hergeben wollen. Es ist ein Erbstück ihrer Großmutter, und sie ist nicht gerade mein größter Fan.«
Der Teufel hielt sein Gesicht in die Morgensonne, und in seinen Augen flackerte es kurz rot auf. »Na, so etwas aber auch. Nun, ich werde der Sache einmal nachgehen. Wie heißt denn die Freundin Ihrer Tochter, die, die angeblich weiß, wo ein Cluviel Dor zu finden ist?«
»Sie wohnt in Bon Temps. Das ist oben im Norden, ganz in der Nähe von Shreveport. Sookie Stackhouse.«
Der Teufel nickte bedächtig. »Den Namen habe ich schon einmal gehört.«
Juli
Als der Teufel sich das nächste Mal mit Copley Carmichael traf, drei Tage nach ihrem Gespräch im Café du Monde, trat er an Carmichaels Tisch im Commander ’s Palace. Carmichael wartete auf sein Abendessen und telefonierte per Handy mit einem Bauunternehmer, der seinen Kreditrahmen erweitern wollte. Doch dazu war Carmichael nicht bereit, und er legte ihm seine Gründe in unmissverständlichen Worten dar. Als er schließlich aufsah, stand der Teufel vor ihm, in demselben Anzug, den er bei ihrem ersten Treffen getragen hatte. Er strahlte eine kühle Eleganz aus und wirkte makellos.
Nachdem Carmichael das Handy beiseitegelegt hatte, setzte der Teufel sich auf den Stuhl ihm gegenüber.
Carmichael war erschrocken, als er den Teufel erkannt hatte. Und da er Überraschungen hasste, verhielt er sich unklug. »Warum zum Teufel tauchen Sie hier einfach auf?«, schnauzte er. »Ich habe nicht um Ihren Besuch gebeten!«
»›Zum Teufel‹ – wie passend«, sagte der Teufel, der sich anscheinend nicht angegriffen fühlte. Er bestellte einen Single Malt Whiskey bei dem Kellner, der plötzlich wie aus dem Boden gewachsen neben ihm stand. »Ich nahm an, Sie würden gern die Neuigkeiten über Ihr Cluviel Dor hören.«
Carmichaels Miene veränderte sich augenblicklich. »Sie haben es gefunden! Sie haben es!«
»Das leider nicht, Mr Carmichael«, erwiderte der Teufel. (Es klang allerdings nicht so, als ob es ihm leidtäte.) »Etwas recht Unerwartetes hat unsere Pläne durchkreuzt.« Der Kellner servierte ihm den Whiskey mit einer gewissen Feierlichkeit, der Teufel nahm einen Schluck und nickte.
»Was?«, zischte Carmichael, vor Wut schäumend.
»Miss Stackhouse hat das Cluviel Dor bereits benutzt, seine magische Kraft ist erloschen.«
Einen Augenblick lang herrschte angespanntes Schweigen, geschwängert mit all den Gefühlen, die dem Teufel Freude bereiten.
»Ich werde sie zugrunde richten«, stieß Carmichael giftig hervor. Es kostete ihn allergrößte Mühe, seine Stimme zu dämpfen. »Und Sie werden mir dabei helfen. Das ist es, was ich statt des Cluviel Dor haben will.«
»Ach du liebes bisschen. Ihren Unterschriftenbonus haben Sie doch schon verbraucht, Mr Carmichael. Sie dürfen nicht zu gierig werden.«
»Aber Sie haben mir das Cluviel Dor nicht beschafft!« Carmichael, eigentlich ein erfahrener Geschäftsmann, war trotzdem aufs Äußerste erstaunt und empört.
»Ich habe es gefunden und wollte es ihr aus der Tasche ziehen«, erzählte der Teufel. »Ich bin in den Körper von jemandem geschlüpft, der hinter ihr stand. Doch sie hat es benutzt, ehe ich es herausziehen konnte. Es zu finden war das, worum Sie mich gebeten haben. Genau dieses Wort haben Sie benutzt, zweimal, und aufstöbern einmal. Damit ist unser Handel abgeschlossen.« Er trank sein Glas auf einen Zug leer.
»Helfen Sie mir wenigstens, es ihr heimzuzahlen«, stieß Carmichael mit zornesrotem Gesicht hervor. »Sie hat uns beide aufs Kreuz gelegt.«
»Mich nicht«, sagte der Teufel. »Ich habe Miss Stackhouse aus der Nähe gesehen und mit vielen Leuten gesprochen, die sie kennen. Sie scheint eine interessante Frau zu sein. Ich habe keinen Grund, ihr zu schaden.« Er stand auf. »Und wenn ich Ihnen einen guten Rat geben darf, dann vergessen Sie diese Sache. Sie hat ein paar machtvolle Freunde, darunter auch Ihre Tochter.«
»Meine Tochter ist eine Frau, die sich mit Hexen abgibt«, erwiderte Carmichael. »Sie war noch nie in der Lage, ihren eigenen Lebensunterhalt zu verdienen, nicht vollständig jedenfalls. Ich habe Erkundigungen über ihre ›Freunde‹ eingezogen, sehr diskret natürlich.« Er seufzte, und jetzt klang er nicht mehr nur wütend, sondern auch entnervt. »Ich weiß, dass diese Kräfte existieren. Und inzwischen glaube ich sogar, dass die Hexen sie wirklich haben. Wenn auch widerwillig. Aber wozu haben sie diese Kräfte genutzt? Die Mächtigste unter ihnen wohnt in einer Baracke.« Carmichael klopfte mit den Fingerknöcheln auf den Tisch. »Meine Tochter könnte eine bedeutende Rolle in der Gesellschaft dieser Stadt spielen. Sie könnte für mich arbeiten und alle möglichen wohltätigen Dinge tun, doch stattdessen lebt sie in ihrer eigenen kleinen Welt, zusammen mit ihrem Freund, diesem Loser. Genauso wie ihre Freundin Sookie. Aber das werde ich nicht auf mir sitzen lassen. Wie viele machtvolle Freunde kann eine Kellnerin schon haben?«
Der Teufel sah nach links hinüber. Zwei Tische weiter saß ein kugelrunder Mann mit dunklem Haar ganz allein an einem mit Essen beladenen Tisch. Der Kugelrunde sah dem Teufel direkt in die Augen, ohne mit der Wimper zu zucken oder den Blick abzuwenden – das gelang nur wenigen. Nach einem sehr langen Augenblick nickten die beiden Männer einander zu.
Carmichael starrte den Teufel wütend an.
»Ich schulde Ihnen nichts mehr für Tyrese«, bemerkte der Teufel. »Und Sie sind auf ewig mein. Bei dem Kurs, den Sie zurzeit einschlagen, werde ich Sie vielleicht sogar früher als erwartet bekommen.« Er lächelte, dass es einem trotz seiner gelassenen Miene kalt den Rücken hinunterlief. Und dann stand er von seinem Stuhl auf und ging.
Carmichael wurde sogar noch wütender, als er auch noch den Whiskey des Teufels bezahlen musste. Den Kugelrunden hatte er überhaupt nicht bemerkt. Der Kugelrunde ihn aber sehr wohl.
Kapitel 1
Am Morgen, nachdem ich meinen Boss von den Toten auferweckt hatte, sah ich ihn nach dem Aufstehen halb angezogen in meinem Garten im Liegestuhl sitzen. Es war ungefähr zehn Uhr vormittags an einem Tag im Juli, und die Sonne hatte den Garten schon in strahlende Hitze getaucht. Sams wirre Locken leuchteten rotgolden. Er öffnete die Augen, als ich die Verandastufen hinunterstieg und durch den Garten auf ihn zuging. Ich war noch im Nachthemd und wollte lieber gar nicht daran denken, wie mein eigenes Haar aussah. Es war so ziemlich eine einzige wilde Mähne.
»Wie fühlst du dich?«, fragte ich ganz leise. Meine Kehle war heiser vom Schreien in der Nacht zuvor, als ich Sam im Garten des Farmhauses, das Alcide Herveaux von seinem Vater geerbt hatte, verblutend auf dem Boden liegen sah. Sam zog die Beine an, damit ich mich zu ihm auf den Liegestuhl setzen konnte. Seine Jeans war übersät von Spritzern seines eigenen getrockneten Bluts. Sein Oberkörper war nackt; das Hemd war wohl einfach zu widerlich, um es noch mal anzuziehen.
Sam gab lange keine Antwort. Obwohl er mir stillschweigend erlaubt hatte, mich zu ihm zu setzen, schien ihm meine Gegenwart nicht willkommen zu sein. Schließlich sagte er: »Keine Ahnung, wie ich mich fühle. Irgendwie nicht wie ich selbst. Es ist, als hätte sich in mir was verändert.«
Ich schauderte. Genau das hatte ich befürchtet. »Ich weiß … das heißt, mir wurde erzählt … dass die Magie immer ihren Preis hat«, sagte ich. »Ich dachte allerdings, ich würde diejenige sein, die dafür zahlt. Tut mir leid.«
»Du hast mich ins Leben zurückgeholt«, stellte er emotionslos fest. »An den Gedanken muss ich mich wohl erst mal gewöhnen.« Er lächelte nicht.
Ich rückte unbehaglich hin und her. »Wie lange bist du denn schon hier draußen?«, fragte ich. »Möchtest du einen Orangensaft oder einen Kaffee? Frühstück?«
»Ich bin schon ein paar Stunden hier draußen«, erzählte er, »und habe auf dem Erdboden gelegen. Ich musste wieder Kontakt aufnehmen.«
»Womit?« Ich war anscheinend doch noch nicht ganz so wach, wie ich gedacht hatte.
»Mit meinem angeborenen Naturwesen«, sagte er langsam und bedächtig. »Gestaltwandler sind Kinder der Natur. Weil wir uns in so viele Geschöpfe verwandeln können. Das ist unsere Legende. Lange bevor wir uns mit den Menschen vermischten, so wurde erzählt, erschuf die Mutter alles Irdischen uns, weil sie sich ein Geschöpf wünschte, das so vielseitig ist, dass es jedes aussterbende Lebewesen ersetzen könnte. Und dieses Geschöpf war der Gestaltwandler. Ich könnte mir das Bild eines Säbelzahntigers ansehen und sofort einer werden. Wusstest du das?«
»Nein«, sagte ich.
»Ich glaube, ich fahre nach Hause. Ich fahre zu meinem Wohnwagen und …« Seine Stimme verlor sich.
»Und was?«
»Und ziehe mir ein Hemd an«, fuhr er schließlich fort. »Ich fühle mich seltsam. Dein Garten ist erstaunlich.«
Jetzt war ich verwirrt und nicht nur leicht besorgt. Die eine Sookie in mir verstand, dass Sam etwas Zeit für sich allein brauchte, um sich von dem Schock des Sterbens und der Wiederkehr zu erholen. Die andere Sookie aber, die Sookie, die Sam schon seit Jahren kannte, war traurig, dass er so gar nicht wie sonst klang. Ich war in den letzten Jahren Sams Freundin, Angestellte, Gelegenheitsdate und Geschäftspartnerin gewesen – all das und noch vieles mehr – und hätte geschworen, dass er mich nicht mehr überraschen konnte.
Mit zusammengekniffenen Augen sah ich zu, wie er sein Schlüsselbund aus der Hosentasche zog. Ich stand auf, damit er den Liegestuhl verlassen und zu seinem Pick-up gehen konnte. Er kletterte in die Fahrerkabine und sah mich einen Augenblick lang durch die Windschutzscheibe an. Dann drehte er den Autoschlüssel im Zündschloss. Er hob die Hand, und mich durchfuhr ein Freudenschauer. Er würde das Seitenfenster noch mal herunterkurbeln. Er würde mich zu sich herüberrufen, um sich zu verabschieden. Doch dann setzte Sam zurück, wendete den Wagen und fuhr langsam die Auffahrt zur Hummingbird Road entlang. Er fuhr davon ohne ein einziges Wort. Kein »Bis später«, »Vielen Dank« oder »Du kannst mich mal«.
Und was hatte er eigentlich damit gemeint, dass mein Garten erstaunlich sei? Er war doch schon Dutzende Male in meinem Garten gewesen.
Dieses Rätsel zumindest war schnell gelöst. Als ich kehrtmachte und ins Haus stapfte – durch außerordentlich grünes Gras –, fiel mir auf, dass die drei Tomatenstauden, die ich vor Wochen eingepflanzt hatte, schwer mit reifen roten Früchten beladen waren. Bei dem Anblick blieb ich unwillkürlich stehen. Wann war das denn passiert? Als ich das letzte Mal einen Blick darauf geworfen hatte, vor einer Woche vielleicht, hatten sie vor sich hingekümmert und so ausgesehen, als müssten sie dringend gegossen und gedüngt werden. Die linke Staude hatte sogar den Eindruck gemacht, als würde sie schon aus dem letzten Loch pfeifen (falls Pflanzen denn pfeifen konnten). Und jetzt hatten alle drei Pflanzen üppig grüne Blätter und sanken unter dem schieren Gewicht der Früchte gegen das Spalier. So als hätte irgendjemand ihnen eine Extradosis Superdünger verpasst.
Mit vor Erstaunen offenem Mund drehte ich mich im Kreis, um auch einen Blick auf die anderen Blumen und Büsche im Garten zu werfen, und davon gab es unzählige. Viele der Stackhouse-Frauen waren begeisterte Gärtnerinnen gewesen und hatten Rosen, Margeriten, Hortensien und Birnbäume gepflanzt … so viel Blühendes und Grünes, gehegt von Generationen von Stackhouse-Frauen. Und mir war es nicht mal gelungen, das alles gut in Schuss zu halten.
Aber … was zum Teufel war denn hier los? Während ich in den letzten Tagen in düsteren Gedanken versunken war, hatte der ganze Garten Dopingmittel eingenommen. Oder vielleicht war auch ein Zauberer mit grünem Daumen zu Besuch gekommen. Alles, was irgend blühen konnte, war mit strahlenden Blüten überladen, und alles, was Früchte tragen konnte, war reich damit bestückt. Und alles andere war eine einzige glänzende grüne Pracht. Wie war das denn passiert?
Ich pflückte ein paar besonders reife und runde Tomaten und nahm sie mit ins Haus. Zu Mittag würde es ein leckeres Schinken-Tomaten-Sandwich geben, das stand schon mal fest, aber zuerst musste ich noch ein paar Dinge erledigen.
Ich griff nach meinem Handy und ging die Liste meiner Kontakte durch. Ja, ich hatte Bernadette Merlottes Nummer. Bernadette, genannt Bernie, war Sams Gestaltwandlermutter. Meine Mutter war gestorben, als ich sieben war (weshalb ich es vielleicht gar nicht richtig beurteilen konnte), aber Sam schien ein gutes Verhältnis zu Bernie zu haben. Wenn es je einen Zeitpunkt gegeben hatte, seine Mom anzurufen, dann jetzt.
Ich will nicht behaupten, dass wir ein angenehmes Gespräch führten, und es war kürzer, als es hätte sein sollen. Doch als ich auflegte, packte Bernie Merlotte eine Reisetasche, um nach Bon Temps zu kommen. Sie würde am Spätnachmittag eintreffen.
Hatte ich das Richtige getan? Ich ging die Sache noch einmal haarklein durch und beschloss schließlich, ja, das hatte ich. Und außerdem beschloss ich, dass ich einen Tag frei brauchte. Vielleicht sogar mehr als einen. Ich rief im Merlotte’s an und erzählte Kennedy, ich hätte die Grippe. Sie versicherte mir, dass man mich nur im Notfall anrufen, ansonsten aber in Ruhe lassen würde, damit ich mich erholen konnte.
»Ich hätt ja nie gedacht, dass man sich im Juli ’ne Grippe einfangen kann. Aber Sam hat auch schon angerufen und genau das Gleiche erzählt«, sagte Kennedy mit einem Lächeln in der Stimme.
Ich dachte: Verdammt.
»Vielleicht habt ihr euch ja gegenseitig angesteckt?«, meinte sie schelmisch.
Ich sagte kein Wort.
»Okay, okay, ich werd bloß anrufen, wenn hier alles in Flammen steht«, fuhr sie fort. »Lass es dir gut gehn und erhol dich von der Grippe.«
Ich weigerte mich, mir Gedanken darüber zu machen, welche Gerüchte dadurch zweifellos losgetreten werden würden. Ich schlief viel, ich weinte viel. Ich räumte alle Schubladen in meinem Schlafzimmer auf: Nachttisch, Frisierkommode, Kleiderkommode. Ich warf nutzloses Zeug weg und sortierte andere Dinge auf eine Weise, die mir vernünftiger erschien. Und ich wartete darauf … von irgendjemandem zu hören.
Doch das Telefon klingelte nicht. Ich hörte nichts, davon aber jede Menge. Und ich hatte auch jede Menge »nichts« im Haus, außer Tomaten. Also aß ich sie alle auf Sandwiches, und schon in dem Augenblick, als die roten gepflückt waren, hingen wieder neue grüne an den Stauden. Ich briet einige der grünen Tomaten, und als die anderen rot geworden waren, machte ich mir zum ersten Mal überhaupt meine eigene Salsa. Die Blumen blühten und blühten und blühten, bis ich in fast jedem Zimmer des Hauses eine Vase voll davon stehen hatte. Und ich ging sogar auf den Friedhof, um ein paar an Grannys Grab zu bringen und einen Strauß auf Bills Veranda zu legen. Wenn ich sie hätte verspeisen können, hätte ich bei jeder Mahlzeit einen vollen Teller gehabt.
Anderswo
Die rothaarige Frau trat langsam und argwöhnisch durch das Tor des Gefängnisses ins Freie, so als würde sie einen üblen Streich erwarten. Sie blinzelte in dem strahlenden Sonnenschein und begann, auf die Straße zuzugehen. Dort parkte ein Auto, doch dem schenkte sie keinerlei Beachtung. Es kam der rothaarigen Frau gar nicht in den Sinn, dass die Insassen auf sie warten könnten.
Ein Durchschnittsmann stieg an der Beifahrerseite aus. Genau so kategorisierte sie ihn: ein Durchschnittsmann. Durchschnittlich braunes Haar, durchschnittlich groß, durchschnittlich gebaut und ein durchschnittliches Lächeln auf den Lippen. Seine Zähne jedoch waren strahlend weiß und perfekt. Eine dunkle Sonnenbrille verbarg seine Augen. »Miss Fowler«, rief er. »Wir sind hier, um Sie abzuholen.«
Zögernd drehte sie sich zu ihm herum. Die Sonne schien ihr ins Gesicht, und sie musste die Augen zusammenkneifen. Sie hatte so vieles überlebt – gescheiterte Ehen, kaputte Beziehungen, das Dasein als Alleinerziehende, Verrat, eine Schusswunde. Sie hatte nicht vor, je wieder ein leichtes Opfer abzugeben.
»Wer sind Sie?«, fragte sie erhobenen Hauptes, auch wenn sie wusste, dass die Sonne gnadenlos jede Falte in ihrem Gesicht und jeden Mangel des billigen Mittels offenlegte, mit dem sie sich im Bad des Gefängnisses die Haare gefärbt hatte.
»Erkennen Sie mich nicht? Wir sind uns bei der Anhörung begegnet.« Die Stimme des Durchschnittsmannes war beinahe sanft. Er nahm die dunkle Sonnenbrille ab, und in ihrem Kopf regte sich eine Erinnerung.
»Sie sind der Rechtsanwalt, der, der mich rausgepaukt hat«, sagte sie lächelnd. »Ich weiß zwar nicht, warum Sie das getan haben, aber ich schulde Ihnen Dank. Ins Gefängnis habe ich ganz sicher nicht gehört. Ich möchte meine Kinder sehen.«
»Und das werden Sie auch«, erwiderte er. »Bitte, bitte.« Er öffnete die hintere Autotür und forderte sie mit einer Geste auf, einzusteigen. »Es tut mir leid. Ich hätte Sie mit Mrs Fowler ansprechen sollen.«
Sie war froh, in die weichen Polster der Rückbank sinken zu können, froh, in der angenehmen Kühle des Wageninneren zu schwelgen. Das war der größte Komfort, den sie seit vielen Monaten genossen hatte. Weiche Sitze und Höflichkeit (oder gute Matratzen und dicke Handtücher) lernt man erst so richtig schätzen, wenn man sie nicht mehr hat.
»Eine Mrs war ich ein paar Mal. Und eine Miss auch mal«, sagte sie. »Ist mir egal, wie Sie mich ansprechen. Was für ein großartiges Auto.«
»Freut mich, dass es Ihnen gefällt«, sagte der Fahrer, ein großer Mann mit ergrauendem, sehr kurz geschnittenem Haar. Er drehte sich nach der rothaarigen Frau um, und er lächelte sie an. Auch er nahm die Sonnenbrille ab.
»Oh, mein Gott!«, rief sie in einem völlig veränderten Ton. »Sie sind es! Tatsächlich! In Fleisch und Blut. Ich dachte, Sie sitzen im Gefängnis. Aber Sie sind hier.« Sie war starr vor Ehrfurcht, aber auch verwirrt.
»Ja, Schwester«, erwiderte er. »Ich weiß, was für eine treu ergebene Anhängerin Sie sind und wie Sie Ihren Wert unter Beweis gestellt haben. Und nun habe ich mich bedankt, indem ich Sie aus dem Gefängnis geholt habe. Dort hinein gehören Sie auf keinen Fall.«
Sie wandte den Blick ab. In ihrem Herzen kannte sie ihre Sünden und Verbrechen genau. Doch es war Balsam für ihre Selbstachtung, dass ein so angesehener Mann – einer, den sie schon im Fernsehen gesehen hatte! – sie für einen guten Menschen hielt. »Haben Sie deshalb all das Geld für meine Kaution aufgebracht? Das war eine verdammt große Summe, Mister. Mehr, als ich je im Leben verdienen werde.«
»Ich will Ihnen ein ebenso ergebener Fürsprecher sein, wie Sie es mir waren«, erwiderte der große Mann aalglatt. »Außerdem wissen wir, dass Sie nicht einfach davonlaufen werden.« Er lächelte sie an, und Arlene dachte, was sie doch für ein Glück habe. Dass jemand über hunderttausend Dollar für ihre Kaution aufgebracht hatte, erschien ihr unglaublich. Eigentlich sogar verdächtig. Aber, sagte sie sich, so weit, so gut.
»Wir bringen Sie nach Hause, nach Bon Temps«, versetzte der Durchschnittsmann. »Dort können Sie Ihre Kinder sehen, die kleine Lisa und den kleinen Coby.«
Die Art, wie er die Namen ihrer Kinder aussprach, ließ ein mulmiges Gefühl bei ihr aufkommen. »So klein sind sie gar nicht mehr«, entgegnete sie, um den Anflug von Zweifel zu ersticken. »Aber ich will sie zum Teu… ich will sie unbedingt sehen. Ich habe sie jeden einzelnen Tag, den ich gesessen habe, vermisst.«
»Es gibt ein paar kleine Dinge, die Sie im Gegenzug auch für uns tun könnten, wenn es Ihnen recht ist«, sagte der Durchschnittsmann. Sein Englisch hatte eindeutig einen leicht ausländischen Tonfall.
Arlene Fowler wusste instinktiv, dass diese paar Dinge nicht wirklich klein sein würden und es ihr ganz sicher nicht freistünde, sie zu tun. Sie sah die beiden Männer an und erkannte, dass sie kein Interesse an dem haben würden, was Arlene ihnen ohne große Probleme überlassen hätte, ihren Körper zum Beispiel. Und sie wollten auch nicht, dass sie ihnen die Hemden bügelte oder das Silber polierte. Sie fühlte sich viel besser, jetzt, da die Karten auf dem Tisch lagen und gleich aufgedeckt würden. »Mhhm«, machte sie. »Was denn?«
»Ich glaube nicht, dass Sie etwas dagegen haben werden, wenn Sie es hören«, sagte der Fahrer. »Wirklich nicht.«
»Alles, was Sie tun sollen«, sagte der Durchschnittsmann, »ist, ein Gespräch mit Sookie Stackhouse führen.«
Eine ganze Weile lang herrschte Schweigen. Arlene Fowlers Blick wanderte abwägend und berechnend zwischen den beiden Männern hin und her. »Und Sie sorgen dafür, dass ich wieder im Gefängnis lande, wenn ich’s nicht tu?«, fragte sie.
»Da wir Sie nur auf Kaution herausgeholt haben und Ihr Prozess noch anhängig ist, könnten wir dafür wohl sorgen«, erwiderte der große Fahrer sanft. »Aber es würde mir mit Sicherheit sehr widerstreben. Ihnen nicht auch?«, fragte er seinen Begleiter.
Der Durchschnittsmann bewegte nachdenklich den Kopf. »Das wäre wirklich höchst bedauerlich. Die kleinen Kinder würden so traurig sein. Haben Sie Angst vor Miss Stackhouse?«
Wieder herrschte Schweigen, während Arlene Fowler mit der Wahrheit rang. »Ich bin der letzte Mensch auf Erden, den Sookie sehen will«, erwiderte sie ausweichend. »Sie gibt mir die Schuld für alles an dem Tag, an dem Tag …« Ihre Stimme verlor sich.
»An dem Tag, als auf all diese Leute geschossen wurde«, kam der Durchschnittsmann ihr freundlich zu Hilfe. »Auch auf Sie. Nun, ich kenne sie flüchtig und glaube, dass sie zu einem Gespräch bereit wäre. Wir werden Ihnen erzählen, was Sie sagen sollen. Und machen Sie sich keine Sorgen wegen ihres Talents. In dieser Hinsicht wird schon alles gutgehen.«
»Ihr Talent? Sie meinen ihre Fähigkeit, Gedanken zu lesen? Talent, von wegen!« Arlene lachte überraschend auf. »Das ist der Fluch ihres Lebens.«
Die beiden Männer lächelten, und das war ein ganz und gar nicht erfreulicher Anblick. »Ja«, stimmte der Fahrer zu. »Das ist ein Fluch für sie, und ich kann mir vorstellen, dass sie das noch viel stärker so empfinden wird.«
»Was wollen Sie überhaupt von Sookie?«, fragte Arlene. »Sie besitzt nichts weiter als dieses alte Haus.«
»Sie hat uns und ein paar anderen Leuten ziemlich große Schwierigkeiten bereitet«, sagte der Fahrer. »Drücken wir es einfach so aus: Jetzt kommen mal einige Schwierigkeiten auf sie zu.«
Kapitel 2
Am Abend des zweiten Tages meiner Einsamkeit stellte ich mich der Tatsache, dass ich Eric aufsuchen musste. Stimmt schon, eigentlich hätte er zu mir kommen müssen. Er war schließlich derjenige, der getürmt war, als ich Sam von den Toten auferweckt hatte, weil er (vermutlich) überzeugt war, das würde bedeuten, dass ich Sam mehr liebte als ihn. Aber egal, ich musste nach Shreveport ins Fangtasia fahren, um mit Eric zu reden, denn ich litt unter seinem Schweigen. Ich sah mir eine Zeit lang das Feuerwerk an, das im Stadtpark stattfand – heute war der 4. Juli –, doch dann ging ich wieder ins Haus und zog mich um. Ich wollte so gut wie möglich aussehen, es sollte aber auch nicht übertrieben wirken. Wer wusste schon, auf wen alles ich treffen würde, auch wenn ich Eric allein sprechen wollte.
Ich hatte von keinem der Vampire gehört, die ich kannte und die regelmäßig im Fangtasia verkehrten. Ja, ich wusste nicht einmal, ob Felipe de Castro, der König von Arkansas, Louisiana und Nevada, noch in Shreveport war und sich in Erics Angelegenheiten einmischte, um ihm das Leben schwer zu machen. Felipe hatte seine Freundin Angie und seinen Stellvertreter Horst mitgebracht, nur um Eric zu ärgern. Der König war heimtückisch und gerissen, und sein kleines Gefolge ähnelte seinem Herrscher nicht unwesentlich.
Und ich wusste auch nicht, ob Freyda, die Königin von Oklahoma, noch in der Stadt war. Erics Schöpfer, Appius Livius Ocella, hatte mit Freyda schriftlich einen Vertrag geschlossen, mit dem er Eric (meinem Verständnis nach) im Grunde als Sklaven an Freyda verkaufte, wenn auch auf so eine kuschelige Art: als ihren Prinzgemahl, mit allen nur denkbaren Vorzügen, die ein solcher Job mit sich brachte. Das einzige Problem war: Appius hatte sich vorher nicht mit Eric kurzgeschlossen. Eric war hin- und hergerissen, um’s mal vorsichtig auszudrücken. Seinen Job als Sheriff hätte er von sich aus niemals aufgegeben. Wenn es je einen Vampir gegeben hatte, der es genoss, der große Fisch im kleinen Teich zu sein, dann war Eric dieser Vampir. Er hatte immer hart gearbeitet, und er hatte jede Menge Geld gemacht für den Herrscher von Louisiana – wer immer das auch gerade gewesen war. Und seit die Vampire an die Öffentlichkeit gegangen waren, hatte er noch viel mehr getan, als nur Geld herbeizuschaffen. Der große, gut aussehende, wortgewandte, tatkräftige Eric war das Paradebeispiel par excellence für einen Vampir, der sich in die Gesellschaft integrieren wollte. Und er hatte sogar eine Menschenfrau geheiratet: mich. Wenn auch nicht nach den Gesetzen der Menschen.
Okay, er hatte auch seine dunkle Seite. Er war eben trotz allem immer noch ein Vampir.
Auf dem ganzen Weg nach Shreveport fragte ich mich zum hundertsten Mal, ob ich nicht einen Riesenfehler machte. Als ich schließlich vor der Hintertür des Fangtasia stand, war ich so angespannt, dass ich zitterte. Ich trug mein liebstes Sommerkleid, das rückenfreie mit den rosaroten Punkten, zupfte am Nackenband herum und holte noch ein paar Mal tief Luft, ehe ich anklopfte. Die Tür schwang auf. Eine grüblerisch wirkende Pam stand an die Wand des Korridors gelehnt da, mit vor der Brust verschränkten Armen.
»Pam«, sagte ich zur Begrüßung.
»Du solltest nicht hier sein«, sagte sie.
Natürlich, all ihre Loyalität galt zuerst Eric, und das würde auch immer so bleiben. Dennoch hatte ich geglaubt, dass Pam mich ein wenig mochte, so sehr sie einen Menschen eben mögen konnte, und ihre Worte waren wie ein Schlag ins Gesicht für mich. Ich wollte nicht noch stärker leiden, als ich es sowieso schon tat, sondern war hierhergekommen, um zu sehen, ob ich die Sache mit Eric nicht wieder einrenken könnte; ich wollte ihm sagen, dass er das mit Sam und mir falsch sah, und herausfinden, welche Entscheidung er wegen Freyda getroffen hatte.
»Ich muss mit Eric reden«, erwiderte ich und versuchte gar nicht erst hineinzugehen. So klug war ich inzwischen.
In diesem Augenblick flog die Tür von Erics Büro auf, und da stand er im Türrahmen. Der große, attraktive, absolut maskuline Eric, der normalerweise zu lächeln begann, wenn er mich sah.
Heute Abend nicht.
»Sookie, ich kann jetzt nicht mit dir reden«, sagte er. »Horst taucht jeden Moment hier auf, und er sollte nicht mal daran erinnert werden, dass du existierst. Sie haben einen Rechtsanwalt herbestellt, der den Vertrag durchsehen wird.«
Es war, als ob er mit einer Fremden sprach, und noch dazu mit einer Fremden, die keinerlei Anlass hatte, an seiner Türschwelle zu erscheinen. Eric wirkte regelrecht wütend und verletzt.
Die Worte, die ich zu sagen hatte, lagen mir auf der Zunge – und mein Herz quoll über davon. Mehr als fast alles auf der Welt wollte ich ihn in die Arme schließen und ihm sagen, wie viel er mir bedeutete. Aber als ich einen halben Schritt auf ihn zu machte, trat Eric zurück und schloss die Bürotür.
Einen Augenblick lang war ich wie erstarrt und versuchte, den Schock und den Schmerz zu verdauen und zu verhindern, dass mir die Gesichtszüge entgleisten. Pam kam auf mich zu, legte mir eine Hand auf die Schulter, drehte mich herum und führte mich zur Tür hinaus. Nachdem sie hinter uns ins Schloss gefallen war, flüsterte sie mir ins Ohr: »Komm nicht wieder hierher. Es ist zu gefährlich. Es geht zu viel vor sich, zu viele Besucher.« Und dann erhob sie die Stimme und fügte hinzu: »Und komm nicht wieder hierher, bis er dich anruft!« Sie gab mir einen kleinen Schubs, der mich in den Fahrersitz meines Autos plumpsen ließ. Und dann zischte sie wieder ins Fangtasia hinein und schloss die Tür hinter sich, in dieser rasanten Vampirgeschwindigkeit, die immer wie reinste Zauberei wirkte, oder wie ein echt gelungenes Videospiel.
Also fuhr ich nach Hause, über Pams Warnung und Erics Worte und Verhalten nachgrübelnd. Mir kam der Gedanke, in Tränen auszubrechen, doch dazu fehlte mir die Energie. Ich hatte es viel zu satt, traurig zu sein, um mich selbst noch trauriger zu machen. Offenbar herrschte irgendein Aufruhr im Fangtasia, und eine Menge Dinge hingen in der Schwebe. Daran konnte ich nichts ändern, nur mich fernhalten und hoffen, dass ich den Machtwechsel überleben würde – wer immer dann auch an die Macht käme. Es war, als würde man darauf warten, dass die Titanic sank.
Ein weiterer Morgen verging, und ein weiterer Tag, an dem ich gefühlsmäßig den Atem anhielt und darauf wartete, dass irgendetwas geschah … irgendetwas Entscheidendes oder Schreckliches.
Es fühlte sich nicht so an, als wartete ich angespannt auf ein Ereignis, das nicht eintrat, eher so, als müsste jeden Augenblick ein Amboss auf meinen Kopf niedersausen. Wenn mir im Fangtasia nicht ein so vernichtender Empfang bereitet worden wäre, hätte ich vielleicht versucht, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen, aber ich war entmutigt, um’s mal so vorsichtig wie möglich auszudrücken. Ich machte einen sehr langen, schweißtreibenden Spaziergang durch den Wald, um den Prescotts einen Korb voller Tomaten auf die hintere Veranda zu stellen. Ich mähte meinen wiesenartig wuchernden Rasen. Wenn ich draußen war, fühlte ich mich immer gleich besser: unversehrter, irgendwie. (Und das war prima, denn ich hatte einen riesigen Haufen Gartenarbeiten zu erledigen.) Doch ich tat keinen Schritt, ohne mein Handy dabeizuhaben.
Ich wartete darauf, dass Sam mich anrief. Aber das tat er nicht. Und Bernie auch nicht.
Ich dachte, Bill würde vielleicht herüberkommen und mir erzählen, was los war. Er tat es nicht.
Und so ging ein weiterer Tag ohne jegliche Kommunikation zu Ende.
Als ich am nächsten Tag aufstand, hatte ich sozusagen eine Nachricht von Eric bekommen. Er hatte mir eine SMS geschickt – eine SMS! –, und das nicht mal persönlich, sondern durch Pam. Sie übermittelte mir eine stocksteife Nachricht mit der Info, dass er später in der Woche mit mir reden würde. Ich hatte die Hoffnung gehegt, dass Pam selbst auftauchen würde, um mich zusammenzustauchen vielleicht oder um mich darüber aufzuklären, was Eric trieb … aber nein.
Während ich mit einem Glas Eistee auf der vorderen Veranda saß, ging ich in mich, um zu erforschen, ob mein Herz gebrochen war. Ich war gefühlsmäßig so erschöpft, dass es gar nicht zu beschreiben war. So wie ich es sah, etwas melodramatisch vielleicht, hatten Eric und ich mit den Banden der Liebe zu kämpfen, die uns vereinten, und diese Bande konnten wir anscheinend weder ganz lösen noch erneut knüpfen.
Ich hatte ein Dutzend Fragen und Vermutungen, fürchtete aber die Antworten. Schließlich holte ich den Rasentrimmer heraus, das Gartengerät, das ich am wenigsten mochte.
Meine Granny sagte immer: »Jeder trifft seine eigenen Entscheidungen und zahlt dafür.« Ich wusste nicht, woher das Sprichwort stammte, aber jetzt verstand ich, was es bedeutete.
»Genau«, sagte ich laut vor mich hin, denn das Radio lief, und über dem Lärmpegel konnte ich meine eigenen Gedanken kaum verstehen. »Wenn man eine Entscheidung trifft, muss man auch die Konsequenzen tragen.« Ich hatte mich nicht mal bewusst dafür entschieden, Sam zu retten, sondern ganz instinktiv gehandelt, als ich ihn sterben sah.
Schließlich ertrug ich dies rückwärtsgewandte Abwägen nicht länger, warf den Rasentrimmer hin und schrie laut auf. Zur Hölle mit all dieser Grübelei!
Ich hatte es satt, darüber nachzudenken.
Deshalb freute ich mich, als ich ein Auto knirschend auf meiner Kiesauffahrt herankommen hörte, nachdem ich alle Gartengeräte weggeräumt und geduscht hatte. Es war Taras Minivan. Als sie am Küchenfenster vorbeifuhr, spähte ich hinaus und versuchte zu erkennen, ob angeschnallt in den Kindersitzen die Zwillinge saßen, aber die Scheiben waren zu dunkel gefärbt. (Der Anblick von Taras Minivan war immer noch ein Schock. Doch Tara und JB hatten sich während Taras Schwangerschaft geschworen, die perfekten Eltern zu sein, und zu diesem Idealbild gehörte eben ein Minivan.) Taras Schultern waren angespannt, als sie auf das Haus zukam, aber immerhin kam sie an die Hintertür, so wie gute Freunde es tun sollten. Sie hielt sich nicht lang mit Klopfen auf, sondern öffnete einfach die Tür zur hinteren Veranda, die auch meine Waschküche war, und rief: »Sookie! Du solltest besser zu Hause sein! Hast du was an?«
»Ich bin zu Hause«, sagte ich und drehte mich zu ihr um, als sie die Küche betrat. Tara trug braune Stretchhosen mit einer lose darüberfallenden weißen Bluse und das Haar zu einem Zopf geflochten, der den Rücken hinabhing. Sie war kaum geschminkt und sah schön aus wie immer, aber dennoch musste ich auf den Wildwuchs ihrer Augenbrauen starren. Die Mutterschaft konnte offensichtlich so einige Verheerungen in der Pflege einer Frau anrichten. Okay, mit zwei Babys auf einmal war es natürlich besonders schwierig, Zeit für sich selbst zu finden. »Wo sind die Kleinen?«, fragte ich.
»Bei JBs Mom«, sagte Tara. »Sie lechzte geradezu danach, sie mal ein paar Stunden lang haben zu können.«
»Also …?«
»Wie kommt’s, dass du nicht arbeitest? Wie kommt’s, dass du deine E-Mails nicht beantwortest und auch deine Post nicht aus dem Briefkasten vorn an der Straße holst?« Sie warf ein Bündel Briefumschläge jeder Größe und ein, zwei Zeitschriften auf den Küchentisch und sah mich verärgert an, als sie fortfuhr: »Du weißt doch, wie nervös das die Leute macht. Leute wie mich!«
Es war mir etwas peinlich, weil ziemlich viel Wahres in dem Vorwurf steckte, dass ich mich ganz egoistisch einfach nicht gemeldet hatte, während ich versuchte, mich selbst zu verstehen und mir über mein Leben und meine Zukunft klar zu werden. »Wie bitte?«, gab ich scharf zurück. »Ich hab mich in der Arbeit krankgemeldet und muss mich doch sehr wundern, dass du es riskierst, meine Bazillen an deine Babys weiterzugeben!«
»Du siehst prima aus«, gab sie ohne einen Hauch Mitgefühl zurück. »Was ist zwischen dir und Sam vorgefallen?«
»Es geht ihm doch gut, oder?« Meine Wut verrauchte und schwand schließlich.
»Sam lässt sich seit Tagen von Kennedy vertreten. Und telefoniert nur mit ihr. Er geht nicht mal ins Merlotte’s hinüber.« Tara sah mich immer noch verärgert an, doch ihre Haltung wurde nachgiebiger. In ihren Gedanken las ich, dass sie sich echte Sorgen machte. »Kennedy freut sich riesig, öfter arbeiten zu können, da sie und Danny darauf sparen, gemeinsam ein Haus zu mieten. Aber der Laden läuft nicht von allein, Sookie, und Sam hat noch nie vier Tage am Stück in der Bar gefehlt, seit er sie gekauft hat – jedenfalls nicht, wenn er in Bon Temps war.«
Der letzte Teil kam größtenteils als gedämpftes Blablabla bei mir an. Sam ging es gut.
Ich setzte mich vielleicht etwas zu hastig auf einen der Küchenstühle.
»Okay, erzähl mir, was passiert ist«, sagte Tara und setzte sich mir gegenüber. »Ich war nicht ganz sicher, ob ich’s wissen will. Aber jetzt solltest du’s mir wohl besser erzählen.«
Ich wollte mit jemandem darüber reden, was auf Alcide Herveaux’ Farm geschehen war. Aber ich konnte Tara nicht die ganze Geschichte erzählen: die entführten Werwölfe, Jannalynns Verrat an ihrem Rudel und ihrem Leitwolf, die schrecklichen Dinge, die sie getan hatte. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie Sam sich fühlte. Er hatte nicht nur das wahre Wesen seiner Freundin kennenlernen müssen – auch wenn einiges darauf hinwies, dass er immer vermutet hatte, dass Jannalynn ein doppeltes Spiel trieb –, er musste auch mit ihrem Tod fertigwerden, der richtig grauenvoll gewesen war. Jannalynn hatte versucht, ihren Leitwolf Alcide zu ermorden, stattdessen aber Sam tödlich verwundet. Und dann hatte Mustapha Khan sie hingerichtet.
Ich machte den Mund auf, um wenigstens den Versuch zu unternehmen, die Geschichte zu erzählen, wusste aber nicht, wo ich anfangen sollte. Hilflos sah ich meine Freundin seit Kindertagen an. Sie wartete, mit einem Blick, der besagte, dass sie in meiner Küche sitzen bleiben würde, bis ich ihre Fragen beantwortet hatte. Schließlich sagte ich: »Im Wesentlichen ist es so, dass Jannalynn nun vollständig und für immer von der Bildfläche verschwunden ist und ich Sam das Leben gerettet habe. Eric hat jedoch das Gefühl, dass ich stattdessen etwas für ihn hätte tun sollen. Etwas sehr Wichtiges, das mir auch bewusst war.« Die Schlusspointe ließ ich aus.
»Dann ist Jannalynn also gar nicht in Alaska, um ihren Cousin zu besuchen.« Tara presste die Lippen aufeinander, um nicht so schockiert zu wirken, wie sie war. Aber es war auch ein Anflug von Triumph zu spüren. Sie dachte, dass sie doch gewusst hatte, dass an dieser Geschichte irgendetwas faul war.
»Nicht, wenn’s in Alaska nicht sehr viel heißer geworden ist.«
Tara kicherte; na ja, sie war auch nicht dabei gewesen. »Hat sie etwas derart Schlimmes getan? Ich hab in der Zeitung gelesen, dass sich jemand dem zuständigen Detective gegenüber am Telefon zum Mord an Kym Rowe bekannt hat und dann verschwunden ist. Ist das etwa zufällig Jannalynn gewesen?«
Ich nickte. Tara wirkte nicht schockiert. Sie wusste alles über Menschen, die schlimme Dinge taten. Zwei davon waren ihre Eltern gewesen.
»Und seitdem hast du also nicht mit Sam geredet«, stellte sie fest.
»Zuletzt am Morgen danach.« Ich hoffte, Tara würde sagen, dass sie ihn gesehen, mit ihm geredet habe, doch sie ging stattdessen zu einem Thema über, das sie interessanter fand.
»Und was ist mit dem Wikinger? Warum ist der sauer? Sein Leben musste doch nicht gerettet werden. Er ist schon tot.«
Ich hob die Hände und versuchte, die richtigen Worte zu finden. Okay, ich konnte genauso gut gleich ganz ehrlich sein, wenn nicht gar drastisch. »Es ist so … ich hatte einen Wunsch frei. Und den hätte ich zu Erics Vorteil nutzen können, um ihn aus einer schwierigen Situation zu befreien. Was seine Zukunft vollkommen verändert hätte. Doch stattdessen habe ich ihn genutzt, um Sam zu retten.« Und dann hatte ich auf das Nachspiel gewartet. Denn der Einsatz von magischen Kräften hatte immer Konsequenzen.
Tara, die richtig schlechte Erfahrungen mit Vampiren gemacht hatte, lächelte breit. Eric hatte ihr früher zwar mal das Leben gerettet, trotzdem empfand sie für ihn die gleiche generelle Abneigung wie für alle Untoten. »Hat dir etwa ein Flaschengeist drei Wünsche gewährt, oder so was?«, fragte sie und versuchte, die Freude in ihrer Stimme zu unterdrücken.
Auch wenn sie nur gescherzt hatte, eigentlich entsprach genau das so ziemlich der Wahrheit. Man ersetze »Flaschengeist« durch »Elfe« und »drei Wünsche« durch »einen Wunsch«, und schon hat man die ganze Geschichte in einem Satz. Oder in einem Cluviel Dor.
»So was Ähnliches«, erwiderte ich. »Eric hat ziemlich viel um die Ohren zurzeit. Lauter Dinge, die sein Leben komplett umkrempeln werden.« Obwohl das, was ich sagte, absolut der Wahrheit entsprach, klang es wie eine schwache Ausrede. Tara versuchte, nicht spöttisch zu lächeln.