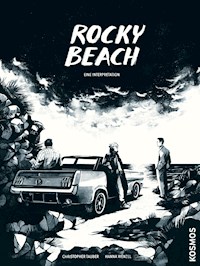11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Kids Books - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Drei außergewöhnliche Helden, die man einfach lieben muss. Soro, Emrah und Maya treffen sich zufällig beim Sankt-Martin-Laternenumzug ihrer kleinen Geschwister – für drei 13-Jährige eigentlich eine komplett langweilige Veranstaltung. Doch dieses Jahr ist alles irgendwie anders. Im Wald hängt tiefer Nebel, und sobald ihnen eine blau leuchtende Gestalt erscheint, ist klar: Hier geht was nicht mit rechten Dingen zu. Als dann auch noch eine seltsame Macht die anderen Menschen zu Zombies werden lässt, müssen die drei handeln. Auf ihrer rasanten Flucht durch den Wald sind Actionstunts, Verrückte Erfindung und Gänsehaut garantiert, und dabei müssen sie nicht nur die Welt vor der Herrschaft der Geister bewahren, sondern werden nebenbei noch waschechte Freunde.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 354
Ähnliche
Für Heidi und Manfred – meine Eltern, die dieses Buch bestimmt gerne gelesen hätten
Schnaufend stellte Kati Schürer den schweren Karton mit den Einmachgläsern ab. Gerade hatte sie den Waldweg erreicht, der sich an der großen Schwarzkiefer in den Mottenpfad und die Basaltstraße gabelte. Nicht weit entfernt war der Waldkindergarten, ihr Arbeitsplatz. Direkt gegenüber lag die Gaststätte Zur Letzten Wurst, wo die Leute ihre Autos parkten, wenn sie im Buxkopfer Forst, dem Wald, der die kleine Stadt Buxstein an der Grippe umgab, spazieren gehen wollten. Es war der elfte November, Martinstag, und Kati hatte die Aufgabe, den Wanderweg für den Umzug des Kindergartens mit Licht zu versorgen.
Sie wischte sich einmal mit dem Ärmel die triefende Nase ab und begann, die Einmachgläser am Wegrand aufzustellen. Alle zehn Schritte ein Glas, und in jedes Glas stellte sie ein elektrisches Teelicht. Es würde nicht mehr lange dauern, bis der Zug am Waldkindergarten startete, dieses Jahr folgte er zum ersten Mal einer anderen Route als in den Jahren zuvor. Ihre Kollegin Isa-Lena war dortgeblieben, um die Familien zu empfangen. Die Lichter, die Kati verteilte, würden den Anfang der Strecke beleuchten, bis zur Hagebuttenhecke, damit die Kleinen sich erst mal an die Dunkelheit im Wald gewöhnen konnten.
Mit leeren Händen spurtete Kati den Weg zurück, um die letzten Gläser und Lichter zu holen. Warum beeilte sie sich eigentlich so? War das nicht ein wenig albern? Sie war schließlich eine erwachsene Frau. Und doch fand sie es immer noch so unheimlich, alleine durch den stillen Wald zu gehen, als wäre sie wieder ein Kind. Jedes noch so kleine Geräusch, das die trügerische Ruhe unterbrach, verunsicherte sie. Hektisches Rascheln im Laub. Der gellende Schrei eines Vogels, ohne Vorwarnung, seine Bedeutung ein Rätsel. Was bewegte sich hinter den Bäumen und im Unterholz, unsichtbar für das menschliche Auge? Sie hatte Bammel. Sie schaute zurück auf den Weg, den sie bereits bestückt hatte. Weit reichte ihr Blick nicht, gerade mal die ersten drei Lichter flackerten sichtbar ihr elektrisches, batteriebetriebenes Glimmern. Zwischen den Baumreihen am Wegesrand hatte sich ein dichter Nebel ausgebreitet, langsam und schleichend, so, als wäre er darauf bedacht, dass ihn niemand bemerke. Kati schluckte trocken. Eine unnatürliche Stille hatte den Nebel begleitet und sich über den Berg Buxkopf gelegt. Der Nebel kroch den Hang herunter, tänzelte in kleinen Schwaden um ihre schweren, mit getrockneter Erde besprenkelten Gummistiefel und nahm ihr jegliche Sicht. Ihr Nacken verspannte sich. Nichts war zu hören. Nichts zu sehen.
Leise begann Kati, ein Lied zu summen, als sie, die Arme um den leeren Karton schlingend, dem Nebelschleier entgegentrat. Ein Schritt, dann blieb sie stehen und starrte in das Nichts, das hinter den Kiefern lauerte. Sie hatte ein Geräusch gehört, ein lautes Knacksen. Als wäre jemand auf einen morschen Ast getreten, nicht nah, sondern weiter bergauf, Richtung Kapellenmoor. Ein lautes, scharfes »Kracks«, widerhallend, aber nur kurz, gefolgt vom Geraschel aufgewühlten Herbstlaubs, ein Trappeln, das in Windeseile näher kam, in vollem Galopp, direkt auf sie zu. Schritte, deren hartes Aufkommen den Boden einzustampfen schienen. Kurz zeichnete sich ein massiver Schatten im Weiß des Nebels ab, dann brach er auch schon aus diesem hervor.
Kati schnappte nach Luft. Ein riesiger Keiler sprang aus dem Gebüsch, landete auf allen vieren auf dem Waldpfad, nur wenige Meter von ihr entfernt. Im gleichen Moment schien das enorme Wildschwein auch schon wieder abzuheben. Mit einem markerschütternden Quieken sprang das Tier in den Nebel. Kati schaute sich um, wonach, das war ihr nicht bewusst. Der Nebel hatte sie eingekesselt, umzingelt, war überall. Sie spitzte die Ohren und lauschte. Nichts war zu hören. Nichts war zu sehen.
Sie atmete tief durch und entspannte gerade noch ihre Schultern, als sie merkte, dass die trockenen Eicheln und kleinen Kiesel zu ihren Füßen zu tanzen anfingen. Unter den Gummisohlen ihrer Stiefel begann die Erde zu beben, und von der anderen Seite des Nebels ertönte ein Grollen, das schnell, sehr schnell anwuchs und wie eine Lawine den Berg herunter auf sie zurollte. Kati konnte gerade noch sehen, wie eine riesige, schwarze Silhouette die Nebelwand verdunkelte, dann befahl ihr ein Instinkt, sich hinter einer dicken Eiche in Sicherheit zu bringen.
Quiekend, röhrend und schnatternd stürmte eine enorme Rotte Wildschweine an ihr vorbei, pflügte das gesamte Erdreich unter ihren schweren Hufen auf, bereit, alles, was sich ihnen in den Weg stellen würde, mit ihren Hauern und sturen Köpfen zur Seite zu fegen oder in den Boden zu rammen. Kati stieß einen Schrei aus, den niemand hörte.
In dem ungebändigten Strom aus Wildschweinen ragte Rotwild empor, zwischen den grauen Körpern der Rotte sah sie Hasen springen, einen Fuchs, hier und da rannte ein Waschbär, sogar ein ausgewachsener Dachs flüchtete mit in Richtung Stadt. Ein majestätischer Hirsch mit einem beeindruckenden Geweih blieb inmitten des Stroms stehen. Er neigte seinen Kopf in Richtung der Eiche, und für einen Augenblick betrachtete er den zitternden Menschen, der ihm beinahe im Weg gestanden hätte. Seine schwarzen Augen funkelten Kati an, als würde er ihr befehlen wollen, sich den Tieren anzuschließen. Ein Uhu sauste im Tiefflug nur wenige Meter an Kati vorbei und brach die Starre zwischen dem König des Waldes und der verängstigten Kindergärtnerin. Dann setzte sich der Hirsch wieder in Bewegung, und mit ihm verschwanden nach und nach alle anderen Tiere und jedes Geräusch in der weißen Leere, die vom Wald Besitz ergriffen hatte.
Mit weichen Knien taumelte Kati zurück auf den Waldweg.
Sie versuchte, einen klaren Gedanken zu fassen, und war dankbar, als sie eines der Einmachgläser erblickte. Es lag wie zur Seite gekickt in einer Pfütze, halb bedeckt mit Schlamm. Aber das kleine Plastiklicht schimmerte weiter tapfer vor sich hin, so als wäre nichts anderes geschehen und als gäbe es nichts anderes zu tun. Dankbar beugte sich Kati zur Pfütze herunter und wischte mit einem Ärmel den Matsch vom Glas, während sie die Nase hochzog. Ihre Augen brannten. Hatte sie geweint? Hatte sie geschrien? Was war eben überhaupt passiert?
Mit dem Ärmel, der noch sauber war, wischte sich Kati über die feuchten Augen und stellte das Licht an einer passenden Stelle ab. Ziellos wanderte ihr Blick den Weg entlang. Die Tiere waren allesamt längst über alle Berge, aber sie wurde das Gefühl nicht los, dass sie immer noch nicht alleine war. Irgendetwas, das spürte sie, begleitete sie, hatte sie schon die ganze Zeit begleitet. Unschlüssig betrachtete Kati die Teelichter, drehte sich dann um und trat ihren Weg zurück zum Parkplatz an. Kleine blasse Schwaden krochen die Böschungen auf den Weg herunter, und ihr kam der unangenehme Gedanke, dass dieses Irgendetwas vielleicht der sich immer weiter ausbreitende Nebel selbst war.
Soro Bratmöller hatte keine Angst. Sie hatte keine Angst, wenn eine Klassenarbeit in Deutsch anstand, für die sie mal wieder versäumt hatte zu lernen. Sie hatte keine Angst, als sie mit Freunden zusammen heimlich den Film mit dem bösen Clown im Gulli guckte. Sie spürte keine Furcht, wenn die Eltern sie in den Keller zum Getränkeholen schickten, sie bekam keine weichen Knie, wenn die Tage kürzer und der Weg zur Schule immer dunkler wurde, und sie hatte keinen Bammel, wenn nachts seltsame Geräusche in den Wänden knackten und sie noch mal aufs Klo musste. Soro, die eigentlich Sofie Rosine hieß, war sich ziemlich sicher, dass sie noch nie in ihrem Leben Angst gehabt hatte. Schon gar nicht vor bösen Geistern. Denn um diese zu fürchten, müsste man ja logischerweise erst mal deren Existenz anerkennen, was ihr blödsinnig vorkam. Aber selbst, wenn sie sich irren würde, und Geister, Gespenster oder welcher Spuk auch immer wären tatsächlich real, dann, so dachte sie, müsste man ihnen vielleicht auch einen Vertrauensvorschuss geben und sie nicht gleich als böse brandmarken. Schließlich hatte noch niemand nachhaltig und unumstößlich das Dasein von Geistern beweisen können, wie beispielsweise das von Zebras oder Giraffen. Deshalb konnte auch niemand davon ausgehen, dass diese stets Böses im Schilde führten.
Angst hatte sie nicht, so viel stand fest. Aber Soro war genervt. Und zwar davon, heute ihr gemütlich unordentliches Zimmer verlassen und mit ihrer Familie raus in die Kälte zu müssen. Nur weil diese, so wie die meisten Familien in Buxstein auch, heute, am St.-Martins-Tag, unbedingt etwas gegen diese bösen Geister tun wollten. Die ganze Veranstaltung erschien ihr krude zusammengewürfelt. Klar, früher wollte man mit Lichtern die bösen Geister der länger werdenden Nächte des Herbsts vertreiben. Aber wie kam da der St. Martin, nach dem der Laterne-Tag schließlich benannt worden war, ins Spiel? Der war ja schließlich nun kein Ghostbuster gewesen, sondern ein ach so großzügiger, reicher Mann, der dem Bettler dann, na vielen Dank, seinen halben Umhang abgab. Wie diese Origin-Story mit der Geisteraustreiberei vereinbar sein sollte, war ihr schleierhaft und vermutlich auch nur ein Vorwand, die bockigen Kleinen an die frische Luft zu locken.
Dazu kam, dass Soro gerade dreizehn (13!) Jahre alt geworden und somit nun offiziell zu alt für so einen Kinderkram war. Theo, ihr Bruder, hingegen war dummerweise sechs und unübersehbar so was von immer noch ein Kind. Vermutlich, dachte Soro, würde er auch auf alle Zeiten eins bleiben.
Theo saß neben ihr auf der Rückbank der bratmöllerschen Familienkutsche. Wie immer vertieft in seiner eigenen Welt, schaltete er ein kleines elektrisches Teelicht an und aus und an und wieder aus, an, aus. Offene Flammen waren bei der heutigen Veranstaltung streng verboten. Wer kein eigenes E-Teelicht dabeihatte, würde vor Ort versorgt werden. Theo war versorgt. An und aus und an und aus. Sein kleiner Kopf ragte gerade so aus der hellblauen Daunenjacke hervor. Die Jacke hatte mal Soro gehört, und sie konnte sich nicht daran erinnern, dass sie darin auch wie eine falsch angemalte Schildkröte ausgesehen hatte. In der Hand hielt Theo bereits seine Laterne, die er erwartungsvoll anschaute. Soro wusste, dass ihre Eltern den Lampionumzug liebten, so wie sie sich eigentlich in alle Feste, die es zu feiern gab, über alle Maßen hineinsteigerten. Wer hatte die aufwendigste Außendeko in der Vorweihnachtszeit? Familie Bratmöller. Wer organisierte an Ostern das Große Eiersuchen, das sich über mehrere Ortschaften erstreckte und ohne GPS schier unlösbar war? Soros Eltern. Wer schickte an Halloween alle Kinder mit einem Herzinfarkt ins Krankenhaus? Graf und Gräfin Bratula. Und wer musste an St. Martin natürlich die seltsamsten und auffälligsten Lampions basteln? Na, wer wohl.
Theos Laterne sah aus wie ein mopsiger Hund, dem schlabbernd die Zunge aus der Schnauze ragte. Vermutlich sollte es auch einer sein. Theo hatte seine Laterne, im Gegensatz zu ihr, freiwillig gebastelt. Tapfer hatte sie die Bastelei zunächst verweigert, aber das hatte ihr nur traurige Blicke ihrer bastelwütigen Mutter eingebracht. Papa hatte einen Kronleuchter und Mama einen Abguss ihres eigenen Kopfes, den sie sonst für Halloween benutzte, zur Lampe-am-Stock umfunktioniert. Mama war von ihrer Kopf-Idee so begeistert, dass sie Soro geradezu bekniet hatte, ebenfalls ein Lampion-Selbstporträt zu erschaffen. Soro hatte sich zwar erweichen lassen, aber dann doch weitaus weniger Mühe gegeben als ihre Mutter. Sie hatte einfach einen hohlen Klumpen aus Küchenrolle und Kleister geformt, diesen lustlos bepinselt und ein paar Wollknäuel als Haarersatz mit der Heißklebepistole befestigt: fertig! Mama war dennoch zufrieden. Eine tolle Mutter-Tochter-Aktion, fand sie.
Als Soro selbst noch klein gewesen war, hatte sie gar nicht begriffen, dass ihre Eltern die einzigen Erwachsenen waren, die auch Lampions vor sich hertrugen, und sich nichts dabei gedacht. Irgendwann fiel ihr auf, wie seltsam das aussah, und ab da wurde ihr das Verhalten ihrer Eltern hochpeinlich. Trotzdem hatte sie brav den Pappmaschee-Ball, der ihr Gesicht darstellen sollte, fertig gepfriemelt. Aber dass sie als Mitglied der Familie auch dazu verdonnert werden würde, am Kinder-Umzug tatsächlich teilzunehmen, damit hatte sie nicht gerechnet. Alles Argumentieren, Diskutieren, Schimpfen, Meckern, Türenknallen hatte nichts geholfen – wenn Soro ihre Eltern und ihren kleinen Bruder nicht für die Zeit zwischen St. Martin und Nikolaus zu beleidigten Nahverwandten machen wollte, musste sie sich dem Zwang ihrer Herkunft beugen. Sie musste sich für einen Abend zum Affen machen und, während alle Rabimmel, rabammel, rabumm sangen, den Mund halbwegs synchron auf- und zumachen – kurz: Sie musste laternegehen. Sie hoffte nur, dass niemand aus ihrer Klasse ein kleines Geschwisterkind in der Kita hatte, damit sie möglichst unbemerkt diese Schmach über sich ergehen lassen konnte. Nicht, dass sie wirklich Angst davor gehabt hätte, von ihren Kumpels und Kumpelinen beim Umzug gesehen zu werden. Denn Angsthaben, das sagte sie sich immer wieder selbst, war einfach nichts für sie. Aber Laternegehen mit dreizehn Jahren erst recht nicht.
Diese Ansicht teilte auch Emrah Aydin, der mit seiner Familie ebenfalls auf dem Weg zum Parkplatz bei der Letzten Wurst war. Er war schon zwölf, also offensichtlich auch zu alt für ein Kindergartenfest, aber das war nicht der Grund, warum seine Stimmung im Keller war. Er fand es einfach nur grundlegend blödsinnig, dass seine Eltern ihn und seine beiden kleinen Schwestern Dilek und Hatti dorthin karrten. Sie waren erst vor zwei Monaten nach Buxstein gezogen, weil seine Mutter dort einen neuen Job angenommen hatte. Sein Vater konnte von überall aus arbeiten, dem war der Ortswechsel egal, er verließ sowieso kaum das Haus und klebte immer am Schreibtisch in seinem Arbeitszimmer fest. Die sechsjährige Dilek und Hatice, die mit acht Jahren in der Mitte hing, waren eh unzertrennlich und sich gegenseitig die besten Freundinnen. Außerdem hatten sie nie Probleme, irgendwo neue Freundschaften zu schließen. Für Emrah ein absolutes Rätsel. Schon im Kindergarten war er ein Einzelgänger gewesen, in der Schule in Hannover hatte es zwei Jahre gedauert, bis er endlich Anschluss gefunden hatte. Bei dem Gedanken an diese zwei Jahre wurde ihm immer direkt übel. Er hatte viel ertragen müssen, und warum, verstand er bis heute nicht. Kinder konnten echt grausam sein, und die Eltern hatten keinen Schimmer davon, wie viel in der Schule tatsächlich gemobbt wurde. Innerhalb von zwei Monaten an einem neuen Ort so mir nichts, dir nichts neue Freunde finden war nicht so leicht, wie sie sich das dachten. Und schon gar nicht, wenn er, anstatt mit einem der vielen Antons und Emils aus der Schule Playstation zu spielen, auf eine dumme Kindergartenparade gehen musste. Was hatten denn er oder seine Familie mit diesem heiligen St. Irgendwas am Hut? Er wusste ganz genau, dass weder seine Eltern noch seine Schwestern an böse Geister glaubten. Der Angsthase in der Familie war schließlich er. Aber auch wenn er die Existenz von Gespenstern oder übernatürlichen Wesen nicht ausschließen wollte, schien ihm die Idee, diesen mit Papierlampen und einem funzeligen Licht zu begegnen, ziemlich aussichtslos. Da mussten doch ganz andere Mittel her. Gruselige Kostüme zum Beispiel, wie an Halloween. Da blieb den wahren Monstern doch die Spucke weg. Oder die Raketen, Böller und Feuerwerke, die an Silvester abgefeuert wurden, damit die bösen Geister aus dem alten Jahr sich noch mal für ein paar Monate in ihre Zwischenwelt verkrochen. Er wusste zwar nicht, ob diese Maßnahmen wirklich etwas gegen echte dunkle Mächte aus anderen Dimensionen ausrichten konnten, aber auf der anderen Seite war er eben auch nicht darauf erpicht, herausfinden zu müssen, was da wirklich helfen würde.
Die schmale Asphaltstraße zum Waldkindergarten schlängelte sich bergauf, vorbei an kleinen Gärten und unbefestigten Wegen, die links und rechts in den düsteren Wald führten. Weißer Dunst stand zwischen den dicht stehenden Bäumen.
»Guck mal, die Wolken. So tief hab ich die noch nie gesehen«, sagte Dilek, die Nase am Fenster platt gedrückt. Ein gutes Stichwort für Baba Aydin, um seine Kinder mal wieder mit wertvollem Wissen zu desillusionieren. Doch während er begann, alles über Kondensation und Aggregatszustände zu vermitteln, zeichnete Dilek bereits Grinsegesichter in die von ihrem Atem beschlagene Scheibe. Hatice hatte ihr »Ich finde alles prima, träume aber vor mich hin«-Gesicht aufgesetzt, und Emrah, der den Wolken-Monolog seines Vaters schon vorgetragen bekommen hatte, als es die anderen beiden noch nicht mal gab, versuchte, sich in den Zeitpunkt der Rückfahrt zu teleportieren. Warum klappte das eigentlich nie? Und warum musste seine Familie seit ein paar Jahren immer auf Ausflüge bestehen, auf die er absolut keinen Bock hatte? Wenn er doch nur die kommenden Stunden überspringen könnte. Aber was kam danach? Dieser komische Raum, der sein neues Zimmer sein sollte, vollgestopft mit unausgepackten Umzugskartons? So oder so, keine Aussicht auf den Rest des Abends wollte Emmys Laune bessern.
Als sie kurze Zeit später den Parkplatz erreichten und Emrah und seine Schwestern sich von der engen Rückbank schälten, änderte er schlagartig seine Meinung. Vielleicht würde dieses Laternegehen ja doch Spaß machen? Denn zwei Parkplätze weiter, aus einem himmelblauen Kleinwagen, stieg gerade Sofie Rosine Bratmöller aus. Soro ging in die Klasse, in die er frisch gekommen war. Sie war fast einen Kopf größer als er. Wenn sie sich meldete, sagte sie die klügsten Sachen. Sie hatte die tollsten Sneaker an, die er je gesehen hatte – rote Sohlen und rote Schnürsenkel, schwarzer Stoff –, und manchmal schaute sie ihn an, und dann wurde er ziemlich nervös. Nicht blöd nervös, sondern irgendwie auf eine gute Art.
Als Soro ihn endlich gesehen hatte und mit einem verhaltenen Winken begrüßte, war für Emrah eine gefühlte Ewigkeit vergangen. Dabei war sie gerade erst aus dem bratmöllerschen Mobil gestiegen. Sie zuckte mit den Schultern, als wüsste sie auch nicht recht, warum sie hier war, warf die Tür des Autos mit einem lauten Knall zu und stapfte, eine selbst gebastelte Laterne lustlos über der Schulter, hinter ihren Eltern her. Emrah löste sich aus seiner Bewunderung, und jetzt bereute er es sehr, dass er das Basteln eines eigenen Lampions so rigoros abgelehnt hatte. Sein Vater, dem selten etwas die gute Laune verderben konnte, hatte darauf mit seinem ganz eigenen Humor reagiert. Anstatt vieler Worte hatte er einfach Emmys alten Kindergartenlampion aus einem Umzugskarton gezaubert. Das sei dann jetzt halt sein Lampion, wenn Emrah ihn nicht mehr wollte. Ein Wink mit dem Zaunpfahl an Emmy, sich daran zu erinnern, dass er vor der Geburt seiner Schwestern sehr wohl sehr gerne laternegegangen war. Ja, und jetzt stand er da – laternelos. Und dabei wäre das doch ein super Gesprächsthema, um Soro anzusprechen. Wie nervig sie es fanden, in ihrem Alter noch zum St.-Martins-Umzug gezwungen zu werden. Wie albern doch diese Lampions waren, allen voran der von Emrah, mit dieser pausbäckigen Sonne auf der einen und dem nicht minder doof aussehendem Mond auf der anderen Seite.
Seinem Baba würde er allerdings nicht die Genugtuung geben, ihn um die Rückgabe seines alten Lampions zu bitten. Aber vielleicht würde ihm Hatti ja ihren kurz leihen? Eine gute Idee! Aber nein … im nächsten Moment erschien ihm jeder seiner Gedanken wieder total albern. Als gäbe es ein Verbot, ohne Lampion eine andere Lampionträgerin anzusprechen. Wie kam er denn auf solche Gedanken? Und wo waren eigentlich seine Schwestern? Eben waren sie noch da gewesen, direkt vor ihm. Sein Blick hangelte sich durch die Menschenmasse, von einem Fremden zum nächsten. Keine Spur von Dilek. Keine Spur von Hatti. Und auch nicht von seinen Eltern. Stattdessen war er umgeben von Anoraks, Parkas, Daunenwesten, Schals und Mützen in allen Ausführungen. Unbekannte Gesichter und namenlose Stimmen lachten, plauderten und schoben sich an ihm vorbei, gaben ihm leichte Schubser im Vorbeigehen, als wäre er gar nicht da, als könnten sie durch ihn hindurchgehen. Emmy war wie versteinert. Nicht schon wieder. Wieso denn gerade jetzt? So groß war der Parkplatz doch gar nicht. Und der Weg vom Auto zum Waldkindergarten? Ein Kinderspiel – nichts im Vergleich zu damals, im Museum, als es ihm zum ersten Mal passiert war. Aber es fühlte sich genauso an. Er begann zu schwitzen, obwohl ihm immer kälter wurde. Seine Beine verloren jegliches Gefühl, und ihm schien es, als würde sich die gesamte Last der Welt auf seine Schultern setzen. Aus den wandelnden Winterklamotten um ihn herum wurden ineinanderfließende, unscharfe Farbflächen. Alles, was er hören konnte, klang dumpf. Bis auf das Lachen, das hier und da erklang. Laut, nah, durchdringend und hallend. Alle lachten. Über ihn. Er fühlte sich winzig. Unsichtbar. Vergessen. Ja, er war sich schrecklich sicher, dass ihn einfach alle vergessen hatten. So wie damals.
Aber das stimmte ja gar nicht, meldete sich zaghaft etwas Mut. Damals hatte ihn doch niemand vergessen, nur nicht gefunden. Und das nur, weil Marlon und Finn, die zwei blöden Bullys aus seiner Klasse, ihm nach dem Museumsbesuch einen falschen Treffpunkt für die Heimfahrt gesteckt hatten, als er dringend noch mal aufs Klo musste. Auf einmal stand Emrah völlig alleine an den Museumstreppen, hielt Ausschau nach Frau Brune, seiner Klassenlehrerin, und den anderen Kindern. Nachdem er niemanden entdecken konnte, wagte er sich in das Menschengetümmel, was sich vor dem Museum durch die Innenstadt drückte. Der Strom verschluckte Emrah geradezu, ließ ihn unkoordiniert in die eine und dann in die andere Richtung laufen, bis ihm klar wurde, dass er verloren gegangen war. In dem Moment war alles aus. Seine Stimme, seine Augen und seine Beine machten dicht, so sehr prasselte alles auf ihn ein, und dann fiel ihm auch noch das Atmen immer schwerer. Selbst als Frau Brune plötzlich vor ihm stand, hielt seine Ohnmacht an.
Aber wie gesagt, diesmal war es überhaupt nicht so. Es gab keinen Grund, Angst zu haben, außer die Angst vor der Angst selbst. Er musste nur losgehen, dann würde er seine Eltern finden, wenn der Boden so gnädig gewesen wäre, ihn jetzt mal loszulassen und … Emmy drehte sein linkes Bein so weit herum, als würde er es aus einem Schlammloch ziehen, verlor das Gleichgewicht und fiel in die Arme irgendeines Vaters, der ihn mit »Hoppla« auffing und wieder losließ. Emmy murmelte »Entschuldigung« und erblickte hoch über dem verknoteten Teig aus Armen, Beinen und Köpfen die vertraute Laterne. Die pausbäckige Sonne lachte ihn an, und direkt darunter sah er den Hut seines Babas, den mit der breiten Krempe. Sein Vater drehte sich um und zeigte Emmy seinen freundlichen, dicht gewachsenen schwarzen Bart. Er sah aus wie eine dunklere, aber ebenso pausbäckige Version des Laternenmondes – nur behaart. Aus der unbestimmten Masse wurden wieder Jacken und Hosen und Schuhe, und aus diesen kristallisierten sich wieder Menschen heraus. Das Gemurmel und Gekicher galt nicht ihm. Niemand hatte ihn vergessen. Alles war okay. Einmal schüttelte ihn noch ein kaltes Frösteln, dann begann er, sich zu seiner Familie durchzuquetschen. Er nahm sich fest vor, seinen Vater zu fragen, ob er ihn seinen Lampion mal tragen lassen würde. Zumindest für ein kleines bisschen.
Nach und nach waren alle Buxsteiner Kindergartenkinder eingetroffen, bald wimmelte es nur so von Zwergen und ihren Eltern, die darauf warteten, dass St. Martin hoch zu Ross erschien, um den Zug anzuführen. Es war kurz davor, dunkel zu werden, und die ersten Lampions wurden mit Lichtern bestückt. Nicht weit vom Sammelpunkt entfernt, bei der Schwarzkiefer, an der sich der Waldweg gabelt, führte eine Lichtspur aufgestellter Einmachgläser in den immer düster werdenden Wald hinein.
Etwas weiter weg, auf der Asphaltstraße zum Ausflugsparkplatz, trat ein Mädchen namens Maya Teichmann schwitzend in die Pedale ihres Fahrrads. Dieses war keinesfalls ein gewöhnliches Fahrrad, wie es die meisten Kinder hatten. Es war auch keines der Räder, die nun vermehrt die alten Leute fuhren, eins mit Elektromotor und farblich abgestimmten Fahrradpacktaschen. Ganz Buxstein war seit Kurzem voll mit ihnen, und Maya hatte oft darüber nachgedacht, ob die Omas und Opas nicht nachts heimlich E-Bike-Rennen abhielten, zum Beispiel beim alten, zugewachsenen Fußball-Platz bei Mauseck.
Zwar hatte Mayas Drahtesel auch einen eingebauten Akku, aber dieser war, wie jede der vielen anderen Besonderheiten an ihrem Bike, selbst erdacht und selbst gemacht. Auf dem orangen Rahmen prangte in neongrüner Schrift sein stolzer Name: Schnellfuß. Und der kam nicht von ungefähr. Ein Knopfdruck würde genügen, und Maya wäre, ohne sich sonderlich anzustrengen, den Berg raufgesaust. Aber damit wäre die Batterie im Nu verbraucht gewesen, und dann würde sie den Rest des Abends einen schweren Akku durch die Gegend kutschieren.
Abgesehen davon war der WAHNSINNSTURBO, der ihr eigenes Patent war, noch nicht ganz ausgereift. Er erfüllte zwar seinen Zweck der sofortigen Beschleunigung (in wahnsinniges Tempo), ließ sich aber nicht wieder ausschalten. Und mit sechzig Stundenkilometern an einem Umzug für Kleinkinder teilnehmen, wie sinnlos wäre das denn bitte? Lustig, vielleicht. Aber irgendwie auch am Ziel vorbei.
Nicht, dass sämtliche ihrer Erfindungen immer den Zweck erfüllen mussten, unheimlich viel Sinn zu ergeben. Meistens waren es einfach Ideen, die Maya irgendwie zugeflogen kamen, und wenn sie Ideen bekam, musste sie diese eben umsetzen. Niemand machte viel Aufhebens darum, schon gar nicht ihre Eltern. Weder um die Konstruktionen selbst, noch um ihre Begabung. Ja, okay, sie hatte jetzt eine Jahrgangsstufe übersprungen, auf Empfehlung der Lehrerin. Aber eigentlich war auch in der neuen Klasse alles wie immer: Der Unterricht war meistens langweilig bis einfach, und die anderen Kinder nahmen sie gar nicht wahr. Maya war schon in ihrer alten Klasse die Kleinste gewesen. Auf den Klassenfotos sah sie immer aus, als hätte sie sich mit ins Bild gemogelt. Komisch eigentlich, dass sie niemand deswegen ärgerte. Aber wenn Maya ehrlich war, könnte es auch sein, dass sie es einfach nicht mitbekam, weil sie gerade von einer neuen Idee heimgesucht worden war.
Die letzte dieser Ideen war ihr gekommen, als der Kalender sich St. Martin näherte. Es hatte ein paar Tage gedauert, das gesamte Material zu sammeln. Aber nun baumelte das Ergebnis klirrend an einem dicken Stab aus Holz, den sie eingeklemmt zwischen Lenker und ihrer linken Hand hielt. Maya musste sich zusammenreißen, nicht vom Weg abzukommen, ihre Augen wanderten immer wieder zu ihrem Mega-Lampion, den sie zu 99 Prozent aus Licht bündelnden Linsen von alten Foto-Apparaten, Lupen, Fernrohren und Monokeln gebastelt hatte. Ihre Erfindung erschien ihr wunderschön und war der einzige Antrieb, an St. Martin überhaupt teilzunehmen. Ihre Eltern hatten das wie immer nicht geschnallt. Für sie war klar, dass Maya immer noch Kind sein wollte, und hatten deshalb nichts dagegen. Sich selbst fanden sie aber schon zu alt dafür und blieben lieber daheim. Maya war sich in solchen Momenten nicht sicher, ob sich ihre Eltern irgendwie für sie schämten oder ob sie Angst hatten, dass sie ihrer Tochter peinlich waren. Im nächsten Moment spielte das alles aber schon wieder überhaupt keine Rolle für Maya, denn wie sie bei ihrer Umwelt ankam, war ihr herzlich schnuppe. Klar, sie mochte ihre Eltern. Aber in ihrem Kopf war zu viel spannender Kram los, als dass sie Lust oder überhaupt die Zeit hatte, sich mit den Gedanken anderer zu beschäftigen.
Die wichtigste Fähigkeit und Aufgabe einer Erzieherin, da war sich Isa-Lena Väth sicher, war das Durchzählen. Um sich dabei nicht aus der Ruhe und dem richtigen Zählstand bringen zu lassen, gab es verschiedene Methoden und Tricks. Isa-Lena beherrschte sie alle und konnte einige sogar gleichzeitig anwenden, sodass sie stets das korrekte Ergebnis erzielte. Trotz dem Gewirr aus quengelnden Vätern, frierenden Müttern und quietschenden Kindern beendete sie gerade ihre dritte Durchzählung und musste leider wieder feststellen, dass eines der angemeldeten Kinder immer noch fehlte. Gleichzeitig verteilte sie weitere LED-Kerzen und sackte die nicht der Vorschrift entsprechenden Teelichter ein. Vorbei die Zeiten der in Flammen aufgehenden Lampions, der schnell erlöschenden Lichter und des damit einhergehenden Geheules der lieben Kleinen. Das war gut so. Weniger gut war, dass neben dem trödelnden Nachzügler-Kind auch ihre Kollegin Kati Schürer wie vom Erdboden verschluckt war. Diese war schon vor einer halben Ewigkeit vorgegangen, um im Wald die Weglichter in den Einmachgläsern aufzustellen. Eigentlich sollte sie nun hier sein und ihr dabei helfen, die Eltern über die neue Route für den diesjährigen Umzug zu informieren. Der Grund dafür war das vermehrte Auftauchen von Waldtieren im Ort. Deshalb hatte der Bürgermeister eine Treibjagd angesetzt, welche die Tiere wieder zurück in den Forst scheuchen sollte. Unzählige Gärten waren von Wildschweinen, Rehen, Hirschen und anderen Bewohnern des Waldes verwüstet worden. Von den alten Häusern am Berghang über die Buxsteiner Altstadt bis hin ins Tal, wo die Grippe floss, hatte man Wild gesichtet. Sogar einen Wolf wollten einige gesehen haben, woran nicht nur Isa-Lena enorme Zweifel hatte. Vermutlich hatte es sich bloß um Rudi, den Irischen Wolfshund von Ravi dem Buchhändler, gehandelt. Dieser ging gerne mal alleine spazieren, und eigentlich war das ja stadtbekannt.
Seltsam war das Aufkommen der Tiere dennoch, und so würde die heutige Wanderung eben die Runde um den Löschteich drehen und dann an der Schrebergartenkolonie West vorbei runter in die Altstadt traben, anstatt wie sonst den Berg hinauf. Die Treibjagd würde Teile der traditionellen St.-Martins-Route betreffen, allen voran das Kapellen-Moor, wo der Zug immer mit einem großen Feuer abschloss. Aufmerksamen Lesern des Buxsteiner Tageblatts war dies sicherlich bekannt, aber Eltern wollten eben immer noch mal extra abgeholt werden. Ohne Kati blieb eben mal wieder alles an Isa-Lena hängen.
Es half nichts, der Zug musste bald losgehen, eigentlich schon jetzt, eigentlich schon längst vorhin. Und wo steckte eigentlich ihr St. Martin?
Sie fand ihn im Bauwagen des Waldkindergartens, die Backen voll mit einem Schinkenbrot, während Krümel auf seine Römer-Uniform rieselten.
»Geht’s los?«, fragte Tommy Caruso schmatzend und nach dem Helm mit dem roten Federkamm greifend. Tommy war kein schlechter St. Martin, aber das dritte Jahr in Folge war ihm die Rolle wohl zu Kopf gestiegen. Er bestand darauf, bis zu Beginn des Umzugs »backstage« zu warten. »Für ’nen maximalen Auftritt«, wie er Isa-Lena erneut erklärte, während sie gemeinsam aus dem Wagen traten. Dass der eigentliche Star des Abends für die Kinder unumstritten das Pferd Juliane war, welches bereits mit Möhren und Äpfeln und Streicheleinheiten der Kinder verwöhnt wurde, konnte oder wollte Tommy wohl nicht verstehen.
»Mach du deins, ich mach meins«, mehr fiel ihr dazu nicht ein. Sie konnte sich ja schließlich nicht um alles kümmern. Und während Tommy Helm und Umhang zurechtzupfte und den Rest des Sandwichs runterschluckte, begann sie, ein letztes Mal durchzuzählen. Dabei wendete sie diesmal die Klick-klack-Methode an, die ziemlich langweilig zu erklären ist, aber hervorragend und unfehlbar funktionierte. Eigentlich hätte sie auch nur nach der fehlenden Teilnehmerin Ausschau halten müssen, die, just in diesem Moment, ächzend ihr seltsames Rad mit dem noch seltsameren Lampion in das Gemenge schob.
Der plötzlich ausbrechende Jubel unter den Kindern irritierte Emmy kurz, dann sah auch er den kostümierten Mann hoch zu Ross. Der St.-Martin-Typ ließ sein Pferd einen kleinen Tanz auf der Stelle aufführen, während sich die wichtigtuerische Kindergärtnerin, die hier wohl alles organisierte, zwischen Emmy und seinen Schwestern durchschob. Besonders fielen Emmy ihre Finger auf, die seltsam zuckten, als würden sie auf eine Tastatur einhämmern. Vermutlich ging jetzt das Laternegehen los, denn alle Kinder und ihre Eltern fingen gleichzeitig an zu krähen: »Sankt Martin, Sahaankt Maartin, Sahankt Maaaartin …« Emrah machte sich keine Sorgen, dass ihm der Text über den heiligen Kerl gerade nicht einfallen wollte, er hatte eh nicht vor, mitzusingen. Im Gegensatz zu seinen beiden Schwestern. Dilek und Hatti schmetterten aus vollem Hals. Zwar sangen beide völlig andere Lieder und beide auf Türkisch, aber dafür mit umso mehr Begeisterung. Manchmal waren die kleinen so bekloppt, dass es Emmy einfach nur herrlich finden konnte. Kein schlechter Moment, um mit einem überzeugenden Lächeln seinen Eltern etwas Bestätigung zu signalisieren, dass der Ausflug doch keine so blöde Idee war. Wenn es sich jetzt noch ergeben sollte, dass er ein paar Sätze mit Soro wechseln konnte, umso besser. Vielleicht war das doch keine so vollkommen blöde Idee gewesen, hier mitzulaufen. Oder ihm war einfach die frische Luft zu Kopf gestiegen. Für seinen Vater kam es durchaus unvermittelt, dass sein zuletzt noch maulender Sohn ihm nun einfach die Sonne-Mond-Laterne aus der Hand schnappte.
»Die gehört ja schließlich mir«, murmelte Emrah. Ömer Aydin verkniff sich jeglichen Kommentar darüber, wie niedlich er seinen Sohn in dem Augenblick fand. Er war ein kluger Vater, der wusste, dass Zwölfjährige das gar nicht gerne hörten.
Der ganze Tross setzte sich in Bewegung, es ging endlich los. Emrah überlegte, wie er jetzt ein paar Reihen aufholen könnte, um ganz locker und möglichst beiläufig neben Soro zu laufen, da überholte ihn von hinten ein anderes Mädchen aus seiner Klasse. Bis eben war ihm gar nicht aufgefallen, dass die merkwürdige Maya auch anwesend war. Als Emmy sah, wie sich Maya neben Soro einreihte, verwarf er geknickt seinen tollkühnen Plan, Soro an diesem Abend privat, also außerhalb der Schule, kennenzulernen. Doch ein Blick auf Mayas Laterne, die wie ein gläserner Fußball aussah, und die gruseligen Pappmaschee-Köpfe von Soro und ihrer Mutter sowie den Kronleuchter-am-Stab von Herrn Bratmöller ließen seine Gedanken nicht allzu düster werden. Denn da in diesem Kaff offensichtlich jeder ein Rad ab hatte, würden er und seine Familie vielleicht doch ganz gut nach Buxstein passen.
Der Weg in den Wald war breit genug, dass der große Tross aus Kindern und Eltern sich in lockeren Dreierreihen verteilen konnte. Und da auch hier und da für eine vierte Person Platz war, konnte Maya ganz selbstverständlich neben Soro herschreiten. Sie hatte gar nicht damit gerechnet, jemanden zu treffen, den sie kannte, und wäre damit auch einverstanden gewesen. Maya sah sich durchaus als Einzelgängerin, kein Problem. Aber da sie in derselben Straße wie Soro wohnte, wäre es irgendwie seltsam gewesen, sie zu ignorieren. Oder vielleicht auch nicht, denn Soro erschrak regelrecht, als Maya sie von der Seite ansprach.
»Letztes Jahr habe ich gar nicht mitgemacht, aber dann kam mir neulich die Idee mit der Licht bündelnden Laterne, und na ja, ich hätte die auch alleine ausprobieren können, alle Rollos runter zu Hause oder warten, bis Neumond ist, und dann im Garten, aber im dunklen Wald ist doch allemal besser, oder?«
»Hey, Maya«, Soros Stimme überschlug sich bei der Begrüßung regelrecht. Maya war wie aus dem Nichts neben ihr aufgetaucht und hatte ihr tatsächlich einen kleinen Schreck eingejagt. »Redest du von dem Dings da aus Glas?« Maya nickte.
»Cool«, gab Soro zu, auch wenn sie keine Ahnung hatte, was Maya da zusammengebappt hatte, geschweige denn, was sie damit wollte. Dass Maya ohne die Begleitung ihrer Eltern wie aus heiterem Himmel irgendwo auftauchte, war hingegen absolut nichts Ungewöhnliches.
»Bist du das?«, fragte Maya unverblümt und geradeaus, den Blick auf Soros Pappmaschee-Kopf geheftet.
»Wonach sieht’s denn aus?«, Soro seufzte. Sie hatte geahnt, dass die bratmöllerschen Lampions Gesprächsstoff werden würden, aber gehofft, dass man sie damit in Ruhe lassen und das große Tamtam darüber mit ihren Eltern verhandelt würde. Aber in der Tat, die Frage musste gestattet sein. Wonach sah dieser Klumpen eigentlich aus?
»Muss ich drüber nachdenken«, gab Maya zurück, »aber ich kann dir schon mal sagen, nicht wirklich nach dir. Oder vielleicht doch, wenn man sich eine Nase dazudenkt und sich vorstellt, dass du wirklich schlecht geschlafen hast und gerade aufgestanden bist.«
»Japp. Erfasst«, antwortete Soro, erstaunt darüber, dass Maya sich mehr mit ihrem hingeklatschten Kunstwerk auseinandersetzte als sie selbst. Vielleicht tat es ihr gerade doch leid, sich so gar keine Mühe gegeben zu haben. Wer weiß, was eine Nase da noch so hätte rausholen können.
»Die Lampions von deinen Alten sind auch super«, stellte Maya fest, während Soro sich sehr über das »auch« wunderte. »Ich glaube, das wird ein gutes St. Martin. Es ist vielleicht nicht dunkel genug, auf Grund des Vollmonds, aber dafür haben wir richtigen Nebel. Ich würde sagen, drei von fünf Sternen.«
»Maya, du bist die einzige Person, die ich kenne, die St.-Martins-Umzüge bewertet«, Soro war gleichzeitig irritiert und amüsiert. Diesen Effekt hatte Mayas Art eigentlich immer auf sie, meistens dann, wenn sie völlig grundlos das Thema wechselte. So wie jetzt.
»Für Lodenmäntel wäre es mir ja jetzt noch zu warm, muss ich sagen. Aber die stehen mir sowieso nicht, schätze ich mal. Habe ich zwar noch nie ausprobiert, so was zu tragen, aber man soll ja niemals Nie sagen, nicht wahr?«
Soro versuchte, Mayas Gedankensprung zu folgen und gleichzeitig ihren eigenen Faden nicht zu verlieren. Bevor Maya sie überfallen hatte, war sie tief in Gedanken versunken gewesen, um dabei die perfekten Worte zu finden, die sie ihren Eltern auftischen würde, um sich eine Erlaubnis zum Ausscheren zu sichern. Ihr Ziel war das alte Basaltwerk, das abseits der Route lag. Dort waren heute Eddie und Lara, Soros beste Freundinnen. Und die hatten einen guten Grund, nachts den Wald aufzusuchen. Nicht gegen böse Geister, sondern gegen böse Jäger wollten sie etwas unternehmen, nämlich gegen die Jäger, die wegen der Treibjagd im Wald unterwegs waren. Gemeinsam mit einem Haufen anderer Mitschüler. Was genau sie unternehmen wollten, das wusste Soro nicht. Eddie hatte ihr lediglich eine kryptische Nachricht geschrieben. »Basaltwerk tonight! Wird wild! Kindergarten war gestern. Du kommst – Ende!«
Bei genauerer Betrachtung könnte es sich auch schlicht um eine Party handeln. So ganz hatte sie das nicht verstanden, aber es war schwer anzunehmen, dass auch George mit dabei war. Was auch immer es genau werden würde, es klang nach einem wesentlich besseren Ort für eine Dreizehnjährige als der Marsch des Kindergartens.
»Dabei weiß ich gar nicht, ob Lodenklamotten so warm halten oder einfach nur schwer sind. Oder schwer aussehen. Aber für irgendwas müssen sie ja gut sein, denn schön finde ich sie nicht. Obwohl die Karlotta, also der steht das schon, aber vielleicht auch nur, weil sie meistens so was Altmodisches trägt. Na ja, und Josef, der sieht eh aus wie sein eigener Opa in Klein.«
Jetzt fiel bei Soro der Groschen. »Du meinst die Walchs?« Natürlich meinte Maya die Walchs, die Zwillinge vom Bauernhof bei St. Trampolin. Karlotta und Josef. Die kannte in Buxstein jeder. Die beiden wirkten wie die bayerische Version dieser Gruselzwillinge aus dem Film mit dem Hotel, wo der Fahrstuhl voller Blut ist und über den hässlichen Teppich suppt. Man sah sie nie mit anderen Kindern reden, geschweige denn spielen. Aber jeder im Ort erzählte die schauerlichsten Geschichten über sie. Dass sie sich beispielsweise telepathisch miteinander unterhalten konnten und deswegen so wortkarg waren. Oder dass sie von all ihren Lehrern kleine Holzfiguren geschnitzt hatten, mit denen sie völlige Kontrolle über sie besaßen. Was ihre guten Noten erklären würde. Und dann hatte Kai aus der Neunten Soro erst kürzlich diese absolut verrückte Geschichte über Stella Dietz erzählt …
Diese absolut verrückte Geschichte über Stella Dietz
as war im letzten Winter passiert, als Stella bei einer Freundin, die am anderen Ende des Orts wohnt, die Zeit vergessen hat. Die beiden wollten gemeinsam Videos für ihren YouTube-Channel drehen (aus dem wurde dann aber nichts, weil die beiden, Stella und Camille, sich noch im Frühling miteinander verstritten hatten, aber das ist ja eigentlich auch egal), und plötzlich war es draußen schon dunkel. Stella hat daraufhin den Heimweg über den Stadtrand angetreten, das ging angeblich schneller. Auf halber Strecke löste sich einer ihrer Schnürsenkel, und als Stella sich hinkniete, um den Schuh zu binden, hörte sie Schritte über den Kies huschen. Alarmiert drehte sie sich um. Im funzeligen Licht der Straßenlaternen kniff sie die Augen zusammen, um in der Dunkelheit etwas zu erkennen. Der Kiesweg war menschenleer. Da war nichts und niemand. Sicher nur ihre hervorragende Einbildung, redete Stella sich selbst ein, und setzte ihren Weg fort.
Total vernünftige Erklärung, aber so richtig überzeugt war Stella dann doch nicht. Ein paar Meter weiter blieb sie stehen und lauschte. Und tatsächlich: Wieder hörte sie scharrende Geräusche im Kies. Sie drehte sich blitzschnell um und sah: Nichts!
Das Herz hat ihr bis zum Scheitel geschlagen, wirklich! Entschlossen setzte sie ihren Weg fort und warf nach wenigen Schritten einen weiteren, schnellen Blick über ihre Schulter.
Da!
Diesmal konnte sie die Ursache der unheimlichen Schritte ausmachen. Zwei schwarze Katzen! Erschrocken, dass Stella sie entdeckt hatte, flitzten die Katzen ab in die Hecken am Wegrand. Stella war ziemlich erleichtert, hat erst mal kräftig durchgeatmet. Aber dann wurde ihr klar, was sie da verfolgte. Sie musste an alle möglichen Sagen und Legenden denken, bei denen schwarze Katzen nie ein gutes Zeichen sind. Vielleicht wollten die Miezen ihre Seele klauen oder so was. Egal. Sie hatte nun wohl ordentlich Schiss. Und was macht man, wenn man Schiss hat? Logo, man sendet einen Hilferuf aus. Am besten an die ganze Community. Mit einem spontanen Livestream!
Stella holte also ihr Handy aus der Hoodie-Tasche und filmte sich selbst: »Hallo, ich bin hier am Stadtrand von Buxstein und werde von zwei schwarzen Katzen verfolgt, kann mal jemand googeln, ob das der Teufel ist, oder so was, ich muss zusehen, dass ich hier schnell wegkomme.«
Und dann geschah es:
Ein gutes Stück hinter ihr begann es, wieder zu rascheln, diesmal aus den Brombeersträuchern, die entlang des schmalen Wegs wachsen. Im Selfie-Modus sah Stella, wie zwei Gestalten aus dem Gestrüpp hervorsprangen. Keine Katzen, sondern zwei Kinder. Zwei Kinder mit ungewöhnlich alten Gesichtern für ihre knappe Statur. Sie schienen zu lächeln, aber nicht so auf die freundliche Art, und ihre Augen glühten grün. Im nächsten Moment rannten sie auf sie zu, ihre Arme hingen dabei an ihren Körpern wie leblose Würste, schlackerten an ihren Körpern wie Tentakel, und Stella stieß einen lauten Schrei aus und sprintete los. So gut das eben mit Flipflops geht. Also gar nicht.
Wer den Livestream verfolgte (und das war leider nur Camille, die die Geschichte als Einzige für wahr beschwört), sah in diesem Augenblick in rascher Abfolge Kiesweg, Nachthimmel und dann die nach dem Handy tastende Hand von Stella. Ächzend rappelte die sich auf, nachdem sie aus den eigenen Sandalen gestolpert war. Ihr verwirrtes Gesicht füllte den ganzen Screen, und noch bevor sie sich panisch nach ihren dämonischen Angreifern umgucken konnte, erschienen von links und von rechts jeweils eine schwarze Katze, die ihr schnurrend das Gesicht abschleckten. Danach, so Camille, war die Übertragung beendet. Stella war da bereits, nach eigenen Angaben, ohnmächtig geworden.
Andere, die behaupten, das Video gesehen zu haben, erzählen die Geschichte so, dass nicht die Katzen, sondern die Monsterkinder der Stella das Gesicht abschleckten und man seither nie wieder was von ihr gehört oder gesehen hatte. Das stimmt auch, zumindest was ihren YouTube-Kanal angeht. Denn seither hat Stella den Account gelöscht, weil ihre Eltern ihr das eh nicht erlaubt hatten. Manche behaupten, eine Kopie des Videos würde durch das Darknet geistern, aber das ist genauso ein Käse wie Stellas angebliches Verschwinden. Fest steht nur, dass sie und Camille seit Anfang des Jahres keine Freundinnen mehr sind. Und damit hatten die Walchs nun wirklich gar nichts zu tun. Wie schon gesagt, die Walchs waren ein gefundenes Fressen für gruselige Geschichten, aber Soro glaubte keine einzige davon.
»Ich glaube keine einzige der fiesen Geschichten über die Walchs«, stellte Maya fest und schob stoisch ihr Fahrrad. Im Gegensatz zu den Zwillingen war es Maya, die Soro manchmal unheimlich vorkam. Es war nicht das erste Mal, dass sie etwas aussprach, was Soro wenige Sekunden zuvor selbst gedacht hatte.
»Ich war ja in ihrer Klasse, bis letztes Jahr. Aber da waren sie eigentlich immer nett. Meistens still. Gesagt haben sie nicht viel. Komisch, manche Menschen reden vermutlich einfach nicht gern. So wie der Neue in deiner Klasse. Also, der andere Neue. Ich bin ja auch neu. Aber wir kennen uns ja. Kennst du den Neuen?«
»Emrah?«, klar kannte Soro den. Er guckte sie ja ständig so fragend an, als wollte er von ihr wissen, warum Wasser nass ist. »Och jo. Sind grad hergezogen, nicht?«