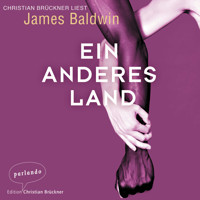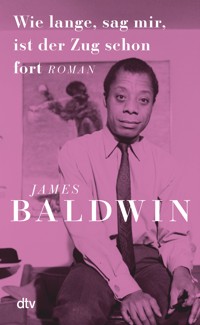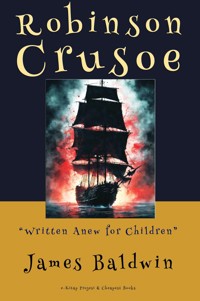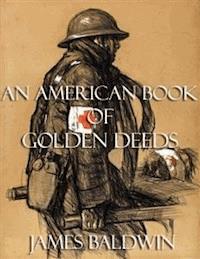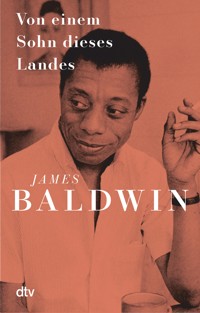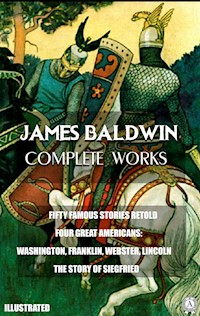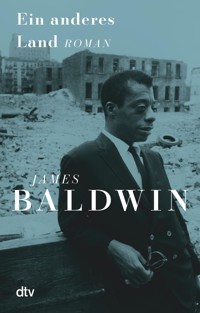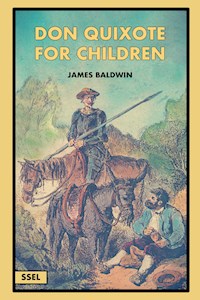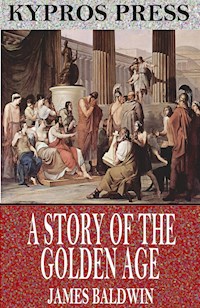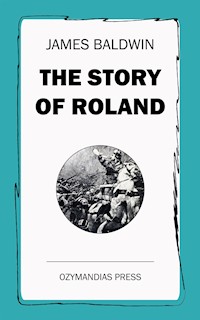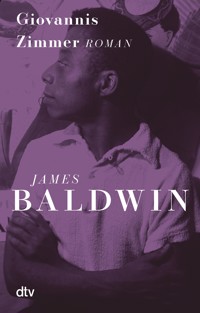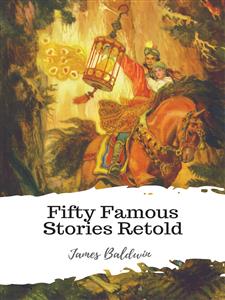10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Harlem Love Story: eine junge Liebe gegen die Willkür einer weißen Justiz »Jeder in Amerika geborene Schwarze ist in der Beale Street geboren. Die Beale Street ist unser Erbe. Dieser Roman handelt von der Unmöglichkeit und von der Möglichkeit, von der absoluten Notwendigkeit, diesem Erbe Ausdruck zu geben. Die Beale Street ist eine laute Straße. Es bleibt dem Leser überlassen, aus dem Schlagen der Trommeln den Sinn herauszuhören.« James Baldwin Dies ist die Geschichte von Tish und Fonny, 19 und 22, und ihrem Kampf gegen die Willkür einer weißen Justiz. Der traurig-schöne Song einer jungen Liebe, voller Wut und doch voller Hoffnung. Ist das Gefängnissystem die Fortsetzung der Sklaverei unter anderen Vorzeichen? Beale Street Blues von James Baldwin strahlt grell in unsere Gegenwart.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 283
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Über das Buch
Tish und Fonny, sie kämpfen und sie verlieben sich im Harlem der Siebzigerjahre. Ihren Familien setzen sie trotzige Hoffnung entgegen, Tish ist schwanger, die Zukunft scheint groß. Doch dann wird Fonny der Vergewaltigung einer jungen Frau beschuldigt und inhaftiert. Und Tish unternimmt alles Menschenmögliche, um Fonnys Unschuld zu beweisen, bevor das Kind zur Welt kommt.
Von James Baldwin ist bei dtv außerdem lieferbar:
Von dieser Welt
Nach der Flut das Feuer
Giovannis Zimmer
Ein anderes Land
Von einem Sohn dieses Landes
James Baldwin
Beale Street Blues
Roman
Aus dem Englischenvon Miriam Mandelkow
Mit einem Nachwortvon Daniel Schreiber
Beale Street Blues
VORBEMERKUNG
Die Beale Street ist eine Straße in New Orleans, wo mein Vater, wo Louis Armstrong und der Jazz geboren wurden.
Jeder in Amerika geborene Schwarze ist in der Beale Street, ist im Schwarzenviertel irgendeiner amerikanischen Stadt geboren, ob in Jackson, Mississippi, oder in Harlem in New York: Alle »Nigger« stammen aus der Beale Street. Die Beale Street ist unser Erbe. Dieser Roman handelt von der Unmöglichkeit und von der Möglichkeit, von der absoluten Notwendigkeit, diesem Erbe Ausdruck zu geben.
Die Beale Street ist eine laute Straße. Es bleibt dem Leser überlassen, aus dem Schlagen der Trommeln den Sinn herauszuhören.
Für Yoran
Mary, Mary,
What you going to name
That pretty little baby?
EINS
Troubled about my soul
Ich betrachte mich im Spiegel. Ich bin auf den Namen Clementine getauft, insofern wäre es logisch, wenn die Leute mich Clem nennen würden oder eben Clementine, immerhin heiße ich so: Tun sie aber nicht. Die Leute nennen mich Tish. Wahrscheinlich auch wieder logisch. Ich bin müde, und so langsam finde ich irgendwie alles, was passiert, logisch. Wieso sollte es sonst passieren? Aber so darf man echt nicht denken, so einen Gedanken kann man nur haben, wenn man in Schwierigkeiten steckt – völlig unlogischen Schwierigkeiten.
Heute war ich bei Fonny. Der heißt auch nicht so, getauft ist er auf den Namen Alonzo: Und logisch wäre zum Beispiel, wenn die Leute ihn Lonnie nennen würden, aber wir haben ihn schon immer Fonny genannt. Alonzo Hunt, so heißt er. Ich kenne ihn schon mein ganzes Leben und werde ihn hoffentlich immer kennen. Alonzo nenne ich ihn nur, wenn ich ihm was richtig Heftiges sagen muss.
»Alonzo …?«, hab ich heute gesagt.
Und da guckt er mich an, so alarmiert, wie er immer guckt, wenn ich ihn mit seinem richtigen Namen anspreche.
Fonny ist im Gefängnis. Wenn wir uns sehen, sitze ich auf einer Bank vor einem Brett, und er sitzt auf einer Bank vor einem Brett. Wir sitzen uns gegenüber, und zwischen uns ist eine Glaswand. Durch die hört man nichts, darum hat jeder auf seiner Seite ein kleines Telefon. Da muss man reinsprechen. Ich weiß nicht, wieso Menschen beim Telefonieren immer nach unten gucken, aber das ist so. Man muss richtig dran denken, die Person anzugucken, mit der man spricht.
Ich denke jetzt immer dran, weil Fonny im Gefängnis sitzt und ich seine Augen liebe und bei jedem Besuch Angst habe, ihn nie wiederzusehen. Sobald ich ankomme, nehme ich also das Telefon und halte es fest und sehe ihn die ganze Zeit an.
Als ich »Alonzo …« sagte, blickte er erst nach unten und dann hoch, und er sah mich an, und er lächelte und wartete mit dem Telefon in der Hand.
Ich wünsche echt niemandem, dass er den, den er liebt, durch eine Scheibe angucken muss.
Es ist nicht so rausgekommen, wie ich es geplant hatte. Ich hatte geplant, es ganz lässig zu sagen, damit es gar nicht erst so klingt, als wenn ich ihm irgendwas vorwerfe.
Es ist nämlich so: Ich kenne ihn einfach. Er ist sehr stolz, und er macht sich dauernd Sorgen, und genau genommen – im Gegensatz zu ihm weiß ich das – ist das auch der Hauptgrund dafür, dass er im Gefängnis sitzt. Er macht sich ja so schon zu viele Sorgen, da will ich nicht, dass er sich noch um mich Sorgen macht. Eigentlich wollte ich gar nichts sagen, aber es musste sein. Er muss ja Bescheid wissen.
Außerdem dachte ich, später, wenn er sich keine Sorgen mehr macht, wenn er wach liegt in der Nacht, wenn er ganz alleine ist, ganz, ganz tief drinnen, wenn er noch mal drüber nachdenkt, ist er vielleicht froh. Und das könnte ihm helfen.
Ich sagte: »Alonzo, wir kriegen ein Kind.«
Ich sah ihn an. Ich lächelte, das weiß ich. Er sah aus, als wenn er ins Wasser stürzt. Ich konnte ihn nicht anfassen. Ich wollte ihn so gerne anfassen. Ich lächelte wieder, und meine Telefonhand wurde feucht, und einen Moment lang konnte ich ihn gar nicht sehen, ich schüttelte den Kopf, mein Gesicht war nass, und ich sagte: »Ich freu mich. Ich freu mich. Mach dir keine Sorgen. Ich freu mich.«
Aber er war jetzt ewig weit weg von mir, ganz für sich. Ich wartete darauf, dass er zurückkommt. Über sein Gesicht zuckte es: Mein Kind? Ich weiß, dass er das dachte. Nicht so, als wenn er mir nicht traut: Aber Männer denken so. Und die paar Sekunden, die er da draußen für sich war, weit weg von mir, war nur das Kind wirklich, als Einziges auf der Welt, wirklicher als das Gefängnis, wirklicher als ich.
Eins habe ich vergessen zu sagen: Wir sind nicht verheiratet. Ihm ist das wichtiger als mir, aber verstehen tu ich ihn schon. Wir wollten heiraten, aber dann ist er im Knast gelandet.
Fonny ist zweiundzwanzig. Ich bin neunzehn.
Er stellte die alberne Frage: »Bist du sicher?«
»Nein, bin ich nicht. Ich will dich nur ein bisschen durcheinanderbringen.«
Da grinste er. Er grinste, weil es jetzt durchgesickert war.
»Was machen wir denn jetzt?«, fragte er mich – wie ein kleiner Junge.
»Na ja, ertränken werden wir es nicht. Also müssen wir es wohl aufziehen.«
Fonny warf den Kopf zurück und lachte, er lachte, bis ihm die Tränen übers Gesicht liefen. Der erste Teil, vor dem ich mich so gefürchtet hatte, war also wohl schon mal ganz gut gelaufen.
»Hast du es Frank schon erzählt?«, fragte er. Frank ist sein Vater.
»Nein.«
»Deiner Familie?«
»Noch nicht. Aber keine Sorge. Dir wollte ich es halt nur zuerst erzählen.«
»Na ja«, sagte er. »Irgendwie logisch. Ein Kind.« Er sah mich an, dann senkte er den Kopf. »Aber im Ernst, was machst du denn jetzt?«
»Ich mach einfach so weiter wie bisher. Bis zum letzten Monat arbeiten, und dann kümmern sich Mama und Sis um mich, da musst du dir keine Sorgen machen. Außerdem haben wir dich bis dahin hier rausgeholt.«
»Sicher?« Sein kleines Lächeln.
»Klar bin ich mir sicher. Immer.«
Ich weiß, was er dachte, aber darüber darf ich in so einem Moment nicht nachdenken – nicht, solange ich ihn vor mir sehe. Da muss ich mir sicher sein.
Ein Mann stellte sich hinter Fonny, die Zeit war um. Fonny lächelte und hob wie immer die Faust, ich hob meine, und er stand auf. Irgendwie überrascht mich hier drinnen immer wieder, wie groß er ist. Wobei er abgenommen hat, dadurch wirkt er vielleicht noch größer.
Er drehte sich um und ging durch die Tür, und die Tür ging hinter ihm zu.
Mir war schwindlig. Ich hatte den Tag über kaum gegessen, und es war spät geworden.
Ich ging raus, durch die großen breiten Flure, die ich inzwischen so hasse, Flure breiter als die Sahara. Die Sahara ist nie leer, diese Flure sind nie leer. Wenn man beim Durchqueren der Sahara hinfällt, kreisen irgendwann Geier über dir, sie riechen deinen Tod, sie spüren ihn. Immer tiefer kreisen sie: Sie warten. Sie wissen Bescheid. Sie wissen genau, wann das Fleisch so weit ist, wann der Geist sich nicht mehr wehren kann. Die Armen durchqueren ständig die Sahara, und die Anwälte und Kautionsagenten und das ganze Pack kreisen um die Armen wie die Geier. Eigentlich sind sie gar nicht reicher als die Armen, darum sind sie ja Geier geworden, Plünderer, unanständige Müllmänner, und dazu zähle ich auch die schwarzen Typen, die zum Teil sogar noch schlimmer sind. Ich persönlich würde mich schämen, glaube ich. Oder auch nicht, so sicher bin ich mir nicht mehr. Keine Ahnung, was ich alles anstellen würde, um Fonny rauszuholen. Hier im Knast hab ich nie Scham erlebt außer bei mir, außer bei den schwarzen Ladies, die so hart arbeiten und die mich Tochter nennen, oder bei den stolzen Puerto Ricanerinnen, die überhaupt gar nichts mehr kapieren – zum Beispiel spricht hier nie einer Spanisch mit ihnen. Die schämen sich, weil ihre Lieben im Knast sitzen, aber dafür sollten sie sich nicht schämen. Die Leute, die für diese Gefängnisse verantwortlich sind, die sollten sich schämen.
Und ich schäme mich nicht für Fonny. Wenn überhaupt, dann bin ich stolz auf ihn. Er ist ein Mann. Das merkt man an der Art, wie er mit dieser ganzen Scheiße umgeht. Angst hab ich allerdings schon manchmal – keiner hält die Scheiße, mit der sie uns bewerfen, ewig aus. Aber dann muss man innerlich den Schalter so umlegen, dass man durchkommt, von einem Tag zum nächsten. Wenn man zu weit vorausdenkt, wenn man auch nur versucht, zu weit vorauszudenken, dann schafft man es nie.
Manchmal nehme ich die Subway nach Hause, manchmal den Bus. Heute bin ich mit dem Bus gefahren, weil er länger braucht und weil mir so viel im Kopf rumging.
Wenn man in Schwierigkeiten steckt, kann einen das ganz komisch durcheinanderbringen. Ich weiß nicht genau, ob ich das erklären kann. Es gibt Tage, da scheint es so, als wenn man Leuten zuhört und mit ihnen redet und seine Arbeit macht, jedenfalls wird die Arbeit fertig, aber in Wahrheit hat man keine Menschenseele gehört oder gesprochen, und wenn jemand fragt, was man den ganzen Tag gemacht hat, muss man richtig lange drüber nachdenken. Zur gleichen Zeit und sogar am gleichen Tag – und genau das ist eben so schwer zu erklären – sieht man Menschen, wie man sie noch nie gesehen hat. Sie blitzen vor einem auf wie Rasiermesser. Vielleicht weil man sie mit anderen Augen sieht als vorher, vor den Schwierigkeiten. Vielleicht denkt man mehr über sie nach, aber anders, und dadurch werden sie einem fremd. Vielleicht wird man ängstlich und taub, weil man nicht weiß, ob man sich überhaupt noch irgendwie auf irgendwen verlassen kann.
Und selbst wenn sie bereit wären, was zu tun – was denn? Ich kann ja nicht einfach zu irgendwem in diesem Bus sagen, Mensch, Fonny steckt in Schwierigkeiten, er sitzt im Knast – könnt ihr euch vorstellen, was die Leute in diesem Bus zu mir sagen würden, wenn sie von mir hören, dass ich jemanden liebe, der im Knast sitzt? –, und ich weiß, dass er kein Verbrechen begangen hat, und er ist so ein wunderbarer Mensch, helfen Sie mir bitte, ihn rauszuholen. Könnt ihr euch vorstellen, was die Leute in diesem Bus sagen würden? Was würdet ihr denn sagen? Ich kann doch nicht einfach sagen, ich erwarte ein Kind, und ich hab Angst, und ich will nicht, dass dem Vater von dem Kind was zustößt, lassen Sie ihn nicht im Gefängnis sterben, bitte, ach, bitte! Das kann man doch nicht sagen. Das heißt allerdings, dass man gar nichts sagen kann. Wenn man in Schwierigkeiten steckt, heißt das, man ist allein. Man setzt sich hin, guckt aus dem Fenster und fragt sich, ob man für den Rest des Lebens mit diesem Bus hin und her fährt. Und was passiert dann mit dem Kind? Und was passiert dann mit Fonny?
Und wenn man diese Stadt jemals gut gefunden hat, dann findet man sie jetzt nicht mehr gut. Sollte ich irgendwann mal aus dieser Geschichte rauskommen, sollten wir irgendwann mal aus dieser Geschichte rauskommen, sieht mich Downtown New York ganz sicher nie wieder.
Vielleicht fand ich es mal gut hier, vor langer Zeit, als Daddy mit Sis und mir hergekommen ist, um Leute und Häuser zu gucken, und Daddy uns bestimmte Sehenswürdigkeiten gezeigt hat und wir im Battery Park Eis essen waren und Hotdogs. Das war immer herrlich, und wir waren selig, aber das lag an unserem Vater, nicht an der Stadt. Weil wir wussten, dass unser Vater uns liebt. Und ich weiß jetzt, dass das auf diese Stadt ganz bestimmt nicht zutrifft. Wir wurden angestarrt wie Zebras – und manche mögen halt Zebras und andere nicht. Aber ein Zebra nach seiner Meinung fragen tut keiner.
Ich war zwar noch nicht in so vielen Städten, nur in Philadelphia und Albany, aber New York ist garantiert die hässlichste und dreckigste Stadt der Welt. Mit den hässlichsten Häusern und den ekligsten Menschen. Und den schlimmsten Bullen. Wenn es einen schlimmeren Ort gibt, dann liegt der so nah an der Hölle, dass man riechen kann, wie die Menschen schmoren. Und ehrlich gesagt: Genau so riecht New York im Sommer.
In den Straßen dieser Stadt hab ich Fonny kennengelernt. Ich war klein, er war nicht mehr so klein. Ich war sechs, so um den Dreh, und er ungefähr neun. Sie wohnten gegenüber, er und seine Familie, seine Mutter und zwei große Schwestern und sein Vater, und sein Vater hatte einen Schneiderladen. Inzwischen frage ich mich, warum er den eigentlich hatte: Wir kannten niemanden, der es sich leisten konnte, seine Kleider zum Schneider zu bringen – alle Jubeljahre vielleicht mal. Aber von uns hätte er jedenfalls nicht leben können. Zwar waren die Leute, was ich so gehört habe, also, die Schwarzen, nicht mehr ganz so arm wie damals, als Mama und Daddy sich irgendwie über Wasser gehalten haben, und auch nicht mehr so arm wie damals im Süden, aber arm waren wir trotzdem und sind es auch immer noch.
Fonny war mir nie so richtig aufgefallen, bis wir einmal nach der Schule Streit hatten. Eigentlich hatte der Streit gar nichts mit Fonny und mir zu tun. Ich hatte eine Freundin, die hieß Geneva und war laut und derbe, hatte eng am Kopf geflochtene Zöpfe, kräftige aschegraue Knie, lange Beine und große Füße – und führte immer irgendetwas im Schilde. Sie war meine beste Freundin, weil ich nie irgendwas im Schilde führte. Ich war dünn und schüchtern, ich bin ihr gefolgt und immer in ihrer Klemme gelandet. Sonst wollte eigentlich keiner so richtig was mit mir zu tun haben und mit ihr schon gleich gar nicht. Jedenfalls meinte sie, dass sie Fonny nicht ausstehen kann. Dass sie ihn nur ansehen muss, da wird ihr schon schlecht. Dauernd erzählte sie mir, wie hässlich er ist, dass er Haut hat wie rohe feuchte Kartoffelschalen und Augen wie ein Schlitzi, und dann diese krausen Haare und die dicken Lippen. Und solche O-Beine, dass er Beulenfüße hat, und so wie sein Hintern rausguckt, war seine Mutter bestimmt ein Gorilla. Ich gab ihr recht, ging ja nicht anders, aber eigentlich fand ich ihn nicht so übel. Seine Augen fand ich schön, ich dachte sogar, wenn die Menschen in China solche Augen haben, dann hätte ich nichts gegen eine Reise nach China. Gorillas hatte ich noch nie gesehen, darum fand ich seinen Hintern ganz normal, genau genommen war er nicht so groß wie der von Geneva; kurz danach fiel mir auf, dass er tatsächlich ein bisschen O-Beine hat. Aber Geneva hat ihn andauernd runtergemacht. Ich glaube, er hat sie gar nicht wahrgenommen. Er war immer mit seinen Freunden unterwegs, den schlimmsten Jungs aus unserem Block. Ständig kamen sie zerfetzt, zerbeult und blutverschmiert die Straße runter, und vor unserem Streit hatte Fonny gerade einen Zahn verloren.
Fonny hatte einen Freund, Daniel, ein großer schwarzer Junge, der es ungefähr so auf Geneva abgesehen hatte, wie Geneva es auf Fonny abgesehen hatte. Ich weiß nicht mehr, wie alles angefangen hat, aber irgendwann hatte Daniel Geneva umgestoßen, und die beiden wälzten sich am Boden; ich versuchte, Daniel von Geneva wegzuziehen, und Fonny zog an mir. Da hab ich mich umgedreht und ihm das Erstbeste an den Kopf gehauen, was ich greifen konnte, und zwar aus dem Mülleimer. Es war bloß ein Stock, aber in dem Stock steckte ein Nagel. Er ratschte Fonny über die Wange, riss ihm die Haut auf, und das Blut tropfte raus. Ich traute meinen Augen nicht. Fonny fasste sich ins Gesicht, sah mich an, sah seine Hand an, und mir fiel nichts Besseres ein, als den Stock fallen zu lassen und wegzulaufen. Fonny lief hinter mir her, und dann schrie auch noch Geneva, als sie das Blut sah, ich hätte ihn umgebracht, umgebracht hätte ich ihn! Fonny hatte mich ganz schnell eingeholt, er packte mich und spuckte mich durch seine neue Zahnlücke an. Er traf direkt in meinen Mund, und das, glaube ich, fand ich so demütigend, dass ich aufschrie und losheulte. Schon komisch. Vielleicht hat sich mein Leben in genau dem Moment verändert, als Fonny mir in den Mund spuckte. Geneva und Daniel, die den Streit überhaupt erst angefangen und selber nicht einen einzigen Kratzer abgekriegt hatten, schrien mich beide an. Geneva meinte, ich hätte ihn umgebracht, ganz bestimmt, ich hätte ihn umgebracht, von rostigen Nägeln kriegt man Wundstarrkrampf und stirbt. Und Daniel sagte, genau, ein Onkel zu Hause im Süden sei daran gestorben. Fonny hörte sich das alles an, während das Blut weiter tropfte und ich weiter weinte. Irgendwann hatte er wohl kapiert, dass es um ihn geht und dass er ein toter Mann beziehungsweise ein toter Junge ist, jedenfalls fing er auch an zu weinen, Daniel und Geneva nahmen ihn in die Mitte, gingen mit ihm weg und ließen mich einfach stehen.
Ein paar Tage lang sah ich Fonny nicht. Ich war mir sicher, dass er am Wundstarrkrampf stirbt, und Geneva sagte, wenn er tot ist, was jede Minute passieren kann, kommt die Polizei und setzt mich auf den elektrischen Stuhl. Ich behielt den Schneiderladen im Auge, da wirkte alles normal. Mr Hunt war da, der lachende, hellbraune Mr Hunt, bügelte Hosen und erzählte jedem, der in den Laden kam – und es kam immer jemand in den Laden – Witze, und hin und wieder kam Mrs Hunt vorbei. Sie war eine Geheiligte, die sowieso wenig lächelte, aber trotzdem verhielten sich die beiden nicht so, als wenn ihr Sohn gerade stirbt.
Als ich Fonny ein paar Tage lang nicht gesehen hatte, wartete ich, bis der Laden leer aussah und Mr Hunt allein war, und ging rüber. Mr Hunt kannte mich damals flüchtig, bei uns im Block kannten wir uns alle ein bisschen.
»Hey, Tish«, sagte er, »wie geht’s? Wie geht’s der Familie?«
»Sehr gut, Mr Hunt«, sagte ich. Eigentlich wollte ich fragen: Und wie geht es Ihrer Familie?, wie sonst auch immer, aber das hab ich nicht geschafft.
»Was macht die Schule?«, fragte er mich nach einer Weile, und ich fand, dass er mich ganz komisch anguckte.
»Geht«, sagte ich, und mein Herz fing an zu rasen, als wenn es mir gleich aus der Brust springt.
Mr Hunt drückte so ein doppeltes Bügelbrett zusammen, wie es immer in Schneidereien steht – praktisch zwei Bügelbretter, die auf und zu gehen –, drückte das obere runter, sah mich ziemlich lange an und lachte: »Mein vorlauter Sohn ist bestimmt bald zurück.«
Ich hörte, was er sagte – irgendwie; nur was genau, wusste ich nicht.
Ich ging zur Tür, tat so, als würde ich rausgehen, und drehte mich noch mal um: »Wie bitte, Mr Hunt?«
Mr Hunt lächelte immer noch. Er zog die Bügelpresse auf und drehte die Hose oder was auch immer um. »Fonny. Seine Mama hat ihn für eine Weile zu ihrer Familie in den Süden geschickt. Weil er hier oben zu viel Mist baut.«
Er drückte das Brett wieder runter. »Was für Mist er da unten baut, kriegt sie ja nicht mit.« Dann lächelte er mich an. Als ich Fonny näher kennenlernte und Mr Hunt auch, wurde mir klar, dass Fonny das Lächeln von ihm hat. »Na, ich sag ihm, dass du vorbeigekommen bist.«
»Grüßen Sie Ihre Familie von mir, Mr Hunt«, sagte ich und rannte über die Straße.
Geneva saß auf den Stufen vor meinem Haus. Sie sagte, ich hätte total bescheuert ausgesehen und wäre ja fast überfahren worden.
Ich blieb stehen. »Du bist eine Lügnerin, Geneva Braithwaite. Fonny hat keinen Starrkrampf, und er stirbt auch nicht. Und ich komme auch nicht ins Gefängnis. Kannst ja seinen Daddy fragen.« Da guckte Geneva mich so komisch an, dass ich zur Tür hochlief, die Treppe rauf, und mich auf die Feuerleiter setzte, aber so nah ans Fenster, dass sie mich nicht sehen konnte.
Nach vier oder fünf Tagen war Fonny zurück und setzte sich zu mir auf die Eingangsstufen vorm Haus. Er hatte keine Narbe, er hatte zwei Donuts. Und setzte sich zu mir. »Tut mir leid, dass ich dir ins Gesicht gespuckt hab.« Er gab mir einen Donut.
»Tut mir leid, dass ich dich gehauen hab«, sagte ich. Das war alles. Er aß seinen Donut und ich aß meinen.
Die Leute glauben immer nicht, dass Jungen und Mädchen in dem Alter so sein können – die Leute glauben überhaupt kaum was, und allmählich kapiere ich auch, warum –, aber genau damals wurden wir Freunde. Besser gesagt, aber das ist eigentlich dasselbe – noch so was, was die Leute nicht wahrhaben wollen –, ich wurde seine kleine Schwester, und er wurde mein großer Bruder. Er mochte seine richtigen Schwestern nicht, und ich hatte keine Brüder. Und so wurden wir füreinander das, was dem anderen fehlte.
Geneva war sauer auf mich und kündigte mir die Freundschaft. Wobei, vielleicht hab ich, ohne es zu wissen, eher ihr die Freundschaft gekündigt, weil ich ja, ohne zu wissen, was das heißt, jetzt Fonny hatte. Daniel war sauer auf Fonny, er nannte ihn eine Memme, weil er sich mit Mädchen abgab, und kündigte Fonny die Freundschaft – für lange Zeit; sie haben sich sogar geprügelt, und Fonny hat noch einen Zahn verloren. Wer Fonny damals gesehen hat, dachte bestimmt, dass er ohne einen einzigen Zahn im Mund groß wird. Ich weiß noch, wie ich Fonny angeboten habe, von oben die Schere meiner Mutter zu holen und Daniel abzustechen, aber Fonny meinte, ich wäre doch bloß ein Mädchen und hätte damit gar nichts zu tun.
Sonntags musste Fonny in die Kirche – und damit meine ich, er musste: Wobei er seine Mutter öfter ausgetrickst hat, als sie es wusste oder wissen wollte. Seine Mutter – die habe ich auch noch näher kennengelernt, dazu gleich mehr – war, wie gesagt, eine Geheiligte, und wenn sie ihren Mann schon nicht retten konnte, dann wenigstens verdammt noch mal ihren Sohn. Er war nämlich ihr Kind, nicht deren Kind.
Ich glaube, darum war Fonny so wild. Und ich glaube, darum war er, wenn man ihn einmal kennenlernte, so nett, ein richtig netter Mensch, ein richtig lieber Mann, mit viel Traurigkeit innen drin: Wenn man ihn kennenlernte. Mr Hunt, Frank, hat nicht versucht, ihn für sich zu beanspruchen, aber er hat ihn geliebt – er liebt ihn. Seine großen Schwestern waren nicht direkt Geheiligte, aber das hätten sie genauso gut sein können, auf jeden Fall kamen sie nach der Mutter. Blieben also Frank und Fonny. Im Grunde genommen hatte Frank Fonny die ganze Woche über, und Fonny hatte Frank die ganze Woche über, das wussten sie auch, darum konnte Frank Fonny sonntags seiner Mutter überlassen. Fonny machte auf der Straße das, was Frank im Schneiderladen und zu Hause machte. Beide machten, was sie wollten. Deswegen hat Frank auch so lange wie möglich an seinem Laden festgehalten. Deswegen konnte er sich um Fonny kümmern, wenn der blutend nach Hause kam; deswegen konnten sie, Vater und Sohn, mich lieben. Das ist gar nicht so rätselhaft, außer dass Menschen immer ein Rätsel sind. Später hab ich mich gefragt, ob Fonnys Eltern überhaupt miteinander schlafen. Und ich hab auch Fonny gefragt.
»Ja, aber nicht so wie wir. Früher hab ich sie immer gehört: Meine Mutter kommt von der Kirche nach Hause, klitschnass und stinkend. Sie tut so, als wenn sie sich kaum bewegen kann vor lauter Erschöpfung, und lässt sich angezogen aufs Bett fallen – vielleicht hat sie gerade noch ihre Schuhe ausgezogen und den Hut abgelegt und ihre Handtasche irgendwo abgestellt. Das Geräusch hab ich noch im Ohr, es klang immer total schwer beim Abstellen, voll mit Silbermünzen. Dann sagt sie: Der Herr hat ja heute Abend vielleicht meine Seele gesegnet, Schatz, wann gibst du dein Leben in die Hände des Herrn? Baby, sagt er dann, und ich schwöre, dabei liegt er da, und sein Schwanz wird steif und, sorry, Baby, aber bei ihr sieht’s auch nicht besser aus, das ist nämlich, kaum zu glauben, wie ein Spiel, das zwei Straßenkatzen in der Gasse miteinander treiben. Scheiße. Sie jault und miauuuut, was das Zeug hält, sie schnappt sich den Tiger, jagt ihn kreuz und quer durch die Gasse, und sie jagt ihn, bis er ihr ins Genick beißt – inzwischen will er eigentlich nur noch schlafen, aber bei ihr ist voller Chor, er muss die Musik ausknipsen, und da gibt es nur einen Schalter: ihr ins Genick beißen, und dann hat sie ihn. Mein Daddy liegt also da ohne Klamotten, sein Schwanz wird immer steifer, und mein Daddy sagt: Wird wohl Zeit, dass der Herr sein Leben in meine Hände legt. Und sie sagt: Ach, Frank, ich führ dich zum Herrn. Und er sagt: Scheiße, Lady, ich führe den Herrn zu dir. Ich bin der Herr. Und da legt sie los mit Heulen und Stöhnen, Herr, hilf mir, diesem Mann zu helfen. Du hast ihn mir gegeben, da kann ich doch nichts machen. Ach, Herr, hilf mir. Und er sagt: Der Herr wird dir helfen, Süße, sobald du wieder ein kleines Kind bist, nackt wie ein kleines Kind. Komm schon, komm zum Herrn. Sie fängt an zu weinen und ruft nach Jesus, während er ihr alles auszieht – und ich höre es rascheln und flüstern, irgendwas reißt, irgendwas fällt runter – manchmal bleib ich morgens mit dem Fuß in was hängen, wenn ich auf dem Weg zur Schule durch ihr Zimmer muss –, und wenn er sie nackt ausgezogen hat und auf ihr liegt und sie noch immer Jesus ruft: hilf mir, Herr, sagt mein Daddy: Den Herrn kriegst du jetzt, und zwar hier. Wo willst du seinen Segen hin? Wo tut’s denn weh? Wo sollen die Hände des Herrn dich berühren? Hier? Oder hier? Wo willst du seine Zunge hin? Wo soll der Herr in dich fahren, du dreckige, dumme schwarze Schlampe? Du Schlampe. Du Schlampe. Du Schlampe. Dann schlägt er sie, fest und laut. Und sie sagt: O Gott, hilf mir, meine Last zu tragen. Und er sagt: Hier ist sie, Baby, die wirst du tapfer tragen, das weiß ich. In Jesus hast du einen Freund, und ich sag dir, wenn er kommt. Das erste Mal. Über seine Wiederkunft wissen wir nichts. Noch nicht. Dann fängt das Bett an zu wackeln, und sie stöhnt und stöhnt und stöhnt. Und am nächsten Morgen ist es so, als wenn nichts passiert ist. Sie ist wie immer. Sie gehört noch zu Jesus, und er geht die Straße runter in den Laden.«
Und dann sagte Fonny: »Wenn ich nicht gewesen wäre, ich glaube, der Tiger hätte sich aus dem Staub gemacht. Ich werde meinen Daddy immer lieben, weil er mich nicht im Stich gelassen hat.« Und ich werde mich immer an Fonnys Gesicht erinnern, wenn er über seinen Daddy spricht.
Fonny drehte sich danach zu mir um, nahm mich in den Arm und lachte: »Du erinnerst mich ziemlich an meine Mutter, weißt du das? Komm, wir singen zusammen, du Sünderin, liebst du meinen Herrn? Und wenn ich kein Stöhnen höre, weiß ich, du bist nicht gerettet.«
Wahrscheinlich kommt es nicht so oft vor, dass zwei Menschen lachen und sich dabei lieben können, sich lieben, weil sie lachen, lachen, weil sie sich lieben. Die Liebe und das Lachen sitzen an derselben Stelle, da gehen nur nicht viele Leute hin.
Irgendwann an einem Samstag fragte mich Fonny, ob ich am nächsten Morgen mit in die Kirche komme, und ich sagte Ja, obwohl wir Baptisten sind und bei den Geheiligten nichts verloren haben. Aber inzwischen wussten alle, dass Fonny und ich Freunde sind, das war einfach so. In der Schule und unseren Block rauf und runter nannten sie uns Romeo und Julia, aber nicht, weil sie das Stück gelesen hatten. An dem Morgen kam Fonny total geknickt bei mir an mit öligen Haaren und so einem messerscharfen Scheitel, als wäre der mit einem Tomahawk oder einer Rasierklinge gezogen. Er trug seinen blauen Anzug, mich hatte Sis eingekleidet. Im Grunde war das so was wie unser erstes Date. Seine Mutter wartete unten.
Es war kurz vor Ostern, also nicht kalt, aber auch nicht warm.
Obwohl wir klein waren und ich nicht im Traum auf die Idee gekommen wäre, ihr Fonny wegzunehmen oder so was, und obwohl sie Fonny eigentlich gar nicht liebt, sondern nur denkt, das gehört sich so, weil sie ihn auf die Welt gepresst hat, konnte mich Fonnys Mutter schon damals nicht leiden. An vielen Dingen hab ich das gemerkt, zum Beispiel war ich fast nie bei Fonny, Fonny dafür ständig bei mir; und zwar nicht, weil Fonny und Frank mich nicht bei sich zu Hause haben wollten. Seine Mutter und seine beiden Schwestern wollten das nicht. Einerseits, das ist mir aber später erst klar geworden, fanden sie, ich bin nicht gut genug für Fonny – was im Klartext hieß, ich bin nicht gut genug für sie –, und andererseits dachten sie, Fonny hat vielleicht genau so was verdient. Ich bin nun mal dunkel, meine Haare sind einfach nur Haare, ich mache nicht viel her, nicht mal Fonny tut so, als wenn ich hübsch wäre, er sagt bloß, hübsche Frauen würden echt nerven.
Wenn er das sagt, denkt er an seine Mutter, das weiß ich –darum behauptet er, wenn er mich ärgern will, ich würde ihn an seine Mutter erinnern. Ich erinnere ihn aber überhaupt nicht an seine Mutter, und das weiß er, er weiß aber auch, dass ich weiß, wie sehr er sie liebt: wie sehr er sie lieben will, wie sehr er will, dass er sie lieben darf, um es mal so auszudrücken.
Mrs Hunt und die Mädchen haben helle Haut, und man sieht, dass Mrs Hunt in Atlanta, wo sie herkommt, ein sehr schönes Mädchen gewesen sein muss. Diese Ausstrahlung hat sie immer noch, dieses Rührmichnichtan, das ehemalige Schönheiten mit ins Grab nehmen. Die Schwestern sind nicht so schön wie ihre Mutter, und natürlich waren sie nie jung in Atlanta, aber sie haben helle Haut – und lange Haare. Fonny ist heller als ich, aber viel dunkler als sie, sein Haar ist einfach kraus, egal, wie viel Öl seine Mutter ihm da sonntags reinschmiert, dadurch kriegt sie es auch nicht glatter.
Fonny kommt eigentlich nach seinem Vater. Als er an dem Sonntag mit mir aus dem Haus ging, schenkte mir Mrs Hunt ein reizendes, gütiges Lächeln.
»Ich freu mich so, dass du heute Morgen mit uns zum Haus des Herrn kommst, Tish«, sagte sie. »Ach, wie hübsch du aussiehst heute Morgen!«
Womit sie mir zu verstehen gab, wie ich sonst morgens aussehe: wie ich generell aussehe.
»Guten Morgen, Mrs Hunt«, sagte ich, und dann gingen wir die Straße runter.
Es war die Sonntagmorgenstraße. Unsere Straßen haben Tage, sogar Stunden. Wo ich geboren wurde und wo mein Kind geboren wird, sieht man die Straße runter und kann fast sehen, was im Haus passiert: Samstag zum Beispiel, drei Uhr nachmittags, ist eine ganz schlechte Zeit. Die Kinder sind aus der Schule zurück. Die Männer sind von der Arbeit zurück. Man sollte meinen, da kommen alle glücklich zusammen, aber so ist es nicht. Die Kinder sehen die Männer. Die Männer sehen die Kinder. Und das macht die Frauen, die kochen und putzen und ihre Haare glätten und sehen, was Männer grundsätzlich nicht sehen, fast wahnsinnig. Das sieht man der Straße an, man hört es an der Art, wie die Frauen nach ihren Kindern rufen. Man sieht es an der Art, wie sie aus dem Haus laufen – eilig, wie der Wind –, ihre Kinder schlagen und nach oben zerren, man hört es den Kindern an, man sieht es an der Art, wie die Männer, die das alles gar nicht mitkriegen, vor einem Geländer beieinanderstehen, in einem Friseursalon beieinandersitzen, eine Flasche rumgehen lassen, zur Bar an der Ecke gehen, die junge Frau hinterm Tresen necken, sich streiten und später furchtbar emsig an ihren Weinreben nesteln. Der Samstagnachmittag hängt wie eine Wolke über allem, als würde man auf den großen Sturm warten.
Am Sonntagmorgen haben sich die Wolken verzogen, der Sturm hat seinen Schaden angerichtet und ist abgeflaut. Was auch immer der Schaden war, jetzt sind alle sauber. Die Frauen haben es irgendwie auf die Reihe gekriegt und halten alles zusammen. Also sind alle hier, sauber, geschrubbt, gekämmt und geölt. Später wird Schweinshaxe gegessen oder Chitlins, Brat- oder Backhähnchen mit Yams und Reis und Gemüse oder Maisbrot oder Brötchen. Sie kommen nach Hause, entspannen sich und sind nett: Manche Männer waschen sonntags ihre Autos sorgfältiger als ihre Vorhaut. An diesem Sonntagmorgen die Straße runterzugehen, Fonny neben mir wie ein Gefangener und Mrs Hunt auf meiner anderen Seite wie eine Königin, die ins Königreich schreitet, war wie ein Bummel über den Jahrmarkt. Inzwischen glaube ich allerdings, es lag nur an Fonny – der kein Wort sagte –, dass ich mir vorkam wie auf dem Jahrmarkt.
Schon aus einem Block Entfernung hörten wir die Tamburine in der Kirche.
»Wenn wir doch deinen Vater dazu kriegen könnten, dass er irgendwann mit ins Haus des Herrn kommt«, sagte Mrs Hunt. Dann sah sie mich an. »In welche Kirche gehst du normalerweise, Tish?«
Wir sind ja, wie gesagt, Baptisten, aber in die Kirche gehen wir nicht oft – vielleicht an Weihnachten oder Ostern, solchen Tagen. Mama kommt mit den Betschwestern nicht klar, und die kommen mit ihr nicht klar, Sis ist Mama ziemlich ähnlich, und Daddy sieht es nicht ein, dem Herrn hinterherzulaufen, irgendwie hat er keinen großen Respekt vor ihm.
»Wir gehen in die Abyssinia Baptist«, sagte ich und starrte auf die Risse im Asphalt.
»Das ist eine schöne Kirche«, sagte Mrs Hunt – als wäre das noch das Beste, was man über unsere Kirche sagen kann, also nicht gerade viel.