
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Schlaflose Nächte waren noch nie so romantisch Ziellos läuft Auden jede Nacht durch Colby, eine Kleinstadt am Meer, wo sie ihren Vater und seine neue Frau besucht. Sie schläft nicht mehr, seit sie als Kind wach blieb, um die Streitereien ihrer Eltern zu verhindern. Bei ihren Streifzügen trifft sie auf Eli, Einzelgänger und Nachtwanderer wie sie. Mit ihm holt sie ihre verpasste Kindheit nach, aber auch Elis Seele ist verwundet ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 523
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Sarah Dessen
Because of you
Roman
Aus dem Amerikanischenvon Gabriele Kosack
Deutscher Taschenbuch Verlag
Deutsche Erstausgabe 2011© 2011 der deutschsprachigen Ausgabe:Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, MünchenDas Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlags zulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.Rechtlicher Hinweis §44 UrhG: Wir behalten uns eine Nutzung der von uns veröffentlichten Werke für Text und Data Mining im Sinne von §44 UrhG ausdrücklich vor.eBook ISBN 978-3-423-41125-7 (epub)ISBN der gedruckten Ausgabe 978-3-423-78253-1Ausführliche Informationen über unsere Autoren und Bücher finden Sie auf unserer Website
Für meine Mutter, Cynthia Dessen, die mir fast alles darüber beigebracht hat, was es heißt, ein Mädchen zu sein, und für meine Tochter, Sasha Clementine, von der ich den Rest lerne.
Inhalt
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Dreizehn
Vierzehn
Fünfzehn
Sechzehn
Siebzehn
Achtzehn
Neunzehn
Danksagung
Eins
Die E-Mails fingen immer gleich an:
Hi Auden!!
Das doppelte Ausrufezeichen ging mir jedes Mal wieder auf den Geist. Meine Mutter nannte es überflüssig, übertrieben, banal. Ich fand es einfach bloß nervig, so wie fast alles, was meine Stiefmutter anging. Heidi.
Ich hoffe, deine letzten Wochen vorm Schulabschluss sind supertoll. Uns allen hier in Colbygeht es sehr gut! Die Vorbereitungen für die Ankunft deiner kleinen Schwester laufen auf Hochtouren. Seit Kurzem strampelt sie herum wie verrückt. Als würde sie da drinnen Karate trainieren! Ich habe ziemlich viel damit zu tun, mich um alles zu kümmern und das Kinderzimmer fertig einzurichten. Alles in Braun- und Rosatönen. Sieht total süß aus! Ich hänge ein Foto an, damit du es dir vorstellen kannst.
Dein Vater werkelt auch die ganze Zeit vor sich hin, vor allem nachts, weil er schwer mit seinem nächsten Buch beschäftigt ist. Ich vermute fast, ich werde ihn in Zukunft öfter sehen als jetzt, nämlich wenn ich nachts mit dem Babyauf bin.
Ich hoffe sehr, du überlegst es dir und kommst uns besuchen, wenn du mit der Schule fertig bist. Wir hätten bestimmt viel Spaß zusammen. Komm, wann immer du möchtest. Wir würden uns sehr freuen, dich bei uns zu haben.
Alles Liebe,
Heidi (und dein Vater und das zukünftige Baby!)
Schon diese Mail-Auswürfe lesen zu müssen strengte mich an. Zum Teil lag es an dem aufgedrehten Stil – als würde dir permanent wer ins Ohr brüllen–, aber auch an Heidi selbst. Sie war einfach… überflüssig, übertrieben, banal. Und nervig. Jedenfalls fand ich sie so, und zwar von Anfang an: Seit sie und mein Vater letztes Jahr ein Paar sowie schwanger geworden waren und daraufhin geheiratet hatten.
Meine Mutter behauptete, das Ganze habe sie nicht im Mindesten überrascht. Seit ihrer Scheidung von meinem Vater hatte sie prophezeit, dass er früher oder später »was mit einer Studentin anfangen würde«, wie sie es ausdrückte. Heidi war zwar keine Studentin, aber mit ihren sechsundzwanzig Jahren genauso alt wie meine Mutter, als sie meinen Bruder, Hollis, bekommen hatte; ich folgte vier Jahre später. Doch damit endeten die Gemeinsamkeiten auch schon. Ansonsten waren die beiden so unterschiedlich wie Tag und Nacht. Meine Mutter hatte einen rasiermesserscharfen Verstand, einen trockenen Sinn für Humor und als Geisteswissenschaftlerin Karriere gemacht: Sie galt als die amerikanische Expertin für die Rolle der Frau in der Literatur der Renaissance. Heidi hingegen war… eben Heidi. Der Typ Frau, deren Stärke darin bestand, ununterbrochen an sich selbst rumzuzuppeln oder zuppeln zu lassen (Pediküre, Maniküre, Strähnchen färben), alles Mögliche und Unmögliche über Rocklängen und Schuhe zu wissen, und Menschen, denen all das schnurzpiepegal war, mit geschwätzigen E-Mails zu bombardieren.
Der Balztanz dauerte nicht lang, die Einpflanzung (wie meine Mutter es nannte) geschah binnen weniger Monate. Innerhalb kürzester Zeit verwandelte sich mein Vater aus dem Menschen, der er jahrelang gewesen war – Ehemann von Professor Doktor Victoria West und Autor eines hochgelobten Romans, seit Längerem allerdings eher für seine ständigen Querelen mit Unikollegen bekannt–, in einen frischgebackenen Ehemann und künftigen Vater eines Neugeborenen.
Zählte man seine neue Stelle als Leiter des Fachbereichs für Kreatives Schreiben am Weymar College hinzu, einer kleinen akademischen Bildungsstätte in einer ebenso kleinen Stadt am Meer, konnte man durchaus behaupten, dass mein Vater ein komplett neues Leben begonnen hatte. Und obwohl die beiden mich ständig einluden, sie endlich zu besuchen, war ich mir nicht sicher, überhaupt herausfinden zu wollen, ob darin noch Platz für mich war.
Aus dem Nebenzimmer hörte ich plötzlich Gelächter und Gläserklirren. Offenbar wurde eifrig angestoßen. Meine Mutter gab eins ihrer berühmten Abendessen für die Studenten ihres Oberseminars, die immer sehr zivilisiert und förmlich begannen (»Kultur ist es, was dieser Kultur so schmerzlich fehlt!«, pflegte sie zu sagen), allerdings unweigerlich in alkoholisierten, lautstarken Diskussionen über Literatur und Literaturtheorie endeten. Ich warf einen Blick auf die Uhr – halb elf–, schob mit dem großen Zeh behutsam die Tür auf, blickte den Flur entlang Richtung Küche. Meine Mutter saß, Rotweinglas in der Hand, am Kopfende – wo sonst? – unseres großen Massivholz-Küchentischs. Wie üblich hatte sich ein Trupp männlicher Magistranden und Doktoranden um sie versammelt und hing bewundernd an ihren Lippen, während sie – soweit ich es den Wortfetzen entnehmen konnte, die zu mir herübersegelten – über Marlowe und die Kultur der Weiblichkeit dozierte.
Meine Mutter war schon immer auf faszinierende Weise widersprüchlich und die Szene in der Küche war ein weiterer Beleg dafür. Mit Frauen in der Literatur kannte sie sich super aus, doch im wirklichen Leben mochte sie ihre Geschlechtsgenossinnen nicht sonderlich. Was sicher zumindest zum Teil daran lag, dass die meisten neidisch auf sie waren: auf ihre Intelligenz (sie hätte problemlos Mitglied bei Mensa werden können), ihre wissenschaftliche Karriere (vier Bücher, unzählige Artikel, ein Stiftungslehrstuhl), ihr Aussehen (groß, die richtigen Kurven an den richtigen Stellen, langes tiefschwarzes Haar, das sie meist offen trug, sodass es richtig wild aussah – das einzig Unkontrollierte an ihr). Aus diesen und ähnlichen Gründen tauchten Studentinnen selten bei diesen Zusammenkünften auf; und wenn, kamen sie noch seltener ein zweites Mal.
»Dr.West«, sagte gerade ein Student, der sorgfältig auf ungepflegt gestylt war: billig wirkendes Jackett, Zottelhaarschnitt, angesagte Spießerbrille mit schwarzem Rahmen. »Sie sollten unbedingt darüber nachdenken, einen Artikel über diese These zu veröffentlichen. Einfach faszinierend.«
Meine Mutter trank einen Schluck Wein, strich sich mit der Hand schwungvoll die Haare aus dem Gesicht. »Meine Güte, nein«, antwortete sie mit ihrer tiefen, rauen Stimme (sie klang wie eine Raucherin, obwohl sie noch nie in ihrem Leben an einer Zigarette auch nur gezogen hatte). »Ich habe ja nicht mal genügend Zeit, das Manuskript für mein nächstes Buch fertig zu schreiben. Und dafür werde ich wenigstens bezahlt. Sofern man das Bezahlung nennen kann.«
Mehr bewunderndes, schmeichelndes Gelächter. Meine Mutter beschwerte sich oft und gern darüber, wie niedrig das Honorar für ihre Bücher – bedeutende wissenschaftliche Werke, die bei diversen Universitätsverlagen erschienen – war, wohingegen mit »dümmlichen Hausfrauengeschichten« (ihre Worte) das große Geld gemacht wurde. Aber wäre es nach meiner Mutter gegangen, würde ohnehin jeder Mensch ausschließlich Shakespeares gesammelte Werke als Strandlektüre wählen, vielleicht noch ergänzt durch ein paar nette Heldenepen.
»Trotzdem, es ist eine so brillante Idee«, fuhr Spießerbrille beharrlich fort. »Ich könnte Ihnen vielleicht behilflich sein, als… äh… Koautor, meine ich.«
Unvermittelt wurde es still im Raum. Meine Mutter hob den Kopf und ihr Glas. Musterte ihn scharf. »Wirklich reizend von Ihnen«, erwiderte sie. »Aber ich arbeite niemals mit einem Koautor zusammen, und zwar aus demselben Grund, aus dem ich mich auch nicht auf Bürogemeinschaften oder Beziehungen einlasse: Ich bin viel zu egoistisch.«
Sogar über die Entfernung hinweg konnte ich sehen, wie Spießerbrille schluckte, rot wurde und hastig nach der Weinflasche griff. Idiot, dachte ich, und schob die Tür wieder zu. Als wäre es tatsächlich so leicht, mal eben eine Verbindung zu meiner Mutter herzustellen… (Und ich wusste, wovon ich sprach.)
Zehn Minuten später schlüpfte ich, Schuhe unter den Arm geklemmt, durch die Hintertür. Stieg in mein Auto. Fuhr durch die fast menschenleeren Straßen, durch stille Wohngegenden, an dunklen Schaufenstern vorbei, bis in der Ferne die roten Lichter von Ray's Diner auftauchten. Ray's war klein, viel zu grell erleuchtet (überall Neon) und die Tische klebten immer ein bisschen. Aber es war das einzige Lokal in der ganzen Stadt, das vierundzwanzig Stunden geöffnet hatte, dreihundertfünfundsechzig Tage im Jahr. Seit ich nicht mehr schlief, hatte ich mehr Nächte dort verbracht als in meinem Bett. Ich hockte an einem Tisch in der Ecke, las, lernte, bezahlte sofort, was auch immer ich bestellte, und gab pro Stunde einen Dollar Trinkgeld extra, bis die Sonne aufging.
Das mit der Schlaflosigkeit hatte vor drei Jahren angefangen, während die Ehe meiner Eltern allmählich in die Brüche ging. Dass sie sich trennten, überraschte niemanden groß, am wenigsten mich selbst: Ihre Beziehung war schwierig und stürmisch gewesen, seit ich denken konnte; allerdings hatten sie sich eher wegen ihrer Arbeit gestritten als wegen einander.
Als sie hierherzogen, hatten beide gerade ihr Studium beendet. Meinem Vater wurde damals an der Uni, an der inzwischen meine Mutter unterrichtet, eine Stelle als Dozent angeboten. Gleichzeitig war es ihm gelungen, einen Verlag für seinen ersten Roman – »Das Horn des Narwals« – zu finden. Meine Mutter war schwanger (mit meinem Bruder) und versuchte parallel dazu, ihre Dissertation fertigzustellen.
Vier Jahre später: Ich wurde geboren, mein Vater schwamm auf einer Erfolgswelle, sowohl was seinen Ruf bei den Kritikern als auch seine finanzielle Situation betraf. Sein Buch stand auf der Bestsellerliste der New York Times, er war für mehrere wichtige Literaturpreise nominiert sowie Leiter des Fachbereichs für Kreatives Schreiben an einer renommierten Uni.
Meine Mutter hingegen schwamm »in einem tiefen Meer aus Windeln und Selbstzweifeln«, wie sie gern zu sagen pflegte. Doch als ich in den Kindergarten kam, stürzte sie sich voller Eifer – und auf Anhieb erfolgreich – wieder ins akademische Leben: Ihre Doktorarbeit wurde veröffentlicht, sie ergatterte eine Gastprofessur, erfreute sich im Lauf der Zeit immer größerer Beliebtheit unter den Studenten, aus der Gast- wurde eine ordentliche Professur; gleichzeitig war sie äußerst produktiv, auf das erste folgten ein zweites, ein drittes wissenschaftliches Buch – und mein Vater hatte plötzlich das Nachsehen. Er behauptete zwar, er sei stolz auf sie, machte Witze darüber, dass sie jetzt die Brötchen verdiente… Doch dann wurde meine Mutter auf den eigens für sie gestifteten Lehrstuhl berufen (eine sehr prestigeträchtige Position), während der Verleger meines Vaters ihn aus heiterem Himmel fallen ließ (weniger prestigeträchtig). Und damit ging der Ärger los.
Die Auseinandersetzungen fingen immer beim Abendessen an. Einer von beiden machte eine Bemerkung, die der andere prompt in den falschen Hals bekam. Anschließend folgte unweigerlich ein kurzer Streit – scharfe, verletzende Worte, ein hingeknallter Topfdeckel–, danach schien die Sache irgendwie geklärt… zumindest bis zehn, elf Uhr. Denn dann hörte ich plötzlich, wie sie wieder auf demselben Thema rumzureiten begannen.
Nach einer Weile begriff ich die Hintergründe dieses Zeitsprungs: Sie warteten nur, bis ich eingeschlafen war, ehe sie richtig loslegten. Deshalb beschloss ich eines Abends, genau das nicht zu tun. Ich ließ meine Zimmertür offen, mein Licht an, ging immer wieder ins Bad, wobei ich soviel Krach wie möglich machte, während ich mir die Hände wusch oder Ähnliches. Eine Zeit lang funktionierte das auch – es blieb ruhig. Bis es eben nicht mehr funktionierte. Und das Gezeter erneut losging. Doch zu dem Zeitpunkt hatte sich mein Körper bereits daran gewöhnt, spätabends noch wach zu sein. Was wiederum bedeutete, dass ich nun jedes einzelne Wort mitkriegte.
Ich kannte jede Menge Leute, deren Eltern sich getrennt hatten. Jeder schien anders darauf zu reagieren: totale Verblüffung, Superfrust und Enttäuschung, absolute Erleichterung. Nur eins war bei allen gleich: Es gab endlose Gespräche über diese Gefühle. Meine Familie hingegen musste natürlich mal wieder die Ausnahme bilden. Okay, den Setz-dich-bitte-wir-müssen-etwas-mit-dir-besprechen-Moment gab es auch bei uns. Meine Mutter überbrachte die Nachricht. Sie saß mir gegenüber am Küchentisch, während mein Vater an der Arbeitsplatte lehnte, an seinem Pullover zupfte und sehr erschöpft wirkte.
»Dein Vater und ich werden uns trennen«, sagte sie in demselben trockenen Ton, den sie anschlug, wenn sie die Referate ihrer Studenten auseinanderpflückte. »Es ist das Beste für uns alle, das siehst du doch bestimmt ähnlich.«
Ich wusste nicht, was ich sehen – oder denken oder fühlen – sollte, als ich das hörte. Erleichterung? Nein. Superfrust und Enttäuschung? Ebenfalls Fehlanzeige. Und schon gar kein Schock, wie gesagt. Was mir am ehesten auffiel, als wir drei da so in der Küche standen beziehungsweise saßen, war, wie winzig ich mir plötzlich vorkam. Wie ein kleines Kind. Was total seltsam war. Als ob durch ihre Trennung eine längst überfällige Welle der Kindheit über mich hinwegbrandete.
Natürlich war ich ein Kind gewesen. Doch als ich auf die Welt kam, waren meine Eltern durch meinen Bruder schon komplett ausgepowert – kein Baby hatte je mehr Koliken gehabt als er, kein Krabbelkind war so hyperaktiv gewesen, kein kleiner Junge so lebhaft (im Klartext: unerträglich). Und er powerte sie immer noch aus, indem er quer durch Europa tingelte und gelegentlich E-Mails bezüglich seiner neuesten Zukunftsplanung schrieb, unweigerlich gefolgt von der Bitte, ihm mehr Geld zu schicken. Wenigstens konnten meine Eltern ihren Freunden jetzt erzählen, dass Hollis sich am Eiffelturm rumtrieb und Zigaretten rauchte, und nicht mehr an der Tanke. Das klang zumindest besser: nach Bohème und gepflegtem Nomadentum…
Hollis war das große Kind, ich die kleine Erwachsene, das Mädchen, das schon mit drei bei den Großen am Tisch saß und sorgfältig die Bilder in Malbüchern ausmalte, ohne auch nur einen Mucks von sich zu geben, während gelehrt über Literatur geplaudert wurde. Ich lernte schon sehr früh, mich mit mir selbst zu beschäftigen. Bereits im Kindergarten (und von da an bis in alle Ewigkeit) war ich wie besessen vom Lernen. Denn mit Bildung, Fleiß und Ehrgeiz konnte ich die Aufmerksamkeit meiner Eltern mühelos auf mich ziehen.
»Keine Sorge«, sagte meine Mutter, wenn einem unserer Gäste in meiner Gegenwart ein Schimpfwort entschlüpfte oder sonst etwas, das eigentlich nur für erwachsene Ohren bestimmt war. »Auden ist sehr reif für ihr Alter.« Was stimmte, egal, ob ich zwei oder vier oder siebzehn war.
Während Hollis es schaffte, seine eigenen Bedürfnisse durchzusetzen, wurde ich einfach überall mit hingeschleppt. Meine Eltern nahmen mich mit in Konzerte und Museen, zu wissenschaftlichen Symposien und Fakultätsversammlungen. Erwarteten, dass ich mich mucksmäuschenstill verhielt. Viel Zeit zum Spielen oder für richtiges Spielzeug blieb nicht. An Büchern hingegen herrschte nie Mangel, Bücher hatte ich immer mehr als genug.
Weil man mich so aufgezogen hatte, fiel mir der Umgang mit Gleichaltrigen eher schwer. Ihre Wildheit und Verrücktheit waren mir fremd. Ich begriff nicht, wie man wie eine Irre auf dem Fahrrad durch die Gegend rasen oder Kissenschlachten vom Zaun brechen konnte. Einerseits sah es zwar so aus, als würde es Spaß machen, andererseits unterschied es sich so sehr von allem, was ich kannte, dass ich mir nicht vorstellen konnte mitzumachen, selbst wenn sich die Gelegenheit dazu ergeben hätte. Was allerdings ohnehin nicht der Fall war, da die Kissenschlachten-Kämpfer und irren Radfahrer eher selten auf die akademisch ambitionierten Privatschulen gingen, die meine Eltern für mich bevorzugten.
Ich hatte in den letzten vier Jahren dreimal die Schule gewechselt. Auf der Jackson Highschool war ich nicht länger als ein paar Wochen, denn nachdem meine Mutter im offiziellen Unterrichtsplan einen orthographischen und einen grammatikalischen Fehler entdeckt hatte, schickte sie mich umgehend auf die Perkins Day, eine staatlich anerkannte Privatschule, die kleiner und vom Unterrichtsstandard her wesentlich besser war als die Jackson High. Allerdings längst nicht so gut wie Kiffney-Brown, die noch viel exklusivere Privatschule, auf die ich zu Beginn der vorletzten Highschool-Klasse wechselte. Kiffney-Brown war von mehreren ehemaligen Professoren in unserer Stadt gegründet worden und eine absolute Eliteeinrichtung: Maximal hundert Schüler, sehr kleine Klassen, intensiver Kontakt zur nächstgelegenen Universität (also der, wo meine Mutter lehrte), sodass man dort vorzeitig Seminare besuchen und erste Scheine erwerben konnte. An der Kiffney-Brown hatte ich zwar ein paar Freunde, aber innige Beziehungen zu entwickeln war trotzdem nicht einfach, weil wir einen Großteil unseres Unterrichts in Eigenregie strukturieren mussten, uns also ziemlich selten über den Weg liefen. Außerdem war die Atmosphäre insgesamt sehr wettbewerbsorientiert.
Was mir allerdings nicht viel ausmachte. Schule war mein Trost, mein Rückzugsort, ins Lernen konnte ich mich flüchten und dabei in meiner Fantasie tausend fremde Leben führen. Je mehr unsere Eltern sich über Hollis’ miese Zensuren und seinen Mangel an Eigeninitiative beklagten, umso eifriger lernte ich. Doch obwohl sie stolz auf mich waren, schienen mir meine Leistungen nie das einzubringen, was ich mir wünschte. Ich war so ein kluges Kind, ich hätte es eigentlich irgendwann kapieren müssen: Der einzige Weg, die Aufmerksamkeit meiner Eltern wirklich zu erringen, wäre gewesen, sie zu enttäuschen. Zu versagen. Doch als ich das endlich begriff, war es schon zu spät: Erfolg zu haben war mir derart in Fleisch und Blut übergegangen, dass ich es mir nicht mehr abgewöhnen konnte.
Mein Vater war zu Beginn meines zweiten Highschooljahres ausgezogen. Er mietete eine möblierte Wohnung in der Nähe des Campus. Die Wochenenden verbrachte ich bei ihm, aber dass es mir Spaß gemacht hätte, konnte ich nicht behaupten, dazu war er zu mies drauf. Er kämpfte mit dem Manuskript für seinen nächsten Roman, gleichzeitig war auf einmal fraglich, ob der überhaupt veröffentlicht werden würde, meine Mutter hingegen stand zunehmend im Rampenlicht… Doch bei ihr fühlte ich mich auch nicht wirklich wohl, dazu war sie zu beschäftigt, ihr neues Leben als Single und ihren beruflichen Erfolg zu genießen: Ständig hatte sie Gäste, Studenten und Doktoranden gingen bei uns ein und aus, jedes Wochenende veranstaltete sie irgendein großes Abendessen. Mir kam es so vor, als gäbe es keinen Zwischenbereich, wo ich mich aufhalten konnte. Außer in Ray's Diner.
Ich war schon eine Million Male dran vorbeigefahren, ohne es zu beachten, bis es mir eines Nachts gegen zwei Uhr, auf dem Heimweg zu meiner Mutter, auffiel. Weder mein Vater noch meine Mutter kümmerten sich noch groß darum, was ich trieb. Mein Stundenplan war so unübersichtlich und komplex – zum Teil hatte ich abends Unterricht, Kurse mit flexiblen Seminarzeiten, eigene Projekte, bei denen überhaupt keine Anwesenheitspflicht herrschte–, dass ich kommen und gehen konnte, ohne dass sie je nachfragten. In jener Nacht warf ich im Vorbeifahren einen Blick zu Ray's rüber. Und irgendetwas packte mich plötzlich. Das Lokal sah nach Wärme und Geborgenheit aus. Außerdem hielten sich dort lauter Menschen auf, mit denen ich zumindest eins gemeinsam hatte. Deshalb parkte ich mein Auto, ging hinein, bestellte eine Tasse Kaffee und ein Stück Apfelkuchen. Und blieb bis Sonnenaufgang.
Das Angenehme an Ray's Diner war, dass mich auch dann niemand nervte, als ich längst Stammgast geworden war. Niemand wollte mehr von mir, als ich zu geben bereit war, und sämtliche Gespräche waren nett, aber kurz. Wenn doch bloß alle Beziehungen so unkompliziert wären – und ich immer genau wüsste, wo mein Platz, welches meine Rolle war.
Im letzten Herbst beugte ich mich gerade über die Bewerbungsunterlagen für diverse Colleges, als eine der Kellnerinnen, eine stämmige ältere Frau– JULIE, laut ihrem Namensschild – an meinen Tisch trat, um mir Kaffee nachzuschenken, und dabei einen Blick auf den Papierstapel vor mir warf.
»Defriese University«, las sie laut vor. Musterte mich. »Ziemlich gutes College.«
»Eins der besten«, pflichtete ich ihr bei.
»Glaubst du, du wirst aufgenommen?«
Ich nickte. »Ja, ich denke schon.«
Sie lächelte, als fände sie mich irgendwie niedlich, und tätschelte meine Schulter. »Ach ja, noch einmal so jung und selbstsicher sein«, meinte sie.
Ich wollte gerade erklären, dass ich überhaupt nicht selbstsicher war, sondern nur verdammt viel gelernt hatte. Aber sie war schon zum Nachbartisch gegangen und plauderte mit dem Typen dort. Außerdem interessierte es sie nicht wirklich. Es gab Welten, wo all das – Zensuren, Schule, Prüfungen, Durchschnittsnoten usw. – enorm viel bedeutete. Und andere, wo das eben nicht der Fall war. Mein gesamtes Leben war nach akademischer Relevanz ausgerichtet und das konnte ich nicht einfach abschütteln.
Deswegen hatte ich all die speziellen Highschool-Abschlussjahr-Momente verpasst, die für meine alten Freunde von der Perkins Dayder Gesprächsstoff der letzten Monate gewesen waren. Das einzige Ereignis, bei dem ich überhaupt erwog teilzunehmen, war der Abschlussball, und das auch bloß, weil Jason Talbot – mein Hauptkonkurrent, wenn es um den besten Zensurenschnitt ging – mich gefragt hatte, ob ich mit ihm hingehen würde; war anscheinend als eine Art Friedensangebot gemeint. Schließlich und endlich wurde selbst daraus nichts, jedenfalls nicht für mich, weil er in letzter Minute absagte. Er war zu irgendeiner hochwichtigen Umweltkonferenz eingeladen worden. Ich redete mir ein, dass es mir nichts ausmachte, letztlich war so ein Ball ja auch nichts anderes als Kissenschlachten und Fahrradverfolgungsjagden, nämlich überflüssig und albern. Trotzdem ging mir – und zwar nicht nur an jenem Abend, den ich schlussendlich allein zu Hause verbrachte – öfter die Frage durch den Sinn, was ich wohl verpasste.
Ich hockte also Nacht für Nacht bei Ray's und so gegen zwei, drei, vier Uhr morgens durchzuckte es mich manchmal. Ein sehr merkwürdiges Gefühl. Dann blickte ich von meinen Büchern auf, betrachtete die anderen Gäste– Lastwagenfahrer, Leute, die schnell einen Kaffee kippten, die üblichen Irren – und hatte urplötzlich dasselbe Gefühl wie an dem Tag, als meine Mutter die Trennung verkündete. Als würde ich überhaupt nicht hierhergehören, sondern nach Hause in mein Bett, tief und fest schlummernd, wie meine Klassenkameraden, die ich in wenigen Stunden in der Schule wiedersehen würde. Doch dieser eigenartige Moment verflüchtigte sich in der Regel schnell und alles um mich her wurde wieder ganz normal. Wenn dann Julie auf einer ihrer Runden mit der Kaffeekanne vorbeikam, schob ich meinen Becher an den Tischrand und machte wortlos klar, was wir ohnehin beide längst wussten – dass ich nämlich noch eine Weile bleiben würde.
***
Meine Stiefschwester, Thisbe Caroline West, wurde am Tag vor meiner Highschool-Abschlussfeier geboren. Sie wog exakt 3173Gramm. Als mein Vater am nächsten Morgen anrief, klang er total erschöpft.
»Es tut mir wirklich sehr leid, Auden«, sagte er. »Ich bin todunglücklich, dass ich deine große Rede nicht miterleben werde.«
»Schon okay«, antwortete ich, während meine Mutter im Morgenmantel in die Küche kam und zielstrebig auf die Kaffeemaschine zusteuerte. »Wie geht es Heidi?«
»Gut«, erwiderte er. »Müde. Das Ganze hat ewig gedauert, war sehr mühsam, und am Ende wurde sie doch per Kaiserschnitt entbunden. Was ihr gar nicht gepasst hat. Aber ich bin sicher, sie muss sich nur ein wenig ausruhen, dann geht es ihr bald wieder besser.«
»Grüß sie von mir und herzlichen Glückwunsch«, meinte ich.
»Mach ich. Und du, mein Schatz, gehst später da raus und heizt ihnen ordentlich ein, versprochen?« Typisch Dad: er war berühmt-berüchtigt für seine Streitlust, und alles, was mit Uni und Wissenschaft, Forschung und Lehre zu tun hatte, betrachtete er automatisch als Schlachtfeld. »Ich denke an dich.«
Ich lächelte, bedankte mich, legte auf. Meine Mutter goss gerade Milch in ihren Kaffee und rührte einen Augenblick stumm in ihrem Becher, sodass der Löffel leise den Rand entlangklirrte, bevor sie sagte: »Lass mich raten – er kommt nicht.«
»Heidi hat gestern ihr Kind gekriegt«, antwortete ich. »Sie haben sie Thisbe genannt.«
Meine Mutter schnaubte verächtlich. »Du liebe Zeit«, meinte sie. »Es gibt bei Shakespeare so viele Namen zur Auswahl und dein Vater entscheidet sich ausgerechnet für diesen? Das arme Mädchen. Ihr ganzes Leben lang wird sie erklären müssen, warum sie so heißt.«
Ausgerechnet. Meine Mutter hatte eigentlich überhaupt kein Recht zu meckern. Schließlich hatte sie meinem Vater erlaubt, die Namen für meinen Bruder und mich auszusuchen: Detram Hollis war ein Professor, den mein Vater bewunderte, ja verehrte, und W.H.Auden sein Lieblingsdichter. Als Kind hatte ich mir eine Zeit lang gewünscht, ich hieße Ashley oder Katherine, was mein Leben deutlich vereinfacht hätte. Doch meine Mutter betonte gern, mein Name sei so etwas wie ein literarischer Lackmustest. Auden sei nicht Frost, pflegte sie zu sagen, oder Whitman, sondern etwas unbekannter. Und wenn jemand tatsächlich von ihm gehört hätte, könnte ich zumindest bis zu einem gewissen Grad sicher sein, dass dieser Jemand in derselben Intelligenzliga spielte wie ich. Ich fand, für Thisbe galt das sogar noch viel mehr, verkniff mir jedoch jeglichen Kommentar und sah stattdessen nochmal die Karteikarten mit meinen Redenotizen durch. Im nächsten Moment zog sie einen Stuhl heran und setzte sich zu mir.
»Ich nehme an, Heidi hat die Geburt überlebt?« Sie trank einen Schluck Kaffee.
»Sie hatte einen Kaiserschnitt.«
»Die Glückliche«, sagte meine Mutter. »Hollis wog über fünf Kilo und die PDA hat nicht gewirkt. Er hat mich beinahe umgebracht.«
Ich fächerte die Karteikarten auf, ging sie eine nach der anderen zum x-ten Mal durch und machte mich innerlich auf eine der Geschichten gefasst, die bei diesem Thema unweigerlich folgen würden. Zum Beispiel, was für ein gieriges Kind Hollis gewesen war – er hatte die Brüste meiner Mutter buchstäblich leer getrunken. Oder seine berühmten Koliken, die schlimmer waren als bei jedem anderen Baby, sodass man endlos mit ihm auf dem Arm durch die Gegend marschieren musste; und selbst dann schrie er ununterbrochen. Oder es gab die Anekdote über meinen Vater, wie er einmal…
»Hoffentlich erwartet sie jetzt nicht, dass dein Vater ihr groß hilft.« Sie streckte die Hand aus, nahm sich ein paar meiner Karteikarten, blätterte sie mit kritischem Blick durch. »Ich konnte mich schon glücklich schätzen, wenn er ab und zu eine Windel wechselte. Sobald es darum ging, nachts aufzustehen und einen von euch zu füttern – Fehlanzeige. Ohne seine neun Stunden Schlaf könne er nicht unterrichten, behauptete er. Sehr praktisch.«
Während sie redete, las sie immer noch in meinen Notizen. Und ich spürte denselben vertrauten Stich wie immer, wenn ich mich unversehens auf ihrem Prüfstand wiederfand. Doch im nächsten Moment legte sie die Karten kommentarlos beiseite.
»Das ist ziemlich lang her«, meinte ich, während sie noch einen Schluck Kaffee trank. »Vielleicht hat er sich geändert.«
»Menschen ändern sich nicht. Im Gegenteil, wenn man älter wird, verfestigen sich Gewohnheiten und Charakterzüge eher, anstatt sich zu verflüchtigen.« Sie schüttelte resigniert den Kopf. »Ich weiß noch, wie ich mit dem brüllenden Hollis in unserem Schlafzimmer saß und mir nichts sehnlicher wünschte, als dass sich die Tür öffnet, dein Vater hereinkommt und sagt: ›Gib ihn mir, ruh du dich aus.‹ Und irgendwann wollte ich nur noch Hilfe, egal von wem.«
Während sie das sagte, blickte sie aus dem Fenster. Ihre Finger umschlossen den Kaffeebecher. Ich sammelte meine Karteikarten zusammen, brachte sie sorgfältig wieder in die richtige Reihenfolge. »Ich sollte mich mal fertig machen«, meinte ich und schob den Stuhl zurück.
Sie rührte sich nicht. Als wäre sie eingefroren, säße nach wie vor wartend in ihrem Schlafzimmer, damals, mit Hollis. Zumindest bis ich den Flur erreicht hatte. Da sagte sie plötzlich doch noch etwas.
»Du solltest das Faulkner-Zitat überdenken. Als Einstieg viel zu übertrieben, zu hochgestochen. Man wird dich automatisch für eine kleine Angeberin halten.«
Ich blickte auf die oberste Karte in meiner Hand, auf der in meiner ordentlichen Blockschrift »Die Vergangenheit ist nicht tot. Sie ist nicht einmal vergangen« stand. »Okay«, sagte ich. Sie hatte recht. Sie hatte immer recht. »Danke.«
***
Ich hatte mich so auf meinen Highschool-Abschluss und die Vorbereitungen fürs College konzentriert, dass ich über die Zeit dazwischen überhaupt nicht nachgedacht hatte. Doch auf einmal war Sommer und nichts mehr zu tun, als darauf zu warten, dass mein eigentliches Leben wieder begann.
Ein paar Wochen lang beschäftigte ich mich damit, alles zusammenzusammeln, was ich für die Defriese University brauchen würde. Außerdem versuchte ich, einige Schichten bei dem Nachhilfeservice zu ergattern, wo ich bis dahin erfolgreich gejobbt hatte, aber es herrschte gerade keine große Nachfrage. Anscheinend war ich die Einzige, die schon ans Studieren dachte, was ich vor allem daran merkte, dass meine alten Freunde von der Perkins Day mich immer wieder aufforderten, mit an den See zu fahren oder abends gemeinsam auszugehen.
Ich hatte nichts dagegen, sie zu sehen. Doch jedes Mal, wenn wir uns trafen, kam ich mir vor wie das fünfte Rad am Wagen. Ich war zwar nur zwei Jahre auf eine andere Schule gegangen, trotzdem kam ich bei dem angeregten Geplauder über Sommerferienjobs, Jungs und wer mit wem liiert war nicht mehr mit. Nach ein paar dieser unbehaglichen Unternehmungen erfand ich immer häufiger Ausreden, warum ich nicht mit von der Partie sein konnte. Und nach einer Weile wurde ich nicht mehr eingeladen – die Botschaft war angekommen.
Zu Hause war es ebenfalls komisch. Meine Mutter hatte ein Forschungsstipendium bekommen, sie arbeitete daher ununterbrochen. Und wenn nicht, tauchten ihre wissenschaftlichen Hilfskräfte und Assistenten ständig zu irgendwelchen improvisierten Abendessen oder spontanen Cocktailpartys bei uns auf. Wenn es mir zu laut und zu voll wurde, setzte ich mich mit einem Buch auf die Veranda und las, bis es so dunkel war, dass ich endlich zu Ray's fahren konnte.
Eines Abends hockte ich wieder einmal vor dem Haus und war in ein Buch über Buddhismus vertieft, als ich plötzlich bemerkte, wie ein grüner Mercedes langsam unsere Straße entlangrollte. Er erreichte unseren Briefkasten, bremste, blieb schließlich stehen. Im nächsten Moment stieg eine hübsche junge Frau mit blonden Haaren aus, die Hüftjeans, ein rotes Tanktop, Sandalen mit Keilabsätzen und in einer Hand ein Päckchen trug. Sie spähte zu unserem Haus herüber, blickte auf das Päckchen, wieder zum Haus und marschierte dann los. Erst als sie die Stufen zur Veranda schon fast erreichte hatte, bemerkte sie mich.
»Hi!«, rief sie so überfreundlich, dass es einem fast Angst einjagen konnte. Ich hatte den Gruß kaum erwidert, da stürzte sie auch schon auf mich zu und strahlte mich begeistert an. »Du bist bestimmt Auden.«
»Ja«, erwiderte ich gedehnt.
»Tara!«, stellte sie sich vor. Mit einer Selbstverständlichkeit, als müsste ich auf Anhieb wissen, um wen es sich handelte. Als ihr jedoch klar wurde, dass ich keine Ahnung hatte, wer sie war, fügte sie hinzu: »Hollis’ Freundin…«
Ach du liebe Zeit, dachte ich. Sagte allerdings: »Ach so, natürlich.«
»Schön, dich endlich persönlich kennenzulernen«, sagte sie, trat auf mich zu, umarmte mich. Sie roch nach Gardenien und frischer Bettwäsche. »Hollis wusste, dass ich auf meinem Heimweg hier vorbeikommen würde, deshalb bat er mich, dir das zu bringen. Direktimport aus Griechenland!«
Sie gab mir das in schlichtes braunes Papier gewickelte Päckchen. Auf der Vorderseite stand in Hollis’ unordentlicher, schräger Handschrift mein Name und unsere Adresse. Ein etwas beklommener Augenblick der Stille folgte, bis ich begriff, dass sie darauf wartete, dass ich das Päckchen öffnete. Also tat ich es. Zum Vorschein kam ein kleiner Bilderrahmen aus Glas. Der Rand war mit bunten Steinen verziert und unten waren die Worte EINE SUPERZEIT eingraviert. Das Foto selbst zeigte Hollis vor dem Tadsch Mahal, in T-Shirt und Cargoshorts, einen Rucksack über der Schulter und mit seinem typischen Lächeln in den Mundwinkeln.
»Toll, was?«, meinte Tara. »Haben wir auf einem Flohmarkt in Athen aufgestöbert.«
Weil ich nicht sagen konnte, was ich wirklich dachte – dass ich es nämlich ganz schön narzisstisch fand, ein Foto von sich selbst zu verschenken–, antwortete ich: »Ja, wirklich sehr schön.«
»Ich wusste, es würde dir gefallen!« Sie klatschte begeistert in die Hände. »Ich habe ihm erklärt, jeder Mensch braucht Bilderrahmen. Erst dadurch wird eine Erinnerung zu etwas wirklich Besonderem!«
Noch einmal betrachtete ich den Bilderrahmen, die hübschen Steine, den lässigen Gesichtsausdruck meines Bruders. EINE SUPERZEIT – in der Tat. »Ja, unbedingt«, erwiderte ich.
Tara schenkte mir erneut ihr Eine-Million-Watt-Lächeln, spähte dann an mir vorbei durchs Fenster ins Hausinnere. »Ist deine Mutter zu Hause? Ich würde sie auch gern kennenlernen. Hollis ist total hin und weg von ihr, redet ununterbrochen über sie.«
»Das beruht auf Gegenseitigkeit«, entgegnete ich. Sie stutzte, warf mir einen forschenden Blick zu. Ich lächelte betont arglos. »Sie ist in der Küche. Lange schwarze Haare, grünes Kleid. Du kannst sie gar nicht verfehlen.«
»Cool!« Bevor ich es verhindern konnte, umarmte sie mich noch einmal. »Vielen Dank.«
Ich nickte. Dieses unbekümmerte Auftreten war typisch für alle Freundinnen meines Bruders, zumindest solange sie sich noch als seine Freundinnen fühlten. Wenn seine E-Mails und Anrufe dann versiegt waren und Mister Hollis wie vom Erdboden verschluckt schien, erlebten wir die andere Seite der Medaille: rot umränderte Augen, tränenreiche Nachrichten auf dem Anrufbeantworter, aufheulende Motoren vor dem Haus…
Gegen elf trieb sich die Schar der Bewunderer immer noch im Dunstkreis meiner Mutter herum, das Stimmengewirr so laut wie immer. Ich hockte in meinem Zimmer, checkte, weil ich nichts Besseres zu tun hatte, meinen Ume.com-Account (keine neuen Nachrichten – ich konnte auch nicht behaupten, dass ich ernsthaft mit welchen gerechnet hätte) sowie meine E-Mails. Überlegte kurz, ob ich eine meiner Freundinnen anrufen sollte, um herauszufinden, was da draußen so passierte. Doch dann fiel mir wieder ein, wie verkrampft meine letzten Versuche gewesen waren, etwas mit anderen zu unternehmen.
Stattdessen setzte ich mich einfach nur aufs Bett. Hollis’ gerahmtes Foto stand auf dem Nachttisch. Ich nahm es in die Hand, betrachtete die kitschigen blauen Steine. EINE SUPERZEIT.Etwas an dem Wort, an Hollis’ lässigem Lächeln erinnerte mich an das Geplauder meiner alten Schulfreundinnen über Tratsch und Jungs und Liebeskummer. Sie hätten vermutlich Millionen Fotos, die in diesen Rahmen passen würden. Ich hingegen besaß kein einziges.
Erneut schaute ich mir das Foto meines Bruders an, den Rucksack über seiner Schulter. Reisen bedeutete immerhin Tapetenwechsel und die Chance auf neue Erfahrungen. Nach Griechenland oder Indien konnte ich mich vielleicht nicht mal so eben aufmachen. Aber es gab einen Ort, wo ich hinkonnte. Colby.
Ich ging zu meinem Laptop, rief das E-Mail-Programm auf, scrollte bis zur letzten Mail meines Vaters. Ohne groß nachzudenken schrieb ich ein paar Zeilen. Sowie eine Frage. Innerhalb einer halben Stunde erhielt ich seine Antwort.
Natürlich kannst du kommen! Unbedingt! Und bleiben, so lange du möchtest. Wir freuen uns auf deinen Besuch!
Und von einem Moment auf den nächsten veränderte sich mein Sommer komplett.
***
Am nächsten Morgen trug ich eine kleine Reisetasche mit Klamotten, meinen Laptop sowie einen Riesenkoffer voller Bücher nach unten. Vor ein paar Wochen hatte ich die Lektürelisten zu einigen meiner Defriese-Seminareim Netz entdeckt. Es konnte sicher nicht schaden, wenn ich mich mit dem Stoff schon mal vertraut machte. Was sollte ich in Colby auch schon groß tun als lernen? Die Alternative bestand darin, am Strand abzuhängen oder meine Zeit mit Heidi zu verbringen – und keins von beidem erschien sehr verlockend.
Ich hatte mich noch am Abend davor von meiner Mutter verabschiedet, da ich annahm, sie würde ausschlafen. Doch als ich in die Küche kam, räumte sie gerade müde und lustlos Unmengen Gläser und zerknüllte Servietten vom Tisch.
»Ist es spät geworden?«, fragte ich, obwohl ich das natürlich längst wusste. Das letzte Auto war gegen halb zwei von unserer Auffahrt verschwunden.
»Eigentlich nicht«, antwortete sie und ließ Wasser ins Spülbecken laufen. Über ihre Schulter hinweg blickte sie auf mein Gepäck. »Du machst dich früh auf den Weg. Kannst es wohl nicht erwarten, von mir wegzukommen, was?«
»Nein, ich möchte nur vermeiden, mich hinten im Stau anzustellen.«
Ehrlich gesagt hatte ich nicht damit gerechnet, dass es meine Mutter groß interessieren würde, ob ich die Sommerferien hier verbrachte oder nicht. Und hätte ich ein anderes Ziel gehabt, wäre das vermutlich auch so gewesen. Doch sobald mein Vater ins Spiel kam, lag der Fall natürlich anders.
»Ich kann mir kaum vorstellen, was dich dort erwartet.« Sie lächelte spöttisch. »Dein Vater mit einem Neugeborenen! In seinem Alter! Zu komisch.«
»Ich werde dir erzählen, wie es ist«, sagte ich.
»Du wirst nicht nur, du musst. Ich möchte regelmäßig Bericht erstattet bekommen.« Sie ließ ihre Hände im Seifenwasser versinken und begann, ein Glas zu spülen.
»Wie fandest du Hollis’ Freundin?«, fragte ich.
Meine Mutter seufzte schwer. »Was wollte sie überhaupt hier?«
»Hollis hatte ihr ein Geschenk für mich mitgegeben.«
»Ach wirklich?« Sie stellte ein paar Gläser aufs Abtropfgestell. »Was denn?«
»Einen Bilderrahmen. Aus Griechenland. Mit einem Foto von Hollis.«
»Aha.« Sie drehte den Wasserhahn zu, strich sich mit dem Handgelenk das Haar aus dem Gesicht. »Hast du ihr geraten, es zu behalten, weil das wahrscheinlich ihre einzige Chance ist, ihn wiederzusehen?«
Obwohl mir der gleiche Gedanke durch den Kopf geschossen war, tat mir Tara plötzlich leid. »Wer weiß?«, antwortete ich. »Vielleicht hat Hollis sich geändert und die beiden verloben sich demnächst.«
Meine Mutter drehte sich um. Musterte mich mit zusammengekniffenen Augen. »Ach, Auden«, erwiderte sie. »Was habe ich dir eingeschärft, immer und immer wieder? Über Menschen, die sich ändern?«
»Dass sie genau das nicht tun.«
»Du sagst es.«
Sie wandte sich wieder dem Spülbecken zu, tauchte einen Teller ins Wasser. In dem Moment entdeckte ich die schwarze Spießerbrille auf der Arbeitsfläche neben der Tür. Plötzlich ergab alles einen Sinn: Die Stimmen, die ich spätnachts noch gehört hatte; dass Mom so ungewöhnlich früh wach war und aufräumte. Einen Augenblick lang erwog ich, die Brille demonstrativ beiläufig in die Hand zu nehmen. Aber dann tat ich einfach so, als hätte ich sie nicht gesehen. Wir umarmten uns zum Abschied. Meine Mutter umklammerte mich immer so, als wollte sie nie wieder loslassen. Doch dann löste sie sich von mir und entließ mich in den Sommer.
Zwei
Das Haus, in dem mein Vater und Heidi wohnten, sah exakt so heimelig aus, wie ich es erwartet hatte: Es war weiß mit grünen Fensterläden, auf der breiten Veranda befanden sich Schaukelstühle, Blumentöpfe und eine putzige gelbe Keramik-Ananas, auf der WILLKOMMEN! stand. Nur der weiße Lattenzaun fehlte.
Als ich vor dem Haus anhielt, sah ich Dads verbeulten alten Volvo in der offen stehenden Garage. Daneben parkte ein etwas neuerer Prius. Sobald ich den Motor abgestellt hatte, konnte ich das Meer hören. Als ich zum Haus ging und einen Blick um die Ecke riskierte, sah ich plötzlich nichts als Strandhafer und einen breiten Streifen Blau, der sich bis zum Horizont erstreckte.
Von der – zugegebenermaßen spektakulären – Aussicht mal abgesehen, beschlichen mich gewisse Zweifel. Ich war noch nie der spontane Typ gewesen, und je weiter ich mich von zu Hause entfernt hatte, umso konkreter begann ich mir die Realität eines ganzen langen Sommers mit Heidi auszumalen. Ob es wohl Maniküregruppensitzungen geben würde, für mich, sie und das Baby? Oder vielleicht würde sie darauf bestehen, dass wir uns gemeinsam in die Sonne legten und dabei T-Shirts im Partnerlook mit der Aufschrift ICH LIEBE EINHÖRNER trugen? Doch dann rief ich mir immer wieder Hollis vor dem Tadsch Mahal ins Gedächtnis zurück und wie ich mich daheim allein gelangweilt hatte. Außerdem hatte ich Dad seit seiner Hochzeit nicht mehr gesehen. Dieser Besuch – acht volle Wochen ohne Schule für mich und Uni für ihn – schien meine letzte Chance zu sein, Zeit mit ihm zu verbringen, ehe mein Studium und damit das richtige Leben begann.
Ich atmete tief durch. Stieg aus. Und redete mir gut zu, dass ich einfach tapfer lächeln und alles über mich ergehen lassen würde, egal, was Heidi sagte oder tat. Wenigstens bis ich mich ins Gästezimmer gerettet hätte und die Tür hinter mir schließen konnte.
Ich klingelte, trat einen Schritt zurück, setzte einen dem Anlass angemessenen, freundlichen Gesichtsausdruck auf. Doch aus dem Inneren des Haus war kein Laut zu hören. Deshalb klingelte ich noch einmal und beugte mich vor, um besser hören zu können, ob sich das charakteristische Klappern hoher Absätze näherte und Heidis muntere Stimme mit einem ebenso munteren »Einen Moment« zu vernehmen war. Doch wieder rührte sich innen gar nichts.
Ich drehte den Knauf – die Tür war unverschlossen – und steckte den Kopf ins Innere des Hauses. »Hallo?«, rief ich. Meine Stimme hallte durch den gelb gestrichenen Flur, der mit gerahmten Kunstdrucken verziert war. »Jemand zu Hause?«
Stille. Ich trat ein, schloss die Tür hinter mir. Erst da hörte ich es wieder: das Meeresrauschen, obwohl es nun anders klang, viel näher – ja, fast so nah, als würde es bis ins Haus hineinbranden. Ich ging dem Geräusch nach, wobei es allmählich so laut wurde, dass ich fest damit rechnete, auf ein geöffnetes Fenster oder eine offen stehende Hintertür zu stoßen. Stattdessen fand ich mich plötzlich im Wohnzimmer wieder. Das Geräusch war nun ohrenbetäubend laut. Und auf dem Sofa saß Heidi, das Baby im Arm.
Zumindest nahm ich an, es handelte sie um Heidi. Es war schwer zu sagen, denn sie sah vollkommen anders aus als bei unserer letzten Begegnung. Ihre Haare waren zu einem unordentlichen Pferdeschwanz zusammengebunden, einige Strähnen hingen ihr wirr ins Gesicht, sie trug ausgebeulte, zerschlissene Sweatpants und ein viel zu großes T-Shirt mit einem feuchten Fleck auf der Schulter. Ihre Augen waren geschlossen, ihr Kopf neigte sich zur Seite. Ich war sicher, sie würde schlafen, bis sie, ohne die Lippen zu bewegen, zischte: »Wenn du sie aufweckst, bringe ich dich um.«
Ich zuckte erschrocken zusammen, wich vorsichtshalber einen Schritt zurück. »Entschuldige, ich wollte nur…«
Sie riss die Augen auf, verengte sie jedoch gleich wieder zu gefährlich wirkenden Schlitzen, während ihr Kopf herumfuhr. Als sie mich entdeckte, verwandelte sich ihre Gereiztheit in Schock. Und im nächsten Moment fing sie an zu weinen. Einfach so.
»Auden«, sagte sie mit gepresster Stimme. »Tut mir wirklich leid. Ich hatte vergessen, dass du… und dann dachte ich… aber das ist keine Entschuldigung…« Sie brach ab. Ihre Schultern zuckten im Rhythmus ihrer Schluchzer. Das Baby schlief die ganze Zeit friedlich weiter und bekam nichts mit. Es war wirklich winzig. So klein. So zart und zerbrechlich, dass man sich wunderte, wie es überhaupt existieren konnte.
Hektisch schaute ich mich im Zimmer um. Wo steckte mein Vater? Erst in diesem Augenblick registrierte ich, dass das Irrsinnsbrandungsgeräusch nicht von draußen kam, sondern durch einen kleinen weißen Apparat erzeugt wurde, der auf dem Beistelltisch stand. Wer zieht sich künstliches Meeresrauschen rein, wenn das echte in Hörweite ist? Eins der vielen Dinge, die – zumindest in jenem Moment – vollkommen rätselhaft waren.
»Äh…«, begann ich. Heidi weinte immer noch. Ihre Schluchzer wurden von gelegentlichen Schniefern sowie dem künstlichen Wellenrauschen begleitet. »Kann ich… brauchst du irgendwie Hilfe oder so etwas?«
Zitternd atmete sie ein, blickte dann zu mir hoch. Sie hatte dunkle Augenränder und auf ihrem Kinn prangte eine Ansammlung feuerroter Minipickel (vielleicht auch eine Art Ausschlag). »Nein.« Prompt stiegen ihr erneut Tränen in die Augen. »Alles in Ordnung. Es ist bloß… nein, mir geht es gut.«
Was selbst in meinen Ohren unglaubwürdig klang, dabei hatte ich mit Situationen wie dieser nun wirklich keine Erfahrung. Allerdings auch keine Zeit zu widersprechen, denn in dem Moment kam mein Vater herein. Er trug ein Plastiktablett mit Kaffeebechern, eine kleine, braune Papiertüte und seine übliche Kluft: verknitterte Khakihosen, Hemd darüber, nicht reingesteckt, und die Brille irgendwie schief auf der Nase. Wenn er unterrichtete, ergänzte er dieses Outfit durch Jackett und Schlips. Turnschuhe – sein Markenzeichen – hatte er allerdings immer an, egal, wie er sonst gekleidet war.
»Da ist sie ja!«, meinte er, als er mich bemerkte. Trat zu mir, um mich zu umarmen. Während er mich an sich zog, blickte ich über seine Schulter hinweg zu Heidi, die sich auf die Unterlippe biss und durch die große gläserne Schiebetür aufs Meer schaute. »Wie war die Fahrt?«
»Gut«, antwortete ich gedehnt. Er löste sich von mir, bot mir einen der drei Kaffeebecher an, nahm sich selbst und stellte dann den letzten vor Heidi auf den Beistelltisch. Sie starrte ihn an, als hätte sie keine Ahnung, was das war.
»Hast du deine Schwester schon kennengelernt?« Er wandte sich wieder zu mir um.
»Äh… nein«, erwiderte ich. »Noch nicht.«
»Aha!« Er legte die Tüte weg, beugte sich über Heidi – die sich krampfhaft versteifte – und nahm das Baby aus ihren Armen. »Da ist sie. Das ist Thisbe.«
Ich betrachtete das Gesicht des Babys. Ihre Augen waren geschlossen, ihre Wimpern kurz und fein. Eine Hand ragte unter der Decke hervor – so winzige Finger…
»Sie ist wunderschön«, sagte ich. Denn so etwas sagte man ja wohl bei solchen Anlässen.
»Nicht wahr?« Dad grinste, schaukelte sie sanft in seinen Armen. Ihre Äuglein öffneten sich. Sie blickte zu uns hoch, blinzelte – und begann auf einmal zu weinen, genau wie zuvor ihre Mutter. »Ups«, sagte er, wiegte sie ein wenig hin und her. Sofort weinte Thisbe etwas lauter. »Schatz?« Mein Vater drehte sich zu Heidi um, die sich nicht gerührt hatte, noch exakt so dasaß wie zuvor, nur dass ihre Arme jetzt schlaff herabhingen. »Ich glaube, sie hat Hunger.«
Heidi schluckte, wandte sich ihm wortlos zu. Und nachdem mein Vater ihr Thisbe gegeben hatte, drehte sie sich ebenso wortlos wieder Richtung Fenster, fast roboterartig. Während das Baby immer durchdringender schrie.
»Komm, wir gehen raus«, sagte mein Vater und schnappte sich die Papiertüte vom Tisch. Er öffnete die Schiebetür und ich folgte ihm auf die Terrasse. Normalerweise hätte es mir bei dem Blick die Sprache verschlagen – das Haus stand wirklich unmittelbar am Meer, ein kleiner Steg führte direkt zum Strand–, doch jetzt drehte ich mich unwillkürlich zu Heidi um. Sie war verschwunden. Ihr Kaffeebecher stand unberührt auf dem Tisch.
»Alles in Ordnung mit ihr?«, fragte ich.
Er öffnete die Tüte, holte einen Muffin heraus, hielt ihn mir hin. Ich schüttelte dankend den Kopf. »Sie ist müde.« Er biss hinein, wischte die Krümel weg, aß beim Sprechen weiter. »Das Baby ist nachts oft wach und ich bin keine große Hilfe, weil ich zu Schlafstörungen neige, wenn ich nicht regelmäßig meine neun Stunden bekomme. Und dann bin ich am nächsten Tag zu nichts zu gebrauchen. Ich versuche schon die ganze Zeit, sie davon zu überzeugen, dass sie sich Hilfe holt, aber sie tut es einfach nicht.«
»Warum nicht?«
»Du kennst doch Heidi«, erwiderte er, als wäre das tatsächlich der Fall. »Sie muss alles allein machen. Und perfekt. Aber keine Angst, das wird schon. Die ersten Monate sind die schwersten. Ich weiß noch, bei Hollis ist deine Mutter halb durchgedreht. Natürlich lag es auch daran, dass er solche Koliken hatte. Die ganze Nacht sind wir mit ihm auf dem Arm herummarschiert, trotzdem hat er wie am Spieß gebrüllt. Und dieser gewaltige Hunger! Meine Güte! Er hat deine Mutter leer gesaugt und konnte immer noch nicht genug bekommen…«
Er redete weiter, aber die Leier hatte ich schon so oft gehört, dass ich abschaltete und meinen Kaffee trank. Links von uns standen weitere Häuser, dahinter gab es eine Art Promenade mit Geschäften und einen öffentlichen Strand, auf dem reger Betrieb herrschte.
»Jedenfalls muss ich wieder an die Arbeit«, sagte mein Vater gerade und knüllte das Muffinpapier zusammen. »Deshalb würde ich dir jetzt gern dein Zimmer zeigen. Wir können uns später beim Abendessen ausführlich unterhalten. Einverstanden?«
»Natürlich«, antwortete ich. Wir gingen wieder hinein. Der Brandungserzeuger auf dem Beistelltisch rauschte nach wie vor in voller Lautstärke. Kopfschüttelnd streckte mein Vater die Hand aus und stellte ihn ab. Klick. Die plötzliche Stille tat fast weh. »Du schreibst also gerade eifrig?«
»Absolut. Ich habe einen richtigen Lauf. Das Buch ist bestimmt bald fertig«, antwortete er. »Eigentlich muss ich nur noch das verbliebene Material strukturieren und ein paar Passagen überarbeiten.« Wir gingen in den Flur, dann die Treppe hinauf. Oben kamen wir an einer offenen Tür vorbei. Ich konnte eine rosafarbene Wand mit einer Bordüre aus braunen Tupfen erkennen. Drinnen war es still.
Mein Vater öffnete die nächste Tür und wies hinein. »Tut mir leid, dass es so klein ist«, sagte er, als ich das Zimmer betrat. »Dafür hast du den schönsten Blick.«
Was definitiv der Wahrheit entsprach. Beides. Der Raum war winzig – außer einem Doppelbett und einem Schreibtisch passte nicht viel hinein–, doch durch das Fenster sah man einen vollkommen unberührten Uferstreifen: Sand, Strandhafer, Wasser. Sonst nichts. »Wunderschön!«, meinte ich.
»Nicht wahr? Ursprünglich war das mein Arbeitszimmer. Aber weil wir direkt daneben das Kinderzimmer einrichten mussten, bin ich auf die andere Seite des Hauses umgezogen. Ich will Thisbe ja nicht mit dem Lärm meines kreativen Prozesses stören.« Er schmunzelte, als wäre das ein Witz, den ich auch noch verstehen sollte. »Apropos – ich mache mich wirklich besser wieder an die Arbeit. Seit Neuestem ist morgens meine produktivste Zeit. Beim Abendessen kannst du mir dann alles erzählen, okay?«, sagte er. Zum zweiten Mal.
»Ah ja.« Ich sah auf die Uhr. Es war fünf nach elf. »Kein Problem.«
»Großartig.« Er drückte kurz meinen Arm und ging raus, wobei er leise vor sich hin summte. Nachdem er an der Tür zu dem rosa-braunen Raum vorbeigegangen war, hörte ich, wie sie leise geschlossen wurde.
***
Abends um halb sieben wachte ich auf, weil ein Baby weinte.
Wobei Weinen eine Untertreibung war. Denn Thisbe brüllte wie am Spieß – klarer Fall von frühzeitigem Lungentraining. Trotz der dünnen Wand zwischen uns war das Geschrei in meinem Zimmer kaum zu hören, doch als ich hinaus auf den Flur trat – auf der Suche nach dem Bad, weil ich mir die Zähne putzen wollte–, schwoll es zu ohrenbetäubender Lautstärke an.
Einen Augenblick lang blieb ich im Dämmerlicht vor dem rosa Zimmer stehen und lauschte: Wie sie brüllte, brüllte, brüllte, immer lauter, immer stärker, wie das Weinen plötzlich für kurze Zeit verebbte, dann allerdings noch viel heftiger losging. Ich fragte mich, ob ich vielleicht die Einzige war, die es mitbekam, bis ich hörte, dass jemand »Sch sch sch« murmelte. Und sofort wieder übertönt wurde.
Irgendetwas daran war mir vertraut, meldete sich aus den Tiefen meines Unterbewusstseins. Als meine Eltern gerade mit ihren nächtlichen Streitereien losgelegt hatten, hatte ich versucht, mich genau auf die Art selbst zu beruhigen. Hatte mir Sch, sch, alles gut vorgebetet, wie ein Mantra, während ich versuchte, nicht auf die beiden zu achten und einzuschlafen. Nun so etwas Ähnliches zu hören fühlte sich seltsam an, weil ich daran gewöhnt war, diese Laute nur in meinem eigenen Kopf zu hören. In der Dunkelheit, die mich umgab, während ich in meinem Bett lag. Deshalb ging ich rasch weiter.
»Dad?«
Mein Vater saß an seinem Laptop, der auf einem Tisch vor einer fensterlosen Wand stand, und rührte sich nicht, als er antwortete: »Hm?«
Ich warf einen Blick über die Schulter, den Flur entlang zum rosa Zimmer. Schaute dann wieder ihn an. Er tippte nicht, starrte bloß auf den Bildschirm. Neben ihm auf dem Schreibtisch lag ein Block mit handschriftlichen Notizen. Er sah fast so aus, als hätte er sich die letzten sieben Stunden, während ich geschlafen hatte, nicht bewegt. »Soll ich vielleicht, äh, mit dem Abendessen anfangen?«, fragte ich.
»Macht Heidi das denn nicht?«, antwortete er, ohne seinen Blick vom Monitor abzuwenden.
»Ich glaube, sie ist mit dem Baby beschäftigt«, sagte ich.
»Ach so.« Endlich drehte er sich zu mir um. »Ja, also, falls du Hunger hast – ganz in der Nähe ist ein nettes, kleines Restaurant. Da gibt’s Hamburger und Ähnliches. Und die Zwiebelringe… legendär.«
Ich lächelte. »Klingt prima. Soll ich Heidi fragen, ob sie auch etwas möchte?«
»Unbedingt. Und mir bringst du bitte einen Cheeseburger und eine Portion Zwiebelringe mit.« Er griff in die hintere Hosentasche, zog ein paar Scheine heraus, reichte sie mir. »Danke, Auden, sehr nett von dir. Vielen Dank.«
Ich nahm die Scheine und kam mir vor wie der letzte Idiot, weil ich geglaubt hatte, er käme mit. Aber natürlich konnte er seine Frau und sein neugeborenes Baby nicht einfach zu Hause sitzen lassen. »Kein Problem«, erwiderte ich, obwohl er sich schon wieder dem Computer zuwandte. »Bin gleich wieder da.«
Ich kehrte zum rosa Zimmer zurück. Thisbe war immer noch in voller Lautstärke zugange. Da ich mir also keine Sorgen machen musste, sie aufzuwecken, klopfte ich. Zweimal. Kurze Zeit später öffnete sich die Tür einen Spalt, Heidi spähte zu mir heraus.
Sie sah noch abgekämpfter aus als vorher, sofern das überhaupt möglich war. Sogar die Andeutung eines Pferdeschwanzes war verschwunden, die Haare hingen ihr strähnig und schlaff ins Gesicht. »Hi«, schrie ich, um das Gebrüll zu übertönen. »Ich wollte los, uns etwas zum Abendessen besorgen. Was hättest du gern?«
»Abendessen?«, wiederholte sie, ebenfalls mit erhobener Stimme. Ich nickte. »Ist es denn schon so weit?«
Ich blickte auf meine Uhr, als müsste ich mir das selbst noch einmal bestätigen. »Es ist Viertel vor sieben.«
»Ach du liebe Zeit.« Sie schloss die Augen. »Ich wollte extra für dich zum Empfang richtig schön kochen. Hatte alles geplant, Hühnchen, Gemüse und so weiter. Aber die Kleine war so unruhig und… «
Ich fiel ihr ins Wort: »Mach dir keinen Kopf, ich hole ein paar Hamburger. Dad hat gemeint, es gibt ganz in der Nähe einen anständigen Imbiss.«
»Dein Vater ist da?«, fragte sie, verlagerte Thisbes Gewicht in ihren Armen und blickte an mir vorbei den Flur entlang. »Ich dachte, er ist in sein Büro im College gefahren.«
»Er sitzt in seinem Arbeitszimmer«, entgegnete ich. Sie schien mich nicht verstanden zu haben, beugte sich fragend vor. »Er schreibt«, wiederholte ich, etwas lauter. »Deshalb hole ich uns etwas zu essen. Was möchtest du?«
Heidi stand einfach nur da – das Baby zwischen uns drehte fast durch – und blinzelte weiterhin über den Flur Richtung Arbeitszimmer. Die Tür stand einen Spalt offen, durch den Licht fiel. Sie machte den Mund auf, wollte etwas sagen, überlegte es sich anders, atmete tief durch. »Bestell einfach, was du magst, ich nehme das Gleiche wie du«, antwortete sie schließlich. »Danke.«
Ich nickte, trat einen Schritt zurück. Sie schloss die Tür. Das Letzte, was ich sah, war das puterrote Gesicht des aus Leibeskräften schreienden Babys.
Zum Glück war es draußen wesentlich ruhiger. Alles, was ich hörte, waren die Brandung und die üblichen Nachbarschaftsgeräusche – spielende Kinder, ab und zu ein Autoradio, ein voll aufgedrehter Fernseher–, während ich in Richtung der Kneipen und Geschäften ging.
Auf der schmalen Strandpromenade reihte sich ein Laden an den anderen: Es gab ein Saftbüdchen, den für Badeorte obligatorischen Souvenirladen, wo man billige Handtücher und mit Muscheln beklebte Uhren erwerben kann, eine Pizzeria… Ungefähr auf der Hälfte des Wegs kam ich an einer kleinen Boutique – Clementine's – mit einer leuchtend orangefarbenen Markise vorbei. An der Tür klebte ein großer Zettel, auf dem in Druckbuchstaben stand: ES IST EIN MÄDCHEN! THISBE CAROLINE WEST, GEBOREN AM 1.JUNI, 3173GRAMM.Ah, Heidis Laden, dachte ich. Blickte durchs Schaufenster, sah Regale mit T-Shirts und Jeans, eine kleine Ecke für Make-up und Bodylotion sowie ein dunkelhaariges Mädchen in einem pinkfarbenen Minikleid – sehr mini, sehr pink!–, das an der Kasse stand, Handy zwischen Ohr und Schulter geklemmt, und beim Telefonieren ihre Fingernägel inspizierte.
Dann tauchte das Last Chance Café auf. Direkt daneben befand sich das letzte Geschäft an der Promenade, ein Fahrradladen. Drei Typen in meinem Alter hockten davor auf einer verwitterten Holzbank, quatschten und sahen den Leuten nach.
»Der Punkt ist, dass der Name griffig sein muss«, meinte der eine gerade. Er war klein, stämmig und trug Shorts, aus denen ein Portemonnaie mit Kette ragte. »Er muss Power haben, verstehst du?«
»Ich finde es wichtiger, dass er clever und lustig ist«, sagte der nächste – dünn, groß und mit Locken. »So wie Schnellfuß zum Beispiel.«
»Hä? Was soll denn das heißen?«, fragte der Kurze.
»Die ersten Laufräder hießen Veloziped und das bedeutet übersetzt Schnellfuß«, meinte sein Kumpel spitzfindig.
»Das rafft doch kein Mensch« Der Stämmige seufzte. »Wir brauchen etwas, das auffällt. Wie zum Beispiel Zoomräder.«
»Also, wenn Fahrräder eins nicht haben, dann einen Zoom«, meinte der Dritte, der mit dem Rücken zu mir saß und bisher noch gar nichts gesagt hatte. »Der Name ist total hirnrissig.«
»Gar nicht wahr«, murmelte der Typ mit den Shorts. »Außerdem – hast du vielleicht irgendwelche brauchbaren Vorschläge?«
Ich hatte bis zu diesem Moment immer noch vor dem Clementine's gestanden und ging nun langsam weiter. Gleichzeitig drehte der dritte Typ sich plötzlich um. Unsere Blicke begegneten sich. Er hatte dunkle, kurze Haare, war supermegabraun und lächelte mich unvermittelt an. Ohne mich aus den Augen zu lassen, meinte er gedehnt: »Wie wär’s mit: Gerade sehe ich das hübscheste Mädchen von ganz Colby vorbeilaufen?«
»Oh, Mann«, sagte der Dünne kopfschüttelnd und der andere lachte schallend auf. »Das ist so was von arm.«
Ich merkte, dass ich rot wurde, während ich stur weiterging. Und, dass er mir immer noch nachblickte, immer noch lächelte. »Ich habe nur gesagt, was sowieso jeder sehen kann«, rief er, als ich so gerade noch in Hörweite war. »Eigentlich hättest du auch mal Danke sagen können.«
Tat ich aber nicht. Ich sagte gar nichts, weil ich keine Ahnung hatte, wie ich auf so eine Bemerkung reagieren sollte. Meine Erfahrungen im Umgang mit Freundinnen waren ja schon begrenzt, doch meine Kenntnisse über Jungs im Prinzip nicht vorhanden. Das wenige, das ich wusste, war auf den Kontakt beschränkt, den wir als Konkurrenten um die besten Notendurchschnitte, Zensuren und College-Aufnahmetests hatten.
Nicht, dass ich noch nie auf jemanden gestanden hätte. An der Jackson Highschool hatte ich mit einem Jungen zusammen Physik gehabt, der in puncto Gleichungen oder Formeln zwar ein hoffnungsloser Fall war. Trotzdem bekam ich jedes Mal, wenn wir Experimente zusammen machen mussten, vor Aufregung feuchte Hände. An der Perkins Day hatte ich schüchtern mit Nate Cross geflirtet, der in Mathe neben mir saß. Aber da die ganze Welt in Nate Cross verknallt war, konnte man das wohl kaum zählen. Erst an der Kiffney-Brown, als ich Jason Talbot kennenlernte, dachte ich, ich würde beim nächsten Treffen mit meinen alten Freundinnen endlich auch einmal eine echte Jungsgeschichte erzählen können. Jason war intelligent, sah gut aus und war ungebunden, denn seine Ex von der Jackson High hatte ihn wegen eines – wie er sich ausdrückte – »kleinkriminellen Schweißers inklusive Tattoo« abserviert. Weil die Klassen an der Kiffney-Brown so überschaubar waren, verbrachten wir automatisch viel Zeit miteinander und versuchten uns gegenseitig als Jahrgangsbester auszustechen, um bei der Zeugnisverleihungszeremonie die große Rede halten zu dürfen. Als er mich fragte, ob ich mit ihm zum Abschlussball gehen würde, war ich aufgeregter, als ich je zugegeben hätte. Bis er (wie bereits erwähnt) einen Rückzieher machte, wegen der »einmaligen Gelegenheit«, an dieser höchst bedeutsamen Ökologiekonferenz teilzunehmen. »Ich wusste, es würde dir nichts ausmachen«, meinte er, als ich mechanisch nickte, nachdem er es mir mitgeteilt hatte. »Du verstehst eben, was wirklich wichtig ist.«
Okay, er hatte mir nicht direkt gesagt, ich sei schön oder so etwas. Aber in gewisser Weise war auch das ein Kompliment.
Es war voll im Last Chance Café, Leute standen Schlange, um einen Tisch zu bekommen, und durch ein kleines Fenster in der Tür sah man, wie zwei Köche durch die Küche wirbelten, während eine Bestellung nach der anderen auf den Halter in der Durchreiche gespießt wurde. Ich bestellte bei einem hübschen, dunkelhaarigen Mädchen mit Lippen-Piercing und setzte mich auf einen Stuhl am Fenster, um auf das Essen zu warten. Ließ meinen Blick über die Promenade wandern. Bemerkte, dass die Typen immer noch auf der Bank hockten. Der, der mich angequatscht hatte, lehnte sich zurück, hatte die Hände im Nacken verschränkt und amüsierte sich über seinen Kumpel, den Kleinen, Stämmigen, der mit dem Rad vor den beiden anderen hin und her fuhr und dabei immer wieder kleine Sprünge machte.
Nachdem meine Bestellung fertig war, wurde mir ziemlich schnell klar, dass mein Vater nicht übertrieben hatte. Noch ehe ich zur Tür raus war, stopfte ich mir schon einen Zwiebelring nach dem anderen in den Mund. Inzwischen herrschte auch auf der Promenade ziemlicher Betrieb: Familien schlenderten vorbei und aßen Eis, Pärchen saßen eng umschlungen auf Bänken, jede Menge Kinder tobten über den Sand. Und im Hintergrund: ein grandioser Sonnenuntergang in Orange und Pink. Darauf konzentrierte ich mich und würdigte den Fahrradladen keines Blickes, während ich daran vorbeilief. Der Typ war immer noch da. Mittlerweile redete er mit einem großen, rothaarigen Mädchen, das eine riesige Sonnenbrille trug.
»Hey«, rief er mir zu, »falls du heute Abend gern was vorhättest – an der Spitze gibt es ein großes Lagerfeuer. Ich halte dir einen Platz frei.«
Ich warf ihm einen Blick zu. Die Rothaarige beäugte mich irritiert. Deshalb verkniff ich mir vorsichtshalber jeglichen Kommentar.
»Die Lady ist eine echte Herzensbrecherin«, sagte er und lachte. Ich ging stur weiter, spürte, wie sich die grimmigen Blicke der Rothaarigen in meinen Rücken bohrten. »Behalt’s im Hinterkopf. Ich werde nach dir Ausschau halten.«
Zurück bei Dad und Heidi im Haus suchte ich nach Tellern und Besteck und deckte den Tisch. Ich schüttete gerade die Ketchuppäckchen aus der großen Papiertüte auf einem kleinen Haufen zusammen, als mein Vater die Treppe herunterkam.
»Dachte ich’s mir doch, dass ich Zwiebelringe rieche.« Begeistert rieb er sich die Hände. »Sieht sehr verlockend aus.«
»Kommt Heidi auch?«, fragte ich und legte seinen Hamburger auf einen Teller.
»Weiß ich nicht genau«, antwortete er und nahm sich einen Zwiebelring. Mit vollem Mund fügte er hinzu: »Die Kleine hat Probleme heute Abend. Wahrscheinlich möchte Heidi sie erst zum Einschlafen bringen.«
Ich blickte flüchtig die Treppe hoch. Konnte es tatsächlich sein, dass Thisbe immer noch brüllte? Immerhin war ich mindestens eine Stunde lang unterwegs gewesen. »Äh
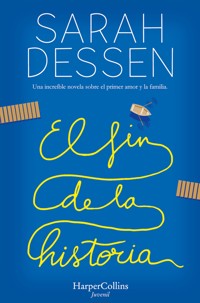

















![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)










