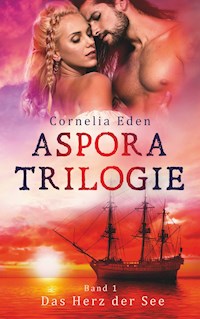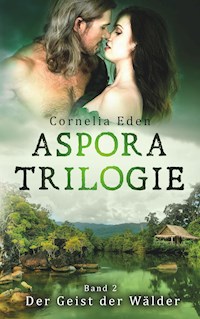Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Theologische Impulse
- Sprache: Deutsch
Um der verbotenen Liebe zum Padeshah des Menschenreichs zu entfliehen, nimmt die Elfenkriegerin Seynin einen gefährlichen Auftrag an. Unter falschem Namen tritt sie in die Dienste des gefürchteten Dunshaan von Dakktien, der sie mit einem Zauber an sich bindet und zu seinem Schatten macht. Doch in seiner Welt der Gewalt und der dunklen Geheimnisse findet sie auch Liebe und beginnt um den Mann zu kämpfen, den er in seinem Herzen verbirgt. Dabei muss sie sich nicht nur gegen alte Feinde, Vampire und einen Halbgott stellen, sondern auch gegen Freunde und sogar gegen ihn selbst.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 762
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Kapitel 1 – Der Auftrag
Kapitel 2 – Sal'hadar
Kapitel 3 – Sang'ri-lak
Kapitel 4 – Wiedergeburt
Kapitel 5 – Dunshaan
Kapitel 6 – Die Spuren der Vergangenheit
Kapitel 7 – Die Weihe
Kapitel 8 – Im Schatten
Kapitel 9 – Gäste auf Rahdfalon
Kapitel 10 – Thaer
Kapitel 11 – Auf verlorenem Posten
Kapitel 12 – Enthüllungen
Kapitel 13 – Spionin der Schilde
Kapitel 14 – Amon
Kapitel 15 – Alhameída
Kapitel 16 – Der letzte Assassine
Kapitel 17 – Auf dem Weg nach Thayon
Kapitel 18 – Der Mondblutpalast
Epilog
Prolog
Er kam zu spät! Das Entsetzen seines Schattens ergoss sich wie geschmolzenes Zinn in seine Adern und erstarrte, als die Frau, die der Thayone soeben noch geliebt hatte, durch einen schnellen Schwertstoß starb. Dann folgte der Schmerz, mit dem dasselbe Schwert Ray Suuls Lunge durchbohrte. Zu spät!
Die Seele begann schnell, dem sterbenden Körper zu entgleiten. Der Dunshaan spürte es wie eine Schwäche, die seinen eiligen Schritten Kraft entzog. Ein zweites Mal würde er nun seinen Schatten verlieren, ein weiteres Mal zurückbleiben, obwohl es ihm gebührte, vorauszugehen.
Er wurde langsamer und wich einer Patrouille der Stadtwache aus, zwei Männern in königsblauen Umhängen, geharnischt und eindrucksvoll bewaffnet, deren Fackeln sie zu leichten Zielen machten. Sie unterhielten sich angeregt und sorglos. Narren!
Der Dunshaan blickte zum nächtlichen Himmel hinauf, wo sich Unaris beharrlich hinter einer Wolkenbank verbarg. Das imposante Gestirn war ihm wohlgesonnen.
„Arhalut, mana Duun“, hörte er sich raunen, dann senkte er den Kopf und berührte seine Stirn.
Das unscheinbare Haus, in dem der Thayone seine Geliebte getroffen hatte, stand in einer Gasse in schützender Dunkelheit, dennoch bewegte er sich mit gewohnter Vorsicht darauf zu. Der Mörder war noch immer dort. Es genügte ihm nicht, seine treulose Frau getötet zu haben, nun ergötzte er sich am Tod seines Rivalen. Warum sonst brachte er es nicht zu Ende?
Rache war ein undankbarer Gefährte, dachte der Dunshaan, als er das Haus betrat. Die Genugtuung versprach so viel und gab so wenig, zu schnell verflüchtigte sich ihr süßer Geschmack und erst dann wurde offenbar, wie hoch der Preis war, den man dafür zahlte.
Nachdem er die Treppe zum Dach hinaufgestiegen war, hielt er einen Moment lang inne. Er würde seinem Schatten nicht mehr helfen können, sein Tod war gewiss, die aufsteigende Kälte nicht mehr aufzuhalten. Alle Hoffnung, die er in seinen ehrgeizigen Nachfolger gesetzt hatte, zerschellte in eisiger Ernüchterung. Der Schatten war dahin, samt der vergeudeten Jahre seiner Ausbildung. Wieder würde er von vorn beginnen müssen, und dieser Tatsache musste er ins Auge sehen.
Der Thayone wäre der perfekte Nachfolger gewesen, allein seine Schwäche für die Frauen der Menschen erwies sich nun als fatal. Vielleicht war es vom Schicksal bestimmt, vielleicht hatte es einen Irrtum korrigiert, der ihn früher oder später als des Amtes unwürdig entlarvt hätte, dann besser früher, so schmerzhaft der Verlust auch war. Ein anderer würde seinen Platz einnehmen, ein neuer Schatten, den er mit noch größerer Sorgfalt formen konnte, und dieser würde vollkommen sein. Nun galt es nur noch dafür zu sorgen, dass der Tod des jetzigen nicht gänzlich sinnlos war.
Der Dunshaan straffte seine Gestalt, um die Schwäche zu vertreiben, die der Sterbende auf ihn übertrug. Die schwarze Robe der Duunkar umhüllte seinen Körper wie das Dunkel einer mondlosen Nacht. Er wiegte seinen Kopf und überließ sich ganz dem vertrauten Abgrund, der sein Gesicht unter der Kapuze verfinsterte. Anonymität war eines der wenigen Dinge, die er wahrlich genoss, ein so harmloses Instrument und doch so mächtig, dass es Knie beugte, Münder öffnete und Waffen aus starren Händen gleiten ließ. Die Wirkung war zuverlässig und schwerer zu durchbrechen als ein erhobener Schild. Er zog die Kapuze noch ein Stück tiefer und öffnete die Tür.
Mit schnellen Blicken erfasste er die sich darbietende Szenerie. Das Liebesnest war ein winziges Zimmer, nur vom Licht eines Wärme versprühenden Kamins erhellt. Der jüngste Erbe der mächtigen Blutlinie von Sink Molan lag bäuchlings und splitternackt auf dem weißen Laken des Bettes. Er verbarg das Blut, das aus seinem dunkelhäutigen, stattlichen Körper rann. Nur der Einstich auf seinem Rücken zerstörte die Illusion, dass er erschöpft vom Liebesspiel schlief. Das Schwert, das diese Wunde hinterlassen hatte, lag blutverschmiert auf den rauen Bodendielen aus Eichenholz, daneben hockte Fürst Cardif und stieß geistesabwesend heisere Schluchzer aus, die tote Gemahlin an sich gedrückt. Er war keine Gefahr mehr. Der Dunshaan beachtete ihn kaum, er setzte sich auf das Bett und drehte die schlaffe Gestalt seines Schattens herum. Flatternd öffneten sich die Lider des Thayonen. Seine dunkle Haut glänzte im Licht des Kamins.
„Mein Dunshaan …“, röchelte er mit bebenden Lippen. „Vergebt mir! Ich war ungehorsam und leichtsinnig … und dumm. Ich habe Euch enttäuscht.“
„Mehr als Ihr Euch vorstellen könnt“, gab er kühl zurück.
„Die Fürstin…ist sie tot?“
„Ja.“ Der Dunshaan spürte den Schmerz des Jüngeren, doch er zwang sich, ihn zu ignorieren. „Unsere Wege müssen sich nun trennen. Ich entlasse Euch aus meinen Diensten und gebe Euch Euren Namen zurück: Ray Suul, Sohn des Masil Kaar. Mein Wort, dass Euer Name im Quaduun Erwähnung findet, doch Eure Linie endet hier. Wenn Euer Lebensfunken erloschen ist, dann wird auch all das sterben, was wir gemeinsam aufgebaut und geteilt haben. Ihr wart mein Schatten, alles was ich bin, doch Ihr lasst nichts zurück. Ich hoffe, sie war es wert.“
Ray Suuls Gesicht verzog sich vor Schmerz und Reue.
„Vergebt mir! Bitte sagt, dass Ihr mir vergebt!“
„Es gibt nichts zu vergeben, Freund. Eure Schwäche für diese Frau offenbart nur mein eigenes Versagen. Ich war zu nachsichtig, ließ Euch gewähren, statt Euch Beherrschung zu lehren. Ihr seid es, der mir vergeben muss. Ein Schwert im Rücken, das ist ein unwürdiger Tod.“
„Ich …“ Ein blutiges Rinnsal floss aus dem Mund des Thayonen, der gurgelnd nach Atem rang. „Ich habe Euch geliebt, mein Vater, mein Bruder, mein… Dunshaan.“
„Findet Euren Frieden… oder findet nichts.“
Er drückte die Lider des Mannes zu, nachdem mit dem letzten Wort auch der letzte Hauch über dessen Lippen gekommen war.
„Euer Werk ist vollbracht“, wandte sich der Dunshaan an den Fürsten, der noch immer neben seiner leblosen Gemahlin kniete, ihn nun jedoch anstarrte wie ein Tier, das in einer Falle saß. Es war der übliche Blick, der ihm entgegenschlug, Angst, Todesangst, Entsetzen, welches den Körper des Fürsten wie ein Gift zu lähmen schien. Seine Stimme klang heiser, voller Schuldgefühl, gleich einem gebrochenen Rad, das auf seiner Narbe krächzte.
„Das Schwert meines Vaters“, sagte er mit Blick auf die Waffe, die am Boden lag. „Er zog im ersten Erzkrieg gegen Thayon, das Schwert kehrte allein zurück. Ich habe es nie zuvor benutzt.“
„Es erfüllt noch immer seinen Zweck.“
„Ich habe meine Frau geliebt! Und ich hätte Ihr alles verziehen, sogar eine Affäre … irgendwann. Aber mit einem verdammten Thayonen? Niemals!“ Eine neue Nuance trat in seinen Blick … Aufbegehren. „Sie war es, die Verrat beging, das Gesetz brach … und mein Herz. Sie hat alles zerstört.“
Der Dunshaan erhob sich von der Bettstatt und wandte sich dem Tisch zu, auf dem neben einer Weinflasche und zwei geleerten Kelchen die lederne Tasche mit Ray Suuls persönlichen Aufzeichnungen lag. Schweigend öffnete er sie, entnahm das Schreibzeug und ein leeres Pergament, dann warf er die Tasche samt ihrem Inhalt in den Kamin, wo das Feuer augenblicklich zu neuem Leben erwachte.
Das Schweigen machte dem Fürsten sichtbar zu schaffen, und als es andauerte, begann er zaghaft zu sprechen.
„Werdet Ihr mich nun töten? … Ihr seid auch ein Thayone, nicht wahr? … Natürlich … Ihr seid ein thayonischer Spion, genau wie er.“ Er hob herausfordernd den Kopf, weil er noch immer keine Antwort erhielt. „Aber ein Dunshaan seid Ihr nicht. Selbst im Tod sprecht ihr Thayonen noch Lügen aus.“
Da endlich entlockte er dem Mann, der sich am Tisch niederließ und das Tintenfass ein Stück zur Seite rückte, eine Reaktion.
„Ich gestatte Euch, jede Anschuldigung gegen Ray Suul auszusprechen, so sie berechtigt ist“, sagte er, während er das Pergament entrollte. „Aber wenn Ihr ihn der Lüge bezichtigt, dann täuscht Ihr Euch, und solltet Ihr es noch einmal tun, stopfe ich Euch den Mund mit heißer Asche, was Euch ganz sicher die Sprache verschlägt.“
Der Blick des Fürsten glitt zum Kamin und über die Glut, die darin prasselte, indes redeten seine Lippen weiter, als agierten sie jenseits der Vernunft.
„Kein Blutsauger würde es wagen, die Grenze nach Dakktien zu überschreiten oder gar einen Fuß in diese Stadt zu setzen, schon gar nicht, wenn er dem Thayonischen Rat angehört.“
Der Dunshaan lachte dunkel und griff nach der Feder.
„Glaubt Ihr das wirklich? Fürstin Cardifa bewies eine schnellere Auffassungsgabe, einen wacheren Geist und viel mehr Weitsicht als Ihr.“
„Meine Frau war ein Mitglied des Diwan!“, stieß der Fürst anklagend hervor. „Deshalb hat er sie umgarnt, nicht wahr? Er hat sie benutzt.“
„Nein … er hat sie rekrutiert“, gab der Dunshaan gleichgültig zurück, während er die Feder in Tinte tauchte und über das Pergament kratzen ließ. „Er hatte den Auftrag, Eure Frau für meine Interessen zu gewinnen, und das ist ihm gelungen. Dass sie sich ineinander verliebten, war eine unglückliche Fügung, die ich nicht weniger bedaure als Ihr.“
„Sie hätte Euch niemals unterstützt“, sagte Cardif und strich der toten Fürstin übers Gesicht. „Sie war gütig und hatte ein offenes Herz für alle Geschöpfe auf dieser Welt, für Menschen wie auch Thayonen, Dykh oder Khyiil, selbst für die Ausgestoßenen und sogar für Vampire. Sie machte keinen Unterschied und hat den Krieg nie verstanden.“
„Sie hat auch das Genesegesetz nie verstanden, das jeden, der nicht reinen Blutes ist, aus Eurer Gesellschaft verbannt“, warf der Dunshaan ein.
„… aber sie hätte sich niemals gegen Dakktien gewandt. Sie war immer stolz auf ihr Menschentum und unsere hohe Kultur, mit der sich allenfalls das Elfenvolk zu messen vermag.“
Der Dunshaan erhob sich und trat auf ihn zu.
„Genau deshalb fiel meine Wahl auf sie. Ihr habt nun all meine Pläne zunichtegemacht. Zwei Leben habt Ihr genommen, die beide von höchstem Wert für mich waren, und alles, was ich im Gegenzug bekomme, ist Eure lausige Existenz. Selbst der schwächste aller Vampire von Thayon vermag seinen Blutdurst besser zu kontrollieren als Ihr Eure niedere Eifersucht und Eure offenkundige Angst vor dem Tod oder was Euch sonst noch heimsuchen mag. Ein feiger Angriff aus dem Hinterhalt war alles, wozu Ihr fähig wart.“
Die Gestalt des Fürsten sackte ein weiteres Stück in sich zusammen, sein Gesicht alterte jäh um ein ganzes Jahrzehnt.
„Es ist wahr. Ich bin kein mutiger Mann, der auf den Schlachtfeldern des Krieges zu Ruhm und Ehre kam. Ich fürchte den Tod, und ich fürchte auch Euch. Wenn Ihr mein Leben verlangt, wäre ich zu einem Handel bereit.“
Der Dunshaan knurrte vor Abscheu, es klang, als würde in der Ferne ein aufziehendes Gewitter grollen.
„Dann unterschreibt dieses Pergament.“
Der Verurteilte schaute auf und versuchte mit verquollenen Augen die Zeilen zu entschlüsseln, die der Dunshaan ihm entgegenhielt.
„Was ist das?“
„Euer Geständnis. Ich will Eure Unterschrift darauf sehen und Euer Siegel.“
Trotz des Hoffnungsschimmers in seinen Augen pendelte Cardifs Kopf ängstlich hin und her.
„Dann bin ich für immer in Eurer Hand. Ich würde mich in ewige Knechtschaft begeben.“
„Ihr seid nicht der erste auch nicht der einzige Mensch, der mir gehört, aber Ihr wäret der erste, der diese Entscheidung bereut. Ich handle mit Leben und mit Tod, und ich bin mir des Wertes von beidem bewusst. Trotz Eurer Unzulänglichkeiten seid Ihr in der Halle des Diwan von größerem Nutzen, als im Totenschrein Eurer Ahnen.“
„Aber … ich bin kein Ratsmitglied“, wand er ein.
„Bemüht Euch um den Sitz Eurer jüngst verstorbenen Frau, deren Leichnam morgen früh gefunden werden wird.“
„Nein! Wenn sie gefunden wird …“
„… dann werdet Ihr eine angemessene Zeit um sie trauern, während diejenigen die Verantwortung für Eure Tat übernehmen, in deren Schuld Ihr fortan steht.“
Wenig später rollte der Dunshaan das gesiegelte Pergament zusammen und schob es in den Gürtel seiner Robe.
„Geht nun, Fürst. Möget Ihr alt und weise werden, denn dies ist zweifellos der kostspieligste Handel, den ich je eingegangen bin, und ich bezweifle auch, dass er sich je auszahlen wird. Erfüllt die Aufgaben, die Ihr erhaltet, und betet, dass wir uns nie wieder begegnen.“
Fürst Cardif erhob sich von dem Stuhl, auf dem er seine Unterschrift geleistet hatte, und strebte mit hastigen Schritten der Tür entgegen, zögerte jedoch, sie zu öffnen. Er wandte sich um.
„Sal'hadar“, sagte er und nickte dabei, als wüsste er genau, wovon er sprach. „Ihr seid kein Dunshaan, sondern ein Ausgestoßener, ich hätte gleich darauf kommen müssen, kein Wunder, dass Ihr Euer Gesicht verbergt.“
„Ihr solltet gehen, und das rasch.“
„Lasst mich zumindest wissen, wem mein Leben nun gehört und wie ich Euch ansprechen darf.“
„Mit 'Dunshaan'.“
Der Fürst schnaufte verdrossen, öffnete jedoch die Tür und schätzte seine Chancen, unbehelligt ins Freie zu gelangen.
„Wie es Euch gefällt … Dunshaan.“ Er neigte den Kopf und verzog das Gesicht. „Als Sal'hadar macht Ihr mir Angst genug. Doch Ihr seid sterblich, sonst hätte der Blutgeruch in diesem Zimmer Euch längst zur Raserei gebracht. Und auch wenn Ihr mein Leben bedroht und mich erpresst … wofür? Ihr verfolgt Ziele, die für Thayon ohne Interesse sind. Ihr versucht den Diwan zu unterwandern und dakktische Gesetze ins Wanken zu bringen, wobei Ihr in den Hallen des Palasts sogar einen mächtigen Fürsprecher habt. Weshalb gefallt Ihr Euch in der absurden Vorstellung, einer der unsterblichen Herrscher von Thayon zu sein? Warum haltet Ihr an dieser offenkundigen Lüge fest?“
Die harten Dielen des Bodens schlugen dem Fürsten ins Gesicht, noch ehe dieser einen Schritt vor den anderen setzen konnte. Er schrie auf, als sein linker Arm gewaltsam auf den Rücken gedreht wurde. Der Schrei überschlug sich, als der Arm aus dem Gelenk sprang und mit einem dumpfen Knacken brach. Sein Angreifer wartete ab, bis das Gebrüll zu einem jammervollen Winseln abgeklungen war, dann beugte er sich nieder, um sicherzugehen, dass der Fürst seine Worte auch vernahm.
„Sprecht mit dieser Stimme und mit dieser Kühnheit vor dem Diwan, und Ihr werdet mein Wohlwollen, Macht und mehr Reichtum erlangen, als Ihr je zu träumen wagtet. Ihr wollt wissen, wem Ihr dient? Ich bin der Dolch, den Ihr bis zu Eurem letzten Atemzug an Eurer Kehle spüren werdet, die Bürde, die Ihr selbst Euch aufgeladen habt, und die Klaue, die das Herz dieses glorreichen Landes in Atem hält. Ihr dient dem Dunshaan von Dakktien.“
Kapitel 1 – Der Auftrag
Seynin wusste, dass sie träumte, denn sie kannte den Traum, den ängstlichen Wahn, der sie diesmal aus den Augen eines untersetzten Fuhrmanns verfolgte.
„Bitte nicht! Ich bin ein treuer Untertan der Duunkar. Ich spende regelmäßig in den Tempeln und besuche die Messen. Aber … ich habe Familie, eine Frau, die hart arbeitet, zwei Töchter und drei starke Söhne. Schon bald werden sie alt genug sein, um nach Dakktien zu ziehen.“
Es knackte vernehmlich, als Seynins Eckzähne über die untere Zahnreihe wetzten, eine dumme Angewohnheit. Unbewusst bleckte sie ihre Lippen, worauf ihrem Opfer ein heiserer Aufschrei entfuhr. Seynin rief sich zur Ordnung.
„Ängstigt Euch nicht“, sagte sie und strich dem zitternden Mann beruhigend über die Schläfe. „Ich habe nicht vor, Euch zu töten oder gar zu verwandeln. Ich erbitte Eure Hilfe.“
„Meine… Hilfe?“ stammelte er.
„Nichts anderes. Ich habe Euch für meine Bedürfnisse ausgewählt, weil Ihr ein Mann seid, stark und nicht zu jung. Sagt mir, wäre es Euch lieber, ich würde mich den Schwachen, den Halbwüchsigen oder den Frauen zuwenden?“
Er schwieg, offensichtlich wäre es ihm lieber gewesen.
„Ich vermag meinen Blutdurst zu zügeln“, fuhr Seynin mit gedämpfter Stimme fort. „Gestattet mir, von Euch zu trinken. Dafür gestatte ich Euch, zu Eurer Familie zurückzukehren … und zu leben.“
Ein Zeichen der Zustimmung erhielt sie nicht, aber das kannte sie schon. Mochten die Thayonen ihren Vampirherrschern auch noch so ergeben dienen, mochten sie Tempel für sie errichten, um sie Göttern gleichzustellen, im gleichen Maße fürchteten sie sie auch.
Der Mann wich zurück, als sie sich ihm näherte. Ihr Hunger schwoll augenblicklich an, wurde schmerzhaft, wie immer, wenn sie kurz davorstand, ihn zu stillen. Und wie immer vermochte sie nicht zu unterscheiden, ob der stechende Schmerz in ihrer Brust der Hunger oder ihr Mitleid war, als sie den Thayonen mit hypnotischer Gewalt bannte und eine sichtbar pulsierende Ader an seinem Arm aufbiss, um sich an dem süßen Leben, das aus ihm heraussprudelte, zu laben.
‚Hör auf, hör auf!’, hämmerte es auch schon in ihrem Kopf, als sie den ersten Heißhunger gestillt hatte. Der Mann zitterte erbärmlich, während sie um ihre Beherrschung kämpfte. Sie hatte zu saugen aufgehört, konnte jedoch nicht verhindern, dass ihre Zunge über die kleinen Rinnsale leckte, die aus der winzigen Wunde herausflossen wie Nektar aus einem geborstenen Bienenstock. Gewaltsam riss sie sich los und stieß den Mann von sich, der rückwärts taumelte und in der Dunkelheit verschwand. Seynin blickte ihm nach und spürte Tränen über ihre Wangen rinnen.
„Es tut mir leid“, flüsterte sie erstickt. „Es tut mir so leid.“
Ihr Weinen wurde lauter. Sie schlug die Hände vors Gesicht. Schluchzend und verschwitzt schreckte sie aus dem Schlaf und grub ihre Fingernägel tief ins eigene Fleisch, bis sie den beruhigenden Schmerz spürte, der ihr sagte, dass der Traum vorüber und ihr Verlangen nach einem Krug Wasser die Wirklichkeit war. Erschöpft ließ sie sich zurück auf ihr Kissen fallen.
Unaris schien durchs Fenster und warf einen hellen Streifen auf das schwere, weiße Fell, das Seynin begrub, blendete sie, so dass sie eine Weile blinzeln musste, bis sie ihr Schlafzimmer in der Garnison Alhameída erkannte.
Ein ganzes Jahr war nun schon vergangen, seit sie sich Murella Duuns Behandlung unterzogen hatte. Ihr Dunkles Blut gehörte der Vergangenheit an, doch die Träume blieben.
Sie schlug das Fell zur Seite und erhob sich von der Bettstatt, trank langsam und genussvoll einen Becher Wasser leer, dann nahm sie ihren Umhang und verließ das Gemach.
Während sie über den breiten Wehrgang durch die Nacht schritt, atmete sie tief und mit halb geschlossenen Lidern. Die kühle Luft, die vom nahen Gebirge herabsank, tat ihr gut. Niemals würde sie verstehen, warum die Menschen es vorzogen, in stickigen Gebäuden zu schlafen. Kein Khyiil wäre je auf diesen Gedanken gekommen. War es ein Wunder, dass sie Albträume hatte, wenn sie auch in dieser Hinsicht versuchte, sich den Menschen anzupassen?
Die Alhameída, die Hochburg der Schilde am Fuße des erzreichen Zentralgebirges von Dakktien, zog sie nach wie vor in ihren Bann. Sie barg Rüstungsarsenale, Trainingsplätze für alle Arten des Kampfes und über achthundert Männer und Frauen der dakktischen Streitmacht, die an Disziplin und Kampfkunst ihresgleichen suchte. Trotzdem vermittelte die Garnison die Ruhe und Abgeschiedenheit eines Klosters, auch wenn tagsüber das Klirren der Schwerter nur selten abklang. Seynin mochte diesen Ort, sie zog ihn sowohl ihrem Landhaus in Brennen als auch dem Palast des Padeshahs in Gestade vor, obwohl letzterer von überwältigender Schönheit war und in seinen Annehmlichkeiten unübertroffen. Nicht einmal die Lilienfeste, die Königin Khyiil bewohnte, und in der Seynin den Großteil ihrer Jugend verbracht hatte, kam diesem großartigen Bauwerk aus weißem Marmor und tiefschwarzem Eisenholz gleich. In jedem noch so kleinen Winkel hatten die Menschen ihre Liebe zur Kunst verewigt. Man konnte Tage damit verbringen, die Schnitzereien, Reliefs und Mosaiken zu bewundern, ohne auch nur die Hälfte davon gesehen zu haben. Doch in ihrem Herzen war und blieb Seynin eine Kriegerin, deshalb fühlte sie sich in der aus grob gemeißelten Granitblöcken errichteten Alhameída, die sich so dicht an die Felswand schmiegte, dass sie fast mit ihr verschmolz, und in der sich Kampfgeschrei mit dem Singsang gemurmelter Gebete mischte, um einiges mehr zuhause.
Aus den Schatten, die das Mondlicht warf, schälte sich eine vertraute Gestalt. Überrascht blieb sie stehen.
„Malik.“
Zwar hatte sie das dunkle Schemen schon aus einiger Entfernung ausgemacht, es jedoch für eine der Schildwachen gehalten. Erst jetzt erkannte sie den Mann an der Außenmauer, der mit aufgestützten Armen auf die neblig schimmernde Landschaft tief unter ihnen blickte.
Er trug noch immer das Reisegewand, in dem er am Tag zuvor den zweistündigen Ritt von Gestade zur Alhameída hinter sich gebracht hatte. Auch den breiten Silberreif, der sein schwarzes Haar so wunderbar zur Geltung brachte, hatte er nicht abgelegt, obwohl die Khyiil wusste, wie gern er sich am Abend davon trennte. Er hatte noch nicht einmal versucht, sich zur Ruhe zu begeben. Seynins Schultern sanken herab. Es bedrückte sie, wenn er Kummer hatte.
Malik war der erste Mensch gewesen, dem sie begegnet war. Würdevoll hatte er damals vor mehr als drei Jahren vor der Königin gestanden und hatte nicht nur sie, sondern auch alle anderen Khyiil mit der Weisheit seiner Worte beeindruckt. Ein so edler Mann verdiente ein Leben, das nicht von alter Trauer getrübt und von neuen Sorgen durchdrungen war.
Kurz bevor sie ihn erreichte, fuhr er herum.
„Bei den Göttern! Ihr schleicht leiser als der Wind durch die Nacht.“
„Wäre ich geschlichen, hättet Ihr mich nicht bemerkt“, gab sie lächelnd zurück. „Aber ich wollte Euch nicht erschrecken, verzeiht.“
Er lachte jedoch und schüttelte den Kopf. „Euer Anblick lässt mich den Schreck schnell vergessen. Ich freue mich Euch zu sehen, wie immer, auch wenn es eine ungewöhnliche Stunde ist. Eure Gesellschaft ist mir willkommen. Nun also, sagt mir, was kann der Padeshah von Dakktien für die erlauchte Botschafterin des Elfenreichs tun?“
„Er könnte weniger förmlich sein“, gab sie zurück. „Die Khyiil, die des Nachts über den Wehrgang wandert, weil sie nicht schlafen kann, fragt sich, was ihr Freund Malik um diese Zeit hier oben tut.“
„Er kann auch nicht schlafen“, antwortete er, doch er winkte ab und grinste jungenhaft. „Und wie es aussieht, bringt Ihr mich nun für den Rest der Nacht um den Schlaf.“
Sie zwinkerte verschmitzt, was den Großteil der Schatten aus seinen Augen wischte, doch die Falten auf seiner Stirn blieben. Seynin strich über die dunkelblaue Seide, die seinen Oberarm bedeckte.
„Der Waffenstillstand mit Thayon währt nun schon viele Monate, und ich bin überzeugt, dass er noch lange anhalten wird. Ihre Niederlage war vernichtend, sie werden Jahre brauchen, um sich wieder …“
„Das ist es nicht“, unterbrach er sie. „Ich weiß, dass die Thayonen niemals Ruhe geben werden. Sie sind auf unsere Erzlieferungen angewiesen … und ja, es quält mich, dieses Volk zum Feind zu haben und Ihnen jede Unterstützung verweigern zu müssen. Aber sie werden auch weiter kein Erz von uns bekommen, solange sie an ihrem Kult festhalten und sich der Herrschaft von Vampiren beugen. Dakktien ist in der Verantwortung, auch allen anderen Völkern gegenüber. Alle sind vom Dunklen Blut bedroht. Dieser Krieg wird erst dann ganz zu Ende sein, wenn in Thayon wieder ein sterblicher König den Thron besteigt, so wie einst, als noch Karawanen zwischen unseren Reichen wanderten, als wir noch Wissen tauschten, Güter handelten und natürlich Erz, bevor Duun die Welt mit Angst überzog, vor der Herrschaft der Duunkar. Doch Sorge bereitet mir all das nicht. Eines Tages wird es so sein. Die Thayonen werden ihren Irrweg erkennen, und so lange werden wir uns zu schützen wissen. Ich vertraue auf Amons Scharfsinn und auf Euren Rat.“
„Dann also die Sal'hadar“, mutmaßte Seynin weiter. „Sie waren in letzter Zeit recht aktiv.“
Der Padeshah hob jedoch nur seine Schultern ein Stück an.
„Die Sal'hadar bereiten mir Kopfzerbrechen schon solange ich denken kann. Ich kann es mir nicht leisten, ihretwegen besorgt zu sein, andernfalls hätte ich noch nie eine ruhige Minute gehabt.“
„Was ist es dann, was Euch solchen Kummer bereitet, dass er Euch um den Schlaf bringt? Ist es der gleiche Grund, warum wir so überstürzt aus der Hauptstadt abgereist sind? Es schien mir wie eine Flucht.“
Malik nickte daraufhin, wandte sich jedoch ab und legte seine Hände auf die Mauer. Sein Blick glitt in die Ferne wie schon zuvor.
„Diesmal ist es etwas Persönliches“, begann er nach einer Weile. „Ich stehe vor einer Entscheidung, die sich auf den Rest meines Lebens auswirken wird, und an diesem Ort finde ich die nötige Ruhe. In gewisser Weise betrifft es auch Euch, doch es fällt mir schwer …“ Er räusperte sich, als wolle er Zeit gewinnen. „Kurz bevor wir von Gestade aufbrachen, ist der Diwan an mich herangetreten. Der Rat sorgt sich um den Erhalt der Dynastie Dilashakan.“ Lautstark atmete er ein und wieder aus. „Im Wortlaut der weisen Männer und Frauen gesprochen, soll ich endlich meine…Nachfolge regeln.“
Seynin trat an die Mauer, um ihn von der Seite anzusehen. Sie war keineswegs überrascht, dass der Diwan es wagte, den Padeshah in einer so persönlichen Angelegenheit zu behelligen. Die Besorgnis des Rates war groß und berechtigt.
„Dakktien wird seit Jahrhunderten von einem Padeshah Dilashakan regiert … und gut regiert“, sagte sie vorsichtig. „Das Blut der Dilashakan steht für Stärke, Güte, für ein angeborenes Höchstmaß an moralischem Bewusstsein, und es ist gegen Vampirismus immun, was es einzigartig macht. Euer Volk würde keinen anderen Herrscher akzeptieren. Dass Euer Vater nur einen einzigen Nachkommen hinterließ, hat Eure Linie bereits geschwächt. Ihr jedoch habt noch nicht einmal geheiratet, obwohl Ihr schon über vierzig seid. Der Diwan denkt nur an das Wohl Dakktiens. Ich rate Euch, das gleiche zu tun.“
Nachdem sie verstummt war, hörte sie Malik seufzen.
„Ich höre die Botschafterin sprechen, doch heute Nacht brauche ich einen Freund.“
„Ich bin Eure Freundin, Ihr wisst das. Eure Heirat ist nun einmal nicht nur persönlicher Natur, sie ist auch ein Politikum. Ich weiß, dass nicht nur der Diwan sich sorgt, auch Euer Volk fragt sich, warum Ihr noch keine Familie gegründet habt. So lange schon wartet es auf die neue Padesharín. Gibt es denn wirklich keine Frau in ganz Dakktien, die Euer Herz …“
Unvermittelt brach sie ab. Malik war zu ihr herumgefahren, der Ausdruck auf seinem Gesicht nahm ihr den Atem. Ein Satzfetzen holte ihre Gedanken ein: 'In gewisser Weise betrifft es auch Euch'. Der Rest ihres Satzes verhallte ungesagt. Oh nein!
Dass Malik Dilashakan sie liebte, war für sie schon lange kein Geheimnis mehr, auch wenn er es nie ausgesprochen hatte. Und er selbst wusste nur zu gut, dass sie seine Gefühle erwiderte. Schon um ihn hin und wieder aufzumuntern, hatte sie es nicht vor ihm verborgen. Doch selbst wenn sie sich kleine Gesten der Zuneigung erlaubten, sanfte, doppelsinnige Worte wechselten und versteckte Berührungen zuließen, die auch ganz zufällig passiert sein konnten, wussten sie doch beide, dass niemals mehr daraus werden würde, und dass schon der Gedanke an ein „mehr“ gefährlich war.
Hatte sie einen Fehler gemacht? Hatte sie ihn überschätzt? Sie wusste sehr wohl, dass die Menschen ihre Gefühle nur schwer im Zaum halten konnten, nicht so wie die Khyiil. Hatte sie nicht schon mehr als einmal erlebt, dass Menschen jede Disziplin und Vernunft vergaßen, wenn Zorn, Trauer oder Liebe sie überwältigten? War selbst der Padeshah nicht davor gefeit?
„Wenn ich heirate“, Malik schaute sie ernst an, „würde ich den gleichen Fehler begehen, den schon meine Mutter begangen hat.“
„Eure … Mutter?“ Beunruhigt schaute Seynin auf, direkt in die Augen des geliebten Mannes, die sich vor Trauer verdunkelt hatten. Sie spürte einen Schauer über ihren Rücken gleiten. In dieser Nacht schien es kein Tabu zu geben, zumindest nicht für ihn. Von jetzt an würde sie sich jedes Wort, das sie von sich gab, sehr genau überlegen müssen.
Nie zuvor hatte Malik seine Mutter auch nur erwähnt. Die letzte Padesharín war eine Geächtete, als Ehebrecherin verbannt, ihr Name wie auch der Name ihres Geliebten aus den Annalen gelöscht. Ihr Verrat hatte Trauer und Aufruhr über das ganze Land gebracht. Das Volk hatte aufgeschrien und sich erst beruhigt, als der Diwan selbst die Erwähnung ihres Namens für immer verbot. Maliks Vater hatte seinen Gram nie verwinden können, er hatte kein zweites Mal geheiratet und das Amt seinem Sohn übertragen, sobald dieser den Kinderschuhen entwachsen war. Sein früher Tod hatte alle Verantwortung für den Erhalt der Dynastie auf Maliks Schultern gelegt. Es hieß, er habe noch einen Onkel, der jedoch als verschollen galt. Die Ehe seiner Tante Gila war kinderlos geblieben. Nein, ein Wunder war es nicht, dass der Diwan sich sorgte, so sehr, dass er es offen zur Sprache brachte.
„Wenn ich heirate“, begann der Padeshah von neuem, „würde ich meine Frau schon vor dem Altar betrügen, weil meine ganze Liebe … einer anderen gehört.“
Seynin hielt den Atem an. Malik kam der Grenze, die sie in einer stillen Übereinkunft gezogen hatten, bedrohlich nahe. Warum tat er das? Es würde nichts ändern.
„Ihr solltet nicht weitersprechen“, flüsterte sie und legte bittend eine Hand auf seine Brust, als hätte sie Angst, jemand könnte sie hören.
„Ich weiß“, gab er ebenso leise zurück und griff nach ihrer Hand. „Doch das ist die Antwort auf Eure Frage. Ich kann nicht schlafen, weil die Gewissheit, Euch niemals lieben zu dürfen, mich fast wahnsinnig werden lässt.“
„Bitte, Malik… hört auf, ich kann …“
„Es fühlt sich an“, fiel er ihr ins Wort, „als würde das Schicksal mir boshaft ins Gesicht lachen und mich verhöhnen. Ich darf Euch nicht lieben, weil ein Gesetz, das ich selbst erlassen habe, es mir verbietet.“
„Wenn dem so wäre, dann wären wir beide schuldig, doch das sind wir nicht. Das Gesetz verbietet uns lediglich, unseren Gefühlen nachzugeben.“
Seine warme Hand streichelte die ihre und führte sie an seine Lippen, die ihre kalten Fingerglieder mit einem sanften Kuss bedeckten.
„Meine Mutter verließ mich, als ich noch zu jung war, um ihr Bild in meinen Erinnerungen zu behalten, doch ich erinnere mich an sehr viel Wärme und Zuneigung, die in jeder ihrer Berührungen steckten. Vermutlich bin ich in ganz Dakktien der einzige Mensch, der verstehen kann, warum sie sich gegen alles und jeden stellte, sich über die Moral hinwegsetzte und selbst die Schande in Kauf nahm … weil sie so sehr liebte.“
Seine Hand wanderte zu ihrem Gesicht, sein Daumen strich über ihre erhitzte Wange, seine Finger gruben sich in ihr langes Haar. Einen Moment lang schloss Seynin die Augen und versuchte, die Berührung in ihrem Gedächtnis festzuhalten. Ihr war bewusst, dass Malik sich diesmal nicht zurückhalten würde. Er hatte die Grenze aufgebrochen, das Unaussprechliche gesagt.
Als sein Kopf sich neigte und seine Lippen den ihren näherkamen, wich sie vor ihm zurück und straffte ihre Gestalt.
„Padeshah“, sagte sie betont.
„Botschafterin.“ Er seufzte unterdrückt.
„Erklärt mir noch einmal …“ Sie sprach sanft aber formell. „… warum habt Ihr ein Genesegesetz erlassen und es noch dazu unter schwere Strafen gestellt?“
Seine Augen wurden zunächst schmal, als wäre er brüskiert, doch dann nahm sein Gesicht einen niedergeschlagenen Ausdruck an.
„Weil ich fünfzehn Jahre alt war und auf den Rat des Diwan hörte,“ sagte er bitter. „Aber das sollt Ihr nicht als Ausflucht verstehen. Der Diwan hatte Recht. Zu jener Zeit war es unabdinglich geworden, weil die Zahl der Sal'hadar so bedenklich anstieg, dass sich die Gefahr eines Bürgerkriegs abzuzeichnen begann. Ich kann niemanden dazu zwingen, etwas anderes in ihnen zu sehen, als den Verrat am eigenen Volk und eine Verunreinigung des Blutes, wie es so unschön heißt.“
Ernst blickte die Khyiil ihn an. „Nein, das könnt Ihr nicht. Kein Mann darf die Frau eines anderen Volkes nehmen, das war schon immer so. Wer sich darüber hinwegsetzt bringt Schande über die Seinen und wird für alle Zeit verstoßen. Das ist keine Tradition, auch keine Regel, die einstmals erdacht und festgelegt wurde. Es ist ein natürliches Empfinden, das von allen Völkern gleichermaßen wahrgenommen wird, von den Faun ganz im Norden bis in den südlichsten Zipfel von Thayon.“
„Nicht alle empfinden so“, widersprach der Padeshah leise.
„Das ist wahr, aber genau das wurde zu einem Problem. Ihr habt das einzig Richtige getan und Beziehungen zwischen den Rassen verboten. Es gibt schon zu viele Sal'hadar.“
„Aber für mich hört es sich nicht richtig an.“ Er seufzte und fuhr mit der Hand über seine gefurchte Stirn. „Die Mütter und Väter der Sal'hadar haben nichts anderes getan, als einander zu lieben, und ich mache es zu einem Verbrechen.“
„Sie haben sich über alle Konsequenzen hinweggesetzt, Zwietracht zwischen Familien und Völkern gesät, Unmut und Misstrauen geschürt, sogar Angst. Sie haben ihr eigenes Glück über das Wohl aller gestellt, genauso wie auch Eure Mutter es tat, als sie ihr Volk im Stich ließ, nur um mit einem anderen Mann zusammen zu sein. Ein solches Verhalten ist … inakzeptabel.“
Das Gesicht des Padeshahs wurde blass, kaum dass sie das letzte Wort ausgesprochen hatte.
„Bei den Göttern, Seynin, noch nie habe ich die Khyiil in Euch so deutlich sprechen gehört wie gerade eben. Ich würde Euch für herzlos halten, würde ich Euch nicht so gut kennen.“
„Wenn Ihr Mitleid und Verständnis aus meinem Mund hören wollt, dann nicht für die Eltern. Sie hatten die Wahl, ihre Kinder nicht. Die Sal'hadar wurden bereits in Schande geboren, sie waren in dem Moment Ausgestoßene, als sie das Licht der Welt erblickten.“
„Da habt Ihr durchaus recht“, sagte Malik bedrückt. „Doch auf was können sie hoffen, wenn sie mit ihren Taten all die Ängste noch schüren? Sie geben mir kaum eine Chance, ihnen einen Platz in unserer Gesellschaft zu ermöglichen. Oh doch, auch sie hatten die Wahl, denkt an Murella Duun.“
„Murella ist zur Hälfte Khyiil, die einzige, von der ich weiß. Sie folgt einfach nur der Vernunft.“
„Ja.“ Er nickte. „Doch wäre sie dem Thayonenblut ihres Vaters gefolgt und nicht dem Elfenblut ihrer Mutter, dann wäre sie heute eine gefährliche Gegnerin.“
„Sie vereint in sich elfische Magie und thayonisches Verständnis für Alchemie und Heilkunst, das ist etwas Gutes, Malik. Trotzdem macht sie den Menschen Angst. Man nennt sie eine Hexe, begegnet ihr mit Misstrauen und weist sie ab, in Dakktien genauso wie in Khyiileen und Thayon. Auch Murella kämpft um nichts anderes als ein wenig Akzeptanz. Unsere Welt ist nur noch nicht bereit dafür. Und solange wir nicht damit umgehen können, ist das Genesegesetz überlebenswichtig … für alle Völker.“
Malik schloss die Augen, fasste ihre Schultern mit beiden Händen und legte seine Stirn an die ihre. Seine Stimme wurde zu einem Flüstern.
„Sagt mir, was würde geschehen, wenn der Herrscher des mächtigen Dakktien eben dieses Gesetz bricht und ein Beispiel gibt, dass es auch anders sein kann? Ein sichtbares Bündnis der Dynastie Dilashakan mit dem Königreich Khyiil … wer würde es wagen, das Kind einer solchen Verbindung Bastard oder Sal'hadar zu schimpfen?“
Seynins Atem stockte. So weit hatte er bereits gedacht? Welche Hoffnungen hatte sie in ihm geschürt?
„Unsere Welt ist noch nicht bereit dafür“, wiederholte sie und hob ihren Kopf, um in seine Augen zu sehen. „Ich … bin nicht bereit dafür. Ich bin Khyiil, vergesst das nicht. Meine Gefühle für Euch sind stark, ich will es nicht leugnen, doch nachgeben kann ich ihnen nicht, niemals.“
„Niemals?“
„Ihr könnt nicht länger warten und darauf hoffen, dass ich vielleicht eines Tages meine Meinung ändere.“ Sie löste sich von ihm. „Ich werde es auch nie tun.“
„Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als Eurem Rat zu folgen.“
Der Schmerz in seiner Stimme tat ihr weh, aber bevor sie etwas erwidern konnte, wandte er den Kopf, und auch Seynin hörte in der Ferne den Hufschlag eines zu höchster Eile angetriebenen Pferdes.
***
Ein feiner Schimmer am Horizont verkündete den erwachenden Morgen, doch in der Garnison Alhameída herrschte bereits das rege Treiben des Tages. Die Kunde von der Ermordung Fürstin Cardifas hatte sich in Windeseile verbreitet und für helle Aufregung gesorgt. Nur in der Basilika, dem von hohen Säulen getragenen Wappensaal der Garnison, fand sich eine kleine Enklave, die sich dem Aufruhr verschloss. Nahe dem großen Kamin herrschte Stille.
„Es kann sich hier doch nur um ein Missverständnis handeln“, brach Seynin das lange Schweigen. „Cardifa war beliebt, großherzig und sanft in ihrem Wesen. Sie tat viel Gutes. Jeder weiß, dass sie noch nie einen Bittsteller abgewiesen hat. Selbst für die Sal'hadar hat sie sich verwendet. Wie oft hat sie sich vor dem Diwan für die Abschaffung des Genesegesetzes ausgesprochen?“
„Mindestens so oft wie ich“, gab Malik leise zurück.
„Es genügte vollkommen, dass sie ein Mitglied des Rates war“, sagte Amon ben Fahím mit düsterem Blick. „Die Thayonen haben durchaus ein Interesse daran, Dakktien zu schaden, indem sie Ratsmitglieder ermorden lassen. Es hätte jeden von ihnen treffen können, aber Cardifa war vermutlich das leichteste Ziel, weil sie den Palast oft verließ, um ihre Schützlinge zu besuchen. Die Tat allein soll ein Zeichen setzen. An die Folgen mag ich noch gar nicht denken.“
Malik blickte von dem Krug auf, den er seit einer halben Stunde in den Händen hielt, ohne daraus zu trinken.
„Die Thayonen? Aber der Mord ist unzweifelhaft auf die Sal'hadar zurückzuführen. Glaubt Ihr, die Duunkar hat sie für ihre Zwecke gekauft?“
„Ich glaube es nicht nur, ich weiß es!“ Der Schwertmeister der Schilde hieb auf die Lehne des schweren Sessels, in dem er saß. Seine Stimme schnarrte vor Verdruss. „Was muss denn noch geschehen, bis Ihr mir endlich glaubt? Die Sal'hadar töten nicht aus Angst vor Entdeckung oder weil sie sich bedroht fühlen, sondern weil man sie in barer Münze dafür bezahlt! Das sind keine verlorenen Kinder, sondern Assassinen, keine armen Seelen, sondern skrupellose Mörder, die jeden Auftrag annehmen, wenn der Goldbetrag nur hoch genug ist.“
Das betretene Schweigen, das ihm antwortete, war vorhersehbar gewesen. Jeder, der Amon kannte, schätzte ihn für seine Besonnenheit und die geradezu stoische Ruhe, die ihm zu eigen war, die er selbst in gefahrvollen Situationen oder bei ausgelassenen Festlichkeiten nicht verlor. Es war ein seltener und bestürzender Anblick, wenn dieser Mantel des Gleichmuts von ihm abfiel und Zorn sein abgeklärtes Gesicht verzerrte. Ein unheilvolles Flackern trat dann in seine Augen, während die grauen Spitzen seines am Ansatz noch dunklen Kinnbartes zitterten. Und die einzigen, die diesen Eklat zustande brachten, waren die Sal'hadar.
„Nun, Gold haben die Thayonen reichlich“, sinnierte Malik mit ruhiger Stimme. „Ihre Wadis sind voll davon. Damit könnten die Sal'hadar zu einer Bedrohung werden, die alles in den Schatten stellt. Sie sind Dakktiens einzige Schwachstelle, und die Duunkar hat sie ausfindig gemacht.“
„Das ist richtig, ganz im Gegensatz zu uns.“ Amon fluchte unterdrückt. „Mit thayonischem Gold kann aus einer Mörderbande sehr schnell ein Heer von Söldnern werden, und wir hätten den Krieg hier im eigenen Land, einen Krieg ohne Schlachten, einen Krieg, den man weder hört noch sieht.“
Der Padeshah nickte. „Ich werde veranlassen, dass die Wachen im Palast verdoppelt werden, und auch …“
„Verzeiht, aber das wird nicht genügen“, mischte sich Seynin in das Gespräch. „Wenn es so ist, dass der Vampirrat von Thayon die Fürstin durch die Sal'hadar ermorden ließ, dann muss den Dunshaan klar gewesen sein, dass wir schnell die richtigen Schlüsse ziehen. Deshalb glaube ich, dass dieses Bündnis schon länger existiert, als uns lieb sein dürfte. Es ist schlimmer, als Amon je behauptet hat. Sie fühlen sich bereits stark genug, eine offene Konfrontation zu wagen, und sie werden gegen alles gewappnet sein.“ Sie unterbrach sich, weil die beiden Männer sie bestürzt musterten. „Ich sage nur, was ich denke.“
Malik holte tief Luft. „Ohne Beweise können wir die Duunkar nicht einmal des Bruchs unseres Friedensvertrages bezichtigen. Sie werden alles auf die Ausgestoßenen schieben und jede Mitwisserschaft leugnen.“
„Allein den Sal'hadar dieses Verbrechen nachzuweisen, wird schwierig genug“, knurrte Amon. „Ich jage sie seit zwanzig Jahren, doch sie sind wie Geister. Und selbst wenn mir einer ihrer Assassinen in die Falle ging, dann hatte ich nichts. Sie richten sich selbst, noch bevor sie die Eisen tragen.“
„Dann ist Jagd der falsche Weg“, meldete Seynin sich erneut zu Wort. „Einem Tier, das zu flüchten versteht, muss man sich lautlos nähern, seine Schwächen ergründen, von ihm lernen, bevor man es erlegt. Auch die Mörder der Fürstin sind nur aus Fleisch und Blut.“
„Den Sal'hadar kann man sich nicht nähern, weder lautlos noch mit List“, wehrte Amon ab. „Sie sind unauffindbar.“
„Unauffindbar für einen Menschen und einen Schwertmeister der Schilde, ich aber bin Khyiil, vielleicht eine … Khyiil im Exil, da wird mir schon etwas einfallen, aber auf jeden Fall eine verdammt gute Assassine mit einer ausgeprägten Affinität zu thayonischem Gold.“ Angriffslustig schaute sie in die Runde und zwinkerte Amon dabei zu.
„Einen Moment.“ Malik richtete sich beunruhigt auf und schaute sie an. „Wollt Ihr schon wieder Euer Leben für Dakktien riskieren? Das werde ich nicht zulassen, nicht nach allem, was während des Krieges geschehen ist. Es muss eine andere Lösung geben.“
Seynin wandte sich ihm zu.
„Ihr werdet die Sal'hadar nicht aufspüren, indem ihr das Land durchkämmt und Zeugen befragt. Sie üben sich schon zu lange in der Kunst, sich versteckt zu halten. Doch ich bin sicher, dass sie jeden willkommen heißen, der sich ihnen anschließen will. Die Duunkar wird sie mit Aufträgen überschütten. Einem Menschen würden sie jedoch nicht trauen, nur ihresgleichen. Als Khyiil habe ich vielleicht eine Chance, mit einer glaubhaften Geschichte und einem scharfen Schwert.“
„Das ist wahr“, warf Amon ein. „Die Schilde haben vor nicht allzu langer Zeit einen Bolonen dingfest gemacht, der eines ihrer Stigmata trug. Wir konnten ihn nicht abhalten, sich selbst zu töten, aber er war reinblütig, ein Deserteur, auf dessen Festnahme in Bolon eine Belohnung ausgesetzt war.“
„Was meine Chancen noch erhöht“, sagte Seynin schnell. „Die Sal'hadar rekrutieren Assassinen und beschränken sich dabei nicht länger auf die Ausgestoßenen.“
„Trotzdem muss ich Malik recht geben“, lenkte der Schwertmeister ein. „Du kannst dich nicht allein auf die Suche begeben. Die Sal'hadar sind mehr als gefährlich, sie sind kalt in ihren Herzen, verroht und böse, voller Hass. Ich hätte zu viel Angst um dich, meine Tochter.“
Wie immer rührte es an ihr Herz, wenn er sie Tochter nannte. Während des Krieges hatte er es das erste Mal getan, als sie nach ihrem langen Verschwinden wieder aufgetaucht war. In Seynins Ohren hatte es wundervoll geklungen, und nur zu gern nahm sie diesen Platz in seinem Leben ein. Fragende Blicke hatten sie lächelnd ignoriert und anderen die Erklärung überlassen, warum der Schwertmeister der Schilde sich voller Stolz einer fremdblütigen Tochter rühmte, ohne mit dem Gesetz in Konflikt geraten zu sein. Sie lächelte warm und legte ihre Hand auf seine geballten Fäuste.
„Vater“, sagte sie sanft, „es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich finde die Sal'hadar und werde von ihnen als Assassine akzeptiert, oder ich finde sie nicht. Vertrau mir! In beiden Fällen kehre ich schon bald zurück, mit den Informationen, die wir brauchen, oder ohne sie.“
„Und wenn sie herausfinden, wer du bist? Ganz Dakktien kennt deinen Namen.“
„Selbstverständlich werde ich einen anderen Namen benutzen. Mein Gesicht kennen nur wenige, noch dazu hat es sich nach … nach meiner Heilung verändert, meine Haarfarbe ebenso. Niemand wird mich erkennen.“
„Die Sal'hadar werden sich nicht so leicht infiltrieren lassen wie ein unbedeutender Vampirclan am Rand der thayonischen Wüste. So genial dieser Schachzug im letzten Krieg auch war, diesmal könnte der geringste Verdacht deinen Tod zur Folge haben.“
„Ich weiß mich zu wehren.“
„Gegen erfahrene Assassinen, von denen wir noch nicht einmal wissen, wie viele es gibt?“ Amon schüttelte den Kopf.
„Nun, auch das werde ich in Erfahrung bringen“, gab Seynin zurück, „wenn du mich lässt.“
Daraufhin seufzte der Schwertmeister und ließ die Hände auf seine Schenkel fallen.
„Ihr seid bereits fest entschlossen, nicht wahr?“, sagte der Padeshah in die entstandene Stille.
Seynin setzte sich auf und verlieh ihrer Stimme alle Überzeugungskraft, die sie aufbringen konnte.
„Immer vorausgesetzt, wir liegen mit unseren Vermutungen richtig, dann haben wir schon viel zu viel Zeit verloren. Die Duunkar hat einen Fuß auf dakktischen Boden gesetzt, ohne dass wir es bemerkten. Wir müssen handeln und das rasch. Tut, was Euch richtig erscheint. Untersucht den Mord an der Fürstin. Lasst Eure Männer die Spuren verfolgen, die sie finden. Doch gebt mir auch die Gelegenheit, das Problem auf meine Art zu lösen. Ich werde mich den Sal'hadar anschließen und die Schilde mit allen nötigen Informationen versorgen, damit sie ihnen das Handwerk legen können. Mit dieser Vorgehensweise haben wir schon einmal einen Krieg gewonnen. Es ist eine Chance, weiteres Unheil abzuwenden.“
Der Padeshah erwiderte ihren eindringlichen Blick, sagte aber nichts, bis Amon sich räusperte.
„Wir müssen wissen, wo sie sich verstecken, wer sie anführt und auf welche Art und Weise die Duunkar die Assassinen hier in Dakktien kontaktiert. Vor allem aber müsstest du in Erfahrung bringen, wie viele es sind, und wir brauchen Namen. Wenn wir die Sal'hadar ausschalten wollen, darf uns kein einziger entwischen, andernfalls besteht die Gefahr, dass sie sich mit thayonischem Gold schnell erneuern.“
Seynin nickte und schaute wieder zu Malik, der noch immer schwieg.
„Ich stelle dir alles zur Verfügung, was ich im Laufe der Jahre über die Sal'hadar gesammelt habe“, fuhr der Schwertmeister fort. „Es ist nicht viel, aber ich denke, dass meine Aufzeichnungen dir von Nutzen sein werden.“
„Danke, Vater.“
„So ist es also beschlossene Sache“, sagte Malik Dilashakan endlich. „Meine Meinung fällt wohl gar nicht mehr ins Gewicht. Aber gut, ich gebe meine Zustimmung. Amon, ich übertrage Euch die Verantwortung für diese Mission, auch wenn die Sal'hadar eigentlich keine Angelegenheit der Schilde sind, worauf ich Euch im Übrigen schon mehrmals hingewiesen habe. Dennoch habt Ihr die meisten Erfahrungen mit ihnen … dann nutzt sie jetzt. Ich erwarte einen regelmäßigen Bericht.“
„Selbstverständlich, Padeshah.“
Malik seufzte und faltete die Hände vor seinem Gesicht zusammen. „Trotz allem hatte ich immer gehofft, dass es eines Tages eine friedliche Lösung geben würde. Die Sal'hadar wurden in eine Welt hineingeboren, die sie von Anfang an nicht wollte. Wen wundert es, dass sie sich auflehnen mit Gewalt und mit Hass, sie sind ohne Wurzeln, heimatlos. Wir alle haben die Sal'hadar verstoßen, ich selbst habe keinen geringen Anteil daran. Aber wenn die Duunkar die Hand im Spiel hat, bleibt uns keine andere Wahl, als mit allen Mitteln gegen sie vorzugehen.“
„Sie sind die Geißel unserer Welt“, brummte Amon, „und wenn Seynin sie aufspüren kann, dann werden wir sie auch vernichten, jeden Einzelnen.“
Auf diese Erklärung antwortete der Padeshah ungewohnt scharf. „Meine Zustimmung galt Seynins Mission die Sal'hadar zu finden, nicht aber einem Blutbad, das sich vielleicht vermeiden lässt. Wir sind noch lange nicht soweit, unser weiteres Vorgehen erwägen zu können. Erst recht müssen wir sehr genau überlegen, ob überhaupt wir die Schilde innerhalb unserer Grenzen zum Einsatz bringen. Wenn Soldaten nötig werden, um den Frieden im eigenen Land zu erhalten, ist das immer eine heikle Angelegenheit. Und jetzt“, er nickte Amon kurz zu, „lasst uns bitte allein. Ich habe noch etwas Persönliches mit der Botschafterin zu besprechen.“
Nachdem der Schwertmeister die Halle verlassen hatte, wandte sich Malik der Khyiil zu und lächelte verhalten.
„Wir werden uns einige Zeit nicht sehen, Wochen, vielleicht Monate.“
„Das war keiner meiner Beweggründe, wenn Ihr das glaubt“, gab sie zurück.
„Nein. Aber vielleicht ist es gut so, auch wenn Euer Rat mir fehlen wird. Ihr werdet mir fehlen.“
„Ihr habt Angelegenheiten zu regeln, bei denen ich Euch kaum von Nutzen bin. Ich wäre eine schlechte Beraterin, wenn Ihr Euch auf Brautschau begebt.“ Sie senkte den Kopf. „Und es wäre mir unerträglich, dabei Zeugin zu sein.“
Er beugte sich ein Stück vor, nahm ihre Hand und hielt sie fest. „Ich weiß, wie sehnsüchtig mein Volk auf die Mutter des zukünftigen Padeshahs wartet, und ich weiß, dass die Menschen Euch lieben, so wie ich Euch liebe. Niemand hätte einen Einwand erhoben oder auch nur ein Wort des Unmuts über die Lippen gebracht. Ich bot Euch den goldenen Reif der Padesharín, die allerhöchste Würde Dakktiens, die sogar die meine übersteigt. Doch Ihr zieht es vor, Euch stattdessen in große Gefahr zu begeben, in die Gesellschaft von Ausgestoßenen und Mördern und selbst Euren Namen zu verleugnen.“
„Das ist weder mein Wunsch noch meine Entscheidung“, gab sie zurück. „Das sind die Pfade der Bestimmung, an die mein Volk glaubt. Es wäre frevelhaft, dem Weg nicht zu folgen, der so offen vor mir liegt, ganz gleich wohin er mich führt. Wenn das Schicksal mich vor eine Aufgabe stellt, dann nehme ich sie an.“
„Ihr seid eine wahre Khyiil.“ Er neigte seinen Kopf. „Mögen die Götter über Euch wachen.“
„Und über Euch.“
Kapitel 2 – Sal'hadar
Rag Maal-Duun war ein aufmerksamer Zuhörer, Seynin wusste das, auch wenn er ganz auf den Lederbeutel konzentriert schien, der von seiner Hand herabbaumelte und Achterkreise beschrieb wie ein außer Kontrolle geratenes Pendel. Als sie ihren Bericht beendet hatte, ließ er ihn auf den Tisch fallen und schob ihn der Khyiil mit einem wohlwollenden Nicken zu.
„Gute Arbeit, Assassine, Ihr habt Euch das Kopfgeld wahrhaft verdient. Die Zeiten, in denen die hohen Herrschaften des Diwan sich innerhalb ihrer Palastmauern sicher fühlten, sind nun endgültig vorbei. Ich bin sehr stolz auf Euch.“
Seynin deutete eine leichte Verbeugung an. „Habt Dank.“
„Seid Ihr an einem neuen Auftrag interessiert?“
„Natürlich.“
„Wie immer.“
Der Vampir lächelte und wies einladend auf einen der Stühle, die den Tisch umstanden. Als sie sich gegenübersaßen, sagte er jedoch kein Wort. Er lehnte sich zurück und musterte Seynin mit durchdringendem Blick. Sie zwang sich, diesem Blick gelassen zu begegnen.
Dank seiner einhundertachtundzwanzig Lebensjahre war ihr Mentor ein exzellenter Empath. Sein Geist durchdrang jede äußere Fassade und las in dem Verborgenen, das in den Tiefen jeder Seele schlummerte. Kombiniert mit seinem messerscharfen Verstand und einem gut ausgeprägten Instinkt ergab dies eine äußerst gefährliche Mixtur.
Bis zu diesem Tag hatten ihre und Amons Pläne bestens funktioniert. In Sinna, der südöstlichsten der dakktischen Städte, nahe der thayonischen Grenze, hatte Seynin ihre Suche begonnen. Die einstmals reiche Provinz, die vom Handel mit den thayonischen Wüstennomaden lebte, gehörte heute zu den ärmsten Regionen des Landes. Der karge Boden, der dem Vormarsch der Wüste zu trotzen versuchte, warf kaum eine nennenswerte Ernte ab, das Vieh kaute auf nährstoffarmen Halmen und siechte dahin, während der Schmuggel florierte, der für so manchen Bewohner des vereinsamten Landstrichs die einzige Einnahmequelle war. Die Sicherung der Grenze oblag einer kleinen mit Söldnern bemannten Bastion, die jedoch einzig dem Zweck diente, Sinna nicht gänzlich von der militärischen Präsenz Dakktiens zu entblößen. Das jenseitige Gebiet war Nomadenland, welches – wenngleich es zu Thayon gehörte - aufgrund der schwelenden Konflikte zu einer territorialen Pufferzone geworden war, die Menschen wie Thayonen mieden.
Die Stadt selbst zeugte noch immer von der Pracht vergangener Tage, die der herrschende Khan mit aller Macht zu erhalten versuchte, doch nichts konnte darüber hinwegtäuschen, dass die Bevölkerung schwand und dass die wenigen Stände auf dem zentralen Marktplatz, auf dem einstmals emsiges Treiben geherrscht hatte, sich fast verloren. Langsam aber stetig verblühte Sinna am hoffnungslosesten Ende der Welt, doch für jene, die andernorts nicht willkommen waren, blieb die Stadt attraktiv. Hier wurde das Gesetz von jeher großzügiger interpretiert, als im Rest des Padeshahrenreiches, und die Vermutung, dass die Sal'hadar vom dünn besiedelten Grenzgebiet aus operierten, lag nah.
In der Tat dauerte es keine zwei Tage, bis Seynin angesprochen wurde, obwohl sie bis dahin mit keinem der hiesigen Menschen auch nur ein Wort gewechselt hatte. Es war auch gar nicht nötig gewesen, eine Geschichte in Umlauf zu bringen, allein ihr Aufzug erklärte sowohl ihre Anwesenheit als auch ihre fragwürdige Gesinnung. Das abenteuerlich anmutende Sammelsurium an Waffen und Rüstungsteilen, die sie trug, ließ keinen Zweifel offen, dass sie zu jenen verachtenswerten Plünderern gehörte, die aus allen Teilen der Welt gekommen waren, um sich auf den Schlachtfeldern des Krieges zu bereichern. Ihre sonstige Ausrüstung verwahrte sie in einem Tornister auf ihrem Rücken, und an ihrem Gürtel hing die goldbeschlagene Scheide ihres Elfenschwerts, von dem sie sich um nichts in der Welt getrennt hätte.
So war sie durch die Schenken von Sinna gezogen und hatte immer wieder verlauten lassen, dass sie bereit wäre, jemanden umzubringen, wenn ein anständiges Rak dabei heraussprang. Es wunderte sie nicht, dass sie schon bald allein an einem der Tische saß und mit misstrauischen Blicken beäugt wurde, bis sie Gesellschaft erhielt.
„Ein anständiges Rak, kleine Khyiil. Übernehmt Euch nicht.“
Der Faun, der sich an diesem Abend unaufgefordert an ihren Tisch setzte und ihr einen tönernen Krug zuschob, machte genau den Eindruck, den Seynin erwartet hatte. Seine von Natur aus kräftige Statur steckte in einer dunklen Lederrüstung, die das Schwert an seinem Gürtel wie eine Warnung blitzen ließ. Auf seinem Kopf trug er einen gehörnten Helm mit Kettenvisier, welches sein Gesicht bis zum Mund verdeckte. Sein Kinn war breit und grau, was für einen Faun ganz typisch war, der leichte Bartwuchs darauf war es allerdings nicht.
„Für mich? Sehr anständig von Euch“, knurrte Seynin ihn an und griff nach dem Krug, als wäre er mit thayonischen Golddukaten gefüllt.
„Ihr seid anspruchslos, was Eure Bezahlung angeht“, fuhr der Faun fort, während sie trank. „Oder dachtet Ihr, ich würde Euch dieses Rak spendieren?“
„Warum nicht?“, fragte Seynin zurück und hickste. „Ihr könnt es Euch doch leisten.“
„Ihr ebenso, Ihr müsst nur Euren Teil der Abmachung noch erfüllen.“
An diesem Abend erhielt sie ihren ersten Auftrag. Es war kein Mordauftrag, nur die Überstellung einer versiegelten Botschaft, deren Inhalt sie nie erfuhr. Die Sal'hadar erwähnte der Faun mit keinem Wort, doch Seynin war sich gewiss, dass sie sie gefunden hatte.
Sie traf sich weiter mit ihm, erzählte ihm nach und nach die Geschichte, die sie sich mit Amons Hilfe zurechtgelegt hatte, und würzte das Ganze mit bissigen Bemerkungen über das Elfenreich, aus dem sie angeblich verbannt worden war, und auch auf die Menschen, die sie im besten Fall duldeten. Trotzdem vergingen mehr als zwei Wochen, bis ihr Kontaktmann ein Treffen mit Rag Maal-Duun arrangierte, der sie offiziell in den Rang einer Assassine erhob und ihr Zugang zum Ashram gewährte. Ihre anfängliche Euphorie über den Erfolg wurde jedoch schnell getrübt.
Der Ashram von Sinna war riesig und - wie sie später erfuhr - nur einer von vielen. Auch lag er nicht an einem entlegenen und nur schwer zugänglichen Ort, sondern direkt vor den Toren der Stadt, ein Teil sogar unter ihr.
„Das Silber von Sinna war schon ausgebeutet, bevor es die Stadt überhaupt gab“, hatte der Faun ihr erzählt, als er sie zum ersten Mal durch die Stollen der alten Mine führte. „Es wurde von den Barbaren geschürft, die einst hier lebten. Sie schmiedeten es zu Schwertern und Äxten, weil sie glaubten, dass ihm eine göttliche Macht innewohnt. Heute weiß niemand mehr davon, aber für uns ist dieser Ort ein Zuhause geworden. Wir leben hier nicht, weil wir die Ausgestoßenen sind, sondern weil es uns so gefällt.“
Den Stolz in seiner Stimme konnte Seynin leicht nachvollziehen. In der Tat hatten die Sal'hadar aus der Mine eine Wohnstatt gemacht, die das Fehlen von Tageslicht schnell vergessen ließ. Aufwändige Behänge verdeckten die kahlen Wände, und Frischluft drang aus schmalen Schächten durch das weitläufige Labyrinth mannshoher Tunnel, das eine Vielzahl von ehemaligen Lagerstätten und natürlichen Luftkammern miteinander verband. Die alten Stollen wurden von Fackeln erhellt, die in kunstvoll geschmiedeten Fassungen steckten, jeder Raum zeugte von Reichtum … und von thayonischem Prunk. Manche dienten als Unterkunft, andere erfüllten einen gemeinschaftlichen Zweck und einige waren einfach nur imposant, wie das Trainingsgewölbe oder die Kuppelhalle, über die sich in großer Höhe ein von Kristallen gespickter Plafond stülpte wie ein funkelnder Baldachin. Es war ein Ort, von dem man einfach beeindruckt sein musste, und das war Seynin auch.
Sehr schnell musste sie sich eingestehen, dass sie die Sal'hadar völlig falsch eingeschätzt hatte, nicht nur was die Anzahl ihrer Mitglieder oder ihre Geldmittel betraf. Anstelle einer wilden Bande mordlustiger Spießgesellen, die ihre Erfolge raufend und trinkend an den Lagerfeuern ihres geheimen Unterschlupfs feierten – so hatte Seynin es sich immer vorgestellt – fand sie ein meisterhaft organisiertes Netzwerk, das in jeder dakktischen Stadt Gemeinschaften unterhielt, die sie Ashrams nannten. Man verhielt sich diszipliniert, sprach respektvoll miteinander, und es gab eine wohl durchdachte Hierarchie, die jedem einen Platz zuwies und ihm das Gefühl vermittelte, ein wichtiger Teil des Ganzen zu sein. Ausgebildete Assassinen gab es kaum mehr als ein Dutzend. Die meisten Sal'hadar waren Handwerker, Heiler, Köche, Boten oder Diebe, und es gab eine ganze Schar kichernder Dirnen, die mit Tanz, Musik und körperlicher Zuwendung die Stimmung hoben. Nichts konnte deutlicher vor Augen führen, wie sehr sich diese Männer und Frauen nach Zugehörigkeit sehnten. Die Atmosphäre war geradezu familiär, Seynin hörte nicht selten, dass sie einander mit Bruder oder Schwester ansprachen. Die Ausrüstung war erstklassig, Unterkunft und Verpflegung standen frei zur Verfügung, wie auch die Dienste der Schmiede und Heiler. Doch nicht die Gewissheit, dass all dies tatsächlich mit thayonischem Gold bezahlt wurde, machte Seynins anfänglich gute Stimmung zunichte. Die Sal'hadar waren schon längst in thayonischer Hand. Sie fand heraus, dass jeder einzelne Ashram von einem Thayonen geleitet wurde, hier in Sinna war es sogar ein Vampir.
Als sie Amon von all dem Bericht erstattet hatte, reagierte dieser mit Zorn und lief eine ganze Weile in dem kleinen Herbergszimmer, in dem sie sich getroffen hatten, auf und ab. Schließlich setzte er sich und fuhr mit beiden Händen über seinen Kopf.
„Das übersteigt meine schlimmsten Befürchtungen.“
„Und die meinen“, fügte Seynin hinzu. „Die Duunkar hat mit großer Weitsicht gehandelt und die Ausgestoßenen schon vor vielen Jahren für sich eingenommen, während des zweiten Erzkrieges, wenn du mich fragst, vielleicht auch schon früher. Ich würde sogar die Vermutung wagen, dass ihre Feindseligkeit gegenüber Dakktien gezielt gefördert wurde. Die Duunkar hat die Sal'hadar zusammengeführt, um ihnen eine Aufgabe zu übertragen, die den Interessen beider Seiten entspricht. Das Genesegesetz…war sicher ein unschlagbares Argument.“
„Allein die Vorstellung, dass es so gewesen sein könnte … lässt mich schaudern“, stöhnte Amon auf. „Malik wusste es immer schon. Wir haben einen Fehler gemacht. Ein Problem lässt sich nicht ausmerzen, indem man es aus der Gesellschaft verbannt. Aber eine Aufhebung des Gesetzes macht den angerichteten Schaden nicht wieder gut.“
Dem konnte Seynin nicht widersprechen. „Die Sal'hadar fühlen sich schon längst nicht mehr als Ausgestoßene. Sie haben nun ihre eigene Gesellschaft, und sie sind bestens organisiert. Ich habe gehört, dass ein Dunshaan höchstselbst sie anführt, und zwar hier von Dakktien aus.“
Amons Kopf fuhr zwischen seinen Händen hoch.
„Seynin! Ist das wahr?“
„Gesichert ist diese Information nicht. Ich hörte andere Assassinen davon sprechen. Aber ich gehe davon aus, dass es stimmt.“
„Und das erzählst du mir so nebenbei? Verstehst du denn nicht? Ein Dunshaan hier in Dakktien, vom Rest der Duunkar isoliert. Wenn es uns gelänge, ihn aufzuspüren …“
„Ich weiß.“ Sie trat ans Fenster der kleinen Kammer, um hinaus in die nächtliche Stille von Sinna zu blicken. „Wir haben im Krieg gegen thayonische Soldaten und niedere Vampire gekämpft, gegen ein Volk freiwilliger Sklaven und gegen Opfer des Dunklen Blutes, die ihre Existenz nie wollten. Es waren die falschen Gegner.“
„Wir hatten nie eine Chance, die Duunkar direkt anzugreifen, nun bietet sich vielleicht eine Gelegenheit. Wenn wir diesen Dunshaan ausfindig machen, dann wird er reden.“
„Ja, das wird er“, gab Seynin leise zurück, „wenn du ihn hungern lässt.“
„Bei den meisten Vampiren genügt es schon, nur damit zu drohen. Ich weiß, dass dir diese Vorstellung missfällt, aber bedenke, welche Antworten wir erhalten könnten. Wo finden wir den Mondblutpalast? Wie viele Dunshaan gibt es im Vampirrat, und über welche Macht verfügt ihre Seherin, die Duun Akbaal?“
„Bei den Sal'hadar heißt es, sie war einst die Geliebte des Duun und steht direkt mit ihm in Kontakt. Angeblich spricht sie mit ihm und kann so seinen Willen verkünden.“
„Ja, angeblich… aber ist es wahr?“
Amon erhob sich von seinem Stuhl und trat an Seynin heran, um über ihre Schultern zu streichen. Sie wandte sich zu ihm um.
„Vielleicht finde ich etwas heraus.“
„Wenn es jemand schafft, dann du.“ Er schloss sie in seine Arme und drückte sie an sich. „Es ist diese ganz besondere Gabe, die ich seit jeher an dir bewundert habe. Du bist Khyiil, aber du lebst unter uns Menschen wie ein Mensch. Du hast unter Vampiren gelebt wie ein Vampir, und du kannst eine Assassine unter Assassinen sein … ohne jemals zu vergessen, wer du bist.“
Genau das tat sie nun seit etlichen Wochen. Anfangs hatte Rag Maal-Duun sie auf unbedeutende Ziele angesetzt, einen Kaufmann, einen niederen Berater des Khans von Lasadir, einen Vorarbeiter in den dakktischen Erzminen, die allesamt von Amon in Sicherheit gebracht wurden, um anschließend in den Gazetten reißerisch ihren Tod zu verlautbaren. Ein Offizier der Schilde war ihnen gefolgt und hernach sogar ein weiteres Mitglied des Diwan, über dessen angebliches Ableben Seynin soeben Bericht erstattet hatte.
Dankbar hatte der alte Ratsherr ihre Hände geküsst, bevor er sich in sein Asyl nach Khyiileen begab. Wie viele würden ihm noch folgen müssen, bis Rag Maal ihr endlich genug vertraute?